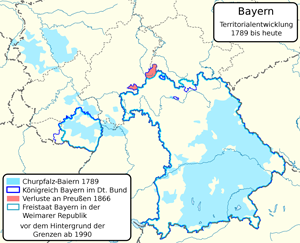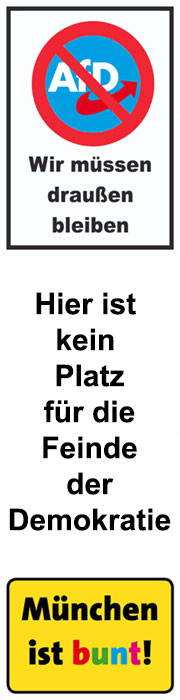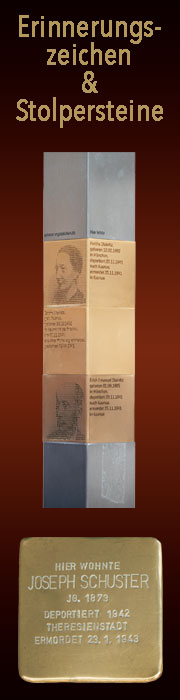Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Geschichte
-
München: Deutsche Verkehrsausstellung
-
Persien: Resa Khan ruft sich zum Schah aus
Reza Khan, der damalige Premierminister von Persien, rief sich selbst zum Schah aus und gründete die Pahlavi-Dynastie, wodurch die Kadscharen-Dynastie endete. Er führte umfangreiche Modernisierungen durch und legte den Grundstein für die weitere Entwicklung des Landes, obwohl seine Herrschaft auch autoritäre Züge aufwies.
-
Gründung der Schutzstaffeln (SS)

1925 wurde die Schutzstaffel (SS) gegründet. Ursprünglich als persönliche Leibgarde Adolf Hitlers gedacht, entwickelte sich die SS unter der Führung von Heinrich Himmler zu einer der mächtigsten und gefürchtetsten Organisationen im nationalsozialistischen Deutschland. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Durchführung der nationalsozialistischen Verbrechen, einschließlich des Holocausts, und war verantwortlich für zahlreiche Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs.
-
Albanien: Ahmed Zogu wird durch Militärputsch Staatspräsident
Ahmed Zogu, ein albanischer Politiker und Offizier, wurde durch einen Militärputsch zum Staatspräsidenten von Albanien. Seine Präsidentschaft markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte Albaniens. Zogu führte später eine Reihe von Reformen durch und krönte sich 1928 zum König Zog I., wodurch er die albanische Monarchie begründete. Seine Herrschaft war geprägt von Versuchen, das Land zu modernisieren und zu stabilisieren, aber auch von autoritären Maßnahmen.
-
München: Die NSDAP wird neu gegründet mit der Reichsleitung in München
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) wurde neu organisiert, wobei ihre Reichsleitung in München angesiedelt wurde. Nach einem vorübergehenden Verbot infolge eines gescheiterten Putschversuchs reorganisierte sich die Partei unter Adolf Hitler. Sie entwickelte sich zu einer zentralen politischen Kraft in Deutschland und ebnete den Weg für Hitlers spätere Machtergreifung und die Etablierung des Dritten Reichs.
-
Tod des Reichspräsidenten Friedrich Eberts

Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, starb am 28. Februar 1925 unerwartet an den Folgen eines Blinddarmdurchbruchs. Die notwendige medizinische Behandlung hatte Ebert verzögert, da er in einen laufenden Prozess verwickelt war, in dem ein Journalist ihn der Kriegsschuld bezichtigt hatte. Sein Tod markierte ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Weimarer Republik.
-
Peking: China: Tod Sun Yat-sens

Sun Yat-sen, oft als "Vater des modernen China" bezeichnet, starb am 12. März 1925 in Peking an Gallenblasenkrebs. Er war ein chinesischer Revolutionär und politischer Führer, der eine einzigartige Position in der chinesischsprachigen Welt einnimmt und als "Vater der Nation" sowohl in der Volksrepublik China als auch in der Republik China (Taiwan) geehrt wird. Sun Yat-sen spielte eine entscheidende Rolle bei der Überwindung der Qing-Dynastie und der Einführung republikanischer Ideen in China.
-
Hindenburg wird Reichspräsident

Paul von Hindenburg, ein ehemaliger General und Monarchist, wurde zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt, nachdem er im zweiten Wahlgang als Kandidat der rechten Parteien angetreten war. Seine Wahl war von Bedeutung, da er für ein nicht-republikanisches und monarchistisches Deutschland stand, was im linken und bürgerlichen Lager sowie im Ausland Besorgnis auslöste.
-
München: Das Deutsche Museum auf der ehemaligen Kohleninsel wird eröffnet
-
Locarno: Konferenz von Locarno (Schweiz)
Die Konferenz von Locarno führte zu mehreren wichtigen internationalen Abkommen zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und Italien. Ziel war es, die Stabilität und Sicherheit in Westeuropa zu gewährleisten. Die Hauptvereinbarungen umfassten die gegenseitige Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und Schiedsabkommen zur friedlichen Konfliktlösung. Diese Abkommen trugen maßgeblich zur Verbesserung der politischen Atmosphäre in Europa bei und ebneten den Weg für Deutschlands Aufnahme in den Völkerbund.
-
XIV. Parteitag der Bolschewiki: Umbenennung zur KPdSU(B) und Ausschluss von Sinowjew und Kamenew
Der XIV. Parteitag der Bolschewiki markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Partei, als sie in die Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) umbenannt wurde. Gleichzeitig wurden die prominenten Parteimitglieder Grigori Sinowjew und Lew Kamenew ausgeschlossen, da sie sich gegen die Machtkonzentration um Josef Stalin stellten. Dieser Ausschluss war Teil der internen Machtkämpfe, die Stalins Position weiter festigten und den Weg für seine spätere totalitäre Herrschaft in der Sowjetunion ebneten.
-
Locarno: Vertrag von Locarno
Der Vertrag von Locarno bestand aus mehreren Abkommen zur Stabilisierung der Nachkriegsordnung in Europa. Deutschland, Frankreich und Belgien garantierten ihre Grenzen, unterstützt von Großbritannien und Italien als Garantiemächte. Deutschland schloss Schiedsverträge mit Belgien, Frankreich, Polen und der Tschechoslowakei ab, verpflichtete sich zur friedlichen Konfliktlösung und akzeptierte die Entmilitarisierung des Rheinlands. Der Vertrag führte zur Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und trug kurzfristig zur Entspannung bei, konnte jedoch langfristige Spannungen nicht verhindern.
Friedrich Ebert (Reichspräsident) (1919-1925)
Dr. Walter Simons (Reichspräsident (kommißarisch) ) (1925-1925)
Paul von Hindenburg (Reichspräsident) (1925-1934)
Wilhelm Marx (Reichskanzler) (1923-1925)
Hans Luther (Reichskanzler) (1925-1926)
Pius XI. (1922-1939)