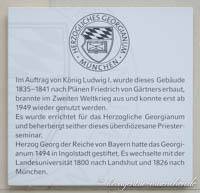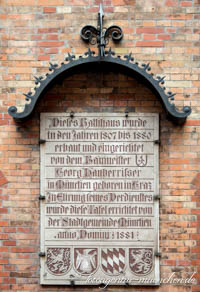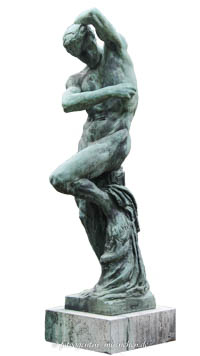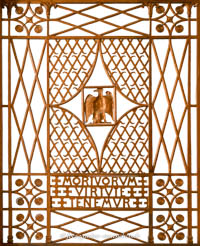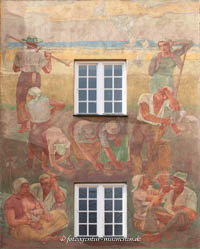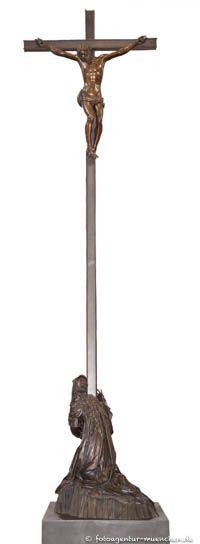Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Umgebungssuche
0 -
0 -
1 - Der Ursprung des Weines liegt im Dunkeln
<p><strong><em>???</em></strong> * Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Ursprung des Weines.<br /> </p>
um 3000 v.u.Z. 2 - Die älteste nachweisbare Aufzeichnung über die Bierzubereitung
<p><strong><em>An den Ufern des Euphrat und Tigris</em></strong> * Die älteste nachweisbare Aufzeichnung über die Bierzubereitung stammt von den Ufern des Euphrat und Tigris. Es ist eine kleine Tontafel mit in Keilschrift eingedrückten Darstellungen, die das Enthüllen des <em>„Emmers“</em> für die Bierzubereitung und ein Tier- und Bieropfer zeigen.</p> <p>Ohne freilich die Zusammenhänge zu verstehen, entdeckten die <em>„Sumerer“</em> nicht nur den Gärprozess am zum Ruhen gestellten Brotteig, sondern verstanden es darüber hinaus auch noch, diesen Vorgang beliebig oft zu wiederholen.</p>
um 800 v.u.Z. 3 - Der älteste Nachweis einer Bierbraukultur auf deutschem Boden
<p><strong><em>Kulmbach</em></strong> * Aus dieser Zeit stammt der älteste Nachweis, dass Bier auf deutschem Boden gebraut worden war. Es sind dies Bieramphoren aus der Hallstattzeit, die in der Nähe von Kulmbach gefunden wurden.</p>
Vor 322 v.u.Z. 4 - Der Beginn der Alchemie l
<p><strong><em>Athen</em></strong> * Nach den Lehren des Aristoteles [+ 322 v.u.Z.] besteht jeder Stoff aus den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Durch eine Änderung der Anteile der Elemente in einem Stoff wollte man diesen umwandeln - und so beispielsweise Blei zu Gold machen. </p>
um Christi Geburt 5 - Eroberung Galliens
Deutschland * Im Gefolge von Julius Cäsars Eroberung Galliens (um Christi Geburt) kommt der Wein über den Rhein nach Germanien.
Ab dem Jahr 41 - Der römische Kaiser Claudius lässt das Alpenvorland erschließen
<p><strong><em>Augsburg</em></strong> * Der römische Kaiser Claudius lässt die <em>„Donaulinie“</em> mit Kastellen bestücken und das von Vindelikern und Raetern besiedelte Alpenvorland durch Straßen erschließen.</p> <p>Zwischen 41 und 45 gründet Claudius die <em>„prokuratorische Provinz Raetia et Vindelica“</em> mit der Hauptstadt <em>„Augusta Vendelicum“</em> = Augsburg. </p>
Um das Jahr 50 - Das Urchristentum verurteilt jeden Krieg
<p><strong><em>Europa</em></strong> * Das Urchristentum verurteilt jeden Krieg und jede Form von Gewalt, da der Krieg eine Konsequenz der <em>„Erbsünde“</em> ist.</p>
166 - Soldaten schleppen die Pest in das Römische Reich ein
<p><strong><em>Alpenvorland</em></strong> * Aus dem <em>„Partherkrieg“</em> zurückkehrende Soldaten schleppen die Pest in das Römische Reich ja ein. Auch im Alpenvorland sterben viele Menschen an der Epidemie. </p>
Um 12 166 - Die Markomannen überschreiten die Donau
Donau * Die Markomannen überschreiten die Donau. Die Zeit friedlicher Entwicklung im Voralpenland ist damit vorbei.
um 270 - Kaiser Aurelianus Domitius verbietet den Weinanbau an Rhein und Mosel
<p><strong><em>Deutschland - Frankreich</em></strong> * Kaiser Aurelianus Domitius verbietet den Weinanbau an Rhein und Mosel, um damit eine lästige Konkurrenz auszuschalten.</p>
282 - Kaiser Probus hebt das Weinanbauverbot an Rhein und Mosel wieder auf
<p><strong><em>Deutschland - Frankreich</em></strong> * Kaiser Probus hebt das Weinanbauverbot an Rhein und Mosel wieder auf, da er erkannte:<em> „Wein braucht Frieden, Frieden braucht Wein, Wein ist Frieden“</em>.</p> <p>Er ist mit dieser Tat der erste <em>„Förderer des Deutschen Weinhandels“</em>.</p>
Circa 306 - Die ersten rechtlichen Bestimmungen zur „Ehelosigkeit“
<p><strong><em>Elvira:</em></strong> Im 4. Jahrhundert hat man die ersten rechtlichen Bestimmungen zur <em>„Ehelosigkeit“</em> und zur <em>„Sexuel„sexuellentsamkeit von Priestern“</em> erlassen. </p>
3. 3 321 - Der Sonntag wird arbeitsfrei
<p><em><strong>Rom ? </strong></em>• Der Kaiser Konstantin der Große erklärt den Sonntag, den Heiligen Tag des Christentums und des Mithraskultes, für arbeitsfrei – für <em>„alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste“</em>. Einzig landwirtschaftliche Arbeiten bleiben sonntags erlaubt. Das Edikt des Kaisers gilt als die Geburtsstunde des staatlich geschützten Ruhetags. </p>
3. 7 321 - Der Sonntag als gesetzlicher Ruhetag tritt in Kraft
<p><em><strong>Rom ? </strong></em>• Das Dekret Kaiser Konstantin des Großen, in dem er den Sonntag als gesetzlichen Ruhetag im römischen Reich erklärt, tritt in Kraft. </p>
Um das Jahr 350 - Augustinus entwirft die Theorie des „gerechten“ Krieges
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Als im 4. Jahrhundert - nach der Bekehrung Konstantins - das Römische Imperium ein christliches Reich wird, muss sich das Christentum der veränderten Situation anpassen.</p> <p>Augustinus entwirft die Theorie des <em>„gerechten“</em> Krieges: <em>„Gerecht werden die Kriege genannt, die Unrecht rächen“</em>. Und weiter: <em>„Ich glaube nicht, dass der Soldat, der einen Feind tötet, wie auch der Richter und der Henker, die einen Verbrecher hinrichten, sündigen, denn mit ihrem Handeln gehorchen sie dem Gesetz“</em>.</p> <p>Nur ein Krieg mit dem Ziel Reichtümer und Ehre zu gewinnen, gilt als unstatthaft. Ein <em>„gerechter Krieg“</em> sollte dagegen Unrecht strafen und wieder gutmachen.</p>
Um den 25. 12 354 - Papst Liberius verlegt Christi Geburt auf den 25. Dezember
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Papst Liberius verlegt das Fest Christi Geburt vom damals üblichen Termin, dem 6. Januar, auf den 25. Dezember. An diesem Tag feiert man im Römischen Reich den Tag der unbesiegbaren Sonne. Ein Fest zu Ehren von Mithras. Damit tritt die Geburt Christi an die Stelle eines heidnischen Festes.</p> <p>An diesem Tag wird das Weihnachtsfest in der westlichen Welt noch heute gefeiert, im Gegensatz zur orthodoxen und orientalischen Kirche, die Weihnachten an Epiphanie [= 6. Januar] begeht.</p>
Um 420 - Der Kirchenlehrer Aurelius Augustinus beschäftigt sich mit den Hexen
<p><strong><em>Algerien</em></strong> * Aurelius Augustinus, einer der vier lateinischen Kirchenlehrer der Spätantike, hat sich bereits im frühen 5. Jahrhundert mit dem beschäftigt, was wir heute unter den Begriffen <em>„Hexe“</em> und <em>„Schadenszauber“</em> verstehen. Es geht ihm aber weniger um die Angst vor einer schädlichen Magie, sondern vielmehr darum, den christlichen Glauben von allen Verunreinigungen durch den heidnischen und abergläubischen Irrglauben zu reinigen.</p> <p>Augustinus will die absolute Überlegenheit des katholischen Christentums propagieren und deutet deshalb die heidnischen Götter und Göttinnen zu teuflischen Dämonen um, die Luzifer hierarchisch unterstellt wären. Wer also in diesem Sinne Magie betreibt, macht sich automatisch des <em>„Teufelspaktes“</em> schuldig. </p>
22. 6 431 - Das erste Marianische-Dogma der katholischen Kirche wird verkündet
<p><strong><em>Ephesus</em></strong> * Das Konzil von Ephesus beginnt. Es dauert bis zum 31. Juli. Auf dem Konzil wird das erste Marianische-Dogma der katholischen Kirche verkündet. Es lautet: <em>„Maria ist Mutter Gottes.“</em></p>
Um den 550 - Persische Mönche schmuggeln Seidenraupen aus China
<p><em><strong>China - Persien</strong></em> * Um selbst Seide herstellen zu können, muss zunächst das Geheimnis der Seidenproduktion gelüftet und die nützlichen Seidenraupen beschafft werden.</p> <p>Das gelingt zwei persischen Mönchen aus der christlichen Sekte der Nestorianer. Sie haben sich in China die notwendigen Kenntnisse angeeignet und schmuggelten nun Eier der Seidenraupe sowie Maulbeersamen in ihren hohlen Pilgerstäben. </p>
5. 5 553 - Das Konzil von Konstantinopel verkündet das zweite „Marianische Dogma“
<p><strong><em>Konstantinopel</em></strong> * Das Konzil von Konstantinopel beginnt. Es dauert bis 2. Juni. Es verkündet den zweiten Marianischen Glaubensgrundsatz. <br /> Er lautet: <em>„Maria hat Jesus als Jungfrau empfangen und geboren“</em>. </p>
Um 620 - Seit der Christianisierung wird Messwein benötigt
<p><strong><em>Europa</em></strong> * Seit der Christianisierung wird der vergorene Traubensaft auch als Messwein benötigt, weshalb Anbau, Veredelung und Herstellung besonders von kirchlicher Seite gefördert wird.</p>
634 - In Luxueil in Burgund wird Bier gebraut
<p><strong><em>Luxueil</em></strong> * In Luxueil in Burgund, dem Ausgangspunkt der Christianisierung Bayerns, wird Bier gebraut.</p>
638 - Jerusalem fällt an die Muslime
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Jerusalem fällt an die Muslime.</p>
Um das Jahr 650 - Der „Gerechte Krieg“ als Rechtfertigung der Kreuzzüge
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Im 7. Jahrhundert wird die <em>„augustinische Definition“</em> präzisiert: <em>„Gerecht ist ein Krieg, der nach Warnung geführt wird, um Güter zurückzugewinnen oder Feinde zurückzuschlagen.“</em></p> <p>Genau dieses Argument dient zur Rechtfertigung der Kreuzzüge, die sich zum Ziel gesetzt haben, die <em>„heiligen Stätten“</em> zurückzugewinnen, da sie unzulässigerweise von den <em>„Ungläubigen“</em> besetzt worden sind.</p>
Um 716 - Herzog Theodo teilt das Herzogtum Baiern unter seinen vier Söhnen auf
<p><strong><em>Freising - Salzburg - Regensburg - Passau</em></strong> * Herzog Theodo teilt das Herzogtum Baiern unter seinen vier Söhnen Theodebert, Grimoald, Theodold und Tassilo auf.</p> <p>Vermutlich residiert Tassilo im Teilherzogtum Passau, Theodebert in Salzburg, Grimoald in Freising und Theodold in Regensburg. </p>
2. 4 747 - Kaiser Karl der Große wird in Aachen geboren
<p><strong><em>Aachen</em></strong> * Der spätere Kaiser Karl der Große wird in Aachen geboren. Das Geburtsjahr könnte aber auch 748 gewesen sein. </p>
763 - Erstmalige Nennung von Pasing und Gräfelfing
Pasing - Gräfelfing * Erstmalige Nennung von Pasing und Gräfelfing.
771 - Karl „der Große“ wird alleiniger Herrscher des Frankenreichs
<p><strong><em>Frankenreich</em></strong> * Karl <em>„der Große“</em> wird alleiniger Herrscher des Frankenreichs. </p>
778 - Baiern wird dem Frankenreich gewaltsam einverleibt
<p><strong><em>Frankenreich</em></strong> * Baiern wird dem Frankenreich<em> </em>unter Karl <em>„dem Großen“</em> gewaltsam einverleibt. </p>
14. 7 790 - Erste Nennung von Giesing
<p><strong><em>Giesing</em></strong><em> * „Der Priester Ihcho und sein Neffe Kerolt schenken ihr eigenes Erbgut an dem Ort Kyesinga und an einem anderen Ort, der Peralohc genannt wird, an die Freisinger Kirche. So geschehen am 14. Juli 790“</em>. </p> <p>So tritt Giesing schriftlich in die Geschichte ein. Giesing ist aber wesentlich älter. Die Anfänge des Ur-Giesings liegen freilich im Dunkeln, doch Ausgrabungen auf dem Gelände der Icho-Schule brachten einen der größten Bajuwarenfriedhöfe Südbayerns zu Tage.</p>
ab 800 - Beginn der Zeit des Klimaoptimums für den Weinanbau
Mitteleuropa * Beginn der Zeit des mitteleuropäischen Klimaoptimums für den Weinanbau.
Um 800 - Die Araber bringen die Kunst der Destillation nach Italien
Italien * Die Araber bringen die Kunst der Destillation nach Italien.
25. 12 800 - Karl der Große wird in Rom zum Kaiser gekrönt
Rom * Karl der Große wird von Papst Leo III. in Rom zum Kaiser gekrönt.
806 - Erstmalige Nennung von Haching
Haching * Erstmalige Nennung von Haching.
12. 2 808 - Haidhausen wird erstmals urkundlich erwähnt
Haidhausen * Haidhausen wird erstmals urkundlich erwähnt. Der Priester Erlaperth schenkt dem Bischof von Freising eine kleine Kirche samt Haus und Hof. Haidhusir ist damals aber bereits ein fertiges Bauerndorf.
Vor 811 - Eine Kirche in oder in der Nähe von Berg am Laim wird erbaut
<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Eine Kirche in oder in der Nähe von Berg am Laim wird während der Amtszeit des Bischofs Atto (783 bis 811) erbaut. Ob es sich dabei um die Baumkirchner Stephanskirche handelte, ist nicht sicher.</p>
23. 4 812 - Die erste Nennung Berg am Laims
<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Der Priester Cundhart und sein Neffe Liuthram übergeben ihren erworbenen beziehungsweise ererbten Besitz <em>„ad Perke“</em> an die Freisinger Bischofskirche. Die Urkunde beinhaltet damit die erste Nennung Berg am Laims.</p>
20. 1 813 - Berg am Laims zweite Nennung
<p><strong><em>Freising - Berg am Laim</em></strong> * Der Dom zu Freising erhält von Hahmunt dessen Gut samt Eigenleuten und Kirche ad Perke [= Berg am Laim].</p>
29. 9 813 - Die Synode von Mainz legt den Feiertag des heiligen Michael fest
<p><strong><em>Mainz</em></strong> * Die Synode von Mainz legt für diesen Tag den Feiertag des heiligen Michael fest. </p>
8. 1 814 - Die dritte Nennung von Berg am Laim
Berg am Laim * In der dritten Nennung von Berg am Laim wird eine Schenkung des Priesters Starcholf und des Diakons Hatto „ad Perke“ an Freising beurkundet.
28. 1 814 - Kaiser Karl der Große stirbt
Aachen * Kaiser Karl der Große stirbt in Aachen. Sein Nachfolger wird sein Sohn Ludwig der Fromme.
870 - Baumkirchen wird erstmals in einer Freisinger Urkunde erwähnt
Berg am Laim * Baumkirchen wird erstmals in einer Freisinger Urkunde als „Pouminunchirihum“ erwähnt.
895 - Die Ungarn tauchen in der Tiefebene an Donau und Theiss auf
<p><strong><em>Ungarn</em></strong> * Die Ungarn tauchen in der zuvor von den <em>„Awaren“</em> bewohnten Tiefebene an Donau und Theiss auf. Die Gegend trägt seitdem ihren Namen. </p>
903 - Freising kann den karolingischen „Königshof Föhring“ erwerben
Föhring - Freising * Durch ein Diplom König Ludwig „des Kindes“ kann Freising den ganzen einstigen Herzogs- und nachmaligen karolingischen „Königshof Föhring“ erwerben.
4. 7 907 - Die Ungarn vernichten nahe Pressburg fast das gesamte baierische Heer
<p><strong><em>Bratislava</em></strong> * Die Ungarn vernichten nahe Pressburg (Bratislava) fast das gesamte baierische Heer und einen Großteil der baierischen Führungsschicht. </p> <p>Die als Hunnen bezeichneten magyarischen Reiterhorden verbreiten Angst und Schrecken. Sie werden als <em>„wilde Gestalten“</em> beschrieben, <em>„mit braungelben Gesichtszügen, tief liegenden Augen, heißerer Stimme und bis auf drei Zöpfe abgeschorenem Haar, die das Blut geschlachteter Tiere trinken und ihre Toten verbrennen</em>“. </p>
10. 8 955 - Die „Schlacht auf dem Lechfeld“ beginnt
<p><strong><em>Lechfeld</em></strong> * Die dreitägige <em>„Schlacht auf dem Lechfeld“</em> beginnt. Die <em>„Hunnen“</em> genannten ungarischen Reiterhorden werden von einem zusammengewürfelten Heer aller deutschen Stämme (Sachsen, Franken, Baiern und Schwaben) besiegt. </p> <p>Anschließend setzen die <em>„Panzerreiter“</em> Ottos des Großen den Flüchtenden nach, werden <em>„eingeschlossen und von Bewaffneten niedergemacht“</em>. Weitere Tausende Ungarn ertrinken angeblich in den Fluten des Lechs, dessen Wasser vom Blut der vielen Toten rot gefärbt ist. Das Schlachtfeld am Lech ist mit Toten übersät. </p> <p>Die <em>„Schlacht auf dem Lechfeld“</em> gilt unter Historikern als eines der bedeutendsten Ereignisse in der deutschen Geschichte. Man spricht sogar von der <em>„Geburtsstunde der deutschen Nation“</em>. </p>
957 - Der Bischof von Freising erhält die „Mühle zu Kiesingenum“
<p><strong><em>Untergiesing</em></strong> * Der Bischof von Freising erhält die <em>„Mühle zu Kiesingenum“</em> samt dem dazugehörigen Grundbesitz vom Edlen Wolftregil übertragen.</p> <p>Sie ist die älteste Mühle von Giesing und steht in der Lohstraße 46, nahe dem Candidplatz, dort wo heute der Mittlere Ring - lärmend und stinkend - den Auer Mühlbach überquert.</p>
962 - Papst Johannes XII. krönt Otto I. „den Großen“ in Rom zum Kaiser
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Papst Johannes XII. krönt den römisch-deutschen König Otto I.<em> „den Großen“</em> in Rom zum Kaiser. Seitdem besteht eine unverbrüchliche Verbindung zwischen den beiden Funktionen. </p> <ul> <li>Der deutsche König versteht sich automatisch als Anwärter auf das Kaisertum. </li> <li>Der Papst gilt als der richtige <em>„Koronator“</em> für den Papst. </li> </ul> <p>Damit entsteht eine besondere Beziehung zwischen dem römisch-deutschen König und dem Papst. </p> <p>Die Päpste werden im Umkehrschluss </p> <ul> <li>ihr Recht ableiten, die Eignung des zukünftigen Kaisers zu überprüfen und </li> <li>auf die Erhebung zum deutschen König Einfluss zu nehmen. </li> </ul>
1. 11 996 - Der Name Ostarrichi für Österreich taucht erstmals auf
<p><em><strong>Bruchsal</strong></em> * Kaiser Otto III. überträgt dem Bischof von Freising, Gottschalk von Hagenau, Grundbesitz im Raum von Neuhofen an der Ybbs im heutigen Niederösterreich. In dieser Urkunde taucht erstmals der Name <em>„Ostarrichi“</em> für Österreich auf.</p> <p>Ostarrichi gehört zu dieser Zeit zum Herzogtum Baiern, bis es 1156 als Herzogtum Österreich unabhängig wird. </p>
Um das Jahr 1000 - Professionelle Bierproduktion im Kloster Sankt Gallen
<p><strong><em>Sankt Gallen</em></strong> * Im Kloster Sankt Gallen wird die Bierproduktion erstmals professionell betrieben. Über 100 Mönche arbeiten, unterstützt von einer noch größeren Anzahl von weltlichen Helfern, in den drei Brauereien.</p> <p>Die beste Sorte ist <em>Celia</em>, die für die Patres und vornehme Gäste bestimmt ist. Die einfachen Mönche bekommen <em>Cervesia</em>. Den letzten, mit Wasser gestreckten Haferaufguss, <em>Conventus</em>, erhalten die Bettler und Pilger.</p>
Um das Jahr 1000 - Der Begriff Hexe leitet sich vom althochdeutschen Hagazussa ab
<p><strong><em>Europa</em></strong> * Der Begriff Hexe taucht in unseren Breitengraden erst vor gut tausend Jahren auf und dürfte sich vom althochdeutschen <em>„hagazussa“</em> ableiten. Das lässt sich mit <em>„Geist oder Mensch, der in der Hecke wohnt oder sitzt“</em> [<em>hag</em> = Hecke, <em>zussa</em> = sitzend] übersetzen. </p>
Um 1000 - Die Seidenraupenzucht verbreitet sich bis Frankreich
<p><em><strong>Griechenland - Süditalien - Frankreich</strong></em> * Die Seidenraupenzucht verbreitet sich um das Jahr 1000 von Griechenland aus nach Süditalien, Sizilien und Frankreich.</p>
1032 - Die „Giesinger Mühle“ gehört dem Edelmann Ordendil
<p><strong><em>Untergiesing</em></strong> * Die <em>„Giesinger Mühle“</em> gehört dem Edelmann Ordendil, danach kommt sie an den Edlen von Ast.</p>
1040 - Das Benediktinerkloster Weihenstephan erhält die Braugerechtsame
<p><strong><em>Weihenstephan</em></strong> * Das Benediktinerkloster Weihenstephan erhält laut einer Urkunde die Braugerechtsame. Die dem bayerischen Staat gehörende Brauerei bezeichnet sich daher als die <em>„älteste Brauerei der Welt“</em>.</p> <p>Dabei handelt es sich bei dieser Urkunde um eine Fälschung aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Urkundenfälschung der frommen Kleriker wird erst im Jahr 1973 aufgedeckt.</p>
1048 - Der letzte Baier auf dem Papstthron
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Der letzte Baier auf dem <em>„Stuhl Petri“</em> ist Poppo von Brixen, der sich Damasus II. nennt und nach wenigen Wochen im Amt stirbt.</p>
1050 - Missionare gründen das Kloster Weltenburg samt Brauerei
<p><strong><em>Weltenburg</em></strong> * Eustasius und Agilus, Missionare aus dem Kloster Luxueil, gründen das Kloster Weltenburg und führen hier die klösterliche Braukunst ein.</p>
18. 5 1052 - Die Chorherren von Sankt Veit in Freising erhalten Baumkirchen
<p><strong><em>Berg am Laim - Freising</em></strong> * Kaiser Heinrich III. gibt den Weiler Baumkirchen samt Kirche, Liegenschaften und <em>„Eigenleute beiderlei Geschlechts“</em> an die Chorherren von Sankt Veit in Freising.</p>
1071 - Der türkische Truppenführer Atsiz besetzt die Stadt Jerusalem
Jerusalem * Der türkische Truppenführer Atsiz besetzt die Stadt Jerusalem, die bis dahin im Besitz der schiitischen Kalifen war.
1076 - Heftige Kämpfe zwischen Seldschuken und Schiiten
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Im <em>„Heiligen Land“</em> kommt zu heftigen Kämpfen zwischen Seldschuken und Schiiten. Die seldschukischen Türken behalten die Oberhand und richten unter den schiitischen Muslims ein Blutbad an.</p> <p>Im christlichen Viertel Jerusalems bleibt es offenbar ruhig und auch die <em>„Grabeskirche“</em> ist für die Pilger - trotz der türkischen Herrschaft - weiterhin zugänglich. Allerdings behindern die Kriegswirren die christliche Wallfahrt.</p>
1095 - Jerusalem befindet sich seit über 400 Jahren in der Hand der Muslimen
Jerusalem * Jerusalem und andere „heilige Stätten“ befinden sich seit über vierhundert Jahren in der Hand der Muslimen.
3 1095 - Byzanz bittet Papst Urban II. um Unterstützung
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Papst Urban II. wird von einer Gesandtschaft des byzantinischen Kaisers Alexios I. um Hilfe gegen die türkischen Seldschuken gebeten. Diese haben das Byzantinische Reich im Sturm erobert und kommen der Hauptstadt Konstantinopel bedrohlich nah.</p>
Ab 8 1095 - Papst Urban II. reist 3.000 Kilometer durch Frankreich
<p><strong><em>Frankreich</em></strong> * Zwischen August 1095 und September 1096 unternimmt der damals etwas über sechzig Jahre alte Papst Urban II. eine mehr als dreitausend Kilometer lange Reise durch Frankreich. Er wird dabei von einer Eskorte von Erzbischöfen und Bischöfen begleitet. Man nimmt an, dass die im Gefolge angeschlossenen Haushalte den Zug auf mehrere Kilometer anwachsen ließen.</p> <p>Die Reiseroute ist zuvor so festgelegt worden, dass das Eintreffen des Papstes in den Städten mit den Ehrentagen wichtiger Schutzpatrone zusammenfällt.</p>
Ab 18. 11 1095 - Papst Urban II. ruft zur Vertreibung der Türken aus Kleinasien auf
<p><strong><em>Clermont</em></strong> * Ein Höhepunkt der Reise von Papst Urban II. ist das Konzil, das bis zum 27. November 1095 in der Hauptkirche von Clermont tagt. Unter dem Vorsitz des Papstes werden finanzielle und organisatorische Angelegenheiten der französischen Kirche abgearbeitet.</p> <p>Am Ende des Konzils hält das Kirchenoberhaupt auf einem Feld vor der Stadt eine Rede, in der es den anwesenden Rittern und Klerikern zunächst die Ergebnisse des Konzils darlegt, danach gegen den Kaiser und den Gegenpapst wettert und anschließend die Befreiung der Kirche von aller weltlichen Gewalt fordert.</p> <p>Schließlich ruft Papst Urban II. die Anwesenden zum Kriegszug zur Vertreibung der Türken aus Kleinasien auf. Als die Menge die päpstliche Predigt am Ende begeistert mit den Worten <em>„Deus lo vult - Gott will es!“</em> quittiert, bestimmt der oberste Kirchenmann, dass dies der Schlachtruf sein soll.</p>
Ab 12 1095 - Papst Urban II. kann die Emotionen seiner Zuhörer wecken
Frankreich * Auf seiner weitere Reise wird der Papst nicht müde zu betonen, dass die Teilnehmer an diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen einen „Befreiungskrieg gegen die muslimische Tyrannei“ führen, bei dem es einerseits um die Befreiung der christlichen Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und andererseits darum geht, „das Heilige Grab aus den Händen der Heiden zu befreien“.
Zur „Beruhigung des Gewissens“ versichert der Papst seinen Zuhörern, dass das Unternehmen eine Umsetzung „christlicher Barmherzigkeit“ ist, bei dem die „Kreuzfahrer“ ihr Leben aus Liebe zu Gott und „zu ihrem Nächsten“ aufs Spiel setzen werden. Die noch fast ein Jahr andauernde „Predigtreise“ spielt eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung der Menschen.
Der alternde Papst versteht es hervorragend, die Emotionen seiner Zuhörer zu wecken. Papst Urban II. nimmt für sich in Anspruch, im Namen Jesu Christi zu sprechen.
3 1096 - Die ersten Kreuzfahrer-Kontingente machen sich auf den Weg
<p><strong><em>Frankreich</em></strong> * Von einer Woge populärer Begeisterung getragen, machen sich - gegen dem Wunsch des Papstes - die ersten Kreuzfahrer-Kontingente auf den Weg. Die meisten dieser Kreuzzugs-Pilger entstammen dem einfachen Sozialmilieu des Bauernstandes und der Städte. Viele von ihnen verkaufen ihre geringe Habe, um die Reise nicht völlig ohne Barschaft antreten zu müssen. Wegen des dadurch entstandenen Überangebots fallen die Preise dramatisch, sodass sich der Verkauf oft kaum mehr lohnt. Andere lassen einfach alles liegen und stehen und schließen sich einem Pilgerzug in den Nahen Osten an.</p> <p>In den nächsten sechs Jahren folgen etwa 130.000 Frauen und Männer ihrem Beispiel. Aus dem Stand des Adels und der Ritter kommen kaum zehn Prozent der Kreuzfahrer. Allerdings übernimmt diese Gruppierung die Führerschaft und - neben den sie begleitenden Priestern - die Verantwortung für die nachfolgend beschriebenen Judenpogrome. Nach den Beweggründen für die Teilnahme an den Kreuzzügen zu suchen ist müßig. Sie sind nicht rational sondern ideologisch begründet. Die meisten, die den Aufrufen der Päpste folgen, bereuen später ihr - in einer durch Predigt und Propaganda bewusst ausgelösten Atmosphäre religiöser Hysterie - abgelegtes Gelübde.</p> <p>Die meisten dieser am sogenannten <em>„Vor-Kreuzzug“</em> beteiligten Pilger kommen nicht weiter als bis zum Balkan. Besteht für die Kirche die Rechtfertigung für den „ersten Kreuzzug“ in der Besetzung Jerusalems durch die Muslime, so entfesselt die Kreuzzugsbewegung aber auch gewalttätige Emotionen in eine andere Richtung.</p> <p>Viele der christlichen Kreuzfahrer nehmen, bevor sie sich überhaupt ins <em>„Heilige Land“</em> aufmachen, erst einmal Rache an den Juden, die - nach ihrer Auffassung - für die <em>„Kreuzigung des Heilands“</em> verantwortlich sind. Die aus einfachsten Verhältnissen stammenden Kriegsteilnehmer haben bis dahin ein sehr bescheidenes Dasein gefristet und setzen nun als <em>„Wagemutige“</em> ihre Existenz aufs Spiel. Und dass etliche Juden durch ihre Geschäfte reich geworden sind, steht im krassen Gegensatz zur kirchlichen Doktrin, wonach die Juden als Strafe und Zeugnis für den ihnen zur Last gelegten <em>„Gottesmord“</em> sichtbar in <em>„Knechtschaft unter den Christen“</em> leben sollen - und nicht umgekehrt.</p> <p>Da die Kreuzfahrer ihr gegen die Muslime gerichtetes Feindbild und die damit verbundenen Aggressionen problemlos auch gegen die Juden anwenden können, entsteht eines der dunkelsten Kapitel in der eh schon so grausamen Kreuzzugs-Geschichte.</p>
10. 4 1096 - Die Kreuzfahrer drohen den Juden mit einem Massaker
<p><strong><em>Trier</em></strong> * In Trier gestaltet sich das Zusammenleben der Juden und der Christen bislang weitgehend friedlich.</p> <ul> <li>Doch jetzt drohen die Kreuzfahrer den Juden mit einem Massaker, wenn sie nicht auf ihre Geldforderungen eingehen. In ihrer Todesangst geben ihnen die Juden alles, was sie haben.</li> <li>Daraufhin ziehen die Kreuzfahrer weiter, doch kommt dann der zweite Trupp und verlangt ebenfalls Geld und Wertsachen. Die Juden kratzen den Rest zusammen und geben es hin.</li> <li>Der Trupp zieht ab und schon bald kommen die nächsten Kreuzfahrer-Kontingente, die zum Teil auch mit Bürgern der Städte und den Landbewohnern gemeinsame Sache machen. Nun haben die Juden nichts mehr, weshalb fundamentalistische Geistliche in den Reihen der Kreuzfahrer die Losung ausgeben: <em>„Wer einen Juden erschlägt, dem werden seine Sünden vergeben“</em>.</li> </ul> <p>Berufen können sie sich auf den Abt des Klosters, aus dem auch Papst Urban II. stammt, Pierre de Cluny. Sein Leitspruch lautet: <br /> <em>„Es ist sinnlos die Feinde unseres Christenglaubens in der Fremde zu bekämpfen, wenn diese Juden, die schlimmer als die Muslims sind, in unseren Städten ungestraft unseren Herrn Jesus Christ beleidigen dürfen.“ </em></p> <p>Insgesamt kommen anlässlich des Ersten Kreuzzuges mindestens 2.500 Angehörige der deutschen Judengemeinden ums Leben. Nur wer sich nach christlichem Ritus taufen lässt, kann sein Leben retten. Viele Juden ziehen allerdings der Zwangstaufe den Freitod vor.</p>
Ende 5 1096 - Die Pilger des „Vor-Kreuzzuges“ hinterlassen eine blutige Spur
<p><strong><em>Ungarn - Griechenland - Naher Osten</em></strong> * Die <em>Pilger</em> des <em>„Vor-Kreuzzuges“</em> überqueren die ungarische Grenze. Sie bedrohen inzwischen alle, die sich anders verhalten als die Kreuzfahrer“. Egal ob Muslime, Juden und bald auch griechisch-orthodoxe Christen. Die Kreuzfahrer überfallen und töten eben jene Christen zu deren Beistand sie der Papst ins <em>„Heilige Land“</em> entsandt hat.</p> <p>Und es sind ausgerechnet die Türken, die den orthodoxen Christen beistehen, die Kreuzfahrer besiegen und den <em>„Vor-Kreuzzug“</em> beenden.</p>
8 1096 - Zum Überleben müssen die Kreuzfahrer plündern
<p><strong><em>Naher Osten</em></strong> * Erst die militärisch besser ausgestatteten Kreuzfahrer-Kontingente haben mehr Erfolg. Das zügige Fortkommen der Kreuzfahrer behindern allerdings arme Pilger, die sich ihnen angeschlossen haben. Dadurch erreichen sie Konstantinopel erst Ende des Jahres 1096/Anfang 1097.</p> <p>Nachdem die Kreuzfahrer von der dortigen Bevölkerung feindlich aufgenommen sowie vom byzantinischen Kaiser nur widerwillig unterstützt und nur mit knapp bemessenem Proviant versorgt werden, ziehen sie auf eigene Faust durch Kleinasien weiter. Seit sie islamisches Gebiet betreten haben, gibt es kein funktionierendes System für Versorgung mit Nachschub mehr. Um Überleben zu können, müssen die Kreuzfahrer plündern.</p> <p>Die bewaffneten Pilger besiegen die Türken bei Dorylaeum und Eregli. Nach einem anstrengenden Marsch gelangen sie nach Antiochia. Sie belagern die Stadt siebeneinhalb Monate und schlagen in deren Verlauf zwei muslimische Verstärkungsarmeen.</p>
19. 6 1097 - Die Kreuzfahrer nehmen Nicäa ein
Nicäa * Die Kreuzfahrer nehmen Nicäa, die erste bedeutende Stadt unter islamischer Herrschaft, ein. Das Heer des Ersten Kreuzzugs besteht aus 40.000 Personen, von denen nur 4.500 Ritter oder Adelige sind. Der Rest sind nicht-waffenfähige Handwerker, Städter und Bauern. Das missfällt zwar den Führern der Kreuzzüge, da die Armen ernährt werden müssen. Doch die Kreuzzüge sind ja zugleich Pilgerfahrten.
10. 3 1098 - Balduin von Boulogne gründet den ersten Kreuzfahrerstaat
<p><strong><em>Edessa</em></strong> * Balduin von Boulogne erobert die Grafschaft Edessa und gründet den ersten Kreuzfahrerstaat.</p>
3. 6 1098 - Antiochia fällt in die Hände des Kreuzzugsheeres
Antiochia * Antiochia fällt in die Hände des Kreuzzugsheeres. Doch nun werden die Kreuzfahrer selbst von einer muslimischen Armee belagert.
10. 6 1098 - Visionen eines den Sieg verheißenden Christus
Antiochia * In der Nacht vom 10. zum 11. Juni ist die Kampfmoral der in Antiochia belagerten Christen derart gesunken, dass Panik entsteht und die Befehlshaber der Kreuzfahrer einen Massenausbruch verhindern müssen.
Kurz darauf kommt es zu Visionen eines erschienenen, den Sieg verheißenden Christus und der Entdeckung einer Lanze, die angeblich den Gekreuzigten durchbohrt hat. Die Stimmung verbessert sich dadurch erheblich.
28. 6 1098 - Die Pilgerkrieger wagen einen Ausfall aus Antiochia
<p><strong><em>Antiochia</em></strong> * Die Pilgerkrieger wagen einen Ausfall aus Antiochia und erringen den Sieg gegen die Muslime.</p>
Um 10 1098 - Der Kreuzzug kommt in Nordsyrien zum Stehen
<p><strong><em>Syrien</em></strong> * Der Kreuzzug kommt in Nordsyrien zum Stehen. Doch die Mehrheit des Kreuzfahrerheeres zwingt die Führer zum Weitermarsch nach Jerusalem.</p>
Mitte 1 1099 - Die Kreuzfahrer besetzen einige wichtige Festungen
Syrien * Die Kreuzfahrer ziehen weiter. Sie besetzen auf ihrer Route einige wichtige Festungen.
7. 7 1099 - Die Kreuzfahrer sind am Ziel ihrer Reise: Jerusalem
Jerusalem * Die Kreuzfahrer sind am Ziel ihrer Reise: Jerusalem. Mit ihrer inzwischen mehrfach erprobten und von Erfolg gekrönten Taktik und Technik belagern sie die Stadt.
15. 7 1099 - Die Kreuzfahrer können Jerusalem einnehmen
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Die Kreuzfahrer können Jerusalem erobern. Damit haben die Pilger endlich den Ort der Verheißung erreicht. Die ganze Zeit ist ihnen von den Predigern versprochen worden, hier wäre das Land, in dem Milch und Honig fließen. Bisher haben die meisten Kreuzfahrer gehungert. Über 100.000 Pilger haben sich ins Heilige Land aufgemacht; kaum 20.000 sind dort angekommen. </p> <p>Da die Kleriker die Eroberung einer muslimischen Stadt durch Christen für etwas Selbstverständliches halten, empfinden sie es folgerichtig als Unrecht, wenn die Muslime ihr Eigentum verteidigen. Wie aber die Christen reagieren, möglicherweise aufgeputscht von den Propaganda-Lügen über die von den Muslims angeblich geschändeten und entweihten Kirchen, ist grausam und unverzeihlich. Die anwesenden Chronisten beschreiben unvorstellbare Szenarien.</p> <p>Raimund von Aguilers schreibt: <em>„Wir kamen zum Tempel Salomons, wo sie ihren Ritus und ihre Gesänge pflegten. Aber was geschah dort? Wenn ich die Wahrheit sage, wird man mir es nicht glauben. Es mag genügen, dass sie im Tempel Salomons und im Vorhof bis zu den Knien und den Zügeln ihrer Pferde im Blut ritten. Wahrlich ein gerechtes Gericht, dass der Ort das Blut derjenigen empfing, deren Gotteslästerung er so lange erdulden musste.“</em></p> <p>Die byzantinische Chronistin Anna Comnena notiert: <em>„Viele Sarazenen und Juden in der Stadt wurden abgeschlachtet.“ </em></p>
22. 7 1099 - Gottfried von Bouillon wird Herrscher von Jerusalem
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Eine Woche nachdem die Kreuzfahrer das Heilige Grab mit blutbesudelten Händen aus der <em>„Macht der Heiden“</em> befreit haben, wählen sie Gottfried von Bouillon zum Herrscher von Jerusalem.</p>
11. 8 1099 - Die Kreuzfahrer besiegen ein großes ägyptisches Entsatzheer
<p><strong><em>Askalon</em></strong> * Die Kreuzfahrer besiegen ein großes ägyptisches Entsatzheer nahe Askalon.</p>
18. 7 1100 - Gottfried von Bouillon stirbt in Jerusalem
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Gottfried von Bouillon stirbt. Sein Nachfolger als König von Jerusalem wird Balduin von Boulogne.</p>
17. 5 1101 - Die Kreuzfahrer erobern Caesarea
Caesarea * Die Kreuzfahrer erobern Caesarea. Die alte Römerstadt wird zum Sitz eines weltlichen Herrn und eines Bischofs.
6. 1 1103 - Kaiser Heinrich IV. verkündet den Reichslandfrieden
Mainz * Mit dem durch Kaiser Heinrich IV. verkündeten Reichslandfrieden stehen alle Juden unter dem persönlichen Schutz des Kaisers. Das bedeutet aber, dass sie ab sofort keine Waffen mehr tragen dürfen und darauf angewiesen sind, sich von des Kaisers Truppen beschützen zu lassen. Das Gesetz begründet
- die Ausnahmestellung der Juden und zugleich
- ihre Wehr- und Waffenunwürdigkeit.
1104 - Hugo von Payns auf dem Weg zu einer Pilgerfahrt ins Land der Heiligkeit
Israel * Hugo von Payns ist ein Herr aus dem mittleren Adel und stammt aus der Champagne. Seine Spuren sind nur sehr rar gestreut, weshalb sich seine Teilnahme am Ersten Kreuzzug nicht mit Sicherheit bestätigen lässt. Tatsache ist aber, dass er sich anno 1104 auf den Weg zu einer Pilgerfahrt ins Land der Heiligkeit macht und Graf Hugo von der Champagne begleitet.
1113 - Papst Paschalis II. erkennt das „Hospital des heiligen Johannes“ an
Jerusalem * Papst Paschalis II. erkennt das „Hospital des heiligen Johannes“ in Jerusalem an.
1114 - Hugo von Payns beteiligt sich an einer „Pilgerfahrt ins Heilige Land“
Jerusalem * Hugo von Payns beteiligt sich erneut an einer „Pilgerfahrt ins Land der Heiligkeit“, bleibt aber in Jerusalem.
1115 - Die Grafen von Scheyern nennen sich jetzt „von Wittelsbach“
Scheyern * Die Grafen von Scheyern nennen sich jetzt „von Wittelsbach“.
Der Name leitet sich von der im Stadtgebiet von Aichach gelegenen Burg ab.
1118 - Balduin II. von Boulogne wird Herrscher von Jerusalem
Jerusalem * Balduin II. von Boulogne wird Herrscher von Jerusalem.
1120 - Hugo von Payns gründet in Jerusalem den ersten „Geistlichen Ritterorden“
Jerusalem * Hugo von Payns gründet - mit acht weiteren französischen Rittern - in Jerusalem den ersten „Geistlichen Ritterorden“.
- Der hauptsächliche Zweck des „Ordens“ besteht im Aufbau einer einheitlichen Organisation, die eine wirksame Polizeigewalt ausüben kann.
- Die Ritter haben die Sicherheit der Straßen und Wege zu gewährleisten, die heiligen Stätten sowie das Kirchengut zu schützen und bei Übergriffen auf den kirchlichen Besitz als Rächer aufzutreten.
- Ganz oben in der Aufgabenliste steht aber der militärische Schutz der christlichen Pilger, die von der Küste nach Bethlehem oder Jerusalem und von dort weiter nach Jericho und zur „Taufstätte Jesu“ am Jordan wollen.
- Herumziehende Räuberbanden machen diesen Schutz notwendig.
Die Initiative zur Gründung des militärisch-mönchischen Ordens geht von den „Rittern“ selbst aus.
Doch als sich Ritter Hugo von Payns mit seinen Gefährten zusammenschließt, haben sie weder eine feste Bleibe noch eine Kirche. König Balduin II. von Jerusalem gibt ihnen Räume dicht bei der Stätte des alttestamentarisch-herodianischen Tempels neben dem Palast des Königs. Dadurch ist der ehemalige „Tempel Salomons“ das Hauptquartier des Ordens und soll der Rittergemeinschaft den Namen geben.
Zunächst nennen sie sich „Pauperes Commilitones Christi templique Salomonis“, also „Arme Ritter Christi vom Tempel Salomonis“ oder kürzer „Fratres militiae templi“. Das heißt übersetzt: „Ritter vom Tempel“. Die Mitglieder der mönchischen Rittergemeinschaften müssen bei ihrer Aufnahme dazu die Gelübde der „Armut“, der „Keuschheit“ und des „Gehorsams“ ablegen. Zwar wird von den wohlhabenderen „Pilgern“ für den Schutz der „Templer“ in Form von „Schenkungen“ bezahlt. Dennoch sind die Anfänge der neu gegründeten „Rittergemeinschaft“ noch von Armut gezeichnet.
1122 - Kaiser Friedrich II. ermahnt die Tempelherren
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Kaiser Friedrich II. ermahnt die Tempelherren, den Angehörigen des aufstrebenden Deutschherren-Ordens wegen des Tragens ihrer weißen Ordensmäntel keine Schwierigkeiten zu machen.</p>
Um 1123 - Der Freisinger Bischof kommt in den Besitz des „Lenzbauernhofes“
Haidhausen - Freising * Zwischen 1123 und 1130 kommt der Freisinger Bischof in den Besitz des „Lenzbauernhofes“ in Haidhausen.
Der „Kleriker“ Rudolf von Feldkirchen übergibt sein Haidhauser Gut als Opfergabe dem „Marienaltar“ in Freising, um es für sein Eigenes und das Seelenheil seiner Eltern zu opfern.
1126 - Graf Hugo von der Champagne tritt dem Templer-Ritterorden bei
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Graf Hugo von der Champagne tritt dem Templer-Ritterorden bei - und damit beginnen die Schenkungen zu strömen.</p>
1127 - Hugo von Payns sucht Unterstützung für die „Tempel-Ritter“
Frankreich - England - Spanien * Hugo von Payns schifft sich mit fünf „Tempel-Rittern“ ein und bereist in der Folge Frankreich, England und Spanien.
Er verfolgt dabei mehrere Ziele: Er will die „Rittergemeinschaft“ mit einer von den obersten Kirchenstellen gebilligten „Ordensregel“ versehen lassen, außerdem den Orden und dessen Ziele im „Abendland“ bekannt machen und um finanzielle Unterstützung werben.
Darüber hinaus muss er „neue Kämpfer“ für das „Heilige Land“ und damit Nachwuchs für den „Orden der Tempel-Ritter“ anwerben.
1128 - Die Reise des Ordensgründers Hugo von Payns ist von Erfolg gekrönt
Frankreich - England - Spanien * Die Reise des Ordensgründers Hugo von Payns und seiner Begleiter ist von Erfolg gekrönt.
Der „Templer-Orden“ erhält großzügige Unterstützung durch den König von Portugal. Er weist dem „Templer-Ritterorden“ reiche Güter an und räumt ihm Vorrechte ein.
13. 1 1129 - Am Konzil von Troyes erhält der Templer-Orden eine feste Regel
Troyes * Hugo von Payns nimmt am Konzil von Troyes teil, auf dem der Templer-Orden eine feste Regel erhält. Anschließend kehrt der Großmeister mit dreihundert Rittern aus den edelsten Familien Frankreichs und gewaltigen Geldmitteln in das Heilige Land zurück. Die Templer werden so das erste stehende Heer des Mittelalters.
1130 - Bernhard von Clairvaux erarbeitet die „Ordensregel“ der „Templer“
Clairvaux * Inwieweit Bernhard von Clairvaux an der Erstellung der „Ordensregel“ der „Templer“ beteiligt war, ist umstritten.
Der „Zisterziensermönch“ konnte aber den „Templern“ bei der Findung eines angemessenen Rahmens helfen und mit seinem rhetorischen Talent diesen auch gegenüber Skeptikern durchsetzen.
Bernhard von Clairvaux sieht in den „Templern“ die neuen „Glaubenskrieger“, die den „freien Zugang zu den Heiligen Stätten“ wieder herstellen, die „Pilger schützen“ und den „Frieden sichern“. Kein Wunder also, dass die „Ordensregeln der Templer“ ganz im Geiste der von Bernhard von Clairvaux stark beeinflussten „Ordensregeln der Zisterzienser“ gehalten sind und die „Tempelritter“ bei ihrem Eintritt in den Orden „Armut, Keuschheit und Gehorsamkeit“ geloben müssen.
In seinem Traktat „Lob der neuen Ritterschaft“ preist Bernhard die „Tugenden“ sowie die „Werke der Nächstenliebe“ der „Tempelherren“ und gibt damit dem „Ritterorden“ eine theologische Begründung.
Bei so viel Unterstützung durch Bernhard von Clairvaux verwundert es nicht, dass sich die „Tempel-Ritter“ zu den „Zisterziensern“ hingezogen fühlen. Aufgrund ihrer Kleidung werden diese Kirchenmänner auch als „weiße Mönche“ bezeichnet. Und nachdem die „Tempelherren“ die „Zisterzienser“ als ihren „Mutterorden“ empfinden, übernehmen sie auch die „Farbe weiß“ für ihren Umhang.
1130 - Der „gerechte Krieg“ ist als das „kleinere Übel“ akzeptiert
Clairvaux * Für Bernhard von Clairvaux ist der „gerechte Krieg“ als das „kleinere Übel“ akzeptiert.
Unter Christen ist er nur gerecht, wenn die „Einheit der Kirche“ auf dem Spiel steht. Gegen die „Juden“, die „Ketzer“ und die „Heiden“ soll Gewalt vermieden werden, weil sich die „Wahrheit“ nicht mit Gewalt durchsetzen lässt.
Der Christ soll überzeugen, weshalb - aus der Sicht des später zum „Heiligen“ erklärten Bernhard von Clairvaux - gegen diesen Personenkreis nur ein „Verteidigungskrieg“ gerechtfertigt ist, bei dem er allerdings die Gewalt auf ein Mindestmaß reduziert wissen will.
Vom „Gerechten Krieg“ zum „Heiligen Krieg“ ist es damit nicht mehr weit, solange er gegen die „Heiden“ und „Ungläubigen“ gerichtet ist. Bernhard von Clairvaux hebt in seinen „Kreuzzugpredigten“ die islamische Aggression und Bedrohung der gesamten christlichen Kirche hervor. Sein Fazit lautet: Nur durch einen „Gerechten und Heiligen Krieg“ kann der „Frieden“ wieder hergestellt werden. Unter „Frieden“ versteht der Kirchenmann die „Aufrechterhaltung der gottgewollten Ordnung“.
Bernhard von Clairvaux will aus „Raubrittern“, „Weiberhelden“, „Totschlägern“, „Meineidigen“ und „Friedensbrechern“ zutiefst beherrschte, asketische und christliche Ritter machen. Dabei will er aber die natürlichen Triebe - wie Aggression - nicht unterdrücken, sondern sie durch höhere Ziele - sozusagen - „veredeln“. Im Zentrum seines Werkes steht deshalb der Begriff der „militia Christi“. „Gute Ritter“ kämpfen, um Glauben und Kirche zu verteidigen, „Schlechte Ritter“ wirken in prunkvollem Aufzug und folgen eigensüchtigen Motiven. In einer Werbeschrift für die „Tempel-Ordensritter“ sagt der heilige Bernhard: „An erster Stelle stehen Disziplin und uneingeschränkter Gehorsam. Jeder kommt und geht, wie es der Vorgesetzte befiehlt. Jeder trägt die ihm zugeteilte Kleidung, keiner besorgt sich Nahrung oder Kleidung nach seinem Gutdünken. Hinsichtlich Ernährung und Gewandung gibt man sich mit dem Notwendigsten zufrieden und meidet alles Überflüssige. Die Templer leben maßvoll und fröhlich in einer Gemeinschaft, ohne Frauen und Kinder. Um der apostolischen Lebensweise möglichst nahe zu kommen, leben sie alle unter gleichen Bedingungen im gleichen Haus, auch nennen sie nichts ihr eigen, um einer einheitlichen Gesinnung und eines friedlichen Zusammenlebens willen. Ungebührliche Reden, nutzlose Beschäftigung, lautes Gelächter, heimliches Tuscheln und selbst unterdrücktes Kichern sind unbekannt. Sie verabscheuen Schach und Würfelspiel; sie hassen die Jagd, ja, sie erfreuen sich nicht einmal am Flug des Falken. Sie verachten Komödianten, Taschenspieler, Schwätzer und zweideutige Lieder sowie Vorstellungen von Possenreißern, denn sie erachten das alles als sinnlose, nichtige Torheiten. Sie tragen das Haar kurz geschnitten, weil es ihrer Ansicht nach beschämend für einen Mann ist, langes Haar zu haben. Niemals übertrieben gekleidet, baden sie selten; sie sind schmutzig und behaart, und ihre Haut erscheint gebräunt vom Tragen des Kettenhemds und von der Sonne“. Die „Glaubenskrieger“ sollen in die „Schlachten Gottes“ ziehen. Und sollte ein „Templer“ dabei sein Leben verlieren, so stirbt er „selig“ als „Blutzeuge“ für den „christlichen Glauben“. In der Werbeschrift Bernhards liest sich das so: „Freue dich, starker Kämpfer, wenn du in dem Herrn lebst und siegst! Aber noch mehr frohlocke und rühme dich, wenn du stirbst und dich mit dem Herrn vereinst“. Die Gegner der „Glaubenskrieger“ sind ja „nur“ Heiden ohne Glauben.
Um 1132 - Der Krieg ist nicht mit dem „Neuen Testament“ in Einklang zu bringen
Clairvaux * Dass sich kriegerische Auseinandersetzungen nur schwer mit dem Wort und Sinn des „Neuen Testaments“ in Einklang bringen lassen, bekümmert den Ordensmann, Mystiker und Prediger Bernhard von Clairvaux nur wenig.
Mit welchen rhetorischen Mittel er arbeitet und welche menschenverachtende Argumentation er dabei benutzt, lässt sich anhand eines Zitats aus einer Predigt zeigen, mit der der Heilige für den „Zweiten Kreuzzug“ wirbt: „Wenn sich dein Vater auf die Schwelle legte, wenn deine Mutter die Brust zeigte, die dich genährt, so steige über deinen Vater hinweg, tritt deine Mutter mit Füßen und folge trockenen Auges dem Kreuzbanner nach. Hier für Christus grausam sein ist die höchste Stufe der Seligkeit“.
Denn, so Bernhard weiter: „Ein Ritter Christi tötet mit gutem Gewissen; noch ruhiger stirbt er. Wenn er stirbt, nützt er sich selbst, wenn er tötet, nützt er Christus“. Wer aber so argumentiert, wem man „Honigsüße“ nachsagt, weil er eine ideologische Grundlage für einen „Gerechten und Heiligen Krieg“ und eine Argumentationskette schafft, die aus einem „Angriffskrieg“ einen „Verteidigungskrieg“ macht, der ist wirklich ein „komischer Heiliger“.
1135 - Papst Innocenz II. unterstützt die „Tempel-Ordensritter“
Rom-Vatikan * Papst Innozenz II., ein ehemaliger „Zisterziensermönch“ und Schüler von Bernhard von Clairvaux, treibt die Gründung von „Bruderschaften“ zur finanziellen Unterstützung der „Templer“ voran.
24. 5 1136 - Überarbeitung der Statuten für die Tempelherren
Frankreich * Spätestens seit dem Tod Hugo von Payns und der zwischenzeitlich erfolgten explosionsartigen Ausbreitung der jungen Ordensgemeinschaft der Tempelherren ist eine Überarbeitung der Statuten notwendig geworden.
1139 - Die „Tempel-Rittern“ erhalten eine umfangreiche „Ordensregel“
Rom-Vatikan * In der Bulle „Omne datum optimum“ gibt Papst Innozenz II. den „Tempel-Rittern“ eine umfangreiche „Ordensregel“, die mit Ergänzungen im Jahr 1230 und 1260 auf insgesamt 678 Artikel anwachsen wird.
Durch die „päpstliche Bulle“ werden die „Tempelherren“ als „extemt“ erklärt, also aus dem kirchlichen Gesamtorganismus heraus genommen.
Sie sind damit die erste Gemeinschaft von „Rittermönchen“, die jeglicher „bischöflicher Jurisdiktion“ entnommen und alleine und direkt dem „Heiligen Stuhl“ unterstellt sind.
Er erklärt die „Templer“ auch zu „Vorkämpfer der Christenheit“ und hebt sie damit über alle anderen „Orden“.
Dadurch nehmen die „Templer“ in der Gesamtkirche eine elitäre Ausnahmestellung ein, die von den Folgepäpsten fortgeschrieben und durch eine Vielzahl von „Privilegien“ erhärtet wird.
So darf kein Kirchenmann oder Laie, lediglich der „Templer-Meister“ mit Zustimmung des „Kapitels“, die „Ordens-Statuten“ ändern.
Das Recht der „Tempel-Ritter“ eigene „Priester“ zu haben, wird in der „Bulle“ ebenso festgeschrieben wie die „Freistellung vom Zehent“.
Die „Templer-Kapläne“ sind berechtigt „Spenden“ zu sammeln, um „Almosen“ zu bitten und einmal im Jahr in jeder Kirche die „Kollekte“ für sich zu behalten.
Einmal jährlich dürfen sie in den unter „Interdikt“, dem „Verbot gottesdienstlicher Handlungen“, gestellten Regionen die „Messe“ halten.
Die Kirche macht - nicht nur aus Sicht der „Templer“ - viel zu viel Gebrauch von dieser Strafmaßnahme, die darauf abzielt, jede religiöse Aktivität, ob das nun Messen oder die Segnungen der Sakramente sind, in einer Ortschaft, einer Region oder einem ganzen Königreich zeitweilig zu verbieten. Damit wollen die Kirchenmänner die Sünden eines Herren, einer Gemeinde oder eines Königs bestrafen.
Gottesdienste, die in solchen vernachlässigten und teilweise auch vollkommen ungerechtfertigt bestraften Regionen abgehalten werden, ziehen freilich viele Gläubige an und bringen schon deshalb außergewöhnlich hohe Einnahmen von „Almosen und Opfergaben“.
Darüber hinaus dürfen die „Tempelherren“ eigene „Kirchen und Friedhöfe“ besitzen, worin sie auch „Exkommunizierte“ beerdigen können, was ihnen häufig großzügigst gedankt wird.
Schließlich ergänzt Papst Coelestin II. die „Privilegien der Templer“ indem er die „Ritter-Brüder“, ihre „Vasallen“ und „Grundholden“ von den durch die Bischöfe ausgesprochenen „Exkommunizierungen“ und „Interdikten“ als ausgeschlossen erklärt.
Dies geschieht sehr zum Ärgernis des „Weltklerus“ und vergiftet das eh schon angespannte Verhältnis zwischen dem „Ritterorden“ und den „Weltpriestern“.
Dennoch hält der „Heilige Stuhl“ beständig seine „schützende Hand“ über die „geistlichen Ordensritter“ und stellt die gewährten „Privilegien“ nie in Frage.
Seit Hugo von Payns den „Tempelherren“ seine Besitzungen schenkte, folgte jeder, der in den „Orden“ eintritt oder sich ihm anschloss, diesem Beispiel.
Durch Schenkungen von Land und Vermögen sind die „Ordensritter“ sehr schnell reich geworden.
Und nachdem heimgekehrte „Kreuzfahrer“ Wunderdinge über das „Heldentum der Templer“ berichten, führt dies in ganz Europa zu einer großzügigen Spendentätigkeit für die Ordensgemeinschaft.
1139 - Papst Innozenz II. erklärt „trennende Ehehindernisse“ für Priester
Rom-Vatikan * Papst Innozenz II. erklärt die „Spende der Weihen“ zu einem „trennenden Ehehindernis“.
Damit können verheiratete Männer nur noch dann zu Priestern geweiht werden, wenn sie ihre Frau durch Ablegung eines „Keuschheitsgelübdes“ freigibt.
Für die Erlangung der „Bischofswürde“ ist sogar der Eintritt der Ehefrau in ein Kloster Voraussetzung.
1140 - Das umfangreiche Imperium der „Tempel-Ordensritter“
Paris * Die „Templer“ besitzen ausgedehnte Ländereien in Frankreich, England, Schottland, Spanien, Portugal, Flandern, Italien, im Deutschen Reich, Ungarn und in der Levante.
Geschenkt wird ihnen vor allem für die „Ablösung von Sünden“ sowie das „Seelenheil“ des Spenders und seiner Angehörigen.
Durch Tausch, Verkauf und Erwerb optimieren die „Templer“ die Ertragslage ihrer „Schenkungen“ zu wirtschaftlich lukrativen Gebilden.
Da ihre Besitzungen hohe Renditen erwirtschaften, fließen dem „Ritterorden“ daraus reichliches Einkommen zu.
Viele ihrer landwirtschaftlichen Gründe haben sie verpachtet.
Nur wenn sich die Ertragslage der Böden wirklich rentiert, dann bearbeiten sie diese auch in „Eigenbewirtschaftung“.
Dafür holen sie sich eigens qualifizierte Spezialisten.
In Spanien und auf den Balearen beschäftigen die „Tempelherren“ dafür sogar geschickte „Muslime“.
Durch ihren Kontakt zur jüdischen und islamischen Welt sind die „Tempelherren“ recht weltoffen und für neue Wissenschaften und Ideen empfänglich geworden.
Der „Orden“ besitzt die „fortschrittlichste Technologie“ der Zeit: im Bereich der „Landwirtschaft“, des „Vermessungswesens“, des „Straßenbaus“ und der „Schifffahrt“.
Die „Templer“ veranlassen die „Bewässerung des Rio-Cinca-Tales“ in Aragón, den Bau eines Mühlensystems an der Aude und die Einführung des vierjährigen Fruchtwechsels in der Normandie.
Mit „Mühlen“ lässt sich ebenso viel Geld verdienen wie mit dem „Weinanbau“ in Portugal.
Der Wein wird bis nach England verkauft.
Auch die „Templer-Schiffe“ bringen einen erheblichen Gewinn.
Den „Ordensrittern“ gehören eigene Häfen, Werften und Schiffe.
Sie sind die Ersten in Europa, die mit einem Magnetkompass ausgestattet sind.
Selbst die der europäischen weit überlegene arabische Medizin ist den „Templern“ nicht fremd.
In den Krankenhäusern des „Ordens“ kommen moderne Prinzipien wie „Hygiene“ und „Sauberkeit“ zum Tragen und sogar das Wissen um die „antibiotische Wirkung von bestimmten Pilzen“ ist vorhanden.
Die „Tempelherren“ sind also keineswegs reine „Haudraufs“.
Neben ihren kriegerischen, politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten betreiben sie auch noch Geldgeschäfte.
Sie sind die einzigen Christen, die aufgrund eines weiteren päpstlichen Privilegs Geld gegen Zinsen verleihen dürfen.
Dadurch können sie einen gewaltigen Reichtum anhäufen.
Und da, um seine Wertgegenstände aufzubewahren, nichts so sicher und unverletzlich ist wie ein „gottgeweihtes Haus“ und nichts mehr Vertrauen erweckt als die „Templer-Burgen“, die von hohen Mauern geschützt, von „Ritter-Mönchen“ verteidigt vor jedem Angriff sicher scheinen, dienen diese bald als Tresore für Kostbarkeiten von weltlichen und geistlichen Herren.
Sie werden zu „Depots“ für Wertgegenstände, Schmuck und Geld, die den Grundstock des immer noch gesuchten „Templerschatzes“ bilden.
Die „Templer“ verwalten die „Depots“ ihrer Kunden, die damit über ein „laufendes Konto“ verfügen.
Sie können Geld abheben, Zahlungen durch einen simplen Brief an den „Schatzmeister“ entrichten und erhalten darüber hinaus drei Mal jährlich einen „Kontoauszug“ zugeschickt.
Zu jedem trogähnlichen Geldschrank gibt es, ähnlich wie bei den heutigen „Bankschließfächern“, zwei verschiedene Schlüssel.
Je einen für den „Hüter der kirchlichen Kostbarkeiten“ und dem „Depotinhaber“.
Bis auf wenige Ausnahmen sind die Depots der „Templer“ absolut sicher, da geldgierige Herrscher nur ganz selten ihre Finger nach ihnen ausstrecken.
So können sich die Niederlassungen der „Templer“ in Europa und im Nahen Osten zu „Zentren des Finanzwesens“ entwickeln und das „Pariser Ordenshaus“, der „Temple“, zum „europäischen Finanzzentrum“.
Der König von Frankreich vertraut beispielsweise im 13. Jahrhundert seine „Kronjuwelen“ der Obhut der „Pariser Templer“ an.
Die Finanzspezialisten der „Tempelherren“ führen bald fortschrittliche Techniken im „Kreditwesen“ und in der „Buchführung“ ein.
Sie entwickeln den „bargeldlosen Zahlungsverkehr“ und führen den „Wechselbrief“ und den „Scheck“ in Europa ein.
Wer also in einem „Ordenshaus“ eine Summe einzahlt, kann sie nach Vorlage der „Kassenanweisung“ in einer weit entfernten „Komturei“ wieder in Empfang nehmen.
Der „Orden“ kassiert dafür lediglich Gebühren und verdient an den Zinsen.
Doch wird dadurch der risikoreiche Transfer von Münzgeld fast völlig entbehrlich.
Neben der einfachen Vermögensverwaltung für Dritte betreibt der „Templer-Orden“ auch „Geldleihe“, wodurch er die eigenen Gelder und die ihnen durch Dritte anvertrauten Einlagen arbeiten lässt.
Alle „Klöster“ und „Konvente“ fungieren deshalb als „Leihkasse“.
An Bauern verleihen die „Templer“ kleinere Summen, damit diese einen Engpass überbrücken können, Kaufleuten geben sie größere Kredite.
Als Sicherheit ziehen sie Grundbesitz heran.
Gibt es bei der Rückzahlung des Kredits Probleme, dann halten sie sich an den Ländereien des „Schuldners“ schadlos.
Zwar passen die Finanzaktivitäten des „Templer-Ordens“ nicht zu ihrer religiösen Berufung, es ist aber die allgemein den „Ritterorden“ aufgetragene Mission, die sie auch in diesem Bereich tätig werden lassen.
Auch die „Johanniter“, der „Deutsche Orden“ und selbst die traditionellen „Mönchsorden“ betätigen sich ähnlich, allerdings auf einer wesentlich niedrigeren Stufe.
Um im Orient überleben zu können, muss der „Templer-Orden“ über umfangreiche Finanzmittel verfügen und all seine Einkünfte weitestgehend in Geld verwandeln.
Sie kaufen dazu auf Märkten und Messen möglichst viele Rechte und Monopole, die ihnen wiederum Einnahmen sichern.
So wird zum Beispiel das ausschließliche „Wiegerecht“, das der „Orden“ vom Grafen der Champagne erwirbt, sehr zu Ungunsten der dort ansässigen Bürger vereinnahmt.
Von dem eingenommenen und erwirtschafteten Verdienst gehen anfangs ein Drittel an die Häuser im Orient. Später werden die Abgaben auf ein Zehntel reduziert.
Aus abendländischer Sicht entsteht immer wieder der Eindruck, als hätten die Männer und Frauen aus dem Westen die Kultur in den „Nahen Osten“ gebracht.
Genau das Gegenteil ist richtig.
Die arabischen Reiche sind den Christen nicht nur militärisch, sondern auch in ihrer Kultur weit überlegen.
Dort im Osten ist das geistige Erbe der Griechen und Römer bewahrt und weiterentwickelt worden.
Geniale Mathematiker und Astronomen sowie geschickte Kaufleute kommen von dort her.
Die Araber haben ein Zahlensystem entwickelt: die arabischen Ziffern, die wir heute noch verwenden.
Eine der wesentlichen Neuerungen besteht darin, dass es für „nichts“ ein eigenes Zeichen gibt: die „Null“.
Diese macht das Multiplizieren und das Bruchrechnen viel einfacher und erlaubt die einprägsame Darstellung des „Dezimalsystems“.
Und genau dieses System lernen die Christen, allen voran die „Tempelherren“, zur Zeit der „Kreuzzüge“ kennen.
Die „arabischen Ziffern“ ersetzen die bisher üblichen „römischen“.
Da die Kaufleute nun einfacher rechnen können, rechnen sie auch besser und erhalten damit ein genaueres Bild über den Verlauf ihrer Geschäfte.
3. 5 1140 - König Konrad III. verleiht dem Freisinger Bischof Otto I. viele Rechte
Freising * Der „Stauferkönig“ Konrad III. verleiht dem Freisinger Bischof in einer Urkunde das Privileg, wonach
- im gesamten Bistum die „Münzstätten“ bischöflich sein müssen,
- der Stadt Freising ein „vollberechtigter Fernhandelsmarkt“ für Salz und andere Großgüter gewährt wird und
- gleichzeitig die Errichtung weiterer „Fernhandelsmärkte“ im Bistum ohne königliche Legitimation ausdrücklich verboten wird.
Bischof Otto I. von Freising, aus dem Geschlecht der Babenberger, will den Raum seines „Bistums“ alleine seinen Interessen unterordnen.
Die monopolistische Politik des „Kirchenfürsten“ richtet sich zunächst gegen den amtierenden Herzog, das war Ottos eigener Bruder Leopold IV., aber auch gegen alle künftig regierenden Herzöge.
In der Folge verlegt der Kirchenfürst das „Freisinger Marktrecht“ kurzerhand an das wesentlich verkehrsgünstiger gelegene Föhring.
Damit maßt er sich ein ihm nicht zustehendes „königliches Privileg“ an.
Dieser Flussübergang stellt jedoch für den geschäftstüchtigen „Freisinger Bischof“ eine sichere, lukrative, aber auch kostengünstige Einnahmequelle dar, da die zum Salz- und Warentransport benutzten „Saumpferde“ zuvor lange Zeit auf den herzoglichen Straßen unterwegs sind, um nur kurz vor der Isarbrücke auf „Freisinger Gebiet“ zu wechseln und es danach ebenso schnell wieder zu verlassen.
Dazwischen kassieren die „bischöflichen Zöllner“.
Außerdem lässt Bischof Otto I. hier eine „Salzniederlage“ und „Zollstätte“ errichten, mit der er sich den ganzen „Handel mit Salz“ zinsbar macht, und das, obwohl es für Föhring gar keine „Marktverleihungsurkunde“ gibt.
Der Markt in Föhring beruht nur auf dem „Herkommen“, also auf einem „Gewohnheitsrecht“.
18. 10 1141 - Herzog Leopold IV. stirbt überraschend ohne eigene Kinder
Niederaltaich * Herzog Leopold IV. stirbt in Niederaltaich überraschend ohne eigene Kinder.
1143 - Heinrich XI. „Jasomirgott“ wird Herzog von Baiern
Regensburg * Heinrich XI. „Jasomirgott“, der Bruder von Herzog Leopold IV., wird Herzog von Baiern und Markgraf von Österreich.
Er residiert in Regensburg, der damaligen Hauptstadt Baierns.
1144 - Die Blütezeit der Alchemie beginnt in Europa
Europa * Ab dem 12. Jahrhundert beginnt die Blütezeit der Alchemie auch im christlichen Abendland. Die europäischen Alchemisten übernehmen das über den jüdisch-muslimischen Kulturkreis entwickelte Wissen und lassen sich vom abwägend-kritischen Denken ihrer orientalischen Kollegen inspirieren.
Bedeutende arabische Alchemiebücher werden ins Lateinische übersetzt. Das erste ist das „Buch über die alchemischen Mischungen“ aus dem Jahr 1144. Dadurch kann sich die Alchemie zu einer weit verbreiteten Form früher Naturwissenschaft entwickeln. Dabei ist die neue Sicht auf die Natur wesentlich, die bis dahin - wenn überhaupt - lediglich als Beiwerk der auf den Menschen konzentrierten Schöpfung aufgefasst wird.
25. 12 1144 - Beginn des Niedergangs des Templer-Ritterordens
Edessa * Dem kometenhaften Aufstieg der Templer im Osten und der erfolgreichen Tätigkeit im Westen folgt ein langsamer, sich immer mehr beschleunigender Niedergang des Ritterordens. Er beginnt am Weihnachtsabend des Jahres 1144, als der islamische Herrscher von Aleppo und Mosul, Imad al-Din Zengi, Edessa erobert. 278 Templer fallen während der Kampfhandlungen.
In der islamischen Welt wird die Eroberung Edessas als Triumph im Glaubenskrieg gefeiert. Immerhin war die Stadt seit dem Jahr 1098 in den Händen der Lateinischen Christen.
12 1145 - Papst Eugenius III. ruft den zweiten „Kreuzzug“ aus
Rom-Vatikan * Papst Eugenius III. ruft einen „Kreuzzug“, den „Zweiten“, aus.
Frühjahr 1146 - Der „Reichslandfrieden“ aus dem Jahr 1103 hält
Deutschland * Der „Reichslandfrieden“ aus dem Jahr 1103 hält, als ein Heer fanatischer „Kreuzfahrer“ aus Frankreich in Deutschland einfällt und der Mönch Rudolf aus dem Kloster Clairvaux bedingungslosen Hass gegen die „Juden“ predigt.
Der damalige deutsche König Konrad III. nimmt sein „Schutzversprechen“ ernst und rettet die meisten „Juden“.
3 1146 - Papst Eugenius III. erlässt eine „Kreuzzugbulle“
Rom-Vatikan * Papst Eugenius III. erlässt eine päpstliche „Kreuzzugbulle“, in der er die „Privilegien für die Kreuzfahrer“ festlegt:
- die „Vergebung der Sünden“,
- den „Schutz für Eigentum und Angehörige“ und
- einen „Zinserlass“.
Zum „Hauptprediger des Kreuzzugs“ beruft er Bernhard von Clairvaux.
4 1146 - Bernhard von Clairvaux wirbt für die Teilnahme am „Kriegszug“
Vézelay * Bernhard von Clairvaux wirbt an Ostern für die Teilnahme am „Kriegszug“.
Vor der Stadt Vézelay er auf einem freien Feld, wo sich Tausende von Menschen einfinden: hoher und niedriger Adel, Kleriker, Söldner und viele, die der himmlische Lohn lockt, oder die normalen Zugewinne im Krieg, oder beides.
Der „Zisterzienser-Abt“ predigt: „Du tapferer Ritter, du Mann des Krieges, jetzt hast du eine Fehde ohne Gefahr, wo der Sieg Ruhm bringt und der Tod Gewinn“. Bernhard von Clairvaux wendet sich auch an die Kriminellen und fordert sie zur „Kreuzfahrt“ auf: „Ist es denn nicht eine ausgesuchte und allein für Gott auffindbare Gelegenheit, dass der Allmächtige Mörder, Räuber, Ehebrecher, Meineidige und mit anderen Verbrechen Belastete in seinen Dienst ruft. [...] Misstraut nicht, Sünder, der Herr ist bei euch!“
Und weiter: „Selige nenne ich die Generation, die den Zeitpunkt derart reichlicher Vergebung ergreift und dieses wahrhafte Jubeljahr lebend angetroffen hat. [...] Gürtet euch mannhaft und ergreift im Eifer für den christlichen Namen die Glück bringenden Waffen“.
Die versammelte Menge ist derart begeistert, dass sie die Teilnahme an dem „Kreuzzug“ gelobt und Bernhard, um genügend Stoffkreuze für die Gewänder der „Kreuzfahrer“ zur Verfügung zu haben, seine Kleider zerreißen muss.
Die „Kreuzzug-Ideologie“ ist inzwischen auf die verschiedensten Schauplätze christlicher Kriegsführung übertragbar gemacht worden. Deshalb soll der „Zweite Kreuzzug“ nicht nur mehr im „Nahen Osten“, sondern gleichzeitig an zwei weiteren Fronten stattfinden: gegen die „Mauren“ in Spanien und gegen die heidnischen „Wenden“ im Norden Deutschlands.
1147 - Das rote und typische „Tatzenkreuz“ der „Tempel-Ordensritter“
Rom-Vatikan * Das rote und typische „Tatzenkreuz“ der „Tempel-Ordensritter“ kommt auf den weißen Umhang.
Es wird ihnen von dem, dem „Ritterorden“ nahestehenden „Zisterzienser-Papst“ Eugen III. verliehen. Die rote Farbe soll an den „Opfertod Christi“ erinnern und die „Bereitschaft zum Martyrium für den Glauben“ symbolisieren.
Ein weiteres wichtiges Erkennungszeichen ist deren „Siegel“. Es zeigt eine Darstellung von zwei Rittern auf einem Pferd und wird inzwischen als „Symbol der Brüderlichkeit“, des „guten Einvernehmens“, der „Harmonie“ und der „Disziplin“, die im „Orden“ herrschen soll, angesehen.
Ebenso symbolträchtig ist der Artikel „Über die Näpfe und Becher“ in der „Templer-Regel“. Dieser besagt: „Was die Näpfe angeht, so sollen sie jeweils für zwei Brüder verteilt werden, damit ihn sich jeder vom anderen besorge; sie sollen das Leben in der Enthaltsamkeit und im Brauch des gemeinsamen Essens schätzen lernen“.
Es geht hierbei nicht um das Essen aus einem Napf, sondern um das gemeinschaftliche Leben im „Konvent“.
Um 3 1147 - Der Krieg gegen die „Mauren“ wird einem „Kreuzzug“ gleichgestellt
Rom-Vatikan - Spanien * Papst Eugenius stellt den „Feldzug“, den König Alfons VII. von Kastilien gegen die „Mauren“ in Spanien führt, einem „Kreuzzug“ gleich.
10 1147 - Angriffe auf die heidnischen „Wenden“ werden als „Kreuzzug“ betrachtet
Clairvaux * Bernhard von Clairvaux gibt den norddeutschen Fürsten die Erlaubnis, ihre Angriffe auf die heidnischen „Wenden“ als „Kreuzzug“ zu betrachten.
Um 10 1147 - Französische und deutsche Heere erreichen Konstantinopel
Naher Osten * Die zwei in den Orient ziehenden Hauptheere bilden die unter der Führung ihres Königs Ludwig VII. stehenden Franzosen und den Deutschen unter dem „Stauferkönig“ Konrad III..
Beide Heere ziehen in engen räumlichen und zeitlichen Abständen durch Europa und erreichen Konstantinopel. Weitere „Kreuzfahrer“ aus den verschiedensten europäischen Regionen kommen per Schiff ins „Heilige Land“. Sie alle haben nur ein Ziel: die "Rückeroberung von Edessa".
Doch der „Zweite Kreuzzug“ wird sich als völliger Fehlschlag erweisen und in einem demoralisierenden Rückzug enden. Der Kriegsverlauf ließ die „Kreuzfahrer“ resignieren. Erst die „Tempel-Ritter“ stellen die Disziplin wieder her. Dennoch geben die „Glaubenskrieger“ ihr ursprünglich gefasstes Ziel, die „Eroberung Edessas“, wieder auf und greifen stattdessen Damaskus an.
7 1148 - Dank der „Templer“ endet der „Kreuzzug“ nicht in einem Desaster
Damaskus * Die „Kreuzfahrer“ können zwar die Obstgärten von Damaskus erobern, stoßen aber auf heftigen Widerstand und verlegen deshalb ihre Truppen in den Osten der Stadt.
Doch dieses Gebiet war eine offene Ebene, die weder Schutz noch Wasser bot, sodass die christlichen Kampftruppen schließlich zum Rückzug gezwungen waren. Die „Templer“ erwerben sich durch ihre Teilnahme am „Zweiten Kreuzzug“ den Ruf „fanatischer Kämpfer von großem Mut“, „äußerster Disziplin“, aber auch von „außerordentlicher Überheblichkeit“.
Frankreichs König Ludwig VII. berichtet, dass es nur den „Tempelherren“ zu verdanken sei, dass der falsch geplante und schlecht geführte „Kreuzzug“ nicht in einem Desaster endete.
Es folgen wechselseitige Beschuldigungen, die das Verhältnis zwischen dem „Abendland“ und den „Kreuzfahrerstaaten“ auf Jahre hin vergiften. Und die Akteure des „Zweiten Kreuzzuges“ beschönigen die Geschichte, indem sie eisern die „Schmach“ verschweigen oder schön reden.
Die Kritiker, die den Tod von vielen Tausenden als sinnlose Opfer bezeichnen, werden immer lauter. Bernhard von Clairvaux, der in seinen „Kreuzzug-Predigten“ sagte: „Im Tod des Heiden sucht der Christ seinen Ruhm, weil Christus verherrlicht wird“, erklärt jetzt, dass das Desaster durch die „Sünden der Pilger“ verursacht worden ist und dass Gott deshalb den „Kreuzfahrern“ seinen Segen entzogen habe. Bischof Otto von Freising, ein Bruder des „Stauferkönigs“ Konrad III. und selbst aktiver Teilnehmer am „Zweiten Kreuzzug“, räumt zwar den Misserfolg des Unternehmens ein, versucht aber zumindest einen kleinen Gewinn zu erkennen, wenn er den Kritikern entgegnet: „Wenn [...] unser Feldzug nicht gut war zur Ausweitung unserer Grenzen, noch für die Wohlfahrt unseres Leibes, so war er dennoch gut für das Heil vieler Seelen“.
Bernhard von Clairvaux ist von der Kritik an seiner Person schwer enttäuscht, weshalb er sich gegenüber Papst Eugenius III. ausführlich rechtfertigt und dabei jede Schuld von sich weist: „Wir eilten nicht dorthin wie ins Ungewisse, sondern auf Deinen, ja durch Dich auf Gottes Befehl“. Der „Zisterzienser-Abt“ lässt sich schließlich in Chartres erneut zum Anführer eines „Kreuzzuges“ wählen, doch der Papst will nach den gemachten leidigen Erfahrungen diesen Plan erst fördern, wenn die Aussicht auf Erfolg auch gesichert ist.
1153 - Den „Templern“ kommt die Schlüsselrolle bei der Eroberung von Askalon zu
Askalon * Den „Templern“ kommt die Schlüsselrolle bei der Eroberung von Askalon zu.
Vierzig „Tempelritter“ werden dabei getötet, die Stadt aber erobert.
20. 4 1153 - Bernhard von Clairvaux stirbt
<p><strong><em>Clairvaux bei Lyon</em></strong> * Bernhard von Clairvaux, der Chefideologe der Templer und des Ordens der Zisterzienser, stirbt, ohne einen weiteren Kreuzzug in die Wege geleitet zu haben. Dennoch hat mindestens eine seiner Parolen für die kommenden Generationen von Kreuzfahrern über viele Jahrhunderte hinweg Bestand.</p> <ul> <li>Diese lautet: <em>„Vollständige Ausrottung der Heiden oder sichere Bekehrung“</em>. Vor diese Alternative - <em>„Tod oder Taufe“</em> - stellen die Kolonisatoren die Bevölkerung der von ihnen eroberten Kontinente. </li> </ul> <p>Der Verfasser dieser Ideologie wird nur einundzwanzig Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen.</p>
6 1154 - Herzog Heinrich „der Löwe“ erhält das Herzogtum Baiern zuerkannt
Goslar * Auf dem „Reichstag in Goslar“ erhält Herzog Heinrich „der Löwe“ von Kaiser Friedrich Barbarossa das Herzogtum Baiern zuerkannt.
Es wird aber noch bis zum 8. September 1156 dauern, bis der Babenberger-Herzog Heinrich XI. „Jasomirgott“ offiziell auf das Herzogtum verzichtet.
6. 4 1156 - Kaiser Friedrich Barbarossa erklärt alle Zölle am Main für aufgehoben
<p><strong><em>Worms</em></strong> * In Worms erklärt Kaiser Friedrich Barbarossa in einer Urkunde alle Zölle am Main - bis auf wenige Ausnahmen - für aufgehoben. Fernhändler hatten sich bei ihm beschwert, dass sie zwischen Bamberg und Mainz allzu oft von regionalen Herrschern zur Kasse gebeten würden. Die Anmaßung königlicher Befugnisse durch die Fürsten widerspricht aber den politischen Zielen Kaiser Friedrich Barbarossas, weshalb er diesen Missbrauch eindämmen will.</p> <p>Der Kaiser setzt den Grundherren daraufhin eine Frist, binnen der sie die Berechtigung dieser Zollerhebungen anhand königlicher Privilegien nachzuweisen haben. Nur die wenigsten Betroffenen können den geforderten Nachweis erbringen. </p> <p>Gut vorstellbar, dass sich vor diesem Hintergrund auch ein heftiger Streit über die bischöflichen Einnahmen aus dem Zoll, dem Markt, der Münze und der Isarbrücke in Föhring entzündet hat. <br /> Man muss davon ausgehen, dass Herzog Heinrich XII. „der Löwe“ die unsicheren Rechtsgrundlagen des Freisinger Bischofs Otto I. über seine selbstherrlich geschaffenen Einrichtungen bewusst sind.</p> <p>Außer den Ansprüchen der beiden Kontrahenten spielt dabei natürlich auch das machtpolitische Interesse des Kaisers mit. Dieser tritt zwar vordergründig als unparteiischer Richter oder Schlichter auf, kann aber im Hintergrund agierend so seine Interessen und Ziele dennoch verwirklichen. Der Herzog und der Kaiser ziehen also am gleichen Ende des Seiles.</p>
8. 9 1156 - Herzog Heinrich XII. der Löwe erhält das Herzogtum Baiern
Konstanz * Der 26-jährige Welfenherzog Herzog Heinrich XII. der Löwe erhält von seinem Cousin Kaiser Friedrich I. Barbarossa das Herzogtum Baiern übertragen. Der Herzog verfügt damit aber nicht über ein in sich geschlossenes Areal, sondern muss auf seinem Herrschaftsgebiet unter anderem eine bischöfliche Enklave tolerieren, zu der neben dem Freisinger Dombezirk auch die Brücke in Föhring gehört. Zwei wichtige ehemalige Römerstraßen durchziehen das Herzogtum Baiern von Ost nach West, um sich bei Augsburg zu vereinen:
- Die von Salzburg kommende Straße überschreitet die Isar bei Grünwald, wobei der beschwerliche Übergang bereits gegen Ende des ersten Jahrtausends aufgegeben worden ist.
- Der andere, der von Wien über Wels kommende Verkehrsweg, überquert die Isar bei Föhring und zieht dadurch den gesamten Fernhandelsverkehr auf sich. Dieser Isarübergang liegt also auf dem Gebiet des Freisinger Bischofs Otto I., dem Onkel Kaiser Friedrich Barbarossas.
Um 1157 - Die „Salzstraße“ wird nach „Munichen“ umgeleitet
München - Haidhausen * Im Jahr 1157 - zuvor und danach war Herzog Heinrich XII. „der Löwe“ nicht in Baiern - wird die „Salzstraße“ nach „Munichen“ umgeleitet.
Die „Salzstraße“ muss man sich als „Trampelpfad“ vorstellen, denn der Lastentransport erfolgt noch nicht mit Fuhrwerken oder Karren, sondern mit „Saumpferden“.
Sie führt noch nicht über den „Gasteig“ (= gacher Steig = steiler Weg) hinunter zur Isar, sondern nutzt eine „Fuhrt“ etwa auf der Höhe der heutigen „Maximiliansbrücke“.
Dass der Welfenherzog ein elementares Interesse an der Aufhebung des unrechtmäßig in Föhring eingerichteten bischöflichen „Fernhandelsmarktes“ hat, ist naheliegend, da er der größte Nutznießer dieser Entscheidung ist.
Und der Freisinger Bischof will nach den Erfahrungen von Worms retten, was noch zu retten ist.
Schon deshalb ziehen die beiden Kontrahenten gemeinsam mit dieser Angelegenheit vor den Kaiser.
14. 6 1158 - Der Augsburger Schied - Münchens Geburtsurkunde
<p><em><strong>Augsburg - München</strong></em> * Ein vergilbtes Pergament im Format 34 × 44 Zentimeter gilt als die Geburtsurkunde der bayerischen Landeshauptstadt. Die von Kaiser Friedrich I. Barbarossa auf dem Reichstag in Augsburg unterzeichnete Urkunde ging als „Augsburger Schied“ in die Geschichte ein. In dem Kaiserdiplom, das als „conventio“ – also als Übereinkunft – bezeichnet wird, werden die Streitpunkte verbindlich geregelt. </p> <p>„Mit Zustimmung und Willen der beiden streitenden Parteien“ wird festgelegt:</p> <ul> <li>Der Markt, der bislang in Föhring abgehalten wurde, ebenso die Zollbrücke und die Münzstätte, werden dort künftig nicht mehr bestehen.</li> <li>Als Ersatz hat Herzog Heinrich der Kirche von Freising ein Drittel des Gesamteinkommens aus seinem Marktzoll zu München übertragen, sei es aus Abgaben für Salz, sei es für andere dort ein- und ausgehende Groß- und Kleinstückwaren. </li> <li>Bezüglich des Zöllners wird vereinbart, dass jede Partei einen eigenen einsetzen kann oder – falls gewünscht – beide gemeinsam einen bestimmen, der beiden verantwortlich ist.</li> <li>Ähnlich verhält es sich mit der Münze: Ein Drittel der Einkünfte erhält der Bischof, zwei Drittel stehen dem Herzog zu. Eine Münzstätte soll nach Ermessen des Herzogs errichtet werden. Zudem darf auch der Bischof von Freising eine eigene Münzstätte gründen, wenn er es wünscht. Von deren Erträgen erhält der Herzog lediglich ein Drittel, das er – unabhängig von dessen Höhe – nach dem Willen des Bischofs als Lehen weitergeben soll, wie es offenbar bereits geschehen ist.</li> </ul> <p>Von einem Unrecht oder gar einer Freveltat des Welfenherzogs findet sich in dieser kaiserlichen Urkunde kein Wort. Als Zeugen für die Richtigkeit des Rechtsspruchs werden vier hohe geistliche Würdenträger und vier weltliche Herrscher benannt. </p> <p>Doch auch wenn die Kaiserurkunde den Charakter einer gütlichen Einigung in sich trägt, so ist sie in ihrem Kern doch ein regalienrechtlicher Spruch des Kaisers. Mit diesem Kompromiss kann Kaiser Friedrich I. Barbarossa einen Interessenausgleich zwischen dem Bischof von Freising und dem baierischen Herzog erzielen und damit beide zufrieden stellen. </p>
15. 6 1158 - Ein Hausbraurecht wird als gesichert angenommen
München * Mit dem Augsburger Schied tritt München am 14. Juni 1158 in die Geschichte ein. Ein gern erzähltes Märchen bezeugt, dass Herzog Heinrich der Löwe am nächsten Tag die Löwenbrauerei gegründet hat.
Für die Zeit der Stadtgründung Münchens ist ein Hausbraurecht als gesichert anzunehmen. Das Brauen gehört - wie das Brotbacken - zu den Pflichten der Hausfrau.
22. 9 1158 - Bischof Otto I. von Freising stirbt
Freising - Citeaux • Der Freisinger Fürstbischof Otto I. stirbt - im Alter von 46 Jahren - auf einer Reise zum Generalkapitel in Citeaux im Zisterzienserkloster Morimund. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird Albert I. von Harthausen.
Nach dem 11. 11 1158 - Unrechtmäßige Verlegung des Marktrechts von Freising nach Föhring
<p><strong><em>Roncaglia</em></strong> * Zwischen dem 11. und 26. November 1158 findet in Roncaglia ein Reichstag statt. Dabei erlässt Kaiser Friedrich Barbarossa ein Gesetz, das jede nicht genehmigte Erhebung von Abgaben untersagt. </p> <p>Darunter fällt freilich auch die unrechtmäßige Verlegung des Marktrechts von Freising nach Föhring durch - den inzwischen verstorbenen - Bischof Otto I.. Auffällig ist dabei die Nähe dieses Gesetzes und der Wormser Urkunde vom 6. April 1156 zum Föhringer Konflikt. </p>
1160 - Hildegard von Bingen beschreibt die Wirkung des Hopfens
Bingen * Hildegard von Bingen beschreibt in ihrem „Buch von den verschiedenen Naturen der Geschöpfe“ die Wirkung des Hopfens.
Scheinbar hält sie nicht allzu viel von dieser Pflanze, attestiert ihr aber, dass sie mit ihrer Bitterkeit „gewisse Fäulnisse von Getränken“ fernhält, „so dass sie umso haltbarer sind“.
1164 - Die „Giesinger Mühle“ wird an das „Kloster Schäftlarn“ geschenkt
Untergiesing * Die „Giesinger Mühle“ wird an das „Prämonstratenser-Kloster Schäftlarn“ geschenkt.
Sie bleibt bis zur „Säkularisation“ - mit kurzen Unterbrechungen - im Eigentum des „Klosters Schäftlarn“, das die Mühle zum „Leibgeding“ verpachtet.
Um 1169 - Herzog Otto I. heiratet in Kelheim (?) die Gräfin Agnes von Loon
Kelheim ? * Der spätere baierische Herzog Otto I. heiratet in Kelheim (?) die Gräfin Agnes von Loon.
1171 - Die „Karmeliter“ erhalten eine Ordensregel
Jerusalem * Nach der im Jahr 1171 vom Patriarchen Albert zu Jerusalem gegeben Ordensregel müssen die „Karmeliter“
- in abgewandten Zellen leben,
- sich abwechselnd bei Tag und in der Nacht mit Handarbeiten und Gebet beschäftigen,
- dürfen nichts Eigenes besitzen,
- niemals Fleisch essen
- und haben zu bestimmten Stunden gänzlich zu schweigen.
Der „Orden der Brüder der Seligen Jungfrau Maria vom Berge Karmel“ ist - neben den „Franziskanern“, „Dominikanern“ und den „Augustiner-Eremiten“ - einer der vier großen Bettelorden der katholischen Kirche.
Die Bezeichnung „Karmelit“ leitet sich von „Karmel“, einer rund fünfzig Kilometer langen, aus dem Meer auf eine Höhe von bis zu 552 Metern aufragende Gebirgskette in Palästina, ab.
„Karmel“ bedeutet „Baumgarten“ und bezieht sich auf den vorhandenen Wasserreichtum, der einen fruchtbaren Bergwald entstehen ließ.
In den zahlreichen Klüften und Höhlen des Bergmassivs siedelten sich bereits im Altertum „Propheten“ an.
Nach der Eroberung Palästinas durch die Kreuzritter ließen sich auf den „heiligen Bergen“ Einsiedler und Mönche nieder, um hier - nach dem Ideal weltabgewandter Askese und in strengster Armut - zu leben.
2 1172 - Herzog Heinrich „der Löwe“ bricht ins „Heilige Land“ auf
Regensburg * Nach einem „Landtag in Regensburg“ bricht Herzog Heinrich „der Löwe“ ins „Heilige Land“ auf.
12 1172 - Herzog Heinrich „der Löwe“ kehrt aus dem „Heiligen Land“ zurück
München * Herzog Heinrich „der Löwe“ kehrt aus dem „Heiligen Land“ wieder zurück und bringt einen Teil der Gebeine des heiligen „Onuphrius“ mit.
23. 12 1173 - Herzog Ludwig I. der Kelheimer wird in Kelheim geboren
Kelheim * Herzog Ludwig I. der Kelheimer wird in Kelheim geboren.
1174 - Bernhard von Clairvaux wird heilig gesprochen
Rom-Vatikan * Bernhard von Clairvaux wird heilig gesprochen.
Um den 1. 2 1176 - Der Bruch zwischen Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen
Chiavenna * Es kommt zum Bruch zwischen Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen, nachdem der Herzog in Chiavenna am Comer See dem Kaiser die militärische Unterstützung für dessen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Lombardei versagt. Denn als Gegenleistung verlangt Herzog Heinrich der Löwe die Kaiserpfalz Goslar und deren reichen Silberminen. Eine Forderung, die der Kaiser strikt ablehnt.
Es kommt angeblich zum Kniefall des Kaisers vor dem mächtigen und uneinsichtigen Herzog - und damit kommt es unausweichlich zum Konflikt. Nun beginnt der Stern des Löwen zu sinken, denn ein kaiserlicher Kniefall gehört zum Zeremoniell der staatlichen Ordnung und gilt zugleich als ein Verfassungselement. Da sich aber der Welfenherzog auch durch diese kaiserliche Geste nicht erweichen lässt, verletzt er die Regeln, was ihm als Überheblichkeit, Hochmut und Verachtung gegenüber dem Reich und dem Kaiser ausgelegt wird.
Um den 3 1176 - Heinrich „der Löwe“ hält sich letztmalig in seinem baierischen Herzogtum auf
München * Im Februar und März 1176 hält sich Herzog Heinrich „der Löwe“ zum letzten Mal seinem baierischen Herzogtum auf.
Denn je rasanter es mit Münchens Wirtschaft aufwärts geht, desto steiler vollzieht sich der Abstieg des „Welfenherzogs“.
Der Grund liegt in der Verweigerung Heinrichs des Löwen an, den Kaiser in seinen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Lombardei zu unterstützen.
29. 5 1176 - In der Schlacht bei Legano werden die kaiserlichen Truppen besieg
Legano * In der Schlacht bei Legano nordwestlich von Mailand werden die kaiserlichen Truppen Friedrich Barbarossas vom lombardischen Fußvolk besiegt. Damit ist Kaiser Friedrich Barbarossas Italienpolitik gescheitert, weshalb er stattliche Besitzungen abgeben muss.
24. 7 1177 - Frieden zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III.
Venedig * In Venedig kommt es zu einem Verständigungsfrieden zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa mit Papst Alexander III..
11 1177 - Die „Tempelherren“ sind am Sieg vor Montgisard beteiligt
Montgisard * An dem Sieg der „Kreuzfahrer“ vor Montgisard sind die „Tempelherren“ beteiligt.
Um 4 1178 - Der „Kölner Fürstbischof“ Philipp überfällt die Stammlande Herzog Heinrichs
Sachsen * Der „Kölner Fürstbischof“ Philipp überfällt mit einem gewaltigen Heer die Stammlande Herzog Heinrichs „des Löwen“.
Da der Herzog zu dieser Zeit gerade einen Kriegszug gegen die „Slawenfürsten“ unternimmt, kommen für ihn und seine Untertanen die Überfälle und Plünderungszüge des „Kölner Fürstbischofs“ völlig überraschend.
11. 11 1178 - Herzog Heinrich erhebt Klage gegen Fürstbischof Philipp von Köln
Speyer * Herzog Heinrich XII. der Löwe erhebt auf dem Hoftag zu Speyer Klage gegen den Fürstbischof Philipp von Köln und andere Fürsten, weil diese ihm Unrecht zugefügt haben.
Der ebenfalls anwesende Kölner Bischof hat zwar mit seiner Gegenklage einen schwachen Stand, doch Kaiser Friedrich Barbarossa greift nicht Herzog Heinrichs, sondern die Klage seiner Gegner auf und setzt zur Behandlung dieser Angelegenheit einen Hoftag in Worms an.
1179 - „Templer“ und „Johanniter“ zu einem Friedensschluss bewegt
Rom-Vatikan * Papst Alexander III. sieht sich veranlasst, die „Templer“ und die „Johanniter“ zu einem Friedensschluss zu bewegen.
13. 1 1179 - Herzog Heinrich der Löwe wird als Angeklagter vorgeladen
Worms * Auf dem Hoftag zu Worms wird der eigentliche Ankläger Herzog Heinrich als Angeklagter vorgeladen. Er ist sich über die gegen ihn eingeleitete Aktion im Klaren und glaubt nicht mehr daran, sein Recht zu erlangen. Die Verweigerung von Chiavenna hat ihn in die Isolierung geführt. Aus den verschiedensten und zum Teil weit zurückliegenden Gründen haben sich der Kaiser, der Kölner Erzbischof sowie viele sächsische Bischöfe und Adelige gegen den Löwen verbündet.
Der Gerichtstag bringt ihnen den ersten Erfolg: Da sich Heinrich weigert zu erscheinen, macht er sich, da er „die Majestät verachtete“, der Rechtsverweigerung, der contumancia, schuldig.
Kaiser Friedrich I. Barbarossa kommt das Nichterscheinen des Herzogs gerade recht, da er sich auf diesem Wormser Hoftag die schwäbischen Welfenbesitzungen, die er nur wenige Wochen zuvor trotz des Erbvertrags zwischen Welf VI. und Heinrich dem Löwen gekauft hatte, formell übertragen lässt.
24. 6 1179 - Heinrich der Löwe kommt nicht zum Hoftag in Magdeburg
Magdeburg * Da der Welfenherzog Heinrich der Löwe auf dem Hoftag in Magdeburg - trotz Ladung - wieder nicht erscheint, verfällt er der Ächtung, die nach Ablauf von einem Jahr das Verfahren mit der Oberacht abschließt.
Mit dem Aussprechen der Oberacht würde der Herzog alle Besitzungen und Lehen verlieren. Würde er sich aber „unterwerfen“, dann wäre der Kaiser berechtigt, ihn wieder in seine Gnade aufzunehmen und teilweise oder vollständig von Neuem in seine Güter und Rechte einzusetzen. Herzog Heinrich hat also ein Jahr Zeit, sein „Unrecht“ wieder gutzumachen.
7 1179 - Das „volksrechtliche Verfahren“ wird mit einem „lehnsrechtlichen“ überlagert
Köln * Unter der Führung des „Fürstbischofs“ Philipp von Köln überlagert die Mehrzahl der Fürsten und Bischöfe das kaiserliche „volksrechtliche Verfahren“ mit einem Zweiten nach der strengen „lehnsrechtlichen Prozessordnung“.
Es geht ihnen dabei nicht um die Beschleunigung der Angelegenheit, sondern darum, dass der Kaiser das Urteil nicht mehr abmildern und die dem Löwen entzogenen Lehen und Ämter am Ende doch wieder an ihn zurückgeben kann.
Gerade Erzbischof Philipp von Köln geht es um diese Rechtssicherheit.
Der von der Kölner Kirche beherrschte westfälische Teil des „Herzogtums Sachsen“ soll nicht wieder gefährdet sein und vor allem vor einer etwaigen Rückgabe an den Herzog geschützt werden.
Deshalb verwundert es nicht, dass es erneut der „Kölner Fürstbischof“ war, der das Verfahren nicht nur konsequent fordert, sondern es auch in Gang bringt.
17. 8 1179 - Herzog Heinrich der Löwe wird drei Mal vorgeladen
Kayna * Nach der strengen „lehnrechtlichen Prozessordnung“ wird Herzog Heinrich der Löwe im Abstand von jeweils sechs Wochen dreimal geladen. Erstmals am 17. August 1179 auf den Hoftag in Kayna, letztmals zum 13. Januar 1180 auf den Hoftag in Würzburg. Herzog Heinrich der Löwe erscheint auf keinem Hoftag.
Um 1180 - Die erste Isarbrücke entsteht
München * Die erste Isarbrücke entsteht.
Der Verlauf der „Salzstraße“ findet sich heute in der „Einstein-“ und in der Fortsetzung in der „Inneren-Wiener-Straße“ wieder.
Beim später entstandenen „Leprosenhaus“ führt sie über den Streckenabschnitt „Am Gasteig“ (= gacher Steig = steiler Weg) mit einem starken Gefälle hinunter zur Isar, die durch mehrere Inseln in viele Flussläufe geteilt ist.
13. 1 1180 - Herzog Heinrich der Löwe verliert alle Reichslehen
Würzburg * Auf dem Hoftag zu Würzburg fällen die Fürsten wegen „Nichterscheinen des Beklagten“ ihr Urteil: Herzog Heinrich werden - noch vor dem Aussprechen der Oberacht - alle Reichslehen abgesprochen und Kaiser Friedrich Barbarossa zur Neuverteilung übertragen. Dieses Urteil kann der Kaiser weder abmildern noch darauf in anderer Form einwirken.
Verfahrenstechnisch entscheidend für den Kölner Erzbischof Philipp ist die Vollstreckung des lehnrechtlichen Urteils noch vor der Verkündigung der volksrechtlichen Oberacht.
13. 4 1180 - Fürstbischof Philipp von Köln hat sein Ziel erreicht
<p><strong><em>Köln</em></strong><em> * </em>Fürstbischof Philipp von Köln hat sein Ziel erreicht: Er erhält den gewünschten westlichen Teil des Herzogtums Sachsen übertragen. Sein Verbündeter, Bernhard aus dem Haus der Askanier, erhält den östlichen Teil.</p>
Um den 28. 6 1180 - Über Heinrich XII. dem Löwen wird die Oberacht verhängt
Regensburg * Kaiser Friedrich Barbarossa verhängt auf dem Reichstag zu Regensburg über den Welfenherzog Heinrich XII. dem Löwen die „Oberacht“. Erstmals wird auch über die Neuvergabe des Herzogtums Baiern beraten.
13. 7 1180 - Kaiser Barbarossa widerruft die Belehnung des Herzogtums Baiern
Regensburg * Auf dem Reichstag zu Regensburg widerruft Kaiser Friedrich Barbarossa die Belehnung des Herzogtums Baiern an Herzog Heinrich dem Löwen. Das Regensburger Urteil, der zweiten für die Gründung Münchens wichtigen Kaiserurkunde, wird vom selben Fürstengremium getroffen, das den Herzog zuvor abgesetzt hat und steht damit natürlich in einem engen Zusammenhang mit der Entmachtung Heinrichs des Löwen.
Erstmals ist darin von der Zerstörung der Brücke und der gewaltsamen Verlegung des Marktes von Föhring die Rede. Die Regensburger Kaiserurkunde bezieht sich allerdings mit keinem Wort auf den Augsburger Schied vom 14. Juni 1158. Dafür heißt es: „Es mögen daher in Gegenwart und Zukunft alle Getreuen des Reiches wissen, dass unser geliebter Albert, Bischof von Freising, vor unserer Majestät erschienen ist und untertänig vor uns Klage geführt hat, dass der Edelmann Heinrich von Braunschweig, vormals Herzog von Baiern und Sachsen, den Markt mit der Brücke in Föhring, den seine Kirche seit uralten Zeiten ungestört in Besitz gehabt hatte, zerstört und ihn gewaltsam in den Ort München verlegt habe“.
Die Darstellung ist knapp und sehr ungenau. Welchen Markt und welche Brücke sollte denn der Löwe zerstört haben? Lautete der erste Punkt des „Augsburger Schieds“ vom 14. Juni 1158 doch: „Der Markt, der bisher zu Föhring abgehalten wurde, die Zollbrücke und die Münze, werden dort künftig nicht mehr bestehen“.
Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt enthält der vierte Absatz des Kaiserdiploms eine regalrechtliche Regelung. Demnach wird dem Freisinger Bischof der Markt und die Zollbrücke übertragen. Wie künftig die Einkünfte der Münze aufgeteilt werden, darüber trifft die Urkunde jedoch keine Aussage.
Um diesen Sachverhalt und die Berechtigung der Klage zu untermauern und eine spätere eventuelle Zurücknahme der Entscheidung zu verhindern, bietet der Freisinger Bischof eine Reihe von hochrangigen Würdenträgern als Zeugen auf.
Damit ist die Rechnung des Klage führenden Bischofs von Freising aufgegangen, indem er sich an das knapp einen Monat zuvor abgeschlossene landrechtliche Verfahren angehängt und gewonnen hat. Er hat in dieser Verfahrensweise die Gelegenheit gesehen, über eine Verurteilung des Welfenherzogs als Friedens- und Rechtsbrecher einen Gewinn für die eigene Kirche herauszuholen. Die Münchner Stadtherrschaft der Freisinger Bischöfe wird bis zum Jahr 1240 andauern.
16. 9 1180 - Herzog Otto I. erhält das restliche Herzogtum Baiern zum Lehen
Altenburg * Auf dem Hoftag zu Altenburg wird die Steiermark vom Herrschaftsgebiet Baiern abgetrennt. Das restliche Kern-Baiern erhält der Wittelsbacher Herzog Otto I. zum Lehen.
Ab 16. 9 1180 - Die Wittelsbacher führen den Adler in ihrem Wappen
München * Die Wittelsbacher führen den Adler als Symbol des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in ihrer Funktion als baierische Pfalzgrafen und als Münchner Gerichtsherren in ihrem Wappen.
11. 11 1181 - Herzog Heinrich der Löwe muss sich dem Kaiser zu Füßen werfen
Erfurt * Herzog Heinrich der Löwe muss sich auf dem Hoftag zu Erfurt den Kaiser zu Füßen werfen und um Gnade bitten. Mit dieser Geste ist die Entmachtung des einst einflussreichen Herzogs vollstreckt. Der Kaiser ist durch das lehnsrechtliche Urteil ohne jede Handlungsmöglichkeit.
Nur noch die Rückgabe des Eigenbesitzes gesteht man dem Ex-Herzog Heinrich dem Löwen unter der Voraussetzung zu, dass dieser sich zu einem Exil am Königshof in London - bei seinem Schwiegervater - bereit erklärt. Die deutschen Fürsten meinen, er soll künftig nicht mehr ihrem Stand angehören.
11. 7 1183 - Herzog Otto I. stirbt in Kelheim
Kelheim * Herzog Otto I. stirbt in Kelheim. Seine Grabstätte befindet sich im Benediktinerkloster Scheyern. Nachfolger auf dem Thron des baierischen Herzogs wird sein Sohn Ludwig I., genannt der Kelheimer.
1184 - Die „Templer“ werden von einer Übermacht besiegt
Nazareth * Die „Templer“ stellen sich mit 150 „Ordensrittern“ bei Nazareth der 7.000 Mann starken Armee des „Sultans“ Saladin in den Weg - und werden aufgerieben.
11. 11 1184 - Der Freisinger Bischof Albert I. von Harthausen stirbt
Freising * Der Freisinger Bischof Albert I. von Harthausen stirbt. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird Otto II. von Berg.
1187 - Jerusalem fällt in die Hände der Muslime
<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Jerusalem fällt in die Hände der Muslime. Das Haupthaus der Tempel-Ordensritter wird daraufhin nach Akkon verlegt.</p> <p>Saladin schlägt das christliche Heer. Er lässt 230 halb tot gefangen genommene Templer hinrichten. Bezogen auf die Tempelherren und die Johanniter meint Saladin:<em> „Ich will die Erde von diesen zwei schändlichen Bruderschaften reinigen, die niemals ihre Feindschaft aufgeben und keinen Dienst als Sklaven leisten.“</em></p> <p>Daraufhin übergeben Die Tempelherren übergeben erstmals ihre Burgen kampflos und zahlen sogar Geld für ihren Abzug.</p>
1191 - Die „Tempelherren“ kaufen Zypern
Zypern * Trotz aller Rückschläge und Niederlagen bleiben die „Tempelherren“ reich, privilegiert und versuchen in immer neuen Vorstößen an einen eigenen „Ordensstaat“ zu kommen.
Anno 1191 kaufen sie König Richard Löwenherz das von diesem eroberte „Zypern“ um 100.000 „Goldbyzantiner“ ab.
Doch die Inselbevölkerung wehrt sich mit einem Aufstand gegen die geplante Herrschaft der „Tempelordens-Ritter“.
So verfügen am Ende die „Johanniter“ und der „Deutsche Orden“ über einen eigenen Staat, nicht aber die „Tempelherren“.
26. 3 1191 - Agnes von Loon, die Ehefrau von Herzog Otto I., stirbt
<p><strong><em>München - Scheyern</em></strong> * Agnes von Loon, die Ehefrau von Herzog Otto I., stirbt. Ihre Grabstätte befindet sich im Benediktinerkloster Scheyern.</p>
1198 - „Sündenablass“ für die Verehelichung mit einer Prostituierten
Rom-Vatikan * Papst Innozenz III. erklärt, dass „alle, die öffentliche Frauen aus dem Bordell führen und sie zu Ehefrauen machen, den Ablass ihrer Sünden erhalten“.
Wohlgemerkt, der Ehemann erhält den „Ablass“, nicht die „Ex-Prostituierte“.
Um das Jahr 1200 - Die Stadtumfassung wird bis zum Kalten- oder Katzenbach erweitert
<p><strong><em>München-Graggenau - München-Angerviertel</em></strong> * Die Stadtumfassung wird bis zum Kalten- oder Katzenbach erweitert. An dieser Stelle befindet sich vorübergehend ein Kaltenbachtor genanntes, isarseitiges Stadttor. </p>
Vor 1202 - Die „Seelhäuser“ haben ihren Ursprung in der „Armenbewegung“
München-Graggenau * Die Münchner „Seelhäuser“ mit ihren kleinen Gemeinschaften der „Seelnonnen“ haben ihren Ursprung in der „Armenbewegung“ und der „religiösen Frauenbewegung“ des Spätmittelalters.
Sie stehen damit in Beziehung zu der weite Teile Europas erfassenden „Beginenbewegung“.
In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hat sich die Lebensform der weiblichen „Beginen“ und der männlichen „Begarden“ rasch in Flandern, Brabant, den nördlichen Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz ausgebreitet.
In einem Bericht aus dem Jahr 1241 heißt es dazu: „Die Anzahl gewisser Frauen, die das Volk Beginen nennt, mehret sich, vor allem in Deutschland, bis zu Tausenden und Abertausenden in unglaublicher Weise; sie geloben und beobachten die Keuschheit und fristen von ihrer Hände Arbeit ein Leben der Zurückgezogenheit“.
Die frühesten zeitgenössischen Berichte über „Beginengemeinschaften“ verweisen auf das „Herzogtum Brabant“, auf die „Diözese Lüttich“.
Als älteste nachweisbare Niederlassung gilt das „Beginenhaus“ von Tirlemont in Brabant.
Es besteht bereits vor dem Jahr 1202.
In die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts fallen die Entstehung der brabantischen „Beginensiedlungen“ von Nivelles [1220] und Herentals [1226] sowie der große „Beginenhof“ von Löwen [1232].
In der „Grafschaft Flandern“ entstehen die „Beginenhöfe“ in Gent [1234], Kortrijk [1238] und Brügge [1245].
Die Hochburgen der „Beginen“ im deutschen Sprachraum sind Großstädte und Bischofssitze wie Köln, Straßburg, Mainz, Basel, Worms, Trier und Würzburg, die als soziale, wirtschaftliche und geistige Zentren günstige Voraussetzungen für das Entstehen von „Beginengemeinschaften“ bieten.
Schon für das Jahr 1211 - oder kurz danach - ist der Ursprung eines „Beginenkonvents“ in Nürnberg bekannt, aus dem später das „Dominikanerinnenkloster Engental“ hervorgeht.
Der erste „Beginenhof“ in Ulm, die „Sammlung“, wird kurz nach dem im Jahr 1229 entstandenen „Franziskanerkloster“ gegründet.
Für 1241 sind „Beginen“ in Nördlingen, 1243 in Dillingen belegt.
Anno 1242 wird eine „femina religiosa“ in Frankfurt, 1244 eine „sorores conversae“ in Straßburg genannt.
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstehen auch in München mehrere „Seelhäuser“ als „Stiftungen“ wohlhabender Bürger.
10 1204 - Herzog Ludwig I. heiratet Ludmilla, die Witwe des Grafen von Bogen
Kelheim * Herzog Ludwig I. „der Kelheimer“ heiratet Ludmilla, die Witwe des Grafen von Bogen, in Kelheim.
1207 - Der „Franziskanerorden“ wird als erster „Bettelmönchsorden“ gegründet
San Damiano * Der „Franziskanerorden“ - als erster „Bettelmönchsorden“ - wird gegründet.
Franz von Assisi wandelt das benediktinische „Gelübde der Armut“ in ein „Gelübde des Bettelns“ um und schließt damit eine Lücke im System der katholischen Kirche.
Er verkündet „völlige Armut und politische Machtlosigkeit“ und lehnt jede „hierarchische Unterordnung innerhalb des Ordens“ ab.
Die „Franziskaner“ gehen barfuß, verfügen weder über Grundbesitz noch Vermögen, ihre Kleidung besteht aus einem groben grauen Umhang mit einer Kapuze, der mit einem Strick zusammengehalten wird.
So gekleidet unterscheiden sie sich kaum von den damals populären „Wanderpredigern“.
Nur für den täglichen Bedarf dürfen die Mönche betteln, doch außer für kranke Mitbrüder kein Geld annehmen.
Besonders die Schichten der städtischen Bewohner, die sich früher wahrscheinlich den „Ketzern“ zugewandt hätten, geraten nun in den Bannkreis der „Minoriten“, die für sie das Ideal einer am „Urchristentum“ orientierten Kirche verkörpern.
Obwohl die „Franziskaner“ von einer Woge des im Volk populären Armutsideal emporgetragen worden sind, nimmt sie die Kirche dennoch nur schrittweise auf.
1207 - Die erste Nennung Münchens als „Bürgergemeinde“ = Stadt
München * Das „Cartular“ des „Klosters Ebersberg“ bezeichnet München als „civitas“.
Das ist die erste Nennung Münchens als „Bürgergemeinde“ = Stadt.
Um das Jahr 1208 - Das „Heiliggeist-Spital“ wird gegründet
München-Angerviertel * Das „Heiliggeist-Spital“ wird gegründet.
1210 - Einflussreiche Kleriker lehnen den neuen „Franziskaner“-Orden ab
Rom-Lateran * Franz von Assisi erhält eine mündliche Gründungsgenehmigung, doch in den Folgejahren lehnen einflussreiche Kleriker die neue „Franziskaner“-Gemeinschaft ab und verdächtigen die Ordensmitglieder der „Häresie“.
1211 - Baiern wird von der Pest und einer Hungersnot heimgesucht
<p><strong><em>Herzogtum Baiern</em></strong> * Ganz Baiern wird - nach den Annalen des Klosters Weihenstephan - von einer großen Pest und einer gewaltigen Hungersnot heimgesucht. </p>
1213 - Die „Leprosen“ Münchens erhalten eine Stiftung
München * Die „Leprosen“ selbst - nicht das „Leprosenhaus am Gasteig“ - werden mit einer Stiftung des venezianischen Kaufmanns Berhardus Teutonikus an die „malsani de Munich“, die Leprosen Münchens, bedacht.
Das setzt eine Organisation voraus, weshalb man auch auf das Vorhandensein eines „Leprosenhauses“ schließt.
Um den 9 1214 - Die Wittelsbacher Herzöge erben die „Rheinpfalz“
Rheinpfalz * Die Wittelsbacher Herzöge erben die „Rheinpfalz“.
Anno 1215 - Gründung des „Ordens der Reuerinnen der Heiligen Magdalena“
Rom-Lateran * Mit der Gründung des „Ordens der Reuerinnen der Heiligen Magdalena“ wird den „Prostituierten“ die Möglichkeit eröffnet, in ein „sündenfreies Leben“ zurückzukehren.
17. 3 1220 - Der Freisinger Bischof Otto II. von Berg stirbt
<p><strong><em>Freising</em></strong> * Der Freisinger Bischof Otto II. von Berg stirbt. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird Gerold von Waldeck. </p>
26. 4 1220 - Kaiser Friedrich erklärt die Bischöfe zu selbstständigen Landesherren
Frankfurt am Main * Kaiser Friedrich II. erklärt in seiner „confoederatio cum principibus ecclesiasicis“ die Bischöfe zu selbstständigen Landesherren. Landesherren können diese aber nur in Gebieten werden, die sie vom Kaiser als Lehen erhalten haben und die nicht unter herzoglicher Herrschaft stehen.
1221 - Die „Annalen des Klosters Schäftlarn“ nennen München erneut als Stadt
Kloster Schäftlarn - München * In den „Annalen des Klosters Schäftlarn“ wird München erneut als „civitas“ (= Stadt) bezeichnet.
1221 - Die ersten franziskanischen Bettelmönche kommen nach München
München-Angerviertel * Das ist die Zeit, in der die ersten franziskanischen Bettelmönche nach München kommen.
Der genaue Zeitpunkt lässt sich jedoch mit Sicherheit nicht mehr feststellen. Nach der „Ordenstradition“ soll ein Bruder Castinus die erste Ordensniederlassung der „Barfüßer“ hier gegründet haben.
Von der Bürgerschaft sei ihm damals die „Jakobuskapelle“ mit einem Häuschen „am Anger vor der Stadt“ übergeben worden. Beweisbar ist das nicht.
5 1222 - Herzog Otto II. heiratet in Worms Agnes Pfalzgräfin bei Rhein
Worms * Herzog Otto II. heiratet in Worms Agnes, die Tochter Heinrichs des Schönen, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Sachsen und dessen Ehefrau Agnes, Tochter Konrads, Pfalzgraf bei Rhein.
1223 - Papst Innozenz III. bestätigt die Ordensregel der „Franziskaner“ schriftlich
Rom-Lateran * Nachdem der „Franziskanerorden“ bereits in vielen Teilen Europas - möglicherweise auch schon in München - Anhänger gefunden hat, bestätigt Papst Innozenz III. die Ordensregel schriftlich.
Nicht aber ohne zuvor noch Änderungen vorzunehmen. So werden beispielsweise die „Wanderpredigten“ verboten und es muss eine Organisation, verbunden mit dem Entstehen einer Ordenshierarchie, aufgebaut werden.
1226 - Die „Einsiedlerbrüder vom Berge Karmel“ erhalten ihre päpstliche Bestätigung
<p><strong><em>Rom-Lateran</em></strong> * Die Ordensgemeinschaft der <em>„Einsiedlerbrüder vom Berge Karmel“</em> erhält ihre päpstliche Bestätigung.</p> <p>Mit dem Vordringen der Muslime gehen viele Eremitenmönche im 13. Jahrhundert nach Zypern, Sizilien, Südfrankreich und England. Dort wenden sie sich einer mehr weltzugewandten Richtung zu, sodass Papst Innozenz IV. die Karmeliter<em> </em>unter die Bettelorden eingereiht und ihnen so die Möglichkeit der Niederlassung in den Städten gibt.</p>
3. 10 1226 - Franz von Assisi stirbt
Assisi * Franz von Assisi stirbt.
Nach dem 4. 10 1226 - Es kommt zu langanhaltenden Flügelkämpfen bei den Franziskanern
Rom-Lateran * Unmittelbar nach dem Tod des Ordensgründers Franz von Assisi kommt es zu langanhaltenden Flügelkämpfen zwischen den gemäßigten Konventualen, die die Armutsregeln abschwächen wollen und den Spiritualen, die sich als die „wahren Nachfolger“ Franziskus’ sehen und auf die strikte Einhaltung des Armutsgelübdes beharren.
Seit 1228 - Herzog Otto II. regiert die „Pfalzgrafschaft Rhein“
Pfalzgrafschaft Rhein * Herzog Otto II. regiert die „Pfalzgrafschaft Rhein“.
1229 - Ein „Abraham von München“ in einer Regensburger Urkunde
München - Regensburg * In einer Regensburger Urkunde wird als jüdischer Zeuge ein „Abraham von München“ genannt.
Ein Hinweis, dass es bereits zu dieser Zeit Juden in München gegeben hat.
13. 4 1229 - Herzog Ludwig II. kommt zur Welt
Heidelberg * Herzog Ludwig II., später genannt „der Strenge“, wird in Heidelberg geboren.
Um 1230 - Freunde der „Franziskaner“ dürfen Geld sammeln und verwalten
Rom-Lateran * Die regierenden Päpste wirken mildernd auf die „Franziskaner-Ordensregeln“ ein und setzen die Praxis durch, dass Freunde des Ordens der „Minderbrüder“ Geld sammeln und verwalten dürfen.
Die „Spiritualen“ wenden sich zwar scharf dagegen, werden aber dafür verfolgt, eingekerkert und sogar erschlagen. Ihr Protest kann jedenfalls die „Konventualen“ nicht bremsen.
1231 - Die „Inquisition“ wird den „Dominikanern“ und „Franziskanern“ anvertraut
Rom-Lateran * Die „Inquisition“ wird durch den Papst den Bettelorden der „Dominikaner“ und „Franziskaner“ anvertraut.
29. 3 1231 - Der Freisinger Bischof Gerold von Waldeck stirbt
<p><strong><em>Freising</em></strong> * Der Freisinger Bischof Gerold von Waldeck stirbt. Er wird von Papst Gregor IX. abgesetzt und exkommuniziert, weil er im Jahr 1230 die Stadt Freising den Wittelsbachern als Lehen überlassen will. Dazu kam es durch überwiegend selbst verschuldeter Finanzschwierigkeiten. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird Konrad I. von Tölz und Hohenburg. </p>
15. 9 1231 - Herzog Ludwig I. der Kelheimer wird ermordet
Kelheim * Herzog Ludwig I. der Kelheimer wird auf der Donaubrücke in Kelheim von einem Unbekannten ermordet. Seine Grabstätte befindet sich im Benediktinerkloster Scheyern. Nachfolger auf dem Thron des baierischen Herzogs wird sein Sohn Otto II., der bereits seit 1228 die Pfalzgrafschaft Rhein regiert.
1232 - Herzogin Ludmilla gründet das „Zisterzienserinnenkloster Seligental“
Landshut * Herzogin Ludmilla von Baiern, die Ehefrau von Herzog Ludwig I. „der Kelheimer“, gründet in der Nähe von Landshut das „Zisterzienserinnenkloster Seligental“.
2. 12 1232 - Die Dominikaner verfolgen die neue Hexen-Ketzer-Sekte
Rom-Lateran * Papst Gregor IX. überträgt den Dominikanern die Aufgabe, die Orthodoxie des christlichen Glaubens zu schützen und deren Feinde aufzuspüren. Gemeint ist damit das Beharren auf bestimmten traditionellen Lehrmeinungen, Ideologien oder Handlungsweisen. Das steht im Gegensatz zu den Erneuerungsbewegungen, der Heterodoxie.
Dadurch engagieren sich die Dominikaner verstärkt in der Verfolgung der neuen Hexen-Ketzer-Sekte.
1235 - Streit zwischen „Templer“ und „Johanniter“ wegen einiger Mühlen
Naher Osten * Die „Templer“ und die „Johanniter“ geraten wegen einiger Mühlen im „Heiligen Land“ heftig aneinander.
1235 - Durch die „Folter“ soll die „Häresie“ [„Ketzerei“] ausgerottet werden
Rom-Lateran * Die „Folter“ wird mit dem Ziel eingerichtet, um die „Häresie“ [„Ketzerei“] auszurotten.
Sie wird damals den „Bettelorden“ anvertraut, den „Franziskanern“ und vor allem den „Dominikanern“, deren Berufung der „Kampf gegen die Häresie“ ist.
19. 11 1235 - Herzog Heinrich XIII. wird in Landshut geboren
Landshut * Herzog Heinrich XIII. wird in Landshut geboren.
28. 5 1239 - Münchens ältestes Stadtsiegel
München * Das älteste erhaltene Stadtsiegel findet sich auf einer Urkunde, in der die Bürgerschaft erstmals neben dem stadtherrlichem Richter auftritt. Das Siegel zeigt einen Mönchskopf mit überzogener Kapuze in einem von zwei Türmen flankierten offenen Tor, über dem ein Adler erscheint. Den Adler als Symbol des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation führen die Wittelsbacher Herzöge in ihrer Funktion als baierische Pfalzgrafen und als Münchner Gerichtsherren seit 1179 in ihrem Wappen. -
Der Stadtherr ist zu diesem Zeitpunkt noch der Bischof von Freising, Konrad I. von Tölz, den die Wittelsbacher Herzöge aber aus „ihrer” Stadt verdrängen wollen und werden.
1240 - Die Wittelsbacher verdrängen den Freisinger Bischof aus München
München * Die Wittelsbacher verdrängen den Freisinger Bischof aus München.
Die Zeit, in der die Freisinger Bischöfe in München regieren, liegt ebenso im Düsteren wie die Zeit vor Herzog Heinrich dem Löwen.
Das liegt daran, dass es schon bald zu Streitigkeiten mit dem neuen baierischen Herzogshaus der Wittelsbacher kommt, die sogar in kriegerische Auseinandersetzungen münden.
Am Ende des weit über fünfzig Jahre andauernden Konflikts, einigen sich die Kontrahenten auf die Vernichtung aller streitbezogenen Dokumente.
Dieser Maßnahme fallen viele wichtige Informationen zum Opfer.
Der Bischof muss seine „Münchner Rechte“ gegen eine jährliche Entschädigung an den Herzog abtreten.
Diese Gebühr wird bis 1802 bezahlt.
Um 1240 - Die „Franziskaner“ kommen wahrscheinlich nach München
München-Angerviertel * Historisch gesichert ist, dass die „Franziskaner“ vor dem Jahr 1257, wahrscheinlich um 1240, nach München kommen und am „Anger“, damals noch außerhalb der Ansiedelung Heinrichs des Löwen, ihr Klösterl errichten können.
In der von den „Franziskanern“ in den 1250er Jahren errichteten und genutzten Kirche können die Münchner Gläubigen an den Festen des heiligen Franziskus, des heiligen Antonius, der heiligen Klara und am Jahrestag der Kirchweihe einen „Ablass“ erlangen.
5. 8 1240 - Herzogin Ludmilla von Baiern stirbt in Landshut
Landshut * Herzogin Ludmilla von Baiern, die Ehefrau von Herzog Ludwig I. dem Kelheimer, stirbt in Landshut. Ihre Grabstätte befindet sich im Zisterzienserinnenkloster Seligental bei Landshut.
1241 - Angehörige des „Templer-Ordens“ kämpfen bei Liegnitz
Liegnitz * Angehörige des „Templer-Ordens“ kämpfen zwischen polnischen Rittern und schlesischen Edelleuten bei Liegnitz.
Alle „Ordensritter“ werden fallen.
1244 - Bei La Forbie in Palästina fallen dreihundert „Templer-Ordensritter“
La Forbie * Eine Niederlage bei La Forbie in Palästina kostet dem „Templer-Orden“ dreihundert Tote.
Nur dreiunddreißig „Ritter“ überleben.
1249 - Die Au wird erstmals urkundlich erwähnt
Au * Die Au wird erstmals urkundlich erwähnt.
1249 - Der Freisinger Bischof Konrad I. kauft Garmisch
Werdenfelser Land * Ritter Swiker von Mindelberg verkauft sein Gut, „das Garmisch genannt wird“, um 250 Pfund Augsburger Pfennige an den Freisinger Bischof Konrad I. von Tölz und Hohenburg, „mit allem was dazu gehört“.
um 1250 - Das Anbaugebiet des „Baierweins“ umfasst circa 2.000 Hektar
Herzogtum Baiern * Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass das Anbaugebiet des „Baierweins“ circa 2.000 Hektar Rebfläche umfasst hat.
Heute sind es nur noch vier Hektar.
1250 - Die „Templer“ zeichnen sich bei Kämpfen um Mansura aus
Mansura * Die „Templer“ zeichnen sich bei Kämpfen um Mansura aus.
Hinterher haben sie 280 Gefallene zu beklagen.
Um das Jahr 1250 - Thomas von Aquin beschäftigt sich mit dem „Teufelspakt“
Italien * Thomas von Aquin greift die Ideen des „Kirchenlehrers“ Aurelius Augustinus aus dem frühen 5. Jahrhundert wieder auf und entwickelt die weitreichende Theorie des „explizit“ [= ausdrücklich] und „implizit“ [= stillschweigend] geschlossenen „Teufelspaktes“, nach dessen Abschluss die Dämonen dem „Magier, Zauberer oder Wahrsager“ hilfreich zur Seite stehen.
Neben seiner Lehre vom „Teufelspakt“ spekuliert Augustinus darüber, ob der Geschlechtsverkehr zwischen Frau und Dämon möglich sei und ob daraus Nachwuchs hervorgehen könne.
Auch Thomas von Aquin vertritt die Auffassung, dass es zwischen Menschen und Dämonen zu Sexualkontakten kommen kann.
Da aber alle „Schöpferkraft“ nur bei Gott liegt, können sie keine Kinder zeugen.
Deshalb muss der Dämon zuerst in Gestalt einer „succuba“ [= weiblicher, unten liegender Dämon] einem Mann den Samen entziehen, um ihn dann in Gestalt eines „incubus“ [= männlicher, oben liegender Dämon] einer Frau einzupflanzen.
Diese Theorie wurde ebensolange diskutiert wie die Frage, ob solche im Prinzip vom Menschen abstammenden Kinder eine zu taufende „Seele“ hätten oder nur „teuflische Wechselbälger“ seien.
Ja, mit so einem Unsinn können sich intelligente Menschen scheinbar intensiv beschäftigen.
1252 - Papst Innozenz IV. sieht der „Folter“ ein Mittel gegen die „Häresie“
Rom-Lateran * Papst Innozenz IV. sieht in der Bulle „Ad extirpendam“ die „Folter“ ausdrücklich als Mittel vor, um in Fällen der „Häresie“ die Wahrheit ans Licht zu bringen.
1253 - In Deutschland entdeckt man eine ketzerische Teufelsanbetung
Rom-Lateran - Deutschland * In Deutschland entdeckt man eine ketzerische Teufelsanbetung, deren charakteristischen Züge Papst Gregor IX. beschreibt: Man findet hier
- die Verleugnung Christi und des Kreuzes,
- die Götzen [Kröte und schwarze Katze, die Verkörperung Luzifers],
- die sexuellen Ausschweifungen und die Homosexualität,
- den Geheimbund und die nächtlichen Versammlungen.
29. 11 1253 - Herzog Otto II. stirbt in Landshut
Landshut - Scheyern * Herzog Otto II. stirbt in Landshut. Seine Grabstätte befindet sich im Benediktinerkloster Scheyern. Herzog Ludwig II. der Strenge regiert zwischen 1253 und 1255 gemeinsam mit seinem Bruder Heinrich XIII. das Herzogtum Baiern und die Pfalzgrafschaft Rhein.
2. 8 1254 - Herzog Ludwig II. der Strenge heiratet Herzogin Maria von Brabant
Landshut * Herzog Ludwig II. der Strenge heiratet in Landshut Herzogin Maria von Brabant und Lothringen.
28. 3 1255 - Das Herzogtum Baiern wird geteilt
Herzogtum Baiern • Das Herzogtum Baiern wird in das „Obere Baiern“ und das „Niederland“ geteilt. Das Teilherzogtum Oberbaiern und die Pfalzgrafschaft Rhein erhält Herzog Ludwig II. der Strenge, das Teilherzogtum Niederbaiern fällt an Herzog Heinrich XIII..
1256 - Der Orden der „Augustiner-Eremiten“ wird gegründet
Rom-Lateran * Der Orden der „Augustiner-Eremiten“ wird gegründet.
Seine Ordensangehörigen führten aber kein einsiedlerhaftes Leben, wie uns dies ihr Name zunächst suggerieren möchte.
Die „mönchische Gemeinschaft“ wird nur deshalb so genannt, weil sie im Gegensatz zu den alten anerkannten Orden, wozu in unserem Falle die „Augustiner-Chorherren“ gehören, ihren Sitz beziehungsweise ihre Mutterkirche nicht in einer der „päpstlichen Basiliken“ hat.
Nur aus diesem Grund wird sie „Eremiten-Kongregation“ genannt.
18. 1 1256 - Herzogin Maria von Baiern wird in Donauwörth enthauptet
Donauwörth * Herzogin Maria von Baiern, die Ehefrau von Herzog Ludwig II. dem Strengen, wird in Donauwörth enthauptet. Ihre Grabstätte befindet sich in der Heiligkreuzkirche in Donauwörth.
Anno 1257 - Die Wurzeln der „Jakobi-Dult“
München-Angerviertel * Die Wurzeln der „Jakobi-Dult“ gehen auf dieses Jahr zurück.
13. 1 1257 - Ein Ablassbrief nennt erstmals das Franziskanerkloster
Rom-Lateran * Papst Alexander IV. erteilt einen Ablassbrief für das Franziskanerkloster in München. Der Ablass gilt an den Festen der Heiligen Franziskus, Antonius und Klara sowie acht darauffolgende Tage. Es ist die erste sichere Kunde vom Bestehen des Franziskanerklosters.
18. 1 1258 - Der Freisinger Bischof Konrad I. von Tölz und Hohenburg stirbt
Freising * Der Freisinger Bischof Konrad I. von Tölz und Hohenburg stirbt. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird Konrad II. Wildgraf von Dhaun.
1259 - Eine Straßenschlacht zwischen Templern und Johannitern
<p><strong><em>Akkon</em></strong> * In Akkon kommt es zu einer Straßenschlacht zwischen Templern und Johannitern mit Einsatz von Waffen. Das Abendland ist entsetzt und fordert die Zusammenlegung der beiden so ähnlichen Orden. Selbst das Konzil von Lyon beschäftigt sich mit dem Vorgang.</p>
24. 8 1260 - Herzog Ludwig II. der Strenge heiratet Anna von Schlesien-Glogau
München ? * Herzog Ludwig II. der Strenge heiratet Herzogin Anna von Schlesien-Glogau.
1262 - Der Papst erlaubt den „Augustiner-Eremiten“ das „Predigen“
Rom-Lateran * Papst Alexander IV. erlaubt den „Augustiner-Eremiten“ das „Predigen“ und „Beichtehören“ - sofern der Diözesanbischof dagegen keine Einwände erhebt.
1265 - Papst Clemens IV. bestätigt die Anwendung der „Folter“
Viterbo * Papst Clemens IV. bestätigt ausdrücklich die Anwendung der „Folter“.
16. 8 1267 - Herzogin Agnes von Baiern stirbt
München - Scheyern * Herzogin Agnes von Baiern, die Ehefrau von Herzog Otto II., stirbt. Ihre Grabstätte befindet sich im Benediktinerkloster Scheyern.
25. 6 1271 - Herzogin Anna von Baiern stirbt
München - Fürstenfeld * Herzogin Anna von Baiern, die zweite Ehefrau von Herzog Ludwig II. dem Strengen, stirbt in München. Ihre Grabstätte befindet sich in der Kirche des Zisterzienserklosters Fürstenfeld.
24. 11 1271 - München erhält eine zweite Pfarrei
München * Auf Bitten der Bürgerschaft Münchens teilt Bischof Konrad II. die Peterspfarrei. Der Grund: Weil
- „durch die Gnade Gottes so ins Unermessliche gewachsen ist, dass sie ohne Gefahr für das Heil der Seelen von einem einzigen Hirten nur noch schwer geleistet werden kann,
- da überdies der Friedhof der Kirche in seiner beengten Lage auch nicht mehr ausreicht für die Gräber der Toten“.
29. 4 1273 - Papst Gregor X. bestätigt die Gründung der Frauen-Pfarrei
München * Papst Gregor X. bestätigt die Gründung
- der Frauen-Pfarrei gleichzeitig mit
- Münchens dritter Pfarrei, der Heiliggeist-Pfarrei, die allerdings nur das Heilig-Geist-Spital umfasst.
1. 10 1273 - Die Kurfürsten wählen Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen König
Frankfurt am Main * Die Kurfürsten wählen Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen König. Herzog Ludwig II. der Strenge ist als Pfalzgraf bei Rhein einer der sieben Kurfürsten. Zugleich nimmt er das Amt des Reichsvikars wahr, des Stellvertreters des Königs bei dessen Abwesenheit oder bei Thronvakanz.
Um den 24. 10 1273 - Herzog Ludwig II. der Strenge heiratet Mechthild von Habsburg
Aachen * Herzog Ludwig II. der Strenge heiratet in Aachen die Gräfin Mechthild von Habsburg.
4. 10 1274 - Herzog Rudolf I. wird in Basel (?) geboren
Basel * Herzog Rudolph I. wird in Basel (?) geboren.
1276 - Das „Augsburger Stadtrecht“ und die Prostitution
Augsburg * Das „Augsburger Stadtrecht“ unterstellt die „varnden freulin“ der Rechtsaufsicht des „Henkers“.
- Dieser Schritt bedeutet einerseits, dass sich die „Reichsstadt Augsburg“ mit der ständigen Anwesenheit der „Prostituierten“ abgefunden hat und
- andererseits sind die Augsburger „Dirnen“ - welch ein Fortschritt - nicht mehr „rechtlos“, sondern einem „Sonderrecht“ unterworfen und
- können sich bei Willkürentscheidungen des „Henkers“ an den „Vogt“ als Schiedsinstanz wenden.
1279 - Die „Franziskaner“ dürfen Nutznießer von Vermögen und Grundstücken sein
Rom-Lateran - München * Papst Nikolaus III. entscheidet, dass der Orden der „Franziskaner“ Nutznießer von Vermögen und Grundstücken sein dürfen.
Nun gehen auch die Münchner „Barfüßer“ allmählich zu einer abgemilderten Praxis des Besitzes über und nehmen bewegliches und unbewegliches Eigentum für ihr Kloster an.
Nach der Auffassung des höchsten Kirchenvertreters verletzen die „Franziskaner“ ihr Armutsgelübde dadurch nicht, da ja letztlich er, der Papst, der eigentliche Eigentümer sei.
1279 - Umherziehende „Lustdirnen“ in Landshut
Landshut * Die umherziehenden „Lustdirnen“, die später oft noch als „Fahrende Fräulein“ bezeichnet werden, werden in Landshut der Gruppe der „Fahrenden“ zugeschlagen.
Sie sind zwar geduldet, aber dennoch missachtet, weshalb sich ihre Häuser am äußeren Stadtrand befinden.
1280 - Der „Gronimushof“ ist in herzoglichem Besitz
Haidhausen * Der „Gronimushof“ in der Haidhauser Kirchenstraße wird als herzoglicher Besitz beurkundet.
1282 - Am Klosterneubau der „Franziskaner“ wird gearbeitet
München-Graggenau * An dem von Herzog Ludwig „dem Strengen“ finanzierten Klosterneubau der „Franziskaner“ wird gearbeitet.
Er entsteht auf dem weitläufigen Wiesengrund bei einer bereits bestehenden „Agneskapelle“, die den Kern der neuen Klosteranlage bildet und in der die Familie Haslang von jeher ein Begräbnisrecht hat.
Der Klostergrund umfasst das Gebiet des heutigen „Residenz-“ und „Nationaltheaters“, einschließlich dem vorgelagerten „Max-Joseph-Platz“.
2 1282 - Der spätere Kaiser Ludwig der Baier wird in München geboren
München * Herzog Ludwig IV., der spätere Kaiser Ludwig der Baier, wird in München geboren. Er entstammt der dritten Ehe von Herzog Ludwig II. dem Strengen mit Gräfin Mechthild von Habsburg.
1284 - Die „Franziskaner“ übernehmen die Betreuung der „Pütrich-Schwestern“
München-Graggenau * Die „Franziskaner“ übernehmen die geistliche Betreuung der vierzig „Pütrich-Schwestern“.
1284 - Der erste „Rat der Stadt“ München
München * München hat einen „Rat der Stadt“, den man „consules civitatis Monacensis“ nennt.
1285 - Ein Münchner Jude soll einen christlichen Knaben ermordet haben
München - München-Graggenau * Ein Münchner Jude soll einen christlichen Knaben ermordet und sein Blut für rituale Zwecke missbraucht haben, obwohl der jüdische Glauben den Genuss von Blut verbietet.
Die Juden der Stadt sterben als „jüdische Glaubenszeugen“ in den Flammen der von Christen angezündeten „Synagoge“.
1285 - Die Patrizierfamilie Pütrich stiftet das erste „Seelhaus“ in München
München-Graggenau * Die Patrizierfamilie Pütrich stiftet das erste „Seelhaus“ in München.
Es befindet sich an der Ecke der heutigen Residenz-/Perusastraße.
Um 1288 - Wilhelm von Occam wird in der Grafschaft Surrey in England geboren
Ockham * Wilhelm von Ockham oder Occam wird in Ockham in der Grafschaft Surrey in England geboren.
1289 - Die Neubauten für das „Franziskaner-Kloster“ sind vollendet
München-Graggenau * Die Neubauten für das „Franziskaner-Kloster“ sind vollendet.
3. 2 1290 - Herzog Heinrich XIII. stirbt in Landshut
Burghausen - Landshut * Herzog Heinrich XIII. stirbt in Burghausen. Seine Grabstätte befindet sich im Zisterzienserinnenkloster Seligental bei Landshut.
5. 4 1291 - Beginn der Belagerung von Akkon
Akkon * Beginn der Belagerung von Akkon.
18. 5 1291 - Akkon wird nach Wochen der Verteidigung von den Muslimen erobert
Akkon * Akkon wird nach mehreren Wochen der Verteidigung von den Muslimen erobert. Die Templer leisten aus ihrem turmartigen Haus weiterhin Widerstand. Als jedoch die Situation für die Verteidiger immer aussichtsloser wird, verspricht ihnen Sultan al-Aschraf Halil den freien Abzug.
Kaum haben die Ordensritter den Turm verlassen, stürzen sich die Angreifer auf sie, nehmen sie fest und schlagen ihnen die Köpfe ab. Als die sich noch im Turm befindlichen, aber verwundeten Tempelherren dies bemerken, setzen sie sich mit letzter Kraft wieder zur Wehr. Daraufhin beginnen die Belagerer mit dem Unterminieren des Turmes.
28. 5 1291 - Circa 300 Tempel-Ordensritter verlieren in Akkon ihr Leben
Akkon * Der von den Islamisten unterminierte Turm in Akkon stürzt ein und begräbt die Templer sowie viele Angreifer unter sich. Circa dreihundert Ordensritter verlieren dabei ihr Leben. Sehr viel mehr sind auch nicht im Einsatz. Der Großmeister der Templer zieht sich auf die Insel Zypern zurück. Durch eine Serie von Niederlagen hat der einstmals vortreffliche Ruf des Ordens stark gelitten.
Nach 6 1291 - Akkon fällt. - Der Sitz der Zentralregierung wird nach Zypern verlegt
<p><strong><em>Akkon - Zypern</em></strong> * Nachdem auch Akkon, dieser letzte befestigte Platz des Königreichs fällt, wird der Sitz der Zentralregierung nach Zypern verlegt. Der Ordenssitz der Templer bleibt aber immer im Orient, oder wie die Tempel-Ordensherren sagten: <em>„Diesseits des Meeres.“</em></p> <p>Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ihre Gegner laut vernehmbar an die Öffentlichkeit treten und den Tempelherren die vielen wirtschaftlichen Aktivitäten, ihren Reichtum und ihre Privilegien, ihre Macht und ihren Einfluss neiden.</p> <ul> <li>So sind die Bischöfe über die direkte Unterstellung der Tempelherren unter den Heiligen Stuhl verärgert,</li> <li>Geschäftsleute beschweren sich über die angeblichen Beeinträchtigungen ihrer Handelsrechte durch die Ordensmänner und</li> <li>der Weltklerus muss ohnmächtig zusehen, wie die Tempelherren in ihren Pfarreien umfassende Kollekten organisieren und dadurch örtliche Projekte leiden müssen.</li> <li>Die anderen Ritterorden, ganz besonders die Johanniter, neiden den Tempelrittern ihre nahezu uneingeschränkten Finanzmittel.</li> <li>Und selbst weil der Großmeister der Templer Vortritt gegenüber dem Johanniter-Großmeister hat, kommt es zu weitreichenden Rivalitäten.</li> </ul> <p>Aus den Neidern werden Feinde, die Material für kommende Auseinandersetzungen sammeln.<br /> Und das wird den Tempel-Rittern dann gefährlich, als sich ein machtvoller politischer Wille gegen sie wendet.</p> <p>Wie in den heutigen politischen Auseinandersetzungen, so werden auch damals Einzelfälle aufgebauscht, ausgeschlachtet und zu wahren Horrorgeschichten ausgebaut. Freilich findet man unter den. Tempel-Rittern einen Trunksüchtigen, einen Sodomistischen, einen Homosexuellen, einen Jähzornigen oder einen glaubensmäßig Unsicheren.</p>
1292 - Nach einer Missernte wird in Niederbaiern das Bierbrauen verboten
Landshut * Wegen Missernte und nachfolgender „ungewöhnlicher Getreidetheuerung“ verbieten die niederbaierischen Herzöge Ludwig III., Otto III. und Stephan I. das Bierbrauen.
1293 - Das „Münchner Handwerk der Brauer“ wird erstmals genannt
München * Das „Münchner Handwerk der Brauer“ wird erstmals genannt.
Es zahlt dem Herzog jährlich 50 Pfund Pfennige, 32½ Scheffel Malz und ein Quantum Wachs.
23. 2 1293 - Die Ortsbezeichnung „Gasteig“ wird erstmals genannt
München * Der Ortsname „Gasteig“ wird erstmals aus Anlass einer Seelgeräte-Stiftung „den siechen auf dem Gasteig ze München“ genannt. Gasteig bedeutet Der gache Steig, der steile Weg.
1294 - Die neue Franziskaner-Klosterkirche „St. Franziskus“ wird eingeweiht
München-Graggenau * Die neue Franziskaner-Klosterkirche „St. Franziskus“ wird eingeweiht.
2. 2 1294 - Herzog Ludwig II. der Strenge stirbt in Heidelberg
Heidelberg * Herzog Ludwig II. der Strenge stirbt in Heidelberg. Seine Grabstätte befindet sich in der Kirche des Zisterzienserklosters Fürstenfeld. Herzog Rudolph I. übernimmt die Regierungsgeschäfte. Sein Bruder, der zwölfjährige Herzog Ludwig IV., den man später den Baiern nennen wird, erhält seine Erziehung am Habsburger Hof in Wien.
12. 3 1294 - Bischof Emicho erwirbt die „Grafschaft ze Mittenwald und Partenkirchen“
Freising - Werdenfelser Land * Der Freisinger Bischof Emicho Wildgraf erwirbt von Berchtold Graf zu Eschenloch die Grafschaft ze Mittenwald und Partenkirchen. In der Kaufurkunde taucht erstmals der Name „Werdenfels“ auf.
31. 3 1294 - Bischof Emicho muss der Ansiedelung der Augustiner-Eremiten zustimmen
<p><strong><em>Freising - München-Kreuzviertel</em></strong> * Zähneknirschend und auf Druck von Herzog Rudolf I. muss der Freisinger Bischof Emicho seine Zustimmung zur Ansiedelung der Augustiner-Eremiten in München geben. Der Bischof fürchet die Konkurrenz und Schmälerung seiner Einkünfte durch die <em>„Parvenü-Kleriker“</em>.</p>
4. 4 1294 - Die ersten Augustiner-Ordensbrüder kommen nach München
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Herzog Rudolf I. dokumentiert den Gründungsakt des Augustiner-Eremiten-Klosters und der Kirche in einer Urkunde. Von Regensburg aus kommen eine Handvoll Ordensbrüder nach München und erhalten einen Platz unmittelbar vor der ersten Stadtbefestigung, nahe am Oberen Tor, das später den Namen <em>„Schöner Turm“</em> erhalten wird. Das Haus Wittelsbach übernimmt auch die Vogtei über das Kloster.</p>
19. 6 1294 - Das Rudolfinum ist das Grundgesetz der Stadt München
München * Im Rudolfinum, dem aus 22 Artikeln bestehenden Grundgesetz der Stadt München, bestätigt Herzog Rudolph I. der Stadt alle Rechte seiner Vorgänger. Die Stadt München bekommt die Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der drei Fälle, die zum Tode führen.
Im Rudolfinum wird bereits der Begriff Burgfrieden als ein Bereich außerhalb der Stadtmauern formuliert, der zum Rechtskreis der Stadt gehört. Wörtlich heißt es dort: „in der stat oder darumbe, daz doch zu der stat gehöret.“
1295 - Das Ridler-Seelhaus wird gegründet
München-Graggenau * Das Ridler-Seelhaus an der Hinteren Schwabinger Gasse [= Theatinerstraße] wird durch die gleichnamige wohlhabende Bürgerfamilie gegründet.
1295 - Die „Franziskaner“ übernehmen die Betreuung der 39 „Ridler-Schwestern“
München-Graggenau * Die „Franziskaner“ übernehmen die geistliche Betreuung der 39 „Ridler-Schwestern“.
Die „Regelhäuser“ und späteren „Klöster des Dritten Ordens“ sind dem „Franziskaner-Kloster“ unmittelbar benachbart, sodass hier ein „franziskanisches Stadtquartier“ entsteht.
7. 4 1296 - Herzog Otto II. wird in Kelheim geboren
Kelheim * Herzog Otto II. wird in Kelheim geboren.
1300 - Das Klimaoptimum für den Weinanbau geht langsam zu Ende
Mitteleuropa * Die Zeit des mitteleuropäischen Klimaoptimums für den Weinanbau geht langsam zu Ende.
Um 1300 - Der Wein ist das dominierende Volksgetränk in Baiern
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Wein ist das dominierende Volksgetränk in Baiern.</p> <ul> <li>Auf dem Münchner Weinmarkt finden sich neben dem einheimischen <em>„Baierwein“</em> die <em>„Südtiroler Weine“</em>, die man als <em>„Welschweine“</em> oder auch <em>„Etschweine“</em> bezeichnet.</li> <li>Das nächstgrößere Einfuhrkontingent der <em>„Fremdweine“</em> bilden die <em>„Neckarweine“</em> aus Württemberg. Das liegt daran, weil hier als <em>„Rückfracht“</em> Salz aus den Münchner <em>„Salzstadeln“</em> in die Weinfässer gestoßen werden kann.</li> <li>Für die <em>„österreichischen Weine“</em> gilt die Bezeichnung <em>„Osterwein“</em>. Wegen fehlender <em>„Rückfracht“</em> ist der Transport sehr kostspielig.</li> <li>Aus Griechenland und Süditalien kommen die <em>„Südweine“</em>.</li> </ul>
Um das Jahr 1300 - Der beste Welschwein kostet 4 Pfennig je Mass
<p><strong><em>München</em></strong> * Für den besten Welschwein wird ein Preis von 4 Pfennig je Mass festgelegt.</p>
Spätestens ab dem Jahr 1301 - Der Erwerb von Lehmgründen in Haidhausen ist notwendig
<p><strong><em>München - Haidhausen</em></strong> * Der Ausbau der Stadt München macht den Erwerb von Lehmgründen in Haidhausen notwendig. Wichtige Bauwerke entstehen: von der Stadtmauer bis zu Kirchen-, Verwaltungs- und Repräsentationsgebäuden.<br /> Sie werden mit Haidhauser Ziegel gebaut und gedeckt.</p>
1301 - Ludwig der Baier regiert in den oberbaierischen-pfälzischen Gebieten mit
Wien * König Albrecht I. von Habsburg, der Onkel der baierischen Herzöge, verhilft Ludwig den Baiern zur Mitregierung in den oberbaierischen-pfälzischen Gebieten.
1302 - Die Mamelucken überfallen die mit Templern besetzte Inselfestung Ruad
Ruad * Einen weiteren großen Prestigeverlust bereiteten ihnen die Mamelucken beim Überfall auf die mit einhundertzwanzig Tempel-Rittern, vierhundert dienenden Brüdern und fünfhundert Bogenschützen besetzte Inselfestung Ruad. Die gefangenen Templer werden in „Schimpf und Schande nach Ägypten geführt“.
1303 - Die „Templer-Banken“ haben einen illustren Kundenstamm
Aragon * Der König von Aragon gibt seine „Kronjuwelen“ der „Templerburg Monzon“ zur sicheren Aufbewahrung.
Der König, seine Familie, seine Beamten, Kaufleute und verschiedene Seigneurs zählen - neben den „Würdenträgern der Tempelherren“ - zum Kundenstamm der „Templer-Banken“.
Der sich immer in Geldnöten befindende französische König will sich das riesige Vermögen des „Tempelordens“ sichern, obwohl es gerade der „Tempelorden“ war, der immer wieder den französischen Staat vor dem Staatsbankrott gerettet hat.
1304 - Die Missgunst gegen die „Templer“ steigert sich immer mehr
Paris * Die Missgunst steigert sich immer mehr, nachdem der „Templer-Orden“ ganz offiziell den „Kampf gegen die Heiden“ aufgibt, der „Großmeister“ sich ins damals schon als flott bekannte Paris zurückzieht und viele „Tempelherren“ in ihrer Heimat, vor allem in Frankreich, wichtige Positionen bekleiden - allerdings ohne der französischen Krone Rechenschaft schuldig zu sein.
Die reichen und arroganten „Templer“, dieser „Staat im Staat“, stört den französischen König Philipp IV., den man „den Schönen“ nennt.
Er ist ein durchaus tüchtiger Herrscher, der etwas von der Macht versteht und deshalb weis, dass es „Macht ohne Geld“ nicht gibt.
Doch gegen die gut ausgebildeten und disziplinierten „Templer“ hat selbst der französische König militärisch nichts entgegenzusetzen.
Außerdem untersteht der „Orden“ direkt dem Papst, gegen dessen Willen er nichts unternehmen kann.
6 1304 - Herzogin Mechthild von Baiern stirbt
München - Fürstenfeldbruck * Herzogin Mechthild von Baiern, die dritte Ehefrau von Herzog Ludwig II. „dem Strengen“, stirbt.
Ihre Grabstätte befindet sich in der Kirche des „Zisterzienserklosters Fürstenfeld“.
1305 - Besorgniserregende Gerüchte über die „Templer“ tauchen auf
Paris * Besorgniserregende Gerüchte über die „Templer“ tauchen auf.
Es geht dabei um „Ketzerei, Götzenkult und Sodomie“.
Sie werden von Esquieu de Floyran in Umlauf gebracht.
1305 - Mittenwald als „forum“ mit einem Richter erwähnt
Freising - Mittenwald * Im „Freisinger Urbar“ wird Mittenwald als „forum“ mit einem Richter erwähnt.
5. 6 1305 - Clemens V. wird zum Papst gewählt
Avignon * Frankreichs König Philipp IV. gelingt es, seinen Wunschkandidaten Bertrand de Got, den Erzbischof von Bordeaux, durch ein französisch dominiertes Kardinalskollegium, auf den Papstthron zu setzen. Der neue Pontifex maximus Clemens V. lässt sich nicht nur außerhalb Roms krönen, sondern residiert dauerhaft in Avignon.
Das bedeutete eine Abkehr vom päpstlichen Universalismus. Denn während der Papst in Rom und dem Kirchenstaat einigermaßen autonom ist, besitzt er um Avignon herum nur wenig Ländereien, die zudem vollständig vom französischen Staatsgebiet umschlossen sind. Das Papsttum gerät damit in Abhängigkeit zur französischen Krone. Der Papst verliert seine überparteiliche Autorität.
2 1306 - Wilhelm von Ockham wird zum Subdiakon in gewählt
??? * Wilhelm von Ockham wird zum Subdiakon gewählt. Er gehört damals bereits dem Franziskanerorden an.
16. 11 1306 - Die Klarissinnen-Nonnen erhalten das Brau- und Schankrecht
München-Angerviertel * Die Klarissinnen-Nonnen vom Kloster Sankt Jakob am Anger erhalten das Brau- und Schankrecht.
Um 1 1307 - König Philipp IV. eröffnet ein Verfahren gegen die „Tempelherren“
Paris * Die Denunziationen gegen die „Tempelherren“ werden zur Anklage aufgebauscht.
Von Seiten des französischen Königs Philipp IV. wird ein Verfahren wird eröffnet.
6 1307 - Jakob von Molay beruft ein „Templer-Ordenskapitel“ ein
Paris * Der „Templer-Ritterordensmeister“ Jakob von Molay beruft ein „Ordenskapitel“ nach Paris ein.
Dort diskutiert man über die verbreiteten Gerüchte.
8 1307 - Papst Clemens V. will die „Johanniter“ und die „Templer“ vereinen
Avignon * Papst Clemens V. will die „Johanniter“ und die „Templer“ vereinen.
Der Versuch scheitert jedoch.
24. 8 1307 - Papst Clemens V. ordnet eine Untersuchung gegen die Templer an
Avaginon * Papst Clemens V. ordnet von sich aus eine Untersuchung gegen die Templer an. Aus Angst, dass sich dadurch die Untersuchung verzögern oder im schlimmsten Fall sogar mit einem Freispruch enden könnte, nimmt die königliche Polizei die Sache selbst in die Hand und schafft damit vollendete Tatsachen.
13. 10 1307 - Im Morgengrauen werden die Templer verhaftet
Paris * Zur Überraschung von Papst Clemens V. werden im Morgengrauen - gleichzeitig in ganz Frankreich - die Templer verhaftet, ihre Güter beschlagnahmt und die Ordenshäuser unter königliche Aufsicht gestellt. Der Überraschungscoup gelingt und es gibt keinen militärischen Widerstand der Tempelritter. Trotzdem kann der Großmeister der Tempelherren, Jacques de Molay, noch kurz vor der Massenverhaftung Bücher und Dokumente des Ordens verbrennen. Die Zahl der Verhaftungen lässt sich nur schwer abschätzen. In Paris gibt es 138 Festnahmen. Lediglich zwölf bis zwanzig Ordensritter können vor der Razzia fliehen, darunter nur ein hoher Würdenträger.
Der Brief von König Philipp IV., datiert vom 14. September [Tag der Kreuzerhebung], hat den folgenden Inhalt:
- „Eine bittere, beklagenswerte, entsetzlich sich vorzustellende Sache [...].
- Ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, eine scheußliche Missetat [...].
- Eine ganz und gar unmenschliche, ja jeder Menschlichkeit fremde Sache ist uns dank mehrerer glaubwürdiger Menschen zu Ohren gekommen“.
Und weiter heißt es:
- „Die Brüder des Ordens der Miliz vom Tempel, die die Wolfsnatur unter dem Schafspelz verbargen und unter dem Habit des Ordens in erbärmlicher Weise die Religion unseres Glaubens beleidigten, werden beschuldigt, Christus zu verleugnen, auf das Kreuz zu spucken, sich bei der Aufnahme in den Orden obszönen Gesten hinzugeben“, und
- „sie verpflichten sich durch Gelübde und ohne Furcht, das menschliche Gesetz zu beleidigen, sich einander hinzugeben, ohne Widerrede, sobald es von ihnen verlangt wird.“
Zur Aufdeckung der Wahrheit werden „ausnahmslos alle Mitglieder des selbigen Ordens unseres Königreichs festgenommen, gefangengehalten und dem Urteil der Kirche vorbehalten“. Alle ihre Güter, „bewegliche und unbewegliche“, werden „beschlagnahmt, von uns eingezogen und getreu verwahrt werden“.
14. 10 1307 - Eine Liste beinhaltet die Verbrechen der Templer
Paris * Ein Manifest wird veröffentlicht, das die Verbrechen der Templer beinhaltet:
- Häresie [Abkehr vom wahren Glauben],
- Blasphemie [Gotteslästerung],
- obszöne Riten,
- Homosexualität und die
- Anbetung eines Götzen namens Baphomet.
Nach bis heute durchaus geläufigen Methoden konstruiert König Philipp IV. ein Anklagegebäude, dessen Vorwürfe er durch unter der Folter erpresste Geständnisse erhärtet.
Im Templerprozess lässt Philipp IV. durch den französischen Generalinquisitor Anklage auf Häresie und Blasphemie gegen den Orden erheben, wobei in der Regel die Geständnisse der zahlreich angeklagten Ordensmitglieder unter der Folter erpresst werden.
16. 10 1307 - Frankreichs König Philipp IV. informiert über die Operation Templer
Paris * Frankreichs König Philipp IV. informiert die europäischen Herrscher über die Operation Templer und fordert sie umgehend zum Handeln im Sinne seiner Politik der vollendeten Tatsachen auf. Zur Untermauerung enthält das königliche Schreiben die gegen die Tempelherren erhobenen Vorwürfe:
- „Die Brüder des Ordens der Miliz vom Tempel, die die Wolfsnatur unter dem Schafspelz verbargen und unter dem Habit des Ordens in erbärmlicher Weise die Religion unseres Glaubens beleidigen,
- werden beschuldigt, Christus zu verleugnen, auf das Kreuz zu spucken,
- sich bei der Aufnahme in den Orden obszönen Gesten hinzugeben.“
Und weiter schreibt der König:
- „Sie verpflichten sich durch ihr Gelübde und ohne Furcht, das menschliche Gesetz zu beleidigen,
- sich einander hinzugeben, ohne Widerrede, sobald es von ihnen verlangt wird.“
Um den 20. 10 1307 - Die Verhöre der verhafteten Templer beginnen
Paris * Die Verhöre der verhafteten Templer beginnen.
24. 10 1307 - 230 Tempelherren gestehen unter der Folter Unglaubliches
Paris * Der Großmeister des Templerordens, Jakob von Molay, bestätigt die Erklärungen des Präzeptors der Normandie, Gottfried von Charneys, und des Generalvisitors der Templer, Hugo von Pairauds. Darin haben sie und rund 230 Tempelherren - unter der Folter - zugegeben,
- dass sie Jesus Christus leugnen und ihn für einen falschen Propheten halten, der für seine Verfehlungen und nicht für die Erlösung der Menschen gestorben ist,
- dass sie bei ihren Zeremonien auf das Kreuz spucken, es mit Füßen treten und drauf urinieren,
- dass sie nicht an sie Sakramente glauben und die Priester des Ordens bei der Messe die Weiheformel vergessen,
- dass die Meister und Würdenträger, obgleich Laien, den Brüdern die Absolution für ihre Sünden erteilen,
- dass sie obszöne Praktiken und Homosexualität leben,
- dass die Brüder durch jede nur mögliche Praxis zur Bereicherung des Ordens beitragen müssen,
- dass sie sich des Nachts im Geheimen versammeln und
- dass jede Enthüllung im Kapitel bestraft wird, bis hin zur Todesstrafe.
27. 10 1307 - Papst Clemens V. protestiert gegen den Gebrauch der Folter
Avignon * Papst Clemens V., der ja eigentlich die direkte Gerichtsgewalt über die Templer hat, zeigt sich lediglich gekränkt und schreibt: „Euer überstürztes Vorgehen ist eine Beleidigung gegen Uns und die römische Kirche.“ Gleichzeitig protestiert er gegen den Gebrauch der Folter.
30. 10 1307 - Englands König glaubt nicht an die Vorwürfe gegen die Templer
London - Paris * König Eduard II. von England antwortet dem Regenten der Franzosen, König Philipp IV., er glaube kein Wort von den gegen die Templer erhobenen Vorwürfe.
12 1307 - Die „Templer-Würdenträger“ widerrufen ihr Geständnis
Paris * Der „Großmeister der Templer“, Jacques de Molay, und die anderen „Templer-Würdenträger“ widerrufen ihr Geständnis vor zwei vom Papst entsandten Bischöfen und begründeten dieses mit ihrer Angst vor der Folter.
Um 1308 - Herzog Ludwig der Baier heiratet Beatrix von Schlesien-Schweidnitz
München * Herzog Ludwig der Baier heiratet Herzogin Beatrix von Schlesien-Schweidnitz, „die Tochter des edlen Polenherzogs Balko I.“.
1308 - Wilhelm von Ockham beginnt sein Studium der Theologie
Oxford * Wilhelm von Ockham beginnt sein Studium der Theologie an der „Universität Oxford“.
2 1308 - Der Papst ist von der Unschuld der „Tempelherren“ überzeugt
Avignon - Paris * Der Papst, der inzwischen von der Unschuld der „Tempelherren“ überzeugt ist, suspendiert die Vollmachten der „Inquisitoren“.
Die inhaftierten „Templer“ bleiben allerdings in den Gefängnissen des Königs.
Auch wenn die Vernichtung des „Templer-Ordens“ vorerst fehlgeschlagen ist, so lässt König Philipp IV. dennoch nicht locker.
3 1308 - König Philipp IV. überhäuft den Papst mit Drohungen
Paris - Avignon * Frankreichs König Philipp IV. überhäuft den Papst mit Drohungen, lässt ihn der „Häresie“ bezichtigen und schickt ihm gleichzeitig ausgewählte „Tempelherren“, die ihre früheren Geständnisse wiederholen.
5 1308 - Papst Clemens V. wird der Wille gebrochen
Poitiers * Papst Clemens V. wird bei der Zusammenkunft in Poitiers endgültig der Wille zum Widerstand genommen.
Mit den führenden „Templern“, Jacques de Molay und Hugues de Pairaud, die in Chinon inhaftiert sind, trifft der „Pontifex maximus“ nie zusammen, weshalb sie ihm auch nie ihre Sicht der Dinge erklären können.
Deshalb beginnt der Papst allmählich selbst an der Unschuld der „Tempelherren“ zu zweifeln und hebt die „Suspension der Inquisitoren“ wieder auf.
1309 - Herzog Ludwig der Baier regiert das Teilherzogtum Niederbaiern mit
Landshut * Herzog Ludwig der Baier wird - gegen den erklärten Willen der Mutter - Vormund der unmündigen Kinder seines verstorbenen Vetters Stephan I. und regiert dessen Teilherzogtum in Niederbaiern.
1309 - Die Päpste regieren nicht mehr in Rom, sondern in Avignon
Rom - Avignon * Die Päpste regieren nicht mehr in Rom, sondern in Avignon, wohin Papst Clemens V. seine Residenz verlegt.
Ab 8. 8 1309 - Die päpstliche Kommission verhört 546 Templer
Paris * Die päpstliche Kommission nimmt in Paris ihre Arbeit auf und verhört insgesamt 546 Templer, die aus dem ganzen Königreich Frankreich kommen.
1310 - Erstmalige schriftliche Nennung der „Jakobi-Dult“
München-Angerviertel * Erstmalige schriftliche Nennung der „Jakobi-Dult“.
1310 - Die älteste Münchner „Floßordnung“ und ihre Strafen
München * In der ältesten Münchner „Floßordnung“ ist der Preis für die Beförderung des Weines und Strafen für die Beschädigung des Weinfasses oder unerlaubtes Trinken aus dem Fass festgelegt.
1310 - Juden dürfen den Christen die Teile geschlachteter Tiere verkaufen
München * Die Juden dürfen den Christen die Teile geschlachteter Tiere verkaufen, die zu verzehren ihnen verboten sind.
1310 - Vier „Templer“ sagen vor der „Päpstlichen Kommission“ aus
Paris * Vier Vertreter des „Templer-Ordens“ sagen vor der „Päpstlichen Kommission“ aus:
Man habe „außerhalb des französischen Königreichs, auf der ganzen Welt keinen einzigen Templerbruder gefunden, der diese Lügen sagt oder gesagt hat, woraus man recht deutlich den Grund ersieht, weshalb diese Lügen im französischen Königreich ausgesprochen werden: weil diejenigen, die sie gesagt haben, durch Furcht, Gebete oder Geld korrumpiert waren“.
1310 - Die „Floßlände“ wird erstmals genannt
München-Lehel * Die „Floßlände“ - nördlich der heutigen „Ludwigsbrücke“ - wird erstmals genannt.
1. 10 1310 - Die Herzöge Ludwig IV. und Rudolph I. teilen sich die Macht
München * Herzog Ludwig IV. der Baier setzt bei seinem älteren Bruder Herzog Rudolph durch, dass Baiern durch eine Nutzungsteilung in einen Landesteil Baiern-Ingolstadt-Amberg, in dem Ludwig regiert, und in einen Landesteil München-Burglengenfeld, in dem Rudolph das Sagen hat, zerlegt wird.
1311 - Papst Clemens V. befiehlt die Anwendung der „Folter“
Avignon * Papst Clemens V. befiehlt, dass die „Templer“ dort, wo dies noch nicht geschehen ist, der „Folter“ zu unterziehen sind.
Das ist die Iberische Halbinsel, Norditalien, Deutschland und England.
1311 - Das „Franziskaner-Kloster“ wird ein Raub der Flammen
München-Angerviertel * Der Klosterbau der „Franziskaner-Ordensmänner“ wird ein Raub der Flammen.
1311 - Eine „Walkmühle“, ein „Loder-Ram“ und ein „Lohstampf“
München-Lehel * Eine „Walkmühle“ zur Tuchbereitung sowie ein „Loder-Ram“, ein Eisenrahmen, auf dem das Tuch gespannt wird, sind im später so genannten „Lehel“ entstanden.
Auch die Lederer betreiben hier ihren „Lohstampf“.
5. 6 1311 - Die Ottonische Handfeste gibt den Ständen neue Privilegien
Landshut * Herzog Otto III. von Niederbaiern gewährt in der Ottonischen Handfeste den Niederbaierischen Ständen Privilegien und Rechte gegen die Leistung einer einmaligen Steuer. Der Adel, der Klerus sowie die Städte und Märkte erhalten dadurch für ihre Besitzungen die Niedere Gerichtsbarkeit.
16. 10 1311 - Auf dem Konzil zu Vienne wird der Templerorden aufgehoben
Vienne * Auf dem Konzil zu Vienne wird der Templerorden aufgehoben. Gleichzeitig entscheidet das Konzil aber auch, dass die Templer der ihnen vorgeworfenen Häresie und Blasphemie nicht überführt sind. Bis dahin geht der König rücksichtslos gegen die Templer vor. Geständnisse werden durch die Folter erzwungen und der Widerruf durch Verbrennen geahndet. Trotzdem sterben viele Templer lieber im Feuer, als ihren Widerruf zurückzuziehen.
1312 - Neben Wein, Met und Bier wird immer auch „Greußing“ erwähnt
München * Neben Wein, Met und Bier wird immer auch „Greußing“ erwähnt.
„Greußling“ ist ein Bier, das aus Gerste oder Weizen, mit einem geringen Anteil an Hopfen, aber einem Zusatz an Kräutern eingesotten wird.
Es ist um 25 Prozent teuerer als Bier.
Damals heißt es: „Greußing soll man schenken pro Eimer (circa 64 Liter) um 40 Pfennig und das Bier den Eimer um 30 Pfennig“.
1312 - Ludwig der Baier wird Vormund der Kinder seines Vetters Otto III.
München - Landshut * Herzog Ludwig der Baier wird Vormund der unmündigen Kinder seines verstorbenen Vetters Otto III. und regiert nun auch dessen Teilherzogtum in Niederbaiern. Auch Ottos III. Witwe wehrt sich gegen diese Vormundschaft und hätte ihre Söhne lieber in österreichischer Obhut gesehen.
Außerdem sieht Herzog Rudolph den Machtzuwachs seines Bruders mit argwöhnischen Augen.
22. 3 1312 - Papst Clemens V. hebt den „Templerorden“ auf
Avignon * Ungeachtet der Konzilsmeinung hebt Papst Clemens V. den „Templerorden“ durch die Bulle „Vox in excelso“ auf.
In der Begründung heißt es, dass allein schon durch den nunmehr schlechten Ruf des Ordens eine derartige Maßnahme notwendig sei, um weiteren Schaden von der Gesamtkirche abzuwenden.
Anschließend übereignet der Papst durch die Bulle „Ad providam“ die Güter des Ordens den „Johannitern“.
In Deutschland übernimmt der „Deutschherrenorden“ den „Templer-Reichtum“ für sich.
Doch der Vollzug dieser Anordnung geht nur langsam vonstatten, und in Frankreich eignet sich König Philipp den größten Teil des verfügbaren Besitzes an, da er für die Abwicklung des Prozesses entsprechende Rechnungen stellt.
1313 - Die „Giesinger Mühle“ liefert an das „Kloster Schäftlarn“
Untergiesing * Die „Giesinger Mühle“ liefert jährlich „11 Metzen Getreide, 30 Pfennig Regensburger Währung, 100 Eier und 10 Käse“ an das „Kloster Schäftlarn“.
Wann der „Schrafnagel-Müller“ die Mühle seinen Besitz nennen kann, ist ungeklärt.
Wahrscheinlich war dies schon im 14. Jahrhundert.
21. 6 1313 - Die Herzöge Rudolph und Ludwig der Baier schließen einen Hausvertrag
München * Die Herzöge Rudolph I. und Ludwig IV. der Baier schließen einen Hausvertrag, in dem wieder die gemeinsame Herrschaft festgeschrieben wird. Außerdem soll Herzog Rudolph I. die Kurwürde vorenthalten bleiben.
24. 8 1313 - Der römische König Heinrich VII. von Luxemburg stirbt
Bounconvento/Siena * Der römische König Heinrich VII. von Luxemburg stirbt und damit beginnt ein Feilschen um seine Nachfolge. Vier Fürsten bewerben sich um seine Nachfolge.
- Die meisten Chancen werden Heinrichs Sohn, König Johann von Böhmen, und dem österreichischen Herzog Friedrich der Schöne zugeschrieben.
- Als wenig chancenreich werden dagegen die Bewerbungen von Graf Wilhelm III. von Holland-Hennegau und Herzog Ludwig IV. von Baiern angesehen.
9. 11 1313 - Die Schlacht bei Gammelsdorf
Gammelsdorf * In der Schlacht bei Gammelsdorf, unweit von Moosburg, schlägt Herzog Ludwig IV. der Baier die Truppen der Habsburger und seines Bruders Rudolph.
Sein schneller Sieg wird durch das schlechte Wetter und einen dementsprechend morastigen Kampfplatz begünstigt. Im Aufgebot Herzog Ludwig des Baiern kämpfen oberbaierische Adelige und Bürger niederbaierischer Städte gegen österreichische und niederbaierische Ritter.
Die militärische Auseinandersetzung flammte auf, nachdem Österreich - unterstützt von Herzog Rudolph - Einfluss auf die niederbaierischen Angelegenheiten nehmen wollte. Dabei geht es konkret um die Vormundschaft der drei unmündigen Herzöge von Niederbaiern, den Kindern der verstorbenen Herzöge Stephan I. und Otto III..
1314 - Konrad III. „der Sendlinger“ wird zum Bischof von Freising gewählt
Freising * Konrad III. „der Sendlinger“ wird zum Bischof von Freising gewählt.
18. 3 1314 - Jacques de Molay und Geoffroy de Charnay werden verbrannt
<p><strong><em>Avignon - Paris</em></strong> * Die Verfügungsgewalt über die höchsten Würdenträger des Templer-Ordens hat sich der Papst vorbehalten. Sie werden von einem Kardinalskollegium zu lebenslanger Haft verurteilt. Zwei von ihnen, der Großmeister Jacques de Molay und der Praeceptor der Normandie, Geoffroy de Charnay, pochen auf ihre Unschuld und lehnen das Urteil ab.</p> <p>Jacques de Molay und Geoffroy de Charnay werden - ohne Rücksicht auf den Papst - noch am gleichen Tag auf der Ile de la Cité in Paris verbrannt. Der letzte Templer-Großmeister soll den Papst und den König noch auf dem Scheiterhaufen verflucht haben, weshalb Clemens V. später <em>„der verfluchte Papst“</em> genannt wird. Der Templer-Prozess ist bis heute einer der ganz großen Justizskandale geblieben. Dem Templer-Orden wurde bis zum heutigen Tage keine Genugtuung erteilt.</p> <p>Das Hauptziel der Verfolgung der Tempelherren durch König Philipp <em>„dem Schönen“</em>, sich das bewegliche Vermögen des Ritterordens anzueignen, war allerdings gescheitert. Der sagenhafte Schatz der Templer wird nie gefunden, sein Verbleib nie geklärt. Das bildet wiederum die Grundlage für eine Vielzahl von Spekulationen. Und kein Orden bot so viel Anlass zu Spekulationen wie der der Templer.</p> <p>Durch ihr Engagement im Heiligen Land kamen die Tempelritter mit Traditionen der jüdischen Welt, des Islam und nicht zuletzt der Antike in Berührung, die ihren mittelalterlichen Horizont enorm erweiterten. Ihre beachtlichen Erfolge auf technischem und finanziellem Gebiet lassen sich darauf zurückführen. Sie entwickelten ein eigenes Weltbild, das höchstwahrscheinlich als Fernziel die Vereinigung der monotheistischen Religionen anstrebte. </p> <p>Gleichzeitig musste der Ritter-Orden erkennen, dass sein neu erworbenes Wissen für das abergläubische mittelalterliche Europa noch nicht nachvollziehbar war und deshalb Schwierigkeiten heraufbeschwören musste. So wurde vieles geheim gehalten, und aus diesen Geheimnissen entstanden sowohl die „Arroganz der Wissenden“ als auch viele Legenden.</p>
Nach 4 1314 - Wirklich aufgehoben wird der „Tempel-Ritterorden“ nur in Frankreich
Paris * Wirklich aufgehoben wird der „Orden der Tempel-Ritter“ nur in Frankreich.
In Aragón werden sie ähnlich wie in Frankreich behandelt, in England ergreift King Edward II. zunächst die Partei des Ordens und schwenkt später - nur widerwillig - auf die päpstlich-französische Linie ein, sodass die „Tempelritter“ der Verfolgung größtenteils entgehen.
In Schottland wird die „päpstliche Bulle“ nie verkündet, weshalb der „Templerorden“ dort ungehindert fortleben kann.
Im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ findet eine Verfolgung der „Templer“ nicht statt. Sie schließen sich nach der offiziellen Auflösung des „Ordens“ den „Johannitern“ oder dem „Deutschen Orden“ an.
20. 4 1314 - Der „verfluchte Papst“ Clemens V. stirbt
<p><strong><em>Roquemaure</em></strong> * Der <em>„verfluchte Papst“</em> Clemens V. stirbt im Jahr der Ermordung der Tempelherren in Roquemaure in Frankreich.</p>
8 1314 - Die luxemburgische Partei verzichtet auf die Kandidatur
Frankfurt am Main * Auf Vorschlag des Mainzer Erzbischofs verzichtet die luxemburgische Partei auf die Kandidatur König Johanns von Böhmen zum römischen König und unterstützt dagegen Herzog Ludwig den Baiern.
Da sich trotz des Kandidatenwechsels keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse abzeichnen, droht eine Doppelwahl mit anschließendem Thronkampf.
19. 10 1314 - Herzog Friedrich der Schöne wird zum Deutschen König gewählt
Sachsenhausen * Baierns Herzog Rudolph I., der Kölner Kurfürst, der Herzog von Sachsen-Wittenberg und der Böhmenkönig aus dem Haus der Herzöge von Kärnten wählen in Sachsenhausen bei Frankfurt den Habsburger Friedrich den Schönen zum Deutschen König.
20. 10 1314 - Herzog Ludwig der Baier wird zum Deutschen König gewählt
Frankfurt am Main * Die Kurfürsten von Mainz, Trier und Brandenburg sowie der Herzog von Sachsen-Lauenburg wählen Herzog Ludwig den Baiern ebenfalls zum Deutschen König.
25. 11 1314 - Die Herzöge Ludwig IV. und Friedrich werden zu Königen gekrönt
Bonn - Aachen * Herzog Friedrich der Schöne, in dessen Besitz sich die Reichskleinodien befinden, wird vom richtigen Coronator, dem Erzbischof von Köln, am falschen Ort - in Bonn - zum König gekrönt.
Herzog Ludwig der Baier wird am richtigen Ort, der Pfalzkapelle in Aachen, vom falschen Coronator, den Mainzer Erzbischof, zum König gekrönt. Ein Thronkampf ist damit unvermeidlich geworden.
29. 12 1314 - König Philipp IV. stirbt
Frankreich * Frankreichs König Philipp IV., der sich bei der Verfolgung der Templer hervorgetan hat, stirbt.
1315 - Die Herzöge Rudolph I. und Ludwig IV. vereinbaren eine Zusammenarbeit
München * Die herzoglichen Brüder Rudolph und Ludwig der Baier vereinbaren ihre Zusammenarbeit. Rudolph kennt Ludwig als Römischen König an.
18. 2 1315 - König Ludwig der Baier gewährt den Münchnern Schutz und Geleit
<p><strong><em>München</em></strong> * König Ludwig IV. der Baier gewährt<em> „den Münchner Bürgern, ihrem Gut und ihren Boten“</em> Schutz und Geleit im ganzen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und natürlich in den baierischen Herzogtümern. </p>
18. 4 1315 - König Ludwig der Baier ist wieder in München
<p><strong><em>München</em></strong> * König Ludwig IV. der Baier ist - nach seiner Krönung - erstmals wieder in München. </p>
21. 4 1315 - Ludwig der Baier befreit das Angerkloster von allen Steuern
<p><strong><em>München-Angerviertel</em></strong> * König Ludwig IV. der Baier befreit das Angerkloster von allen Steuern. </p>
29. 4 1315 - Die vier baierischen Herzöge treffen sich in München
<p><strong><em>München</em></strong> * Die vier baierischen Herzöge [König Ludwig IV. der Baier und die Herzöge Rudolf, Heinrich und Otto] treffen sich in München zu einer Unterredung. </p>
6. 5 1315 - König Ludwig IV. der Baier und der Burgfrieden
München * König Ludwig der Baier äußert sich zum Burgfrieden wie folgt: „in der stat und uberal in den gerichtt, daz zu derselben stat gehört“.
6. 5 1315 - König Ludwig der Baier schließt mit seinem Bruder einen Vertrag
München * König Ludwig IV. der Baier schließt mit seinem Bruder Herzog Rudolph I. einen Sühnevertrag, in dem sie
- ihre Zusammenarbeit vereinbaren und
- Herzog Rudolph I. seinen Bruder Ludwig IV. als Römischen König anerkennt.
6. 5 1315 - Sicheres Geleit für alle Kaufleute im Münchner Stadtgebiet
München * König Ludwig IV. der Baier erteilt allen Kaufleuten „sicheres Geleit“ im Münchner Stadtgebiet.
Um den 15. 5 1315 - Herzog Ludwig V., später genannt der Brandenburger, wird geboren
??? * Herzog Ludwig V., später genannt der Brandenburger, wird als Sohn König Ludwigs IV. der Baier an einem nicht bekannten Ort geboren.
16. 7 1315 - München das Recht, schädliche Leute im Herzogtum zu fangen
München * König Ludwig IV. der Baier erteilt der Stadt München das Recht, „schädliche Leute“ im ganzen Herzogtum Baiern zu fangen und vor dem Stadtgericht zu verurteilen, nicht jedoch hinzurichten.
21. 7 1315 - König Ludwig der Baier erlässt das erste Münchner Judenrecht
München * König Ludwig IV. der Baier erlässt das erste Münchner Judenrecht. Es entspricht dem Augsburger Judenrecht und hebt gleichzeitig alle entgegenstehenden Vorschriften auf.
22. 12 1315 - Die Diözesan-Beschreibung des Bischofs Konrad III.
Freising * Im Auftrag des Freisinger Bischofs Konrad III. dem Sendlinger wird eine Diözesan-Beschreibung gefertigt, die sogenannte Konradinische Matrikel.
Sie beinhaltet sämtliche fürstbischöfliche Besitzungen und zählt gleichzeitig alle Einnahmen auf. Daneben enthält sie eine präzise Diözesanbeschreibung, die alle Kirchen, Kapellen, Klöster und Friedhöfe aufführt.
- Nach der Konradinischen Matrikel ist das Bistum Freising in 18 Dekanate eingeteilt, die insgesamt 233 Pfarreien, 564 Filialkirchen und 22 weitere Kapellen umfassen.
- Das rechte Isarufer gehört bis hinunter zur Menterschwaige zur Pfarrei Bogenhausen, die wiederum dem Dekanat Ismaning unterstellt ist.
- Die Pfarrei Bogenhausen umfasst die Filialkirchen mit Begräbnisstätten in Haidhausen, die Leprosenkirche am Gasteig, sowie die in Giesing, Trudering, Riem, Gronsdorf, Haar und Harthausen, einer im Dreißigjährigen Krieg untergegangenen Siedlung bei der heutigen Menterschwaige.
- Aus der Konradinischen Matrikel geht auch hervor, dass die zum Dekanat Ismaning gehörende Pfarrkirche in Baumkirchen eine Filialkirche in Pachem besitzt.
- In dieser Matrikel findet sich erstmals eine farbige Abbildung des Hochstiftswappen, das den Freisinger Mohr enthält.
19. 2 1316 - König Ludwig IV. hebt das Grundruhrrecht auf
Ingolstadt * König Ludwig IV. hebt das „Grundruhrrecht“ auf der Isar und allen anderen baierischen Gewässern auf. Dadurch gehört das auf einem gestrandeten Schiff oder Floß befindliche Gut nicht mehr dem Finder oder demjenigen, an dessen Grundstück es ans Land gespült wird, sondern es bleibt weiterhin im Eigentum des Eigentümers.
26. 3 1316 - Die Kaufingerstraße wird erstmals genannt
München-Kreuzviertel - München-Hackenviertel * Die Kaufingerstraße [= „Kaufringergazz“] wird erstmals genannt.
1. 5 1316 - Ludwig der Baier erlässt für die Siechen am Gasteig eine Hausordnung
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * König Ludwig der Baier erlässt für die Siechen am Gasteig eine Hausordnung. Die Ordnung enthält unter anderem eine Vorschrift, wonach <em>„aus der ganzen Versammlung der siechen Menschen”</em> ein Hausmeister und eine Hausmeisterin benennen sind, die auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten haben. Die Spital-Insassen müssen ihnen Gehorsam leisten.</p> <p>Übertretungen einzelner Bestimmungen haben zum Teil sehr empfindliche Strafen für die Kranken zur Folge. Disziplinierungsmittel sind vorgesehen. Sie reichen von Geldstrafen bis zu Fasten bei Wasser und Brot, dem Essen auf dem Stubenboden, der Verrichtung von vorgeschriebenen Gebeten - kniend auf dem Stubenboden - in Anwesenheit der anderen Spitalinsassen. Selbst Strafen in der Kheichen, dem Kerker, bei Wasser und Brot, sind unter bestimmten Umständen möglich.</p> <ul> <li>Mit vier Stunden nehmen die religiösen Übungen und Gebete den größten Teil des Tages ein.</li> <li>Die Arbeitszeiten zugunsten des Leprosenheims werden auf dreieinhalb Stunden pro Tag begrenzt.</li> <li>Commissionäre überwachen die Arbeit im Siechen-Spital. </li> </ul> <p>Mittelalterliche Spendentätigkeit hat sehr viel mit dem Seelenheil des Geldgebers zu tun. Je größer deren Spendierfreudigkeit ausfällt, desto länger sind die Gebete der Almosenempfänger und desto schneller kommen die Reichen dem <em>„Paradies“</em> ein Stückchen näher.</p> <p>Das Leprosenhaus ist vornehmlich für Münchner Bürger und die in der Stadt Dienenden bestimmt. <br /> Nur sie erhalten hier unentgeltliche Aufnahme und Verpflegung. Für die <em>„Auswärtigen Siechen”</em> müssen die zuständigen Landgerichte die anfallenden Kosten übernehmen.</p>
7. 8 1316 - Johannes XXII. besteigt den Apostolischen Stuhl in Avignon
Leyden * Der 67-jährige französische Kardinal Jacques Duèze - in deutschen Quellen auch Jakob von Cahors genannt - wird in Leyden in den Niederlanden nach einem vierzigtägigen Conclave zum Papst gewählt. Als Johannes XXII. besteigt er den Apostolischen Stuhl in Avignon.
Zuvor hatte Dante die sieben italienischen Kardinäle beschworen, einen Italiener zum Papst zu wählen, der die Kurie wieder nach Rom bringen sollte. Das Ansinnen hatte jedoch gegen die 17 französischen Kardinäle keine Chance. Johannes XXII. ist der zweite in Avignon residierende Papst.
Im deutschen Thronstreit nimmt Johannes XXII. lange eine abwartende Haltung ein und betrachtet den Thron des Reiches als vakant.
1317 - König Ludwig der Baier verbietet das Bierbrauen
München * König Ludwig der Baier verbietet das Bierbrauen. Der Grund sind Missernten. Brotgetreide ist eben wichtiger als Braugetreide. Und den Durst stillt man am Besten mit Wein.
26. 2 1317 - Rudolph I. überlässt König Ludwig IV. Baiern und die Pfalz
München * Die herzoglichen Brüder Rudolf und Ludwig der Baier treffen eine Übereinkunft. Danach überlässt Herzog Rudolph I. seinem königlichen Bruder Baiern und die Pfalz, so lange Ludwig der Baier Krieg gegen den Habsburger Friedrich den Schönen führt.
1318 - In Portugal werden die „Tempel-Ritter“ von jedem Verdacht freigesprochen
Portugal * In Portugal werden die „Tempel-Ritter“ durch einen Untersuchungsausschuss von jedem Verdacht freigesprochen.
Sie ändern ihren Ordensnamen in „Christusorden“.
Dieser widmet sich in der Folgezeit der Seefahrt und hat so berühmte Mitglieder wie Vasco da Gama und Heinrich den Seefahrer.
Die portugiesischen Schiffe segeln deshalb auch unter dem berühmten „Tatzenkreuz der Templer“.
??? 1318 - Margarete von Tirol, später genannt „Maultasch“, wird geboren
Tirol * Margarete von Tirol, später genannt „Maultasch“, die Erbtochter Herzog Heinrichs von Kärnten und Tirol und Titularkönigs von Böhmen, wird geboren.
1318 - Das Speditionswesen ist durch die „Rott“ organisiert
Mittenwald * Das Speditionswesen ist in Mittenwald durch den „Verein der bürgerlichen Fuhrleute“, der sogenannten „Rott“, organisiert.
Die „Strata inferior“, die „Untere Straße“, die über den „Brenner“ durch die „Grafschaft Werdenfels“ führt, ist eine der „Haupttransitstrecken“.
Zahlreiche Ortschaften entlang dieses Verkehrsweges verdanken ihren Aufschwung diesem spätmittelalterlichen Handel und Verkehr. Neben den Städten Bozen, Meran, Innsbruck oder Schongau, sind dies in der „Grafschaft Werdenfels“ Mittenwald und Partenkirchen.
Für diesen Handel bildet sich ein Frachtwesen heraus, das unter dem Namen „Rottfuhrwesen“ bekannt ist.
Und so ist die „Rott“ organisiert:
An der Handelsstraße werden in Tagesabständen [20 bis 30 Kilometer] „Rottstationen“ [= Niederlagen] errichtet.
Den „Rottfuhrleuten“ dieser Stationen steht das alleinige und ausschließliche Recht zu, „Rottgüter“ gegen „Niederlagegeld“ und „Fuhrlohn“ von ihrer Station zur nächsten zu befördern.
Außerdem wird bereits von einem regen „Floßverkehr“ auf der ab Mittenwald floßbaren Isar berichtet.
1319 - König Ludwig der Baier befreit das Leprosenhaus am Gasteig von Lasten
Haidhausen * König Ludwig der Baier befreit das Leprosenhaus am Gasteig von allen landesherrlichen Abgaben, Steuern sowie Diensten und übergibt ihm Grundbesitz, um die Pflege der Kranken zu gewährleisten.
12. 8 1319 - Herzog Rudolf stirbt in England (?)
England * Herzog Rudolph I. stirbt in England (?).
10. 9 1319 - Der Freisinger Bischof vergrößert sein Land
München - Freising * König Ludwig der Bayer verkauft um 100 Mark Silber die Herrschaft über die Orte Ismaning, Niederföhring (heute Unterföhring), Oberföhring, Englschalking und Daglfing an das Hochstift Freising. Fürstbischof Konrad III. der Sendlinger von Freising wird erster Landesherr der aus diesen Orten gebildeten Grafschaft auf dem Yserrain, der späteren Grafschaft Ismaning, die bis zur Säkularisation 1802/03 Bestand haben wird.
Um 1320 - Wilhelm von Ockham übersiedelt nach London
London * Wilhelm von Ockham übersiedelt nach London, wo er im „Studienhaus der Franziskaner“ unterrichtet.
12. 4 1322 - Konrad III. „der Sendlinger“, der Bischof von Freising, stirbt in Freising
<p><strong><em>Freising</em></strong> * Konrad III. <em>„der Sendlinger“</em>, Bischof von Freising, stirbt in Freising. Angeblich hat ihn einer seiner Diener vergiftet. </p>
16. 6 1322 - Johann Wulfing von Schlackenwerth wird Bischof von Bamberg
Avignon - Bamberg * Papst Johannes XXII. ernennt Johann Wulfing von Schlackenwerth zum Bischof von Bamberg.
24. 8 1322 - Königin Beatrix von Baiern stirbt in München
München - München-Kreuzviertel * Königin Beatrix von Baiern, die erste Ehefrau von König Ludwig IV. dem Baiern, stirbt in München. Ihre Grabstätte befindet sich in der heutigen Münchner Frauenkirche. Mit ihrer Bestattung wird die Marienkapelle zur Hofkirche erhöht.
28. 9 1322 - Die Schlacht bei Mühldorf erzwingt die Entscheidung
<p><em><strong>Erharting</strong></em> * Ludwig der Baier und Friedrich der Schöne treffen mit jeweils Tausenden Kämpfern im Nordosten von Mühldorf aufeinander. Sie standen sich in über sieben Jahren sechs Mal gegenüber, wichen aber einer militärischen Auseinandersetzung immer wieder aus. Doch jetzt wollen die feindlichen Parteien endlich eine Entscheidung erzwingen.</p> <p>Die kriegerische Auseinandersetzung gilt als die letzte große Ritterschlacht auf deutschem Boden. Das Gefecht zieht sich übermehrere Stunden hin und fordert eine Unzahl von Toten. Der Thronkampf endet mit einem Sieg des taktisch klüger agierenden Königs Ludwig des Baiern. König Friedrich der Schöne wird gefangen genommen und auf die Burg Trausnitz bei Nabburg in der Oberpfalz gebracht. </p> <p>Das Kampffeld lag westlich der Gemeinde Erharting. Die Kriegshandlung ging aber als Schlacht bei Mühldorf beziehungsweise als Schlacht bei Ampfing in die Geschichte ein. </p>
10 1322 - Papst Johannes XXII. eröffnet einen Prozess gegen Ludwig den Baiern
Avignon * Papst Johannes XXII. erkennt Ludwig den Baiern nicht als römischen König an, weil ihm König Friedrich der Schöne Unterstützung im Kampf gegen die großen oberitalienischen Stadtkommunen in Aussicht gestellt hat. Daraufhin unterstützt König Ludwig der Baier die Visconti in Mailand, die sich dadurch erfolgreich gegen einen päpstlichen Kreuzzug erwehren können.
Papst Johannes XXII. eröffnet deshalb einen Prozess gegen König Ludwig des Baiern. Er ihn bezichtigt ihn
- der Anmaßung königlicher Rechte und
- seiner Regierung ohne päpstliche Approbation [Anerkennung, Genehmigung] sowie
- der Unterstützung der als Ketzer verurteilten italienischen Signori.
1323 - Wilhelm von Ockham wird der „Häresie“ bezichtigt
London * Wilhelm von Ockham wird der „Häresie“ bezichtigt.
Die Anklageschrift zählt 56 Lehrsätze auf, die als „Irrtümer“ angeprangert werden.
Um 4 1323 - Ludwig der Baier erhält in Nürnberg die Reichskleinodien
Nürnberg * Herzog Leopold von Österreich übergibt König Ludwig dem Baiern in Nürnberg die Reichskleinodien. Die Insignien der Macht werden umgehend in Ludwigs Residenzstadt München gebracht und in der eigens für diesen Anlass neu ausgestatteten Lorenzkapelle im Alten Hof untergebracht. Die Reichsinsignien werden dort bis 1350 aufbewahrt.
4 1323 - Ludwig IV. der Baier macht seinen achtjährigen Sohn zum Kurfürsten
München * Der achtjährige Herzog Ludwig V., später genannt der Brandenburger, wird von seinem Vater König Ludwig IV. mit der Markgrafschaft Brandenburg belehnt. Damit wird Ludwig V. der Brandenburger zu einem der sieben Kurfürsten.
Um den 5. 5 1323 - Das „Freisinger Domkapitel“ wählt Albert von Enn zum Bischof
Freising * Das „Freisinger Domkapitel“ wählt den Freisinger „Dompropst“ Albert von Enn zum Bischof.
Nachdem der Salzburger Erzbischof Friedrich III. von Leibnitz die Wahl nicht bestätigen will, muss Papst Johannes XXII. in Avignon eine Entscheidung herbeiführen.
12. 11 1323 - Papst Johannes XXII. bezieht Stellung zur Armutsfrage
Vienne * Papst Johannes XXII. bezieht auf dem Konzil von Vienne abschließend Stellung zur sogenannten Armutsfrage. Die Lehre, wonach Christus und die Apostel kein Eigentum besessen haben, sei eine Entstellung der Evangelien, womit diese Lehre grundsätzlich für irrtümlich und ketzerisch erklärt wird.
23. 12 1323 - Johann Wulfing von Schlackenwerth wird Freisinger Bischof
Avignon - Freising * Papst Johannes XXII. ernennt Johann Wulfing von Schlackenwerth zum Freisinger Bischof.
1324 - Wilhelm von Occham reist nach Avignon
Avignon * Wilhelm von Occham reist nach Avignon, um sich dem gegen ihn angestrengten Prozess zu stellen.
25. 2 1324 - König Ludwig der Baier heiratet die Gräfin Margarete von Holland
Köln * König Ludwig der Baier heiratet in Köln Gräfin Margarete von Holland, Seeland und Friesland.
20. 3 1324 - Bischof Johann Wulfing von Schlackenwerth begibt sich nach Freising
<p><strong><em>Bamberg - Freising</em></strong> * Der vom Papst Johannes XXII. zum Freisinger Bischof ernannte Johann Wulfing von Schlackenwerth begibt sich erst jetzt von Bamberg in sein neues Bistum. </p>
23. 3 1324 - Papst Johannes XXII. spricht den Bannfluch über Ludwig den Baiern
Avignon * Der in Avignon residierende Papst Johannes XXII. spricht den Bannfluch wegen Häresie über König Ludwig den Baiern aus. Er schließt ihn damit aus der Gemeinschaft der Kirche aus, in die Ludwig bis zu seinem Tod nicht wieder aufgenommen werden wird. In der katholischen Kirche gilt er bis heute als exkommuniziert.
Gleichzeitig enthebt ihn der Papst seiner königlichen Rechte und belegt das Reich mit Interdikt, also dem Verbot der Spendung der Sakramente. Der Bannfluch wird Ludwig bis zu seinem Tod verfolgen.
26. 4 1324 - Der Freisinger Bischof Johann Wulfing von Schlackenwerth stirbt
Freising * Der Freisinger Bischof Johann Wulfing von Schlackenwerth ist gerade einmal 5 Wochen und zwei Tage an seinem neuen Wirkungsort, dann stirbt er.
22. 5 1324 - König Ludwig der Baier klagt den Papst der Häresie an
Sachsenhausen * In der Sachsenhausener Appellation bezeichnet König Ludwig der Baier Papst Johannes XXII. wegen seiner Haltung in der viel diskutierten Armutsfage als „Schützer und Gönner ketzerischer Bosheit“ und klagt ihn der Häresie an. Der König benutzt dabei die Formulierung: „Johannes, der sich Papst nennt“ und dass er „ein Feind des Friedens“ sei.
4. 7 1324 - Albert von Enn wird Bischof von Brixen
Avignon - Brixen - Freising * Albert von Enn wird von Papst Johannes XXII. zum Bischof von Brixen ernannt. Damit endet die Auseinandersetzung um die Besetzung des Freisinger Bischofstuhls, der an Konrad IV. von Klingenberg übertragen wird.
5. 7 1324 - Konrad IV. von Klingenberg wird der neue Bischof von Freising
Avignon - Freising * Papst Johannes XXII. ernennt Konrad IV. von Klingenberg zum neuen Bischof von Freising.
8 1324 - Konrad IV. von Klingenberg muss aus Freising flüchten
Freising - Konstanz * Obwohl das königstreue Freisinger Domkapitel den neuen Bischof nicht anerkennt, zieht Konrad IV. von Klingenberg in Freising ein. Ende August kommt es zu einem kleinen Gefecht zwischen den Anhängern König Ludwigs IV. des Baiern und den Gefolgsleuten Bischof Konrads IV. von Klingenberg. Bei der Auseinandersetzung wird der Bischof verletzt und muss nach Konstanz fliehen.
30. 11 1324 - Herzog Ludwig V. wird mit Margarete von Dänemark verheiratet
Wørdingborg * Der neunjährige Herzog Ludwig V. „der Brandenburger“ wird mit Margarete, der 18-jährigen Tochter des dänischen Königs, in Wørdingborg verheiratet.
23. 12 1324 - Albert von Enn tritt seine Bischofsstelle in Brixen an
Brixen * Albert von Enn tritt seine Bischofsstelle in Brixen an.
13. 3 1325 - Friedrich der Schöne erkennt Ludwig IV. alsrömischen König an
<p><strong><em>Nabburg</em></strong> * Mit der sogenannten „<em>Trausnitzer Sühn“</em> versöhnt sich König Ludwig der Baier mit Friedrich dem Schönen auf der Burg Trausnitz bei Nabburg in der Oberpfalz. Friedrich erkennt Ludwig als römischen König an und verpflichtet sich, ihn bei seinem Kampf gegen den Papst zu unterstützen. Dafür erhält er die Freiheit.</p>
12. 6 1325 - König Ludwig IV. der Baier stellt Freising unter seinen besonderen Schutz
Freising * Bei seinem Besuch stellt König Ludwig IV. der Baier die Stadt Freising unter seinen besonderen Schutz.
5. 9 1325 - Ludwig der Baier und Friedrich der Schöne werden Doppelregenten
München * Im Münchner Vertrag vereinbaren König Ludwig der Baier und Herzog Friedrich der Schöne eine gleichberechtigte Doppelregentschaft, der den Habsburger zum Mitregenten macht.
Ab 1326 - Die Theorie vom Vorrang des weltlichen Herrschers über die Kirche
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Im Umkreis des Franziskanerklosters und des Alten Hofs lebt Dr. Marsilius von Padua. Der Arzt, Jurist und Theologe ist der Autor des <em>„Defensor pacis“</em>. Er begründet darin die politische Theorie vom Vorrang des weltlichen Herrschers über die Kirche, die letztlich auch zur Säkularisation beitragen soll.</p>
1326 - Ockhams Ansichten werden als „häretisch oder irrig“ bezeichnet
<p><strong><em>Avignon</em></strong> * Im abschließenden Gutachten werden von 51 Lehrsätzen Occhams 29 als <em>„häretisch oder irrig“</em>, die übrigen 22 als <em>„möglicherweise falsch“</em> bezeichnet.</p> <p>Unter anderem wurde Ockham des<em> „Pelagianismus“</em> für schuldig befunden. [Der <em>„Pelagianismus“</em> lehrt, dass die menschliche Natur – von Gott stammend – auch göttlich ist und dass der sterbliche Wille in der Lage sei, ohne göttlichen Beistand zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.</p> <p>Damit steht seiner Verurteilung durch Papst Johannes XXII. nichts mehr im Wege, doch Ockham bleibt bis 1328 als Angeklagter in Avignon und es kommt aus unbekannten Gründen zu keinem Urteil.</p>
1 1326 - Ludwig der Baier bietet Papst Johannes XXII. einen Amtsverzicht an
<p><strong><em>München - Avignon</em></strong> * König Ludwig der Baier bietet Papst Johannes XXII. einen Amtsverzicht zugunsten seines Vetters Friedrich den Schönen an. Doch der Papst geht auf das Angebot nicht ein.</p>
13. 2 1327 - Der verheerendste Stadtbrand der Münchner Geschichte
<p><strong><em>München-Angerviertel</em></strong> * Beim <em>„ersten Hahnenschrei“</em> bricht im Angerkloster ein Feuer aus, das zum verheerendsten Stadtbrand der Geschichte Münchens wird. Fast ein Drittel der Stadt wird ein Opfer der Flammen. Dreißig Menschen sterben bei dem Großfeuer. </p>
14. 2 1327 - Verheerend wirkt sich der große Stadtbrand aus
<p><strong><em>München</em></strong> * Verheerend wirkt sich der große Stadtbrand aus. Er erfordert einen Neubau von Franziskaner-Kloster und Klosterkirche, der erst nach großzügigen Spenden der Kaufmannsfamilie Ridler im Jahr 1392 abgeschlossen werden kann.</p>
Um 3 1327 - König Ludwig der Baier bricht zu seinem Feldzug gegen Italien auf
München * König Ludwig der Baier bricht zu seinem Feldzug gegen Italien auf.
3. 4 1327 - Aus dem Dux Bavarie wird Ludwig aus Baiern
<p><strong><em>Avignon - München</em></strong> * Papst Johannes XXII. spricht König Ludwig IV. sogar das Herzogtum ab. Aus dem <em>„Dux Bavarie“</em> wird nun <em>„Ludovicus de Bavaria“</em>, also <em>„Ludwig aus Baiern“</em> oder eben <em>„Ludwig der Baier“</em>. </p>
17. 5 1327 - König Ludwig der Baier zieht in Mailand ein
Mailand * König Ludwig der Baier zieht in Mailand ein. Um seinen Herrschaftsanspruch auf Italien zu demonstrieren, lässt er sich mit der „Eisernen Krone der Langobarden“ krönen.
11. 10 1327 - König Ludwig der Baier zieht triumphal in Pisa ein
Pisa * Nach einer einmonatigen Belagerung zieht König Ludwig der Baier triumphal in Pisa ein. Er macht die Stadt zu seinem wichtigsten Stützpunkt in Italien.
11 1327 - Bischof Konrad IV. von Klingenberg zieht in Freising ein
Freising * Nachdem König Ludwig IV. der Baier im März nach Italien aufbrechen ist, kann sich Bischof Konrad IV. von Klingenberg die Unterstützung des niederbaierischen Herzogs Heinrich XIV. erschleichen und in Freising einziehen.
1. 12 1327 - Der Franziskaner-General Michael von Cesena trifft in Avignon ein
Avignon * Der Ordensgeneral der Franziskaner, Michael von Cesena, trifft, von Papst Johannes XXII. nach Avignon zitiert, in der Stadt ein. Er wohnt dort im Franziskanerkonvent, wo auch Wilhelm von Ockham untergebracht ist.
Ockham, der sich bisher auf theologische und philosophische Fragen konzentriert hatte und kirchenpolitisch kaum hervorgetreten war, sieht sich zur Auseinandersetzung mit dem Armutsstreit veranlasst.
Michael von Cesena überzeugt Wilhelm von der Richtigkeit der Armutsforderung und dass die gegenteiligen Verordnungen des Papstes häretisch sind. Daraus ziehen die beiden Franziskaner die Konsequenz, dass der Papst vom wahren Glauben abgefallen sei.
21. 12 1327 - König Ludwig der Baier bricht von Pisa in Richtung Rom auf
Pisa - Rom * König Ludwig der Baier bricht von Pisa in Richtung Rom auf.
1328 - Konstruiertes Gründungsjahr der „Augustiner-Brauerei“
München-Kreuzviertel * Dieses Jahr wird als Gründungsjahr der „Augustiner-Brauerei“ angenommen.
Die älteste auffindbare Urkunde stammt allerdings aus dem Jahr 1411.
Ab 1328 - Michael von Cesena lebt im „Franziskaner-Kloster“
München-Graggenau * Michael von Cesena, der anno 1316 zum „Generaloberen der Franziskaner“ gewählt worden war und der wegen der „Armutsfrage“ in Konfrontation mit Papst Johannes XXII. steht, lebt im „Franziskaner-Kloster“.
7. 1 1328 - Ludwig der Baier erreicht die Ewige Stadt Rom
Rom * König Ludwig der Baier erreicht mit seinem Heer aus etwa 4.000 Reitern und zahlreichem Fußvolk die Ewige Stadt Rom.
17. 1 1328 - König Ludwig der Baier wird in Rom zum Kaiser gekrönt
Rom * König Ludwig IV., der Baier, wird in Rom unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und in feierlicher Zeremonie erstmals zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gekrönt. An Stelle des Papstes vollziehen zwei kaisertreue - und gebannte - Bischöfe die Krönung.
18. 4 1328 - Kaiser Ludwig der Baier setzt Papst Johannes XXII. wegen Häresie ab
<p><strong><em>Rom - Avignon</em></strong> * Kaiser Ludwig der Baier setzt Papst Johannes XXII. unter dem Vorwurf der Häresie ab und lässt den Beschluss durch eine Volksversammlung bestätigen.</p> <p>Papst Johannes XXII. schickt daraufhin im Gegenzug eine Bannbulle nach Rom, worauf Ludwig der Baier für ihn die Todesstrafe wegen Ketzerei verkündet.</p>
12. 5 1328 - Der Franziskaner Pietro Rainalducci wird zum Papst Nikolaus V.
Rom * Kaiser Ludwig der Baier lässt den Franziskaner Pietro Rainalducci vom römischen Volk zum Papst Nikolaus V. wählen.
26. 5 1328 - Ludwig der Baier stellt die flüchtigen Franziskaner unter seinen Schutz
Pisa * Michael von Cesena, Wilhelm von Ockham und die Franziskaner Bonagratia von Bergamo und Franz von Marchia fliehen aus Avignon und begeben sich auf dem Seeweg nach Pisa. Dort treffen sie auf König Ludwig den Baiern. Dieser stellt die flüchtigen Franziskaner unter seinen Schutz.
27. 5 1328 - Kaiser Ludwig der Baier und Papst Nikolaus V. krönen sich gegenseitig
Rom * Kaiser Ludwig der Baier und Papst Nikolaus V. krönen sich gegenseitig. Größere Bedeutung erlangt Nikolaus V. nie. Nach Ludwigs Kaiserkrönung und seiner Abreise aus Rom findet er nicht einmal mehr genug Anhänger in Italien. Sein eigentliches Ziel, den Papst in Avignon zu schwächen, ist gescheitert.
20. 7 1328 - Wilhelm von Ockham wird vom Papst exkommuniziert
Avignon * Wilhelm von Ockham wird von Papst Johannes XXII. exkommuniziert. Er wird nun zu einem Vorkämpfer der Gegner des Papstes und beginnt sich intensiv mit politischen und kirchenrechtlichen Grundsatzfragen zu befassen. Insbesondere dem Verhältnis zwischen weltlicher und geistlicher Macht und den Grenzen der Befugnisse des Papstes.
1329 - Die 11-jährige Margarete wird mit dem 7-jährigen Johann Heinrich verheiratet
Tirol * Die elfjährige Margarete von Tirol, später genannt „Maultasch“, wird mit dem siebenjährigen Johann Heinrich, dem Sohn König Johanns von Böhmen aus dem Hause Luxemburg, verheiratet.
1329 - Streit zwischen den „Franziskanern“ und der Pfarrgeistlichkeit
München-Graggenau * Da bei den Beerdigungen sogenannte „Stol-Gebühren“ fällig werden, kommt es zum Streit zwischen den „Franziskanern“ und der Pfarrgeistlichkeit von „St.-Peter“ und „Unserer Lieben Frau“.
Man einigt sich auf einen Modus: Die für den „Franziskaner-Friedhof“ bestimmten Leichen müssen zuvor in den zuständigen Pfarrkirchen ausgesegnet werden.
Anschließend werden sie in einer „Prozession“ zur „Franziskaner-Begräbnisstelle“ überführt.
4. 8 1329 - Der Vertrag von Pavia
Pavia * Mit dem Vertrag von Pavia versöhnt sich Kaiser Ludwig der Baier mit den Söhnen seines verstorbenen Bruders Rudolph I. [Rudolph II. und Rupprecht I.] und räumt ihnen die Pfalz am Rhein und die Oberpfalz als eigenes Landesfürstentum ein.
Beim Aussterben der einen Linie soll die andere ihre Territorien erben.
1330 - Die Münchner bauen ein Wehr in die Isar
Au * Die Münchner bauen in der Höhe der heutigen Marienklausenbrücke ein Wehr in die Isar, um damit das Flusswasser für die Festungsgräber, die Mühlen, die Floßlände und die Holztrift zur Stadt hin aufstauen zu können.
Dadurch entsteht zwischen der Isar und dem Hochufer ein Streifen Trockenland - die Au.
1330 - Der „Lenzbauernhof“ als Freisinger Domkapitel-Eigentum
Haidhausen * Der „Lenzbauernhof“ in Haidhausen wird als Freisinger Domkapitel-Eigentum erwähnt.
1330 - Der Franziskaner-Konvent erhält eine wertvolle Reliquie
München-Graggenau * Von besonderer Bedeutung für den Franziskaner-Konvent wird nun eine wertvolle Reliquie, nämlich ein Oberarmknochen des heiligen Antonius von Padua. Er ist als Geschenk Kaiser Ludwigs des Baiern nach München gelangt, jedoch in der Zeit der Großen Pest angeblich eingemauert worden.
1330 - Schon wieder eine Kinderhochzeit
Tirol * Die zwölfjährige Margarete „Maultasch“ von Tirol wird mit dem drei Jahre jüngeren Johann Heinrich von Luxemburg verheiratet.
Um 1330 - Das sogenannte „Gries“ wird in die Stadtmauer einbezogen
<p><strong><em>München-Graggenau - München-Angerviertel</em></strong> * Das sogenannte <em>„Gries“</em> wird in die Stadtmauer einbezogen und durch das Isartor abgeschlossen. Das Isartor ist damit offensichtlich der letzte Baustein in der Mauer und der Abschluss der Stadterweiterung. Nun kann auch eine Torwache für das <em>„Porta nova in valle“</em>, dem <em>„Neuen Tor im Tal“</em>, bestellt werden. </p>
Um 1 1330 - Wilhelm von Ockham trifft mit seinen Gefährten in München ein
München * Wilhelm von Ockham trifft mit seinen Gefährten in München ein, wo er bis zu seinem Tod bleibt.
Er kann seine Stellung als Berater des Kaisers festigen und hilft Kaiser Ludwig den Baiern auch im Ehestreit um Margarete von Tirol mit einem Gutachten.
2 1330 - Der Freisinger Bischof Konrad IV. von Klingenberg flüchtet nach Österreich
Freising * Nach der Rückkehr Kaiser Ludwigs IV. des Baiern aus Italien flüchtet der Freisinger Bischof Konrad IV. von Klingenberg nach Österreich. Das Bistum wird seither vom Freisinger Dompropst Leutold von Schaunberg verwaltet.
Aus Verärgerung lässt Bischof Konrad IV. von Klingenberg das Domkapitel durch Papst Benedikt XII. exkommunizieren - allerdings ohne jede Wirkung.
28. 4 1330 - Kaiser Ludwig der Baier stiftet das Kloster Ettal
Ettal * Kaiser Ludwig der Baier stiftet das Kloster Ettal.
25. 8 1330 - Der Gegenpapst Nikolaus V. verzichtet auf sein Amt
Avignon * Nachdem man ihm Leben und Pension zugesichert hat, verzichtet der Gegenpapst Nikolaus V. auf sein Amt, unterwirft sich Papst Johannes XXII. und begibt sich nach Avignon.
1332 - Die Falknerei wird zum festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens
München * Kaiser Ludwig der Baier hat festgelegt: „Es mögen auch die Ritter alle Kurzweil vol treiben, mit Pyrsen, mit Paizzen, mit Jagen“.
In der Folge werden die zur Falkenjagd notwendigen und kunstvoll gearbeiteten Gerätschaften zum Statussymbol und zum Kennzeichen der Zugehörigkeit zur Oberschicht. Damit ist die Falknerei zum festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens an den Fürstenhöfen geworden.
6. 11 1332 - München erhält das Recht der Salzniederlage und des Salzhandels
München * Kaiser Ludwig IV. der Baier bestätigt der Stadt München das Recht der Salzniederlage und des Salzhandels. Er gibt ihr damit ein regelrechtes Salzhandelsmonopol. Von Wasserburg her darf das Salz zwischen Landshut und dem Gebirge nur bei München über die Isar gebracht werden. Die Urkunde wird - wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung - mit einer Goldbulle besiegelt. Sie gilt als Magna Charta der Stadt.
Der Salzhandel ist - neben dem Handel mit Wein - die wichtigste Quelle des wirtschaftlichen Aufstiegs der Stadt und war schon 1158 ein Auslöser der Marktverlegung von Föhring nach Munichen.
1333 - Die Ehe wird „vollzogen“
Tirol * Die Ehe zwischen Herzog Ludwig „der Brandenburger“ und Margarete (von Dänemark) wird „vollzogen“.
Vor dem Jahr 1333 - Die „Bleichen“ sind im später so genannten „Lehel“ entstanden
München-Lehel * Die „Bleichen“, in der die Färber ihre Tücher zum Trocknen und Bleichen auslegen können, sind im später so genannten „Lehel“ entstanden.
16. 10 1333 - Der als Gegenpapst gescheiterte Nikolaus V. stirbt in Avignon
Avignon * Der als Gegenpapst gescheiterte Nikolaus V. stirbt in Avignon, wo er in der Franziskanerkirche beigesetzt wird.
4. 12 1334 - Papst Johannes XXII. stirbt in Avignon
Avignon * Papst Johannes XXII. stirbt in Avignon. Sein Nachfolger wird Benedikt XII..
2. 11 1336 - Albert von Enn, der Bischof von Brixen, stirbt
Brixen * Albert von Enn, der Bischof von Brixen und für die selbe Stelle in Freising vom Domkapitel gewählt, aber vom Papst nicht anerkannt, stirbt in Brixen.
5 1338 - Die Unabhängigkeit des gewählten Römischen Königs vom Papst
??? * Kaiser Ludwig der Baier manifestiert die Unabhängigkeit des gewählten Römischen Königs von einer Anerkennung durch den Papst.
1339 - Johann Heinrich von Luxemburg übernimmt die Regentschaft in Tirol
Tirol * Johann Heinrich von Luxemburg übernimmt die Regentschaft in Tirol.
18. 2 1339 - Noch eine Kinderhochzeit
München * Die 13-jährige Anna, Tochter Kaiser Ludwigs IV. des Baiern, wird in München mit dem elfjährigen Herzog Johann I. von Niederbaiern verheiratet.
1340 - Im „Stadtrechtsbuch“ finden sich Bestimmungen für den Brandfall
München * Im Münchner „Stadtrechtsbuch“ finden sich Bestimmungen über den Umgang im Brandfall.
Dort heißt es: „Wenn es in der Stadt brennt, müssen zu dem Feuer kommen, sobald die Sturmglocke läutet, alle Bader und ihre Gehilfen, die Amt haben, und ihre Badergeräte mitbringen, die Maurer und Zimmerer mit ihren äxten und die Kornmesser und Salzmesser und die Salzlader und die Auflader und die Holzleut mit ihren äxten und was sie haben, das dem Feuer gut ist; - wer nicht kommt, verliert sein Recht in der Stadt für ein Jahr - was ihnen verdirbt, wird von der Stadt ersetzt“.
1340 - Die Ortsbezeichnung Berg am Laim ist erstmals eindeutig
Berg am Laim * Durch den Zusatz „auf dem Laimb“ kann die Ortsbezeichnung „Berg“ erstmals Berg am Laim eindeutig zugeordnet werden.
7. 4 1340 - Bischof Konrad IV. von Klingenberg stirbt in Ulmerfeld
Ulmerfeld * Bischof Konrad IV. von Klingenberg stirbt in Ulmerfeld (heute Gemeinde Amstetten/Niederösterreich).
Um 5 1340 - Herzogin Margarete (von Dänemark) stirbt in Berlin
Berlin * Herzogin Margarete (von Dänemark), die erste Ehefrau von Herzog Ludwig V. „dem Brandenburger“, stirbt in Berlin.
Ihre Grabstätte befindet sich in der dortigen „Franziskanerkirche“.
4. 6 1340 - Erstmalige Anwendung der Hinrichtung durch das Rad
München * Für die erstmalige Anwendung der Hinrichtung durch das Rad erhält der Münchner Henker eine Sonderzahlung von 60 Pfennigen.
20. 12 1340 - Erstmalige Nennung der Au
München - Au * Erstmals wird die spätere Vorstadt Au in einem amtlichen Schreiben genannt. In dieser Urkunde übereignet Kaiser Ludwig IV. der Baier dem Heiliggeistspital drei Mühlen in der Au zu Giesing.
21. 12 1340 - Niederbaiern fällt an das Herzogtum Oberbaiern zurück
Landshut * Die niederbaierische Linie Herzog Heinrichs XIII. stirbt mit dem elfjährigen Herzog Johann das Kind aus. Niederbaiern fällt an das Herzogtum Oberbaiern zurück.
2. 11 1341 - Bei der Rückkehr vom Jagdausflug ist das Tor verriegelt
Tirol * Nachdem die elf Jahre andauernde Ehe zwischen Margarete von Tirol, später genannt „Maultasch“, und Johann Heinrich von Luxemburg kinderlos geblieben war, nimmt die 23-jährige Margarete ihr Schicksal selbst in die Hand. Bei der Rückkehr von einem Jagdausflug findet ihr 20-jähriger Ehemann das Tor von Schloss Tirol verriegelt vor.
Um 10. 12 1341 - Margarete von Tirols Ehe wird für ungültig erklärt
Tirol * Kaiser Ludwig der Baier erklärt die Ehe der Tiroler Gräfin Margarete und ihrem Gatten Johann Heinrich von Luxemburg für „nicht vollzogen“ und damit für ungültig.
Dass Margarete von Tirol ihren Ehemann Johann Heinrich von Luxemburg aus Schloss Tirol aussperrt, ist vermutlich mit Kaiser Ludwig dem Baiern abgestimmt gewesen, da sich dieser äußert, dass „sogleich die ganze Erde aussterben würde, käme die Fähigkeit zum Beischlaf abhanden“.
Um 1 1342 - Gegenbischof Ludwig von Kammerstein stirbt auf dem Weg nach Tirol
Freising - Tirol * Der Freisinger Gegenbischof Ludwig von Kammerstein verunglückt auf dem Weg nach Tirol und stirbt. Er sollte die erste Ehe der Margarete „Maultasch“ von Tirol mit Johannes von Böhmen auflösen und die neue mit dem Kaisersohn Ludwig V. den Brandenburger schließen.
Daraufhin erklärt Kaiser Ludwig IV. der Baier die Ehe der Tiroler Gräfin Margarete und ihrem Gatten Johann Heinrich von Böhmen (Luxemburg) für „nicht vollzogen“ und damit für ungültig.
Der Nachfolger des Freisinger Gegenbischofs wird Leutold von Schaumburg-Julbach.
28. 1 1342 - Ludwig der Brandenburger erlässt den Großen Tiroler Freiheitsbrief
Tirol * Herzog Ludwig der Brandenburger, der älteste Sohn Kaiser Ludwigs des Baiern und künftiger Ehegatte der Gräfin Margarete von Tirol, erlässt den Großen Tiroler Freiheitsbrief. Darin
- bestätigt er den Tirolern die Rechte des Landes und
- verspricht ihnen, keine Steuern ohne Zustimmung der Landstände zu erheben, sowie
- die Regierung nur nach Rücksprache mit den Landständen zu führen.
- Außerdem darf er keine Ausländer - auch keine Baiern - in Dienst nehmen und
- Margarete nicht außer Land bringen.
10. 2 1342 - Ludwig der Brandenburger heiratet Margarete „Maultasch“ von Tirol
<p><strong><em>Schloss Tirol</em></strong> * Herzog Ludwig V. der Brandenburger, der älteste Sohn Kaiser Ludwigs des Baiern, heiratet auf Schloss Tirol die Gräfin Margarete von Tirol, später genannt <em>„Maultasch“</em>. Das Paar lebte - kirchenrechtlich gesehen - 17 Jahre in wilder Ehe.</p>
11. 2 1342 - Ludwig der Brandenburger und Margarete erhalten die Grafschaft Tirol
Meran * Kaiser Ludwig der Baier belehnt Herzog Ludwig den Brandenburger und dessen Ehefrau Margarete im Hof des Trienter Bischofs in Meran mit der Grafschaft Tirol und dem Herzogtum Kärnten.
7. 5 1342 - Clemens VI. zum Papst gewählt
Avignon * Der Erzbischof von Sens und Rouen sowie Bischof von Arras, Pierre Roger, wird nach zehntägiger Sedisvakanz zum neuen Papst gewählt. Der 1338 zum Kardinal erhobene Kleriker nimmt den Namen Clemens VI. an.
8. 5 1342 - Verbot der feuergefährlichen Stroh- und Schindeldächer
München * Kaiser Ludwig IV. der Baier erteilt der Stadt in einem 2. Gunstbrief die volle Zuständigkeit und Entscheidungsgewalt in allen Bauangelegenheiten. Bisher besaß die Kommune dieses Recht nur für den Marktplatz [siehe 4. Mai 1315].
Kaiser Ludwig vereinbart mit der Stadt - zur Verhütung von Bränden - das Verbot der feuergefährlichen Stroh- und Schindeldächer. Neu erbaute Häuser und Stadel sollen künftig mit Ziegeln gedeckt und - wenn der Bauherr das erforderliche Vermögen besitzt - auch die Wände aus Stein gemauert werden. Schmieden, die nicht aus Mauerwerk bestehen, werden abgerissen.
Durch strenge Strafbestimmungen soll der Ausbruch von Bränden verhütet werden. Feuergefährliche Betriebe müssen vor die Stadtmauern.
19. 5 1342 - Papst Clemens VI. wird in Avignon inthronisiert
Avignon * Papst Clemens VI. wird in Avignon inthronisiert.
1343 - Der „Bürgerbrunnen“, der spätere „Fischbrunnen“, wird erstmals genannt
München-Graggenau * Der „Bürgerbrunnen“, der spätere „Fischbrunnen“, wird erstmals genannt.
In dieser Bezeichnung kommt seine zentrale Bedeutung für die ganze Bürgerschaft zum Ausdruck.
1343 - Eine Verordnung zu „Glocken und Schellen an der Kleidung“
Nürnberg * Eine Verordnung befasst sich mit „Glocken und Schellen an der Kleidung“.
1343 - Glocken und Schellen an der Kleidung
Nürnberg * Eine Verordnung befasst sich mit „Glocken und Schellen an der Kleidung“.
9. 3 1344 - Herzog Meinhard III. wird in Landshut geboren
Landshut * Herzog Meinhard III. wird in Landshut geboren. Er ist der Sohn von Herzog Ludwig dem Brandenburger und dessen Ehefrau Margarete von Tirol.
1347 - Das „Stadtrechtsbuch“ beschreibt den Bau der Isarbrücke
München * Die heutige „Ludwigsbrücke“ wird im „Stadtrechtsbuch“ sinngemäß beschrieben:
„Im Abstand von 36 Schuh [9,36 Meter] werden Joche, die aus einer Reihe von senkrecht zur Strömung gerichteten Baumstämmen bestehen, in den kiesigen Untergrund getrieben.
Dann sägt man sie auf gleicher Höhe ab und verbindet sie mit Querhölzern.
Sechs Balken liegen von Joch zu Joch.
Auf diese Balken werden Bohlen von 16 Schuh [4,67 Meter] Länge quer aufgebracht.
Dies ergibt die Brückenbreite.
Über diese Bohlen wird Kies geschüttet.
Die Höhe über den mittleren Wasserstand ist so ausgelegt, daß ein Mann, der auf einem Floß oder Kahn unter der Brücke hindurchfährt, mit ausgestrecktem Arm die Hauptträger nicht berühren kann“.
9. 4 1347 - Wilhelm von Ockham stirbt in München
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Wilhelm von Ockham, der berühmte mittelalterliche Philosoph, Theologe und kirchenpolitische Schriftsteller stirbt in München als Exkommunizierter.</p>
11. 10 1347 - Kaiser Ludwig der Baier stirbt in der Nähe des Klosters Fürstenfeld
Fürstenfeld - München-Kreuzviertel * Kaiser Ludwig der Baier stirbt in der Nähe des Klosters Fürstenfeld. Seine Grabstätte befindet sich in der Münchner Frauenkirche.
4. 7 1348 - Papst Clemens VI. gegen die Verfolgung von Juden
Avignon * Papst Clemens VI. wendet sich in einer Bulle gegen die Verfolgung von Juden als Verursacher der Pest. Doch niemand hält sich an die Worte des Oberhaupts der katholischen Kirche.
26. 9 1348 - Papst Clemens VI. droht den Verfolgern mit Exkommunikation
Avignon * In einer zweiten päpstlichen Bulle, in der Papst Clemens VI. die Juden vor dem Vorwurf in Schutz nimmt, Verursacher von Brunnenvergiftungen und der Pest zu sein. Er droht den Verfolgern die Exkommunikation an.
1349 - Die Pest mündet in Pogrome
München - Herzogtum Baiern * Die „Pest“ tobt im ganzen Land.
Die „Mattseer Annalen“ sprechen von einem Drittel der Menschen, die von der „grauenvollsten Pest“ hingerafft werden. Unter den am meisten heimgesuchten Orten werden Braunau, München und Landshut genannt.
Deshalb werden in Salzburg und München, aber auch in anderen Städten, „aus ruchloser übler Nachrede, die Juden verbrannt, geschlachtet, zerstückelt und auf sonstige Weise abgeschlachtet und getötet“.
3. 10 1349 - Johannes II. Hake Bischof von Freising stirbt in Avignon
Freising - Avignon * Johannes II. Bischof von Freising stirbt in Avignon.
20. 10 1349 - Papst Clemens VI. verbietet das Flagellantentum
Avignon * Papst Clemens VI. verbietet das Flagellantentum. Die Flagellanten sind nach Beginn der Pest gekommen. Sie ziehen durch die Städte, singen Hymnen und schlagen sich mit Peitschen, um damit Vergebung für die Sünden der Menschen zu erflehen.
Um den 28. 10 1349 - Albert II. von Hohenberg wird zum Bischof von Freising ernannt
Freising * Albert II. von Hohenberg wird von Papst Clemens VI. zum Bischof von Freising ernannt. Das Domkapitel wird dabei bewusst übergangen.
1350 - „Gegenbischof“ Leutold von Schaunberg geht nach Wien ins Exil
Freising - Wien * Der vom Freisinger „Domkapitel“ im Jahr 1342 gewählte „Gegenbischof“ Leutold von Schaunberg tritt zurück und geht nach Wien ins Exil.
1350 - Die Wittelsbacher müssen die Reichsinsignien abgeben
München * Drei Jahre nach dem Tod Kaiser Ludwig des Bayern müssen die Wittelsbacher die Reichsinsignien an den Luxenburger Karl IV. abgeben. Ein herber Verlust für die Herzöge und die Residenzstadt München.
1351 - Herzog Ludwig „der Brandenburger“ teilt seine Länder
München * Herzog Ludwig „der Brandenburger“ teilt seine Länder.
Die „Markgrafschaft Brandenburg“ übergibt er seinen jüngeren Halbbrüdern Ludwig „den Römer“ und Otto. Er selbst behält sich Oberbaiern.
Damit reicht das baierische Herrschaftsgebiet von der Donau im Norden bis nach Trient.
Seine Regierungssitze sind der „Alte Hof“ in München und „Schloss Tirol“.
6. 12 1352 - Papst Clemens VI. stirbt
Avignon * Papst Clemens VI. stirbt. Er wird in der Abtei La Chaise-Dieu beigesetzt. Sein Nachfolger auf dem apostolischen Stuhl wird Innozenz VI..
1353 - Von der Zucht der Seidenraupe und der Verarbeitung der Seide
Regensburg * Der Regensburger Domherr Konrad von Mergenberg beschreibt die Zucht der Seidenraupen und die Verarbeitung der Seide.
Dort heißt es: „Solche Raupen werden auch an manchen Orten Deutschlands gezüchtet und besonders in unserer königlichen Stadt Regensburg. Aus der Seide dieser Raupen werden aber in höherem Maße Frauenschleier gewebt als andere Seidenstoffe“.
1356 - Der Freisinger „Gegenbischof“ Leutold von Schaunberg stirbt in Wien
Freising - Wien * Der Freisinger „Gegenbischof“ Leutold von Schaunberg stirbt in Wien.
1356 - Kleidervorschriften in Speyer
Speyer * In Speyer erlässt der Rat eine Vorschrift über
- die „Zahl der Falten und Rüschen an den Schleiern“,
- die „Tiefe des Dekolletés“ und
- das „bartlose Gesicht der Männer“.
23. 6 1356 - Kaiserin Margarete I. stirbt in Quesnoy
Quesnoy - Valenviennes * Margarete I. von Holland, auch Margarete von Avesnes oder Margarete von Hennegau genannt, die zweite Ehefrau von Kaiser Ludwig dem Baiern, stirbt in Quesnoy. Ihre Grabstätte befindet sich in der Minoritenkirche in Valenviennes.
1357 - Bogenhausen kommt zum „Chorherrnstift Sankt Veit“ bei Freising
Bogenhausen - Schäftlarn - Freising * Nach langer Zugehörigkeit zum „Kloster Schäftlarn“ kommt Bogenhausen zum „Chorherrnstift Sankt Veit“ bei Freising.
1359 - Eine 17 Jahre andauernde „Wilde Ehe“ wird sanktioniert
Tirol - Rom-Vatikan * Die Ehe zwischen der Gräfin Margarete Maultasch von Tirol und dem Markgrafen Johann Heinrich von Mähren, die Kaiser Ludwig der Baier anno 1341 für ungültig erklärt hatte, wird nun auch vom Papst annulliert. Erst damit wird die 17 Jahre andauernde „Wilde Ehe“ von Herzog Ludwig dem Brandenburger mit Margarete von Tirol kirchenrechtlich sanktioniert.
25. 4 1359 - Der Freisinger Bischof Albert II. von Hohenberg stirbt in Stein am Rhein
Stein am Rhein * Albert II. von Hohenberg, der amtierende Bischof von Freising, stirbt in Stein am Rhein.
15. 5 1359 - Paul von Jägerndorf wird Bischof von Freising
Freising * Paul von Jägerndorf wird Bischof von Freising.
4. 9 1359 - Herzog Meinhard III. wird mit Margarete von Österreich verheiratet
Passau * Der 15-jährige baierische Herzog Meinhard III. wird in Passau mit der 13-jährigen Herzogin Margarete von Österreich verheiratet.
1361 - Der „Kotterhof“ gehört zum „Leprosenhaus am Gasteig“
Haidhausen * Aus diesem Jahr stammt die älteste Urkunde über die Zugehörigkeit des „Kotterhofes“ in der Haidhauser Kirchenstraße zum „Leprosenhaus am Gasteig“.
1361 - Die ältesten „Kleiderordnungen“ in „Altbaiern“ kommen aus Landshut
Landshut * Die sowohl ältesten als auch einzigen „Kleiderordnungen“ in „Altbaiern“, die nicht vom Fürsten, sondern vom Rat der Stadt erlassen wurden, enthält das „Landshuter Stadtbuch“.
Neben „Kleidervorschriften“ befasst sich die Verordnung auch Fragen der Bewirtung der Gäste bei Hochzeiten sowie der Anwesenheit von Frauen am Wochenbett und Geschenke für das Taufkind und die Mutter.
Obwohl Landshut in dieser Zeit in besonderer wirtschaftlicher Blüte steht, will der Rat der Stadt, dass sich die Bürgerin bescheidener kleidet.
Den Landshuter Frauen ist verboten, Perlen, Samt, Gold, Goldstoffe und Hermelin zu tragen.
Nur den „Reichen“ ist eine Goldborte „von der Breite eines kleinen Fingers“ um den Busen und am Mantel erlaubt.
Bis auf wenige Knöpfe ist den Frauen jeglicher Silberschmuck an den Kleidern verboten.
Es war eine reine „Luxusbeschränkung“, die noch kaum eine standesgemäße Trennung vorsieht.
Es entsteht eher der Eindruck, dass diese Verordnung nur deshalb erlassen wurde, um den Ehemännern und Vätern den Kostenaufwand für die Einkleidung ihrer Frauen, Töchter und Söhne zu begrenzen.
18. 9 1361 - Herzog Ludwig der Brandenburger stirbt in der Nähe von Zorneding
Zorneding - München-Kreuzviertel * Herzog Ludwig der Brandenburger stirbt in der Nähe von Zorneding. Seine Grabstätte befindet sich in der Münchner Frauenkirche.
1363 - Nur Angehörige aus Münchner Patrizierfamilien erhalten das „Braurecht“
München * Das „Braurecht“ wird nur an Angehörige aus Münchner Patrizierfamilien vergeben.
Im Jahr 1363 entstammen alle zwölf Inhaber des „herzoglichen Lehensbriefes“, der „Gerechtigkeit“, einer Familie, die auch im Rat der Stadt und als Bürgermeister zu finden ist.
Diese „Brauberechtigten“ verdienen ihr Geld im Großhandel mit Salz, Wein und Eisen. Sie brauen nicht selbst und überlassen diese Aufgaben ausgebildeten Brauern.
13. 1 1363 - Herzog Meinhard III. stirbt auf Schloss Tirol
Schloss Tirol * Herzog Meinhard III. stirbt auf Schloss Tirol. Herzog Stephan II., der Bruder Herzog Ludwig des Brandenburgers, übernimmt das Teilherzogtum Baiern-München und die Grafschaft Tirol.
Um den 20. 1 1363 - Herzogin Margarete überträgt Tirol an Habsburg
Tirol * Herzogin Margarete von Baiern-München überträgt die Grafschaft Tirol an ihren habsburgischen Vetter Herzog Rudolf IV. von Österreich.
21. 1 1363 - Erstmalige Benennung der Münchner Stadtviertel
München * Erstmals werden die Stadtviertel Münchens in lateinischer Sprache benannt.
Es sind dies
- das quarta fori pecorum, das Viertel des Rindermarktes,
- dann das quarta secunda ad gradus superioris institarum, das Zweite Viertel zu den oberen Kramen,
- weiter das quarta tercia apud fratres heremitanos, das Dritte Viertel bei den [Augustiner-] Eremiten,
- und zuletzt das quarta ultima apud Chunradum Wilbrechtum, das Letzte Viertel beim Konrad Wilbrecht.
Das Tal schließt sich als eigener Bereich an, der jedoch nicht als Viertel bezeichnet wird.
22. 5 1363 - Strafe für eine Amts-Verweigerung
München * Weigert sich ein Bürger das Bürgermeisteramt zu übernehmen, muss er 100 Pfund Pfennige als Strafe zahlen.
29. 9 1363 - Margarete Maultasch von Tirol verzichtet auf ihre Besitzungen
Tirol * Margarete „Maultasch“ von Tirol, die Witwe des baierischen Herzogs Ludwig V. der Brandenburger, verzichtet endgültig auf ihre Besitzungen und überlässt sie ihren habsburgischen Verwandten.
11 1363 - Es kommt zum „Tiroler Erbfolgekrieg“
München - Tirol * Der oberbaierische Herzog Stephan II. nimmt den Verlust der „Grafschaft Tirol“ nicht so ohne weiteres hin.
Es kommt zum „Tiroler Erbfolgekrieg“.
8. 2 1364 - Herzog Rudolf IV. von Österreich wird mit der Grafschaft Tirol belehnt
<p><strong><em>Tirol</em></strong> * Herzog Rudolf IV. von Österreich wird von seinem Schwiegervater, Kaiser Carl IV., offiziell mit der Grafschaft Tirol belehnt. Die Belehnung wird von Baiern jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Der Krieg geht weiter.</p>
31. 5 1364 - Strafe für eine Amts-Verweigerung (Teil II)
München * Weigert sich ein Bürger das Amt des Kämmerers oder des Steuerers anzunehmen, wird er mit einer Strafe von 31 Pfund Pfennigen belegt.
Spätestens seit dem Jahr 1368 - Flößer, Fischer und Färber haben im „Lehel“ ihre Wohnhäuser errichtet
München-Lehel * Alle Flößer und alle Fischer sowie die meisten Färber haben im später so genannten „Lehel“ nicht nur ihre Arbeitsplätze, sondern auch ihre Wohnhäuser errichtet.
Die Bezeichnungen der Häuser und Gewerke leitete man von den markanten Bauteilen der Stadtmauer ab.
So erhielten die einzelnen Objekte beispielsweise den Zusatz „vor/bei des Wurzers Tor“ oder „hinter dem Lugerturm“ oder „gelegen auf dem Lohstampf“.
1369 - München hat 11.237 Einwohner
München * München hat 11.237 Einwohner.
29. 9 1369 - Herzog Stephan II. muss die Grafschaft Tirol abtreten
Tirol * Nach mehr als sechs Jahren Krieg und trotz zäher Gegenwehr muss Herzog Stephan II. die Grafschaft Tirol gegen eine Entschädigung von 116.000 Gulden an die Habsburger abtreten. Die Grenzgerichte Schärding, Kufstein, Rattenberg und Kitzbühel bleiben bairisch und werden in der Folgezeit dem Teilherzogtum Baiern-Ingolstadt zugeteilt.
3. 10 1369 - Herzogin Margarete „Maultasch“ stirbt in Wien
Wien * Herzogin Margarete von Baiern-München und Gräfin von Tirol stirbt in Wien. Ihre Grabstätte befindet sich in der dortigen Minoritenkirche zum Heiligen Kreuz.
Margaretes Beiname „Maultasch“ taucht erst seit dem späten 14. Jahrhundert auf. Von Zeitgenossen wird sie als schöne Frau beschrieben. Es ist wohl mehr die luxemburgische und päpstliche Propaganda, die mit diesem abwertenden Beinamen das „wenig rollenkonforme Verhalten“ der Herzogin brandmarken und sie in ein schiefes Licht bringen soll.
1370 - „Korsettähnliche Unterkleider, die den Busen heben“
Straßburg * Eine Verordnung aus Straßburg dreht sich um „korsettähnliche Unterkleider, die den Busen heben“.
Anno 1371 - „Der Stern“ beherbergt Münchens erstes erwähntes Bordell
München-Kreuzviertel * Eine Frau Aerdingerin verkauft ihre Häuser mit dem Hausnamen „Venediger“ und „Der Stern“, die beide „in unserer Frauen-Pfarrei an der Ringmauer, bei unserer Herren Thor [= Schwabinger Tor] gelegen“ waren. Die Häuser standen entweder auf dem Gebiet der heutigen Theatinerkirche oder am Salvatorplatz.
- Im Haus „Venedig“ ist vermutlich ein ehemaliges Hospiz für Venedig-Fahrer untergebracht;
- der „Stern“ beherbergt Münchens erstes erwähntes Bordell, das als Privatunternehmen geleitet wird.
18. 4 1371 - Der Münchner Rat erhöht die Bürgerrechtsgebühr
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Münchner Rat setzt die Bürgerrechtsgebühr auf fünf Pfund fest und damit in eine - für Arbeiter, Taglöhner, Kleinhandwerker, Dienstboten und Knechte, Mägde und Handelsdiener - unerreichbare Höhe. </p> <p>Um das Gemeinwesen und damit das Stadtsäckel durch den Zuzug unvermögender Personen nicht übermäßig zu belasten, werden besitz- und gewerbslose Zuwanderer in der jungen, aufstrebenden Stadt schon ziemlich früh zu <em>„unwillkommenen Gästen“ </em>erklärt. Der Rat der Stadt will nicht Armut, sondern leistungsfähige und finanzkräftige Menschen einbürgern. Umgekehrt müssen die Aufgenommen mindestens zehn Jahre in der Stadt bleiben, sonst haben sie mit einer Strafsteuer von 31 Pfund zu rechnen. </p>
1372 - In München gibt es 21 Brauer
München * In München gibt es 21 Brauer, von denen aber höchstens elf einen eigenen „Bräustadel“ besitzen.
7. 8 1372 - Das Ende des sogenannten Patrizierbrauens
München * Da die alten Bräuämter den Bedarf an Greußling nicht herstellen können, gibt es Zwietracht in der Münchner Bevölkerung. Da aber daraufhin „heimlich und widerrechtlich“ Greußling gebraut wird, entgehen dem Herzog Steuereinnahmen. Deshalb soll künftig jeder brauen können, der vom Herzog mit dem Braurecht belehnt wird.
Die Reform leitet das Ende des sogenannten Patrizierbrauens ein.
1376 - Papst Gregor XI. verlegt seine Residenz von Avignon nach Rom
Avignon - Rom-Vatikan * Der mittlerweile regierende Papst Gregor XI. verlegt seine Residenz von Avignon nach Rom.
23. 7 1377 - Der Freisinger Bischof Paul von Jägerndorf stirbt
Freising ? * Der Freisinger Bischof Paul von Jägerndorf stirbt in Freising oder Österreich.
1378 - Der „Bürgerbrunnen“ heißt jetzt „Marktbrunnen“
München-Graggenau * Der „Bürgerbrunnen“ heißt jetzt „Marktbrunnen“.
Er steht vor dem Haus des Hans Impler, an der Stelle des heutigen „Fischbrunnens“.
27. 3 1378 - Papst Gregor XI. stirbt
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Als Papst Gregor XI. stirbt, befürchten die Römer, dass der neue Papst wieder nach Avignon zurückkehren wird. Auch deshalb, weil sich an der französischen Dominanz im Kardinalskollegium nichts geändert hat.</p>
4 1378 - Leopold von Sturmberg wird Bischof von Freising
Freising * Leopold von Sturmberg wird Bischof von Freising.
7. 4 1378 - Römische Bürger stürmen das „Konklave“
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Bewaffnete römische Bürger stürmen das Konklave und fordern die Wahl eines Römers zum Papst.</p>
8. 4 1378 - Die Kardinäle einigen sich nicht auf einen Römer
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Die Kardinäle einigen sich zwar nicht auf einen Römer, wohl aber auf einen Italiener, den Erzbischof von Bari namens Bartolomeo Prignano. Weil jedoch das Konklave am Wahltag erneut von römischen Bürgern gestürmt wird, schiebt man <em>„</em><em>um sich zu retten"</em> für kurze Zeit den Seniorkardinal Tebaldeschi als angeblich neu gewählten Papst vor.</p>
9. 4 1378 - Erst einen Tag nach der Wahl wird das Ergebnis bekannt gemacht
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Erst einen Tag nach der Wahl wird die Ernennung Bartolomeo Prignanos zum Papst Urban VI. bekannt gegeben. Die Wirren des Konklaves bietet den Kardinälen später die Möglichkeit, das Wahlergebnis öffentlich anzufechten.</p>
8 1378 - Papst Urban VI. regiert sehr autokratisch und unerbitterlich streng
Rom-Vatikan * Papst Urban VI. regiert sehr autokratisch und unerbitterlich streng.
Insbesondere die elf französischen Kardinäle und der Spanier Peter von Luna rücken daher von ihm ab und monieren, dass die Wahl unter Zwang stattgefunden und der Gewählte sich zudem als „unfähig und geisteskrank“ erwiesen hat - und erklären ihn für abgesetzt.
Papst Urban VI. ernennt daraufhin 29 neue Kardinäle, wodurch das Kollegium erheblich vergrößert wird.
Dagegen protestieren nun auch italienische Kardinäle, denn üblicherweise entscheiden Papst und Kardinäle gemeinsam über die Ernennung neuer Purpurträger.
An einer Ausweitung des Kreises haben die Kardinäle kein Interesse, weil die Einkünfte des Kollegiums dann auf mehr Köpfe verteilt werden muss.
20. 9 1378 - Zwei Päpste konkurrieren untereinander
Fondi * Die protestierenden Kardinäle verlassen den päpstlichen Hof, schließen sich mit den Franzosen zusammen und wählen in Fondi Robert von Genf zum Papst Clemens VII.. Damit ist das Schisma besiegelt: Zwei Päpste konkurrieren um den Anspruch, der „wahre Inhaber der kirchlichen Höchstgewalt“ zu sein.
Das Abendländische Schisma unterscheidet sich gegenüber früheren Kirchenspaltungen fundamental. Waren es in vergangenen Zeiten meistens Könige und Kaiser, die im Streit mit dem Papst ihnen genehme Gegenpäpste einsetzten, so war die jetzige Trennung aus der Mitte der Kirche entstanden. Außerdem gleicht es einem revolutionärer Akt, dass sich das Kardinalskollegium selbst die Kompetenz zusprach, einen Papst abzusetzen und einen Nachfolger zu wählen.
Frankreich, England und Spanien erklären Clemens VII. zum rechtmäßigen Papst. Das deutsche Reich ist uneins, aber Kaiser Carl IV. und sein Nachfolger Wenzel unterstützten Urban VI., ebenso Schottland, Ungarn und weitere Territorien.
20. 1 1380 - Der Begriff Burgfrieden wird erstmals beschrieben
München * Im Gerichtsbuch der Stadt München erscheint erstmals der wörtliche Begriff Burgfrieden.
1381 - Mittenwalder Fuhrleute müssen die „Warenniederlage“ nicht beachten
Mittenwald * Den Mittenwalder Fuhrleuten wird das Recht zugestanden, die in Partenkirchen gesetzlich festgelegte „Warenniederlage“ nicht beachten zu müssen.
5. 8 1381 - Der Freisinger Bischof Leopold von Sturmberg stirbt
Freising * Der Freisinger Bischof Leopold von Sturmberg stirbt bei einem Unfall.
Um 9 1381 - Berthold von Wehingen wird Bischof von Freising
Freising * Berthold von Wehingen wird Bischof von Freising.
1383 - Das Regensburger Fernhandelshaus Runtinger kauft Seide
Regensburg * Das Regensburger Fernhandelshaus Runtinger kauft seit dem Jahr 1383 griechische und syrische Seide roh, gesponnen oder als fertiges Gewebe in Venedig ein.
1385 - In der ältesten „Ungeltordnung“ ist vom „Frankenwein“ die Rede
München * In der ältesten „Ungeltordnung“ ist vom „Frankenwein“ die Rede.
1385 - Städtische „Amtsleute“ überwachen den „Weinmarkt“
München-Graggenau * Städtische „Amtsleute“ überwachen den „Weinmarkt“.
Schon sehr früh entdeckt man den Wein als sprudelnde Einnahmequelle. Eine „Verbrauchssteuer“, das „Ungelt“, in Höhe von 4 Mass vom Eimer (circa 60 Mass) wird vom Herzog erhoben.
Das Bier bleibt zunächst vom „Ungelt“ befreit.
1385 - Die „Franziskaner- Mönche“ beziehen wieder einen richtigen „Konventbau“
München-Graggenau * Die „Franziskaner- Mönche“ beziehen - nach einem jahrzehntelangen Provisorium - wieder einen richtigen „Konventbau“.
1385 - Es kommt zu einer großen Umsiedelungsaktion
München * Es kommt zu einer großen Umsiedelungsaktion.
Die Flößer, Fischer und Färber müssen ihre Wohnstätten im später so genannten „Lehel“ aufgeben und in die erweiterte Stadt umziehen.
Damit liegen außerhalb der Stadttore nur mehr die Mühlen, die „Länden“ und die „Bleichen“.
Doch langsam füllt sich die Gegend wieder auf.
Die „Färbhäuser“, der „Lohstampf“, „Hammer- und Klingenschmiede“, „Waschhäuser“ liegen nun wieder vor dem „Wurzer-“ und dem „Schiffertor“.
Andere Werksanlagen werden bei der Stadterweiterung aus der Stadt verlegt oder entstehen im Laufe der Zeit neu.
Fast alle diese Werksanlagen oder Gewerke gehören der Stadt und werden von ihr verpachtet.
Zum Teil hat die Stadt die Anlagen selbst wieder von der „herzoglichen Hofkammer“ geliehen.
Damit kommen wir zur Entstehung des Namens „Lehel“, denn den Begriff „Pacht“ kannte man im Mittelalter nicht.
Der in dieser Zeit übliche Name hieß „Leihe“ und das geliehene Gut war das „Lehen“.
Die genannten Gewerke sind also „Lehen“, deren Bau- und Unterhaltspflicht für Gebäude und Anlagen generell bei der Stadt liegt.
1386 - Die „alt Schöttin
München * Die „alt Schöttin" wird als Hexe aus der Stadt gejagt.
1387 - Das Jagdrevier des baierischen Herrscherhauses wird erstmals erwähnt
München-Englischer Garten - Schwabing * Die „Aw vor dem Schwäbinger Tor“, das unmittelbar an die Münchner Residenz anschließende Jagdrevier des baierischen Herrscherhauses, wird erstmals erwähnt.
Der stadtnahe Teil führt den Namen „Hirschanger“ mit dem „Hirschangerwald“.
Flussabwärts, auf der Höhe von Schwabing, schließt sich die „Hirschau“ an.
26. 5 1388 - Ein zufälliger Reliquien-Fund auf dem Andechser Burgberg
Andechs * Auf dem halbverfallenen Burgberg in Andechs machen die Herzöge Stephan und Johann unter dem Altar zufällig einen Fund. Sie entdecken eine eisenbeschlagene Holztruhe, die selbst 150 Jahre nach der Zerstörung der Andechser Burg, nicht einmal nennenswert Rost angesetzt hat, und in welcher zahlreiche Reliquien eingelagert sind. Darunter befinden sich
- drei Hostien,
- das Spottzepter und
- das Schweißtuch Christi,
- ein Teil der Dornenkrone,
- ein Stück der Lanze des Longonius,
- das Brautkleid und das Kreuz der heiligen Elisabeth,
- das Siegeskreuz Karls des Großen,
- sowie zahlreiche Hirnschalen, Rippen, Fuß- und Armknochen.
Allerdings war bis zu ihrem wundersamen Auftauchen von diesen Reliquien niemals die Rede.
Die baierischen Herzöge bringen das Schatzkästlein samt Inhalt in die Lorenzkapelle des Alten Hofes. Die Kapelle hat schon vorher zur Aufbewahrung der Reichsinsignien gedient. Der Aufbewahrungsort und die Art der Reliquien sind eine bewusste Anspielung auf die verlorenen Reichsinsignien.
Ob es Zufall oder ein geschickt eingefädelter Coup ist, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Auch deshalb, weil gleichzeitig eine Vernebelungstaktik beginnt. Die Einträglichkeit eines solchen Fundes ist den Herzögen freilich bekannt. Und der seit 1385 begonnene Bau der Neuen Veste kostet viel Geld.
1389 - Das „Sternfrauenhaus“ heißt jetzt offiziell „Frauenhaus“
München-Kreuzviertel * Das „Sternfrauenhaus“ heißt jetzt offiziell „Frauenhaus“ und ist in städtischen Besitz übergegangen.
Denn als „Frauenhaus“ bezeichnet man ein „Bordell“ nur dann, wenn es sich in städtischem oder landesherrlichem Besitz befindet.
2. 5 1389 - Herzogin Sophie heiratet den römischen und böhmischen König Wenzel
Prag * Die 13-jährige Sophie, Tochter Herzog Johanns II., heiratet den 28-jährigen römischen und böhmischen König Wenzel.
Angeblich wird wegen Sophie - der Legende nach - im Jahr 1393 „Johannes ne Pomuk“ [Johann von Pomuk] ertränkt, weil er dem König den Inhalt der Beichte seiner Frau nicht preisgeben will.
Es ging bei der Auseinandersetzung aber nicht um das „Beichtgeheimnis“, sondern um kirchenpolitische Angelegenheiten.
Um das Jahr 1390 - Der billige Hopfen setzt sich bei den Brauern verstärkt durch
München * Da die Preise für die Kräuter immer höher steigen, setzt sich der billige Hopfen bei den Brauern verstärkt durch.
Die Unterschiede verwischen sich mit der Zeit.
18. 3 1390 - Erstmals werden die Andechser Reliquien in München gezeigt
<p><em><strong>Andechs - München-Graggenau</strong></em> * Erstmals wird das Andechser Heiltum, die Andechser Reliquien, in der Lorenzkirche im Alten Hof zu München öffentlich gezeigt. </p>
6. 4 1390 - Bischof Berthold von Wehingen gewährt einen „vollen Ablass“ der Sünden
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Berthold von Wehingen, der Bischof von Freising, gewährt allen Gläubigen, die </p> <ul> <li>die herzogliche Lorenzkapelle besuchen und die Andechser Reliquien bewundern, </li> <li>dort beichten und </li> <li>ein Almosen opfern, </li> </ul> <p>einen <em>„vollen Ablass“</em> ihrer weltlichen Sünden. </p> <p>Entscheidend für die Anziehungskraft der Andechser Reliquien ist die ihnen zugesprochene Fähigkeit Wunder zu wirken. </p>
16. 9 1390 - König Wenzel hebt alle Judenschulden in Baiern auf
Nürnberg * König Wenzel hebt in Nürnberg alle Judenschulden in Baiern auf. Die Juden erhalten ihr Geld nicht mehr zurück. Die davon profitierenden Schuldner müssen aber dem König Ersatzleistungen zahlen.
17. 3 1391 - Münchens Gerichtsbezirk
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Stadt und der Burgfrieden bilden einen einzigen Gerichtsbezirk.</p>
1392 - Umbauarbeiten am Vorläuferbau des Alten Rathauses
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Die Umbauarbeiten am Vorläuferbau des Alten Rathauses dauern bis 1394. Es wird ein Saal eingebaut, der in der folgenden Bürgerrevolution Tagungsort des <em>„Großen Rats der Dreihundert“</em> ist. </p>
Ab 17. 3 1392 - Das erste „Gnadenjahr“ außerhalb Roms ist in München
<p><strong><em>Rom-Vatikan - München</em></strong> * Papst Bonifaz IX. gewährt für die Zeit vom 17. März bis zum 1. August 1392 einen auf München und seinen Burgfriedensbezirk beschränkten Ablass. Er gilt für alle Sünden, außer für vorsätzliche Tötungen. Es war das erste <em>„Gnadenjahr“</em> außerhalb Roms. Die Ablasserbitter müssen in dieser Zeit </p> <ul> <li>nach München pilgern, </li> <li>dort sieben Tage verweilen, </li> <li>je dreimal die Frauenkirche, </li> <li>die Peterskirche, </li> <li>die Jakobskirche am Anger und </li> <li>die Spitalskapelle besuchen und </li> <li>mindestens einmal die ausgestellten Reliquien verehren, </li> <li>beichten und </li> <li>ein vom Beichtvater festgelegtes Almosen spenden. </li> </ul> <p>Die ganze Aktion ist nur darauf angelegt, dieses <em>Almosen</em>, eine versteckte Steuer, den Gläubigen aus der Tasche zu ziehen. ´Der Zugang zum Himmel muss mit barem Geld erkauft werden. Der Kirche ist es höchst effektvoll gelungen, den um ihre arme Seele fürchtenden Gläubigen einzureden, sie könnten sich durch Beichte und milde Gabe von der Strafe des Fegefeuers loszukaufen: <em>„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!“</em> </p> <p>Nonnen wollen trotz Klausur nach München. Ihre Kirchenoberen können es ihnen nur unter Androhung der Exkommunikation und des Kerkers verbieten. Damit die Pilger ihr Geld nur an die vorbestimmte Stelle bringen, wird eine eigene Straßenpolizei gegründet. </p> <p>Die Masse der kleinen Leute ist es, die das Geld nach München bringt. Die Geschäftsleute Münchens machen einen enormen Schnitt. Auch die Jakobidult erlebt ab dem Gnadenjahr einen ungeheueren Aufschwung. </p> <p>Ursprünglich hat man geplant, die Einnahmen je zur Hälfte den genannten Kirchen und dem Papst zuzugestehen. Später wird auch Herzog Stephan ein Viertel zugesprochen. Da die Münchner einen Teil der Einnahmen abzweigen und der Papst dadurch leer ausgeht, werden über die „ruchlose Stadt“ die höchsten Kirchenstrafen verhängt: Bann und Interdikt. Das gesamte kirchliche Leben der Stadt muss solange ruhen, bis die Gelder zurückerstattet werden. </p>
1394 - Das „Franziskaner-Kloster“ liegt geschützt innerhalb der Stadt
München-Graggenau * Die Franziskaner-Klosterkirche „St. Franziskus“ wird dem heiligen „St. Antonius von Padua“ geweiht.
Durch den Bau der Ringmauer liegt das „Franziskaner-Kloster“ inzwischen geschützt innerhalb der Stadt.
1394 - Der „Arm des heiligen Antonius“ wird wiederentdeckt
München-Graggenau * Im Münchner „Franziskaner-Kloster“ wird der „Arm des heiligen Antonius“ wiederentdeckt.
Nach ihrer Wiederauffindung des in der Zeit der „Großen Pest“ eingemauerten Oberarmknochens bildet die „Reliquie des hl. Antonius“ das Ziel zahlreicher Wallfahrer.
Den „Antonius-Arm“ hatte Ludwig IV. „der Baier“ nach München gebracht, doch während eines Stadtbrandes ist er „verloren“ gegangen.
Die „Franziskaner“ wollen mit dem „Antonius-Arm“ an den Triumph der „Andechser Reliquien“ anknüpfen.
Doch der „Antonius-Reliquie“ gelingt es nicht, München zum „Wallfahrtsort“ zu machen.
1395 - Das Ridler-Seelhaus kommt an die Residenzstraße
München-Graggenau * Das Ridler-Seelhaus an der Hinteren Schwabinger Gasse [= Theatinerstraße] verlegt ihren Sitz an die Vordere Schwabinger Gasse [= Residenzstraße].
5 1396 - Vermutlich herrscht um diese Zeit in München eine Pest.
München * Vermutlich herrscht um diese Zeit in München eine Pest.
1398 - Ein Gutachten wertet alle Zauberei als „Götzen- und Teufelsanbetung“.
Paris * Ein Gutachten der Pariser „Theologischen Fakultät“ wertet alle Zauberei als „Götzen- und Teufelsanbetung“.
Um 1400 - Amtshandlungen werden mit einem Weinumtrunk beschlossen
<p><strong><em>München</em></strong> * Bedeutende Amtshandlungen werden mit einem Weinumtrunk beschlossen. Vom Bier war dabei nie die Rede.</p>
1401 - Konrad der Preisinger und Emeran der Haßlanger bauen Häuser in der Au
Au * Konrad der Preisinger legt einen großen Garten mit einem villenähnlichen Haus an der heutigen Lilienstraße an.
Emeran der Haßlanger erbaut daneben ein schlossähnliches Gebäude.
1402 - „Magie“ kann immer nur mit Hilfe des Teufels ausgeübt werden
Paris * „Magie“, so ein Traktat, kann immer nur mit Hilfe des Teufels ausgeübt werden und ist deshalb als „Apostasie“ [= Abfall vom Glauben] und „Ketzerei“ [= das Abweichen von einer allgemein als gültig erklärten Meinung] zu bewerten.
1403 - Herzog Ludwig der Bärtige von Ingolstadt kauft den „Edelsitz Niedergiesing“
Au * Erwerb des „Edelsitzes Niedergiesing“ durch den mit seiner Münchner Verwandtschaft zerstrittene Ingolstädter Herzog Ludwig der Bärtige.
Er will von hier aus seine Fehde mit den Münchner Herzögen austragen.
1403 - Das „Ungelt“ von Wein und Met wird auf 6 Mass vom Eimer erhöht
München * Das „Ungelt“ von Wein und Met wird auf 6 Mass vom Eimer erhöht.
Neben „Steuern und Zöllen“ ist das „Weinungelt“ jahrhundertelang die Haupteinnahmequelle der Stadt.
21. 8 1403 - Die künftige Machtverteilung wird neu festgelegt
München * Nach heftigen Bürgerunruhen in München werden im sogenannten Wahlbrief die Grundlagen für die künftige Machtverteilung und des bürgerlichen Mitspracherechts neu festgelegt.
Einungen bezeihungsweise Zünfte werden verboten, Bestehende aufgelöst. Die Münchner Handwerkerverbände nehmen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts keine politischen Funktionen mehr wahr. Durch eine straffe Gewerbeorganisation und -kontrolle stabilisiert der Rat seine Position.
Ab 1405 - Ein spiritueller Anziehungspunkt des Franziskaner-Klosters
München-Graggenau * Zu einem weiteren spirituellen Anziehungspunkt des Franziskaner-Klosters wird das Grab des am 29. April 1327 im Ruf der Heiligkeit verstorbenen Fraters Marquard Weismaler. Seine irdischen Überreste werden in einem Schrein auf den Altar erhoben und verehrt.
7. 12 1405 - Vorschriften zur „Bekämpfung des Luxus“
München * Der Rat der Stadt erlässt Vorschriften zur Bekämpfung des Luxus. Neben dem Laden und Bewirten von Gästen bei Hochzeitsfeierlichkeiten und Taufen geht es auch um Kleidervorschriften.
1407 - In Mittenwald wird die „Nasse Rott“ gegründet
Mittenwald * Aufgrund des starken Güteraufkommens wird in Mittenwald zusätzlich ein Rottfuhr-Unternehmen auf der vorbeifließenden Isar gegründet, die „Nasse Rott“.
1407 - Die „Andechser Reliquien“ werden wieder nach Andechs gebracht
Andechs * Die „Andechser Reliquien“ werden wieder nach Andechs gebracht.
Damit ist der Versuch, die „Andechser Reliquien“ fest in München zu etablieren, fehlgeschlagen.
3 1407 - Der Ruf nach der „Einberufung eines allgemeinen Konzils“ wird immer lauter
Savona * Das „Schisma“ wird von Anfang an als Skandal empfunden, weshalb man erhebliche Anstrengungen unternimmt, die Kircheneinheit wieder herzustellen.
Deshalb wird der Ruf nach der „Einberufung eines allgemeinen Konzils“ immer lauter. In Savona kommt es zu Verhandlungen zwischen den beiden Machtblöcken.
6 1407 - Dreizehn „Kardinäle“ treffen sich in Livorno
Livorno * Dreizehn „Kardinäle“ treffen sich in Livorno.
Ihr Ziel ist die Beendigung der Kirchentrennung [„Schisma“]. Sie berufen ein „Konzil“ nach Pisa ein.
20. 6 1407 - Der Markt Mittenwald erhält ein eigenes Wappen und Siegel
Mittenwald * Der Freisinger Fürstbischof und Landesherr über das Werdenfelser Land, Berthold von Wehingen, verleiht dem Markt Mittenwald ein eigenes Wappen und Siegel.
1409 - Erstmals wird ein herzoglicher „Pawmgarten auf dem Pachh“ erwähnt
München-Graggenau * Erstmals wird ein herzoglicher „Pawmgarten auf dem Pachh“ erwähnt.
Er liegt östlich der um 1385 erbauten „Neuveste“.
25. 3 1409 - Das Konzil von Pisa beginnt
<p><strong><em>Pisa</em></strong> * Das Konzil von Pisa beginnt. Noch nie zuvor hat ein Kardinalskollegium - ohne Rücksprache mit Papst oder Kaiser - ein allgemeines Konzil der Gesamtkirche einberufen. Die Initiative der Kardinäle stößt auf breite Zustimmung: Über 600 Kleriker nehmen am Konzil von Pisa teil.</p> <p>Die parallel einberufenen Konzilien der beiden Päpste Gregor XII. in Cividale und Benedikt XIII. in Perpignan haben nicht annähernd so viele Teilnehmer. Die überwiegende Zustimmung des Klerus zum Konzil in Pisa isoliert die beiden Päpste auf Dauer.</p> <p>Das Konzil von Pisa zitiert die Päpste Gregor XII. und Benedikt XIII. nach Pisa und macht ihnen nach deren Weigerung einen förmlichen Ketzerprozess als hartnäckige Schismatiker. Damit ist die entscheidende Grundlage für das weitere Vorgehen geschaffen.</p>
5. 6 1409 - Das Konzil von Pisa setzt die beiden amtierenden Päpste ab
Pisa * Das Konzil von Pisa setzt die beiden Päpste Gregor XII. und Benedikt XIII. ab.
24. 6 1409 - Alexander V. wird vom Konzil von Pisa zum Papst gewählt
Pisa * Zum Nachfolger wählt das Konzil von Pisa Papst Alexander V.. Weil jedoch Benedikt XIII. und Gregor XII. auch weiterhin auf ihre Ansprüche beharren, gibt es nunmehr statt zwei drei Päpste. Doch nun bekennen sich die wichtigsten Mächte zu Papst Alexander V. und dessen Nachfolger, Johannes XXIII.. Nur Spanien unterstützt auch weiterhin Papst Benedikt XIII..
1410 - Berthold von Wehingen, der Bischof von Freising, stirbt in Wien
Wien * Berthold von Wehingen, der Bischof von Freising, stirbt in Wien.
3. 5 1410 - Papst Alexander V. stirbt. Sein Nachfolger wird Johannes XXIII.
Bologna * Papst Alexander V., der hauptsächlich in Bologna regiert, stirbt.
Sein Nachfolger wird Papst Johannes XXIII..
17. 5 1410 - Papst Johannes XXIII. wird zum Papst gewählt
Bologna * Baldassare Cossa wird in Bologna zum Papst gewählt. Er wird den Namen Johannes XXIII. annehmen.
24. 5 1410 - Papst Johannes XXIII. erhält die Priesterweihe
Avignon * Der eine Woche zuvor zum Papst Johannes XXIII. gewählte Baldessare Cossa erhält die Priesterweihe.
25. 5 1410 - Papst Johannes XXIII. wird gekrönt
Avignon * Der zum Papst Johannes XXIII. gewählte Balassare Cossa erhält die Bischofskonsekration. Am späten Nachmittag des selben Tages wird er schließlich zum Papst gekrönt.
1411 - Die älteste Urkunde des Bestehens der „Augustiner-Brauerei“
München-Kreuzviertel * Die älteste Urkunde des Bestehens der „Augustiner-Brauerei“.
23. 3 1411 - Konrad V. von Hebenstreit zum Bischof von Freising ernannt
<p><strong><em>Avignon - Freising</em></strong> * Papst Johannes XXIII. ernennt Konrad V. von Hebenstreit - gegen des Willen des Domkapitels - zum Bischof von Freising. </p>
Um 4 1412 - Bischof Konrad V. von Hebenstreit wird von seinen Dienern ermordet
Straßburg - Freising - Bischoflack * Der von Papst Johannes XXIII. zum Freisinger Bischof ernannte Konrad V. von Hebenstreit macht sich nach seiner Berufung von Straßburg aus auf den Weg in seine Freisinger Besitzungen.
In Bischoflack wird er im Schloss von einer Freisinger Gesandtschaft empfangen.
In der selben Nacht aber von seinen Dienern ermordet.
26. 7 1412 - Hermann von Cilli wird Freisinger Bischof
Avignon - Freising * Hermann von Cilli wird von Papst Johannes XXIII. - auf Intervention des deutschen Kaisers Sigismund - zum Bischof von Freising ernannt.
1413 - König Sigismund will das dreifache „Schisma“ beenden
Lodi * Der neue deutsche König Sigismund will das dreifache „Schisma“ ein für alle Mal beenden.
Neben religiösen Aspekten verbindet er damit die Hoffnung auf die Kaiserkrone.
Sigismund trifft sich mit Papst Johannes XXIII. in Lodi und zwingt diesen zur Einberufung des „Konzils von Konstanz“.
Um den 9 1414 - Papst Johannes XXIII.: „Hier liege ich in Teufels Namen!“
Arlbergpass * Papst Johannes XXIII. bricht zum „Konzil“ nach Konstanz auf.
Als sein Wagen am „Arlbergpass“ umstürzt, schreit er wenig päpstlich und zornig: „Hier liege ich in Teufels Namen!“
3. 11 1414 - Jan Hus trifft zwei Tage vor Beginn des Konzils in Konstanz ein
Konstanz * Jan Hus trifft zwei Tage vor Beginn des Konzils in Konstanz ein.
Ab dem 5. 11 1414 - Auf dem Konzil von Konstanz soll das Schisma überwunden werden
Konstanz * Das Konzil von Konstanz beginnt. Es dauert bis zum 22. April 1418. Der wichtigste Tagesordnungspunkt des Konzils ist die Beendung des Abendländischen Schisma und damit die Wiederherstellung der Einheit der Kirche. Die Lösung besteht darin, alle drei Päpste abzusetzen und einen neuen, von allen anerkannten Papst zu wählen.
Doch auf dem Konzil wird nach kurzer Zeit eine ungewöhnliche Reform des Stimmrechts unternommen: Fortan gilt nicht mehr das Prinzip ein Teilnehmer, eine Stimme, sondern es wird nach Nationen abgestimmt, wobei jede Nation nur eine Stimme haben soll. Damit haben die Italiener nur noch eine Stimme, die gegen die drei anderen Nationen England, Deutschland und Frankreich sowie die des Kardinalskollegiums steht.
Dem Kirchenkritiker Jan Hus, dem König Sigismund freies Geleit zugesichert hatte, wird auf dem Konzil von Konstanz der Prozess gemacht und am Scheiterhaufen verbrannt.
28. 11 1414 - Jan Hus wird während des Konzils von Konstanz gefangen genommen
Konstanz * Jan Hus wird während des Konzils von Konstanz gefangen genommen.
Ab dem 6. 12 1414 - Jan Hus wird in Konstanz in einem Verlies inhaftiert
Konstanz * Jan Hus wird auf der Dominikanerinsel in Konstanz in einem Verlies inhaftiert. Weil Jan Hus seine Thesen nicht widerrufen will, wird der Geleitbrief des Königs für den Kritiker für ungültig erklärt, weil jetzt nicht mehr die weltliche Ordnung für ihn zuständig sei, sondern die kirchliche.
Außerdem war die Zusage - nach damaliger Rechtsauffassung - sowieso ungültig, weil es gegenüber einem Häretiker keine verpflichtende Zusage geben kann.
24. 12 1414 - König Sigismund trifft in Konstanz ein
Konstanz * König Sigismund trifft in Konstanz ein. Er ärgert sich zwar über den von ihm ausgestellten und von den Kirchenoberen gebrochenen Geleitbrief für Jan Hus, unternimmt aber nichts zur Hilfe des Kirchenkritikers.
1415 - Jakob Klewber besitzt in der Wein- und Landschaftsstraße ein Haus
München-Graggenau * Der „Weinschenk“ und „Salzsender“ Jakob Klewber besitzt in der Wein- und Landschaftsstraße ein Haus.
An seiner Stelle befindet sich heute am „Neuen Rathaus“ das „Kloiber-Eck“ mit der plastischen Darstellung eines Holzhackers („kloiben“ = Holz hacken).
20. 3 1415 - Papst Johannes XXIII. flieht nach Schaffhausen
<p><strong><em>Konstanz - Schaffhausen</em> </strong>* Papst Johannes XXIII., als dessen Gefangener Jan Hus gilt, flüchtet - heimlich und als Knappe verkleidet - von Konstanz nach Schaffhausen. Er befürchtet, dass man ihm wegen früherer Fehltritte den Prozess machen könnte. </p>
24. 3 1415 - Jan Hus wird vom Verlies in eine gesündere Unterkunft gebracht
Konstanz * Schlecht genährt und krank wird Jan Hus vom Verlies auf der Dominikanerinsel in Konstanz in eine gesündere Unterkunft gebracht. Er kommt in den Gewahrsam des Bischofs von Konstanz. Der Kirchenkritiker soll zwar seine Thesen widerrufen, doch ein toter Jan Hus nützt niemanden.
6. 4 1415 - Die Hoheit des Konzils über den Papst wird festgeschrieben
<p><strong><em>Konstanz</em></strong> * Auf dem Konzil von Konstanz wird die Hoheit des Konzils über den Papst wird festgeschrieben. </p>
29. 4 1415 - König Sigismund lässt Papst Johannes XXIII. gefangen nehmen
Heidelberg * König Sigismund lässt Papst Johannes XXIII. gefangen nehmen und im Heidelberger Schloss inhaftieren.
29. 5 1415 - Das Konzil von Konstanz erklärt Papst Johannes XXIII. für abgesetzt
Konstanz * Das Konzil von Konstanz erklärt Papst Johannes XXIII. für abgesetzt. Nun muss sich das Konzil mit den beiden anderen Päpsten beschäftigen.
- Papst Gregor XII., bereits über 80 Jahre alt, lenkt bald ein. Er erkennt das Konzil von Konstanz als legitimes Konzil der Kirche an und erklärt seine Resignation.
- Papst Benedikt XIII., der inzwischen in Perpignan residiert, erklärt sich zwar zu einer Abdankung bereit, knüpft daran jedoch Bedingungen, die ihm allerdings nicht bewilligt werden. Daraufhin hält er seinen Anspruch aufrecht und flieht nach Peñiscola in Spanien.
König Sigismund erreicht aber, dass ihm die spanischen Königreiche die Unterstützung entziehen und als fünfte Konzilsnation nach Konstanz kommen. Damit ist Papst Benedikt XIII. endgültig isoliert. Wegen „Verweigerung der Resignation“ wird ihm der Prozess gemacht.
31. 5 1415 - Papst Johannes XXIII. erhält seine Absetzung
Heidelberg - Konstanz * Papst Johannes XXIII. erhält während seiner Gefangenschaft auf Schloss Heidelberg seine vom Konzil in Konstanz ausgesprochene Absetzung. Er erklärt sich mit seinem Rücktritt unter der Bedingung einverstanden, dass auch die beiden anderen Päpste abtreten.
5. 6 1415 - Jan Hus kommt in das Franziskaner-Kloster in Konstanz
Konstanz * Jan Hus kommt in das Franziskaner-Kloster in Konstanz. Dort wird er bis zum 8. Juni verhört.
Bis um den 30. 6 1415 - Jan Hus schwört seinen Lehren nicht ab
Konstanz * Böhmische und mährische Adlige haben erreicht, dass Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz sich selbst und seine Lehren öffentlich verteidigen kann. Das Konzil verlangt von Jan Hus „den Widerruf und die Abschwörung seiner Lehren“. Der als Häretiker Angeklagte lehnt dies jedoch ab.
4. 7 1415 - Der römische Papst Gregor XII. tritt zurück
Konstanz * Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz, ein religiös sehr engagierter Mann, bringt den römischen Papst Gregor XII. dazu, zu resignieren. Der Greis wird im Gegenzug zum päpstlichen Legaten auf Lebenszeit ernannt.
6. 7 1415 - Jan Hus wird zusammen mit seinen Schriften verbrannt
Konstanz * Jan Hus wird am Vormittag wegen seiner Lehre von der „Kirche als der unsichtbaren Gemeinde der Prädestinierten“ als „Häretiker“ zum Feuertod verurteilt.
Am Nachmittag wird Jan Hus zusammen mit seinen Schriften auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Seine Asche wird in den Rhein gestreut.
29. 3 1416 - Den Juden wird ein Platz für einen Friedhof zugewiesen
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Münchner Juden erhalten von den Herzögen Ernst und Wilhelm einen Platz für einen Friedhof zugewiesen, <em>„gelegen bey dem perg zwischen Mossach und dez Rennweges“</em>. Er liegt in der Gegend des heutigen Maßmannbergls, mit dem Rennweg ist die Schleißheimer Straße gemeint. </p>
26. 7 1417 - Der Avignoner Gegenpapst Benedikt XIII. wird abgesetzt
Konstanz - Avignon * Der Avignoner Gegenpapst Benedikt XIII., der erst gar nicht zum Konzil von Konstanz erschienen ist, wird für abgesetzt und sein Papsttum für ungültig erklärt.
Nach der Absetzung beziehungsweise der Abdankung der drei Päpste ist der Weg frei für eine Neuwahl. Das in Konstanz versammelte Kardinalskollegium erklärt sich bereit, an der Wahl auch die Vertreter der Nationen zuzulassen.
8. 11 1417 - Das Konklave beginnt mit der Wahl des neuen Papstes
Konstanz * Das Konklave beginnt mit der Wahl des neuen Papstes.
11. 11 1417 - Der Italiener Oddo di Colonna wird zum Papst Martin V. gewählt
Konstanz * Das Konklave entscheidet sich für den Italiener Oddo di Colonna, der sich den Namen Martin V. gibt. Damit hat die Kirche wieder einen von allen anerkannten Papst. Das Abendländische Schisma gilt damit als beendet.
1418 - Der „Hafnermeister“ Chunrat Lecker fertigt im Auftrag der Stadt Ziegel
Haidhausen * Der „Hafnermeister“ Chunrat Lecker fertigt im Auftrag der Stadt Ziegel.
Im Jahr darauf brennt er 230.000 Steine in 10 Öfen.
1418 - Das „Jägerbuch“ von Herzog Ludwig VII. dem Bärtigen von Baiern-Ingolstadt
Ingolstadt * Im „Jägerbuch“ von Herzog Ludwig VII. dem Bärtigen finden sich Hinweise auf die „Falknerei“ in Baiern.
Der Herzog von „Baiern-Ingolstadt“ ist der Bruder der französischen Königin Isabeau de Baviére.
Spätestens bei seinen langen Aufenthalten am Hof des französischen Königs lernt er die „Beizjagd“ kennen.
Und da schon im Mittelalter an den Höfen des französischen Königs eine unglaubliche Prachtentfaltung herrscht, wird hier auch die „Falknerei“ mit größtem Glanz und Aufwand betrieben.
Es gibt dort sogar einen „Falkenmeister des Königs“, der später den Titel „Großfalkonier von Frankreich“ trägt.
Herzog Ludwig VII. von Baiern-Ingolstadt, der sich anno 1402 mit Anna von Bourbon vermählt hatte, regiert und verwaltet sein Teilherzogtum nach französischem Muster.
Der Adel kleidet sich französisch und sogar die Ingolstädter Häuser sind nach Pariser Geschmack erbaut und eingerichtet worden.
Hier dürfte demzufolge auch die „Beizjagd“ entsprechend aufwändig ausgeübt worden sein.
In dem bereits genannten „Jägerbuch“ ist festgelegt worden, dass die „Falkner“ zu dem Personenkreis gehören, die das „Recht der Nachtselden“ in Anspruch nehmen können.
Das bedeutet konkret, die vom Herzog den Klöstern und Kirchen auferlegte Verpflichtung, „unsere jägermaister, jäger und valcknär“ zu beherbergen und zu verpflegen oder ersatzweise jährlich einen Geldbetrag abzuliefern.
Die „Prälaten“ von sechs Klöstern verklagen daraufhin Herzog Ludwig VII. vor dem „Baseler Konzil“, das ihn anno 1433 mit dem „Kirchenbann“ belegt.
Der Regent des Ingolstädter Herzogtums stirbt mit dieser Strafe.
22. 4 1418 - Ein verheerendes Großfeuer zerstört weite Teil der Stadt
München * Ein verheerendes Großfeuer zerstört weite Teil der Stadt.
Anno 1420 - Das „Stern-Frauenhaus“ besteht aus einer „Frauenmeisterin und 6 Dirnen“
München-Kreuzviertel * Das „Frauenhaus Der Stern“ besteht aus einer „Frauenmeisterin und sechs Dirnen“.
Seit der Gründung des „Frauenhauses am Anger“ (1437) heißt das „Bordell“ am Schwabinger Tor „das alt Frauenhaus“.
Um das Jahr 1420 - Der nächste Schritt zur Kriminalisierung der „Magie“
Paris * Der nächste Schritt zur Kriminalisierung der „Magie“ kristallisiert sich zwischen 1400 und 1430 heraus und ist eine Folge der politisch motivierten „Magie- und Schadenszauberprozesse“ am französischen Königshof.
Eine neue Tätergruppe wird gefunden in den „gotteslästerlichen, die göttliche wie obrigkeitliche Ordnung verleugnende Ketzersekte der schadenstiftenden Hexen“, die sich zu ihren nächtlichen „Verschwörungsorgien“ an „heimlichen Orten“ auf „allerlei Fluggeräten“ auf den Weg machen.
Daraus leitet sich ab: der „Pakt“, die „Buhlschaft“, der „Flug“, der „Sabbat“ und der „Schadenszauber“.
Das ist der Beginn einer breiten „Hexenverfolgung“ in den Tälern der Westalpen.
Um 10 1420 - Wieder Pest in München
München * Um diese Zeit herrscht in München die Pest.
1421 - Der Vorläufer des „Roten Turms“ erstmals genannt
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Ein „torhäusl auf der Iserbrucken“ wird genannt.
Es ist der Vorläufer des „Roten Turms“.
13. 12 1421 - Der Freisinger Bischof Hermann von Cilli stirbt
Freising * Der Freisinger Bischof Hermann von Cilli stirbt.
1422 - Eine „Wasserstube am Gasteigberg“ wird erstmals genannt
Au * Eine „Wasserstube am Gasteigberg“ wird erstmals genannt.
29. 3 1422 - Nikodemus della Scala zum Bischof von Freising ernannt
Rom-Vatikan * Papst Martin V. ernennt den von Herzog Heinrich XVI. dem Reichen von Baiern-Landshut unterstützten Nikodemus della Scala zum Bischof von Freising.
9. 4 1424 - Eine Kleidervorschrift wird beraten.
<p><strong><em>München</em></strong> * Eine Kleidervorschrift wird beraten. Es geht um das Tragen der Schleier und <em>„Stauchen“</em> durch die Frauen. Die <em>„Stauchen“</em>, der <em>„Stauch“</em> oder das <em>„Stäuchel“</em> ist ein mehrfach um den Kopf geschlungenes Tuch.</p>
1425 - Beseitigung dieser „Stätte der Unzucht“ gefordert und abgelehnt
München-Angerviertel * Der „Dekan“ von „Sankt Peter“, in dessen Pfarrei sich das „Haus des Scharfrichters“ und damit das „Stadt-Bordell“ liegt, fordert die Beseitigung dieser „Stätte der Unzucht“.
Doch der Münchner Rat lehnt dieses Ansinnen mit dem Hinweis auf „das Herkommen und das Alter“ dieser Einrichtung kategorisch ab.
Um 1425 - „Hexerei“ als eines der verabscheuungswürdigsten Verbrechen
Norditalien - Mittelitalien * Bernardino von Siena, ein „franziskanischer Bußprediger“, der später „heiliggesprochen“ wird, predigt auf seinen „Missionsreisen“ durch Nord- und Mittelitalien vehement gegen „Juden“, „Häretiker“, „Sodomiten“ und „Ehebrecher“.
Auch glaubt er, überall auf „magische Praktiken, Wahrsagerei, Zauberei und das Wirken von Dämonen“ zu treffen.
Er bezeichnet die „Hexerei“ als eines der verabscheuungswürdigsten Verbrechen, für dessen Duldung Gott die Menschheit hart bestrafe.
Seine Zuhörer fordert der „heilige Mann“ auf, die „Hexen, Wahrsager und Zauberer“ aufzuspüren und zu vernichten.
Seine Predigten enden regelmäßig in regelrechten Verfolgungen und Hinrichtungen.
Das „Verfolgunsgebiet“ ist so erweitert worden.
1427 - Die „schöne Ursel“ von Wolfratshausen wird als Hexe aus der Stadt gejagt
München - Wolfratshausen * Die „schöne Ursel“ von Wolfratshausen wird als Hexe aus der Stadt gejagt, weil sie den „Pfaffen der Pötschnermesse“ so bezaubert hat, dass dieser Messgewänder und das Messbuch an die Juden versetzt.
1428 - Ein öffentlicher „Weinkeller“ zur Förderung des Weinhandels
München-Graggenau * Zur Förderung des Weinhandels richtet der Rat der Stadt unter der „Bürgertrinkstube“ im „Implerhaus“ einen öffentlichen „Weinkeller“ ein.
1428 - Die Brüder Pientzenauer verkaufen ihren „aigen Hof in Haidhausen“
Haidhausen * Die Brüder Pientzenauer verkaufen ihren „aigen Hof in Haidhausen“ an Ulrich und Kathrayn Schaefftaler, die weitere Zukäufe zum „Gronimushof“ tätigen.
24. 4 1429 - Ein Stadtbrand vernichtet große Areale
München * Ein Brand legt große Teile der Stadt in Schutt und Asche.
25. 6 1429 - Die Stadt betreibt ihren ersten städtischen Ziegelofen in Haidhausen
Haidhausen * Im Interesse seiner eigenen Bauvorhaben, aber auch, um für den privaten Hausbau die Kosten zu senken, betreibt die Stadt München ihren ersten städtischen Ziegelofen in Haidhausen.
1430 - Ein fünfbändiger Entwurf für einen „christlichen Idealstaat“
Savoyen * Herzog Amadeus VIII. von Savoyen, der spätere „Gegenpapst“ Felix V., lässt einen fünfbändigen Entwurf für einen „christlichen Idealstaat“ erarbeiten.
Darin dürfen keinerlei „Normverstöße“, erst recht keine „Gotteslästerung, Häresie und Zauberei“ geduldet werden.
Als weltlicher Herrscher führt er in seinem Herzogtum bereits schärfere Gesetze gegen „sittliche und religiöse“ Verstöße ein.
Dabei führt Herzog Amadeus - „der Friedfertige“ - das „inquisitorische Verfahren“ gegen „Ketzer“ wie gegen „Zauberer“ ein und ermuntert seine Amtsleute, mit „dominikanischen und franziskanischen Inquisitoren“ zusammenzuarbeiten.
Um 10 1430 - Die Pest sucht die Stadt heim
München * Die Pest sucht die Stadt heim.
1431 - Drei Ratsmitglieder reisen mit Wein zu Verhandlungen nach Straubing
München - Straubing * Als drei Ratsmitglieder zu Verhandlungen nach Straubing abgesandt werden, gibt man ihnen ein ansehnliches Quantum „Malvasier“ und „Romanier“ mit, damit sie entsprechend „witzig und schlagfertig“ sind und von den „herzoglichen Räten“ nicht übertroffen werden.
1431 - Dem „Zauberer“ Schneider werden die Augen ausgestochen
München * Dem „Zauberer“ Schneider werden wegen „unchristlicher Buberei“ die Augen ausgestochen und die Zunge abgeschnitten.
Vor dem 29. 5 1432 - Den Franziskanern fließt ein stattliches, ständig wachsendes Vermögen zu
München-Graggenau * Den bei der Münchner Einwohnerschaft beliebten Franziskaner Barfüßern fließt innerhalb weniger Generationen ein stattliches, ständig wachsendes Vermögen zu. Zahlreiche Adelige und Bürger stiften dem Kloster sogenannte Jahrtage mit regelmäßigen Reichnissen in Naturalien und Bargeld. Das führt schnell zur Verwahrlosung der Klostersitten, sodass sich der Münchner Rat zum Einschreiten veranlasst sieht.
29. 5 1433 - Verordnung über das Spielen und den Bau eines Frauenhauses
München-Angerviertel * Die Herzogbrüder Ernst und Wilhelm III. erlassen - auf Bitte des Rats der Stadt - eine ausführliche Verordnung über das „Spielen“ und den Bau eines Frauenhauses (Stadtbordell), „daz dadurch vil ybels an frawen und jugkfrawen understannden [verhindert] werde“. Die Stadt erwirbt dafür vom Heiliggeist-Spital ein Anwesen an der Mühlgasse am Anger.
3. 10 1433 - Der Rat der Stadt erlässt eine neue Bußordnung
München * Die neue, vom Rat der Stadt erlassene Bußordnung enthält neugefasste Sätze über die Bewirtung der Gäste bei Hochzeiten und Taufen. Nach der Bußordnung ist die Sperrstunde im Sommer um 9 Uhr, im Winter um 8 Uhr. Die Beschränkungen beim Kleiderluxus werden aufgeweicht.
1434 - Der Haidhauser Lehm wird auf Tauglichkeit untersucht
Haidhausen * Die Stadt lässt einen „Ziegelmeister“ aus Straubing kommen, der den Haidhauser Lehm auf Tauglichkeit untersuchen soll.
Gleichzeitig schickt die Stadtverwaltung Lehmproben nach Augsburg.
Das Ergebnis ist eine schallende Ohrfeige für die Münchner „Hafner“, weil die Augsburger eine wesentlich bessere Qualität an Ziegeln herstellen konnten als die Münchner. Damit war eindeutig bewiesen, am Material liegt es nicht.
12. 10 1435 - Agnes Bernauer wird in Straubing in der Donau ertränkt
Straubing * Agnes Bernauer, die nicht-standesgemäße Frau des späteren Herzogs Albrecht III., wird in Straubing in der Donau ertränkt.
1437 - Kathrayn Schaefftaler schenkt den „Gronimushof“ ans „Heiliggeist-Spital“
Haidhausen * Kathrayn Schaefftaler schenkt den Haidhauser „Gronimushof“ an das „Heiliggeist-Spital“ in München „zu Hilf und Trost meines Mannes sel., mein und aller glaubigen Sel heil willen“.
1437 - Der Bedarf an Ziegel ist gewaltig
München - Haidhausen * Der Bau des „Salzstadels“ sowie der durchgreifende Um- und Neubau der „Stadtmauer“ erfordert gewaltige Mengen an „Ziegeln“.
22. 1 1437 - Herzog Albrecht III. heiratet Anna von Braunschweig
München * Herzog Albrecht III. heiratet Anna von Braunschweig.
9. 3 1437 - Die Vorarbeiten am Münchner „Frauenhaus“ beginnen
München-Angerviertel * Die Vorarbeiten am Münchner „Frauenhaus“ [= Bordell] beginnen. Für 15 ½ Pfund Pfennige werden 17.000 Mauersteine gekauft.
Um den 28. 10 1437 - Das neue städtische Bordell wird eröffnet
München-Angerviertel * Das neue Stadtbordell wird eröffnet. Es befindet sich in der Mühlgasse am Anger, Ecke Rossmarkt und Blumenstraße. Umgeben ist das Gebäude von einem kleinen Garten.
Das Münchner Frauenhaus ist ein zweigeschossiges, äußerlich an ein oberbaierisches Bauernhaus erinnerndes Gebäude mit 32 großen und zwei kleinen Fenstern. In jedem Geschoss ist eine Stube untergebracht, in der die Kontakte zwischen dem Freier und den Prostituierten hergestellt werden. Hier kann aber auch gezecht und vermutlich gespielt werden. Sie sind also ein Ort der Geselligkeit.
Um diese Stuben, die als einzige Räume beheizbar sind, gruppieren sich insgesamt zwölf abschließbare Kammern. Diese sind mit je einem Bett bestückt. Sehr wahrscheinlich sind das die einzigen Einrichtungsgegenstände dieser Räume. Das Münchner Frauenhaus“ähnelte demnach eher einem modernen Barbetrieb mit angeschlossenen chambres separées als einem heutigen Eroscenter.
Das Frauenhaus ist nicht weit vom Haus des Scharfrichters entfernt. In dem direkt an das Haus angebauten Gebäude mit dem Aufzuggiebel ist lange Zeit der städtische Schinder, Wasenmeister oder Abdecker untergebracht, der ebenso wie der Henker bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als „ehrlos“ gilt und nicht im bürgerlichen Wohnbereich geduldet wird.
Um den 30. 10 1437 - Die Dirne Aellen wird im Stadtbordell ermordet
München-Angerviertel * Die Dirne Aellen wird im Frauenhaus (= Stadtbordell) ermordet. Der Scharfrichter muss sie auf der Freistatt, einem henkereigenen Begräbnisplatz, verscharren.
2. 7 1438 - Herzog Albrecht III. übernimmt den baierischen Thron
München * Herzog Albrecht III. übernimmt den baierischen Herzogsthron von seinem Vater Ernst.
4. 7 1439 - Die Münchner Juden entrichten eine außerordentliche Reichssteuer
München * Die Münchner Juden haben eine außerordentliche Reichssteuer in Höhe von 2.000 rheinischen Gulden entrichtet. Das ist der letzte Nachweis für die Existenz einer Münchner Judengemeinde.
Ab 21. 9 1439 - Ein Exibitionist treibt sein Unwesen
München • Ein Exibitionist hält sich in der Stadt auf und zeigt den Frauen „den zers“, das männliche Glied.
5. 11 1439 - Herzog Amadeus VIII. wird zum Gegenpapst Felix V. gewählt
Basel * Herzog Amadeus VIII. von Savoyen, genannt der Friedfertige, wird zum Gegenpapst Felix V. gewählt, aber lediglich von Baiern, Aragonien, Ungarn und der Schweiz in dieser Funktion anerkannt.
5. 12 1439 - Das abgelaufene Jahr wird als Pestjahr bezeichnet
München * Über das abgelaufene Jahr berichtet der Stadtschreiber Dr. Hans Rosenbusch von einem Pestjahr.
1440 - Die Stadt betreibt fünf „Ziegelwerke“ in Haidhausen
Haidhausen * Die Stadt betreibt fünf „Ziegelwerke“ in Haidhausen.
7. 2 1440 - Eine Leiche im Fass strandet in München
München * An der Isarbrücke verfängt sich ein Fass, dass eine Selbstmörderin enthält, die sich durch Erhängen das Leben genommen hatte. Recherchen im Landgericht Wolfratshausen ergeben, dass man dort die Frau nicht begraben wollte und man sie deshalb in dem Fass auf das Wasser der Isar setzte. Die Münchner legen sie daraufhin wieder in das Fass und lassen sie weiter isarabwärts treiben.
Es war durchaus üblich, dass man Leichen oder Delinquenten, mit denen man nichts zu tun haben wollte, auf einem Floß auf der Isar aussetzte.
23. 5 1440 - Albrecht III. lehnt die Wahl zum böhmischen König ab
Prag * Herzog Albrecht III. wird auf einem Landtag in Prag fast einstimmig zum böhmischen König gewählt. Er nimmt aber die Wahl nicht an.
1441 - Der Rat kauft den zur Lehmgewinnung erforderlichen Grund in Haidhausen
Haidhausen * Zur Errichtung „stadteigener Ziegelwerke“ kauft der Rat den zur Lehmgewinnung erforderlichen Grund und Boden in Haidhausen.
1442 - Jeder „Weinwirt“ muss dem Bürgermeister einen Eid leisten
München * Jeder „Weinwirt“ muss dem Bürgermeister „an Eidesstatt in Treue geloben, sich als Weinwirt friedlich, ehrbar und der Zunftordnung gemäß zu verhalten, jeden Wein nach seinem Wert auszuschenken und nicht zu mischen“.
1442 - Herzog Albrecht III. vertreibt alle Juden aus seinem Teilherzogtum
München * Herzog Albrecht III. vertreibt alle Juden aus dem Teilherzogtum München-Oberbaiern.
Die „Synagoge“ wird in eine „Marienkapelle“ umgewandelt.
Die Vertreibung bedeutet zudem das Ende der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in München.
1443 - Der Müller Oswalt Rueshaimer ist im Besitz der „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Der Müller Oswalt Rueshaimer ist im Besitz der „Giesinger Mühle“ „für drei Leben“, was soviel bedeutete, wie für die Lebenszeit von drei Familienangehörigen, hier: Vater, Mutter, Kind.
6. 3 1445 - Arme Leute aus Oberbaiern kommen für Schanzarbeiten
München * Baiernherzog Albrecht III. gibt den Befehl, wonach den Münchner Bürgern zwei Jahre lang Arbeiter aus dem Umland zur Hilfeleistung für die Schanzarbeiten geschickt werden sollen. Die „armen Leute aus Oberbaiern“ erhalten „genügend Brot und einen Zehrpfennig“. In Haidhausen und in der Au finden sie eine neue Heimat.
1446 - Die Stadt kauft mehrere Lehm-Äcker des Haidhauser „Lenzbauernhofes“
München - Freising * Die Stadt kauft dem „Freisinger Domkapitel“ mehrere Lehm-Äcker des Haidhauser „Lenzbauernhofes“ zum „Ziegelwerch“ ab.
1447 - Die Stadtobrigkeit erlässt „Anordnungen zum Brauwesen“
München * Die Stadtobrigkeit erlässt „Anordnungen zum Brauwesen“, auch wenn sie dabei ihre Kompetenzen weit überschreitet.
Der „Brausatz“ von 1447 besagt, dass das gesottene Bier mindestens 8 Tage in „gepichten Fässern“ lagern muss. Bei einem Verstoß gegen die Anordnung werden empfindliche Strafen in Aussicht gestellt.
25. 6 1448 - Die Rennordnung für das Scharlachrennen wird erlassen
München * Der Rat der Stadt erlässt eine Rennordnung für das sogenannte Scharlachrennen. Die selbe Rennordnung gilt auch für das Fräuleinlaufen, bei dem sich „die freylein“ einen Wettlauf „umb das parchanttuech“ liefern. Das Hurenlaufen ist ein großes jährliches Spektakel.
1449 - Mittenwald erhält zwei Jahrmärkte
Mittenwald * Der Freisinger Landesherr über das „Werdenfelser Land“, Bischof Johann III. Grünwalder, gewährt den Mittenwaldern die Abhaltung von zwei Jahrmärkten.
1450 - München zählt 16 bürgerliche Brauereien
München * München zählt 16 bürgerliche Brauereien.
1450 - Am Anger wird ein „Eichstadel“ für Wein eröffnet
München-Angerviertel * Am Anger wird ein „Eichstadel“ eröffnet.
Durch gewissenhaftes Eichen will der Rat die Weinzufuhren der Kaufleute steigern.
Ab dem Jahr 1450 - Niederbaiern bezieht rund 90 Prozent seiner Einnahmen aus dem Weinbau
<p><strong><em>Landshut</em></strong> * Etwa ab dem Jahr 1450 bis zum Jahr 1500 bezieht das niederbaierische Herzogshaus rund 90 Prozent seiner Einnahmen aus dem Weinbau. Die Staatseinnahmen vom Bier liegen bei zwei Prozent.</p>
1450 - In Mittenwald entsteht ein „Ländhafen“ für Flöße
Mittenwald * In Mittenwald entsteht ein eigener, 50 Meter langer und 16 Meter breiter „Ländhafen“ für den Flusswarentransport, der „Nassen Rott“.
Um 1450 - Die Araber führen die Produktion von Seide in Spanien ein
Spanien * Die Araber führen die Seidenproduktion in Spanien ein.
Aber selbst im 15. Jahrhundert wird noch immer die Seide aus China importiert, weil diese als hochwertiger gilt und die europäischen Fabrikate den Bedarf nicht decken können. Man importiert jedoch hauptsächlich Rohseide, da es hier bereits genügend Arbeitskräfte zum Weben und Verarbeiten gibt.
20. 1 1452 - Es tobt wieder die Pest in der Stadt
München * Es tobt wieder die Pest in der Stadt. Zur Beratung wird für 26 Pfennige Malvasier-Wein für den Stadtrat gekauft.
1453 - Ein weiterer „Brausatz“ verbietet den Brauern jede „Einung“
München * Ein weiterer „Brausatz“ des Münchner Rats verbietet den Brauern jede „Einung“ und untersagt ihnen, sich zu Absprachen zu treffen oder sich gegenseitig verzuschreiben, wie viel und wann sie brauen wollen.
Sie dürfen auch kein Getreide aufkaufen, das sie später wieder verkaufen wollen. Damit soll Handelsschaft und Spekulation verhindert werden.
1454 - Zwei Frauen wegen „Zauberei“ auf den Pranger gestellt
München * Der Münchner Henker muss zwei Frauen wegen „Zauberei“ auf den Pranger stellen und sie dann aus der Stadt treiben.
16. 9 1454 - Johann von Capistran predigt auf dem Schrannenplatz
München-Graggenau * Der Franziskaner-Pater Johann von Capistran predigt auf dem Schrannenplatz so eindringlich, dass sich angeblich „gemeine Töchter“ [= Prostituierte] zum Besseren bekehren und Münchner ihre Spielbretter und Karten verbrennen. Der Asket erhält dafür von der Stadt ein üppiges Gastgeschenk in Form von Wein, Fischen und Fleisch [!] und reist am selben Tag wieder ab. Doch kaum eine Woche später geben sich die Stadtbewohner wieder den Lustbarkeiten hin.
1455 - Dr. Johann Hartlieb verfasst ein Buch über die Kunst der Zauberei
München * Der Arzt und Schriftsteller Dr. Johann Hartlieb verfasst für den Markgrafen Johann von Brandenburg-Kulmbach ein „Puoch aller verpoten kunst und ungelaubens und der zaubrey“.
Johann Hartlieb ist mit Sibilla verheiratet, der illegitimen Tochter von Herzog Albrecht III. und Agnes, und schon deshalb eng mit dem Münchner Hof verbunden.
1458 - Das sogenannte „Pesthaus, Kaltenegger- oder Nonnenhaus“ wird erbaut
Au * Mit diesem Jahr wird allgemein das Entstehungsjahr des sogenannten „Pesthauses, Kaltenegger- oder Nonnenhauses“ an der Franz-Prüller-Straße in der Au angegeben.
1458 - Erstmals erscheint der Name „Kreuzviertel“
München-Kreuzviertel * Erstmals erscheint der Name „Kreuzviertel“.
Er leitet sich von der damals wichtigsten Straße ab, der „Kreuzgasse“, dem heutigen „Promenadeplatz“.
Dort befindet sich der für die Wirtschaft so wichtige „Salzmarkt“.
1459 - Der Rat der Stadt erlässt mehrere Artikel mit „Kleidervorschriften“
München * Der Rat der Stadt erlässt in einem Nachtrag zur „Bußordnung“ vom 3. Oktober 1433 acht neue Sätze und Artikel mit „Kleidervorschriften“.
Die hauptsächlich die Frauenmode betreffenden Vorschriften befassen sich mit Regelungen über Pelzbesätze, die Art der Ärmel, die Länge der Röcke und Mäntel.
Sie verbieten Männern wie Frauen Röcke aus Samt und Seide, Perlenbesatz und Brusttücher für die Frauen.
22. 3 1459 - Maximilian I., der spätere Kaiser, wird geboren
Wiener Neustadt * Maximilian I., der spätere Kaiser aus dem Hause Habsburg, wird in Wiener Neustadt geboren.
1460 - Sebolt Schönmacher wird aus der Stadt gewiesen
München * Weil Sebolt Schönmacher mit seiner „Alchemie“ etliche Bürger geschädigt hat, muss er schwören und versprechen, „zeitlebens nicht mehr in die Stadt und in das Land zu kommen“.
29. 2 1460 - Herzog Albrecht III. stirbt
München * Nach dem Tod Albrechts III. werden seine Söhne Johann IV. und Siegmund Herzöge im Teilherzogtum Baiern-München.
24. 10 1460 - Die Stadtgrenzen werden im Burgfriedensbrief festgelegt
München * Die Grenzen des Münchner Burgfriedens werden im Burgfriedensbrief festgelegt. Das auf der rechten Isarseite gelegene Gebiet gehörte ursprünglich zum Landgericht Wolfratshausen, das dort auch die Jurisdiktion, die Gerichtsbarkeit, ausübte. Die Stadtherren beantragten bei den regierenden Herzögen Johann und Sigmund die Erweiterung des Münchner Burgfriedens.
In dem Erlass wurde daraufhin für den Bereich des Gasteigs bestimmt: „Es soll auch das Siechhaus auf dem Gastay enhalb der Yserpruckh vnnd auch dieselb Yserpruckh auch In vnnserer Statt München Burckfrid ligen. Doch so behalten wir vnns den wasserstromb der Yser, das vnns der mit Herrlichkeit soll beleiben vnnd zustehen“.
1461 - Eine Konzession für „gewerbsmäßige Bettler“
München * Die „Stadtkammer“ lässt „91 Schiltlein“ anfertigen und an die offiziell zugelassenen „Stadtarmen“ verteilen.
Diese müssen künftig diese Schilder beim „Betteln“ offen auf der Brust tragen.
Wer ohne diese Erlaubnis bettelt, wird in die „Schergenstube“ gebracht und auf den „Pranger“ gestellt.
Die Stellung dieser „gewerbsmäßigen Bettler“ lässt sich auch an ihrer offiziellen Teilnahme an der „Fronleichnamsprozession“ ablesen, in der sie in der Gruppe der „Handwerker“ den Abschluss bilden.
1462 - Papst Pius II. bestätigt die „Augustinische Lehre“ zur „Prostitution“
Rom-Vatikan * Papst Pius II. bestätigt die Gültigkeit der „Augustinischen Lehre“ zur „Prostitution“.
1462 - In Perugia wird das erste Leihhaus gegründet
Perugia * Der Franziskanerpater Barnabas gründet in Perugia das erste Leihhaus. Man will damit den Wucher bekämpfen und Menschen, welche vorübergehend in Not geraten sind, vor der Vernichtung ihrer Existenz retten.
Weitere solche Einrichtungen folgen auf italienischem Gebiet. Über Frankreich verbreiten sich die Leihhäuser bald über ganz Europa. Sie heißen damals „Montes pietatis“. Das bedeutet soviel wie „Berg oder Haus des Mitleids“. Die Leihhäuser haben zu dieser Zeit einen ausgesprochenen karitativen Charakter.
Anno 1463 - Die Auer bauen eine „Heilig-Kreuz-Kapelle“ am heutigen Mariahilfplatz
Au * Bei einem Hochwasser der Isar wird ein Kruzifix aus der Gegend um Tölz am heutigen Mariahilfplatz angeschwemmt.
Die Auer bauen eine „Heilig-Kreuz-Kapelle“ um das Relikt.
3. 6 1464 - Umfangreiche Arbeiten an der Isarbrücke
München * Umfangreiche und 107 Pfund und 11 Pfennige teuere Arbeiten an der Isarbrücke beginnen und dauern bis 7. Oktober an.
Ab dem Jahr 1465 - Eine „Warmphase“ begünstigt den Weinanbau in Mitteleuropa
Mitteleuropa * Bis 1552 begünstigt eine „Warmphase“ den Weinanbau in Mitteleuropa.
1465 - Der „Frauenmeister“ muss jede „Dirne“ an der Verehelichung hindern
München * Nach dem „Eidregister“ ist der „Frauenmeister“ verpflichtet, eine jede „Dirne“ an der Verehelichung zu hindern.
10. 9 1465 - Herzog Albrecht IV. wird Mitregent seines Bruders Sigmund
München * Herzog Albrecht IV. wird Mitregent seines Bruders Sigmund im Teilherzogtum Baiern-München.
1467 - Arbeiten an der „Wasserstube“ und am Rohrleitungssystem
Au * Der städtische „Brunnenmeister“ und seine Knechte arbeiten an der am „Gasteigberg“ gelegenen „Wasserstube“ und am Rohrleitungssystem.
3. 9 1467 - Herzog Sigmund zieht sich auf Schloss Blutenburg zurück
Schloss Blutenburg * Herzog Sigmund verzichtet - wegen „Blödheit meines Leibes" - auf das Herzogamt im Teilherzogtum Baiern-München und zieht sich zu einem bequemen Leben auf Schloss Blutenburg zurück.
9. 2 1468 - Grundsteinlegung für die Frauenkirche
München-Kreuzviertel * Bischof Johann Tulbeck und Herzog Sigismund legen den Grundstein für die Frauenkirche. Als Baumeister ist Jörg von Halspach bestimmt worden.
1469 - Der Henker muss die „Huntlerin“, eine „Zauberin“, aus der Stadt treiben
München * Der Henker muss die „Huntlerin“, eine „Zauberin“, aus der Stadt treiben.
1469 - Die „Neuveste“ wird zur ständigen Residenz ausgebaut
München-Graggenau * Die Nachfolger des Baiernherzogs Albrecht IV. erweitern die „Neuveste“ und bauen sie zu ihrer ständigen Residenz - als Ersatz für den „Alten Hof“ - aus.
Damit befindet sich das „Franziskanerkloster“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur „Residenz“ und kann von dort aus sogar direkt betreten werden.
10. 11 1469 - Ein Haidhauser Ziegelstadel für den Bau der Frauenkirche
München - Haidhausen * Die Stadt kauft eigens für den Bau der Frauenkirche einen Ziegelstadel in Haidhausen. Die Ziegel werden im Klosterformat gebrannt: 17,5 cm breit, 34 cm lang und 7,5 cm hoch.
1470 - Jörg von Halspach beginnt mit dem Neubau des [Alten] „Rathauses“
München-Graggenau * Jörg von Halspach, der als „Obrist-Maurer“ auch die „Frauenkirche“ erbaut, beginnt mit dem Neubau des [Alten] „Rathauses“.
Sein Vorhaben konzentriert sich auf den nördlich des „Rathausturmes“ anschließenden Trakt, in dem in der Erdgeschosszone ein neues „Stadtgefängnis“ und ein von allen städtischen Bäckern bedientes „Brothaus“ entsteht.
Über der Sockelzone des Neubaus wird ein großer „Fest- und Tanzsaal“ geschaffen, der dem Repräsentationsbedürfnis der Bürgerschaft und der Stadtherrschaft dient.
Dazu muss zuvor der „Saalbau“ des ersten Münchner „Rathauses“ abgerissen werden.
1470 - Auf 50 Öfen wird in Haidhausen „Ziegel“ gebrannt
Haidhausen * Auf 50 Öfen wird in Haidhausen „Ziegel“ gebrannt.
1470 - In Mittenwald wird ein gemeindliches „Ballenhaus“ gebaut
Mittenwald * Für die aufgespeicherten Waren wird in Mittenwald ein gemeindliches „Ballenhaus“ gebaut.
18. 4 1470 - Die Stadt kauft dem Heiliggeist-Spital den Gronimushof ab
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Die Stadt kauft dem Heiliggeist-Spital den Haidhausener Gronimushof um 245 Pfennige ab, um dort den Rohstoff für die Ziegelherstellung zu erhalten. Der Haidhauser Bauernhof wird auf Leibgeding vergeben. Das bedeutet, dass sich der Lehensnehmer verpflichten muss, den jeweils benötigten Ziegelgrund entschädigungslos an die Stadt abzugeben. Nach dem Lehmabbau erfolgt dann die Rückgabe des Grundes zur weiteren landwirtschaftlichen Nutzung.</p>
1473 - Die „Städtischen Ziegelmeister“ kaufen 356 Föße zum „Ziegelbrennen“ auf
Haidhausen * In 56 Öfen werden in Haidhausen über 782.000 Ziegel gebrannt.
Die „Städtischen Ziegelmeister“ kaufen 356 Föße zum „Ziegelbrennen“ auf.
1473 - Die „Ziegelsteine“ für das „Starnberger Schloss“ sind aus Haidhausen
Haidhausen - Starnberg * Herzog Albrecht IV. bezieht die „Ziegelsteine“ für den Bau des „Starnberger Schlosses“ von den Haidhauser Ziegeleien.
1474 - Das „Richtfest“ für den „Fest- und Tanzsaalbau des Alten Rathauses“
München-Graggenau * Das „Richtfest“ für den „Fest- und Tanzsaalbau des Alten Rathauses“ wird gefeiert.
1474 - Heinrich Institoris wird „Inquisitor der oberdeutschen Ordensprovinz“
Rom-Vatikan * Heinrich Institoris wird zum „Inquisitor der oberdeutschen Ordensprovinz“ ernannt.
Das ist das deutschsprachige Gebiet zwischen Böhmen und Frankreich, Vorderösterreich, der deutschsprachigen Schweiz und dem Elsass.
1475 - Neun von der Stadt benannte „Ziegelmeister“ werden genannt
München - Haidhausen * Neun von der Stadt benannte „Ziegelmeister“ werden genannt.
1475 - Verbot der Schweinehaltung in der inneren Stadt
München * In der inneren Stadt dürfen keine Schweine gehalten werden.
Im Bereich an der heutigen Erhardstraße werden auf städtischem Grund Schweinställe angelegt.
Um 1475 - Die „Franziskaner“ streiten um die Zulässigkeit der regelmäßigen Einkünfte
München-Graggenau * Über die Zulässigkeit der regelmäßigen Einkünfte und über den Umgang mit ihrem Grundbesitz kommt es innerhalb des „Franziskaner-Ordens“ zum Streit.
1475 - Der Innenausbau für das „Alte Rathaus“ beginnt
München-Graggenau * Das „Alte Rathaus“ wird mit Lärchenschindeln gedeckt.
Inzwischen haben auch die Arbeiten für den „Fest- und Tanzsaal“ begonnen.
Der Saal nimmt mit seinen 31 x 17 Meter das gesamte Obergeschoss ein.
Eine „Himmelsleiter“ führt vom Marktplatz direkt in den Saal.
Das Tonnengewölbe ist 10,5 Meter hoch und mit Tannenbrettern verschalt.
Hier ist der Ort, an dem die „Moriskentanzfiguren“ von Erasmus Grasser aufgestellt werden.
7. 4 1475 - Zu viele Schweine in der Stadt
München * Nachdem den Bürgern die Anzahl der Schweine und die damit verbundene Verunreinigungs- und Geruchsbelästigung zu hoch geworden ist, verbietet der Rat der Stadt die Schweinehaltung in der Innenstadt ganz und schränkt sie in der äußeren Stadt auf sechs Stück je Schweinehalter ein.
14. 11 1475 - Die Fürstenhochzeit von Landshut
Landshut * Bei der Landshuter Fürstenhochzeit heiratet der 22-jährige Prinz Georg von Baiern-Landshut die polnische Königstochter Jadwiga (oder Hedwig).
1476 - Die Ausschmückung des „Fest- und Tanzsaales“ im „Alten Rathaus“ beginnt
München-Graggenau * Die Ausschmückung des „Fest- und Tanzsaales“ im „Alten Rathaus“ beginnt.
Hier werden Erasmus Grassers „Moriskentanzfiguren“ aufgestellt.
Um 10 1477 - Der Rohbau der „Frauenkirche“ ist fertig gestellt
München-Kreuzviertel * Die Umfassungsmauern der 109 Meter langen, 41,5 Meter breiten und 35 Meter hohen „Frauenkirche“ sind fertig gestellt.
Der Nordturm ist 98,57 Meter hoch, der Südturm 98,45 Meter. Die Differenz beträgt 12 Zentimeter.
19. 3 1479 - Papst Sixtus IV. führt das Fest des „Hl. Joseph“ ein
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Josef ist ein später Heiliger. Erst Papst Sixtus IV. führt das Fest des <em>„Hl. Joseph“</em> ein.</p>
1480 - 16 „Moriskentänzer“ für das „Alte Rathaus“
München * Erasmus Grasser rechnet mit der „Stadtkammer“ die Herstellung von 16 „Moriskentänzern“ für das „Alte Rathaus“ ab.
1480 - Das „Pütrich-“ und „Ridler-Seelhaus“ schließen sich den „Franziskanern“ an
München-Graggenau * Das „Pütrich-Seelhaus“ und das „Ridler-Seelhaus“ schließen sich - nicht ohne äußeren Zwang - den „Franziskanern“ an.
Um 1480 - Die Stadt Einbeck bei Hannover zählt etwa 300 Brauereien
Einbeck * Die Stadt Einbeck bei Hannover zählt etwa 300 Brauereien.
1480 - Herzog Albrecht IV. zwingt die „Konventualen Franziskaner“ zum Abzug
München-Graggenau * Der regierende Herzog Albrecht IV. zwingt - mit päpstlicher Genehmigung und mit Ausnahme von drei reformwilligen Mönchen - die „Konventualen“ zum Abzug und initiiert gemeinsam mit Papst Sixtus IV. eine Reform des Münchner „Franziskanerordens“.
Das Kloster übernehmen nunmehr Pater der „alten Observanz“. Seit dieser Zeit gehen auch die anfallenden Baulasten des Klosters zu Lasten des Herzogs, da den „Observanten“ nach der strengen Auslegung der Armutsregel jedes Eigentum an den Gebäuden untersagt ist.
Nach 1480 - Die Münchner „Franziskaner“ leben von „Almosen“
München-Graggenau * Die Münchner „Franziskaner“ leben nach der Klosterreform in erster Linie von „Almosen“.
Ihre „Klosterbrauerei“ entsteht erst nach Einführung der strengen „Observanz“ als neuer Erwerbszweig. Traditionell bilden zudem die Gebühren für Bestattungen und dem Lesen von Messen auf dem bei den Münchner Bürgern beliebten „Klosterfriedhof“ eine Einnahmequelle.
Als neuer „Hausbetrieb“ entsteht im Münchner Kloster eine „Tuchmanufaktur“.
Sie beliefert die gesamte Provinz mit Stoffen für den „Habit und Wolldecken“.
An handwerklich ausgebildeten „Laienbrüdern“ mangelt es nicht, verfügt doch der umfangreiche Konvent durchschnittlich über siebzig Mönche.
Auch das „Studium der Kleriker“ findet im eigenen Haus statt.
1480 - Der Oberarmknochen des „heiligen Antonius von Padua“
München-Graggenau * Der Oberarmknochen des „heiligen Antonius von Padua“ wird in einem spätgotischen „Reliquiar“ gefasst.
14. 8 1480 - Erasmus Grassers Moriskentanzfiguren werden bezahlt
München * Die Stadt zahlt 150 Pfund 4 Schilling an Meister Erasmus Grasser für die Herstellung von 16 Moriskentanzfiguren für den Festsaal im Alten Rathaus.
29. 9 1480 - In Cham wird böhmisches Bier ausgeschenkt, nicht aber gebraut
Cham * In einem Schreiben wird ausgeführt, dass in der damals zur Kurpfalz gehörenden Stadt Cham böhmisches Bier ausgeschenkt wird, nicht aber gebraut.
10 1480 - Kajetan von Thiene wird geboren
Thiene bei Vicenza • Kajetan von Thiene kommt in Thiene bei Vicenza zur Welt.
1481 - Das Amt des „Bettelmeisters“ in München
München * Das Amt des „Bettelmeisters“ wird in München von zwei dazu Beauftragten ausgeführt.
Sie üben ihre Aufgabe ehrenamtlich aus und bekommen zu ihrer Unterstützung städtisch besoldete „Bettelknechte“ zur Seite gestellt.
1481 - Streit der Bäcker mit den Brauern
München * Ein Ratsprotokoll bereichtet erstmals vom Streit der Bäcker mit den Brauern, bei dem es um das Recht der „Hefezubereitung“ geht.
Die Brauer lieferten den Bäckern die Hefe.
Da diese aber mit der Qualität sowie der Art und Weise wie die Brauer die Hefe lieferten nicht einverstanden waren, gingen sie dazu über, ihre „Backhefe“ selbst herzustellen.
Dadurch verdarb den Brauern die Hefe, wodurch sie einen großen, vermutlich finanziellen Schaden erlitten.
Ab 1481 - Die „Hexen-Verfolgungskampagne“ in der „Diözese Konstanz“
Konstanz * Die „Verfolgungskampagne“ des Heinrich Institoris, des „Inquisitors der oberdeutschen Ordensprovinz“, in der „Diözese Konstanz“ ist - nach seinen eigenen Angaben - erfolgreich verlaufen.
Zwischen 1481 und 1485 werden hier 48 Frauen als „Hexen“ hingerichtet.
1482 - 32 Wagen für die Rott in Mittenwald
Mittenwald * In Mittenwald sollen mindestens 32 Wagen für die Rott bereitgehalten werden.
16. 10 1482 - Wieder beherrscht die Pest München
München * Wieder beherrscht die Pest München. Sie dauert bis zum Anfang des nächsten Jahres.
20. 7 1483 - Die Stadt finanziert mehrere Wallfahrten gegen die Pest
München * Die Stadt finanziert mehrere Wallfahrten gegen die Pest.
Um das Jahr 1484 - Ein früher Entwurf einer „Münchner Brauordnung“
München * Aus diesen Jahren stammt ein Entwurf einer „Münchner Brauordnung“.
Als Begründung für das Entstehen dieses Entwurfs nennen die Verfasser „Missstände im Bräuamt“ und „zahlreiche Beschwerden“ darüber.
Die städtischen Gesetze umfassen die Organisation des Handwerks, die Herstellung des Produkts vom Einkauf der Rohstoffe bis zur Fertigung des Produkts und dessen Vertrieb.
Zudem finden sich in diesem ratsherrlichen Entwurf Anweisungen zum Bierpreis und zur Biersorte.
Die städtische Obrigkeit tritt eindeutig für die Interessen der Verbraucher ein.
1484 - Papst Innozenz VIII. erlässt eine „Hexenbulle“
Rom-Vatikan * Papst Innozenz VIII. erlässt eine „Hexenbulle“.
1484 - Papst Innozenz VIII. erlässt die Bulle „Summis desiderantes“
Rom-Vatikan * Der Verfasser des „Hexenhammers“, Heinrich Kramer [„Henricus Institoris“], erwirkt von Papst Innozenz VIII. die Bulle „Summis desiderantes“, in der er die von „Hexen“ begangenen Schäden beklagt, die in den „Erzbistümern“ Köln, Mainz, Trier, Salzburg und Bremen aufgetreten sein sollen.
Gleichzeitig kritisiert er den Widerstand, mit dem viele Städte und Territorien eine „Hexenverfolgung“ verweigern.
1. 1 1484 - Wieder einmal: Die Pest in München
München * Noch immer herrscht die Pest in München. Wer kann, verlässt die Stadt.
5. 2 1484 - Durch die Pest kommt das Marktleben und der Handel zum Erliegen
München * Der Rat sagt der Gemain zu, für das Jahr 1483 keine Steuer zu erheben. Das Marktleben und der Handel waren durch die herrschende Pest zum Erliegen gekommen.
21. 2 1484 - Aufwandsentschädigung wegen der Pest
München * Während der Pestzeit haben die meisten Stadträte die Stadt verlassen. Diejenigen, die die Amtsgeschäfte weitergeführt haben, erhalten jetzt vom Rat eine Aufwandsentschädigung zugebilligt.
1485 - Die „Hexenverfolgung“ in der „Diözese Brixen“ scheitert
Brixen * Die „Hexenverfolgung“ des Heinrich Institoris, des „Inquisitors der oberdeutschen Ordensprovinz“, in der „Diözese Brixen“ scheitert, nachdem der dortige Bischof für den Abbruch des Verfahrens sorgt und Institoris hinaus wirft.
Seine Prozessführung ist offensichtlich so wirr, rechtsbrüchig und skandalös, dass der Bischof keinen anderen Weg als diesen sieht.
14. 10 1485 - Herzog Albrecht IV. erlässt eine neue Brauordnung
München * Herzog Albrecht IV. erlässt eine neue Brauordnung. Er übernimmt darin größtenteils die städtischen Gesetze, die um das Jahr 1484 durch den Rat der Stadt München erlassen worden sind. Die herzogliche Brauordnung regelt vornehmlich die Organisation des Münchner Braugewerbes.
1486 - Der berüchtigte „Hexenhammer“ wird veröffentlicht
Speyer * Der berüchtigte „Hexenhammer - Malleus maleficarum“, ein „Lehrbuch des Hexenglaubens und der Hexeninquisition“, wird veröffentlicht.
Der „Dominikanermönch“ Heinrich Institoris, der zudem „Inquisitor der oberdeutschen Ordensprovinz“ ist, schreibt das Buch, nachdem er mit einer Inquisition in Innsbruck in der „Diözese Brixen“ gescheitert ist.
Nach dieser Niederlage will er seine Position stärken und die „Hexenverfolgung“ vor deren Gegnern zu rechtfertigen.
Das Buch wird als Vorbild für die künftig in Deutschland geführten „Hexenprozesse“ dienen und wird bis ins 17. Jahrhundert hinein in 29 Auflagen erscheinen.
6. 8 1486 - Herzog Albrecht IV. nimmt in Regensburg in Besitz
Regensburg * Herzog Albrecht IV. zieht in Regensburg ein, um die Stadt gemäß deren Wunsch in Besitz zu nehmen.
7. 11 1486 - Die Stadt Landshut veröffentlicht eine Brauordung
Landshut * Die Stadt Landshut veröffentlicht eine Brauordung. Eine Abschrift erhält auch der Münchner Stadtrat, dem sie zur Orientierung dient. Sie beinhaltet ein Reinheitsgebot, das als Bestandteile des Bieres nur Gerste und Hopfen nennt.
Um 12 1486 - Eine erste Fassung des „Münchner Reinheitsgebots“ entsteht
München * Eine erste Fassung des „Münchner Reinheitsgebots“ entsteht.
Es besagt: „Item sie [die Brauer] sollen auch Bier und Greußing sieden und brauen nur allein von Gersten, Hopfen und Wasser und sonst nichts darein oder darunter tun noch sieden, oder man strafe sie für falsch“.
1487 - Der „Bozener Markt“ wird nach Mittenwald verlegt
Mittenwald * Die Venetianer Kaufleute verlassen Bozen als ihren Hauptstapelplatz für Waren nach einem Streit mit der dortigen Regierung.
Als Ersatzstandort erwählen sie Mittenwald, in dem sie bis 1679 den sogenannten „Bozener Markt“ abhalten und die „welschen“ - sprich fremden - Waren angebieten, verkaufen und verfrachten.
Auf Saumtieren und Karren werden die Güter über die steilen Gebirgspässe gebracht und gelangen schließlich über Zirl und Seefeld hinab nach Scharnitz und Mittenwald.
Den Weitertransport übernehmen heimische Fuhrleute.
Gehandelt wird mit: Gewürzen, Südfrüchten, Ballen mit Baumwolle, Pfeffersäcke, Säcke mit Johannisbrot, Safran und Ingwer, Ballen mit Schreibpapier, Borten, Schleier, Ölfässer, Fässer mit Feigen, Zucker, Welsch- und Etschwein.
Um 1487 - Herzog Sigmund von Tirol erklärt Venedig den Krieg
Bozen * Herzog Sigmund von Tirol lässt auf dem „Bozener Markt“ 130 venezianische Kaufleute verhaften und erklärt darüber hinaus der „Republik Venedig“ den Krieg.
Aus diesem Grund schlagen die venezianischen Händler ihre Kaufstände seither im bischöflich-freisingischen Mittenwald auf.
1487 - Heinrich Institoris veröffentlicht den „Hexenhammer“
Nürnberg * Der „Dominikanermönch“ Heinrich Institoris veröffentlicht den „Hexenhammer“ genannten „Malleus Maleficorum“ und schafft damit eine ausgeklügelte, systematische „Hexenlehre“.
1487 - Erstmals wird eine Bronzemadonna auf eine Marmorsäule gestellt
Udine * Erstmals wird in Udine eine Bronzemadonna auf eine Marmorsäule gestellt.
3. 1 1487 - Herzog Albrecht IV. ehelicht die 21jährige Kaisertochter Kunigunde
Innsbruck * Der 39jährige Baiernherzog Albrecht IV. entführt und ehelicht die 21-jährige Kaisertochter Kunigunde in Innsbruck.
11. 11 1487 - Der gepachtete Ziegelstadel wird nicht mehr gebraucht
Haidhausen * Letztmals zahlt die Stadt die Pacht für das Abziegeln von Grundstücken der Familie Pötschner in Haidhausen. Ab sofort wird der eigens für den Bau der Frauenkirche gepachtete Ziegelstadel nicht mehr gebraucht.
30. 11 1487 - Herzog Albrecht IV. erlässt das sogenannte Münchner Reinheitsgebot
München * Herzog Albrecht IV. erlässt auf Druck des Münchner Rats das sogenannte Münchner Reinheitsgebot. Der erste Paragraph dieses Gesetzes lautet:
„Zuerst so sollen nu füran die Bier hie nit höher dann ein maß ze einem oder zwaien Pfenningen ausgeschenkt, auch aus nicht anderm dann Hopfen, Gersten und Wasser gesotten und nit ausgeschenckt [werden], sy seyen dann vor[her] von den[en], die, als hernach folget, darzue geordent und gesetzt werden, beschaut und gesetzt.“
- Der erste Teilsatz setzt den Preis pro Mass fest,
- Teilsatz 2 bestimmt, woraus das Bier ausschließlich zu brauen ist und
- Teilsatz 3 nennt die Voraussetzungen für die Erlaubnis zum Ausschank:
Die vorherige Beschau oder Prüfung und die Preisfestsetzung durch die nachstehend bestimmten Prüfer.
Um den 12 1487 - Herzog Albrecht IV. erlässt eine „Brauordnung“ für Regensburg
Regensburg * Eine von Herzog Albrecht IV. erlassene „Brauordnung“ für die Stadt Regensburg lautet im Kernsatz:
„Die Bierbräuen sollen einen Eid zu Gott und den Heiligen schwören, zum Biersieden nichts anderes dann allein Malz, Hopfen und Wasser zu nehmen, noch jemand irgendetwas anderes darin zu versiegen noch in das Bier tun, dieweil das in seiner Gewalt ist, gestatten“.
Damit war man schon ganz nahe am „Münchner Reinheitsgebot“.
Auffallend ist jedoch, dass anstelle von der „Gerste“ vom „Malz“ gesprochen wurde.
Damit konnte auch weiterhin dem Bier „Hafer“ zugegeben und dadurch auf die unterschiedlichen Ernteergebnisse Rücksicht genommen werden.
Eine weitere große Ausnahmeregelung unterscheidet das „Regensburger“ vom „Münchner Reinheitsgebot“:
Die Zugabe von bestimmten Gewürzen und Kräutern, die beim Regensburger Wein nicht verpönt waren und deshalb beim Bier - unter bestimmten Voraussetzungen - auch nicht ausgeschlossen werden sollten.
1488 - Der Bau der „Frauenkirche“ ist vollendet
München-Kreuzviertel * Der Bau der „Frauenkirche“ ist vollendet.
1488 - Albrecht IV. schließt mit Hans von Degenberg einen „Erbschaftsvertrag“
München * Herzog Albrecht IV. schließt mit Hans von Degenberg einen „Erbschaftsvertrag“, wonach beim Aussterben der Degenberger in der männlichen Linie deren gesamter Herrschafts- und Besitzkomplex in den Besitz der Wittelsbacher übergeht.
1488 - Das Verhelichungsverbot für Prostituierte entfällt
München * Die strenge Regel im „Eidregister“, wonach der „Frauenmeister“ verpflichtet ist, eine jede „Dirne“ an der Verehelichung zu hindern, fällt weg.
22. 5 1489 - Der Stadtrat erlässt eine Weinschenken-Ordnung
München * Der Rat der Stadt erlässt eine 27 Artikel umfassende Weinschenken-Ordnung.
27. 12 1489 - Predigende Franziskaner sind eine geistliche Konkurrenz
München-Graggenau * Die Pfarrer der Peterskirche und der Frauenkirche beschweren sich bei den Franziskanermönchen, dass diese durch ihre Predigten eine scharfe geistliche Konkurrenz gegenüber den weltlichen Stadtpfarreien ausüben.
Man einigt sich darauf, dass die Franziskaner zu bestimmten Zeiten das Predigen an Vormittagen unterlassen.
Um 1490 - Ein Hochgrab für Kaiser Ludwig den Baiern in der Frauenkirche
München-Kreuzviertel * Im Auftrag Herzog Albrechts IV. entsteht in der Frauenkirche ein Hochgrab für Kaiser Ludwig den Baiern aus Rotmarmor.
1490 - Das „öffentliche oder heimliche Halten von Konkubinen“ wird verboten
Rom-Vatikan * Der päpstliche Vikar Giacomo Botta erlässt ein Dekret, das allen Klerikern und Laien bei Androhung der „Exkommunikation“ und des „Verlustes der Ämter und Pfründe“ das „öffentliche oder heimliche Halten von Konkubinen“ verbietet.
Papst Innozenz VIII., das ist übrigens auch der mit dem „Hexenhammer“, lässt den Erlass umgehend zurücknehmen und erklärt, dass das „Konkubinat“ nicht verboten sei.
In der Folge gibt es in der heiligen Stadt Rom kaum noch einen Priester oder „Kurialen“, der ohne „Konkubine“ lebt.
6. 1 1490 - Balthasar Pötschner erhält das Papiermonopol auf 20 Jahre
München - Au * Balthasar Pötschner erhält von Herzog Albrecht IV. das Recht, „zu Giesing under dem perg, genannt Neydeck, ain papirmul zu pawen“. Gleichzeitig bekommt er das Produktionsmonopol für Papier auf 20 Jahre.
2. 10 1491 - Nürnberg nimmt ein Hexen-Gutachten unter Verschluss
Nürnberg * Ein Gutachten des Dominikaners Heinrich Institoris über die Verfolgung von Hexen in der Reichsstadt Nürnberg, nimmt der Rat sofort unter Verschluss. Für die Nürnberger Juristen sind die Ansichten des Inquisitors der oberdeutschen Ordensprovinz nicht zu realisieren.
1492 - München wird als eine vornehme Stadt, als „citta noblissima“, beschrieben
München * Andrea de Franceschi, der spätere „Großkanzler von Venedig“, beschreibt München als eine vornehme Stadt, „citta noblissima“, mit prächtigen, mit Kieslsteinen gepflasterten Straßen und mit breiten Plätzen, in deren Mitte sich Brunnen befinden.
1492 - Die „Kesselbergstraße“ wird ausgebaut
Walchensee - Königssee * Die „Kesselbergstraße“ wird ausgebaut.
Der holprige Weg vom Walchensee zum Königssee ist bereits seit dem Jahr 1120 als „Königspfad“ bekannt.
Er war allerdings - trotz des Namens - ein wenig einladender „Saumpfad“.
Dieser wird jetzt auf Anregung des Münchner Ratsherrn Heinrich Barth zu einer Straße ausgebaut, die in neun Kehren die beiden Seen miteinander verbindet.
Der aufblühende „Bozener Markt“ in Mittenwald profitiert von dieser neuen Route.
Bisher mussten die Fuhren nach München entweder die häufig überschwemmte Straße durchs „Murnauer Moos“ und das „Loisachtal“ nehmen, oder sie waren auf das enge Tal der Isar angewiesen.
1492 - Herzog Albrecht IV. muss Regensburg zurück geben
Regensburg * Herzog Albrecht IV. muss Regensburg auf kaiserlichen Druck an das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ zurück geben.
1492 - Herzog Albrecht IV. stiftet den „Franziskanern“ einen neuen „Hochaltar“
München-Graggenau - München-Lehel * Als sichtbaren Ausdruck ihrer Anteilnahme am Leben des Klosters stiftet Herzog Albrecht IV. und seine Gemahlin Kunigunde von Österreich den „Franziskaner-Barfüßern“ einen neuen, von Jan Polack im Stil der Münchner Spätgotik ausgeführten „Hochaltar“.
Er befindet sich heute als ein herausragendes Glanzstück im „Bayerischen Nationalmuseum“.
9. 2 1492 - Haidhausen erhält eine feste Stelle für einen Kaplan
<p><strong><em>Rom-Vatikan - Haidhausen</em></strong> * Papst Alexander VI. genehmigt für Haidhausen ein Inkuratbenefizium, eine feste Stelle für einen Kaplan.</p>
1493 - Die älteste Darstellung von München
München * Der von Michael Wolgemut gefertigte Holzschnitt in der „Hartmann Schedel‘schen Weltchronik“ ist die älteste Darstellung von München.
- Es sind noch keine Isarinseln zu sehen,
- dafür wird am unteren Bildrand die am „Gasteigberg“ gelegene „Wasserstube“ gezeigt.
17. 6 1493 - Haidhausen erhält einen Benefizianten
Haidhausen * Der Benefiziant erhält in Haidhausen eine eigene Wohnung und ist zum ständigen persönlichen Aufenthalt bei seiner Kirche verpflichtet. Das Patronatsrecht über den Haidhauser Kaplan übt der Bogenhausener Pfarrer aus.
14. 12 1494 - Das Herzogliche Georgianum wird gegründet
Ingolstadt * Das Herzogliche Georgianum wird durch Herzog Georg den Reichen von Landshut-Niederbaiern ins Leben gerufen und in die im Jahr 1472 gegründete Universität Ingolstadt eingegliedert. Es ist heute das zweitälteste und einzige staatliche Priesterseminar der Welt.
25. 7 1495 - Die Jakobi-Dult fällt wegen der Pest aus
München * Es herrscht immer noch Pest. In Abstimmung mit dem Stadtrat ordnet Herzog Albrecht IV. an, dass die Jakobi-Dult nicht abgehalten werden soll.
18. 9 1495 - Herzog Ludwig X. kommt in Grünwald zur Welt
Grünwald * Wegen der in München herrschenden Pest wird das fünfte KInd des Herzogpaares Albrecht und Kunigunde, der spätere Herzog Ludwig X., auf der Burg Grünwald geboren.
1496 - Die „Syphilis“ tritt epidemieartig auf
München * Die „Syphilis“ tritt epidemieartig auf.
Diese „Geschlechtskrankheit“ betrachtet man als „Strafe Gottes“ für einen „ausgelassenen Lebenswandel“.
Sie bringt aber nicht die Schließung der „städtischen Frauenhäuser“.
Um den 25. 7 1496 - Die Jakobi-Dult findet trotz der Pest statt
München-Angerviertel * Die Jakobi-Dult findet trotz der noch anhaltenden Pest statt.
19. 9 1496 - Herzog Georg der Reiche von Baiern-Landshut macht sein Testament
Landshut * Herzog Georg der Reiche von Baiern-Landshut bestimmt in seinem Testament, dass seine Tochter Elisabeth, ihr zukünftiger Ehemann Ruprecht von der Pfalz und ihre etwaigen Söhne das Teilherzogtum erben sollen. Herzog Georg und seine Gemahlin Hedwig von Polen hatten keine gemeinsamen männliche Erben.
8. 5 1497 - 30 Vorschriften für die Messerschmiedegesellen
München * Eine Schlichtungsvereinbarung zwischen den Meistern und Gesellen des Messerschmiedehandwerks regelt in dreißig Artikeln das Verhalten der Messerschmiedegesellen. Der Inhalt spannt sich von Bekleidungsvorschriften über Essens- und Trinkgebahren oder so detailierte Vorschriften, wonach kein Geselle Semmeln in Wein tränken und danach essen soll.
Dazu gibt es auch das Verbot, mit einer „gemeinen Frau“, gemeint ist eine Prostituierte, zu tanzen. Die Ordnung schließt mit dem berühmten Artikel 30, in dem es heißt: „Es sol auch kain gesell täglich in dem frawnhauß ligen.“
1498 - In Nürnberg wird ein städtisches Leihhaus eröffnet
Nürnberg * In Nürnberg kann ein städtisches Leihhaus eröffnen.
19. 8 1498 - Randalierende Handwerksgesellen stürmen das Frauenhaus
München-Angerviertel * Randalierende Handwerksgesellen stürmen das Frauenhaus (Stadtbordell) und wollen dem Frauenmeister ans Leben, weil sie ihn für die Einschleppung der Syphilis verantwortlich machen. 35 bewaffnete Soldaten müssen daraufhin 46 Tage und Nächte das Frauenhaus bewachen.
10. 2 1499 - Herzogin Elisabeth und Herzog Ruprecht von der Pfalz heiraten
Landshut * Herzogin Elisabeth von Baiern-Landshut und Herzog Ruprecht von der Pfalz - Cousine und Cousin - heiraten. Ruprechts Mutter Margarete war die Schwester von Herzog Georg dem Reichen von Baiern-Landshut.
13. 3 1499 - Die Stadt München kauft den Lenzbauernhof in Haidhausen
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Der Lenzbauernhof in Haidhausen geht in das Eigentum der Stadt München über. Sie erwirbt ihn vom Freisinger Domkapitel, um auf seinem Grund Lehm für die Ziegelherstellung abzubauen.</p>
1500 - München hat 14 berufsmäßig betriebene „Badstuben“
<p><strong><em>München</em></strong> * München hat 13.500 Einwohner. Es gibt 14 berufsmäßig betriebene Badstuben.</p>
Um 1500 - Der „franziskanische Gottesacker“ wird mit einer Mauer umgeben
München-Graggenau * Der „franziskanische Gottesacker“ wird kurz nach dem Jahr 1500 mit einer sechs bis sieben Meter hohen Mauer umgeben.
Um den 1500 - Es gibt keine Verordnung zur Hygiene der „Prostituierten“
<p><strong><em>München</em></strong> * Es gibt keine Verordnung in Bezug auf die Hygiene der Prostituierten. Das hindert jedoch niemanden am Besuch eines Bordells. Zwar gibt es schon Verbote, den Freiern kranke Frauen zuzuführen, doch ansonsten begreift man zu dieser Zeit eine Krankheit als <em>„Strafe für ein ausschweifendes und wollüstiges Leben“</em>. </p>
1500 - München hat 13.447 Einwohner
München * München hat 13.447 Einwohner.
24. 2 1500 - Carl V., der spätere Kaiser aus dem Hause Habsburg, wird geboren
Gent * Carl V., der spätere Kaiser aus dem Hause Habsburg, wird in Gent geboren.
10. 9 1500 - Auf dem Reichstag wird eine große Reichspolizei-Ordnung beschlossen
Augsburg * Auf dem Reichstag in Augsburg wird eine große „Reichspolizeyordnung“ beschlossen. Sie beinhaltet auch Fragen der Kleiderordnung.
22. 11 1500 - Herzog Albrecht IV. festigt das Hefe-Monopol der Brauer
München * Herzog Albrecht IV. nimmt in einer Verordnung Stellung zum Bäcker-Brauer-Streit um die Hefezubereitung. Der Landesherr spricht sich darin gegen die Herstellung der Gerben durch die Bäcker aus.
Sollte man den Bäckern den Handel mit Malz gestatten, würde dem herzoglichen Brauwesen - und damit natürlich über die daraus fließenden Abgaben auch an den Herzog - „nit wenig Abbruch zugefügt“.
Der Herzog festigt mit seinem Spruch das Monopol der Brauer. Um aber den Klagen der Bäcker gerecht zu werden, müssen die Brauer auf ihre Kosten einen eigenen Keller einrichten, in denen sie ihre Hefe künftig unter der Aufsicht von Beschauern lagern sollen.
Um den 5. 1 1501 - Die baierischen Herzöge erlassen entsprechende Kleiderordnungen
München - Landshut * Die Regenten der beiden Teilherzogtümer Baiern-München, Herzog Albrecht IV., und Baiern-Landshut, Herzog Georg, nehmen eine große Reichspolizeiordnung, die am 10. September 1500 auf dem Augsburger Reichstag erlassen worden war, zum Anlass, für ihren jeweiligen Bereich entsprechende Kleiderordnungen zu erlassen.
Inhaltlich beruhen sie auf einer Pfälzer Ordnung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die entsprechend modifiziert und den ober- und niederbaierischen Verhältnissen angepasst werden. Im Gegensatz zu Landshut ist das Landgebot „Ueberfluß und Unmaas der Bekleidung und anders hiernachfolgendes berührend“ die erste Kleiderordnung für München.
1502 - In 39 Münchner bürgerlichen Brauereien wird Bier hergestellt
München * In 39 Münchner bürgerlichen Brauereien wird Bier hergestellt.
Erstmals stimmt die Zahl der Brauer mit der Zahl der Brauhäuser überein.
Die 39 Brauhausbesitzer stellen für 13.500 Einwohner Bier her.
Zum Vergleich: Im Jahr 1372 brauten 21 Brauer für 11.500 Münchner.
Kamen also 1372 noch 536 Münchner auf einen Brauer, so waren es 1502 nur mehr 346.
Das kann sich nur dann rentiert haben, wenn sich der Bierumsatz des einzelnen Münchners um mindestens das Eineinhalbfache gesteigert hat.
War das der Beginn für den unvergleichlichen Aufstieg des Bieres und der Anfang vom Niedergang des Weinkonsums in München?
1502 - „Konkubinat“ und „Hurerei“ sind beim römischen Priestertum weit verbreitet
Rom-Vatikan * Ein Brief beschreibt die Situation im Vatikan derart:
„Die Häufigkeit des außerehelichen Beischlafs, des Inzests, der Vergewaltigungen von Knaben und Mädchen, die Zahl der Huren, die im Palast des heiligen Petrus herumlungern, und der Herden von Kupplern, die dort umherlaufen, übersteigt in ihrer Schamlosigkeit jene der Bordelle und der Freudenhäuser“.
An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit sind also „Konkubinat“ und „Hurerei“ beim römischen Priestertum sehr weit verbreitet.
10. 4 1502 - Ottheinrich, der spätere Herzog von Pfalz-Neuburg, wird in Amberg geboren
Amberg * Herzog Ottheinrich, der Sohn der niederbaierischen Herzogin Elisabeth und Herzog Rupert von der Pfalz, wird in Amberg geboren.
8. 1 1503 - Der Münchner Hurenwirt wird ermordet
München * Eine Nachricht aus dieser Zeit besagt, dass man den Münchner Bordellwirt doch noch ermordet hat. Die Suche nach dem Täter weitet man sogar bis nach Landshut und Burghausen aus.
10. 3 1503 - Ferdinand I., der spätere Kaiser, kommt bei Madrid zur Welt
Alcalá de Henares * Ferdinand I., der spätere Kaiser und Bruder von Carl V., kommt in Alcalá de Henares bei Madrid zur Welt.
12. 11 1503 - Herzog Philipp von der Pfalz wird in Heidelberg geboren
Heidelberg * Herzog Philipp, der zweitgeborene Sohn Sohn der niederbaierischen Herzogin Elisabeth und Herzog Rupert von der Pfalz, wird in Heidelberg geboren.
1. 12 1503 - Herzog Georg der Reiche vom Teilherzogtum Baiern-Landshut stirbt
Landshut * Herzog Georg der Reiche vom Teilherzogtum Baiern-Landshut stirbt. In der Folge kommt es zum Landshuter Erbfolgekrieg gegen das Teilherzogtum Baiern-München.
Nach dem 1. 12 1503 - Herzog Albrecht IV. widerspricht dem Testament von Georg dem Reichen
München - Landshut * Herzog Albrecht IV. von Baiern-München akzeptiert das Testament von Herzog Georg dem Reichen nicht, wonach seine Tochter Elisabeth, ihr Ehemann Ruprecht von der Pfalz und ihre etwaigen Söhne das Teilherzogtum erben sollen.
Das Testament widerspricht dem Wittelsbachischen Hausvertrag, nach dem beim Aussterben einer männlichen Linie die Besitzungen an die jeweils andere Linie fällt. Das Testament ist aus oberbaierischer Sicht ein Vertragsbruch. Deshalb kommt es zum Landshuter Erbfolgekrieg.
13. 12 1503 - Herzog Albrecht IV. von Baiern-München macht seine Erbansprüche geltend
Landshut * Auf dem noch von Herzog Georg dem Reichen nach Landshut einberufenen Landtag, macht Herzog Albrecht IV. von Baiern-München seine Erbansprüche geltend.
5. 2 1504 - König Maximilian I. stellt sich als Vermittler zur Verfügung
Augsburg * König Maximilian I. lädt die streitenden Parteien der Teilherzogtümer Oberbaiern-München und Niederbaiern-Landshut ins Augsburger Rathaus ein. Er stellt sich als Vermittler zur Verfügung, erhebt aber an beide Seiten Gebietsansprüche für diese Tätigkeit.
Um den 10. 4 1504 - Herzog Albrecht IV. erhält finanzielle und militärische Hilfe
<p><em><strong>München</strong></em> * Herzog Albrecht IV. von München-Oberbaiern erklärt sich bereit, die Gerichte Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg an König Maximilian I. für seine Vermittlungstätigkeiten abzutreten. König Maximilian I. sagt ihm daraufhin eine finanzielle Unterstützung und 10.000 Mann als Hilfstruppe zu. </p>
17. 4 1504 - Der Regentschaftsrat wird aufgehoben
Landshut - Burghausen * Der nach dem Landtag vom 13. Dezember 1503 gegründete Regentschaftsrat wird von Herzog Elisabeth von Landshut-Niederbaiern und Herzog Ruprecht von der Pfalz aufgelöst.
Landshut, Burghausen und andere niederbaierische Städte werden von pfälzischen Truppen besetzt. Herzog Ruprecht von der Pfalz wird von seinem Vater, Pfalzgraf Philipp der Aufrechte, von Frankreich, Böhmen und Baden unterstützt, so dass er über ein Heer von 30.000 Mann verfügen kann.
23. 4 1504 - König Maximilian I. verhängt über Herzog Ruprecht die „Reichsacht“
Augsburg * König Maximilian I. belehnt den Münchner Herzog Albrecht IV. mit den Ländern von Herzog Georg „dem Reichen“ und verhängt über Herzog Ruprecht von der Pfalz und seinen Anhängern die „Reichsacht“.
Herzog Albrecht IV. und sein Sohn Herzog Wilhelm IV. verfügen über ein Heer von insgesamt 60.000 Mann. Diese setzen sich zusammen aus baierischen und königlichen Truppen sowie der „Reichstadt“ Nürnberg, die alleine 5.000 Mann stellt, und andere Unterstützer wie der „Schwäbische Bund“, Herzog Ulrich von Württemberg und Markgraf Friedrich II..
21. 6 1504 - Der Landshuter Erbfolgekrieg beginnt
München - Landau an der Isar * Der Landshuter Erbfolgekrieg beginnt. Mit einem Heer, bestehend aus 12.000 Mann Fußtruppen und 2.000 Reiter, belagert Herzog Ruprecht von der Pfalz Landau an der Isar und erobert es nach Beschießung mit Bomben.
13. 7 1504 - Es kommt zur ersten größeren Schlacht zwischen Ober- und Niederbaiern
Altdorf bei Landshut * Es kommt zur ersten größeren Auseinandersetzungen zwischen den oberbaierischen Truppen von Herzog Albrecht IV. und den Truppen des Rupert von der Pfalz. Die Schlacht endet mit einem Sieg für Albrecht IV. Der mit Albrecht verbündete Götz von Berlichingen verliert dabei seine Hand.
20. 8 1504 - Herzog Ruprecht von der Pfalz stirbt an der Ruhr
Landshut * Herzog Ruprecht von der Pfalz stirbt in Landshut an der Ruhr.
18. 10 1504 - Pfälzische Truppen verwüsten die Dörfer im Isartal
München - Bogenhausen - Grünwald * Die pfälzischen Truppen belagern München im Landshuter Erbfolgekrieg ohne Erfolg. Doch alle Dörfer im Isartal, von Bogenhausen bis Grünwald werden verwüstet.
30. 7 1505 - Der Kölner Schiedsspruch beendet den Landshuter Erbfolgekrieg
Köln * Der Kölner Schiedsspruch des römisch-deutschen Königs Maximilian I. beendet den Landshuter Erbfolgekrieg.
- Die wittelsbachischen Teilherzogtümer München-Oberbaiern und Landshut-Niederbaiern werden wieder vereinigt.
- Das Landshuter Erbe wird geteilt zwischen dem Pfalzgrafen, den bairischen Herzögen und König Maximilian I..
- Das Fürstentum Pfalz-Neuburg wird gebildet.
9. 11 1505 - Ein Tändlermarkt wird wegen der Pest abgesagt
München * Ein erstmals genannter Tändlermarkt wird wegen der Pest abgesagt.
8. 7 1506 - Das Primogeniturgesetz legr die Unteilbarkeit Baierns fest
München * Herzog Albrecht IV. legt mit dem Primogeniturgesetz die Unteilbarkeit Baierns fest. Künftig soll nur mehr der erstgeborene Sohn im Baiernland herrschen. Für die nachgeborenen Söhne müssen sich die herzoglichen Familienväter anderswo Einnahmen und Finanzquellen eröffnen.
1. 9 1506 - Es grassiert wieder die Pest
München * Es ist wieder ein Pestjahr. Der Schulmeister der städtischen Poeten- oder hohen Schule wird entlassen, weil wegen der Pest die Schüler nicht mehr zur Schule kommen.
1. 11 1506 - Zusätzliche Totenträger wegen der grassierenden Pest
München * Wegen der herrschenden Pest muss die Stadt zunächst für drei Wochen zusätzliche Totenträger einstellen.
12 1506 - Wegen der Pest residiert Herzog Albrecht IV. in Landshut
München - Landshut * Wegen der in München grassierenden Pestepidemie residiert Herzog Albrecht IV. in Landshut.
31. 12 1506 - Keine Steuern wegen der Pest
München * Vermutlich wegen der Pest werden in diesem Jahr keine Steuern erhoben.
16. 5 1507 - Verhaftungen nach dem Sturm aufs Frauenhaus
München-Angerviertel * Erzürnten Gesellen gelingt erneut die Erstürmung des Frauenhauses, wofür sie zur Strafe in der Schergenstube eingesperrt werden.
9 1507 - Ein Handwerkerehepaar kauft das „Sternhaus“
München-Kreuzviertel * Ein Handwerkerehepaar kauft das „Sternhaus“, worauf es nicht mehr in den „Steuerbüchern“ auftaucht.
4. 2 1508 - Maximilian I. wird im Dom zu Trient zum Kaiser gekrönt
Trient * König Maximilian I. wird im Dom zu Trient zum Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ gekrönt.
Um 3 1508 - Erneuter Angriff auf das „Frauenhaus“
München-Graggenau * In der „Schergenstube“ sitzen erneut mindestens zehn Personen wegen eines Angriffs auf das „Frauenhaus“ ein.
18. 3 1508 - Herzog Albrecht IV. stirbt
<p><strong><em>München</em></strong> * Herzog Albrecht IV. stirbt. Sein minderjähriger Sohn Wilhelm IV. wird Herzog von Baiern unter der Vormundschaft seines Onkels Wolfgang. </p>
1509 - Die Reichenhaller Salzsiedestellen gehören Herzog Wilhelm IV.
Reichenhall - München * Die Reichenhaller Salzsiedestellen gehen in den Besitz Herzog Wilhelm IV. über.
Damit verfügt er über das einträgliche Monopol für die Salzgewinnung.
Um ??? 1510 - Der Nürnberger Peter Henlein erfindet die Taschenuhr
Nürnberg * Der Nürnberger Peter Henlein erfindet die Taschenuhr.
Inzwischen wird die Erfindung als eine Fälschung aus dem späten 19. Jahrhundert bezeichnet.
Wahrscheinlich 1511 - Herzog Wilhelm IV. lässt das spätere „Schloss Neudeck“ erbauen
Au * Herzog Wilhelm IV. lässt in der Au ein Jagdschoss erbauen, das spätere „Schloss Neudeck“.
1511 - Münchens ältestes „Brunnhaus“ wird gebaut
Au * Münchens ältestes „Brunnhaus“, das „Wasserhaus am Isarberg“, wird gebaut und in der Folgezeit mehrmals umgebaut und auf den technisch neuesten Stand gebracht.
Die aus dem Isarhochufer austretenden Quellen werden gefasst und danach in Bleirohren dem „Brunnhaus“ zugeführt. Mit einem „Wasserhebewerk“ aus Holz wird dann das Quellwasser in einen kupfernen Kessel im obersten Stockwerk des „Wasserturms“ gedrückt.
Vom Kessel wird das Wasser mit Druck „in hölzerne Deichen über die Isar in die Stadt geleitet, und durch unzählige äste vertheilt. Es läßt sich leicht denken, daß bey diesem großen Wasserreichtume, in den vielen Privatgärten an herrlichen Springwässern, kein Mangel sey“.
14. 10 1514 - Wilhelm IV. und Ludwig X. wollen gemeinsam regieren
Rattenberg * Die herzoglichen Brüder Wilhelm IV. und Ludwig X. vereinbaren im Rattenberger Vertrag, dass sie das Herzogtum Baiern künftig gemeinsam regieren wollen - bei getrennter Verwaltung.
Ab 1515 - Der Müller Kunz Hochstetter ist Besitzer der „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Der Müller Kunz Hochstetter ist Besitzer der „Giesinger Mühle“.
1515 - Keine Hinweise auf das Herrschen einer Pest in München
München * Weder das „Ratsprotokoll“ noch die „Kammerrechnung“ erhalten Hinweise auf das Herrschen einer Pest in München.
Um 1515 - Ein italienischer Ziergarten mit einem zentralen Gartentempel wird angelegt
München-Graggenau * In der Regierungszeit Herzog Wilhelms IV. wird bei der „Residenz“ ein italienischer Ziergarten mit einem zentralen Gartentempel angelegt.
Er ersetzt den alten „Burggarten“.
24. 4 1516 - Die Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. verkünden das Reinheitsgebot
Ingolstadt * Die Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. verkünden auf dem Landtag in Ingolstadt eine Landes- und Polizeiordnung. Die Landesfreiheitserklärung bestimmt bis zur Aufhebung der Landständischen Korporation im Jahr 1808 das Verhältnis zwischen der Landschaft und dem Landesherrn.
Das „Buch der gemeinen Landpot, Landesordnung, Satzung und Gebräuch des Fürstentums Ober- und Niederbaiern“ enthält auch die Vorgabe „Wie das Bier im Sommer und Winter auf dem Land ausgeschenkt und gebraut werden soll“. Dieser Passus wird erst im 20. Jahrhundert als Bayerisches Reinheitsgebot bezeichnet werden.
Er hat folgenden - ins Neuhochdeutsche übersetzten - Wortlaut:
- „Wir verordnen, setzen und wollen mit dem Rat unserer Landschaft, dass forthin überall im Fürstentum Bayern sowohl auf dem Lande wie auch in unseren Städten und Märkten, die kein besondere Ordnung dafür haben, von Michaeli bis Georgi ein Maß oder ein Kopf Bier für nicht mehr als einen Pfennig Münchener Währung und von Georgi bis Michaeli die Maß für nicht mehr als zwei Pfennig derselben Währung, der Kopf für nicht mehr als drei Heller bei Androhung unten angeführter Strafe gegeben und ausgeschenkt werden soll.
- Wo aber einer nicht Märzen-, sondern anderes Bier brauen oder sonstwie haben würde, soll er es keineswegs höher als um einen Pfennig die Maß ausschenken und verkaufen.
- Ganz besonders wollen wir, daß forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.
- Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Faß Bier, so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden.
- Wo jedoch ein Gauwirt von einem Bierbräu in unseren Städten, Märkten oder auf dem Lande einen, zwei oder drei Eimer Bier kauft und wieder ausschenkt an das gemeine Bauernvolk, soll ihm allein und sonst niemandem erlaubt und unverboten sein, die Maß oder den Kopf Bier um einen Heller teurer als oben vorgeschrieben ist, zu geben und auszuschenken.“
Nach dem 11. 5 1516 - Eine Prostituierte aus dem „Frauenhaus“ [= „Stadtbordell“] stirbt
München-Angerviertel * Eine Prostituierte aus dem „Frauenhaus“ [= „Stadtbordell“] stirbt.
Sie wird aus der Stadt gebracht und vom „Züchtiger“ auf freiem Feld begraben.
1517 - Dieses Jahr ist nachweislich kein Pestjahr !
München * Weder die vorhandenen „Ratsprotokolle“ noch die „Kammerrechnungen“ enthalten den geringsten Hinweis auf das Herrschen einer Pest in München.
Auf dieses „Pestjahr" geht - angeblich - der im „Glockenspiel des Neuen Rathauses“ dargestellte „Schäfflertanz“ und der „Metzgersprung“ zurück.
Der „Schäfflertanz“ entwickelt sich auch erst im 18. Jahrhundert.
1517 - Der „Rote Turm“ zur Verteidigung der „Isarbrücke“ wird erbaut
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Zwischen 1517 und 1519 wird der „Rote Turm“ zur Verteidigung der „Isarbrücke“ erbaut.
1517 - Schlussstrich unter den sogenannten „Bäcker-Brauer-Streit“
München * Herzog Wilhelm IV. zieht einen Schlussstrich unter den sogenannten „Bäcker-Brauer-Streit“ um die „Hefezubereitung“.
31. 10 1517 - Martin Luthers Kampf gegen die Prostituierten
Wittenberg - München * Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg. Umgehend setzt eine Diskussion über den künftigen Umgang mit den Prostituierten und ihren Einrichtungen ein.
Das erste städtische Frauenhaus wird noch in diesem Jahr geschlossen. Der Prozess zieht sich aber bis zum Jahr 1595 hin, dauert also weit über siebzig Jahre. Er beginnt in den evangelisch beeinflussten Ortschaften und in den Reichsstädten.
In den katholischen Gebieten setzt der Prozess später ein und dauert entsprechend länger. Das Münchner Frauenhaus ist eines der letzten, wenn nicht sogar das Letzte, das geschlossen wird.
1518 - Die Grundlage für eine einheitliche „Gerichtsverfassung“ geschaffen
München * Mit der „Landes- und Polizeiordnung“ von 1518 und der „Gerichtsordnung“ von 1520 wird die Grundlage für eine einheitliche „Gerichtsverfassung“ und ein einheitliches „Gerichtsverfahren“ geschaffen.
12. 1 1519 - Kaiser Maximilian I. stirbt auf der Burg in Wels
Wels * Kaiser Maximilian I. stirbt gegen 3 Uhr früh auf der Burg in Wels im Alter von 60 Jahren. Zur Buße hat er verfügt, dass seine Leiche gegeißelt, seine Haare geschoren und seine Zähne eingeschlagen werden. Dennoch seien seine Pferde in Tränen ausgebrochen und hätten in tiefer Trauer tagelang nichts gefressen.
28. 6 1519 - Carl V. wird zum römisch-deutschen König gewählt
Frankfurt am Main * Carl V. wird in Abwesenheit in Frankfurt am Main einstimmig zum römisch-deutschen König gewählt.
um 1520 - Verbesserte Produktionsweise für obergäriges Bier
Böhmen * Aus Böhmen kommt die Kenntnis einer verbesserten Produktionsweise für obergäriges Bier nach Baiern.
1520 - Martin Luther zum Thema „Frauenhäuser“
Deutschland * Martin Luther, der Verfechter der neuen Lehre, schreibt in seinem Pamphlet „An den christlichen Adel deutscher Nation“ zum Thema „Frauenhäuser“ folgendes:
„Zuletzt, ist das nicht ein jämmerlich Ding, dass wir Christen unter uns sollen halten freie, gemeine Frauenhäuser; so wir alle sind zu Keuschheit getauft?
Ich weiß wohl, was etliche dazu sagen [...], besser ein solches, denn etliche und Jungfrauen-Personen oder noch ehrlichere zu Schanden machen.
Sollten aber hier nicht bedenken weltlich und christlich Regiment, wie man demselben nicht mit solch heidnischen Weise möchte zuvorkommen“.
1520 - Das „Haidhauser Kreuz“
Haidhausen * Das „Haidhauser Kreuz“ in der alten „Sankt-Johann-Baptist-Kirche“ ist gegenüber der Kanzel angebracht.
Es steht den Werken von Hans Leinberger nahe.
20. 9 1520 - Keine Steuererhebung wegen der grassierenden Pest
München * Wegen der grassierenden Pest wird die Erhebung der Steuern vorläufig ausgesetzt.
23. 10 1520 - König Carl V. wirdzum Kaiser gekrönt
Aachen * Der römisch-deutsche König Carl V. wird im Aachener Dom durch den Kölner Erzbischof Hermann V. von Wied zum „erwählten römischen Kaiser“ gekrönt.
26. 10 1520 - Carl V. wird zum Kaiser erhoben
Rom-Vatikan * Papst Leo X. willigt ein, dass Carl V. den Titel „erwählter römischer Kaiser“ führen kann.
Ab 1 1521 - 400 Pesttote in München
München * Die Herzöge residieren 24 Wochen lang in Grünwald und Menzing [„Blutenburg“], die herzoglichen Räte in Dachau.
Angeblich sterben bei dieser Pest alleine in München 400 Menschen.
3. 1 1521 - Martin Luther wird exkommuniziert
Rom-Vatikan * Martin Luther wird durch die päpstliche Bannbulle „Decet Romanum Pontificem“ exkommuniziert.
17. 4 1521 - Martin Luther wird auf dem Reichstag zu Worms „angehört“
Worms * Martin Luther wird auf dem Reichstag zu Worms am 17. und 18. April 1521 „angehört“. Er lehnt jeden Widerruf ab, solange er nicht aus der „Schrift“ oder aus Vernunftgründen widerlegt würde.
8. 5 1521 - Über Martin Luther wird die Reichsacht verhängt
<p><em><strong>Worms </strong></em>* Als Folge der päpstlichen Bannbulle vom 3. Januar 1521 wird in Worms von Kaiser Carl V. das Edikt gegen Martin Luther erlassen.</p> <ul> <li>Über Luther wird die Reichsacht verhängt und außerdem</li> <li>das Lesen und die Verbreitung seiner Schriften verboten. </li> <li>Luther kann von jedermann, der seiner habhaft wird, an Rom ausgeliefert werden. </li> <li>Seine Beherbergung ist bei Strafe verboten. </li> </ul>
23. 8 1521 - Jakob Fugger unterzeichnet die Stiftungsurkunde für die Fuggerei
Augsburg • Jakob Fugger der Reiche unterzeichnet - auch im Namen seiner verstorbenen Brüder Georg und Ulrich - die Stiftungsurkunde für eine Reihenhaussiedlung für bedürftige Augsburger, die Fuggerei.
1 1522 - Der Augustinereremit Leonhard Beier wird in den Falkenturm gesperrt
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * Der Augustinereremit Leonhard Beier, ein Münchner Bürgersohn, wird für drei Jahre in den Falkenturm gesperrt, nachdem er die <em>„Wittenberger Artikel“</em> in das Münchner Kloster bringt. Sie stellen unter anderem jedem Mönch frei, das Kloster zu verlassen. </p>
5. 3 1522 - Lesen und Verbreitung lutherischer Schriften wird unter Strafe gestellt
München * Im Religionsmandat beziehen die gemeinsam regierenden Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. Stellung gegen Martin Luther und die neue Lehre. Das Lesen und die Verbreitung lutherischer Schriften wird unter Strafe gestellt.
1523 - Am „Marktbrunnen“ wird eine Glocke angebracht
München-Graggenau * Am „Marktbrunnen“ wird eine Glocke angebracht.
Mit ihr wird die „Marktzeit“ ein- und ausgeläutet.
1523 - Der Streit um die Heiligsprechung des Bischofs Benno von Meißen
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Die Heiligsprechung Bischof Bennos von Meißen löst einen konfessionellen Streit aus.</p> <p>Martin Luther verfasst eine Schrift mit dem Titel: <em>„Wider dem neuwen Abgott und alltem Teuffel der zu Meyssen soll erhoben werden“</em>.</p>
31. 5 1523 - Papst Hadrian VI. spricht den Bischof Benno von Meißen heilig
<p><em><strong>Rom</strong></em> * Papst Hadrian VI. spricht auf Betreiben von Herzog Georg dem Bärtigen von Sachsen den Bischof Benno von Meißen, den späteren Münchner Stadtpatron, heilig.</p> <p>Die Heiligsprechung des Bischofs von Meißen löst einen konfessionellen Streit aus. Martin Luther reagiert mit einer Streitschrift unter dem Titel: <em>„Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden.“</em></p> <p> </p>
7 1523 - Ein Bäckerknecht wird wegen seines lutherischen Glaubens enthauptet
München * Ein namentlich nicht bekannter Bäckerknecht wird wegen seines lutherischen Glaubens mit dem Schwert enthauptet.
Es ist dies die erste in München verhängte Todesstrafe wegen des neuen Glaubens.
24. 6 1524 - Der Theatiner-Orden wird gegründet
Rom • Papst Clemens VII. bestätigt die Gründung des Theatiner-Ordens. Er war als Regularkleriker-Orden zur religiösen Erneuerung des Klerus gegründet worden. Die Klostergemeinschaft wird auf Initiative von Gian Pietro Caraffa, dem späteren Papst Paul IV., und von Kajetan von Thiene ins Leben gerufen.
Bis 1525 - Die „Frauenkirche“ erhält die „welschen Hauben“
München-Kreuzviertel * Die „welschen Hauben“ werden auf die Türme der „Frauenkirche“ gesetzt.
Etwa 1525 - Der „Marktbrunnen“ trägt die Bezeichnung „Fischbrunnen“
München-Graggenau * Der „Marktbrunnen“ trägt die Bezeichnung „Fischbrunnen“, weil bei ihm der „Fischmarkt“ stattfindet.
1526 - Die Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. erlassen eine „Ordnung der Klaider“
<p><strong><em>München - Landshut</em> *</strong> Von den Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig X. wird im wiedervereinigten Baiern erneut eine <em>„Ordnung der Klaider“ </em>mit dem Untertitel <em>„Von Überflißigkeit der Klaider“</em> erlassen.</p> <p>Diese mit den Landständen abgestimmte Bekleidungsvorschrift ist sehr umfangreich und ausführlich. Sie teilt die baierische Bevölkerung in 17 Gruppen ein, was jedoch keine rangmäßige Einstufung bedeutet.</p> <ul> <li>So bilden die Frauen und Töchter des Adels, der Patrizier-Geschlechter, der Kaufleute und reichen Bürger sowie der Handwerksmeister jeweils eine eigene Gruppe.</li> <li>Die dem <em>„Hofgesindt“</em> zugerechneten oberen Beamten wie die fürstlichen Räte und die nicht-adeligen Sekretäre sind mit den Patrizier-Bürgergeschlechtern gleichgestellt.</li> <li>Der ebenfalls zum „Hofgesindt“ gehörende höhere Beamtenstand, wozu die fürstlichen Pfleger, Richter, Kastner, Mautner, Zöllner, Ungelter, Forstmeister, oberste Jäger, Futterschreiber, Küchenschreiber und Mundköche gehören, sind kleidungstechnisch im selben Rang wie die Kaufleute und die reichen Bürger.</li> <li>Der gemeine Bürger ist dem Handwerksgesellen und</li> <li>der Tagelöhner dem Bauern gleichgestellt.</li> </ul> <p>Das ergibt insgesamt acht Standesgruppen. </p>
8. 2 1527 - Der erste Wiedertäufer wird durch Verbrennen hingerichtet
<p><strong><em>München</em></strong> * Der erste Wiedertäufer wird in München durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Es handelt sich um den <em>„Klosterwagner von Fürstenfeld“</em> Georg Wagner aus Emmering bei Bruck.</p>
6. 5 1527 - Der Sacco di Roma beginnt
Rom * Der „Sacco di Roma“ beginnt. Die Erstürmung, Plünderung und Besetzung Roms durch deutsche Landsknechte dauert bis zum 17. Februar 1528. Die Stadt fällt den Landsknechten wie eine reife Frucht in den Schoß, weil die völlig korrupte und seit Jahrzehnten ein Lotterleben führende römische Oberschicht nicht in der Lage ist, sich gegen die enthemmt wütende Soldateska zu wehren.
Die Kirchen Roms werden zu Pferdeställen, Bordelle und öffentlichen Toiletten umgewandelt. Die Mätressen, aber auch die Nichten der Kirchenfürsten, die Frauen und Töchter der Fürsten und Herzöge sowie jede Nonne, die sie fangen, vergewaltigten sie und tun das am Liebsten unter dem Hochaltar.
Sie notzüchtigten die Damen des Adels im Beisein ihrer Ehemänner, Väter und Brüder. Sie foltern die Häupter der ältesten und reichsten römischen Feudalgeschlechter viele Wochen lang. So lange, bis sie auch die letzten Verstecke verraten, in denen sie ihre Frauen und ihr Gold versteckt haben.
6 1527 - Leonhard Dorfbrunner predigt in München als „Wiedertäufer“
München * Der aus Weißenburg im Bistum Eichstätt stammende ehemalige Priester Leonhard Dorfbrunner predigt in München als „Wiedertäufer“ und tauft vier Bürger.
31. 7 1527 - Maximilian II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Maximilian II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren.
12. 11 1527 - Ein weiterer Wiedertäufer wird enthauptet
München * Mit Jakob Wagner aus Windach bei Landsberg wird ein weiterer Wiedertäufer auf dem Münchner Richtplatz enthauptet, nachdem er widerrufen hat.
15. 11 1527 - „Baierisches Landgebot gegen die Wiedertäufer“ erlassen
München * Herzog Wilhelm IV. erlässt ein „Baierisches Landgebot gegen die Wiedertäufer“, in dem er für diesen Personenkreis die Todesstrafe anordnet.
6. 1 1528 - Münchner Wiedertäufer werden verhaftet
München * 29 Angehörige der Münchner Wiedertäufergemeinde werden verhaftet, verhört und gefoltert. Nur neun Mitglieder bleiben ihrem Glauben treu. Das bedeutet für sie das Todesurteil, das am 30./31. Januar vollstreckt werden wird.
7. 1 1528 - DreiWiedertäufer werden in München geköpft
München * Drei Wiedertäufer (Augustin und Christoph Perwamger aus Günzlhofen und Vogach sowie ein Müller aus Mittelstetten) werden in München geköpft, nachdem sie ihren Glauben widerrufen haben.
Um den 15. 1 1528 - Ein Wiedertäufer wird mit dem Schwert hingerichtet
München * Ein weiterer Wiedertäufer (Jörg Prenner aus Schmiechen bei Friedberg) wird mit dem Schwert hingerichtet.
25. 1 1528 - Der Wiedertäufer Hans Grintz wird enthauptet
München * Der Wiedertäufer Hans Grintz von Hilzingen, der als Prediger tätig ist, wird nach dem Widerruf seines Glaubens in München enthauptet.
30. 1 1528 - Sechs Münchner Wiedertäufer werden verbrannt
München * In München werden sechs Wiedertäufer, biedere Münchner Handwerker zumeist, die ihrem Glauben treu geblieben sind, „an gewöhnlicher Brandstatt“, in einer eigens gefertigten Stube, verbrannt. Es handelt sich um die Brüder Meister Michel und Meister Caspar, beide Steinmetzen, um einen Scheffle Christoph, um Dietrich Kramer, Melchior Oxenfurter und Jörg Noichinger.
31. 1 1528 - Wiedertäufer-Frauen werden erst in der Isar ertränkt und dann verbrannt
München * Drei Frauen, die der Münchner Wiedertäufergemeinde angehören und ebenfalls zum Brand verurteilt worden sind, werden zuerst in der Isar ertränkt und danach verbrannt. Es sind die Ehefrauen des Schäfflers Christoph und des Dietrich Kramer sowie eine Paungartnerin.
2. 2 1528 - Zwanzig begnadigte Wiedertäufer müssen Abbitte leisten
<p><strong><em>München</em></strong> * Von den zwanzig begnadigten Wiedertäufer werden 19 barfuß, barhäuptig, jeder mit einer brennenden Kerze und ein hölzernes Kreuz tragend vor die Peterskirche und die Frauenkirche geführt. Dort müssen sie in Begleitung von Seelschwestern stehen. Die Prozedur wiederholt sich an den beiden folgenden Sonntagen.</p>
17. 2 1528 - Die ersten begnadigten Wiedertäufer werden aus der Haft entlassen
München * Von den zwanzig begnadigten Wiedertäufern werden zehn aus der Haft entlassen. Die restlichen Zehn werden Ende Februar, im März, im Mai und einer erst im August entlassen.
24. 4 1528 - Ein Wiedertäufer wird mit dem Schwert hingerichtet
München * Ein Wiedertäufer namens Buntzer wird in München mit dem Schwert hingerichtet.
27. 4 1528 - Herzog Wilhelm IV. erlässt ein weiteres „Mandat gegen die Wiedertäufer“
München * Herzog Wilhelm IV. erlässt ein weiteres „Mandat gegen die Wiedertäufer“.
1530 - Der Rat der Stadt ändert die bestehende „Bettelordnung“
München * Der Rat der Stadt ändert die schon länger bestehende „Bettelordnung“.
Sie verbietet allen „Bürgern und Gästen beiderlei Geschlechts“ das „Betteln“ und gestattet es nur denjenigen, die vom „Rat“ die ausdrückliche Erlaubnis dazu haben.
Diese drückt sich eben im Tragen des „Bettelzeichens“ aus.
Zur Erteilung der „Bettelerlaubnis“ muss aber zuvor die „Bedürftigkeit“ nachgewiesen werden.
- Dazu gehört neben der Darlegung des Personenstandes, der Kinderzahl und der Vermögensverhältnisse,
- die Bestätigung des „Beichtvaters“, dass der Antragsteller im vergangenen Jahr mindestens einmal gebeichtet und die „Absolution“ erhalten hat.
Der „Hausbettel“ ist nach der „Bettelordnung“ strengstens verboten.
Hauptsächlich vor den Kirchentüren, nicht aber im Kircheninneren ist das „Betteln“ erlaubt.
- Missgestaltete, behinderte Bettler müssen ihre „Gebersten“ bedecken, damit „schwangere Frauen“ durch den Anblick „nicht Schaden nehmen“.
- Es dürfen auch keine „gemalten Bilder, wunderliche Tiere und sonstige Schaustücke“ gezeigt werden.
- Lediglich Singen ist ihnen gestattet.
- Den Schülern ist das „Betteln“ nur dann zu genehmigen, wenn sie in der Schule „fleißig und gehorsam“ waren und für bettelnde „Wöchnerinnen“ werden gesonderte Zeichen bereitgehalten.
Es werden vier „Bettelmeister“ bestellt.
- Deren Hauptaufgabe ist die „gerechte Auswahl“ der „berufsmäßigen Bettler“.
- Halbjährlich müssen sie die Inhaber der „Bettelzeichen“ - gemeinsam mit ihren Kindern - an einem Ort zusammenkommen lassen und prüfen, ob ihre Bedürftigkeit auch weiterhin besteht.
- Für die Einhaltung der „Bettelordnung“ sind die „Bettelknechte“ verantwortlich.
Sie müssen vor ihrem Amtsantritt „geloben und schwören“, dass sie niemanden bevorzugen oder benachteiligen und dass sie sich nicht bestechen lassen.
1530 - Die „Reichspolizeiordnung“ verbietet jeden „Beischlaf außerhalb der Ehe“
München * Die „Reichspolizeiordnung“ verbietet jeden „Beischlaf außerhalb der Ehe“.
Anno 1530 - Eine Ordnung gegen die „Winkelhurerey“ außerhalb des „Frauenhauses“
München * Der Rat der Stadt erlässt eine „Ordnung wider die Laster“, die sich vor allem gegen die „Winkelhurerey“ außerhalb des „Frauenhauses“ wendet.
In dem Dekret heißt es:
„Glaubhaften Berichten zufolge trieben etliche unverschämte Weibspersonen öffentlich innerhalb und außerhalb der Stadt, unter den Kramen am Marktplatz, in Ställen, in der Au etc., bei Tag und bei Nacht Unzucht“.
1530 - Die Familie Rampoger besitzt die „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Die Familie Rampoger besitzt die „Giesinger Mühle“.
24. 2 1530 - Kaiser Carl V.: „Die lutherische Ketzerei in Deutschland ausrotten“
Rom-Vatikan * Kaiser Carl V. gibt Papst Clemens VII. das Versprechen, „die lutherische Ketzerei in Deutschland mit Stumpf und Stil auszurotten“.
10. 6 1530 - Großer Empfang für Kaiser Carl V.
München * Kaiser Carl V. hält sich vom 10. bis zum 14. Juni in München auf. Der Besuch des Kaisers ist natürlich der gesellschaftliche Höhepunkt der Residenzstadt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Als sich am Freitag vor Pfingsten der ranghöchste deutsche Adelige in Begleitung seines Bruders, König Ferdinand von Böhmen, mehreren Herzögen, Mark- und Pfalzgrafen sowie geistlichen Würdenträgern, den Mauern der Stadt nähert, veranstalten die Münchner ein Riesenspektakel mit einer unglaublichen Prachtentfaltung.
10. 6 1530 - Ein Manöverspiel für die kaiserliche Gefolgschaft
Ramersdorf - Haidhausen - München * Die kaiserliche Gefolgschaft wird kurz hinter Ramersdorf, auf einer Lüften genannten Schafweide, von einer festlich herausgeputzten Ritterschar begrüßt, die den Rahmen für ein Manöverspiel bilden.
Wie der Historiker Sigmund Riezler in seiner Baierischen Geschichte berichtet, ist hier „mit den herzoglichen Heerpaukern und Trompetern die Reiterei der Landsassen und Hofbeamten aufgestellt, 550 Pferde stark, darunter etwa 300 in vollständiger Rüstung, Blankharnisch, Armzeug, Knieköpfen, die Rosse mit Eisenstrinen, alle in roten Röcken mit dem herzoglichen Wappen auf dem Ärmel, eine buntschimmernde Masse, überragt von langen, schwarz und weiß bemalten Spießen mit schwarzen Fransen. An den Anführern bewundert man damastene Röcke, goldene Ketten und vergoldete Waffen“.
Jeder Reiter hat hinter sich einen Pagen, der ihm die Lanze und den Helm mit wallenden Federn trägt. Ein alter Kriegsmann, der Ritter Dietrich von Knöringen, befehligt diese glänzende „cavalli alla borgognona“.
Um den Empfangsplatz bilden einhundert Feldgeschütze - Quartanen, Schlangen, Falkonetlein und Mörser - einen Halbkreis, wobei die Zuschauer ganz besonders eine achtzehn Fuß lange, hölzerne, mit Eisenringen umwickelte Büchse interessiert. Diese haben baierische Truppen im Jahr 1525 vor Rastatt den aufständischen Bauern abgenommen.
10. 6 1530 - Ein gewaltiges Feuerwerk auf dem Schrannenplatz
München-Graggenau * Am Abend brennen die Münchner Gastgeber auf dem Schrannenplatz noch ein gewaltiges Feuerwerk ab, wobei man am Schluss ein aus Pappe und Stoff zusammengezimmertes, schlossähnliches Bauwerk den Flammen übereignet.
10. 6 1530 - Ein Manöver mit vielen Toten und Verletzten
München - Haidhausen * Der eigentliche Höhepunkt soll aber erst rund achthundert Meter weiter kommen, etwa an der Stelle des heutigen Rosenheimer Platzes. Dort ist innerhalb von wenigen Tagen - fast nach Hollywood-Manier - eine wehrhaft aussehende Burg mit vier Türmen und Bastionen aus Holz, Leinwand und Farbe errichtet worden. Alles wirkt sehr realistisch.
In der Festung warten einhundert schwerbewaffnete Männer, bis die Gäste auf der Ehrentribüne Platz genommen haben. Auf ein Zeichen Herzog Wilhelms IV. rücken die von Ramersdorf kommenden Angreifer heran und es kommt unausweichlich zur Schlacht, bei der sechzehnhundert Mann unter ohrenbetäubendem Kriegsgeschrei das Schloss stürmen.
Nachdem einige an die Mauern gelehnte Sturmleitern von den Verteidigern der Burg umgestoßen worden sind und sich dabei die Angreifer und das nachdrängende Fußvolk etliche Blessuren zugezogen haben, „überkam beide Seiten eine große, unbändige Wut“, schreibt unser Zeitzeuge. Und da es sich sowohl bei der Burgbesatzung als auch bei den Angreifern um „temperamentvolle, rauflustige und keine Schmähung duldende Altbaiern” handelt, wird aus dem zur Ergötzung des Kaisers veranstaltetem Scheingefecht sehr schnell blutigster Ernst.
Die Manöver-Gegner dreschen derart rabiat aufeinander ein, dass am Ende acht Tote und eine unbekannte Zahl von Männern verletzt liegen bleibt. Das wird von den Ehrengästen auf ihren Tribünen natürlich nicht bemerkt. Immerhin erhalten die Getöteten ein Begräbnis auf dem Salvatorfriedhof und deren Witwen und Waisen ein jährliches Gnadengeschenk aus der landesherrlichen Privatschatulle.
Auf dem Manöverfeld schießen die Angreifer die Burg später schließlich noch in Trümmer und Fetzen. Der Chronist vermerkt: „Mit ungeheuerem Krachen entluden sich alle Geschütze auf einmal.” Immerhin zeigt sich Kaiser Carl V. von dem Manöver und der dabei gezeigten baierischen Kampfkraft mächtig beeindruckt.
10. 6 1530 - Begrüßung mit Prachtentfaltung und lebenden Bildern
München - Haidhausen * Nach der Schlacht bei Haidhausen setzt sich der Zug wieder in Richtung München in Bewegung. Als die hochgestellten Persönlichkeiten von der Stadt aus sichtbar werden,
- beginnen alle Glocken Münchens zu läuten,
- von den Türmen und Stadtmauern begrüßen Freudenschüsse die Gäste,
- von der Isarbrücke aus gibt es ein Fischerstechen zu sehen und
- über dem Isartor schwebt ein Ballon in Gestalt eines fliegenden Drachens.
- Hoch in der Luft, noch über dem Ballon, werden weißblaue Fahnen mit dem baierischen Wappen sichtbar, die ein Taubenschwarm trägt.
Auf dem weiteren Weg können von den hochrangigen Gästen dann noch die damals so beliebten lebenden Bilder besichtigt werden. Sie stoßen auf um so größeres Interesse, je blutiger es dabei zugeht. Und die Münchner sollen an diesem Pfingstfreitag voll auf ihre Kosten kommen.
- Auf einer Bühne bei der Hochbrücke im Tal sehen die Besucher die Geschichte der Königin Esther, die als Gemahlin des persischen Königs Xerxes ihren jüdischen Glaubensbrüdern zu blutiger Rache verhilft.
- Das zweite Bild zeigt die Skythenkönigin Tomiris, wie sie das abgeschlagene Haupt des Cyrus in einen Eimer voll Blut stößt. „Der Schauplatz bei den städtischen Fleischbänken war dafür nicht übel gewählt“, schreibt Sigmund Riezler lapidar dazu.
- Auf der dritten Bühne - an der Burgstraße - lässt der Perserherrscher Kambyses einen ungerechten Richter schinden und mit dessen Haut einen Sessel polstern, auf den sich der Sohn des Bösewichts setzen muss, um als Nachfolger seines Vaters später einmal gerecht zu urteilen.
- Andere Bilder zeigen das Herausreißen des Herzens aus einer geöffneten Brust durch einen Wilden und ähnliche Grässlichkeiten, die aber durchwegs mit Wohlgefallen und Zustimmung aufgenommen werden.
Nur der Kaiser zeigt sich - nach Aussage eines Augenzeugen - „ein wenig befremdet ob des vielen Blutes”.
Dem päpstlichen Legaten Campeggi „schien es gut zu sein, Seiner Majestät zu sagen, dass die Szenen nicht ohne geheime Anspielung gemacht seien, und dass man sie auf die Ketzer beziehen könne, gegen welche man, wenn sie den von Seiner Majestät gebotenen Gottesfrieden nicht annehmen wollen, die eisernen Ruten brauchen werde“.
11. 6 1530 - Das Programm für Kaiser Carl V. geht weiter
München - Perlach * Das Programm für Kaiser Carl V. geht weiter. Die Gäste und die Gastgeber pflegen das Waidwerk und begeben sich zur Hirschjagd auf die Perlacher Haid. Mehr als einhundert Hirsche finden bei dieser eingestellten Jagd den Tod. Der päpstliche Legat Campeggi würdigt das Abschlachten von zuvor eingefangenen Tieren später als „schönste Hirschjagd der Welt“.
Nach dem 11. 6 1530 - Die zweitälteste Stadtansicht von München
München * Die zweitälteste Stadtansicht von München wird von Hans Beham in Holz geschnitten. Im Vordergrund ist der Einzug Kaiser Carl V. mit seinem Heer dargestellt.
11. 6 1530 - Ein 70.000 Gulden teuerer Prunk und Glanz für den Kaiser
München-Graggenau * Danach gibt es im Lusthaus im Hofgarten ein Menü. „Um ein Uhr nachts“, nach dem 32. Gang, gibt der Kaiser das Zeichen zum Aufbrechen. Man verlässt den Hofgarten, um anschließend am Tanz im Rathaus teilzunehmen, wo „die schönsten Frauen des Landes bis gegen vier Uhr früh morgens im Reigen sich schwangen“.
Der 70.000 Gulden teuere Prunk und Glanz soll beim Habsburger Kaiser den Eindruck entstehen lassen, dass bei den Wittelsbachern kein Mangel besteht. Das dazu notwendige Geld hat der Baiernherzog Wilhelm IV. ein Jahr zuvor dem Volk als Türkenkriegssteuer abgepresst.
14. 6 1530 - Kaiser Carl V. verlässt München in Richtung Augsburg
München - Augsburg * Kaiser Carl V. und sein Gefolge verlassen München in Richtung Augsburg, wohin er einen Reichstag einberufen hat. Dort sollen die Religionsparteien geeinigt werden, doch der Kaiser will „die lutherische Ketzerei in Deutschland mit Stumpf und Stil ausrotten“. Denn genau dieses Versprechen hat er am 24. Februar 1530 Papst Clemens VII. ja gegeben.
14. 9 1531 - Philipp Apian wird in Ingolstadt geboren
Ingolstadt * Philipp Apian wird als Philipp Bienewitz [oder Bennewitz] in Ingolstadt geboren.
1532 - Die „peinliche Halsgerichtsordnung” setzt auf „Zauberei“ den „Feuertod“
Regensburg * Die von Kaiser Carl V. erlassene „peinliche Halsgerichtsordnung” - „Constitutio Criminalis Carolina“ - setzt auf „Zauberei“, die den Menschen Schaden zufügt, den „Feuertod“.
23. 7 1532 - Kaiser Carl V. schließt den Nürnberger Religionsfrieden
Nürnberg * Kaiser Carl V. schließt mit den evangelischen Reichsständen den Nürnberger Religionsfrieden. Gegen Bezahlung einer Türkenhilfe dürfen sie ihre Religion vorläufig frei ausüben.
1533 - Der Geschichtsschreiber „Aventinus“ charakterisiert das baierische Volk
München * Der baierische Geschichtsschreiber Johannes Thurmair, genannt „Aventinus“, charakterisiert das baierische Volk in seiner „Chronik“ folgendermaßen:
„Das Bayrisch volck (gemainlich davon zu reden) ist geystlich schlecht [schlicht] und gerecht, get, läuft gern kyrchferten, hat auch viel kyrchfart; legt sich mer auf den ackerpau und das viech, dan auf dy krieg [...] bleibt gern dahaim, rayst nit vast auß in frembde land; trinckt seer, macht vil kinder [...].
Der gemain man, so auf dem gä [Gäu] und land sitzt, gibt sich auf den ackerpau vnd das viech, ligt demselbigen allain ob, darf sich nichts, on geschafft [Befehl] der öbrikait understeen, wirdt auch in kaynen rat genomen oder landschaft erfordert. Doch ist er sunst frey, mag auch frey ledig aigen gyeter [Güter] haben, dient seynem herren, der sunst kain gewalt yber yn hatt, Järliche gü1t, zins und scharwerck.
Thut sunst was er will, sitzt tag und nacht bey dem weyn, schreyt singt tanzt karrt [spielt Karten] spielt [spielt Würfel]; mag wer [Waffen] tragen, schweinspies, und lange messer“.
Im Jahr 1533 - Mehrere „Lustmädchen“ werden gezüchtigt und aus der Stadt getrieben
München * Man lässt mehrere „liederliche, öffentliche Unzucht treibende Weibspersonen“ an den „Pranger“ stellen, züchtigen und anschließend aus der Stadt treiben.
Fallen diese nichtregistrierten „Lustmädchen“ in die Hände des „Frauenwirts“, so kann er sie ohne weiteres in das „Gemeine Haus“ überführen und dort solange behalten, „bis sie ihr Leben von Sünde und Schande zur Bußfertigkeit kehrten“.
1533 - Johann Turmair, genannt „Aventinus“, beschreibt die Gründung Münchens
München * Der „baierische Historiker“ Johann Turmair, genannt „Aventinus“, schreibt folgende Zeilen über die Gründung Münchens:
„Herzog Hainrich, der zwelft herzog in Bairn, hat die stat München gepaut auf des closters von Scheftlarn grunde, darumb man die stat München hat genent und füret ein münich für ir wappen.
Damals war der salzhandl niderlag zu Vering underhalb München, gieng die straß von Reichenhal und Wasserburg durch, gehört dem stift Freising zue.
Herzog Hainrich verprent Vering die stat, prach die pruck über die Iser ab, legt maut und zol, die straß und allen handl in sein stat München“.
Diese „Raubrittergeschichte“ hat sich seitdem unauslöschlich in die Gehirne bayerischer Schulkinder und Erwachsener eingebrannt.
Mit dieser Schilderung geht „Aventinus“ jedoch mit viel Phantasie weit über die knappen Angaben des „Regensburger Urteils“ vom 13. Juli 1180 hinaus.
Denn darin finden sich zu diesem Sachverhalt nur die folgenden Zeilen:
„[...], dass der Edelmann Heinrich von Braunschweig, [...] den Markt mit der Brücke in Föhring, den seine Kirche seit uralten Zeiten ungestört in Besitz gehabt hatte, zerstört und ihn gewaltsam in den Ort Munichen verlegt habe“.
Von der Brandschatzung des gesamten Ortes Föhring steht im „Regensburger Urteil“ ebenso wenig, wie sie Auskunft gibt, wie stark der Markt und die Brücke zerstört wurden.
Außerdem ist Johann Turmair der „Augsburger Schied“ vom 14. Juni 1158 nicht bekannt, da diese für die „Münchner Stadtgründung“ so elementar wichtige Urkunde erstmals im Jahr 1582 veröffentlicht werden wird.
Also nimmt der Historiker die ihm zugänglichen Informationen und zieht daraus seine Schlüsse.
Und tatsächlich deutet im „Regensburger Urteil“ von 1180 nichts auf die Existenz einer früheren - einvernehmlichen - Abmachung hin.
Allerdings wird der Welfenherzog als Rechts- und Friedensbrecher dargestellt.
3. 9 1533 - Gnadenersuchen für einen Rumor im Frauenhaus
München * Vor dem Münchner Rat erscheint „das gantz hantwerck“ und bittet für Hans Walts, der seit drei Tagen wegen eines „rumors“ im Frauenhaus in Arrest sitzt, um Gnade. Hans Walts wird ermahnt und freigelassen. Im Gegenzug gelobten die Gesellen, „frid gegen [den] frauenwirt und den [= die] seinen“ zu halten.
1534 - Die Gesellschaft Jesu wird gegründet
Rom * Die Gesellschaft Jesu wird von dem ehemaligen Offizier Ignatius von Loyola gegründet und wie ein Militärverband aufgebaut. Ihr Tätigkeitsfeld sehen die Jesuiten vor allem in der geistigen Erneuerung und Seelsorge. In der Folgezeit entwickelt er sich zum Kampforden der katholischen Kirche.
Der Jesuit Lamormain wird viele Jahre später behaupten: „Wenn es nicht die Schulen der Gesellschaft gegeben hätte, die nach dem weisen Ratschluss der Kaiser und Erzherzöge in Wien, Prag, Graz, Olmütz und anderenorts in Deutschland gegründet wurden, dann wäre von der katholischen Religion kaum eine Spur übrig geblieben.“
1534 - Erneute Angriffe auf das Münchner „Frauenhaus“
München-Angerviertel * Angriffe auf das Münchner „Frauenhaus“ gibt es auch im diesem Jahr.
Hier ist ein Überzeugungstäter am Werk, der seinen Mitbürgern vorleben will, wie der „Kampf gegen das Laster“ zu führen sei.
5. 5 1534 - Der vereinigte Kampf gegen die „Wiedertäufer“
München * Herzog Wilhelm IV. bittet den Pfalzgrafen Ottheinrich von Pfalz-Neuburg, „Wiedertäufer“ aufzuspüren, sie zu bestrafen und ihnen kein freies Geleit durch sein Land zu geben.
1536 - Die Münchner „Lustdirnen“ bezichtigen den „Frauenwirt“ der Gewalt
München * Die Münchner „Lustdirnen“ wenden sich an den Rat der Stadt und bezichtigen den „Frauenwirt“, eine der ihren geschlagen und gepeinigt zu haben.
1536 - Nürnbergs Rat verbietet den „Besuch von Zauberern und Wahrsagern“
Nürnberg * Der Rat der Reichsstadt Nürnberg verbietet den scheinbar weit verbreiteten „Besuch von Zauberern und Wahrsagern“.
Seit dem Jahr 1537 - Aus „den“ Lehen[gütern] wird „das“ Lehen
München-Lehel * Der Begriff „Lehen“ wandelt sich vom Sachbegriff - „die Lehen“, also einer Anzahl von Sachen - zu einem räumlichen Begriff.
Aus „den“ Lehen[gütern] wird „das“ Lehen.
1538 - Zur „Hauptmannschaft Obergiesing“ gehören rechtsisarische Orte
Obergiesing * Zur „Hauptmannschaft Obergiesing“ gehören Haidhausen, die Au, Niedergiesing, Putzbrunn, Höhenkirchen, Bogenhausen und Obergiesing.
1538 - Ein Connz Holzhauser wird als Haidhauser Hausbesitzer aufgeführt
Haidhausen * In einem „Steuerverzeichnis“ des „Landgerichts Wolfratshausen“ wird ein Connz Holzhauser als Haidhauser Hausbesitzer aufgeführt.
Ob dieser aber mit der später auftauchenden Familie Holzhauser in einem Zusammenhang steht, lässt sich wegen Fehlens weiterer Angaben nicht mit Sicherheit feststellen.
27. 9 1540 - Die Jesuiten erhalten die päpstliche Bestätigung für ihren neuen Orden
Rom-Vatikan * Die Gesellschaft Jesu, die Jesuiten, erhält die päpstliche Bestätigung für ihren neuen Orden.
1541 - Der Brauer Jörg Heiß gründet den späteren „Singlspielerbräu“
München-Angerviertel * Der Brauer Jörg Heiß gründet an der Ostseite der Sendlinger Straße den späteren „Singlspielerbräu“.
5. 4 1541 - Der „Nürnberger Religionsfrieden“ vom 23. Juli 1532 wird erneuert
<p><strong><em>Regensburg</em></strong> * Bis zum 29. Juli 1541 findet beim Reichstag in Regensburg ein <em>„Religionsgespräch“</em> statt. Nach ihrem Scheitern wird der <em>„Nürnberger Religionsfrieden“</em> vom 23. Juli 1532 erneuert. </p>
1542 - Ein „Ratsbefehl“ gegen „verdächtige Personen, Gotteslästerer und Spieler“
München * Ein „Ratsbefehl“ verpflichtet die Wirte alle „verdächtigen Personen, Aufrührer, Gotteslästerer und Spieler“ sogleich zu melden.
1542 - Die „Agnes auf dem Färbergraben“ erhält einen „Stadtverweis“
München * Die „Agnes auf dem Färbergraben“ erhält einen „Stadtverweis“.
Da sie zuerst mit dem „Kapellmeister“ Ludwig Senfl und danach mit dem „Dechant“ der Frauenkirche „in Unehren gehaust“ hat, verdächtigt man sie nun, dass sie mit ihren Liebestränken den beiden Würdenträgern „Vernunft, Gedächtnis und die Leibsgesundheit“ geraubt hätte.
In der „Schergenstube“ wird sie vom Henker „mit Daumenstock und Nagelbrand“ zum Geständnis gebracht.
1542 - Ein Kloster als Zufluchtstätte für bußwillige Kurtisanen
Rom * Auf Betreiben des Jesuiten Ignatius von Loyola wird in Rom das Kloster Santa Marta gegründet, das als „Zufluchtstätte für bußwillige Kurtisanen“ gedacht ist. Es muss wegen mangelnden Zulauf im Jahr 1573 in ein gewöhnliches Kloster umgewandelt werden.
1543 - Zum „Ungelt“ kommt eine neue „Getränkesteuer“ hinzu, der „Aufschlag“
München * Zum „Ungelt“ kommt eine neue „allgemeine Getränkesteuer“ hinzu, der „Aufschlag“.
Er wird auch auf das Bier erhoben.
1544 - Die Jesuiten gründen in Köln ihr erstes Colleg nördlich der Alpen
Köln * Die Jesuiten gründen in Köln ihr erstes Colleg nördlich der Alpen.
1544 - Baiern kennt nur die „Strafbarkeit des Schadenszaubers“
München - Herzogtum Baiern * Im Herzogtum Baiern orientiert man sich vorläufig noch an dem „Strafrechtskommentar“ des Andreas Perneder.
Diese ist für die „Strafrechtspraxis“ im Herzogtum wichtiger als die von Kaiser Carl V. im Jahr 1532 erlassene „Constitutio Criminalis Carolina“.
Der baierische Kommentar kennt nur die „Strafbarkeit des Schadenszaubers“.
Den sonstigen „Aberglauben“, insbesondere die „weiße Magie“, hält Perneder dagegen nicht für strafbar.
7. 8 1547 - Kajetan von Thiene stirbt in Neapel
Neapel • Kajetan von Thiene, der Mitbegründer des Theatinerordens, stirbt in Neapel.
3. 8 1548 - Das Privileg Weißbier zu brauen und zu verkaufen
München - Degenberg * Reichsfreiherr Hans VI. von Degenberg erhält von Herzog Wilhelm IV. das Privileg, im nordostbayerischen Raum „vor dem Behaimer Waldt ennhalb der Thunaw (Donau)“ Weißbier zu Brauen und zu verkaufen. Der Degenberger betreibt Brauhäuser in Zwiesel, Schwarzach und Linden.
13. 11 1549 - Die Jesuiten übernehmen die Universität in Ingolstadt
Ingolstadt * Auf Betreiben Herzog Wilhelms IV. kommen die Jesuiten nach Ingolstadt, um die dortige Universität im Sinne des erneuerten katholischen Glaubens zu übernehmen.
Ab dem Jahr 1550 - Kein Brauer unter den „Vertretern der Bürgerschaft“
München * Bis zum Jahr 1800 sind die „Weinschenken“ und „Handelsleute“ die eigentlichen „Vertreter der Bürgerschaft“.
In dieser Zeit findet sich in dem aus 24 Mitgliedern bestehenden „äußeren Rat“ weder ein „Handwerker, Bäcker oder Metzger“, auch kein „Brauer“.
1550 - Verbot des Gebrauchs von Kutschen für „Kurtisanen“
Rom * Das Verbot des Gebrauchs von Kutschen für „Kurtisanen“ ist ein harter Schlag für das „Kurtisanenwesen“, weil sich Kutschen als besonderer Luxus und somit als Statussymbol ersten Ranges darstellen.
Das Verbot ist das am häufigsten überschrittene Gesetz und eine reich sprudelnde Einnahmequelle des „Kirchenstaates“.
Andere Maßnahmen erschweren zwar das Leben der „Kurtisanen“, können die gehobene „Prostitution“ aber nie ernsthaft eindämmen.
Das liegt freilich auch an der wenig konsequenten Durchführung der Maßnahmen.
1551 - Die „Stadtschreiberei“ und das „Amt für Goldwäscherei“ in der Burgstraße 5
München-Graggenau * Die „Stadtschreiberei“, das „Amt für Goldwäscherei“ und ein „Weinstadel“ werden im Haus an der Dienerstraße 20/Burgstraße 5 untergebracht.
Der „Hofmaler“ Hans Mielich fertigt die Bemalung des Hauses im Stil des „Manierismus“.
1552 - Die Jesuiten gründen ein Colleg in Wien
Wien * Die Jesuiten gründen ein Colleg in Wien.
1552 - Ignatius von Loyola zieht seine Ordensbrüder aus Ingolstadt wieder ab
Ingolstadt * Da - nach dem plötzlichen Tod des Herzogs Wilhelm IV. - das versprochene Kolleg in Ingolstadt nicht errichtet wird, zieht Ignatius von Loyola seine Ordensbrüder wieder ab.
1552 - Philipp Apian erhält eine Professur an der „Universität Ingolstadt“
Ingolstadt * Der 21-jährige Philipp Apian übernimmt die Druckerei seines Vaters und erhält im selben Jahr eine Professur an der „Universität Ingolstadt“.
Er lehrt hier Mathematik und beginnt parallel dazu ein Medizinstudium.
18. 7 1552 - Rudolf II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Rudolf II., der spätere deutsch-römische Kaiser, wird in Wien geboren.
ab 1553 - Eine klimatische „Kaltphase“ schränkt den Weinanbau ein
Mitteleuropa * Bis zum Jahr 1628 führt eine klimatische „Kaltphase“ zu einer deutlichen Einschränkung des Weinanbaus in Mitteleuropa.
1553 - Bei „Bauernhochzeiten“ ist der Ausschank teuerer „Südweine“ untersagt
München * Nach einer Vorschrift dürfen zu einer Mahlzeit im Gasthaus nur zwei Sorten guten Weines ausgeschenkt werden.
Bei „Bauernhochzeiten“ ist der Ausschank teuerer „Südweine“ untersagt.
Tiroler, österreichischer, oberländischer und fränkischer Wein ist dagegen erlaubt.
1553 - Die „Brauperiode für untergäriges Bier“ wird festgelegt
München * Festlegung der „Brauperiode für untergäriges Bier“ auf die Zeit vom 29. September (Michaeli) bis 23. April (Georgi).
Sie gilt bis 1850.
1553 - Juden ist der Aufenthalt im Herzogtum Baiern verboten
München * In der „Landesordnung“ wird das Verbot für Juden, sich im Herzogtum Baiern aufzuhalten, bestätigt.
2. 3 1553 - Einbecker Bier wird nach München transportiert
Einbeck * Im Auftrag von Herzog Albrecht V. werden aus Einbeck zwei Wagen mit dem berühmten Bier der Stadt beladen und erstmals auf den Weg nach München geschickt.
An dem aus dem Braunschweigischen stammenden „Edelstoff“ stimmt - im Gegensatz zu dem ebenso wässrigen wie qualitativ sehr wechselhaften Münchner Bier - einfach alles.
Die Lieferung erfolgte auf der Strecke Einbeck - Erfurt - Nürnberg nach München.
2. 4 1553 - Das berühmte Bier aus Einbeck kommt in München an
München * Die Lieferung mit dem berühmten Bier aus Einbeck kommt in München an. Sie ist seit dem 2. März auf 600 Kilometer lange Wegstrecke. Als Spediteure fungieren Nürnberger Handelshäuser, die damit gutes Geld verdienen.
Die lange Reise des Edelstoffes aus dem protestantischen Norden
- ändert nichts an der dunklen Farbe des Bieres;
- auch der kräftige Geschmack bleibt erhalten und
- selbst die nicht geringen Alkoholprozente kommen unverändert in München an.
Doch eines hat sich während der langen Reise massiv verändert: der Preis.
Das Bier verteuert sich durch die weiteren Belastungen an „Zehrung“ für die Mannschaft und die Pferde sowie durch die Zölle und Mauten auf etwa das Dreifache.
1554 - Die Stadt lässt ein zweites „Brunnwerk“ errichten
München-Kreuzviertel * Die Stadt lässt nördlich des „Neuhauser Tores“ ein zweites „Brunnwerk“ errichten, das sogenannte „Gasteiger Brunnhaus“ am heutigen „Künstlerhaus“.
1554 - Philipp Apian soll das Herzogtum Baiern kartographisch erfassen
Ingolstadt * Herzog Albrecht V. erteilt Philipp Apian den Auftrag, das Herzogtum Baiern kartographisch zu erfassen.
Der Herzog gefällt sich als Förderer der Wissenschaft, weshalb er seinen Ingolstädter Studienkollegen mit diesem Mammutprojekt betraut.
Die Karten sollen die 1526 bis 1533 entstandene „Bairische Chronik“ des Johannes Aventinus ergänzen.
„Sechs oder schier sieben Summer“, von 1554 bis 1561, reitet Philipp Apian mit seinem Bruder Timotheus und einem Vermessungsgehilfen Ober- und Niederbaiern, die Oberpfalz, das Erzbistum und Hochstift Salzburg und das Bistum Eichstätt und führt Landvermessungen durch.
Das zu bearbeitende Gebiet umfasst rund 50.000 Quadratkilometer.
17. 12 1554 - Herzog Ernst von Baiern kommt zur Welt
München * Herzog Ernst von Baiern wird geboren. Um ihn standesgemäß zu versorgen, wird für ihn eine kirchliche Laufbahn vorgesehen. Als Sekundogenitur wird der Kölner Bischofsstuhl ins Auge gefasst.
1555 - Die „Riegermühle“ wird durch Herzog Albrecht V. neu erbaut
Au * Die „Riegermühle“ wird durch Herzog Albrecht V. neu erbaut.
1555 - Die ältesten Münchner „Wasserbriefe“
München * Die ältesten Münchner „Wasserbriefe“ beurkunden die Wasserabgabe aus den städtischen „Brunnhäusern“ an Privatpersonen.
25. 9 1555 - Die religiös-politischen Verhältnisse im Reich werden regelt
Augsburg * Auf dem Augsburger Reichstag wird ein Reichsgesetz verkündet, das die religiös-politischen Verhältnisse im Reich regelt und damit die Glaubensspaltung festschreibt.
Im Augsburger Religionsfrieden werden lutherische Protestanten - nicht die Reformierten - den Katholiken reichsrechtlich gleichgestellt. Der Landesherr kann über die Konfession seiner Untertanen bestimmen. Andersgläubige dürfen das Land verlassen. Später wird der Grundsatz auf die griffige Formel „Cuius regio, eius religio“ [„Wessen die Herrschaft, dessen Glaube (gilt)“] gebracht.
29. 10 1555 - Ulrich Diefstetter wird Mühlenbesitzer in der Au
Au * In einem Lehensbrief wird die Übergabe der Mühle in der Au an Melchiors Sohn, Ulrich Diefstetter, beschrieben.
„Von gottes genaden Wir Albrecht Pfalenzgraue bei Rhein, Hertzog in Obern und Nidern Bairn Bekennen mit dem offen brief, Das Wir Ulrichen Diefsteter Klingenschmid dem Mullschlag Ihenhalb [jenseits] der Iser an dem Rain auf dem pach zwischen der Mull Neideckh vnnd der Yserbrukchen, darauf yetzt ain Plathamer vnnd Schleifmull stet, mit sambt den Wasserflussen daselbey, in vnnserm Lanndgericht Wolfertzhausen gelegen, [...] zur rechten lehen verliehen haben, vnnd verleihen Ime solches alles vnnd yedes mit seinen erenrechten gerechtigkaiten ein vnnd zuegehorungen hiemit wissentlich vnnd crafft ditz briefs [...].“
1556 - Das „Wasserhaus auf dem Isarberg“ wird erneuert
Au * Das „Wasserhaus auf dem Isarberg“ wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
1556 - Herzog Albrecht V. beruft die Jesuiten
Ingolstadt * Herzog Albrecht V. beruft die Jesuiten an die Universität nach Ingolstadt, um durch sie den radikalen Verfall der theologischen Fakultät zu stoppen.
Seit dem Jahr 1556 - Brauereibesitz in der Neuhauser Straße
München-Kreuzviertel * Das Anwesen Neuhauser Straße 42 ist im Besitz von verschiedenen Brauern.
5. 7 1556 - Werben um die Rückkehr der Societas Jesu
München - Ingolstadt * Von München aus setzt erneut das Werben um die Rückkehr der Societas Jesu ein und so treffen wieder achtzehn Jesuiten in Ingolstadt ein.
23. 8 1556 - Kaiser Carl V. verzichtet auf die Kaiserwürde
Regensburg ? * Kaiser Carl V. verzichtet zu Gunsten seines Bruders Ferdinand I. auf die Kaiserwürde.
24. 2 1557 - Matthias, der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Matthias, der spätere Kaiser, wird in Wien geboren.
26. 2 1558 - Ferdinand I. wird - gegen den Willen von Papst Paul IV. - zum Kaiser gekrönt
Rom * Ferdinand I. wird - gegen den Willen von Papst Paul IV. - zum Kaiser gekrönt. Erst Pauls IV. Nachfolger, Papst Pius IV., erkennt ihn an.
21. 9 1558 - Der Ex-Kaiser Carl V. stirbt im Kloster San Jerónimo de Yusta
San Jerónimo de Yusta • Der Ex-Kaiser Carl V. stirbt im Kloster San Jerónimo de Yusta.
1559 - Die Jesuiten schaffen langsam ein Klima für die Hexenjagd
München * Mit der Ankunft der Jesuiten in München entsteht langsam ein Klima für die Hexenjagd. Die Jesuiten betätigen sich als Berater der Herzöge und als fanatische Massenprediger.
Unter Herzog Wilhelm V. und seinem Sohn Maximilian I. schießt in Baiern der Hexenwahn üppig ins Kraut und München sowie Baiern bleiben davon nicht verschont. Hinzu kommt, dass sich auch in den anderen mitteleuropäischen Staaten das Blatt wendet.
2 1559 - Johann Tserclaes Graf von Tilly wird geboren
Schloss Tilly * Johann Tserclaes Graf von Tilly wird in Brüssel oder in dem 35 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegenen Schloss Tilly geboren.
4. 7 1559 - Herzog Albrecht V. bittet um die Entsendung von 14 Jesuitenpatres
München - Rom * Herzog Wilhelm V. wendet sich an den Ordensgeneral der Gesellschaft Jesu, Diego Lainez, mit der Bitte, vierzehn Jesuiten zum Aufbau eines Collegs und als Unterstützung im Kampf gegen die Reformation nach München zu entsenden.
13. 10 1559 - Die ersten zwei Jesuitenpater kommen in München an
München-Kreuzviertel * Die ersten zwei Jesuitenpater kommen in München an, um hier im Auftrag von Herzog Albrecht V. eine Schule zu eröffnen. Sie bewohnen zunächst einen Teil des Augustinerklosters.
20. 11 1559 - Sieben weitere Jesuiten treffen in München ein
München-Kreuzviertel * Sieben weitere Jesuiten treffen in München ein.
13. 12 1559 - Die Jesuiten eröffnen ihr Colleg in München
München-Kreuzviertel * Die Jesuitenpatres eröffnen ihr Colleg, das spätere Wilhelmsgymnasium, in einem Nebengebäude des Augustiner-Klosters.
Um 1560 - Die der Jesuiten erhalten ein großes Grundstück in Haidhausen
Haidhausen * Kurz nach Ankunft der Jesuiten in München erhalten diese ein großes Grundstück in Haidhausen an der heutigen Kirchen-/Ecke Elsässerstraße, den sogenannten Jesuitengarten. Das Anwesen besteht aus einem „sonderlich erbauten Keller“ und einem von Planken eingeschlossenen, 6 Tagwerk großen Garten, von dem 3 Tagwerk als Krautgarten genutzt werden.
Um 1560 - In Baiern wird die „Loreto-Wallfahrt“ volkstümlich
München * In Baiern wird die „Loreto-Wallfahrt“ bekannt und durch die „Lauretanische Litanei“ volkstümlich.
Ab dem 1560 - Herzog Albrecht V. lässt einen neuen „Lustgarten“ anlegen
München-Graggenau * Herzog Albrecht V. lässt für seine Ehefrau, die Erzherzogin Anna, einen neuen „Lustgarten“, mit „Lusthaus“, „Arkadengang“, „Ziertürmen“ und aufwändigen „Wasseranlagen“ anlegen.
Der sogenannte „Annagarten“ entsteht nördlich des „Alten Hofgartens“ und bildet den Ausgangspunkt für die späteren Anlagen unter Herzog/Kurfürst Maximilian I..
Nach 1560 - Die Missernten haben aufgrund der Klimaveränderung zugenommen
Europa * Die Missernten haben aufgrund der Klimaveränderung nach 1560 stark zugenommen.
Der Mechanismus einer „Agrarkrise“ lässt sich vereinfacht wie folgt darstellen:
Das Ergebnis einer klima- oder unwetterbedingten „Missernte“ ist die „Verknappung der Grundnahrungsmittel“, was bis ins 19. Jahrhundert hinein immer das „Brotgetreide“ betrifft.
Die unmittelbare Folge davon ist eine „Teuerung“, die dazu führt, dass große Teile der Bevölkerung hungern oder an Unterernährung leiden.
Dieser verschlechterte Allgemeinzustand bewirkt oft das Auftreten von epidemischen Krankheiten oder eine stark erhöhte Krankheitsanfälligkeit.
Dieser Zyklus dauert bis zur nächsten Ernte, also bis zum Spätsommer des folgenden Jahres.
Folgt aber in der Zwischenzeit eine weitere „Missernte“, erhöht sich der Schaden um ein Vielfaches.
Die „Perioden der Teuerung“ treten um das Jahr 1560 häufiger auf und dauern länger.
Diese „Hungerkrisen“ betreffen große Teile Europas, weshalb neue „Hexenverfolgungen“ beginnen und in den verschiedenen Ländern zu einer Verschärfung der „Hexen-Gesetzgebung“ führen.
Die Verfolgung der „Hexen“ ist nicht von der konfessionellen Überzeugung der Verfolger abhängig.
Auch drängen sich nach der „Reformation“ die katholisch gebliebenen Gebiete - wie man gerne unterstellt - nicht in den Vordergrund.
Im Gegenteil: In Spanien hat sich die „Inquisition“ seit dem Jahr 1526 auf eine sehr gemäßigte Position zurückgezogen.
In Italien führt eine Debatte in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts zu einem deutlichen Widerstand gegen die „Hexenverfolgungen“ in den oberitalienischen Alpentälern.
Anders verhält es sich mit den „Hexenverfolgungen“ in Deutschland.
Hier beginnen die „Protestanten“ achtzig Jahre später dort, wo die „Katholiken“ in den 1480er Jahren aufgehört haben, nämlich im deutschen Südwesten.
1561 - Die Jesuitenpatres erhalten für ihr Gymnasium einen Neubau
München-Kreuzviertel * Die Jesuitenpatres erhalten für ihr Gymnasium einen Neubau. Das vorläufige Unterrichtsgebäude für das Münchner Jesuiten-Colleg wird vom Provinzial der Oberdeutschen Ordensprovinz, Petrus Canisius, eingeweiht. Die „feine neue Residenz“ befindet sich etwa an der Stelle des Chores der heutigen Michaelskirche.
Ab 1561 - Philipp Apian arbeitet an der Ausarbeitung der großen „Baiernkarte“
Ingolstadt * Nach der Vermessung des Landes arbeitet Philipp Apian an der Ausarbeitung der großen „Baiernkarte“.
1561 - Erste Versuche mit der Pflanzung von Maulbeerbäumen
Herzogtum Baiern * Bereits während der Regierungszeit des Baiernherzogs Albrecht V., wird in Altbaiern der Versuch unternommen, Maulbeerbäume anzupflanzen.
Nennenswerte Erfolge bleiben seinerzeit allerdings aus. Jedenfalls wird von einem nutzbringenden Erfolg später nicht mehr berichtet.
31. 10 1561 - Der Münchner Burgfrieden wird neu festgelegt und erheblich erweitert
München * Im sogenannten Albertinischen Rezeß wird der Grenzverlauf des Münchner Burgfriedens neu festgelegt und dabei das rechtsisarische Gebiet erheblich erweitert. Herzog Albrecht V. bestimmt, dass der „Wasserturm und der Farthweg auf dem Gasstach“ zum Münchner Burgfrieden gehören soll.
31. 10 1561 - Verfassungsrechtliche Verbesserung durch den Albertinischen Rezeß
München * Mit dem Albertinischen Rezeß kommt es zu einer weiteren verfassungsrechtlichen Verbesserung für die Stadt München. Damit werden die Müller, Kalt- bzw. Kupferschmiede und die Bierbrauer der Gerichtsbarkeit der städtischen Obrigkeit unterstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat dieser Personenkreis eine Sonderstellung eingenommen.
Außerdem wird die vermutlich schon vorher tatsächlich ausgeübte Blutgerichtsbarkeit der Stadt durch Herzog Albrecht V. als gegeben hingenommen. Umgekehrt nimmt nun aber der Landesherr verstärkt Einfluss auf die Auswahl und die Besetzung der Stadtrichter. So muss sich der Stadtoberrichter als höchster städtischer Richter, bei seinem Amtsantritt erst den Blutbann vom Herzog übertragen lassen. Damit ist die Doppelbindung des obersten städtischen Juristen an Stadt und Herzog festgeschrieben.
1562 - Die „Münchner Bettelordnung“ regelt die „Armenversorgung“ neu
München * In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ändert sich die Einstellung zu den „Armen“ grundlegend.
Martin Luther und später auch die katholischen Reformer lehnen jede Form von „Bettel“ ab und fordern eine Versorgung aller „Arbeitsunfähigen“ auf Kosten der Gemeinde.
Dies findet in der letzten rein städtischen „Münchner Bettelordnung“ ihren Niederschlag. Die „Armenversorgung“ wird auf die Basis eines „Unterstützungsfonds“, dem „Stock-Almosen“, gestellt.
Freiwillige Spenden, Gelder aus Opferstöcken, Sondersammlungen in Kirchen und Klöstern und die Erträge aus den Haussammlungen sollen eine gezielte Versorgung der „Armen“ gewährleisten. Dazu ziehen jeden Freitag vier „Biedermänner“ mit Sammelbüchsen von Haus zu Haus und ersetzen damit die bisher üblichen Bettelgänge der „Armen“.
Die Sammlungen erhalten den Namen „Freitagsbrot“.
1562 - Philipp Apians „Wappensammlung“ umfasst insgesamt 646 Wappen
Ingolstadt * Die in Holz geschnitzte „Wappensammlung“ von Philipp Apian umfasst insgesamt 646 Wappen der baierischen Geistlichkeit, des Adels und der Städte und Märkte Baierns.
1562 - Der Rat der Stadt verbietet das „Hurenlaufen“
München * Der Rat der Stadt verbietet das „Hurenlaufen“ mit der Begründung, dass die „gemeinen Weiber“ großes Ärgernis erregen, da sie „so schändlich liefen und sich dabei gar hoch entblößten“.
14. 5 1562 - Maximilian II. wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt
Prag * Maximilian II. wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt.
3. 8 1562 - Ein großes Hagelunwetter vernichtet den Wein und das Getreide
Südwestdeutschland * Ein großes Hagelunwetter vernichtet - zu Beginn der Erntezeit - den Wein und das Getreide - und damit das täglich Brot. Das Unwetter löst die erste große Hexenjagd der Neuzeit aus. Alleine in der kleinen protestantischen Herrschaft Wiesensteig werden 63 Hexen verbrannt. Die Verfolgungen werden relativ spontan und gesetzlos durchgeführt.
30. 11 1562 - Maximilian II. wird römisch-deutscher König
Frankfurt am Main * Maximilian II. wird in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen König gewählt.
1563 - Georg Schobinger kauft den „Platner-Hammer“ und das „Haßlang-Schloss“
Au * Der Münchner Bürgermeister Georg Schobinger kauft den „Platner-Hammer“ und das „Haßlang-Schlösschen“ an der heutigen Lilienstraße.
Er gibt seiner Neuerwerbung den Namen „Wageck“.
1563 - Die Herzöge führen strenge Aufsicht über die „Konkubinen“ der Geistlichen
München * Die Herzöge führen strenge Aufsicht über die „Konkubinen“ der Geistlichen.
1563 - Philipp Apians „Baiernkarte“ ist fertiggestellt
München * Philipp Apian legt Herzog Albrecht V. die von ihm in Auftrag gegebene circa sechs mal sechs Meter große „Baiernkarte“ vor.
1563 - Melchior Bocksberger malt das herzogliche „Lusthaus“ aus
München-Graggenau * Melchior Bocksberger erhält eine hohe Summe ausbezahlt.
Wahrscheinlich für die Deckenbilder im Saal des „Lusthauses“ im neuen herzoglichen „Lustgarten“.
1563 - Die Herzöge halten strenge Aufsicht über die „Konkubinen“ der Geistlichen
München * Spätestens seit der Beendigung des „Trienter Konzils“ führen die Herzöge eine strenge Aufsicht über die „Konkubinen“ der Geistlichen.
1563 - Der „Teufelspakt“ gilt als Wesensmerkmal des „Hexerei-Delikts“
Schottland * Mit dem schottischen „Witchcraft Act“ findet sich erstmals nicht der „Schadenszauber“, sondern der „Teufelspakt“ als Wesensmerkmal des „Hexerei-Delikts“.
1563 - Der Jesuiten Petrus Canisius predigt die Hexenverfolgungen
München * Petrus Canisius, der wortgewaltige jesuitische Ordensprovinzial für Oberdeutschland, schreibt: „Überall bestraft man die Hexen, welche merkwürdig sich mehren. Ihre Freveltaten sind entsetzlich. [...] Man sah früher in Deutschland niemals die Leute so sehr dem Teufel ergeben und verschrieben. [...] Sie schaffen viele durch ihre Teufelskünste aus der Welt und erregen Stürme und bringen furchtbares Unheil über Landleute und andere Christen. Nichts scheint gesichert zu sein gegen ihre entsetzlichen Künste und Kräfte“.
Ohne jeden Zweifel an der Existenz der Hexenverbrechen oder Kritik an den angewandten ungesetzlichen Inquistitionsverfahren, das gegen alle strafprozessrechtlichen Bestimmungen der „Carolina“ verstößt, predigt er im Augsburger Dom über die in Wiesensteig und im schwäbischen Raum stattfindenden Hexenverfolgungen.
Die juristischen und medizinischen Einwände interessieren den Jesuiten nicht. Für ihn steht die Theologie weit über der Jurisprudenz.
12. 4 1563 - Der Alte Südliche Friedhof wird als Pestfriedhof eingeweiht
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * Der Alte Südliche Friedhof vor den Mauern der Stadt wird eingeweiht. Das Anwachsen der Stadt hat eine Erweiterung der bestehenden Beerdigungsplätze - gerade für die einfache Bevölkerung - notwendig gemacht. Er dient der Stadt aber auch als Pestfriedhof. </p>
16. 7 1563 - Maximilian II. wird zum König von Ungarn und Kroatien gekrönt
Pressburg * Maximilian II. wird in Pressburg zum König von Ungarn und Kroatien gekrönt.
19. 10 1563 - In Rom wird die Marianische Kongregation gegründet
Rom * In Rom wird die Marianische Kongregation als Schwesterorganisation des Jesuitenordens gegründet. Ihren Ursprung hat die Marianische Männerkongregation im römischen Jesuitenkolleg, wo der flämische Jesuit Jean Leunis eine Studentengemeinschaft bildet, um den Erziehungsauftrag des Kollegs: „Die Einheit von Leben und Glauben in einer persönlichen Bindung an Jesus Christus unter dem Schutz der himmlischen Mutter zu finden“ weiter zu vertiefen.
16. 4 1564 - Papst Pius IV. gestattet den Laienkelch im Herzogtum Baiern
Rom-Vatikan - München * Papst Pius IV. gestattet den „Laienkelch“, also die „Kommunion in beiderlei Gestalt“, auch im Herzogtum Baiern. Das päpstliche Breve kommt zu spät, da Herzog Albrecht V. seine Meinung inzwischen geändert hat und nun gegen den „Laienkelch“ kämpft.
25. 7 1564 - Kaiser Ferdinand I. stirbt in Wien
Wien * Kaiser Ferdinand I. stirbt in Wien.
Sein Nachfolger als Kaiser und Landesherr im Erzherzogtum Österreich wird Maximilian II., der bereits am 24. November 1562 zum römisch-deutschen König gewählt worden war.
1. 10 1564 - Herzog Albrecht V. veröffentlicht ersten Index verbotener Bücher
München * Herzog Albrecht V. veröffentlicht den ersten Index verbotener Bücher, der von einer Kommission des Konzils von Trient erarbeitet worden ist.
Um 10 1565 - Freisings Bischof Moritz gibt seine „Resignation“ bekannt
Freising * Da Herzog Albrecht V. seinen zehnjährigen Sohn Ernst auf einen Bischofsstuhl unterbringen will, gibt der Freisinger Bischof Moritz von Sandizell seine „Resignation“ zugunsten des Prinzen bekannt.
1566 - Philipp Apian verlegt die „Bairischen Landtafeln“
München * Philipp Apian lässt auf der Basis der „Großen Karte“ von Jost Amman Holzschnitte im kleineren Maßstab von 1 : 144.000 anfertigen.
Diese in 24 Holzschnitten aufgeteilten sogenannten „Bairischen Landtafeln“ verlegt Philipp Apian in seiner eigenen Druckerei.
Die Genauigkeit der Landkarten wird erst im 19. Jahrhundert übertroffen.
1566 - Papst Pius V. gibt die „Toleranz“ gegenüber dem „Dirnenwesen“ auf
Rom-Vatikan - München * Papst Pius V. gibt die „Toleranz“ gegenüber dem „Dirnenwesen“ auf.
Am Ende appellieren sogar die katholischen Pfarrer an den Rat der Stadt, das „Frauenhaus“ zu schließen.
Sie beziehen sich dabei - wie die „Reformierten“ - auf die Aussagen der Bibel gegen die „Hurerei“.
1566 - Kaiser Maximilian II. nimmt die Beschlüsse des „Konzils von Triest“ an
Augsburg * Auf dem Augsburger „Reichstag“ nehmen Kaiser Maximilian II. und die katholischen Fürsten die Beschlüsse des „Konzils von Triest“ an.
14. 1 1566 - Kaiser Maximilian II. zieht in München ein
München * Kaiser Maximilian II. zieht in München ein. Er bleibt fünf Tage in der Stadt.
16. 3 1566 - Die „Zunft der Weinschenken“ erhält neue „Sätze und Ordnung“
München * Die „Zunft der Weinschenken“ erhält neue „Sätze und Ordnung“.
18. 10 1566 - Papst Pius V. genehmigt die Resignation des Freisinger Bischofs
Rom-Vatikan - Freising * Nach längeren Verhandlungen genehmigt Papst Pius V. die Resignation [= freiwilliger Amtsverzicht] des Freisinger Bischofs Moritz von Sandizell. Damit kann der elfjährige Baiernprinz Ernst zum Bischof von Freising gewählt werden.
16. 11 1566 - Herzog Albrecht V. erlässt ein religiöses Mandat
München * Herzog Albrecht V. erlässt ein religiöses Mandat
- zur Einhaltung des sonn- und feiertäglichen Gottesdienstes,
- die Aufforderung zu einem gottesfürchtigen Leben und
- zur täglichen Verrichtung des Türkengebets.
Außerdem wird den Wirten verboten, an gebotenen Fasttagen, auch Freitagen und Samstagen, Fremden und Inländern öffentlich Fleisch zu essen zu geben.
9. 12 1566 - Herzog Albrecht V. befiehlt die Musterung in den Stadtvierteln
München * Da im Frühjahr des kommenden Jahres ein Übergreifen der Türken von Ungarn aus nach Österreich zu befürchten ist, befiehlt Herzog Albrecht V. die Musterung in den Stadtvierteln.
1567 - Der Haidhauser Dorfteich ist halt nur eine Lacke
Haidhausen * Über den Haidhauser Dorfteich, die „Große Lacke“, heißt es: „Welches fleckhlein, nachdem es zum theil nur ain Lackhen, weder Vieh noch leut, Dieffe des wassers halber, mit nichte geniessen“.
1567 - Georg Schobinger lässt „Wageck“ zu einem „Edelsitz“ erheben
Au * Georg Schobinger lässt „Wageck“ an der Lilienstraße durch zusätzliche Zahlungen zu einem „Edelsitz“ erheben.
1567 - Die „Württembergische Landesordnung“ und das neue „Hexerei-Delikt“
Stuttgart * In der „Württembergischen Landesordnung“ wird das neue „Hexerei-Delikt“ ausformuliert:
„Wo aber jemandt sich mit dem Teuffel, zu Nachtheil und Beschädigung der Menschen in Bündnuß eingelassen und damit noch niemandts Schaden gethon hette, der soll gestrafft werden nach Gelegenheit der Sach“.
6. 8 1567 - Am Haßlang-Schlösschen wird ein Triebwerk eingehängt
Au * Am Haßlang-Schlösschen in der heutigen Lilienstraße wird ein Triebwerk in den Auer Mühlbach eingehängt. Damals übergeben die Herzöge Sigmund und Albert dem Hanns Platner von der Rosen einen Platz zum Lehen, damit er eine Mühle und einen Hammer erbauen kann.
Die Urkunde hat folgenden Wortlaut: „Von gottes gnaden Wir Sigmund vnd Wir Albrecht gebrüdere Phallenz grauen bey Reine Hertzogen in Obern vnd Nidern Bairn [...] tun kunnt [...], Das wir vnnserm getrewen Hannsen Platner mit der Rosen von sunndern gnaden ainen Mulslag gelegen enthalb der Yser an dem Rain auf dem pach zwischen der Mul Neydegk und der Yserbrugken, Darauf er machen vnd slagen mag ain Sleifmul vnd obe er ainen platthamer auch darauf richten mocht [...]“.
22. 11 1567 - Herzog Albrecht V. schränkt den Weißbierausschank stark ein
München * Herzog Albrecht V. erlässt ein Mandat, das den Ausschank von Weißbier stark einschränkt.
- Es darf fortan nur mit eigenem oder im Ausland gekauften Weizen gebraut werden.
- Der Ausschank von Weißbier ist nur in den Städten und Märkten jenseits der Donau in Richtung Bairischer Wald erlaubt.
- Neue Weißbierbrauereien dürfen bei Strafe nicht mehr errichtet werden,
- auch deshalb, weil beim Brauen große Mengen Weizen verschwendet werden.
Denn, so der Herzog weiter, das Weißbier ist „gar ein unnuez getranck, [...] das weder fueert noch nert, weder sterck, krafft noch macht gibt, und dahin gericht ist, das es die Zechleut, oder diejenigen dies trincken, nur zu mehrerm trincken raitzt und ursacht“. Allerdings, mehr kann man sich doch von einem Getränk nicht erwarten.
1568 - Johann Tserclaes Graf von Tilly wird in Lüttich und Köln erzogen
Lüttich - Köln * Johann Tserclaes Graf von Tilly muss mit seinen Eltern die Niederlande verlassen, weil sich sein Vater an den aufrührerischen Aktivitäten der „Geusen“ beteiligt hatte.
Er erhält seine Erziehung in Lüttich und Köln.
24. 2 1568 - Ein festliches Turnier zur öffentlichen Unterhaltung
München-Graggenau * Herzog Wilhelm V. und Renata von Lothringen feiern auf dem Schrannenmarkt mit einem festlichen Turnier (24. Februar) und anderen öffentlichen Unterhaltungen ihre Vermählung. Es findet sich im Glockenspiel am Neuen Rathaus wieder.
1569 - Philipp Apian muss als Protestant die Universität Ingolstadt verlassen
Ingolstadt * Als überzeugter Protestant muss Philipp Apian - auf Betreiben der Jesuiten - die Universität Ingolstadt verlassen. Er geht nach Tübingen.
1570 - Die Holzbrücke zum „Lustgarten“ wird durch Stein ersetzt
München-Graggenau * Die Holzbrücke zum herzoglichen „Lustgarten“ wird durch eine Brücke aus Stein ersetzt.
1571 - Streit zwischen den Münchner und den Auer „Schneidern“
München - Au * Der Herzog muss einen Streit zwischen den Münchner und den Auer „Schneidern“ schlichten.
Es endet damit, dass die Münchner ihre Schmähungen und Herabsetzungen zurücknehmen müssen.
Dafür müssen es die Auer künftig unterlassen, mit Elle und Schere „auf die Stör“ in die Stadt zu kommen. Sie dürfen nur Schneiderarbeiten annehmen, die man ihnen bringt.
1571 - München ist reich an Hunden
München * München war schon immer reich an Hunden.
Alleine zur herzoglichen Hofjagd gehören etwa 220 Hunde.
7. 10 1571 - Im Ionischen Meer findet die Seeschlacht von Lepanto statt
Lepanto * Im Ionischen Meer findet die Seeschlacht von Lepanto statt. Oberbefehlshaber der Heiligen Liga ist Don Juan de Austria. Die Flotte des Osmanischen Reichs führt Ali Pascha an. Er stirbt während der Seeschlacht, die als jene mit den meisten Toten an einem Tag in die Geschichte eingeht.
1572 - Heinrich Schobinger kommt in den Besitz des „Zaichingerhofes“
Bogenhausen * Heinrich Schobinger der Jüngere, Kaufmann, Waffenschmied von der Au, Inhaber zahlreicher Ämter der Münchner Bürgerschaft sowie der baierischen Herzöge und des Deutschen Kaisers, kommt durch Heirat mit Juliane Stadler in den Besitz des „Zaichingerhofes“ in Bogenhausen.
1572 - Isarinseln sind noch nicht erkennbar
München * Die Stadtansicht von Braun und Hagenberg zeigt zwar eine nicht ganz realitätsgetreue Ansicht von München, doch Isarinseln sind noch nicht erkennbar.
1572 - Eine neue „Bettelordnung“ wird veröffentlicht
München * Eine neue „Bettelordnung“ wird veröffentlicht.
In ihr zeichnet neben dem „Rat der Stadt“ erstmals auch der „Landesherr“ verantwortlich.
- Unter dem Einfluss Herzog Albrechts V. wird in dem Gesetzeswerk
- ein „absolutes Bettelverbot“ ausgesprochen.
- Wirte und allen Einwohnern war die Beherbergung „nichtansässiger Bettler“ verboten.
- Den „Bettelrichtern“ zahlt man „Fangprämien“ und
- den Festgenommenen drohen schwere Strafen.
Im besten Fall ihre „Ausweisung“, im schlimmsten Fall aber „Hängen“.
Doch schnell wird klar, dass sich in München ein „absolutes Bettelverbot“ und die Versorgung der „Armen“ aus der Gemeindekasse nicht verwirklichen lassen.
Die Einnahmen der Sammlungen reichen einfach nicht aus.
„Sondersieche“, also mit ansteckenden Krankheiten Behaftete, und „Blinde“ haben sich mit „betteln“ zu ernähren, da sie keine Arbeit finden können.
Außerdem sammeln die „Biedermänner“ das „Freitagsbrot“ nun zusätzlich am Mittwoch.
1572 - Der „Teufelspakt“ zieht die „Todesstrafe“ nach sich
Sachsen * Die „Kursächsischen Konstitutionen“ nimmt für den „Teufelspakt“ die „Todesstrafe“ auf.
24. 8 1572 - Der Pogrom gegen die Hugenotten beginnt
<p><strong><em>Paris</em></strong> * In der Nacht zum 24. August 1572, dem Namenstag des Heiligen Bartholomäus, beginnt gegen 3 Uhr in Paris eine wahre Hetzjagd auf Menschen anderen Glaubens, in diesem Falle Protestanten. Bis zu 10.000 Hugenotten fallen in dieser Nacht und den folgenden Tagen dem grauenhaften Gemetzel zum Opfer.</p> <p>Veranlasst wurde der Progrom, der als <em>„Pariser Bluthochzeit“</em> oder <em>„Bartholomäusnacht“</em> in die Geschichte einging, von Katharina von Medici, der Mutter des französischen Regenten Karls IX. Vorausgegangen war die Hochzeit des protestantischen Heinrich von Navarra mit Margarete von Valois, die das Pulverfass der Gewalt entzündete. </p>
1573 - Ernst von Baiern wird zum Bischof von Hildesheim gewählt
Hildesheim * Der 19-jährige Ernst von Baiern wird zum Bischof von Hildesheim gewählt.
1573 - 120 Fässer „Einbecker Bier“ an den Herzogshof nach München geliefert
Einbeck - München * Werden anfangs jährlich vierzig bis fünfzig Fässer „Einbecker Bier“ nach München geliefert, so steigert sich der Bedarf des Herzoghofes und erreicht in den Jahren 1573 und 1574 - mit jeweils einhundertzwanzig Fässern - die Höchstgrenze.
Danach sinken die Lieferungen wieder auf dreißig bis fünfzig Fässer pro Jahr ab.
Doch die ständig offensichtlicher werdende Finanzmisere schreckt die „Hofkammer“ angesichts des sich anbahnenden „Staatsbankrotts“ auf.
Die herzogliche „Finanzbehörde“ stellt daraufhin die Frage, weshalb das Bier für den „baierischen Hof“ - unter den gegebenen Umständen - noch immer für teures Geld aus Einbeck im hohen deutschen Norden bezogen wird.
Immerhin handelt es sich dabei doch um ein „Ketzerbier“ aus dem „lutherischen Ausland“.
Jeder der 600 „Hofbediensteten“ - je nach Rang und Funktion - hat das Recht auf ein bestimmtes Quantum Bier.
Die Herrschaften an den „besseren Tischen“ können sogar trinken, soviel sie wollen.
Und sie genießen das „Freibier“ derart in „vollen Zügen“, dass der Herzog immer wieder mit Verboten gegen die „unzimbliche“ und übermäßige Trunkenheit einschreiten muss.
1573 - Das Kloster Santa Marta in Rom wird ein normales Kloster
Rom * Das Kloster Santa Marta in Rom, das 1542 als Zufluchtstätte für bußwillige Kurtisanen gegründet worden war, muss wegen mangelnden Zulauf in ein gewöhnliches Kloster umgewandelt werden.
17. 4 1573 - Maximilian I. wird in München geboren
München • Maximilian I., der spätere baierische Herzog und Kurfürst, wird als drittes Kind des herzoglichen Thronfolgerpaares Wilhelm V. und Renata von Lothringen in München geboren.
1574 - Johann Tserclaes Graf von Tilly tritt in das „Spanische Heer“ ein
Spanien * Johann Tserclaes Graf von Tilly tritt in das „Spanische Heer“ ein.
1574 - Ein Brunnen mit Drehmechanik wird für den „Lustgarten“ geliefert
München-Graggenau * Im herzoglichen „Lustgarten“ wird ein aufwändig gestalteter Brunnen mit Drehmechanik für den herzoglichen „Lustgarten“ geliefert.
Er wird bereits 1577 als „nicht funktionsfähig“ wieder abmontiert.
9. 10 1574 - Elisabeth Renata von Lothringen wird in Nancy geboren
Nancy • Elisabeth Renata, die spätere baierische Kurfürstin und Ehefrau von Maximilian I., Tochter von Herzog Carl II. von Lothringen und Claudia von Frankreich, erblickt in Nancy das Licht der Welt.
1575 - Eine „Keller- und Speisenordnung“ des herzoglichen Hofes
München-Graggenau * Eine „Keller- und Speisenordnung“ des herzoglichen Hofes zur Zeit Herzog Albrecht V. regelt genau, wer was und wie viel an Getränken den Teilnehmern der herzoglichen „Hoftafel“ aufgetischt wird.
1575 - Bei der Rückkehr von der Kurtisane erwischt
Rom * Herzog Ernst von Baiern, Bischof von Freising und Hildesheim, wird in Rom ertappt, wie er frühmorgens - von einer Kurtisane kommend - über eine Strickleiter in sein Quartier zurückkehrt.
27. 10 1575 - Rudolf II. wird in Regensburg zum römisch-deutschen König gewählt
Regensburg * Rudolf II. wird in Regensburg zum römisch-deutschen König gewählt.
1. 11 1575 - Rudolf II. wird zum römisch-deutschen König gekrönt
Regensburg * Rudolf II. wird in Regensburg zum römisch-deutschen König gekrönt.
1576 - Das Jesuiten-Gymnasium wird durch ein größeres Gebäude ersetzt
München-Kreuzviertel * Das Münchner Jesuiten-Gymnasium wird durch ein größeres Gebäude ersetzt.
1576 - Erste Marianische Vereinigungen entstehen in Dillingen und Ingolstadt
Dillingen - Ingolstadt * Im deutschsprachigen Raum verbreitet sich die neue religiöse Bewegung rasch. Die ersten Marianischen Vereinigungen entstehen in Dillingen und Ingolstadt.
1576 - Philipp Apian fertig für Herzog Albrecht V. einen Globus
München-Graggenau * Im Auftrag von Herzog Albrecht V. fertigt Philipp Apian einen Globus, der im „Bibliotheksraum“ im Obergeschoss des „Antiquariums der Residenz“ aufgestellt wird.
26. 7 1576 - Der Hexenbischof Marquard II. vom Berg regiert im Hochstift Augsburg
Augsburg * Der als Hexenbischof bekannte Marquard II. vom Berg regiert im Hochstift Augsburg als Bischof. Er behält gleichzeitig sein Bischofs-Amt in Bamberg.
9. 9 1576 - Herzog Philipp Wilhelm kommt in München zur Welt
München * Herzog Philipp Wilhelm von Baiern, der spätere Fürstbischof von Regensburg, wird in München geboren. Er ist der Sohn von Herzog Wilhelm V. und Renata von Lothringen und ein Bruder des späteren Kurfürsten Maximilian I..
12. 10 1576 - Kaiser Maximilian II. stirbt überraschend auf dem Reichstag in Regensburg
Regensburg * Kaiser Maximilian II. stirbt überraschend auf dem Reichstag in Regensburg. Sein Nachfolger als Kaiser und in den österreichsichen Erblanden wird sein Sohn Rudolf II.
1577 - 300.000 Gulden Schulden in neun Jahren Erbprinz-Hofhaltung
Landshut - München * Nach neunjähriger Hofhaltung als Erbprinz in Landshut muss Wilhelm V. seinem Vater 300.000 Gulden Schulden eingestehen.
1577 - Die erste Münchner Marianische Kongregation wird gegründet
München-Kreuzviertel * Unter der Leitung von Joachim von Fugger wird von elf Studenten der Jesuitenschule die erste Münchner Marianische Kongregation [= Gemeinschaft] ins Leben gerufen. Ihre Versammlungen halten sie nach der Erbauung des Jesuitenkollegs in dem dortigen großen Saal ab.
Ihre - Sodalen genannten - Mitglieder stellen sich unter den Schutz Marias, um so „den Gefahren des Glaubensabfalls und der Verwahrlosung der Sitten“ zu begegnen.
10. 4 1577 - Herzog Ernst von Baiern wird in das Kölner Domkapitel aufgenommen
<p><strong><em>Köln</em></strong> * Herzog Ernst von Baiern wird in das Kölner Domkapitel aufgenommen. </p>
6. 10 1577 - Ferdinand, der spätere Kurfürst von Köln, wird in München geboren
München * Ferdinand, der spätere Kurfürst und Erzbischof von Köln, wird in München geboren. Er ist ein Sohn von Herzog Wilhelm V. und dessen Ehefrau Renata von Lothringen. Sein Onkel ist der Kölner Erzbischof Ernst. Sein ältester Brüder ist der spätere Kurfürst Maximilian I..
1578 - Herzog Albrecht V. gründet die „Salvator-Stiftung“
München - München-Isarvorstadt - Giesing * Herzog Albrecht V. gründet die „Salvator-Stiftung“ zum Unterhalt der „Salvatorkirche“ am heutigen „Alten Südlichen Friedhof“.
Zur „Salvator-Stiftung“ gehören drei Bauernhöfe in Ober- beziehungsweise Untergiesing.
1578 - Die Klagen über die Teuerung des Weines verstummen nicht mehr
München * Die Klagen über die Teuerung des Weines verstummen nicht mehr.
Die „Baierische Landesordnung“ vermerkt, dass immer mehr Leute bei den „Bierbrauern“ zum Essen einkehren.
1578 - Der Rat der Stadt soll die „Pfaffenhuren“ (Konkubinen) aus der Stadt treiben
München * Der Rat der Stadt erhält von Herzog Wilhelm V. den Auftrag, die „Schlafweiber“ genannten „Pfaffenhuren“ (Konkubinen) aus der Stadt zu vertreiben.
Dabei sieht der Stadtrat nicht nur die menschliche Seite des Problems, sondern sorgt sich auch um die unversorgten Kinder, sodass er drei Jahre später wegen „Nachlässigkeit im Kampf gegen die Konkubinen“ zu einer Geldstrafe von 500 Gulden verurteilt wird.
1578 - Die ursprüngliche Bezeichnung für „Hexe“ ist in München „Unholdin“
München * Die ursprüngliche Bezeichnung für „Hexe“ ist in München „Unholdin“.
Dieser Begriff taucht erstmals auf, als die Barbara Beyrl unter den Verdacht der „Hexerei“ gerät und in die „Schergenstube“ gesperrt wird.
Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt.
11. 3 1578 - Margarete Schiller wird als erste Hexe in München verbrannt
Bozen - München * Die aus Bozen stammende Margarete Schiller wird als erste Hexe in München verbrannt. „Sie hatte in der Folter gestanden eine Unholdin zu sein, Gott geleugnet und dem bösen Feind sich ergeben zu haben, vielmals fleischlich mit ihm verkehrt und auf der Gabel ausgefahren zu sein, viele Menschen durch Zauber ums Leben gebracht, den Bauern das Vieh verzaubert und zuletzt das Wetter, das auf Starnberg und Weilheim niederging gemacht zu haben“.
Das war ein typisches Hexengeständnis, das in qualvollen Folterprozeduren erpresst wurde.
9. 7 1578 - Ferdinand II. wird in Graz geboren
Graz * Der spätere deutsch-römische Kaiser Ferdinand II. wird in Graz geboren.
1579 - Herzog Albrecht V. stirbt
München * Herzog Albrecht V. stirbt. Sein Sohn Wilhelm V. übernimmt die baierische Regentschaft.
1579 - Auflösung des „Frauenhaus“ ist nicht nachweisbar
München * Angaben, wonach Herzog Wilhelm V. das „Frauenhaus“ auflöst und sieben der „gemeinen Tochterlein“ freiwillig zu Nonnen und die anderen mit jungen Männern verheiratet werden, lassen sich nicht nachweisen.
1579 - Ein Dreijähriger auf dem Bischofsstuhl
München - Regensburg * Der dreijährige Herzog Philipp Wilhelm von Baiern wird Fürstbischof von Regensburg.
Mit Philipp Wilhelms Wahl soll das hoch verschuldete Bistum Regensburg stärker an das baierische Herzogtum gebunden werden. Gerade auch deshalb, weil sich in der Reichsstadt Regensburg die Protestanten eine einflussreiche politische Position erarbeiten konnten.
10 1579 - Wo wird im „Baierischen Wald“ Weißbier gebraut ?
München * Herzog Wilhelm V. lässt durch eine vierköpfige Kommission prüfen, an welchen Orten im „Baierischen Wald“ wie viel „weiß Behamisch Pier“ gebraut wird und woher die dafür benötigten Braumaterialien stammen.
Seit 1580 - Unterbindung der protestantischen Glaubensausübung
München - Wien * Verschiedene geistliche Fürsten unternehmen - unterstützt von Baiern und Österreich - die ersten Versuche, die protestantische Glaubensausübung zu unterbinden.
Um 1580 - Der Jesuitenpater Jeremias Drexel bekämpft die Hexen
München-Kreuzviertel * Der in München ansässige Jesuitenpater und Hofprediger Jeremias Drexel predigt in der Michaelskirche: „Oh ihr Feinde der göttlichen Ehre! Befiehlt denn nicht das göttliche Gesetz ausdrücklich: Die Zauberer sollst du nicht leben lassen? Hier rufe ich so laut ich kann und auf göttliches Geheiß zu den Bischöfen, Herren, Fürsten, Königen: Lasset die Zauberer nicht am Leben! Mit Feuer und Schwert muss diese entsetzliche Pest ausgerottet werden.
Ausgerissen muss dieses Unkraut werden, dass es nicht in übergroßer Fruchtbarkeit emporschieße, wie wir es leider sehen und beklagen. Ausgeräumt soll werden mit den Gottlosen, dass die Pest nicht weiter greift, brennen sollen die Aufrührer Gottes. [...].“
Insgesamt haben die Verfolgungsbefürworter am herzoglich-baierischen Hof ein größeres Gewicht als die kritischen Stimmen.
1581 - Ernst von Baiern wird auch noch das Bistum Lüttich übertragen
Lüttich * Dem 26-jährigen Ernst von Baiern wird auch noch das Bistum Lüttich übertragen.
Damit ist er Herr über die drei Bistümer Freising, Hildesheim und Lüttich.
1581 - Herzog Wilhelm V. verspricht den Jesuiten ein Kollegium mit einer Kirche
München-Kreuzviertel * Herzog Wilhelm V. verspricht den Jesuiten ein eigenes Kollegium mit einer Kirche.
1581 - Erste Hexenverfolgungen in der „Grafschaft Werdenfels“
Werdenfelser Land * Elsbeth Schlamp aus Garmisch, „ein seltsames Mensch von Ansehen“, und Maria Neuwirth aus Klagenfurt werden in der „Grafschaft Werdenfels“ der „Zauberei“ beschuldigt.
Ihnen wird die Erzeugung einer Seuche und eines schwerer Hagelschauers vorgeworfen.
Da aber weder der „Pfleger der Grafschaft“, noch die „Freisinger Regierung“ an einer Verfolgung interessiert sind, verläuft der Vorgang im Sand.
Ab dem Jahr 1581 - Eine Änderung in der Schreibweise „Lehen“ tritt ein
München-Lehel * Eine Änderung in der Schreibweise „Lehen“ tritt ein.
Von jetzt an wird „Lehen“ nicht nur mehr mit einfachem „h“, sondern - meistens - mit „ch“ geschrieben, also „Lechen“.
Man trägt damit der Tatsache Rechnung, dass manche Menschen das Wort härter aussprechen.
Damit entwickelt sich der Name „Lehel“ vom Sachbegriff „die“ Lehen zum räumlichen Begriff „das“ Lehen mit der neuen Schreibvariante „Lechen“ neben „Lehen“.
1581 - Wegen „Nachlässigkeit im Kampf gegen die Konkubinen“ bestraft
München * Der Rat der Stadt wird von Herzog Wilhelm V. wegen „Nachlässigkeit im Kampf gegen die Konkubinen“ zu einer Geldstrafe von 500 Gulden verurteilt.
1582 - Georg Hainmiller kauft den „Zengerbräu“ und „Kempterbräu“
München-Graggenau * Georg Hainmiller kauft die an der Burgstraße gelegenen „Zengerbräu“ und „Kempterbräu“.
1582 - Der „Augsburger Schied“ vom 14. Juni 1158 wird erstmals veröffentlicht
Salzburg * Der „Augsburger Schied“ vom 14. Juni 1158, Münchens 34 x 44 Zentimeter große Geburtsurkunde aus Pergament, wird erstmals in Wiguläus Hunds „Metropolos Salzburgensis“ veröffentlicht.
Die Urkunde fällt in dem umfangreichen Werk aber kaum auf.
1582 - Ein „bairisch-spanisches Heer“ marschiert in Köln ein
Köln * Als der „Erzbischof und Kurfürst von Köln“, Gebhard Truchseß von Waldburg, zum evangelischen Glauben übertreten, heiraten, aber auf seine Ämter nicht verzichten will, marschiert ein „bairisch-spanisches Heer“ in Köln ein und besiegt die Truppen des Truchseß.
1582 - Im „Kurpfälzischen Landrecht“ steht für den „Teufelspakt“ die „Todesstrafe“
Pfalz * Im „Kurpfälzischen Landrecht“ ist für den „Teufelspakt“ die „Todesstrafe“ vorgesehen.
12. 2 1582 - Papst Gregor XIII. ordnet eine grundlegende Kalenderreform an
Rom-Vatikan * Papst Gregor XIII. ordnet in der Bulle Inter gravissima eine grundlegende Kalenderreform an. Er will damit den auf die Antike zurückgehenden Julianischen Kalender reformieren, um die Nachtgleichen wieder mit dem Kalender in Übereinstimmung zu bringen und so eine gesicherte Osterberechnung zu ermöglichen.
Mit dem neuen Kalender sollte auf den 4. Oktober 1582 der 15. Oktober folgen.
4. 10 1582 - Umstellung des Kalenders bei den Katholiken
Rom-Vatikan * Papst Gregor XIII. reformiert den auf die Antike zurückgehenden Julianischen Kalender, um damit die Nachtgleichen wieder mit dem Kalender in Übereinstimmung zu bringen. Auf den 4. Oktober soll der 15. Oktober 1582 folgen.
Kaiser Rudolph II. fordert daraufhin die Reichsstände auf, den neuen Gregorgianischen Kalender einzuführen. Doch während die Katholischen Stände den Kalender annehmen, lehnen ihn die Evangelischen Stände aus konfessionellen Gründen ab.
Damit werden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zwei Kalender mit unterschiedlicher Tageszählung benutzt, was die Handels- und Rechtsgeschäfte massiv beeinträchtigt. Das bleibt so bis zum 17. Februar 1700 so.
1583 - Im „Ridlerhaus“ wird die „Klausur“ eingeführt
München-Graggenau * Im „Ridlerhaus“ wird die „Klausur“ eingeführt.
1583 - Beim „Kölner Krieg“ nimmt Johann Tserclaes Graf von Tilly teil
Köln * Beim „Kölner Krieg“ nimmt Johann Tserclaes Graf von Tilly als „Fähnrich“ eines wallonischen Regiments teil.
1583 - Philipp Apian verliert seinen Posten an der „Universität Tübingen“
Tübingen * Philipp Apian verliert nach 14-jähriger Lehrtätigkeit an der „Universität Tübingen“ seinen Posten, weil er sich weigert, den „Calvinismus“ zu verdammen.
Bis zum Ende seines Lebens widmete sich Apian der Vervollständigung seines topografischen Werkes.
Zusammen mit einer Beschreibung des Landes Bayern sollte die Sammlung die Darstellung des Landes auf den Landtafeln ergänzen und vervollständigen.
Philipp Apian ist über der Arbeit an Sammlung und Beschreibung verstorben.
Um 2 1583 - „... weil sein Fetl nicht hinab zu bringen sei“
Freising - Köln * Als bei der Auseinandersetzung um die Besetzung des Kölner Bischofsstuhls die Anwesenheit Bischof Ernsts von Baiern dringend notwendig ist, kann er sich nicht von seiner Freisinger Liebschaft losreißen.
Sein Bruder, der regierende baierische Herzog Wilhelm V. schreibt damals:
„Das sei gewislich die einzige und vornehmliche Ursach, daß der Bruder darum nicht hinab nach Köln wolle, weil sein Fetl nicht hinab zu bringen sei“.
Um 4 1583 - „Nie habe ich käuflichere Leute gefunden ...“
Köln * Die Kurie nimmt Bestechung nicht nur hin, sondern beteiligt sich sogar aktiv daran, sodass „Nuntius“ Malspina schreibt: „Nie habe ich käuflichere Leute gefunden als in diesem Kölner Kapitel“.
Zunächst wird der junge Graf Hans Philipp von Manderscheid-Gerolstein bewogen, für zweihundert Dukaten und eine jährliche Pension auf seinen Kapitelplatz zu verzichten.
Dann wird auf ähnliche Weise drei ältere Vorrechte auf seine Nachfolge abgelöst.
18. 4 1583 - Herzog Wilhelm V. den Grundstein für die prachtvolle Michaelskirche
München-Kreuzviertel * Ungeachtet der ungeheueren Schuldenlast und der Widerstände seiner Familie, der Räte und der Münchner Bürgerschaft legt Herzog Wilhelm V. den Grundstein für die prachtvolle Michaelskirche und das palastartige Kloster der Societas Jesu.
22. 5 1583 - Das Kölner Domkapitel wählt den Ernst zum Erzbischof von Köln
Köln * Das Kölner Domkapitel wählt den 28-jährigen baierischen Wittelsbacher Ernst, der bereits Herr über die drei Bistümer Freising, Hildesheim und Lüttich ist, zum Erzbischof von Köln. Da „die unschätzbare Freundschaft Baierns nur durch außergewöhnliche Opfer erkauft werden kann“, übersieht die Römische Kurie den
- ungebührlichen Lebenswandel des wittelsbachischen Erzbischofs und den
- Verstoß gegen das Pfründenhäufungsverbot des Trienter Konzils.
- Außerdem unterläuft der Wittelsbacher in vier von fünf Fällen das für die Übernahme eines Bistums vorgeschriebene Mindestalter und
- selbst die Residenzpflicht wird für ihn aufgehoben.
Die Kurie nimmt Bestechung nicht nur hin, sondern beteiligt sich sogar aktiv daran, sodass Nuntius Malspina schreibt: „Nie habe ich käuflichere Leute gefunden als in diesem Kölner Kapitel.“ Zunächst wird der junge Graf Hans Philipp von Manderscheid-Gerolstein bewogen, für zweihundert Dukaten und eine jährliche Pension auf seinen Kapitelplatz zu verzichten. Dann wird auf ähnliche Weise drei ältere Vorrechte auf seine Nachfolge abgelöst.
Herzog und Fürstbischof Ernst von Baiern wird Kölner Erzbischof und Kurfürst. Mit dieser Wahl erhält er den ersten Kurhut für die baierisch-wittelsbachischen Fürsten. Mit der Wahl Ernsts zum Kurfürsten wird eine protestantische Mehrheit im Kurkolleg, das den Kaiser wählt, verhindert. Kurfürst Ernst kann allerdings nur geschützt von baierischen Waffen in Köln einziehen.
4. 10 1583 - Das Fürstbistum Trier übernimmt den Gregorianischen Kalender
Trier * Das Fürstbistum Trier übernimmt den Gregorianischen Kalender. Auf den 4. folgt der 15. Oktober 1583.
1584 - Der Kölner Kurfürst Ernst erhält noch das Bistum Münster
Münster * Der Kölner Kurfürst Ernst erhält - trotz seines Lebenswandels - noch das Bistum Münster.
Damit besitzt er die fünf Bistümer Köln, Freising, Hildesheim, Lüttich und Münster.
1584 - Erbprinz Maximilian I. tritt der Münchner Marianischen Kongregation bei
München-Kreuzviertel * Der elfjährige Erbprinz Maximilian I. tritt der Münchner Marianischen Kongregation bei und wird zum Generalpräfekten aller Marien-Sodalitäten Deutschlands ernannt.
1584 - Christoph Pollinger erwirbt die Brauerei in der Neuhauser Gasse
München-Kreuzviertel * Christoph Pollinger erwirbt die Brauerei in der Neuhauser Gasse.
Er nennt seine Brauerei „Zum Oberpollinger“, weil die Familie Pollinger in der Sendlinger Straße eine weitere Brauerei, den „Unterpollinger“, betreibt.
1585 - Das „herzogliche Weinverzeichnis“ umfasst 27 Weine jeder Qualität
München * Das „Weinverzeichnis des herzoglichen Haushofmeisters“ umfasst 27 Weine jeder Qualität.
1585 - In einer Bulle verbietet Papst Sixtus V. sämtliche Zauberbücher
Rom-Vatikan * In einer Bulle verbietet Papst Sixtus V. sämtliche Zauberbücher.
1586 - Noch immer sind keine Isarinseln vorhanden
München * Die „Beschreibung und Contrafractur der vornehmbsten Stätt der Welt“ von Braun und Hagenberg zeigt eine Ansicht von München.
Auch sie gibt nur die typischen, naturbelassenen Kiesbänke in der Isar wieder.
Isarinseln sind noch immer nicht vorhanden.
1586 - Mit dem „Weißbier“ ist durchaus Gewinn zu erzielen
München * Untersuchungen der „Hofkammer“ ergeben, dass aus dem „Weißbier“ durchaus Gewinn zu ziehen ist.
Voraussetzung ist die Errichtung eigener „Weißer Brauhäuser“ durch den Herzog.
Ab 1586 - In Oberstdorf werden etwa 25 Personen als „Hexen“ verbrannt
Oberstdorf * In dem zum „Hochstift Augsburg“ gehörenden Oberstdorf werden zwischen 1586 und 1587 etwa 25 Personen als „Hexen“ verbrannt.
3. 5 1586 - Herzog Ferdinand von Baiern lässt in Neudeck ein Brunnwerk erbauen
Au * Herzog Ferdinand von Baiern lässt zur Versorgung des großen Brunnens in seinem Münchner Garten am Neudeck ein Brunnwerk erbauen.
Außerdem kauft er die Neudecker Weiher.
Die Unterhaltung der Fischerei unterstand dem Hoffischer.
14. 6 1586 - Reichsfreiherr Ottheinrich von Schwarzenberg darf Weißbier brauen
Winzer * Reichsfreiherr Ottheinrich von Schwarzenberg erhält von Herzog Wilhelm V. das Recht, in seinem Brauhaus in Winzer Weißbier zu brauen und es im Herzogtum zu verkaufen.
In der Verleihungsurkunde lässt der Herzog einen Passus aufnehmen, der ihm und seinen Wittelsbacher Nachkommen im Falle des Aussterbens der Familie von Degenberg berechtigt, neben denen von Schwarzenberg selbst Weißbier zu brauen.
13. 9 1586 - Drei Wiedertäufer werden zum Tod mit dem Schwert verurteilt
München * Drei Wiedertäufer werden zum Tod mit dem Schwert verurteilt, weil sie trotz der Folter ihrem Glauben nicht abschwören wollen. Nach dem Verlesen des Todesurteils widerrufen zwei Delinquenten, weshalb nur ein Einziger hingerichtet wird.
1587 - Die „Brunnwerke“ am „Lilienberg“ und im „Brunnthal“ gehen in Betrieb
Au - Haidhausen * Die „herzoglichen Brunnwerke“ am „Lilienberg“ und im „Brunnthal“ gehen in Betrieb.
1587 - Zwischen 1587 und 1591 gibt es in Dillingen 17 weibliche Todesopfer
Dillingen * In dem zum „Hochstift Augsburg“ gehörenden Dillingen gibt es zwischen 1587 und 1591 aufgrund der „Hexenverfolgungen“ mindestens 17 weibliche Todesopfer.
8. 5 1587 - Herzog Victor Amadeus I. von Savoyen wird in Turin geboren
Turin • Herzog Victor Amadeus I. von Savoyen, der Vater von Henriette Adelaide, der späteren Kurfürstin von Baiern, wird in Turin geboren.
1588 - Im „Badischen Landrecht“ gilt für den „Teufelspakt“ die „Todesstrafe“
Baden * Auch im „Badischen Landrecht“ ist für den „Teufelspakt“ die „Todesstrafe“ vorgesehen.
Damit ist Baiern umzingelt.
Jetzt kann die Saat des „Hexenhammers“ auch in München und im Herzogtum Baiern aufgehen.
10. 1 1588 - Herzog Wilhelm V. muss dem Landtag Schulden bekannt geben
München * In München findet bis 6. April ein Landtag statt, auf dem Herzog Wilhelm V. den Ständen eine Schuldenlast von 1.992.736 Gulden bekanntgeben muss. Alleine 700.000 Gulden hat der Kölner Krieg verschlungen.
12 1588 - Die Kapläne müssen im Stadtbordell übernachten
München-Angerviertel * Beim Einsammeln des sogenannten „Leibpfennigs“ suchen die Kapläne Graßmann und Ostler von der „Sankt-Peters-Pfarrei“ auch das „Stadtbordell“ auf und zechen mit dem Wirt und seiner „Gesellschaft“.
Als sich die „genachbarten Knappen“ vor dem Haus zusammenrotten, wagen sie sich nicht mehr aus dem „Bordell“ und verbringen die Nacht in demselben.
1589 - Die Münchner Brauersgattin „Kalteneckerin“ wird der „Hexerei“ bezichtigt
München * Eine Münchner Brauersgattin namens „Kalteneckerin“ wird der „Hexerei“ bezichtigt und die Brauerei „von Gerichts wegen“ geschlossen.
1589 - Peter Binsfeld und sein Buch „Von Bekanntnuss der Zauberer und Hexen“
Trier * Peter Binsfeld, der „Weihbischof“ und „Generalvikar“ von Trier, veröffentlicht sein Buch „Von Bekanntnuss der Zauberer und Hexen“.
Er trägt damit entscheidend zur Förderung des „Hexenwahns“ bei und ist für die größten deutschen „Hexenverfolgungen“ des 16. Jahrhunderts, die von 1585 bis 1591 dauern, verantwortlich.
Binsfelds Buch ist hier weitaus einflussreicher als der „Hexenhammer“.
1589 - In Schwabmünchen beginnen die „Hexenverfolgungen“
Schwabmünchen * In dem zum „Hochstift Augsburg“ gehörenden Schwabmünchen beginnen die „Hexenverfolgungen“, wo der als „Hexenbischof“ bekannte Marquard II. vom Berg bald das Gefängnis erweitern lassen muss, um die Angeklagten unterzubringen.
Hierher kommt der Biberacher „Hexenspezialist“ Christoph Hiert.
Das Ergebnis des bischöflichen „Hexenwahns“ sind 27 Hinrichtungen.
1589 - Auch Ingolstadt wird vom „Hexenwahn“ ergriffen
Ingolstadt * Im Zuge der großen „Hexenverfolgungen“ im Herzogtum Baiern wird auch Ingolstadt vom „Hexenwahn“ ergriffen.
Mehrere unschuldige Frauen werden verhaftet, verhört und gefoltert.
Bis zum Jahr 1592 werden in Ingolstadt 13 unschuldige Frauen als „Hexen“ zum Tode verurteilt.
21. 1 1589 - Ein herzogliches Mandat erwähnt erstmal die Bäckerschelle
München * In einem von Herzog Wilhelm V. herausgegebenen Mandat wird erstmal die Bäckerschelle erwähnt. Sie ist zunächst als Strafe für Gotteslästerer und Flucher gedacht, wird aber ab 1596 auch für betrügerische Bäcker angewendet, die zu kleine Brote backen.
Um 3 1589 - Maximilian I. ist bei „Folterungen von Hexen“ anwesend
Ingolstadt * Maximilian I., Sohn Wilhelms V. und späterer baierischer Herzog und Kurfürst, studiert an der „Hohen Schule“ in Ingolstadt „Rechtswissenschaften“.
Sein Lehrer ist der „Doktor beider Rechte“ Johann Baptist Fickler, der „Hexerei“ als eine Realität betrachtet und sie als einen „Fluch des Teufels“ bezeichnet, dem mit „allen Strafmitteln“ begegnet werden muss.
Dem „Hexenwahn“ steht der studierte „Jurist“ ebenso mit Arglosigkeit und Kritiklosigkeit gegenüber, wie sein Zögling Herzog Maximilian I..
Man lässt den damals gerade 17-jährigen Prinzen der „Folterung von Hexen“ beiwohnen.
Nach solcher Vorbereitung auf den Regentenberuf kann es nicht überraschen, dass Maximilian I. der ärgste „Hexenverfolger“ unter den baierischen Fürsten wird.
7 1589 - Hexen-Verfolgung nach Hagelschäden und Ernteausfälle in Schongau
Schongau - München * Das Zentrum des „ersten altbaierischen Hexenprozesses“ ist Schongau bei Weilheim, das vom Bruder Wilhelms V., Herzog Ferdinand, verwaltet wird.
Herzog Ferdinand reagiert empfindlich, als ihm sein „Landrichter von Schongau“ von „Hagelschäden, Ernteausfällen“ und den damit verbundenen „Einnahmeverlusten“ berichtet.
Zum Glück kann „Richter“ Hans Friedrich Herwarth von Hohenburg gleich die für die Katastrophe Verantwortlichen benennen: die „Hexen“.
24. 7 1589 - Alle bösen Leute und Unholden sollen umgehend verhaftet werden
München - Schongau * Herzog Ferdinand befiehlt seinem Landrichter, alle „bösen Leute und Unholden“, denen er habhaft werden kann, umgehend zu verhaften. Ihre Wohnungen sollen nach Salben, Amuletten, wächsernen und durchstochenen Bildern, menschliche Knochen und ähnlichen Zaubermitteln durchsucht werden. Benennen die Angeklagten freiwillig Mitschuldige, soll man ihnen einen Straferlass versprechen.
Den Grund dafür, weshalb der „böse Feind“ an Macht gewonnen hat, sieht der Herzog im Zusammenhang mit dem sündhaften Leben der Untertanen. Nur deshalb lässt Gott dem Teufel und seinen Werkzeugen freie Hand. Die Pfarrer und Prediger im Landgericht Schongau sollen deshalb das Volk zur Buße und Besserung des Lebens ermahnen.
Herzog Ferdinand fordert zur Unterstützung der unerfahrenen baierischen Hexenjäger den darin geschulten Nachrichter von Biberach an.
Er soll die Verdächtigten auf „Hexenmale“ untersuchen.
„Dann wir gesinet, auf alle in Schwung geende und wachsende hochsträfliche Laster, sonderlich das ungeheur Unholdwerckh ernstliche Inquisition und Straf furnemmen“.
Ab 8 1589 - Der „Schongauer Hexenprozess“ beginnt
Schongau * In dem ohne gesetzliche Grundlage durchgeführten und „Hexenprozess“ werden unter rücksichtslosester Anwendung der „Folter“ die unsinnigsten Geständnisse erpresst.
Die Frauen gestehen unter anderem
- das „Wettermachen“,
- das „Töten von Tieren“ durch Beschmieren mit der „Hexensalbe“,
- das „Ausgraben und Sieden von Kindern“ zur Salbenherstellung,
- „sexuellen Umgang mit dem Teufel“ und
- „nächtliche Ausfahrten auf der Heugabel“ zu teuflischen Festen.
Die Aussagen der so gepeinigten Angeklagten werden mit einer entsprechenden Empfehlung des „Schongauer Landrichters“ Hans Friedrich Herwarth von Hohenberg an Herzog Ferdinand gesandt, der dann den „Hinrichtungsbefehl“ gibt.
1. 9 1589 - Sich katholisch erklären oder das Land verlassen
München * Der Weinsiegler Hanns Reiter und seine Ehefrau sollen sich bis Michaeli [29. September] „katholisch erklären“ oder das Land verlassen.
27. 9 1589 - Das Hofbräuhaus wird gegründet
München-Graggenau * Die Hofkammer will die Geldverschwendung für den Durst der Hofschranzen eingeschränkt sehen, weshalb sie einen Antrag für den Bau eines „aigen Preuhaus“ formuliert. Das Datum gilt seither als offizieller Gründungstermin des Hofbräuhauses.
Einen Brand beim alten Hennen- und Badhaus im Alten Hof erkennt man als Zeichen des Himmels und umgehend beginnen die Arbeiter in der Nähe des Zerwirkgewölbes die Wände einzureißen, die Keller einzuschachten und Sudanlagen zu installieren. Der Keller diente zuvor dem Herzogshof als Vorratsraum. Der Standort am Alten Hof kam den Verantwortlichen aufgrund der „besseren Überwachung bezüglich der möglichen Veruntreuungen“ gerade recht.
Darin wird zunächst nur braunes Bier gebraut.
28. 9 1589 - Hexenverfolgungen in der Grafschaft Werdenfels
Freising - Werdenfelser Land * In der zum Fürstbischof von Freising gehörenden Grafschaft Werdenfels beginnt mit der Verhaftung der 55-jährigen Ursula Klöck sowie Elsbeth Schlamp und ihre Tochter Appolonia eine große Hexenverfolgung, in deren Verlauf fünfzig Frauen und ein Mann der Hexerei beschuldigt werden.
Als Landesherr des Freisinger Kirchenstaates steht ebenfalls ein Bruder des baierischen Herzogs Wilhelm V. an der Spitze: Fürstbischof Ernst von Freising ist zugleich Kurfürst des Fürstbistums Köln am Rhein.
14. 10 1589 - Kostenvoranschlag für den Bau des Hofbräuhauses
München-Graggenau * Ein Kostenvoranschlag für den Bau des Hofbräuhauses wird vorgelegt.
30. 10 1589 - Anwendung der Folter bei den Werdenfelder Hexen
Freising - Werdenfelser Land * Aus Freising geht der Befehl in die Grafschaft Werdenfels, gegen die der Hexerei Angeklagten Ursula Klöck sowie Elsbeth Schlamp und ihre Tochter Appolonia die Folter anzuwenden.
Damit ist der Ausweitung des Hexenprozesses Tür und Tor geöffnet. Durch die über die Folter herausgepressten Geständnisse werden etwa 180 Personen in den Prozess einbezogen. Am Ende werden 50 Frauen und ein Mann der Hexerei schuldig befunden und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
15. 11 1589 - Philipp Apian stirbt in Tübingen
Tübingen * Der Mathematiker, Arzt, Kartograph und Heraldiker Philipp Apian stirbt in Tübingen.
1590 - Erste Gegenmaßnahmen zur Besiedelung der Au
Au * Die Au ist nach Auffassung des „herzoglichen Hofkastenamtes“ so stark besiedelt, dass man sich zu ersten Gegenmaßnahmen entschließt.
1590 - Herzog Wilhelm V. lässt in der „Herzog-Max-Burg“ Wein anpflanzen
München-Kreuzviertel * Herzog Wilhelm V. lässt im Hofgarten der späteren „Herzog-Max-Burg“ Wein anpflanzen.
Der daraus gekelterte Wein soll in manchen Jahren „bey 50 Eimer gehabt haben“ (= ca. 3.200 Liter).
Um 1590 - Ehefrauen Münchner Bierbrauer werden der Hexerei verdächtigt
München * Während der Hexenverfolgungen werden einige Ehefrauen Münchner Bierbrauer der Hexerei verdächtigt.
Darunter die Frauen des „Gilgenrainerbräus“ Viereck, des „Unterspatenbräus“ Jörg Spät und des „Kalteneckerbräus“ Galle Stoltz, der seine Brauerei „von Gericht wegen“ schließen musste. Betroffen war auch die Anna Freykamerin.
In einer Zeitung heißt es zu den Hexenverbrennungen: „Volgends um den anfang des Monats Julii sind irer bey fünffen in München verbranndt worden. Under welchen eine wolbekannte Prewin gewesen, die ausgesagt sol haben, wie sie und etlich hundert mit ir in dem Mertzenbier, eh sie dies ausgeschenkt, gebadet habe“.
Ab 1590 - In Oberstdorf werden noch einmal 68 Frauen als „Hexen“ verbrannt
Oberstdorf * In dem zum „Hochstift Augsburg“ gehörenden Oberstdorf werden zwischen 1590 und 1592 noch einmal 68 Frauen als „Hexen“ verbrannt.
Um 1590 - Im „Pfleggericht Rettenberg“ werden 25 „Hexen“ ermordet
Rettenberg * In dem zum „Hochstift Augsburg“ gehörenden „Pfleggericht Rettenberg“ werden 25 „Hexen“ ermordet.
10. 3 1590 - Die Einstellung gegenüber den Hexenverfolgungen ändert sich
<p><strong><em>München</em></strong> * Dr. Johann Georg Herwarth von Hohenburg wird zum Geheimen Rat und Obristkanzler ernannt. Mit seiner Berufung ändert sich die Einstellung gegenüber den Hexenverfolgungen. Der Jurist versucht diese mit den Mitteln des geltenden Strafprozessrechts einzudämmen und bestreitet jedes Ausnahmerecht.</p> <p>Der Grund dafür ist, dass hier Ermittlungen, Verfolgungen und Verurteilungen wegen Hexerei und Zauberei ohne entsprechende landesherrliche Gesetze und Vorgaben eingeleitet und vollstreckt werden. Zu zahlreich sind die Übergriffe und Unregelmäßigkeiten geworden.</p> <p>Um den gesetzlosen Zustand zu beenden, leitet Dr. Johann Georg Herwarth von Hohenburg - noch während im baierischen Herzogtum die Hexenprozesse in Schongau, Ingolstadt und München laufen - eine Gesetzgebung gegen das Hexenverbrechen und damit die Eindämmung der Hexenverfolgung im Herzogtum Baiern ein. </p>
2. 4 1590 - Gesetzgebung gegen das Hexenverbrechen
<p><strong><em>München</em></strong> * Herzog Wilhelm V. fordert zur Unterstützung des Verfahrens zur <em>„Gesetzgebung gegen das Hexenverbrechen“</em> vom Hofrat und von der juristischen und theologischen Fakultät der Universität Ingolstadt ein <em>„Gutachten über die zu ergreifenden Maßnahmen gegen die überhand nehmende Hexerei“</em> an.</p> <p>Darin führt der <em>Herzog</em> aus, Gott selbst habe wegen der schrecklichen Sünden der Menschen diese mit der <em>„neuen Pest der Hexerei“</em> gestraft. Und weil die <em>Hexerei</em> die größte aller Sünden wäre, würde Gott wiederum beleidigt werden. Er, Wilhelm V., sei als <em>Fürst</em> Gott verantwortlich und müsse durch <em>„Bestrafung und Ausrottung der Hexen“</em> die <em>„Ehre Gottes“</em> retten und wiederherstellen.</p> <p>Die Argumentation, dass sich nach dieser Logik Gott eigentlich selbst beleidige, wird ignoriert. Es geht auch nicht so sehr um die Ehre Gottes, sondern um die Angst vor weiteren göttlichen Strafen. </p>
6. 4 1590 - Die Hexen-Gutachten des Hofrats und der Universität Ingolstadt
<p><strong><em>München - Ingolstadt</em></strong> * In dem <em>Gutachten des Hofrates</em> werden zunächst ausdrücklich die Meinungen derjenigen protestantischen <em>Hexenverfolger</em> zurückgewiesen, die gemäßigt auftreten. Dazu gehören Johannes Brenz aus Stuttgart und seine Anhänger, die jede Möglichkeit eines tatsächlichen <em>Wetterzaubers</em> abstreiten. Wetter sind eine Angelegenheit der Natur oder Gottes, nicht aber Sache <em>„alter Weiber“</em> oder gar des <em>„Teufels“</em>.</p> <ul> <li>Nach dem Hofratsgutachten ist den Katholiken künftig jeder Zweifel an der Existenz der Hexen, des Teufelspakts, des Hexenflugs und des Schadenszaubers ebenso verboten wie jede inhaltliche Kritik. </li> <li>Auch das von vier Theologieprofessoren ausgearbeitete Ingolstädter Gutachten,kommt zum Ergebnis, dass <em>„die Obrigkeit mit Eifer und Strenge gegen die Hexen“</em> vorgehen und es den Untertanen zur Pflicht machen soll, <em>„Verdächtige zu denunzieren“</em>. </li> </ul> <p>Die Gutachten folgen alleine den katholischen Autoren und unter diesen wiederum nur denjenigen, die die härtesten Ansichten zur Hexenverfolgung vertreten, die jemals in der europäischen dämonologischen und juristischen Literatur zum Hexenprozess geäußert worden sind. </p>
5 1590 - DerHofrat erlässt die „Gemeine General Instruction“
München * Der Hofrat erlässt die „Gemeine General Instruction. Wie sich alle und jede Pfleger, Richter und Beamte [...] mit den Unholden und Hexenwerckhs verleumbden Personen in Erkennung, Einziehung und Besprachung [...] zu verhalten haben.“ Damit ist die Strafbarkeit des Hexereidelikts im baierischen Herzogtum landesherrlich gebilligt. Die Verrechtlichung des Hexerei-Tatbestands führt zunächst aber zum Rückgang der Verfolgungen.
Den zuständigen Unterbeamten erscheint die Einleitung eines Verfahrens juristisch offensichtlich zu kompliziert und risikoreich. Und nicht jeder Landrichter ist Jesuitenschüler und versteht die dahinter stehende theologische Logik. Hinzu kommen die Widersprüchlichkeiten der Hexenprozess-Ordnung und die ständig eintreffenden einschränkenden Vorgaben.
14. 5 1590 - Der Student Maximilian I. berichtet völlig unberührt von den Folterungen
Ingolstadt - München * In mehreren Briefen, unter anderem in dem vom 14. Mai 1590, berichtet der Student Maximilian I. - völlig unberührt - an seinen Vater von den entsetzlichsten Folterungen, die er in den Ingolstädter Hexenprozessen erlebt hat. Auch nach seinem Regierungsantritt huldigt der Herzog und Kurfürst Maximilian I. dem Hexenwahn.
Um 6 1590 - In München findet ein erster Hexenprozess statt
München * In München findet ein Hexenprozess statt, in dessen Zusammenhang vier Frauen verbrannt werden. Der Münchner Falkenturm fungiert als Hexenturm.
Leider haben sich die Akten nur lückenhaft überliefert, sodass weder ein Zusammenhang des Hexenprozesses mit dem Einsturz des Turms der Michaelskirche, noch mit der Nennung von vier Brauerinnen hergestellt und bewiesen werden kann. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es auch wesentlich mehr als die vier bekannten Opfer gewesen sein können.
2. 7 1590 - Der von Herzog Wilhelm V. ausgehende Hexenprozess ist zu Ende
München * Der von Herzog Wilhelm V. ausgehende Hexenprozess ist zu Ende. Die Anklage gegen vier „Weibspersonen“ unterschiedlichen Alters lautet auf
- Buhlschaft mit dem Teufel,
- Leichenraub und Leichenschändung,
- Hostienentweihung sowie
- Hexerei.
Die vier Frauen, Anna Anbacherin, Brigitte Anbacherin, Regina Bollingerin und Regina Lutzin, machen die üblichen Geständnisse: Ausfahrt mit dem Teufel über Felder und in verschiedene Weinkeller. Eine andere gestand, sie habe ein totes Kindlein auf dem Gottesacker vor dem Sendlinger Thor ausgegraben und daraus eine wässrige, zähe und wasserfarbige Salbe bereitet.
Aufgrund des erdrückenden Beweismaterials werden alle vier Frauen als Hexen zum Tode verurteilt. Wegen ihres hohen Alters werden sie - auf Fürbitte hoher fürstlicher Personen - vorher erdrosselt und danach ihre geschundenen Körper verbrannt.
Um den 14. 8 1590 - Der venezianische Goldmacher Marco Bragadino in Landshut
Landshut * Der weithin bekannte venezianische Goldmacher Marco Antonio Bragadino reitet auf einem Berberhengst durch das Landshuter Stadttor ein. Er ist mit den erlesensten und teuersten Stoffen gekleidet und wird von Dienern und zwei großen schwarzen Doggen begleitet.
Der anwesende baierische Herzog Wilhelm V. begrüßt den vornehmen Ankömmling mit überschwänglicher Freude. Der Baiernregent erhofft sich von dem Fremden die Lösung seiner gesundheitlichen und - vor allem - seiner finanziellen Probleme, da dieser mit dem „Lapis philosophorum” den Stein der Weisen besitzt.
3. 9 1590 - Marco Bragadino berichtet nach Padua
Landshut * Marco Bragadino berichtet in einem Brief nach Padua über seine Erfahrungen mit Herzog Wilhelm V.:
„Ich befinde mich bei diesem Fürsten von Baiern, einem Herrn voll der frömmsten Gedanken und Sitten und jeder einzigartigen Tugend, der mich liebt und so sehr meine völlige Zufriedenheit wünscht, dass ich wirklich sagen kann, ich sei der eigentliche Herr und Gebieter, ja noch mehr sagen könnte, wenn ich es wagte“.
4. 9 1590 - Der Goldmacher Marco Bragadino reist nach Augsburg
Landshut - Augsburg * Der Goldmacher Marco Bragadino reist von Landshut nach Augsburg, um dort Chemikalien für seine Kunst einzukaufen.
10. 9 1590 - Marco Bragadino lässt seine Familia aus Padua nachkommen
Padua - Landshut * Marco Bragadino lässt seine „Familia“ aus Padua nachkommen. Der Zug mit insgesamt elf Personen macht sich auf den Weg nach Landshut. Die Reisegruppe kommt aber nur langsam voran, da Bragadinos Lebensgefährtin Laura Canova, eine verwitwete Vilmerca, hochschwanger ist, nicht reiten darf und deshalb in einer Sänfte reisen muss, was die Reisekosten enorm in die Höhe treibt.
19. 9 1590 - Marco Bragadinos Familia erreicht Landshut
Landshut * Marco Bragadinos Familia erreicht die Tore von Landshut. Marco Bragadino ist nicht in der Stadt, da er am 4. September 1590 nach Augsburg aufgebrochen ist, um dort Chemikalien einzukaufen. Seine Rückreise geht über München.
24. 9 1590 - Instruktion über die Behandlung von Unholden
München * Herzog Wilhelm V. erlässt für seine Richter eine „Instruktion über die Behandlung von Unholden und des Hexenwerks verdächtige Personen“.
Um den 28. 9 1590 - Marco Bragadino trifft wieder in Landshut ein
Landshut * Marco Bragadino trifft wieder in der niederbaierischen Residenzstadt ein.
10 1590 - Den „Hexenmalen“ kommt keine Beweiskraft mehr zu
Ingolstadt * In einem Gutachten der „Universität Ingolstadt“ gegenüber der „Hochstiftlichen Regierung in Freising“ wird festgestellt, dass den von den „Scharfrichtern“ ermittelten „Hexenmalen“ keine Beweiskraft mehr zukommt, weil sich ein „so gewöhnlicher und verworfener Mensch“ wie ein „Nachrichter“ bei der „Erkennung der Hexenzeichen“ durchaus täuschen könne.
Damit ist die sogenannte „Nadelprobe“, die zum hoch geschätzten Gutachterwissen der „Scharfrichter“ gehört, für das Verfahren wertlos geworden.
16. 10 1590 - Der unerwartete Tod der Herzogin Anna
Landshut * Durch den unerwarteten Tod der Herzogin Anna, der Mutter Herzog Wilhelms V., wird der Aufenthalt auf der Burg Trausnitz in Landshut für die Herzogsfamilie und der Gefolgschaft des Goldmachers Marco Bragadino jäh beendet.
18. 10 1590 - Der Alchemist Marco Bragadino trifft in München ein
München-Kreuzviertel * Der Alchemist Marco Bragadino trifft in München ein. Vermutlich wohnt der Goldmacher mit seinem Gefolge wie sein Auftraggeber in der Wilhelminischen Veste, der heutigen Herzog-Max-Burg. Dadurch kann der Herzog viele Stunden mit seinem neuen Günstling verbringen, ohne dass dies großes Aufsehen erregt.
1591 - „Die Zauberer sollst du nicht leben lassen“
München * In München erscheint das „Tractat von Bekanntnuß der Zauberer und Hexen“ in deutscher Sprache, das der Trierer „Weihbischof“ Peter Binsfeld verfasst hat und darin die Forderung „die Zauberer sollst du nicht leben lassen“ erhebt.
??? 1591 - Dreiunddreißig Jesuiten ziehen in das neue Kolleg ein
München-Kreuzviertel * Dreiunddreißig Jesuiten ziehen in das neue Kolleg ein.
1591 - Herzog Wilhelm V. beklagt sich über die „Unmoral“ in der Stadt
München * Herzog Wilhelm V. beklagt sich über die stark überhand nehmende „Unmoral“ in der Stadt.
Dabei haben selbst die Repräsentanten der Amtskirche Probleme mit der eigenen „Lust“.
Nur in einem sehr schwierigen Prozess gelingt es, die geistlichen Herren auf Dauer von ihren - „Schlafweiber“ genannten - „Konkubinen“ zu trennen.
1591 - Die Familie Pämb lebt im „Kelheimer Armenhaus“
Kelheim * Anna Pämb [50] lebt mit ihrem Mann Paulus [48] und den Söhnen Gumpprecht [13], Michael [11] und Hansel [ein Jahr alt] im „Kelheimer Armenhaus“.
Vater Paulus bietet seine Arbeitskraft als „Kesselflicker“ an.
Mit seinen älteren Söhnen verdingt er sich auch als „Abortgrubenräumer“, als sogenannter „Pappenheimer“.
Im „Armenhaus“ von Kelheim lernt Anna Pämb eine gewisse Zieglerin kennen.
Die Frauen verstehen sich auf Anhieb.
1591 - Peter Binsfelds Buch erscheint in München in deutscher Sprache
München * Peter Binsfelds Buch „Von Bekanntnuss der Zauberer und Hexen“ erscheint in München in deutscher Sprache.
Der Münchner „Stadtgerichtsassessor“ Bernhard Vogel hat das Werk aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt.
Der „Verleger“ Adam Berg lässt es im Einverständnis mit dem „Geistlichen Rat“ drucken.
Gewidmet ist das Buch „Von Bekanntnuss der Zauberer und Hexen“ Herzog Ferdinand, der den „Schongauer Hexenprozess“ der Jahre 1589/90 führte und nachträglich für seine abscheuliche Tat gerühmt werden soll.
Adam Berg schreibt im Vorwort des Buches, dass es gerade jetzt notwendig sei, da man „zu diser zeit etliche Personen finden möchte, die sagen dörfften, man thue den Leuthen unrecht“.
Das Buch verfolge also vornehmlich den Zweck, „das diejenigen, so irgent hierinn zweiflen, ein Bericht haben und nit also freventlich die hohe Obrigkeit in Straffung solcher Laster urtheilen und Nachreden“.
24. 3 1591 - Der Alchemist und Goldmacher Marco Bragadino wird verhaftet
München * Der Alchemist und Goldmacher Marco Bragadino wird - auf Betreiben der Landstände und ohne Wissen des Herzogs Wilhelm V. - verhaftet.
1. 11 1591 - Das Braune Hofbräuhaus wird als hochmoderne Musteranlage eingerichtet
München-Graggenau * Am Allerheiligen-Tag ist das Werk endlich vollendet. Heimeran Pongraz richtet das Braune Hofbräuhaus als hochmoderne Musteranlage ein.
- Während in anderen Braustätten noch die Maische von Hand geschöpft und die Würze in Holzkübeln geschleppt werden muss, läuft bei Pongraz fast alles über Leitungen.
- Es gibt eine rechteckige kupferne Sudpfanne, die man mit einem offenen Feuer aus Fichtenholz beheizt.
- Über eine Rinne aus Lärchenholz läuft die Maische zum runden eichenen Maischbottich.
- Abgeläutert wird durch die schmalen Schlitze eines Bretterbodens.
- Dampfend fließt die Würze dann in die beiden Kühlschiffe aus Lärchenholz und von dort durch eine Bleileitung zu den Gärbottichen im Keller.
Der ledige Braumeister muss während des Brauvorgangs im Brauhaus schlafen, um bei Bedarf jederzeit eingreifen zu können. Sein Einkommen beträgt bei freier Kost und Logis vierzig Gulden im Jahr.
5. 11 1591 - Die beiden letzten Werdenfelser Hexen werden hingerichtet
Werdenfelser Land * Mit Brigitta Krätzler und Barbara Feurer werden die beiden letzten Beschuldigten des Werdenfelser Hexenprozesses hingerichtet. Dann endet zunächst die Hexenverfolgung im Werdenfelser Land. Das liegt einerseits am verstärkt auftretenden Widerstand aus der Bevölkerung, andererseits an den hohen Kosten.
Alleine der Nachrichter erhält für jede Besichtigung zwei Gulden, dazu täglich ein Wartegeld von zwei Gulden und für jede Hinrichtung nochmal acht Gulden. Auch Verpflegung und Unterkunft trägt die Staatskasse. Insgesamt kostet der Werdenfelser Hexenprozess rund 4.000 Gulden.
Am Ende dieser Verfolgungs-Periode zählt man 49 auf dem Scheiterhaufen zum Teil lebendig verbrannter Angeschuldigter, zum Teil werden sie vorher erwürgt oder geköpft. Zwei Frauen sterben während ihres Gefängnisaufenthalts, eine davon verübt Selbstmord.
14. 12 1591 - Herzog Wilhelm V. befiehlt den Eid auf den Glauben abzulegen
München * Herzog Wilhelm V. befiehlt, dass neben den Beamten auch alle Offiziere, bürgerliche Obrigkeiten, Stadt- und Marktschreiber, Gerichtsprokuratoren und Schulmeister den „Eid auf den Glauben“ ablegen müssen.
1592 - Die „Schongauer Hexenverfolgung“ endet mit der Hinrichtung von 63 Frauen
Schongau * Nach einem drei Jahre dauernden Prozess endet die „Schongauer Hexenverfolgung“ mit der Hinrichtung von 63 Frauen durch das Schwert.
Die Leichen der „Hexen“ werden anschließend verbrannt.
1593 - Die Jurisdiktion über den Haidhauser Jesuitengarten
Haidhausen - Taufkirchen * Die Jurisdiktion über den Haidhauser Jesuitengarten wird von der Jesuiten-Hofmark Taufkirchen wahrgenommen.
1593 - Die „Eberlbrauerei“ und der „Faberbräu“ werden gegründet
München-Angerviertel * Die „Eberlbrauerei“ und der „Faberbräu“ werden gegründet.
Ihre Sud- und Schankstätten befinden sich in der Sendlinger Straße.
1593 - Spaltung und innere Reform des „Karmeliter-Ordens“
Rom * Reformbewegungen führen zur Spaltung und zur inneren Reform des „Karmeliter-Ordens“.
Die Hauptträger der Erneuerung des „Karmels“ - Theresia von Avila und Johannes vom Kreuz - greifen auf die alten Regeln, ohne die späteren Milderungen, zurück.
Im Volk nennt man die Mitglieder dieser Reformklöster die „Unbeschuhten Karmeliter“.
Nach langen Konflikten losen sich die „Unbeschuhten Karmeliter“ vom „Beschuhten“ Stammorden los.
Der Papst will die „Unbeschuhten“, ähnlich wie die anderen Reformorden, vordringlich zur Erneuerung des kirchlichen Lebens in den Städten, zur Abwehr der „Häretiker“ und zur Ausbreitung des Glaubens in den Missionsgebieten einsetzen.
1593 - Herzog Wilhelm V. muss erneut um die Übernahme seiner Schulden bitten
München * Herzog Wilhelm V. muss den „Landtag“ erneut um die Übernahme seiner Schulden in Höhe von 1.300.000 Gulden bitten.
Seit 1593 - Erbprinz Maximilian I. ist als Vertreter in Regierungsangelegenheiten tätig
München * Der 20-jährige Erbprinz Maximilian I. ist als Vertreter seines Vaters Herzog Wilhelm V. in Regierungsangelegenheiten tätig.
1593 - Der „Bildhauer“ Hubert Gerhard erschafft die „Mondsichelmadonna“
München * Der „Bildhauer“ Hubert Gerhard erschafft die mit 2,17 Meter überlebensgroße, ursprünglich feuervergoldete und als Bronzehohlguss hergestellte „Mondsichelmadonna“, die im Jahr 1638 auf der „Mariensäule“ Aufstellung fand.
Sie gilt als das Hauptwerk Hubert Gerhards.
Seit 1594 - Der „Reichstag“ tagt nur noch im „Regensburger Rathaus“
Regensburg * Der „Reichstag“, die „Ständevertretung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“, tagt bis dahin in unregelmäßigen Abständen in verschiedenen Städten.
Seither wird er nur noch im „Reichssaal“ des „Regensburger Rathauses“ abgehalten.
1595 - Die „Stadtschreiberei“ und das „Amt für Goldwäscherei“ ziehen ins Tal
München-Graggenau * Die „Stadtschreiberei“ und das „Amt für Goldwäscherei“ ziehen in das „Ridlerhaus“ im Tal um.
Der „Weinstadel“ bleibt im Haus Dienerstraße 20/ Burgstraße 5.
Um 1595 - Johann Tserclaes Graf von Tilly tritt in kaiserliche Dienste ein
Wien * Johann Tserclaes Graf von Tilly tritt in kaiserliche Dienste ein und steigt bis 1605 zum „Feldmarschall“ auf.
1595 - Kurfürst Ernst von Köln ziehst zu seiner Mätresse
Arnsberg * Um seiner Mätresse Gertrud von Plettberg näher zu sein, zieht sich Ernst, der Kurfürst von Köln und Chef der fünf Bistümer Köln, Freising, Hildesheim, Lüttich und Münster, in seine Arnsberger Neben-Residenz zurück.
Dort hat er zwischenzeitlich das Palais „Landsberger Hof“ errichten lassen.
Gemeinsam mit Gertrud von Plettberg hat Bischof Ernst einen Sohn: Wilhelm Freiherr von Höllinghofen.
Er wird anno 1650 zum „Fürstabt der Reichsabtei Stablo-Malmedy“ ernannt.
Außerdem wird der 17-jährige Baiernprinz Ferdinand zum „Koadjutor“ (= Nachfolger) seines Onkels Ernst auf dem Kölner Bischofsstuhl gewählt.
1. 1 1595 - Herzog Maximilian I. regiert mit seinem Vater
München * Herzog Wilhelm V. überträgt seinem Sohn Maximilian I. die Mitregierung in Form der Stellvertretung. Die Landstände hatten den Herzog aufgrund seiner Verschuldung und der Unordnung in der Hof- und Staatsverwaltung zu diesem Schritt gedrängt. Doch die „Verwirrung im Finanzwesen“ wird durch die Doppelregierung noch schlimmer. Es wird eine Abdankung auf Raten.
6. 2 1595 - Maximilian I. und Elisabeth Renata heiraten in Nancy
Nancy • Herzog Maximilian I. von Baiern und Herzogin Elisabeth Renata von Lothringen heiraten in Nancy.
15. 5 1595 - Ein Mailänder Seidenhändler will sich in München niederlassen
München * Da die Nachfrage nach Seidenartikeln im Herzogtum Baiern unverändert hoch ist, versuchen italienische Handelsleute die Marktlücke zu schließen. Deshalb will sich der Mailänder Händler Hieronymus Peverollj in München niederlassen und „einen handsladen von sament unnd seyden aufrichten“.
Herzog Maximilian I. empfiehlt in einem Schreiben dem Rat der Stadt die Annahme des Gesuchs, „weil man dann die Waren soll wohlfeiler haben können, wan man nicht immer an einen handlsman gebunden ist [...]. Auch Wir hätten bei diesem vorschlag nuz vnd vortheil“.
Der Münchner Bürgermeister informiert vor der Zusage und „zur verhüettung khonftiger Irrung“ zuerst die „handlsleuth und Cramer“, die allerdings keinerlei Bedenken äußern.
18. 11 1595 - Die letzte Meldung über das Münchner Frauenhaus
München * Die letzte Meldung über das Münchner Frauenhaus taucht auf. An diesem Tag wird dem Hanns Ernst und seiner Hausfrau Rosina Selberin, „verschidener zeit gewester wirtin im gemainen haus alhie“, von der Stadtkammer die zehn Gulden Büßerinnen-Prämie ausbezahlt, die man jeder Prostituierten überreicht, wenn sie aus dem Bordell ausscheidet.
1596 - Erstmalige Gedanken der Eingemeindung der Au
München-Kreuzviertel - Au * Als Ersatz für die 34 Bürgerhäuser, die dem Bau der „Michaelskirche“ geopfert werden müssen, befasst sich der Magistrat der Stadt München erstmals mit dem Gedanken der Eingemeindung der Au.
Man nimmt aber wieder Abstand davon, nachdem Herzog Wilhelm V. auf eine jährliche Steuer von 600 Gulden verzichtet.
1596 - Herzog Wilhelm V. ermahnt den Münchner Rat
München * Herzog Wilhelm V. ermahnt den Münchner Rat, „fleißiger auf die bösen Weiber zu achten, die die Kindlein verzaubern“.
19. 8 1596 - Herzog Friedrich V. wird in Amberg geboren
Amberg * Friedrich V., der spätere Kurfürst von der Pfalz und böhmische König wird in Amberg geboren.
10 1596 - Maximilan I. fordert Informationen über herzogliche „Brauberechtigungen“
München * Herzog Maximilan I. fordert Informationen über noch geltende herzogliche „Brauberechtigungen“, über bestehende Brauhäuser und deren Ertragskraft und über geeignete Orte zur Gründung neuer Brauhäuser - unabhängig von der Biersorte - an.
3. 12 1596 - Hinrichtung eines Wiedertäufers
München * Peter Ungelter, ein aus Augsburg stammender Weber, wird als Wiedertäufer mit dem Strang hingerichtet. Noch am Vortag erklärte er, dass er sich bekehren würde. Als ihm jedoch der Priester erklärte, dass er dennoch sterben müsse, bleibt Ungelter seinem Glauben treu.
18. 12 1596 - Fürstbischof Philipp Wilhelm wird Kardinal
Regensburg - Rom * Der Regensburger Fürstbischof Philipp Wilhelm wird im Alter von 20 Jahren von Papst Clemens VIII. zum Kardinal erhoben.
1597 - Hanns Spätt ist Müller auf der „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Hanns Spätt ist Müller auf der „Giesinger Mühle“.
1597 - Die Münchner Marianische Kongregation wird geteilt
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Die erste Münchner Marianische Kongregation hat einen großen Mitgliederzulauf, sodass eine Teilung der zu groß gewordenen Kongregation notwendig wird. </p> <ul> <li>Die Schüler des Lyzeums vereinen sich mit den Adeligen, Hofbeamten und Akademikern in der <em>„Congregatio Maior“</em>, die wegen der Lateinkenntnisse ihrer Mitglieder auch die <em>„Lateinische“</em> genannt wird. </li> <li>In der <em>„Congregatio Minor“</em> versammeln sich die Schüler des Gymnasiums, die jüngeren Studenten, sowie die lateinunkundigen Bürger. </li> </ul>
19. 6 1597 - Herzog Wilhelm V. soll - zur Verhütung des Staatsbankrotts - abdanken
München * Eine eingesetzte Kommission verlangt zur Verhütung des Staatsbankrotts die Abdankung von Herzog Wilhelm V..
15. 10 1597 - Das Herzogtum Baiern steht vor dem Staatsbankrott
München * Herzog Wilhelm V. verzichtet zugunsten seines Sohnes Maximilian I. auf die Regierung des Herzogtums. Der Grund ist hauptsächlich in der Verschuldung Baierns zu suchen. Das Land steht kurz vor dem Generalanstand, also dem Staatsbankrott.
23. 12 1597 - Herzog Maximilian I. wird mit dem Herzogtum Baiern belehnt
Wien - München * Herzog Maximilian I. wird vom Kaiser mit dem Herzogtum Baiern belehnt.
1598 - 778 Gemälde gesammelt
München - Landshut * Die Wittelsbacher Herzöge haben bereits 778 Gemälde zusammengetragen - und sie sammeln weiter.
1598 - Eine „Zaubergesellschaft“ sitzt in der Schergenstube in Haft
<p><strong><em>München</em></strong> * Eine aus 18 Personen bestehende <em>„Zaubergesellschaft“</em> sitzt in der Schergenstube in Haft, deren Mitglieder </p> <ul> <li>Zauberbücher und glückbringende Alraunenwurzeln besaßen, </li> <li>sich unter dem Galgen oder</li> <li>in der oberen Stube des Alexander Freisinger in der Au trafen und dort Beschwörungen zur Wiedergewinnung gestohlener oder verlorener Sachen und <em>„Ansegnungen gegen den bösen Feind“</em> betrieben.</li> </ul> <p>Eine eigene Ratskommission wird gebildet, die sich aus Mitgliedern des Inneren und Äußeren Rats zusammensetzt.</p> <p>Die Urteile sind vergleichsweise glimpflich.</p> <ul> <li>Die meisten werden auf die <em>„Schragen“</em> gestellt, zum Teil mit umgehängten Zauberbüchern. Diese Strafe ist - im Gegensatz zum Pranger - nicht <em>„ehrlos“</em>.</li> <li>Einige werden zusätzlich zu den Jesuiten zur Beichte und Kommunion geschickt,</li> <li>zwei erhalten eine Geldstrafe und</li> <li>einer wurde zu vier Jahren <em>„gegen den Erbfeind der Christenheit“</em>, die Türken, verurteilt. </li> </ul>
1598 - Rezeptur für den Stein der Weisen
<p><em><strong>Stolberg-Weringerode</strong></em> * Der <em>Alchemist</em> Essaias Stumpfeld bietet dem <em>Fürsten</em> von Stolberg-Wernigerode die Rezeptur für den <em>Stein der Weisen</em> an. Bei einer Arbeitsprobe entstehen wenige kleine rote <em>„Rubinlein“</em>, die aus Arsen-, Antimon- und Quecksilbersulfid bestehen. Und tatsächlich kann man scheinbar mit den <em>„Rubinlein“</em> Silber in Gold verwandeln. Denn wenn man ein Silberblech mit den <em>„Rubinlein“</em> bedampft, erscheint dieses unter dem dünnen, gelben Belag von Arsensulfid golden. </p>
18. 1 1598 - Erzherzog Ferdinand II. bedankt sich für die erteilte Ehedispens
Wien - Rom-Vatikan * Erzherzog Ferdinand II. bedankt sich bei Papst Clemens VIII. für die erteilte Ehedispens mit Herzogin Maria Anna von Baiern. Zuvor waren von protestantischer Seite Angriffe auf das Paar unternommen worden.
Beanstandet wurden der beträchtliche Altersunterschied, wobei die 24-jährige Maria Anna lediglich vier Jahre älter als Ferdinand II. war, dann die Hässlichkeit der Braut und schließlich die nahe Verwandtschaft der Geschwisterkinder. [Ferdinands Mutter Erzherzogin Maria war die Schwester von Maria Annas Vater Wilhelm V..] Schon deshalb musste der päpstlicher Dispens eingeholt werden.
4. 2 1598 - Die Untertanen werden auf Herzog Maximilian I. vereidigt
München * Die Beamten, Lehensvasallen und Untertanen werden von ihrem Eid gegenüber Herzog Wilhelm V. entbunden und auf Herzog Maximilian I. vereidigt.
13. 3 1598 - Maximilian I. erlässt ein ausführliches Religions- und Sittenmandat
<p><strong><em>München</em></strong> * Herzog Maximilian I. erlässt ein ausführliches <em>„Religions- und Sittenmandat“</em>. Zur Überwachung der Vorschriften werden eigens geheime Kundschafter, sogenannte <em>„Aufsteher“</em>, bestellt. Diese Spitzel müssen jede Übertretung des Mandats anzeigen.</p> <ul> <li>Auf Fluchen werden Strafen bis zum Verlust von Gliedmaßen und bis zum Tode ausgesetzt.</li> <li>Übertretungen des Fastengebots müssen angezeigt werden.</li> <li>Andersgläubige, auch Wiedertäufer, werden im Land nicht mehr geduldet.</li> <li>Nach ketzerischen Büchern wird ohne Voranmeldung gefahndet.</li> <li>Priesterkonkubinen werden verfolgt, gegen Unzucht, Leichtfertigkeit und ungebührliches Spielen werden Strafen ausgesetzt.</li> </ul>
21. 5 1598 - Kardinal Philipp Wilhelm stirbt in Dachau
Dachau * Der 21-jährige Kardinal und Fürstbischof von Regensburg, Philipp Wilhelm, stirbt in Dachau. Er wird in der Münchner Frauenkirche beigesetzt.
1599 - Im Rentamt Straubing gibt es über zwanzig Weißbier-Baustätten
<p><strong><em>Straubing</em></strong> * Alleine im Rentamt Straubing gibt es über zwanzig Weißbier-Baustätten.</p>
1600 - München zählt achtzig Brauereien
München * Mit 74 bürgerlichen Brauereien - plus 6 Klosterbrauereien - erreicht man den Höchststand in der Geschichte Münchens.
Ab 1600 - Vollständige Erneuerung des „Isarberg-Brunnhauses“
Au * Die durchgeführte vollständige Erneuerung des „Isarberg-Brunnhauses“ verschlingt über 5.000 Gulden.
Um das Jahr 1600 - Fragen nach den Ursachen der Armut
<p><strong><em>München</em></strong> * Unter Herzog Maximilian I. wird erstmals nach den Ursachen der Armut gefragt. Folgende Erkenntnisse fassen die Untersucher zusammen: Verantwortlich für die Armut ist</p> <ul> <li>die Überbevölkerung der Städte,</li> <li>die Überbesetzung der Zünfte und Gewerbe,</li> <li>die allzu großen Freiheiten des Handels,</li> <li>die Vernachlässigung der Polizeigewalt und</li> <li>der Verfall der Religion und der Sitten.</li> </ul> <p>Das Ergebnis ist die Einführung restriktiver Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem Zuzugsbeschränkungen sowie Festnahmen und Einkerkerung von Bettlern und Vagabunden.</p>
1600 - München hat 18.000 Einwohner
München * München hat 18.000 Einwohner.
2 1600 - Die Familie Pämb lebt beim Kleinbauern Ulrich Schölz bei Riedenburg
<p><strong><em>Altmannstein</em></strong> * Die Familie Pämb lebt beim Kleinbauern Ulrich Schölz bei Riedenburg. Da taucht der Amtmann von Altmannstein auf und verhaftet die komplette Familie bis auf den inzwischen zehnjährigen Hansel, der bei den Bauersleuten zurückbleibt. Ein verurteilter, inzwischen in Wörth an der Isar hingerichteter Dieb namens Geindl hat die beiden Pämb-Brüder Michael und Gumpprecht als angebliche Komplizen angeschwärzt.</p> <p>Schnell kann der wahre Hintergrund aufgeklärt werden. Geindl und Michael Pämb haben sich einmal geschlägert, wobei Geindl unterlegen ist. Wutentbrannt hat der Dieb danach geschworen, er werde es den Pämbs schon noch heimzahlen.</p> <p>Der Amtmann sieht ein, dass die Denunziation wohl nur ein Racheakt gewesen war, schickte das Protokoll nach München und wartet auf die Nachricht, dass die Familie freizulassen sei. </p>
3 1600 - Der Münchner Hofrat ordnet die Folter an
<p><strong><em>Altmannstein</em></strong> * Die aus München kommende Antwort ordnet die <em>„hochnotpeinliche Befragung“</em> der Familie Pämb an. Unter der Tortur der Folterknechte gestehen die 59-jährige Anna, der 57-jährige Paulus und die Söhne Michael [20] sowie Gumpprecht [22] jede Menge Diebstähle, Brandstiftungen und Raubüberfälle. Michael und Gumpprecht bekennen sich zudem, <em>„Hexer“</em> zu sein.</p> <p>So wirr, unlogisch und widersprüchlich die unter der Folter erpressten <em>„Geständnisse“</em> auch sind, der Altmannsteiner Amtmann verständigt daraufhin umgehend den Hofrat in München. </p>
16. 4 1600 - Die Familie Pämb wird im Falkenturm eingekerkert
Altmannstein - München * Die Familie Pämb nach München überführt und im Falkenturm eingekerkert. Die Männer kommen in einzelne, „Keuchen“ genannte Zellen. Nur Hansel durfte bei seiner Mutter bleiben. Nun beginnt der sogenannte Pappenheimer-Prozess.
17. 4 1600 - Eine vierköpfige Kommission untersucht die Landfahrerfamilie Pämb
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Eine vierköpfige Kommission untersucht die <em>Landfahrerfamilie</em> Pämb. Auf Wunsch von Herzog Maximilian I. soll zunächst geprüft werden, ob sich die Familie tatsächlich für ein öffentlichkeitswirksames Exempel eignet. Die Kommission scheint zufrieden. Denn vor ihnen stehen zwei alte, ausgezehrte Menschen und zwei Burschen, die alle vier bereits durch die <em>Folter</em> gezeichnet sind, dazu ein zehnjähriges Kind. Sie sind davon überzeugt: diesen Delinquenten kann man alles mögliche andichten, auch eine <em>Teufelsanbetung</em>. Begeistert erstattet man dem Herzog davon Bericht.</p> <p>Den <em>Hexen-Prozess</em> leitet der <em>Hofratskommissar </em>Dr. Johann Simon Wagnereckh. Zunächst befragt er den kleinen Hansel. Mit anwesend sind dabei die <em>Hofräte</em> Jacob Hainmüller und Ernst von Roming, ein <em>Schreiber</em> sowie der <em>Eisenmeister</em> Sebastian Georg, der zugleich der Verwalter des <em>Falkenturms </em>und oberster <em>Folterknecht</em> ist.</p> <p>Zunächst soll Hansel nur sagen, ob seine Brüder jemals <em>abgeschnittene Kinderhände</em> mit sich geführt hätten. Schockiert schüttelt Hansel den Kopf und gab damit das Zeichen für die <em>Folterknechte</em>. Nach der <em>Tortur</em> gesteht der Zehnjährige alles, was man ihm an Unterstellungen über seine Brüder eingeredet hat. </p> <ul> <li>Ja, sie haben Kindern die Hände abgeschnitten,</li> <li>ja, sie haben Schwangere ermordet, um an die Hände der Ungeborenen zu kommen.</li> <li><em>„Ja“</em>, immer wieder <em>„ja“</em>. </li> </ul>
19. 4 1600 - Die „Inquisitoren“ nehmen sich den Vater Paulus Pämb vor
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Die Inquisitoren nehmen sich den Vater Paulus Pämb vor. Er kommt an den Wippgalgen, bei dem man an nach hinten gestreckten Armen und einem Gewicht an den Füßen hochgezogen wird. Auch sein Widerstand bricht schnell und er bestätigt jede nur mögliche Grausamkeit, die man ihm und seinen erwachsenen Söhnen unterstellt.</p> <p>Die Verhandlungsführer gehen immer nach dem gleichen Muster vor. Die gewünschten Antworten werden quasi vorformuliert und müssen von dem Opfer nur noch bestätigt werden. Was dann im Geständnis steht, ist also in der Regel der Phantasie der Befrager entsprungen.</p>
23. 4 1600 - Herzogin Maria Anna wird mit Erzherzog Ferdinand II. verheiratet
Wien * Maria Anna, die Schwester von Herzog Maximilian I., wird mit Erzherzog Ferdinand II. von Innerösterreich, dem späteren Kaiser, verheiratet.
Um den 24. 4 1600 - Nach dem Vater muss Michael Pämb in den Wippgalgen
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Nach dem Vater muss Michael in den Wippgalgen. Doch der Bursche hält länger durch als sein Vater. Erst als man ihn zusätzlich mit einer brennenden Fackel unter den Achseln foltert, ist auch sein Wille gebrochen. Er bestätigt, dass er Kinderhände zum Zaubern genutzt hat, gesteht Morde, Brandstiftungen, Einbrüche, Raubzüge und alle sonstigen Verbrechen, die man ihm suggeriert. Die Mutter habe ihm das Hexen beigebracht.</p> <p>Bei seinem älteren Bruder Gumpprecht erzwingen die Folterknechte die Bestätigung für alles sowie weitere Gräueltaten. </p>
28. 4 1600 - Zuletzt widmen sich die Hofräte der betagten Mutter Anna Pämb
München-Graggenau * Zuletzt widmen sich Hofkommissar Dr. Johann Simon Wagnereckh und die Hofräte Hainmüller und Roming der betagten Mutter Anna. Bei ihr fragt man nicht erst nach Morden oder anderen Verbrechen, sondern widmet sich gleich dem schlimmsten aller Verbrechen: der Hexerei und Teufelsanbetung. Dabei steht gar nicht zur Frage, ob sie eine Hexe sei. Das wird als Tatsache vorausgesetzt.
Die gemarterte Frau erfindet äußerst wilde Geschichten von der alten Zieglerin und dem Knecht, der der Satan gewesen sei, um den Qualen endlich ein Ende zu bereiten. Insgesamt gibt Anna Pämb zu, dass sie 100 Kinder und 19 alte Menschen mit ihren Zauberkünsten brutal ermordet habe. Ferner nennt sie rund 400 weitere Personen, die ebenfalls Hexerei betreiben.
Um den 30. 4 1600 - Die alte Anna „Pämbin“ widerruft sie ihre Aussage
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Einige Tage nach ihrem Folterverhör, nachdem sich die alte <em>„Pämbin“</em> wieder ein wenig erholt hat, widerruft sie ihre Aussage. Der Widerruf führt sie jedoch direkt zurück in die Folterkammer, wo sie erneut alles zugibt, was ihr die Inquisitoren des Herzogs Maximilian I. unterstellen. </p>
5 1600 - Die Familie des Klostermüllers wird der Hexerei bezichtigt
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Unter der Tortur bezichtigen die Pämbs auch die Familie des Klostermüllers aus dem niederbaierischen Tettenwang der Hexerei. </p> <p>Der Klostermüller, seine Frau Anna und beider Tochter Agnes, später auch Ursula genannt, sowie weitere Bekannte der Pämbs werden umgehend verhaftet, nach München gebracht und dort so lange gefoltert, bis auch sie grauenhafte, hexerische Untaten gestehen.</p> <p>Dabei hatte der Klostermüller von Tettenwang den Pämbs lediglich geholfen und den fahrenden Bettlern Unterkunft und Essen gewährt. </p>
5 1600 - Ein zusätzlicher „Hexenturm“ muss eingerichtet werden
<p><strong><em>München-Graggenau</em> </strong>* Zur Erpressung von Geständnissen unter der Anwendung der Folter gehört auch das Denunzieren von Mitmenschen als Hexen, Zauberer und Teufelsbündler.</p> <p>Es war deshalb nicht verwunderlich, dass bei Erreichen des Höhepunkts der Hexenverfolgung im Herzogtum Baiern der Falkenturm bald überfüllt ist und aus diesem Grund ein Stadtmauerturm, unmittelbar neben der Alten Münze, als zusätzlicher <em>„Hexenturm“</em> eingerichtet werden muss. </p>
5 1600 - Paulus, Michael und Gumpprecht bestätigen, selbst „Hexer“ zu sein
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Paulus, Michael und Gumpprecht bestätigen im Lauf der nächsten Wochen, selbst <em>„Hexer“</em> zu sein, den Teufel anzubeten und grässliche Verbrechen, die sie durch <em>„Zauberei“</em> begangen haben.</p> <ul> <li>Paulus Pämb hat im <em>„Dienst des Teufels“</em> 44 Morde begangen.</li> <li>Gumpprecht hat sogar 54 Menschen auf seinem jungen Gewissen und</li> <li>als ganz besonders blutrünstig erweist sich Michael mit 103 Morden.</li> </ul> <p>Dass die über 300-fachen Mörder außerdem unzählige Schadenzauber, Diebstähle und Brandstiftungen begangen haben, spielt da kaum noch eine Rolle.</p> <p>Aufgrund der Denunziation werden zwei ihrer skrupellosen Gefährten verhaftet und mit den Pämbs vor Gericht gestellt: der Bauer Ulrich Schölz sowie ein Schneider namens Georg Schmälzl, die ebenfalls gefoltert und zu <em>„Geständnissen“</em> gezwungen werden. Einzig den kleinen Hansel verschont man mit weiteren Folterungen. </p>
26. 7 1600 - Die Hofkommissare fällen ihr Urteil im Pappenheimer-Prozess
München * Die Hofkommissare unter der Leitung von Dr. Johann Simon Wagnereckh fällen ihr Urteil. Nachdem sie es ausformuliert haben, begeben sie sich in den Falkenturm, wo sie den Malifikanten die Geständnisse vorlesen.
Es ist üblich, den Delinquenten drei Tage vor der Hinrichtung diese sogenannten Urgichten noch einmal zur Kenntnis zu geben, damit sie die Gelegenheit zur Korrektur haben und eventuell Denunziationen zu widerrufen. Aus panischer Angst vor weiteren Folterungen verzichten die Pämbs und ihre Mitangeklagten darauf, den Urgichten zu widersprechen. Danach gewährt man ihnen eine Henkersmahlzeit, die auch gebratenes Fleisch und Wein umfasst.
29. 7 1600 - Der elfjährige Hansel Pämb muss der Hinrichtung seiner Eltern beiwohnen
München-Maxvorstadt * Das wohl mit weitem Abstand Verabscheuungswürdigste der Hinrichtung aber ist, dass der inzwischen elfjährige Hansel Pämb, auf dem Pferd des Bußamtmanns sitzend, der qualvollen Hinrichtung seiner Eltern und Brüder beiwohnen muss. Doch auch dem Kind bleibt der spätere Feuertod nicht erspart, da Hansel ja schon „im Mutterleibe dem Teufel geweiht und an seiner Stelle ein anderes gestohlenes Kind getauft worden sei“.
29. 7 1600 - Die herzogliche Justiz demonstriert ihre unvorstellbare Bestialität
München * Nun demonstriert die herzogliche Justiz ihre unvorstellbare Bestialität. Noch auf der Freitreppe des Rathauses reißen der Henker und seine Helfer den Männern mit glühenden Zangen jeweils sechs Fleischstücke aus den Armen und dem Oberkörper. Danach schneidet man Anna Pämb die Brüste ab und schmiert sie ihr und den beiden Söhnen dreimal „umb das Maul“, mit dem Hinweis, dass aus diesen Brüsten solche abscheuliche Bubenstücke „gesogen“ wurden.
Schließlich verfrachtet man die Schwerstverwundeten auf zwei Schandkarren, um sie zum Galgenberg zu bringen, der vor den Toren der Stadt liegt, etwa an der Stelle, an der heute die Hackerbrücke auf die Landsberger Straße trifft. Tausende Schaulustige begleiten die Wagen, Hansel Pämb reitet auf dem Pferd des Bußamtmanns mit.
29. 7 1600 - „Die Teufelsbrut wird verbrannt“
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Am Galgenberg werden die fünf Männer gerädert. Dazu bindet man die Malefikanten auf ein scharfkantiges Balkengerüst und zerschmettert ihnen mit einem eisenbeschlagenen Richtrad die Gliedmaßen. Für gewöhnlich beginnt diese Bestialität bei den Unterschenkeln. Die Zahl und der Rhythmus der Schläge sowie die Reihenfolge der Gliedmaßen sind genau vorgeschrieben. Paulus Pämb wird nun zusätzlich <em>„gespießt“</em>. Der Henker rammt ihm einen kurzen Jagdspieß durch den After in den Unterleib.</p> <p>Der letzte Akt der Justizwillkür im Namen des Herzogs Maximilian I. ist der Feuertod. Man zerrt die Pämbs und ihre Bekannten zu ihren Scheiterhaufen, bindet sie an - Anna setzt man dabei auf einen Stuhl- und verbrennt die <em>„Teufelsbrut“</em> lebendig und <em>„unter jämmerlichem Geschrei“</em>. </p>
11. 8 1600 - Agnes Klostermüller wird elfmal aufgezogen
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Die zwanzigjährige Agnes Klostermüller wird elfmal <em>„aufgezogen“</em>, davon zehnmal belastet mit einem fünfzig Pfund schweren Stein. Das Mädchen bleibt standhaft, obwohl ihm alle Glieder zerrissen werden. Nichts, außer der Beteuerung ihrer Unschuld, ist aus ihr herauszubringen.</p> <p>Vor dem Beginn der Folter spricht Hofrat Dr. Johann Simon Wagnereckh lateinische Verse und Psalme über sie, um sie zu <em>„entzaubern“</em>. Da hier der Name Jesus vorkommt, sagt Agnes Klostermüller: <em>„sie wolle diesen Jesus nit </em>[in dessen Namen man Unschuldige martert] <em>sondern wolle den haben, der sie erschaffen und für sie am Stamme des Kreuzes gelitten“</em>.</p> <p>Nach der Folter lässt man Agnes für etwa zehn Wochen in Ruhe. </p>
20. 10 1600 - Agnes Klostermüller wird erneut zur Tortur geschleppt
München-Graggenau * Agnes Klostermüller wird erneut zur Tortur geschleppt. Dann, nach viermaligen Aufziehen ist ihre Kraft endgültig gebrochen.
24. 10 1600 - Ein Selbstmordversuch der Agnes Klostermüller scheitert
München-Graggenau * Ein Selbstmordversuch der eingesperrten und gefolterten Agnes Klostermüller scheitert. Gebrochen und verzweifelt erzählt sie nun alles, was man von ihr hören will:
- „Sie habe eine Menge Kinder umgebracht,
- habe an dreißig Herzlein [von Kindern] gegessen,
- habe acht alte Leute durch Bestreichen mit der Salbe getötet,
- sei ausgefahren, besonders zu Brunn im Schloss in den Keller, wo sie guten Wein getrunken.
- Des Edelmanns Weib dort habe sie ‚erkrümbt‘.
- Sie habe an 20 Rinder gefällt, vielen Kühen die Milch benommen, fünf Wetter [...] gemacht.“
13. 11 1600 - Papst Clemens VIII. teilt den Karmeliter-Orden auf
Vatikan * Papst Clemens VIII. teilt den Karmeliter-Orden in zwei selbstständige Kongregationen auf.
- In eine Spanische, die für die Länder der spanischen Krone, also Spanien, Portugal und Mexiko, zuständig ist.
- Und in eine Italienische, die sich in der übrigen Welt ausbreiten soll.
26. 11 1600 - Die Scheiterhaufen lodern auf dem Münchner Galgenberg erneut
München-Maxvorstadt * Die Scheiterhaufen auf dem Münchner Galgenberg lodern erneut. Diesmal befindet sich neben der Agnes Klostermüller und ihrer Mutter Anna, der Weber Hans Stumpf, Glashansl genannt, und der Brotträger Augustin Baumann. Auch der elfjährige Hansel Pämb wird dem Feuer übergeben.
Der alte Klostermüller stirbt noch im Falkenturm. Es ist ungewiss, ob an den Qualen der Folter oder durch einen Selbstmord.
1601 - Der Baiernprinz Ferdinand wird Bischof im Bistum Lüttich
Lüttich * Der Baiernprinz Ferdinand wird Bischof im Bistum Lüttich.
1602 - Schauspieler haben einen schlechten Leumund
München * In der „Haußpolicey“ findet man zu den Schauspielern folgenden Text:
„Nicht die geringste ursach warumb die Jugent in die unzucht und geilheit gerahtet seind die Comedien Spektackel und Schawspiel / welche an etlichen orten an den Fürstlichen Höfen oder in den Heusern der Mechtigen oder in den offentlichen darzu bestimbten Heusern gehalten werden.
Dann sie [die Schauspieler] seindt gemeinklich eitele / liderliche / verschlagene / arglistige / unverschambte und gottlose leut / ja was mehr ist / man findt under jhnen Landverwisene / ehvergessene / Landstürtzer / Zigeiner und arge Ketzer.“
Es ist die Zeit der „Gegenreformation“ und schon deshalb hat alleine das „Schauspiel der Jesuiten“ Niveau und ist staatlicherseits legitimiert worden.
10. 6 1602 - Hans VIII. von Degenberg stirbt ohne Nachkommen
Degenberg * Hans VIII. von Degenberg stirbt ohne Nachkommen. Damit geht aufgrund eines Erbschaftsvertrags aus dem Jahr 1488 der gesamte Herrschafts- und Besitzkomplex in den Besitz der Wittelsbacher über.
1. 8 1602 - Das weiße Brauwesen wie gewohnt weiterführen
Degenberg * Der Degenbergische Pfleger und Bräuverwalter Leonhard Mair wird beauftragt das weiße Brauwesen wie bisher und mit dem selben Personal als landesherrliches Unternehmen weiterzuführen. Das ist die Geburtsstunde des wittelsbachischen Weißbierbrauwesens. Die Brauereien befinden sich in Schwarzlach, Zwiesel und Linden.
Weil auch sämtliche weiteren Einnahmen der Degenberger Güter an den Herzog gehen kommt es zu einem langjährigen Rechtsstreit.
1603 - Der „Karmeliter-Pater“ Dominicus a Jesu Maria ist in Rom tätig
Rom * Der „Karmeliter-Pater“ Dominicus a Jesu Maria ist in Rom tätig.
1604 - Der heilige Benno wird zum „Stadtpatron Münchens“ erklärt
München-Kreuzviertel * Der heilige Benno wird von Herzog Maximilian I. zum „Stadtpatron Münchens“ erklärt.
Der triumphbogenartige „Bennobogen“ wird in der „Frauenkirche“ erstellt.
1605 - Herzog Maximilian I. zahlt freiwillig eine jährlich fällige Strafe
München * Der „Landtag“ beschäftigt sich mit dem herzoglichen „Weißbier-Brauwesen“ mit heftiger Kritik.
Herzog Maximilian I. zahlt freiwillig jährlich eine sogenannte „Komposition“ in Höhe von 10.000 Gulden.
1605 - Das „Herzogliche Hofbräuhaus“ verzeichnet einen Reingewinn
München-Graggenau * Das „Herzogliche Hofbräuhaus“ braut insgesamt 2.256 „Eimer“ Winter- und Sommerbier.
Da ein „Eimer“ 64 Liter fasst, sind das 1.444 Hektoliter.
Davon werden 705 „Eimer“ an die Münchner Bevölkerung verkauft, weshalb die Bilanz mit einem Reingewinn von fast 200 Gulden abschließt.
1606 - Die Madonnenfigur kommt auf den Hochaltar der „Frauenkirche“
München-Kreuzviertel * Die vergoldete Madonnenfigur, die später die „Mariensäule“ schmücken soll, kommt auf den provisorischen Hochaltar der „Frauenkirche“.
1606 - Herzog Maximilian I. gestaltet das Hochgrab Kaiser Ludwigs des Baiern um
München-Kreuzviertel * Herzog Maximilian I. lässt das Hochgrab des Kaisers Ludwig des Baiern abbauen. Die Deckenplatte wird jetzt nur knapp über dem Boden verlegt.
10. 2 1606 - Christine Marie von Frankreich kommt in Paris zur Welt
Paris • Christine Marie von Frankreich, die spätere Mutter der baierischen Kurfürstin Henriette Adelaide, kommt in Paris zur Welt.
26. 4 1606 - Die protestantische Mehrheit verprügelt spontan die Katholiken
Donauwörth * In Donauwörth zieht die katholische Minderheit - unter Verletzung des „Augsburger Religionsfriedens“ - aus Anlass einer jährlich stattfindenden „Bittprozession“ mit „fliegenden Fahnen“ vom „Kloster Heiligenkreuz“ aus.
Es kommt zum Konflikt mit der protestantischen Mehrheit, die die Katholiken spontan verprügelt.
Donauwörth ist eine der acht „Freien Reichsstädte“, in denen nach den Bestimmungen des „Augsburger Religionsfriedens“ Katholiken und Protestanten das „Recht freier Religionsausübung“ genießen.
6 1606 - „Kapuziner, Kapuziner, Speck, Speck!“
Donauwörth * Laurentius von Brindisi, ein führendes Mitglied des Kapuzinerordens, befindet sich auf dem Weg ins kaiserliche Wien. In der Reichsstadt Donauwörth wird er von einer Menge umzingelt und mit den Worten „Kapuziner, Kapuziner, Speck, Speck!“ verunglimpft und am Weitergehen behindert.
1607 - Feuchtfröhliche Turminspektion
München-Angerviertel * Als man den abgebrannten Turm der „Peterskirche“ inspiziert, trinken die Beauftragten 27 Mass Wein.
1607 - Das „Hofbräuhaus“ darf nur mehr „zur Nothdurft des Hofstaates“ brauen
München-Graggenau * Der Erfolg des „Herzoglichen Hofbräuhauses“ bringt die bürgerlichen Brauer derart in Rage, dass sie sich über die staatliche Konkurrenz beschweren.
Das „Hofbräuhaus“ darf ab 1607 nur mehr „zur Nothdurft des Hofstaates“ brauen.
26. 2 1607 - Prozess ums Weißbiermonopol
Degenberg * Die Erben der Degenberger führen einen langjährigen Prozess gegen den baierischen Herzog. Maximilian I. erhält zwar den gesamten Degenbergischen Herrschaftsbesitz, muss dafür aber 62.000 Gulden bezahlen. So viel ist ihm aber das Weißbiermonopol wert.
16. 3 1607 - Kaiser Rudolf II. bevollmächtigt Herzog Maximilian I. zum Kampf
Wien - München - Donauwörth * Kaiser Rudolf II. bevollmächtigt Herzog Maximilian I. mit dem Schutz der katholischen Minderheit von Donauwörth.
26. 4 1607 - Die Protestanten belagern das „Kloster Heiligkreuz“ in Donauwörth
Donauwörth * Zur nächsten „Markusprozession“ schickt der Kaiser „Kommissare“ nach Donauwörth, die einen geregelten Ablauf sicherstellen sollen.
Doch die Protestanten belagern das „Kloster Heiligkreuz“ und lassen weder die „Kommissare“ noch die „Katholiken“ zur Prozession aus dem Kloster.
Der ausschließlich aus Protestanten bestehende Stadtrat toleriert dieses Verhalten.
3. 8 1607 - Kaiser Rudolf II. verhängt die Reichsacht über Donauwörth
Wien - Donauwörth * Kaiser Rudolf II. verhängt - auf Antrag Herzog Maximilians I. - die Reichsacht über Donauwörth und beauftragt den baierischen Herzog mit ihrer Exekution.
17. 12 1607 - Donauwörth muss vor der baierischen Militärmacht kapitulieren
Donauwörth * Donauwörth muss vor der baierischen Militärmacht kapitulieren.
1608 - In Haidhausen wird der sogenannte „Johannesdreißiger“ gefeiert
Haidhausen * Zu Ehren des heiligen „Johannes Baptist“ wird jährlich zwischen dem 24. Juni und dem 25. Juli in Haidhausen der sogenannte „Johannesdreißiger“ gefeiert.
1608 - Die „schwarze Christlin“ kommt mit etlichen „Ansegenweibern“ in Haft
München * Die „schwarze Christlin“ mit etlichen „Ansegenweibern, die sich des Ansegnens und Zauberwerks gebrauchen“ kommen in Haft.
4 1608 - Auf dem „Regensburger Reichstag“ kommt es zum Eklat
Regensburg * Auf dem „Regensburger Reichstag“ kommt es zum Eklat zwischen Protestanten und Katholiken.
Die katholischen Fürsten stellen einen Antrag auf „Restitution aller Kirchengüter“, die seit 1552 säkularisiert worden sind.
Davon betroffen wären rund 500 Klöster und Konvente vor allem in Niedersachsen und Württemberg, die Erzbistümer Bremen und Magdeburg sowie 15 reichsunmittelbare Bistümer in Norddeutschland.
Die protestantischen „Landesstände“ verlassen daraufhin den „Reichstag“.
Das „Restitutionsedikt“ wird erst 1629 beschlossen.
12. 4 1608 - Dr. Wagnereckh präsentiert sein Aberglaubens- und Hexenmandat
<p><strong><em>München</em></strong> * Dr. Johann Simon Wagnereckh präsentiert einen ersten Entwurf des von ihm ausgearbeiteten baierischen Aberglaubens- und Hexenmandat. Mehrere Räte kritisierten seine <em>„übergroße Schärfe“</em>.</p> <p>Zu einer Verabschiedung des Mandats kommt es nicht mehr, weil dadurch ein Machtkampf zwischen den Zelanten [= Eiferer] und den Politikern ausgebrochen ist und sich die beiden Gruppen gegenseitig blockieren. </p>
5 1608 - Der „Beyerin von Winden“ wird der „Hexen“-Prozess gemacht
Markt Schwaben * Der „Beyerin von Winden“, einer Bäuerin aus der Gegend um Markt Schwaben, wird der Prozess gemacht.
„Ankläger“ ist erneut der „Hofrat“ Dr. Johann Simon Wagnereckh.
Es kommt wiederholt zur Auseinandersetzung mit dem „Hofoberrichter“ Dr. Bernhard Barth von Hermatingen, sodass sich der Prozess monatelang hinzieht und die Frau im Mai 1608 einen Selbstmord verübt.
14. 5 1608 - Die protestantischen Stände gründen die Union
Auhausen * Aufgrund der Donauwörther Ereignisse und zunehmender Spannungen mit den Katholiken gründen protestantische Reichsstände in Auhausen an der Wörnitz im Fürstentum Ansbach die Union, ein Defensivbündnis. Durch den Beitritt weiterer Stände wächst die Zahl der Mitglieder auf insgesamt acht Fürsten, den Grafen von Oettingen und 17 Städte an.
Christian I. von Anhalt-Bernburg übernimmt das Direktorium der Union, die er durch Bündnisse mit England, den Niederlanden und Schweden außenpolitisch absichert.
26. 5 1608 - Schadenszauber und Hexerei auch in Donauwörth
Donauwörth * Während der Fronleichnams-Prozession geht ein schweres Gewitter über der Stadt Donauwörth nieder, das man sich nur mit Schadenszauber und Hexerei erklären kann. Birgit Schuster und Paul Ritter werden als Verursacher des Unwetters verhaftet.
Birgit Schuster gesteht unter der Tortur, nennt über hundert weitere Hexen und wird verbrannt. Paul Ritter wird ebenfalls den Flammen übergeben. Durch die Denunziation werden weitere 17 „Unholdinnen“ angeklagt.
13. 7 1608 - Ferdinand III., der spätere Kaiser, wird in Graz geboren
Graz * Ferdinand III., der spätere Kaiser, wird in Graz geboren.
1609 - Herzog Maximilian I. will eine Verbesserung der Stadtbefestigung
München * Herzog Maximilian I. will eine Verbesserung der mittelalterlichen Stadtbefestigung, da diese den Anforderungen der neuen Kriegstechnik nicht mehr entspricht.
Der Stadtmagistrat lehnt den Vorschlag aus Kostengründen ab.
3 1609 - Der „Donauwörther Hexenprozess“ greift auf Wemding über
Wemding * Der „Donauwörther Hexenprozess“ greift durch Denunziation auf Wemding über.
Auch der dortige „Pfleger“ Konrad Bemelberg d. J., der Sohn des Donauwörther „Statthalters“, erhält vom Münchner „Hofrat“ Dr. Johann Simon Wagnereckh eine „Blankovollmacht“ zur „Folteranwendung“.
Das Amt des „Richters“ übt Dr. Gottfried Sattler aus.
Neun Frauen und ein Mann werden daraufhin der „Hexerei“ bezichtigt und später hingerichtet.
3. 6 1609 - Der Kaiser überlässt dem baierischen Herzog die Reichsstadt Donauwörth
München - Wien * Herzog Maximilian I. präsentiert dem Kaiser für die Exekution von Donauwörth eine Rechnung in Höhe von 255.403 Gulden. Kaiser Rudolf II. verpfändet daraufhin dem baierischen Herzog dafür die Reichsstadt Donauwörth. Maximilian I. lässt umgehend die Ausübung des protestantischen Glaubens verbieten und führt die Gegenreformation und damit die Rekatholisierung ein.
9. 7 1609 - Kaiser Rudolf II. stellt den Majestätsbrief aus
Prag * Kaiser Rudolf II. und zugleich König von Böhmen stellt den sogenannten Majestätsbrief aus. Er gewährt den evangelischen Landständen des Königreichs Böhmen besondere Privilegien zu. Der Majestätsbrief beinhaltet
- das Recht der Stände den König zu wählen,
- er erlaubt den Protestanten den Bau von Kirchen und Schulen in den Städten und auf dem Land,
- er beendet die gegenreformatorischen Bestrebungen der katholischen Adeligen, indem er die gewaltsame Bekehrung der Untertanen verbietet, und
- er überträgt den Protestanten die bis dahin angeeigneten Kirchengüter.
10. 7 1609 - In München gründen katholische Fürsten die Liga
München * In München gründen katholische Fürsten die Liga, die zunächst nur ein Bündnis oberdeutscher katholischer Reichsstände darstellt. Baierns Herzog Maximilian I. wird ihr Bundesoberst.
30. 7 1609 - Die drei geistlichen Kurfürsten treten der katholischen Liga bei
München * Die drei geistlichen Kurfürsten (Köln, Mainz, Trier) treten der katholischen Liga bei.
1610 - Die „Liga“ wird in ein oberländisches und ein rheinisches Direktorium geteilt
München - Mainz * Die „Liga“ wird in ein oberländisches und ein rheinisches Direktorium unter der Leitung von Maximilian I. und dem Mainzer Kurfürsten eingeteilt.
Die militärische Leitung der Gesamt-“Liga“ bleibt beim baierischen Herzog.
Johann Tserclaes Graf von Tilly wird „Bundesfeldherr der katholischen Liga“.
1610 - Die Baumaßnahmen für den zukünftigen „Hofgarten“ beginnen
München-Graggenau * Die Baumaßnahmen für den zukünftigen „Hofgarten“ beginnen im Osten.
Sie dauern bis 1620.
Der Garten wird beträchtlich vergrößert und erreicht etwa seine heutige Dimension.
13. 1 1610 - Die Kaisertochter Maria Anna wird in Graz geboren
Graz • Maria Anna, die Tochter des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II. und der baierischen Herzogin Maria Anna, spätere zweite Ehefrau des baierischen Kurfürsten Maximilian I., kommt in Graz zur Welt.
30. 3 1610 - Friedrich Förner erlässt für Bamberg ein „Aberglaubens- und Hexenmandat“
Bamberg * Friedrich Förner hat in Bamberg ein „Aberglaubens- und Hexenmandat“ erlassen.
5 1610 - Der „Gerichtsbezirk ob der Au negst München“ wird geschaffen
Au - Haidhausen - Untergiesing * Der „Gerichtsbezirk ob der Au negst München“ wird wegen seiner besonderen Sozialstruktur geschaffen.
Die vergleichsweise große Einwohnerzahl der Ortschaften Haidhausen, Au und Niedergiesing, das sich in der Gegend um den heutigen „Nockherberg“ befindet, und der daraus resultierende Verwaltungs- und Jurisdiktionsbedarf erfordert diese Sonderstellung.
Gerade auch deshalb, weil das „Landgericht“ weit entfernt liegt und der „Richter von Wolfratshausen“ sowie der „Amtmann von Perlach“ den Verhältnissen nicht mehr gewachsen sind.
In einem ersten Schritt werden diese Orte dem „Hofoberrichter“ unterstellt.
Um 5 1610 - „Hofrat“ Wagnereckh legt sein „Aberglaubens- und Hexenmandat“ vor
München * Noch während die „Wemdinger Hexenprozesse“ laufen, nutzt der „Hofratskanzler“ Dr. Johann Simon Wagnereckh die Gunst der Stunde und bringt seinen abgeschmetterten Vorschlag für ein „Aberglaubens- und Hexenmandat“ wieder aufs Tablett.
3. 6 1610 - Die dritte Marianische Kongregation für München wird gegründet
München-Kreuzviertel * Durch den anhaltend großen Zulauf wird von 17 Münchner Bürgern im Jesuitengymnasium eine dritte, die „Marianische deutsche Kongregation der Herren und Bürger zu unserer Lieben Frau Verkündigung“ gegründet.
6. 6 1610 - Das erste Kloster des Ordens der Heimsuchung Mariens gegründet
Annecy • Das erste Kloster des Ordens der Heimsuchung Mariens wird in Annecy, der Stadt, in der Franz von Sales als Bischof lebt, gegründet. Der Orden wird von Franz von Sales und Franziska von Chantal gegründet.
Die Ordensgründer wollen mit diesem Namen die aktive Tätigkeit des Neuen Ordens ausdrücken: Heimsuchungsschwestern sollten Arme, Kranke und Bedürftige daheim aufsuchen, um sie zu unterstützen.
10 1610 - Ein „Aberglaubens- und Hexenmandat“ für das „Hochstift Augsburg“
Augsburg * Bischof Heinrich V. von Knöringen erlässt ein entsprechendes „Aberglaubens- und Hexenmandat“ für das „Hochstift Augsburg“.
Sie alle stehen damit in einer Linie mit den fränkischen Bischöfen und den Fürsten in München sowie Köln und zählten zu den von Papst Urban VIII. so bezeichneten „Zelanten“.
5. 11 1610 - Die Kongregation wird der römischen Mutterkongregation angegliedert
Rom * Die Martialische Deutsche Kongregation der Herren und Bürger zu Unserer Lieben Frauen Verkündigung wird der Marianischen Mutterkongregation in Rom angegliedert.
1611 - Vom Weinanbau in der „Herzog-Max-Burg“
München-Kreuzviertel * Der Augsburger Patrizier Philipp Hainhofer berichtet vom Weinanbau in der „Herzog-Max-Burg“ folgendes:
„[...] haben Sie mir zur nachtmahlzeit zwo grosse Flaschen ihres [Münchner] gewächß geschickhet, als ein rotten, den Sie Rappes [Kräuterwein, Würzwein] nennen, und ein schiller [rosafarbener Wein], der so schön im glaß, als wannß ein Carfunkel were, und kein schönern Wein nie gesehen habe und ist nit nur schön, sondern auch guet darneben“.
1611 - Ein Befehl zur „Ausweisung der Priesterkonkubinen“
München * Der Münchner Rat verhält sich gegenüber der Ausweisung der „Schlafweiber“ weiterhin so zurückhaltend, dass in den Jahren 1611, 1612 und 1613 der „Befehl wegen Ausweisung der Priesterkonkubinen“ von Herzog Maximilian I. wiederholt werden muss.
Der Befehl sieht bei der Vernehmung der „Konkubinen“ auch die Anwendung des „Daumenstocks“ vor.
1611 - „Landgebot gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und Teufelskünste“
München * Herzog Maximilian I. erlässt ein „Landgebot gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“.
1611 - Das „Weiße Brauhaus“ in München erwirtschaftet alleine 10.438 Gulden
München-Graggenau * Das „Weiße Brauhaus“ in München erwirtschaftet im Rechnungsjahr 1610/11 alleine 10.438 Gulden.
24. 1 1611 - Dr. Cosmas Vagh legt dem Hofrat sein Hexen-Mandat vor
München * Der Jurist Dr. Cosmas Vagh, der wegen seinen Positionen und seiner Härte in der Hexenverfolgung berüchtigt ist, hat ein „Landgebott wider die Aberglauben, Zauberey, Hexerey und andere sträffliche Teuffelskünste“ verfasst, das er nun persönlich dem Gremium des Hofrats in aller Ausführlichkeit vorträgt. Zuvor war es inhaltlich mit den Jesuiten abgestimmt worden. Die Hofräte verabschieden das Hexen-Mandat noch in der gleichen Sitzung.
2 1611 - Das baierische „Aberglaubens- und Hexenmandat“ geht in Druck
München * Abschließend wird das baierische „Aberglaubens- und Hexenmandat“ dem „Hofratskanzler“ Dr. Johann Simon Wagnereckh zur abschließenden Kontrolle vorgelegt, bevor es in der Druckerei der „Anna Bergin wittib“ im Februar 1611 auf Papier gebracht wird.
Wie so oft, handelt „Hofratskanzler“ Wagnereckh auch hier wieder eigenmächtig.
Das Werk geht in Druck, bevor es Herzog Maximilian I. unterzeichnet hat - und damit nicht rechtskräftig ist.
12. 2 1611 - Das baierische Aberglaubens- und Hexenmandat liegt gedruckt vor
München * Das „Herzogliche Baierische Mandat gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“ liegt in gedruckter Form vor.
28. 3 1611 - Der Geheime Rat will das Hexen-Mandat nicht veröffentlichen
München * Der Geheime Rat kann sich erst jetzt mit dem Hexen-Mandat befassen. Er nimmt - besonders an den Paragraphen, in denen es um die Konfiszierung von Eigentum geht - umfangreiche Korrekturen vor und erklärt, dass er das Mandat in der vorliegenden gedruckten Form nicht veröffentlichen will.
23. 5 1611 - Die Böhmischen Stände krönen Matthias zum Böhmischen König
Prag * Die Böhmischen Stände krönen Kaiser Rudolfs II. Bruder Matthias zum Böhmischen König, nachdem er die im Majestätsbrief gegebenen Bestimmungen zugesagt hat.
Um 7 1611 - Der „Hexenrichter“ Dr. Gottfried Sattler muss in den „Falkenturm“
München * Der aus Ingolstadt stammenden Dr. Schober mit der Untersuchung der „Prozess-Umstände“ von Wemding beauftragt.
Schobers Urteil ist für den „Hexenrichter“ Dr. Gottfried Sattler niederschmetternd, woraufhin alle in München und Wemding Angeklagten auf Befehl des „Hofrats“ freigelassen werden müssen.
Dafür wird Dr. Sattler verhaftet und in den „Falkenturm“ nach München gebracht.
Die Kosten der Untersuchung durch Dr. Schober und die Unterbringung der vier Verdächtigen im „Falkenturm“ werden dem „Hexenrichter“ Sattler und dem „Gerichtsschreiber“ aufgebrummt.
Bei den Vernehmungen kommen nicht nur die „Unterschlagungen und Veruntreuungen“ in Höhe von 3.000 Gulden ans Tageslicht, sondern auch ein „adulterium“, eine unzüchtige sexuelle Handlung.
Damit ist die Geduld des „Hofes“ erschöpft und das Todesurteil über den „Hexenrichter“ schnell gefällt.
Und das, obwohl er aus dem Kreis der „Hofräte“, die sich zur „Partei der Hexenprozess-Befürworter“ zählen, massive Unterstützung erhält.
Anno 1612 - Ein eigenständiges „Gericht ob der Au negst München“ wird eingerichtet
Au - Haidhausen - Untergiesing * Ein eigenständiges „Gericht ob der Au negst München“ wird eingerichtet.
Es ist allerdings kein selbstständiges „Landgericht“, sondern ein „Niedergericht“, deren „hochgerichtlichen Funktionen“ auch weiterhin vom „Landrichter in Wolfratshausen“ wahrgenommen werden.
Das „Gericht ob der Au“ ist also letztlich nichts anderes als eine „Hofmark“ unter der „Gerichtsbarkeit“ des „Hofoberrichteramtes“.
Haidhausen, die Au und Niedergiesing scheiden deshalb aus der „Hauptmannschaft Obergiesing“ aus.
1612 - Die „Konkubine“ Barbara Ferchthin muss am Pranger stehen
München * Herzog Maximilian I. verlangt vom Rat der Stadt, die „Konkubine“ Barbara Ferchthin an drei Sonn- oder Feiertagen hintereinander öffentlich vor die Frauenkirche zu stellen und sie danach „sechs Meilen Wegs“ von München wegzuschaffen.
1612 - Neun landesherrliche „Weißbier-Brauhäuser“ im Herzogtum
Herzogtum Baiern * Die Zahl der landesherrlichen „Weißbier-Brauhäuser“ ist auf neun angewachsen.
Weitere neun „Weißbier“ brauende „Kommun-Brauhäuser“ sind dem Herzog gegenüber abgabepflichtig.
1612 - Der „Landtag“ beschäftigt sich mit dem herzoglichen „Weißbier-Brauwesen“
München * Dieser „Landtag“ beschäftigt sich erneut mit dem herzoglichen „Weißbier-Brauwesen“.
Herzog Maximilian I. entkräftet sämtliche Argumente, muss aber zugestehen, dass er bei einer „Weizenknappheit“ das Getreide aus dem Ausland beziehen oder die „Weißbierproduktion“ einschränken wird.
Die als „Komposition“ bezeichnete Abgabe in Höhe von 10.000 Gulden zahlt der Herzog auch weiterhin an die „Landschaftskasse“.
Dieser Betrag ist aber im Vergleich zu den Einnahmen aus dem herzoglichen „Weißbiermonopol“ lächerlich gering.
1612 - Der aus Einbeck stammende „Bierbrauer“ Elias Pichler kommt nach München
Einbeck - München * Der aus Einbeck - im hohen protestantischen Norden - stammende „Bierbrauer“ Elias Pichler wird vom baierischen Herzoghaus ans „Hofbräuhaus“ nach München angeworben, um hier ein Bier nach „ainpöckischer Art“ zu Brauen.
Bevor er seine Tätigkeit aufnimmt, muss er aber noch schnell zum katholischen Glauben konvertieren.
Er braucht zwar noch einige Experimente, aber dann gibt‘s statt des bis dahin gebrauten „Plempels“ ein würziges, süffiges und bekömmliches „Bockbier“ aus dem „Herzoglichen Hofbräuhaus“.
Das wird aber erst im Jahr 1614 sein.
1612 - Die verfolgungskritischen „Politiker“ kriegen die Mehrheit
München * Das Kräfteverhältnis im „Hofrat“, dem zentralen kurfürstlichen Entscheidungsträger in der „Justiz“, hat sich zu Gunsten der verfolgungskritischen „Politiker“ verändert.
Ab 1612 - In den fränkischen „Hochstiften“ weitere „Hexenverfolgungen“
Bamberg * In den fränkischen „Hochstiften“ erreichen die „Hexenverfolgungen“ einen neuen Höhepunkt.
Vor allem der Bamberger „Weihbischof“ Friedrich Förner tut sich als Antreiber hervor.
In der Zeit von 1610 bis 1630, in der er sein einflussreiches Kirchenamt ausübt, fordert er fanatisch die „Ausrottung der Trudner“, wie man hier die „Hexen“ bezeichnet.
Noch während der ersten „Verfolgungswelle“ der Jahre 1612/13 kommt es zur „Hinrichtung“ von 15 „Hexen“.
19. 1 1612 - Der Ausbau der Münchner Stadtbefestigung wird abgelehnt
München * Wegen zu erwartender kriegerischer Auseinandersetzungen mit der protestantischen Union fordert Herzog Maximilian I. erneut den Aus- und Umbau der Münchner Stadtbefestigung. Er argumentiert zusätzlich mit der Möglichkeit einer Erweiterung des ummauerten Stadtgebiets. Doch auch die Landstände Versagen ihre Zustimmung aus finanziellen Gründen.
20. 1 1612 - Kaiser Rudolf II. stirbt in Prag
Prag * Kaiser Rudolf II. stirbt in Prag. Sein Bruder Matthias wird daraufhin Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Entgegen seinem Versprechen hält er sich jedoch nicht an die den Böhmischen Ständen gegebenen Zusagen im Majestätsbrief.
21. 1 1612 - Eine Strafarbeit für die voreiligen Juristen
München * Der Geheime Rat schickt das „Herzogliche Baierische Mandat gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“ wieder zurück, weshalb es den Beamten erst im März 1612 zugänglich gemacht werden kann. Die für den voreiligen Druck verantwortlichen Hofräte Dr. Cosmas Vagh und Dr. Hieronymus Faber mussten die Korrekturen als Strafarbeit persönlich in die anderen Exemplare übertragen.
Das Verhalten des Hofrats gegenüber dem Geheimen Rat löst auch die Untersuchung der Vorgänge in Wemding aus.
17. 2 1612 - Kölns Kurfürst und Erzbischof Ernst stirbt bei der Jagd
Arnsberg - Köln * Kölns Kurfürst und Erzbischof Ernst stirbt bei einem Jagdausflug im westfälischen Arnsberg in Westfalen. Er wird im Kölner Dom beigesetzt. Sein Nachfolger wird der jüngste Sohn von Herzog Wilhelm V., Herzog Ferdinand von Baiern, der Bischof von Lüttich.
Er erhält nun zusätzlich das Bistum Köln einschließlich der Kurfürstenwürde, dazu die Bistümer Hildesheim und Münster, ohne dass dagegen der Papst, der Kaiser oder die Fürsten einschreiten. Nur das Freisinger Domkapitel widersteht allen Einschüchterungsversuchen des Münchner Hofs.
Ferdinand zeigt sich als kompromissloser Vorkämpfer einer kirchlichen Restauration auf der Grundlage des Trienter Konzils. Trotzdem weigert er sich lebenslang, die höheren Weihen zu empfangen und als konsekrierter Bischof seiner Ämter zu walten. Selbst die Jesuiten in seiner Umgebung, die als ständige Berater und Beichtväter die einflussreichsten Positionen einnehmen, können Ferdinand diese Entscheidung nicht abringen.
3 1612 - Das baierische „Aberglaubens- und Hexenmandat“ wird veröffentlicht
München * Erst jetzt ist das „Herzogliche Baierische Mandat gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“ den Beamten zugänglich gemacht.
Das „Landgebott wider die Aberglauben Zauberey Hexerey und andere sträffliche Teufelskünste“ umfasst 40 Seiten und ist das umfangreichste „Gesetz gegen die Hexerei, Zauberei und Aberglauben“, das jemals in Mitteleuropa publiziert worden ist.
Es listet 52 strafbare Formen von „Aberglauben“ auf.
Darunter beispielsweise Wahrsagen, Astrologie, Geisterbeschwörung, Ausgraben von Leichen und Alraunen, abergläubisches Schatzsuchen, Ungezieferbeschwörung, Wetter- und Bildzauber, Bannung von Geistern und Krankheiten durch Ansegnen, Missbrauch von Scharfrichterutensilien und so weiter.
Ausdrücklich wird „guter“ und „schlechter Zauber“ gleichgesetzt.
Auch harmloser „Aberglaube“ gilt als „Vorstufe zum Hexenverbrechen“.
Jede Form von „Zauberei“ muss ausgerottet werden, weil sonst „Gott der Allmechtig zu billichem Zorn gegen uns Menschen bewegt und unser Landt und Leuth mit thewrung Krieg und Pestilentz auch andern mannigfaltigen Plagen straffen und angreiffen möchte“.
Schließlich ist es Aufgabe der Obrigkeit, die „Ehre Gottes“ zu retten.
Als besonders tatverdächtig werden im Bereich des „Aberglaubens“ die „Schmiede auf dem Lande“, die „alten Weiber“ und die „Nachrichter“ genannt.
Erstmals wird für den Bereich des Herzogtums Baiern nun auch der „Teufelspakt“ als Straftat ausformuliert.
21. 7 1612 - Das Aberglaubens- und Hexenmandat zeigt keine große Wirkung
München * Zur Veröffentlichung des Hexenmandats muss dieses von der Kanzel verlesen werden. Doch der Landrichter von Friedberg berichtet, dass sich die Priesterschaft im Bezirk der Verlesung des Hexenmandats verweigern würde und führt dies auf den Einfluss der zuständigen Bischöfe zurück.
Außerdem untersagt der Geheime Rat dem Hofrat die Veröffentlichung des Mandats in den Hofmarken. Damit zeigt das Mandat keine allzu große Wirkung.
6. 12 1612 - Herzog Wilhelm V. schenkt Neudeck seinem Kammerdiener
Au * Herzog Wilhelm V. schenkt Neudeck seinem Kammerdiener Johann Hebenstreit. Dieser fungiert als Strohmann und kauft im herzoglichen Auftrag weitere Grundstücke hinzu.
1613 - Die erste, offensichtlich dauerhafte Kiesbank in der Isar
München * Auf dem Stadtplan von Tobias Volckmer ist die erste, offensichtlich dauerhafte Kiesbank in der Isar zu sehen.
Hier ist die spätere „Kohleninsel“ ein „Whördt“, eine knapp aus dem Wasser ragende Insel, die mit Büschen und Gestrüpp bewachsen ist.
Die südliche und die nördliche Spitze der Insel ist mit einer Uferverbauung, einem „Beschächt“, befestigt.
Die natürliche „Kiesbank“ wird damit befestigt.
Die Münchner Isarinseln sind also ein Produkt menschlicher Arbeit.
1613 - Der älteste „Stadtplan Münchens aus der Vogelperspektive“
München * Tobias Volckmer sticht den ältesten „Stadtplan Münchens aus der Vogelperspektive“ in Kupfer.
1613 - Der Münchner „Henker“ Hans Stadler wird wegen „Zauberei“ angeklagt
München * Der Münchner „Henker“ Hans Stadler wird angeklagt, weil er gestohlene Sachen durch „Zaubern“ wieder zurückholen kann und diese „Kunst“ für 12 Gulden einem Mitglied aus der Adelsfamilie der Taufkirchner zur Verfügung stellte.
23. 5 1613 - Dr. Gottfried Sattler wird in Markt Schwaben hingerichtet
München - Markt Schwaben * Herzog Maximilian I. macht der Vorschlag, das Urteil gegen Dr. Gottfried Sattler außerhalb von München zu vollstrecken, um so ein größeres Aufsehen zu vermeiden. Dr. Gottfried Sattler wird wenig später in Markt Schwaben hingerichtet. Es ist aber nicht die willkürliche Art seiner Prozessführung, die zu seiner Verurteilung führt, sondern
- die „Unterschlagung und Veruntreuung“ und damit
- die „Schmälerung der landesherrlichen Einnahmen“.
Erst nach dem Wemdinger Fiasko setzt sich beim Hofrat eine vorsichtigere Verfolgungspraxis durch. Die Außenbeamten werden jetzt sorgfältiger überwacht und voreilige Maßnahmen frühzeitiger gerügt. In der Folgezeit endeten die meisten Untersuchungen wegen Zauberei mit strengen Verweisen.
23. 10 1613 - Kaiser Matthias will ein drittes Liga-Direktorium
Wien * Kaiser Matthias will die katholische Liga mit der Einrichtung eines dritten Liga-Direktoriums für Erzherzog Maximilian unter habsburgische Kontrolle bringen.
11. 11 1613 - Pfalzgraf Wolfgang-Wilhelm konvertiert zum katholischen Glauben
Neuburg * Magdalena, eine Schwester von Herzog Maximilian I., geht in München eine Ehe mit dem protestantischen Herzog Wolfgang-Wilhelm von Pfalz-Neuburg ein. Der Pfalzgraf konvertiert bei dieser Gelegenheit zum katholischen Glauben.
1614 - Pfalz-Neuburg tritt aus der protestantischen „Union“ aus
Neuburg * Pfalz-Neuburg tritt aus der protestantischen „Union“ aus.
1614 - Der „Hofgarten“ wird angelegt und der „Zentrale Pavillon“ erstellt
München-Graggenau * Der „Hofgarten“ wird im Zusammenhang mit der Erweiterung der „Residenz“ unter Herzog Maximilian I. angelegt und der „Zentrale Pavillon“ erstellt.
Die Wegachsen der Gartenanlage münden sternförmig in die Rundbogenöffnungen des „Pavillons“.
1614 - Der zwölfjährige Onophrius Mießl kommt in den Verdacht der „Hexerei“
München * Der zwölfjährige Onophrius Mießl kommt in den Verdacht der „Hexerei“, nachdem er dreimal hintereinander eine geronnene Milch heimbrachte.
Mit vorformulierten Fragen stimuliert das „Kürschnerehepaar“, bei dem er angestellt ist, ihn zu „Hexereigeständnissen“.
Auf Anraten eines Paters wird der „Stadtrichter“ vom Verdacht informiert und der Junge unter Einsatz der „Folter“ verhört.
Der Rat der Stadt stellt abschließend fest, dass das Geständnis ein „erdichtetes Lügen- und Fabelwerk“ sei und sperrt statt des Knaben das „Kürschnerehepaar“ acht Tage bei „Wasser und Brot“ ins Gefängnis.
1614 - Die Gebrüder Bettaga wollen in München eine Seidenhandlung eröffnen
München * Die Gebrüder Bettaga bitten um Aufnahme als Bürger und wollen ebenfalls eine Seidenhandlung eröffnen. Und das, obwohl „ein Verschleiß in nicht katholischen Ländern besser ist“.
Sie begnügen sich jedoch nicht mit einem einfachen Geschäft, sondern errichten dazu eine Seidenspinnerei. Das Unternehmen soll „jährlich bis zu 7.000 Seelen, arme, meist junge Leuthe abrichten und ernehren, welche sonst dem müssiggang und Petl nachgehen“.
Die Bettegas führen das Geschäft ganze sieben Jahre.
1. 3 1614 - Ein weiteres herzogliches Bettelmandat
München * Mit einem herzoglichen Mandat wird wieder einmal der Versuch gestartet, Bettler, müßiggehendes Gesindel und herrenlose, bewaffnete Soldaten zu bekämpfen.
25. 4 1614 - Alle fremden Bettler müssen München verlassen
München * Nach einem Befehl des Stadtrats müssen alle fremden Bettler durch die städtischen Amtsleute aus dem Münchner „Burgfrieden“ geschafft werden.
Wer wieder zurückkommt, wird mit Peitschenhieben bestraft werden.
Um den 1. 5 1614 - Elias Pichler kredenzt erstmals das von ihm gebraute „Bockbier“
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Braumeister Elias Pichler kredenzt in München erstmals das von ihm gebraute Bier nach original <em>„Einbecker Art“</em>, das später über <em>„ainpöckisch Bier“</em> den Namen <em>„Bockbier“</em> erhalten wird.</p> <p>Aufgrund der merkantilistischen wirtschaftspolitischen Grundprinzipien ist Herzog Maximilian I. - auch beim Bier - der Meinung, dass es wirtschaftlich besser ist, Fertigwaren auszuführen und allerhöchstens die Rohstoffe einzuführen, um dann am erzielten Mehrwert zu verdienen. Deshalb werden ab dem Jahr 1612, mit der Anwerbung des aus Einbeck stammenden Braumeisters Elias Pichler, auch die Lieferungen von Einbecker Bier für den Münchner Hof eingestellt.</p> <p>Schon zuvor ist am Münchener Herzogshof der Bedarf an dem Gerstensaft aus dem hohen deutschen (protestantischen) Norden durch den Aufschwung, den das <em>„Weiße Bier“</em> hier genommen hat, stark zurückgegangen.</p> <p>Das Luxusgetränk mit seinen mehr als 16 Prozent Stammwürze und über sieben Prozent Alkoholgehalt bleibt auch weiterhin ein Privileg des Landesfürsten. Herzog Maximilian I. lässt - auf nachhaltiges Drängen - zwar den <em>„Bock“</em> auch an seine <em>„Landeskinder“</em> ausschenken, erklärt aber die Herstellung des Bockbieres - wie schon zuvor des Weißbieres - zum fürstlichen Regal, also zum Monopol der Landesherrschaft.</p> <p>Aus dem <em>„ainpöckischen Bier“</em> wird im Volksmund bald der <em>„Bock“</em>. Im Kanzleideutsch aber ist noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein vom <em>„Ainbock“</em> die Rede. </p>
4. 11 1614 - Maria Pettenbeck stirbt
München * Maria Pettenbeck, die Gemahlin von Herzog Ferdinand, stirbt.
21. 11 1614 - Ungeratene Kinder werden in den Turm gesperrt
München * Gabriel Ridler bittet den Stadtrat, seinen Sohn Ernst „wegen seiner vielen Schulden und seines liederlichen Lebenswandels“ im Turm einzusperren. Der Rat der Stadt bewilligt die Bitte, da man schon öfter „ungeratene Kinder auf diese Weise coerciert“ hat.
Nach 1615 - „Mit Feuer und Schwert ist diese schlimmste menschliche Pest zu vertilgen“
München-Graggenau * Der „Hofprediger“ Jeremias Drexel geifert von der Kanzel:
„Ich rufe auf Befehl Gottes und so laut ich nur kann, Bischöfen, Fürsten und Königen zu: Lasset die Hexen nicht leben!
Mit Feuer und Schwert ist diese schlimmste menschliche Pest zu vertilgen.“
1615 - Der Teich im „Unteren Hofgarten“ wird eingelassen
München-Graggenau * Der Teich im „Unteren Hofgarten“ wird eingelassen.
An der Stelle des ehemaligen „Lustgartens“ Herzog Wilhelms IV. entsteht die „Zeughaus-Anlage“ Herzog Maximilians I..
1. 4 1615 - Albrecht von Lerchenfeld erhält die Hofmark Berg am Laim
<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Der Kastner und Hofkammerrat Albrecht von Lerchenfeld erhält von Herzog Maximilian I. aufgrund seiner Verdienste die bisher herzogliche Hofmark Berg am Laim übertragen.</p>
8. 8 1615 - Der Magistrat gibt seine Zustimmung zum Ausbau der Festungsanlagen
München * Das ständige Drängen Herzog Maximilians I. zeigt Erfolg. Der Magistrat der Stadt gibt seine Zustimmung zum Ausbau der Festungsanlagen.
12. 9 1615 - Das Münchner Stadtgericht kommt unverhofft zu einem Hexenprozess
München-Graggenau * Ohne eigenes Zutun kommt das Münchner Stadtgericht zu einem Hexenprozess. Eine Bettlerin wird nach einem Selbstmordversuch festgenommen und diese erklärt dazu völlig unerwartet, dass sie, Barbara „Bärbl“ Schwerzin, „vom Teufel besessen“ und sie, ihre Schwester Elisabeth „Elsl“ und besonders ihre Mutter Katharina Hexen seien. An diesem 12. September beginnt der Hexenprozess.
4. 12 1615 - Der Stadtrat beschließt die Hinrichtung von drei Hexen
München-Graggenau * Der Stadtrat beschließt die Hinrichtung der drei Hexen: Barbara „Bärbl“, Elisabeth „Elsl“ und Katharina Schwerzin. Auch der Hofrat schließt sich dem Vorschlag an. Doch nun stellt sich Herzog Maximilian I. gegen die Auffassung des Stadtrats und seiner eigenen Justizbehörde.
Auf Drängen Herzog Maximilians I. nimmt dieser städtische Hexenprozess beinahe wieder ausufernde Formen an. Getreu der Doktrin: „Wo eine Hexe ist, da sind noch mehr zu finden.“
1616 - Die „Rosskastanie“ verbreitet sich über den ganzen Kontinent
Istanbul * Die „Rosskastanie“, der typische Münchner Biergartenbaum, gelangt von Istanbul nach Frankreich, von wo aus sie sich dann über den ganzen Kontinent verbreitet.
1616 - Georg Schobinger kauft den an der Lilienstraße gelegenen „Klingenhammer
Au * Georg Schobinger kauft auch den an der Lilienstraße gelegenen „Klingenhammer mit Werkzeug, Polier- und Schleifmühle, die oberen und unteren Gärten, Röhrlwasser, Brunnstuben und Fischgerechtigkeit am Mühlbach um 8.000 Gulden“.
Die Klingenschmiede hatte zwar ihren Ruf und ihre Bedeutung verloren, war aber nachweislich noch als „Schobinger Mühle“ in Betrieb.
Um 1616 - Die Statue der „Diana“ oder „Tellus Bavarica“ wird aufgestellt
München-Graggenau * Auf der Spitze des zentralen „Pavillons“ im „Hofgarten“ wird die Statue der „Diana“ oder „Tellus Bavarica“ aufgestellt.
Erbaut werden die Nord- und Westarkaden, das neue „Brunnhaus“ und eine Brücke zum „Hofgarten“, die den Zugang von der durch den Stadtgraben abgetrennten „Residenz“ bildet.
Ab 1616 - In Bamberg müssen 159 Menschen als „Hexen“ sterben
Bamberg * In der zweiten „Verfolgungswelle“ des Bamberger „Weihbischofs“ Friedrich Förner zwischen 1616 und 1622 müssen erneut 159 Menschen als „Hexen“ sterben.
Ab 1616 - In Würzburg kommt es zu Hexen-Verfolgungen
Würzburg - Tübingen * In Würzburg kommt es unter „Fürstbischof“ Julius Echter von Mespelbrunn zu ersten Verfolgungen.
In einem Tübinger Bericht berichtet ein anonymer Verfasser über den aufkeimenden „Hexenwahn“ im Hochstift:
„Auß dem Bißthum Würzburg: Gründliche Erzehlung der Bischof zu Würzburg das Hexenbrennenim Frankenland angefangen, wie er dasselbeforttreiben, und das Ungeziffer gentzlich außrotten wil, und allbereit zu Geroltzhoffen starke Brände gethan, hinführe alle Dienstag thun will“.
14. 1 1616 - Maximilian I. legt das Bundesobristenamt der katholischen Liga nieder
München * Herzog Maximilian I. legt nach erbitterten Auseinandersetzungen das Bundesobristenamt der katholischen Liga nieder.
21. 1 1616 - Der Hexenprozess gegen die Familie Schwerzin wird wieder aufgenommen
München * Der Hexenprozess gegen Barbara, Elisabeth und Katharina Schwerzin wird wieder aufgenommen. Nach den Geständnissen der Elsl Schwerzin unter der Folter werden vier weitere Frauen verhaftet, jedoch im Mai wieder entlassen. Am letzten Gerichtstag widerrufen die Mutter Katharina und ihre Tochter Bärbl alles vorher gesagte; nur Elsl bleibt bei ihren früheren Aussagen.
Das Stadtgericht nimmt nun den Prozess mit verstärkter Anwendung der Folter wieder auf, prüft aber die erzwungenen Aussagen besser nach und muss feststellen, dass die Aussagen frei erfunden und erlogen sind.
25. 6 1616 - Aufgrund der langanhaltenden Hitze beginnt man mit der Getreideernte
München * Aufgrund der großen und langanhaltenden Hitze beginnt man mit der Getreideernte. Fünf Bittprozessionen werden abgehalten. Doch die Hitze schadet den Feldern so sehr, dass Getreidemangel eintritt und jede Ausfuhr von Hafer, Flachs, Hanf, Garn, Wolle und Schmalz verboten wird.
Um 8 1616 - Tagelöhner müssen das Wasserrad mit ihrer Körperkraft antreiben
Au * Nach einer lang anhaltenden Dürre reicht das Wasser zum Antrieb des „Wasserrades“ im „Brunnhaus am Isarberg“ nicht mehr aus.
Angeheuerte Tagelöhner müssen das Rad sechs Wochen lang mit ihrer Körperkraft antreiben.
Um den 14. 9 1616 - Ein Hochwasser lässt die Flüsse über die Ufer treten
München * Nach der Hitzeperiode lässt ein Hochwasser die Flüsse über die Ufer treten.
29. 9 1616 - Der Preis für das Hochzeitsmahl
München * Das Hochzeitsmahl
- einer Weinhochzeit kostet bis zu 45 Kreuzer pro Person,
- bei einer Bierhochzeit bis zu 20 Kreuzer.
29. 9 1616 - Eigene Baierweinschenken bilden sich heraus
München * Die Baierische Polizeiordnung untersagt den „gleichzeitigen Ausschank von Baierwein und eingeführten Weinen“. Dadurch bilden sich eigene Baierweinschenken heraus.
29. 9 1616 - Das Landrecht stellt die Rechtseinheit in Baiern her
München * Mit dem Landrecht Herzog Maximilians I. wird die endgültige Rechtseinheit in Baiern hergestellt, die alle Rechtsgebiete umfasst. Damit ist Baiern eines der wenigen deutschsprachigen Territorien, das über eine systematisch erfasste und in allen Rechtsangelegenheiten abgestimmte Landesgesetzgebung verfügt.
Die Landes- und Polizeiordnung enthält:
- Eine Polizeiordnung.
- Das Landrecht, das einheitlich für Ober- und Niederbaiern gültige Zivilrecht, das bis 1756 in Kraft bleibt.
- Eine Gerichtsordnung, die den ordentlichen Prozess auf der Grundlage der Gerichtsordnung von 1520 regelt.
- Die summarische Prozessordnung, die bis 1753 Gültigkeit hat.
- Sie schreibt unter anderem das Wandern der Handwerksgesellen als Grundlage für den Erwerb der Meisterschaft vor.
- Sie enthält eine allgemeine Fischordnung für Donau, Salzach, Isar und den Inn usw..
- Sie schafft in der Malefizordnung die Strafe des Ertränkens ab.
29. 9 1616 - Lockerer Umgang mit dem Reinheitsgebot
München * In der Landes- und Polizeiordnung heißt es: „Doch wann jemand ein wenig Salz, Krametbeer [= Wacholder] und ein wenig Kümmel in das Bier täte und damit kein Übermaß gebrauchte, soll er deshalben nicht gestraft werden“.
Es gab viele Gründe mit pflanzlichen Zusätzen zu arbeiten und zu experimentieren. Vor allem sollte die längere Haltbarkeit des Bieres erreicht und das Sauerwerden verhindert beziehungsweise rückgängig gemacht werden. Saueres Bier war wegen des schlechten Geschmacks nicht nur unverkäuflich, sondern bedeutete durch den Verlust der teueren Rohstoffe einen volkswirtschaftlichen Schaden.
29. 9 1616 - Aufenthalts-, Handels- und Gewerbeverbot für Juden erneuert
München * Herzog Maximilian I. erneuert das Aufenthalts-, Handels- und Gewerbeverbot für Juden in Baiern.
29. 9 1616 - Die Gejaidsordnung verbietet er das Schießen der Reiher
München * Herzog Maximilian I. ist seit seiner Ingolstädter Studienzeit ein leidenschaftlicher Jäger auf den Hirschen und mit dem Falken. In seiner „Gejaidsordnung“ verbietet er das Schießen der Reiher, außer wo sie in Fischwassern großen Schaden verursachen, „weil Wir die uns zu unserm und anderer frembden ankommenden Fürstenperson lust und ergetzung vorbehalten haben“.
8. 11 1616 - Elsl Schwerzin wird als Hexe hingerichtet
München * „Elsl“ Schwerzin wird als Hexe hingerichtet, die „Alte“ Schwerzin freigelassen und von der Stadt versorgt. „Bärbl“ gibt in ihrer Verwirrung immer neue Geständnisse ab, denen der Stadtrat aber keinen Glauben mehr schenkt.
Seit dem Jahr 1617 - Herzog Maximilian I. will vom „Isartor“ hin zum Fluss die Stadt erweitern
München * Im Zuge des Ausbaus der „Münchner Wallbefestigung“ will Herzog Maximilian I. auf dem Gelände vom „Isartor“ hin zum Fluss eine „Stadterweiterung“ vorantreiben und diese in die Stadtmauer einbinden.
Als offizielle Begründung gibt er die Platznot sowie die Übervölkerung in der ummauerten Stadt und den Mangel an Mietwohnungen, beziehungsweise der zu hohen Mieten für die vorhandenen an.
Dadurch sei für den wachsenden „Hofstaat“ und das „Hofgesinde“ keine ausreichende Unterkunft gesichert.
Der „Münchner Rat“ wehrt sich heftigst gegen jede „Stadterweiterung“, da die Bürger, so seine Argumentation, für den Bau von Häusern zu arm seien und die wenigen Reichen kein Interesse hätten, ihr Vermögen in „Zinshäuser“ zu stecken, deren Erträgnisse nicht einmal die Zinsen für die Baukosten decken.
Außerdem würden durch Neubauten vor den Toren der Stadt der Wert der Häuser in der Stadt gemindert und daneben die Mieten gesenkt werden.
Der „Rat der Stadt München“ setzt sich durch und die „Stadterweiterung“ unterbleibt!
Anno 1617 - Papst Paul V. lässt eine Bronze-Madonna auf eine antike Säule stellen
Rom * Papst Paul V. lässt die Bronzefigur einer „Maria Immaculata“ in Rom bei „Santa Maria Maggiore“ auf eine antike Säule stellen.
1617 - Im „Bistum Eichstätt“ beginnen die Hexen-Verfolgungen
Eichstätt * Im „Bistum Eichstätt“ beginnen die Hexen-Verfolgungen.
Dort ist es Johann Christoph von Westerstetten, der sich bereits im „Bistum Ellwangen“ als fanatischer „Hexenbischof“ hervortat und an seiner neuen Wirkungsstätte die „Hexen-Verfolgungen“ forciert.
In seiner Amtszeit zwischen 1617 und 1630 lassen sich mindestens 155 Hinrichtungen [133 Frauen und 22 Männer] nachweisen.
Mit seinem Tod enden auch die Verfolgungen.
Auch in Eichstätt gehen die Verfolgungen durch alle sozialen Schichten, Opfer werden Bürgermeister, Ratsherren und deren Frauen ebenso wie der „Klosterrichter“ und andere.
27. 5 1617 - Herzog Maximilan I. gründet eine neue katholische Liga
München * Herzog Maximilan I. gründet zusammen mit Würzburg, Bamberg, Eichstätt und Ellwangen eine neue katholische Liga.
29. 6 1617 - Die böhmischen Landstände wählen Erzherzog Ferdinand zum König
Prag * Aufgrund seines angegriffenen Gesundheitszustandes wählen die böhmischen Landstände Erzherzog Ferdinand - noch zu Lebzeiten von Kaiser und König Matthias - zum designierten König von Böhmen, nachdem auch er die im Majestätsbrief garantierten Freiheiten und Privilegien beeidet. Erzherzog Ferdinand II. wird von dem böhmischen Ständen - trotz seines bekanntermaßen kämpferischen Katholizismus - zum König gewählt und im Prager Veitsdom feierlich gekrönt.
Doch die an den herzoglichen, königlichen und kaiserlichen Höfen sitzenden und Einfluss habenden Jesuiten wollen - ebenso wie der spanische Hof - die Bestimmungen des Majestätsbriefes rückgängig machen. Sie ersinnen eine Gegenstrategie, in deren Folge zwei protestantische Kirchen abgerissen werden.
1618 - München verfügt über 1.771 „bürgerliche Gerechtigkeiten“
München * München verfügt über 1.771 „bürgerliche Gerechtigkeiten“, einschließlich des „Handels“.
1618 - König Ferdinand II. wird vom ungarischen Reich als König anerkannt
Ungarn * König Ferdinand II. wird vom ungarischen Reich als König anerkannt.
1618 - Hexenprozesse gegen Kinder in Augsburg
Augsburg * Besonders unverständlich erscheint uns die nicht zu unterschätzende Anzahl von „Hexenprozessen gegen Kinder“.
In der „Reichsstadt Augsburg“ finden in den Jahren zwischen 1618 und 1730 acht derartige Verfahren statt, in denen 45 Kinder und Jugendliche betroffen sind.
Ein Drittel davon sind Mädchen, der Rest sind Knaben, die alle dem „Unterschichtenmilieu“ entstammten.
Um 1 1618 - „Bärbl“ Schwerzin wird dem „Heiliggeist-Spital“ übergeben
München-Angerviertel * „Bärbl“ Schwerzin wird dem „Heiliggeist-Spital“ übergeben.
„Das Costgelt trag die Stadtchammer“.
Um 3 1618 - Die protestantischen „Landstände“ in Böhmen beschweren sich beim Kaiser
Prag * Die protestantischen „Landstände“ in Böhmen rufen einen „Landtag“ ein, auf dem sie die im „Majestätsbrief“ gewährten Rechte verletzt sehen und beim Kaiser Beschwerde einlegen.
Dessen Antwort ist kurz und bündig. Er verbietet weitere Sitzungen des „Landtags“ und setzt damit den „Majestätsbrief“ faktisch außer Kraft.
21. 5 1618 - Die böhmischen Stände treffen sich trotz Strafandrohung
Prag * Obwohl Kaiser Matthias das Zusammentreten des böhmischen Landtags - bei Strafe - verboten und damit den Majestätsbrief faktisch außer Kraft gesetzt hatte, kommen die Ständevertreter zur Versammlung.
23. 5 1618 - Die Delinquenten werden defenestriert und landen auf dem Misthaufen
Prag * Die Ständevertreter begeben sich in das Schloss auf dem Hradschin, um die kaiserlichen Beamten zur Rede zu stellen. Es kommt zu einem heftigen Streit, in dessen Folge die Aufständischen zwei Statthalter Ferdinands samt deren Sekretär aus einem Fenster der Burg werfen. Doch die katholischen Statthalter überleben, was in der katholischen Propaganda umgehend zu einer Engels- und Marienerscheinung und damit zu einem Wunder umgedeutet wird.
Weniger pathetische Stimmen sprechen von einem Misthaufen der den Sturz abgemildert hat. Doch auch einen Misthaufen hätten - nach einem freien Fall aus 18 Metern Höhe - drei Ungeübte nicht so leicht überstanden, dass sie hinterher noch in der Lage gewesen wären wegzulaufen. Die Lösung liegt wahrscheinlich an der unter dem Fenster schräg verlaufenden Wand. Durch die kleinen Fenster konnten die Delinquenten nicht mit Schwung „defenestriert“ werden und so nach unten rutschen.
Die Ereignisse auf der Prager Burg stilisieren die katholischen Propagandisten zur Staatsaffäre hoch. Der Prager Fenstersturz ist die Initialzündung für den Dreißigjährigen Krieg.
1. 7 1618 - Ferdinand II. wird in Preßburg zum König von Ungarn gekrönt
Preßburg * Ferdinand II. wird in Preßburg zum König von Ungarn gekrönt. Sofort beginnt man mit einer gegenreformatorischen Politik.
31. 7 1618 - Die böhmischen Stände erklären sich zur Wahlmonarchie
Prag * Die Böhmische Konföderation, ein Bündnis der nicht-katholischen Stände, wird in Prag gebildet.
- Der König als monarchisches Oberhaupt wird weitgehend entmachtet.
- Die Regierungsgewalt wird in die Hände der Stände gelegt.
- In der Konföderationsakte erklären die böhmischen Stände sich zur „freien, ständisch verfassten Wahlmonarchie“.
- Die Stände der Nebenländer Mähren, Schlesien, Ober- und Niederlausitz werden denen Böhmens gleichgestellt. Sie dürfen fortan an der Königswahl teilnehmen.
- Der Protestantismus wird zur Staatsreligion erklärt.
21. 11 1618 - Peter Ernst II. Graf von Mansfelds Truppen erobern Pilsen
Pilsen * Peter Ernst II. Graf von Mansfeld gelingt nach einem 15-stündigen Kampf die Einnahme der habsburgtreuen Stadt Pilsen. Es ist der erste Belagerungskampf des Dreißigjährigen Krieges. Pilsen gilt als bedeutendster Stützpunkt der katholischen Kaisertreuen und hatte sich dem Böhmischen Aufstand nicht angeschlossen.
Der Söldnerführer Graf von Mansfeld lässt nach der gewonnenen Schlacht einen Galgen errichten, an dem als Erster der Pilsener Henker sein Leben lässt. Ihm wird nachgesagt, dass er sich bei der Verteidigung der Stadt als Scharfschütze mit einer stets treffenden Teufelskugel hervorgetan hätte. Die meisten Verteidigererhalten aber einen freien Abzug, heuern aber hinterher bei der Mansfeldschen Armee an.
Nach dem Fall von Pilsen bekommt die protestantische Sache in Böhmen großen Auftrieb. Der Kaiser verhängt zur Strafe die Reichsacht über Mansfeld.
26. 11 1618 - Der Bau der Münchner Befestigung wird in Angriff genommen
München * Herzog Maximilian I. befiehlt die sofortige Schätzung der für den Festungsbau benötigten Grundstücke.
13. 12 1618 - Kurfürst Ferdinand wird Bischof von Paderborn
Paderborn * Kurfürst Ferdinand von Köln, der Inhaber der Bistümer Köln, Lüttich, Hildesheim und Münster, wird zum Bischof von Paderborn gewählt.
Ab 1619 - Das Ludwigsmonument befindet sich nahe dem Bennobogen
München-Kreuzviertel * Zwischen 1619 und 1622 entsteht in der Frauenkirche über der Deckenplatte für Kaiser Ludwig dem Baiern der bronzene Kenotaph. Das Ludwigsmonument befindet sich nahe dem Bennobogen.
1619 - Der Bau des barocken Befestigungsgürtels beginnt
München * Der Ausbau der Stadtmauer zu einem barocken Befestigungsgürtel mit Wall und Gräben beginnt.
5. 2 1619 - Die Stadt ist für den ordentlichen Zustand der Salzstraße zuständig
München * Nach einer Anordnung Herzog Maximilians I. ist die Stadt München für den ordentlichen Zustand der „Salzstraße“ zuständig.
20. 3 1619 - König Ferdinand will in Prag die Regierung antreten
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Matthias, der Kaiser des <em>Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation</em>, stirbt in Wien. Umgehend, als sei nichts gewesen, teilt König Ferdinand den <em>Böhmischen Ständen</em> in Prag mit, dass er gewillt sei, jetzt die Regierung anzutreten. Im gleichen Brief bestätigt er den <em>böhmischen Landständen</em> alle bisherigen Privilegien und Freiheiten.</p> <p>Doch die Böhmen glauben die Zusagen des Habsburgers nicht mehr und akzeptieren unter den gegebenen Umständen den als <em>Gegenreformatoren </em>bekannten <em>Erzherzog</em> nicht mehr als ihren König. Als Alternative schlagen sie Jan Smirický, einen schwerreichen böhmischen Adeligen zur Wahl vor. Das ist - in dieser stockaristokratischen Welt - nun wirklich <em>„revolutionär“</em>.</p>
8 1619 - Die älteste Pipeline der Welt geht in Betrieb
Reichenhall - Traunstein * Die Soleleitung von Reichenhall zur neuen Saline in Traunstein wird in Betrieb genommen. Sie ist eine technische Meisterleistung. Die Sole fließt von Reichenhall durch eine hölzerne Leitung nach Traunstein. Dabei muss sie auf ihren 32 Kilometern einen Höhenunterschied von 260 Metern überwinden. Hofbaumeister Hans Reiffenstuel und sein Sohn Simon haben dazu ein System von sieben Pumpstationen entwickelt.
Im österreichischen Salzkammergut gibt es zwar eine noch ältere Soleleitung. Diese folgt aber nur dem natürlichen Gefälle. Deshalb wird die bayerische Soleleitung als die „älteste Pipeline der Welt“ bezeichnet.
19. 8 1619 - Die böhmischen Stände setzen Ferdinand als ihren König ab
Prag * Die böhmischen Stände setzen den Habsburger Ferdinand II. als ihren König ab.
26. 8 1619 - Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz wird böhmischer König
Prag * Die aufständischen böhmischen Stände wählen den pfälzischen Kurfürsten Friedrich V. statt des am 19. August abgesetzten Habsburgers Ferdinand II. zu ihren König. Friedrich V. wird als tragischer Winterkönig in die Geschichte eingehen.
28. 8 1619 - Erzherzog Ferdinand II. wird in Frankfurt am Main zum Kaiser gekürt
Frankfurt am Main * Erzherzog Ferdinand II. wird in Frankfurt am Main zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gekürt.
29. 8 1619 - Kurfürst Friedrich V. erfährt von seiner Königswahl
Amberg * Der in Amberg weilende pfälzische Kurfürst Friedrich V. erfährt erst jetzt, dass er von den böhmischen Ständen am 26. August zum König gewählt worden ist.
12. 9 1619 - Friedrich V. soll sich von den böhmischen Angelegenheiten fernhalten
Rothenburg ob der Tauber * Die in Rothenburg ob der Tauber tagende protestantische Union rät dem pfälzischen Kurfürsten Friedrich V., sich nicht in die böhmischen Angelegenheiten einzumischen.
Um den 24. 9 1619 - Friedrich V. nimmt die Königswahl an
Heidelberg - Prag * Der pfälzische Kurfürst Friedrich V. nimmt die Wahl als böhmischer König an.
27. 9 1619 - Friedrich V. reist nach Prag
Heidelberg - Prag * Der pfälzische Kurfürst und König von Böhmen, Friedrich V., begibt sich von Heidelberg aus mit großer Gefolgschaft auf die Reise nach Prag.
8. 10 1619 - Herzog Maximilian I. wird großzügig entschädigt
München * Herzog Maximilian I. von Baiern sichert Kaiser Ferdinand II. im Münchner Vertrag die Unterstützung der Liga - unter seinem Oberbefehl - gegen das aufständische Böhmen zu. Kaiser Friedrich II. sagt dem Baiernherrscher
- das uneingeschränkte Direktorium über die katholische Liga zu
- und garantiert ihm Ersatz für alle Unkosten, die er beim Krieg gegen Böhmen haben würde.
- Bis zur endgültigen Abrechnung sind ihm pfandweise österreichische Länder zu übertragen.
Nur mündlich erhält Herzog Maximilian I. das kaiserliche Versprechen, dass Kurfürst Friedrich V. geächtet und die pfälzische Kurwürde nach Baiern verlagert wird.
31. 10 1619 - Friedrich V. zieht triumphal in Prag ein
Prag * Friedrich V., pfälzischer Kurfürst und böhmischer König, zieht mit insgesamt 568 Personen und fast 100 Wagen in Prag ein, wo man ihn begeistert willkommen heißt.
4. 11 1619 - Friedrich V. wird im Prager Veitsdom zum König gekrönt
Prag * Der pfälzische Kurfürst Friedrich V. wird im Veitsdom in Prag zum König von Böhmen gekrönt. Nach der Krönung nimmt der neue König die Huldigung der Stände entgegen.
12 1619 - Die katholische „Liga“ beschließt den Kriegseintritt
Würzburg * In Würzburg beschließt die katholische „Liga“ die Aufstellung eines Heeres - und damit den Eintritt in den Krieg.
12 1619 - Der Kostenvoranschlag für den Festungsausbau
München * Das Ergebnis der von Herzog Maximilian I. befohlenen Schätzung der für den Festungsbau benötigten Grundstücke liegt vor.
Es beläuft sich auf 25.990 Gulden.
1620 - Die „Hofmark Berg am Laim“ wird durch Zukäufe vergrößert
Berg am Laim * Der inzwischen zum „Generalkriegskommissar“ aufgestiegene Albrecht von Lerchenfeld kauft den „Großmeierhof“ und den „Kleinmeierhof“ in Echarding und fügt beide in seine „Hofmark Berg am Laim“ ein.
Zudem erwirbt er die drei „Schwaigen“ Harlaching, Geiselgasteig und Harthausen, die heutige „Menterschwaige“.
Noch im gleichen Jahr stirbt Albrecht von Lerchenfeld.
1620 - Reform der altbaierischen „Franziskaner-Konvente“
München - Rom * Die nächste Reform der altbaierischen „Franziskaner-Konvente“ entspringt den kirchenpolitischen Vorstellungen des regierenden Herzogs Maximilian I..
Es geht dem die „Gegenreformation“ tragenden Herrscher um die innere Erneuerung der katholischen Kirche, damit sich diese erfolgreich gegenüber der lutherischen „Reformation“ behaupten und verloren gegangenes Terrain zumindestens teilweise zurückgewinnen kann. Er will Baiern zu einem gut verwalteten und modernen Zentralstaat ausbauen, der in alle Lebensbereiche seiner Untertanen eingreifen und diese beaufsichtigen soll. Dazu gehört auch die Übereinstimmung der kirchlichen und staatlichen Territorialgrenzen.
Ein Hauptziel liegt dabei in der Abtrennung der altbaierischen „Franziskanerkonvente“ von der „Observatenprovinz Straßburg“, um so eine baierische - und damit unabhängige, aber staatstreue - „Franziskanerprovinz“ zu errichten.
Zur Durchsetzung seiner Ziele besetzt Herzog Maximilian I. - obwohl keine besonderen Missstände im Münchner und den anderen baierischen „Franziskaner-Niederlassungen“ vorliegen - die Schlüsselpositionen und sogar halbe „Konvente“ mit italienischen „Riformati“, einer italienischen Reformgruppe innerhalb des Ordens, neu. Diese „Reformaten“ übernehmen als erstes und wichtigstes Kloster in Altbaiern den „Franziskaner-Konvent“ bei der „Münchner Residenz“.
1620 - Die Baumaßnahmen am „Hofgarten“ sind beendet
München-Graggenau * Mit der Fertigstellung des „Vischhauses“ sind die Baumaßnahmen am „Hofgarten“ beendet.
1620 - Ein Altargemälde ersetzt die Bronze-Madonna
München-Kreuzviertel * Die „Madonnenplastik“ vom provisorischen Hochaltar der „Frauenkirche“ wird entfernt und durch ein riesiges Altargemälde von Peter Candid ersetzt, das allein schon im Format alles übertrifft, was es im baierischen Herzogtum an Altarbildern gibt, und das „Mariae Himmelfahrt“ zeigt.
Die „Madonna“ wird 18 Jahre später auf der „Mariensäule“ wieder verwendet.
1 1620 - Die „Schanzarbeiten“ beginnen vor dem „Schwabinger Tor“
München-Graggenau * Die „Schanzarbeiten“ beginnen vor dem „Schwabinger Tor“ und verlaufen in Richtung „Kosttor“.
200 Männer und 300 Frauen werden von der Stadt für die Arbeiten am Festungsbau bezahlt.
Straftäter werden nicht mehr des Landes verwiesen, sondern zum „Schanzbau“ zwangsverpflichtet, Bettler und Landstreicher aus allen Rentämtern werden dem Großbauvorhaben zugeführt.
Im ersten Jahr sind etwa 2.000 auswärtige Arbeiter in München im Ausbau der Festung beschäftigt.
5 1620 - Der „Karmelitengeneral“ Dominicus a Jesu Maria geht nach Baiern
Schärding * Der bereits 60-jährige „Karmelitengeneral“ Dominicus a Jesu Maria geht auf päpstliche Weisung nach Baiern.
Noch in Rom hat er den Sieg von Prag vorausgesagt:
„Wenn die Schlacht anfangen wird, werde ich auf einem mutigen Pferd sitzen, durch die Glieder des Kriegsheeres reiten, die Soldaten anfrischen: Die mich erblickenden Feinde werden aufschreien: Was für ein Teufel aus der Hölle kommt zu dem katholischen Kriegsheer?“
In Schärding am Inn, wo die „Liga“ ihre Truppen gesammelt hat, trifft der „Karmeliter-Pater“ Dominicus a Jesu Maria erstmals auf Herzog Maximilian I. und dessen Ehefrau Elisabeth Renata von Lothringen.
Gemeinsam begeben sich die zur „Strafaktion“ versammelten Regimenter und Maximilians Hofstaat nach Böhmen.
Der „Karmeliter-Pater“ reist in einer Sänfte.
In einem von den böhmischen Aufständischen zerstörten Dorf findet der Ordensmann ein kleines Bild, das die Geburt Jesu darstellt.
Calvinistische Bilderstürmer haben Maria und Josef die Augen ausgekratzt.
Sofort hängt sich der „Karmelit“ dieses „Gnadenbild“ um den Hals.
30. 6 1620 - Maximilian I. soll den Aufstand in Oberösterreich niederwerfen
Wien - München * Kaiser Ferdinand II. erteilt dem baierischen Herzog Maximilian I. den Auftrag, im Land ob der Enns (Oberösterreich) mit der Niederwerfung des Aufstandes zu beginnen.
23. 7 1620 - Die Niederschlagung des oberösterreichischen Aufstands beginnt
Haag am Hausruck - Schloss Aistersheim * Herzog Maximilian I. von Baiern überschreitet mit einem aus 30.000 Mann bestehendem Heer der Katholischen Liga die Grenze nach Österreich. Das von Tserclaes von Tilly geleitete Heer erobert das von Bauern besetzte Schloss Aistersheim.
31. 7 1620 - Der Ulmer Vertrag sichert die Besetzung Oberösterreichs
Ulm * Im Ulmer Vertrag wird - durch französische Vermittlung - ein Neutralitätsabkommen zwischen der katholischen Liga und der protestantischen Union geschlossen, das sich aber nicht auf Böhmen erstreckt.
Damit ist Herzog Maximilian I. vor einem Angriff der Union sicher und kann mit seinem stattlichen Heer, bestehend aus 24.500 Mann zu Fuß und 5.500 Reiter, vor der oberösterreichischen Grenze aufmarschieren.
4. 8 1620 - Maximilian I. zieht mit seinem Liga-Heer in Linz ein
Linz * Das von Baiern geführte Heer der Katholischen Liga zieht mit Herzog Maximilian I. an der Spitze ins Schloss der Landeshauptstadt Linz ein.
20. 8 1620 - Herzog Maximilian I. lässt sich in Linz huldigen
Linz * Baierns Herzog Maximilian I. erzwingt von den oberösterreichischen Landständen die Auslieferung der Konföderationsurkunde mit Böhmen und empfängt die Huldigung.
26. 9 1620 - Herzog Maximilian I. überschreitet die böhmische Grenze
Böhmen * Baiernherzog Maximilian I. von Baiern überschreitet mit seinem Heer der Katholischen Liga, das sich zuvor dem kaiserlichen Heer vereinigt hatte, die böhmische Grenze.
10 1620 - Die „Rebellion von Prag“ ist der erhoffte Anlass zum Krieg
Prag * Für Erzherzog Ferdinand ist die „Rebellion von Prag“ der erhoffte Anlass, um gegen die „böhmischen Stände“ loszuschlagen.
Die „Ständevertreter“ interpretieren ihre Gewalttat als Notwehr, doch für den habsburgischen Kaisersohn ist die kriegerische Niederwerfung der „Aufständischen“ unausweichlich geworden.
Die dafür notwendige Finanzierung soll durch die eingezogenen Güter der „Rebellen“ sichergestellt werden.
Außerdem soll „der Schrecken der Hinrichtungen die Stände zum Gehorsam zwingen“.
In Prag geht inzwischen das Gerücht um, dass die „Jesuiten“ eine „Bluthochzeit“, also die Ermordung der Protestanten, planen. Andererseits streuen die kaiserlich Gesinnten das Gegengerücht, wonach die „böhmischen Stände“ vom „türkischen Kaiser Hilfe begehrt hätten“.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den „Kaiserlichen“ und den „Böhmischen“ beginnen.
Am Abend des 7. 11 1620 - Die katholisch- kaiserliche Armee steht westlich vor Prag
Prag * Die katholisch- kaiserliche Armee steht westlich vor Prag.
Am Morgen des 8. 11 1620 - Die Schlacht am Weißen Berg entbrennt
Prag * Der Karmeliten-Pater Dominicus a Jesu Maria tritt mit einem von kalvinistichen Bilderstürmern geschändeten Marienbild um den Hals und dem Kreuz in der Hand vor die Söldnertruppen und ruft im mitreißenden Glaubenseifer zum Kampf auf. Engel würden die katholische Sache zum Sieg führen. Der Schlachtruf lautet: „Maria!“
Am Weißen Berg entbrennt der Kampf gegen das böhmische Ständeheer. Eine Übermacht von 32.400 kaiserlichen Infanteristen und 7.550 Reitern tritt gegen 8.000 böhmische Fußsoldaten und 5.000 Kavalleristen an. In nur einer einzigen Stunde erringen die Kaiserlichen einen triumphalen Sieg über die böhmischen Rebellen.
Domenicus a Jesus Maria stilisiert anschließend den Kampf zu einer Schlacht des Katholizismus gegen den Unglauben hoch. Die vernichtende Niederlage des protestantischen Heeres wird dementsprechend als Sieg des Katholizismus und schließlich als göttliches Wunder umgedeutet.
Im Morgengrauen des 9. 11 1620 - Der „Winterkönig“ Friedrich V. flieht Hals über Kopf
Prag * Der „Winterkönig“ Friedrich V. flieht Hals über Kopf von der Burg. Der Prager Hradschin ist damit wieder fest in der Hand des katholischen Kaisers.
Friedrich V. wird zum Rädelsführer einer „im Reich teutscher Nation niemalen erhört, gesehenen noch gelesenen Rebellion“ erklärt und unter „des Heiligen Reichs Acht“ gestellt. „Seine Liebden“ Maximilian habe über das Heer der Rebellen „durch Verleyhung Göttlicher Gnaden und Beistand obgesiegt“.
1621 - Im Pütrichhaus wird ebenfalls sie Klausur eingeführt
München-Graggenau * Im Pütrichhaus wird ebenfalls sie Klausur eingeführt. Damit sind die beiden ältesten Münchner Seelhäuser zu traditionellen Klöstern geworden.
1621 - Kaiser Ferdinand II. erklärt den „Josephstag“ zum Feiertag
Wien * Kaiser Ferdinand II. erklärt den „Josephstag“ zum Feiertag und gibt damit den Auftakt für den neuen Heiligenkult.
Ab der Brausaison 1621 - Das „Bockbier“ wird ein eigener Rechnungsposten
München-Graggenau * Die von Elias Pichler kreierte neue „Bier-Spezialität“, das „Bockbier“, taucht bei allen Abrechnungen der Sudstätte als eigener Rechnungsposten auf.
22. 1 1621 - Kaiser Ferdinand II. erklärt Friedrich V. zum Reichsfeind
Wien * Kaiser Ferdinand II. erklärt Friedrich V. zum Reichsfeind - ohne die üblichen Formvorschriften zu erfüllen. Dadurch kann der Habsburger sein Versprechen gegenüber Herzog Maximilian I. von Baiern erfüllen: Die Belehnung mit der pfälzischen Kur.
29. 1 1621 - Eine schnelle Klärung der Pfandherrschaft über Oberösterreich
München - Wien * In Wien trifft die von Herzog Maximilian I. beauftragte baierische Gesandtschaft ein. Sie soll eine möglichst schnelle Klärung der Pfandherrschaft über Oberösterreich herbei führen.
15. 2 1621 - Ein Pfandschaftsrezeß über Oberösterreich wird unterzeichnet
Wien * Ein Pfandschaftsrezeß wird unterzeichnet. Er beinhaltet die pfandweise Überlassung von Oberösterreich einschließlich des Kammergutes, dessen wichtigster Faktor das Salzwesen bildet, an Baiern.
6. 3 1621 - Oberösterreich an das Herzogtum Baiern verpfändet
Wien - Linz * Kaiser Ferdinand II. informiert die Landstände in Linz, dass Oberösterreich an das Herzogtum Baiern verpfändet wird.
24. 4 1621 - Die protestantische Union löst sich selbst auf
Heilbronn * Die protestantische Union löst sich beim Unionstag in Heilbronn - unter dem Eindruck der militärischen Überlegenheit der kaiserlichen Heere und der katholischen Liga - selbst auf.
21. 6 1621 - In Prag wird ein blutiges Gericht über die Aufständischen gehalten
Prag * Nach dem Zusammenbruch des Böhmischen Aufstands und der Flucht des Winterkönigs Friedrich V. lässt Kaiser Ferdinand II. - vor dem Altstädter Rathaus in Prag - ein blutiges Gericht über seine Anhänger halten.
43 Todesurteile gegen protestantische böhmische Adelige werden gesprochen, 27 werden an diesem Tag öffentlich vollstreckt. 24 durch das Schwert, drei am Galgen. Zwölf der abgeschlagenen Köpfe werden zur Abschreckung am Prager Brückenturm aufgesteckt und erst zehn Jahre später durch die sächsische Besatzungsmacht entfernt.
6. 9 1621 - Neudeck wird eine geschlossene Hofmark
Au * Neudeck wird geschlossene Hofmark.
22. 9 1621 - Herzog Maximilian I. erhält die pfälzische Kurwürde
Wien - München • Herzog Maximilian I. von Baiern erhält von Kaiser Ferdinand II. die pfälzische Kurwürde. Die Übertragung wird aber geheim gehalten.
8. 12 1621 - Maximilian Heinrich, der spätere Kurfürst von Köln, wird geboren
München * Maximilian Heinrich, der spätere Fürstbischof und Kurfürst von Köln, wird in München geboren. Er ist ein Sohn von Herzog Albrecht VI. und dessen Ehefrau Mechthildis von Leuchtenberg.
Sein Bruder Albrecht Sigismund wird Bischof von Freising und Regensburg. Zu seinen Onkeln zählen Kurfürst Maximilian I. sowie der Erzbischof und Kurfürst Ferdinand von Köln.
1622 - Herzog Maxililian I. veröffentlicht Mandate zu den Hexenprozessen
München * Herzog Maxililian I. veröffentlicht Mandate zu den Hexenprozessen.
Bis 1622 - Die „Franziskaner-Klöster“ werden von „Reformaten“ übernommen
Herzogtum Baiern * Die anderen altbaierischen „Franziskaner-Klöster“ - in Landshut, Ingolstadt und Kelheim sowie die geistliche Leitung des „Klarissinnenklosters St. Jakob am Anger“ - werden von „Reformaten“ übernommen.
Viele der alten „Observanten“ verlassen daraufhin die neue Provinz wegen des „welschen guberno“, also der Vorherrschaft ihrer italienischen Mitbrüder.
Doch schon innerhalb einer Generation sind die einheimischen „Reformaten“ wieder nachgewachsen.
1622 - Die Neugestaltung des „Hochaltars“ der „Frauenkirche“ ist abgeschlossen
München-Kreuzviertel * Die Neugestaltung des „Hochaltars“ der „Frauenkirche“ ist abgeschlossen.
1623 - Kaiser Ferdinand II. erhebt Georg Schobinger in den erblichen Adelsstand
Wien - München * Kaiser Ferdinand II. erhebt Georg Schobinger in den erblichen Adelsstand.
Ab 1623 - Der „Hofgarten“ wird in die Umwallung einbezogen
München-Graggenau * Der „Hofgarten“ wird in die Umwallung einbezogen.
7. 1 1623 - Der Regensburger Fürstentag beginnt
Regensburg * Der Regensburger Fürstentag beginnt. Um die Verhältnisse nach der Niederschlagung des Böhmischen Aufstands zu regeln, lädt Kaiser Ferdinand II. die Regenten aus Köln, Mainz, Trier, Kursachsen, Brandenburg, Braunschweig-Wolfenbüttel, Pommern, Hessen-Darmstadt, Baiern, Salzburg und Bamberg zu einem Treffen nach Regensburg.
Bis auf Hessen-Darmstadt lehnen alle protestantischen Fürsten die Teilnahme ab. Sachsen und Brandenburg entsenden lediglich Beobachter zu dieser Besprechung.
25. 2 1623 - Herzog Maximilian I. von Baiern erhält die pfälzische Kur offiziell
Regensburg * Kaiser Ferdinand II. löst sein Versprechen ein und belehnt Herzog Maximilian I. von Baiern auf dem Regensburger Fürstentag mit der pfälzischen Kur des gestürzten Winterkönigs Friedrich V.. Wie verabredet erhält er die Kurwürde nur auf Lebenszeit. Außerdem wird ihm die Oberpfalz zugesprochen. Die Rheinpfalz kommt unter baierische und spanische Verwaltung.
Damit ist die katholische Mehrheit im siebenköpfigen Kurfürstenkollegium gesichert. Die baierischen Wittelsbacher besitzen nun - mit Köln - über zwei der sieben Kurwürden.
10. 3 1623 - Herzog Wilhelm V. kauft die Hofmark Neudeck
<p><strong><em>Au</em></strong> * Herzog Wilhelm V. kauft Johann Hebenstreit die Hofmark Neudeck um 15.000 Gulden ab. </p>
13. 5 1623 - Handwerker-Protest gegen die Seidenwirker
München * Als die Gebrüder Beniamin und Sinj aus Florenz das Unternehmen der Gebrüder Bettega übernehmen wollen, laufen die Münchner Handwerker der „Loder, Leinweber, Strumpfwürckher und Gschlachtgwandter“ dagegen Sturm, da ihnen die besten Spinnerinnen „von den Italiänern abgerungen werden [...] und das clainod vnd fürnembste comercium des landts, das gewerbe mit loden, Tuech, federrith, handschuech und strimpf geht zu grund“.
Der Münchner Bürgermeister unterstützt den Protest der ansässigen Handwerker mit dem Argument, dass der Holzverbrauch der Seidenwirker unvergleichlich hoch sei.
Doch Herzog Maximilian I. erhebt sich über die Proteste und erteilt für die „besonders lieben Beniamin und Sinj“ am 13. Mai 1623 das erbetene Privileg, da sie „weeder mit einer abwerbung der gespunstleüth noch in ander weeg den loders etc. khainen eintrag thuen“. Außerdem dürfen für die Arbeiten nur Leute beschäftigt werden, die aus Orten kommen, die fünf Meilen entfernt sind.
11. 7 1623 - Kurfürst Maximilian I. verlangt einen Beitrag zu den Kriegskosten
München * Kurfürst Maximilian I. verlangt von seiner Haupt- und Residenzstadt einen Beitrag zu den Kriegskosten in Höhe von 50.000 Gulden. Zur Finanzierung des Betrags muss die Stadt ihrerseits eine Anleihe bei ihren Bürgern aufnehmen. München wird unter der so herbeigeführten Verschuldung noch jahrzehntelang leiden.
5. 8 1623 - Albrecht Sigismund wird in München geboren
München • Herzog Albrecht Sigismund, der spätere Fürstbischof von Freising und Regensburg sowie Hofmarkherr von Berg am Laim, wird in München geboren. Seine Eltern sind der baierische Herzog Albrecht VI. und Mechthilde von Leuchtenberg.
29. 10 1623 - Einweihung der Carl-Borromäus-Kirche
Au * Bischof Veit Adam von Gepeckh weiht die Carl-Borromäus-Kirche in der Au ein.
5. 12 1623 - Albrecht Sigismund, der spätere Bischof von Freising kommt zur Welt
München * Albrecht Sigismund, der spätere Bischof von Freising und Regensburg, kommt in München zur Welt. Er ist der Sohn von Herzog Albrecht VI. und seiner Ehefrau Mechthilde von Leuchtenberg, der Tochter des Landgrafen Georg Ludwig von Leuchtenberg.
1624 - Öffnungszeiten des „Weinmarkts“ auf dem „Schrannenplatz“
München-Graggenau * Der „Weinmarkt“ wird jetzt jeden Montag und Dienstag auf dem „Schrannenplatz“ abgehalten.
Ab 1624 - Das „Alte Rathaus“ wird im Stil der Spätrenaissance umgestaltet
München-Graggenau * Das „Alte Rathaus“ verliert sein gotisches Gesicht.
Es wird im Stil der Spätrenaissance umgestaltet.
1624 - Der Stadtrat lässt Bettler mit „Zwangsarbeit beim Schanzenbau“ einsetzen
München * In einem Bericht an Kurfürst Maximilian I. betont der Stadtrat, dass er starke „Bettler und Bettlerinnen“ in „Eisen schlagen“ und anschließend zur „Zwangsarbeit beim Schanzenbau“ einsetzen lässt.
Mit diesen Zwangsmaßnahmen wollen die „Stadt- und Landesherren“ den „Arbeitsscheuen“ den „Teufel des Müßiggangs“ austreiben.
Doch nach ihrer Entlassung finden die „Bettler“ trotzdem keine Möglichkeit der Beschäftigung vor.
Anfang 10 1624 - Die „Basilianer“ werden fristlos entlassen
Au * Die „Basilianer“ werden fristlos entlassen, da sie „zur Seelsorge nicht taugen und ein burschikoses Leben führen“.
4. 10 1624 - Der Beginn der Rekatholisierung in Oberösterreich
Wien - Oberösterreich * In das von Kaiser Ferdinand II. an das Herzogtum Baiern verpfändete Oberösterreich soll eine Reformkommission die evangelisch gewordenen Untertanen wieder katholisch machen. Durch ein Patent Kaiser Ferdinands II. wird die Ausweisung aller evangelischen Schulmeister und Prediger im Lande ob der Enns verfügt.
Da die freigewordenen Pfarrstellen nicht mit einheimischen Pfarrern besetzt werden können, holt man italienische Priester aus dem italienischen Teil Tirols. Diese sprechen kaum deutsch und können deshalb die Messe, wie es zuvor üblich war, nicht in der Landessprache halten.
Etwa 1625 - Der „Marktbrunnen“ trägt die Bezeichnung „Fischbrunnen“
München-Graggenau * Der „Marktbrunnen“ trägt die Bezeichnung „Fischbrunnen“.
Bei ihm findet der „Fischmarkt“ statt.
1625 - König Christian IV. von Dänemark greift in den Krieg ein
Dänemark * König Christian IV. von Dänemark greift auf der Seite der von Frankreich, England und den Niederlanden unterstützten „Protestanten“ in den Krieg ein.
Damit wird aus dem „Böhmisch-Pfälzischen Krieg“ der „Dänisch-Niederländische Krieg“.
1625 - Papst Urban bestätigt die „Franziskanerprovinz“
Rom-Vatikan - München * Papst Urban VIII. bestätigt die von Kurfürst Maximilian I. angestrebte selbstständige baierische „Franziskanerprovinz zum heiligen Antonius von Padua“.
Ab 1625 - Im „Fürstbistum Bamberg“ werden 630 Menschen als „Hexen“ hingerichtet
Bamberg * Unter „Fürstbischof“ Johann Georg II. Fuchs von Dornheim sollen alleine zwischen 1625 und 1630 nicht weniger als 236 Menschen verbrannt worden sein.
Insgesamt werden im „Fürstbistum Bamberg“ zwischen 1616 und 1630 mindestens 630 Menschen als vermeintliche „Hexen“ hingerichtet.
1625 - Zur Seidenherstellung Maulbeerbäume pflanzen
München * In einem Reskript befiehlt Kurfürst Maximilian I., „in dero Fürstenthumb und landen zu deroselben wie auch der underthanen prouit [Profit], nuzen und aufnehmen mehrere Comercia und gwerschafften, auch eine von Seidenwerkh zu introducieren“.
Dazu fordert er seine Verwaltungsleute auf, Rückmeldungen über bereits vorhandene Maulbeerbäume zu liefern. Seine Untertanen ermuntert er, „an allen tauglichen Orten Maulbeerbäume zu pflanzen“. Aus den Berichten geht hervor, dass der Maulbeerbaum an verschiedenen Orten in Baiern wohl bekannt ist. Dennoch sind sich die Berichterstatter nahezu einstimmig einig, dass „das Klima im allgemeinen in Baiern für die Kultur des Maulbeerbaumes zu rau sein dürfte“.
In den Folgejahren nimmt dann - kriegsbedingt - das Interesse an der Seidenzucht stark ab. Der Dreißigjährige Krieg lässt alle weiteren Versuche scheitern.
1 1625 - Die oberösterreichischen Bauern wehren sich
Natternbach - Oberösterreich * Der Dechant Blasius de Livo und der von ihm eingesetzte italienische Pfarrer von einigen Hundert Bauern mit Steinen beworfen und verjagt.
Das bleibt zunächst ohne Konsequenzen, bringt aber eine Reihe von Ereignissen in Gang die im Oberösterreichischen Bauernkrieg enden.
15. 5 1625 - Das grausame Frankenburger Würfelspiel
Frankenburg * Ein Zentrum des oberösterreichischen Aufstands gegen die baierische Besatzungsmacht ist der Ort Frankenburg bei Völklabruck. Hier wird ein Exempel statuiert.
Man treibt rund 5.000 Bauern aus Frankenburg und Umgebung auf dem „Haushamer Feld“ zusammen und erklärt den 36 Anführern, dass sie wegen Widerstands zum Tode verurteilt sind. Aus Gnade wolle man aber der Hälfte das Leben schenken. Um diese Hälfte zu ermitteln, werden Paare gebildet, die um ihr Leben würfeln sollen. An 16 Verlierern wird das Todesurteil sofort vollstreckt, zwei Todgeweihte werden begnadigt.
Das Frankenburger Würfelspiel wird zum Auslöser für den großen oberösterreichischen Bauernaufstand im Mai 1626.
10. 10 1625 - Eine Religionsedikt für Oberösterreich
Wien - Oberösterreich * Nach einer kaiserlichen Instruktion wird in dem von Baiern besetzten Oberösterreich durch ein Religionsedikt die totale Gegenreformation eingeführt.
Alle protestantischen Einwohner Oberösterreichs müssen bis Ostern 1626 katholisch werden - oder auswandern. Wer sich zu diesem Schritt entschließt, muss zehn Prozent seines Vermögens als Nachsteuer bezahlen.
8. 12 1625 - Ferdinand III. wird zum König von Ungarn gekrönt
Ungarn * Ferdinand III. wird zum König von Ungarn gekrönt.
Ab 1626 - Die Hexenverfolgungen in Bistum Würzburg werden ausgeweitet
<p><strong><em>Bamberg</em></strong> * Der Neffe des Bamberger Fürstbischofs Johann Georg II. Fuchs von Dornheim, Philipp Adolf von Ehrenberg, ein <em>„Eiferer“</em>, weitet in den Jahren 1626 bis 1630 die Hexenverfolgungen massiv aus.</p> <p>Dabei geraten - im Gegensatz zum üblichen Verlauf der Verfolgungen - zahlreiche Adelige und Bürger, aber auch Ordensleute und sogar das Verfolgungspersonal selbst in den Sog der <em>„Trudenjagd“</em>.</p> <p>Nach der Beendigung der Hexenverfolgung durch eine Entscheidung des Reichskammergerichts und dem Einmarsch der schwedischen Truppen sind in der Stadt Würzburg 220 Personen und im Hochstift Würzburg über 900 Menschen als Hexen erst geköpft und dann verbrannt worden. </p>
1626 - Erste Stimmen der Jesuiten gegen die Verfolgung der Hexen
<p><strong><em>München</em></strong> * Selbst unter den Jesuiten gibt es erste Stimmen, die sich entschieden gegen die Verfolgung der Hexen aussprechen. Dazu gehört der Jesuitenpater Adam Tanner, der sich im dritten Band seines Werkes <em>„Theologiae Scholasticae“</em> vehement gegen die Ansicht wehrt, dass Gott es zulassen würde, dass neben vielen <em>„Schädlichen“</em> auch viele <em>„Unschuldige“</em> sterben müssten.</p> <p>Tanner bejaht zwar die Existenz der Hexen, glaubt grundsätzlich an den <em>„Teufelspakt“</em> und sieht in der Hexerei<em> </em>ein <em>„todeswürdiges Verbrechen“</em>, dem der Prozess zu machen sei.</p> <ul> <li>Er verlangt aber auch, dass bis zum Beweis des Gegenteils von der Unschuld der Angeklagten auszugehen sei.</li> <li>Geständnisse unter der Folter dürfen keine Begründung für einen Urteilsspruch<em> </em>sein. </li> </ul> <p>Seine Forderungen bringen dem Jesuiten Adam Tanner mannigfache Anfeindungen ein.<br /> Erboste Inquisitoren drohen ihm sogar die Folter an. </p>
7. 2 1626 - Der Alt-Herzog Wilhelm V. stirbt in München
<p><strong><em>München - Au</em></strong> * Der Alt-Herzog Wilhelm V. stirbt in München. Seine Grabstätte befindet sich in der <em>„Michaelskirche“</em>. </p> <p>Sein Lieblingssohn, Herzog Albrecht VI., erbt die <em>„Hofmark Neudeck“</em>. </p>
Um den 12. 5 1626 - In Oberösterreich bricht ein Bauernkrieg los
<p><em><strong>Lembach im Mühlkreis - Oberösterreich</strong></em> * Mit dem Frankenburger Würfelspiel sollte ein Exempel statuiert werden. Doch wächst dadurch der Zorn der protestantischen Bauern noch stärker, worauf im Mai 1626 der Bauernkrieg durch erste Kampfhandlungen in Lembach im Mühlkreis beginnt. Bei einer Rauferei im Markt Lembach werden sechs baierische Soldaten getötet.</p> <p>Der Oberösterreichische Bauernkrieg richtet sich gegen Kurfürst Maximilian I. und die baierische Besatzungsmacht. Zehntausende Bauern versammeln und organisieren sich. Über ihren Haufen wehen schwarze Fahnen, die mit Totenköpfen geschmückt sind.</p> <p>Eines ihrer Kampfleder lautet:<br /> <em>„Von Baiern Joch und Tyrannei,<br /> Und seiner großen Schinderei,<br /> Mach uns, o lieber Herr Gott, frei!“ </em></p>
16. 5 1626 - Der Stiftungsbrief für die Pfarrei Neudeck wird unterzeichnet
München - Au * Kurfürst Maximilian I. unterzeichnet den Stiftungsbrief für die Pfarrei Neudeck.
21. 5 1626 - Eine missglückte katholische Strafexpedition im Mühlkreis
Peuerbach - Oberösterreich * Eine Strafexpedition soll die Unruhen im Mühlkreis niederschlagen. Doch die geschickt operierenden und zahlenmäßig überlegenen Aufständischen können die Truppen des Statthalters in Peuerbach vernichtend schlagen.
24. 6 1626 - Linz wird von den aufständischen Bauern belagert
Linz * Die unter baierischer Pfandschaft stehende oberösterreichische Landeshauptstadt Linz wird von aufständischen Bauern belagert und kann von ihnen trotz mehrerer Sturmangriffe nicht eingenommen werden.
26. 6 1626 - Kurfürst Maximilian I. erlässt eine Kleiderordnung
München * Kurfürst Maximilian I. erlässt eine Kleiderordnung, die die Bevölkerung in sieben Gesellschaftsgruppen einteilt.
10. 9 1626 - Ein Waffenstillstand mit den aufständischen Bauern
Linz * Ein Waffenstillstand zwischen den baierischen Truppen und den aufständischen oberösterreichischen Bauern wird für die Zeit vom 10. bis einschließlich 18. September 1626 geschlossen. Damit scheint der Oberösterreichische Bauernkrieg für beendet.
17. 10 1626 - Kurfürst Maximilian I. ruft Wallenstein zu Hilfe in Oberösterreich
München - Oberösterreich * Kurfürst Maximilian I. schreibt an Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, genannt „Wallenstein“, er möge einen Teil seiner Armee „zur Stillung der Unruhen nach Oberösterreich“ senden.
20. 10 1626 - Jakob Balde erhält in der Loretokapelle seine niederen Weihen
Berg am Laim * Jakob Balde erhält in der Berg am Laimer Loretokapelle seine Tonsur und die niederen Weihen.
26. 10 1626 - Agostino Barelli wird in Bologna geboren
Bologna • Agostino Barelli, der spätere Architekt der Theatinerkirche, wird in Bologna geboren.
11 1626 - Eine baierische Elite-Armee besiegt die aufständischen Oberösterreicher
Oberösterreich * Erst eine baierische Elite-Armee unter Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim besiegt die aufständischen Oberösterreicher unter großen Mühen.
Um den 25. 11 1626 - Die aufständischen Bauern werden in vier blutigen Schlachten geschlagen
Oberösterreich * Eine baierisch-kaiserliche Armee besiegt in vier blutigen Schlachten die sich tapfer und verzweifelt wehrenden Bauern in Oberösterreich vollständig. 8.000 Bauern kommen dabei ums Leben.
Ende November herrscht wieder Ruhe im Land. Ein weiterer Widerstand der Untertanen ist nicht mehr zu befürchten.
1627 - Die „kaiserlich-katholischen Truppen“ besetzen Jütland
Jütland * Die „kaiserlich-katholischen Truppen“ besetzen Jütland.
1. 3 1627 - Ursula Bonschab wird der Hexerei beschuldigt
Eichstätt * Ursula Bonschab wird der Hexerei beschuldigt. Sie wurde aufgrund von 16 Denunziationen gefangen genommen und „gütlich und peinlich vernommen“. 20 Tage hält sie den Qualen einer extrem grausamen und sich immer steigernden Folterprozedur stand, erst dann ist die selbstbewusste Frau gebrochen.
Sie gesteht schließlich alles, was man ihr vorsagt: „Wetterzauber, Kinderausgraben, Coitus mit dem ‚bösen Feind‘, Schadzauber mit Pulver und Salben an Menschen und Tieren“. Außerdem nennt sie noch 34 „Gespielinnen“, an denen sich die fürstbischöflichen Kommissare im Anschluss ebenfalls vergehen.
8. 5 1627 - Ursula Bonschab wird „von Rechts wegen“ als Hexe verbrannt
Eichstätt * Ursula Bonschab wird „von Rechts wegen“ als Hexe mit dem Schwert der Kopf abgeschlagen und ihr Körper anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das nicht unbeträchtliche Vermögen der Bürgermeisterin wird vom Fürstbischof Johann Christoph von Westerstetten, seinen Terrorkommissaren, Foltermeistern und Henkerknechten geraubt.
20. 8 1627 - Die Paulanermönche werden in die Au geholt
Au * Die Paulanermönche werden in die Au geholt.
10 1627 - Die „Pest“ verbreitet sich in ganz Baiern
Kurfürstentum Baiern * Die „Pest“ verbreitet sich in ganz Baiern.
17. 11 1627 - Zwölf Paulaner-Mönche treffen in der Au ein
Au * „8 Väter und 4 Laienbrüder des Ordens der minderen Brüder des heiligen Franziskus von Paula“ treffen in der Au ein.
27. 11 1627 - Ferdinand III. wird zum König von Böhmen gekrönt
Böhmen - Prag * Ferdinand III. wird zum König von Böhmen gekrönt.
1628 - „Bücherverbrennung“ in der rekatholisierten Oberpfalz
Oberpfalz * „Bücherverbrennungen“ in der rekatholisierten Oberpfalz.
1628 - Die „Marianische Kongregation Maria, Königin der Engel“
München * Die „Marianische Deutsche Kongregation der Herren und Bürger zu Unserer Lieben Frauen Verkündigung“ beschließt aus „Angst vor Überfremdung“, keine Junggesellen mehr als „Sodalen“ aufzunehmen, „sofern sie nit in fürstlichen Diensten, Herrn- oder Bürgers-Sohn seynd“.
Daraufhin gründen die „ledigen Mannspersonen“ eine eigene „Kongregation“ unter dem Namen „Maria, Königin der Engel“.
1628 - Kurfürst Ferdinand von Köln verstärkt die Hexenverfolgung
Köln * Kurfürst Ferdinand von Köln, sowie Bischof von Lüttich, Hildesheim, Münster und Paderborn, erlässt eine überarbeitete „Hexenprozessordnung“, in der er die Regelungen der kaiserlichen „Halsgerichtsordnung - Constitutio Criminalis Carolina“ verschärft und den Einsatz der „Folter“ erleichtert.
1628 - Die „kaiserlich-katholischen Truppen“ besetzen Mecklenburg und Pommern
Mecklenburg - Pommern * Die „kaiserlich-katholischen Truppen“ besetzen Mecklenburg und Pommern.
Ab 1628 - Im „Fürstentum Pfalz-Neuburg“ sterben über 100 „Hexen“
Neuburg * Das Jahr ist von einer extrem kalten Witterung geprägt, die zu Ernteausfällen und „Pestepidemien“ führt.
Im „Fürstentum Pfalz-Neuburg“ sterben zwischen 1628 und 1630 etwa achtzig der „Hexerei“ bezichtigte Personen, in Neuburg sind es 22.
22. 2 1628 - Kurfürst Maximilan I. gibt seinem oberösterreichischen Pfandbesitz zurück
München - Wien * Kurfürst Maximilan I. ist durch die Aufstände die Freude an seinem oberösterreichischen Pfandbesitz abhanden gekommen. In einem in München geschlossenen Vertrag wird das Land gegen den Besitz der Oberpfalz und Gebieten der Rheinpfalz an Kaiser Ferdinand II. zurückgegeben.
22. 2 1628 - Die baierische Kurwürde wird erblich
München * Der zweite Münchner Vertrag zwischen Kaiser Ferdinand II. und Kurfürst Maximilian wird unterzeichnet. Er beinhaltet, dass
- die am 25. Februar 1623 nur auf Lebenszeit verliehene Kurwürde auch auf Maximilians Erben übertragen wird,
- die Oberpfalz und die rechts des Rheins liegenden Gebiete der unteren Pfalz um 13 Millionen verkauft werden,
- Baiern Oberösterreich wieder an den Kaiser zurückgibt.
4. 3 1628 - Die Kurwürde Baierns wird erblich
München * Kurfürst Maximilian I. von Baiern erhält die erbliche Kurwürde offiziell verliehen. Die ihm am 25. Februar 1623 übertragene Kurwürde war nur „auf Lebenszeit“. Jetzt ist die baierische Kurwürde erblich, doch der 55-jährige Kurfürst Maximilian I. hat noch keinen Erben. Die Rangerhöhung Baierns vom Herzogtum zum Kurfürstentum wird im ganzen Land kundgetan.
Im siebenköpfigen Kurfürstenkollegium scheint damit die katholische Mehrheit auf Dauer gesichert. Gleichzeitig fühlen sich aber die protestantischen Reichsstände zu erhöhtem Widerstands- und Kampfeswillen herausgefordert.
27. 4 1628 - Kurfürst Maximilian I. macht die Oberpfälzer wieder katholisch
München - Amberg * Kurfürst Maximilian I. erlässt, nachdem er mit der Oberpfalz belehnt worden ist, ein Religionsmandat mit dem eine radikale Gegenreformation eingeleitet wird.
5. 5 1628 - Oberösterreich geht von Baiern wieder an den Kaiser
München - Linz * Oberösterreich wird von Baiern an die Bevollmächtigten des Kaisers übergeben.
6. 8 1628 - Die Feuermadonna der Marianischen Männerkongregation
Köln - München-Kreuzviertel * Der Kölner Kurfürst und Erzbischof Ferdinand, ein Bruder des baierischen Kurfürsten Maximilian I., schenkt der Münchner Marianischen Männerkongregation ein Stück jener Eiche, in deren Inneren im Jahr 1609 im flandrischen Foy eine Marienfigur gefunden worden war.
Der Hofbildhauer Hans Krumper formt daraus die sogenannte „Feuermadonna“, die noch heute von der Marianischen Männerkongregatio“ in Ehren gehalten wird.
28. 9 1628 - Das erste Opfer der Pest
München * Im Haus des Geheimen Rats Bartholomäus Richel stirbt eine Magd vermutlich an der Pest. Umgehend werden alle Kontaktpersonen der Verstorbenen für zwanzig Wochen in Gartenhäusern vor der Stadtmauer isoliert. Durch diese Maßnahme kann eine Verbreitung der Seuche vermieden und die Zahl der Opfer klein gehalten werden.
1629 - Das Mariengnadenbild wird den Paulaner-Mönchen übergeben
Au * Das Mariengnadenbild, das Sebastian Rottaw in Frankreich vor den Kalvinisten gerettet hatte, wird den Paulaner-Mönchen übergeben.
1629 - Barbara Perhofer aus Aubing muss sich auf den „Pranger“ stellen
München-Kreuzviertel * Eine Barbara Perhofer aus Aubing muss sich - mit eingeflochtenen Strohzöpfen und einen Strohkranz auf dem Kopf - zur Strafe eine Stunde an der „Soldatenwache“ auf dem Marktplatz auf den „Pranger“ stellen.
Erstmals taucht in diesem Bericht die „Alte Hauptwache“ am „Thomaßeck“ auf.
1629 - Kardinal Richelieu bietet Baiern ein „Defensivbündnis“ an
Paris - München * Kardinal Richelieu, der Leiter der französischen Politik, bietet Baiern ein „Defensivbündnis“ an.
1629 - König Gustav II. Adolf lässt sich einen dreijährigen Krieg finanzieren
Schweden * König Gustav II. Adolf lässt sich von den schwedischen „Ständen“ finanzielle Mittel „für einen Krieg von drei Jahren in Deutschland“ gewähren.
Der Schwedenkönig sieht seine Vormachtstellung im Ostseeraum durch die Ausdehnung der Habsburger Macht in den Norden gefährdet.
Ab 1629 - Wemding ist erneut das Zentrum einer „Hexenverfolgung“
Wemding * Im „Kurfürstentum Baiern“ ist Wemding von 1629 bis 1630 erneut das Zentrum einer „Hexenverfolgung“.
Die baierische Enklave liegt auf fränkischem Gebiet und ist umgeben von den Auswirkungen der dortigen „Hexenverfolgungen“.
„Denunziation“ aus dem „Herzogtum Pfalz-Neuburg“ und der „Grafschaft Oettingen“ führen auch hier zu einer neuen Verfolgungswelle - trotz der gemachten schlechten Erfahrungen.
Vierzig Personen werden Opfer des „Hexenwahns“.
1629 - Auch Ingolstadt bekommt noch einen Hexenprozess
Ingolstadt * Auch Ingolstadt bekommt einen Hexenprozess. Das Strafurteil fällt die Juristenfakultät der Universität Ingolstadt, die zwar im Allgemeinen milder urteilte, als es dem Herzog gefiel, dennoch einige Todesurteile fällte. Verurteilt wird die Hofschneiderin Catharina Nickhlin wegen „Teufelsbündnis, Teufelsvermischung, Absagung Gottes, Schädigung von Mensch und Vieh“ und wegen „Verunehrung der Hostien“.
Catharina Nickhlin stammt aus Eichstätt und wird aus dem Kreis der dort wegen Hexerei verbrannten Frauen und Männer denunziert. Sie flieht nach Ingolstadt, wird aber dort auf Ersuchen der Eichstätter Behörden am 13. Februar 1629 verhaftet. Nachdem sich die Stadt Ingolstadt gegen den Hexen-Prozess wehrt, muss ein Dr. Wolfgang Kolb auf Befehl des Münchner Hofrats die Tortur durchführen. Dr. Kolb hat vorher schon als Hexen-Kommissar in Eichstätt gedient.
24. 2 1629 - Die Paulaner übernehmen die Pfarrei in der Au
Au * Die Paulaner übernehmen die kirchliche Seelsorge der Pfarrei in der Au.
24. 2 1629 - Die Au wird erstmals als Vorstadt bezeichnet
Au * Die Au wird erstmals als Vorstadt bezeichnet.
6. 3 1629 - Kaiser Ferdinand II. erlässt das Restitutionsedikt
Wien * Kaiser Ferdinand II. erlässt - in Übereinstimmung mit den Kurfürsten von Mainz, Köln, Trier und Baiern - das Restitutionsedikt, das jede „Entfremdung von katholischem Kirchengut nach dem Stichjahr 1552 für unrechtmäßig“ erklärt.
Davon betroffen sind rund 500 Klöster und Konvente vor allem in Niedersachsen und Württemberg, die Erzbistümer Bremen und Magdeburg sowie zwölf reichsunmittelbare Bistümer in Norddeutschland. Nur Meißen, Merseburg und Naumburg werden dem Kurfürsten von Sachsen aus politischen Rücksichten vorerst überlassen. Es erhebt sich nicht nur bei den protestantischen Reichsständen lauter Protest. Selbst der Papst äußert Bedenken.
6. 7 1629 - Erfolgreiche Einführung einer neuen Foltermethode
Ingolstadt * Die Juristenfakultät der Universität Ingolstadt stellt das Todesurteil gegen Catharina Nickhlin aus, nachdem der Hofrat zuvor die Hinrichtung durch Verbrennen befohlen hat.
Dr. Kolb exekutiert in Wallerstein zwischen 1628 und 1630 zwanzig Hexen, in Wemding ist er im Jahr 1629 für die Hinrichtung der ersten neun Delinquenten verantwortlich. Den „Erfolg“ von Dr. Wolfgang Kolb führt man auf die Einführung einer neuen Foltermethode zurück: auf den „Bock“, den er erstmals im Kurfürstentum Baiern anwendet.
8. 10 1629 - Papst Urban VIII. spricht Kajetan von Thiene selig
Rom • Papst Urban VIII. spricht Kajetan von Thiene, den Mitbegründer des Ordens der Theatiner, selig.
1. 11 1629 - Die ersten vier Karmeliten treffen in München ein
München-Kreuzviertel * Die ersten vier Mönche des Ordens der Brüder der Seligen Jungfrau Maria vom Berge Karmel treffen aus Prag kommend in München ein.
4. 11 1629 - Die Niederlassung der Karmeliter wird bewilligt
Freising * Bischof Veit Adam von Freising bewilligt die erste Niederlassung der Karmeliter und weist ihnen die Nikolauskapelle in unmittelbarer Nähe der Wilhelminischen Veste [= Herzog-Max-Burg] als vorläufige Unterkunft zu.
20. 11 1629 - Die Karmeliter übernehmen die Nikolauskapelle
München-Kreuzviertel * Die Karmeliter übernehmen die Nikolauskapelle, die Herzog Wilhelm V. als Ersatz der älteren, durch den Bau der Michaelskirche abgebrochenen Kirche errichten hat lassen.
1630 - Oswald Schys von Peillenstein lässt drei Kreuze aufrichten
Haidhausen * Oswald Schys von Peillenstein, „Kurfürstlicher Geheimrat“, „Hofkammerpräsident“ und „Pfleger von Rottenburg“, kauft dem „Leprosenhaus“, dort, wo sich die Straße nach Rosenheim und die „Salzstraße“ zweigen, einen kleinen Platz ab.
Dort lässt er drei Kreuze aufrichten.
Um 1630 - Angst vor der häufig auftretenden Tollwut
München * Unter Kurfürst Maximilian I. werden eigene „Hundefänger“ und „Hundeschlächter“ besoldet, deren Aufgabe es ist, streundende Hunde einzufangen und zu erschlagen.
Dies geschieht auch aus Angst vor der damals häufig auftretenden Tollwut.
29. 1 1630 - Eine Bücherverbrennung in Amberg
Amberg * Im Zuge der Rekatholisierung der Oberpfalz lässt Kurfürst Maximilian I. vor den Toren von Amberg 11.183 unkatholische Bücher verbrennen. Diese wurden zuvor von den baierischen Beamten bei systematischen Hausdurchsuchungen eingezogen. Propagandistisch wird die Bücherverbrennung als Strafgericht inszeniert und durch Jesuitenschüler musikalisch unterstützt.
Die Rekatholisierung der Oberpfalz wird bis zum Jahr 1675 weitestgehend abgeschlossen sein.
3. 7 1630 - Ein für den Kaiser wenig erfolgreicher Regensburger Kurfürstentag
Regensburg * Kaiser Ferdinand II. eröffnet den Regensburger Kurfürstentag. Er wird bis November dauern. Auf dem Kurfürstentag will Kaiser Ferdinand II.
- die Wahl seines Sohnes Ferdinand III. zum deutsch-römischen König sichern und
- Unterstützung gegen die niederländischen Generalstaaten einfordern.
Doch die Kurfürsten verweigern die Zustimmung zur Wahl Ferdinands III. und fordern stattdessen
- eine Verringerung der kaiserlichen Armee und
- eine Milderung der Kriegskosten.
- Der kaiserliche Oberbefehlshaber Albrecht von Wallenstein wird seines Postens enthoben.
Der 71-jährige Johann Tserclaes Graf von Tilly erhält dafür zusätzlich zu seinem Kommando der katholischen Liga nun auch noch den Oberbefehl über das kaiserliche Heer. - Der Kaiser einer Überprüfung des Restitutionsedikts zustimmen.
6. 7 1630 - Gustav II. Adolf landet mit 13.000 Mann an der Küste Pommerns
Pommern * Der schwedische König Gustav II. Adolf landet mit einem Heer von 13.000 Mann an der Küste Pommerns und greift in die kriegerischen Auseinandersetzungen des Dreißigjährigen Krieges ein. Ihm werden zwei siegreiche Schlachten genügen, um die kaiserlich-katholische Position in Norddeutschland zu zerschlagen und bis an die habsburgischen Erblande vorzudringen.
1631 - Hans Spätts Sohn Georg betreibt die „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Hans Spätts Sohn Georg betreibt die „Giesinger Mühle“.
1631 - Ein breites Aufflammen der „Hexenprozesse“ im Herzogtum Westfalen
Westfalen * Ein breites Aufflammen der „Hexenprozesse“ kostet während der Zeit von 1626 bis 1631 nachweislich etwa 574 Angeklagten im Herzogtum Westfalen das Leben.
Durch die von Kurfürst Ferdinand von Köln erlassene „Hexenprozessordnung“ enden nahezu alle Anklagen mit einem Todesurteil.
12. 1 1631 - Hexen werden begnadigt, wenn sie sich freiwillig stellen
München * Durch ein weiteres Hexen-Mandat wird den Hexen Begnadigung zugesagt, wenn sie sich freiwillig stellen.
5 1631 - Eine „Defensiv-Allianz“ zwischen Frankreich und Baiern
Fontainebleau - München * In Fontainebleau wird eine „Defensiv-Allianz“ zwischen Frankreich und Baiern geschlossen.
Der Vertrag ist zwar für die Dauer von acht Jahren geschlossen, wird aber bereits im Frühjahr 1632 hinfällig.
5 1631 - Friedrich Spees Schrift gegen Folter und „Hexen-Verfolgungen“
München * Die Schrift „Cautio Criminalis“ des „Jesuitenpaters“ Friedrich Spee erscheint, in der er sich - erstmals im katholischen Bereich - kritisch mit der Anwendung der „Folter“ und den „Hexen-Verfolgungen“ auseinander setzt.
Die Schrift muss „anonym“ erscheinen.
Auch ein aussagekräftigerer Titel - wie etwa „Wider den Hexenwahn“ - wäre ein eindeutiger Verstoß gegen die allgemein herrschende Überzeugungen gewesen und geeignet, neben dem Verfasser auch noch den Drucker und den Verleger in Verdacht zu bringen, dass sie „Hexen“ in Schutz zu nehmen und somit die „Partei des Satans“ stärken würden.
Der „Jesuitenpater“ Friedrich Spee hatte während seiner Aufenthalte in den Zentren der „Hexenverfolgung“ in Köln, Trier, Würzburg, Mainz, Speyer und Paderborn „Hexenprozesse“ verfolgt und kam dabei zur Überzeugung, dass die „Folter“ nicht zur „Wahrheitsfindung“ geeignet sei.
Das verstößt freilich gegen die damalige „Rechtsauffassung“, denn daraus lässt sich ableiten, dass die verdächtigten Frauen - trotz ihrer Geständnisse unter der „Tortur“ - unschuldig sind.
Innerhalb der „Gesellschaft Jesu“ bleibt die Autorenschaft des „Paters“ Friedrich Spee nicht verborgen.
Zeitweise droht ihm sogar die Entlassung aus dem „Jesuitenorden“.
10. 5 1631 - 26.800 kaiserliche Soldaten belagern Magdeburg
Magdeburg * Das „Massaker von Magdeburg“ beginnt. Rund 26.800 kaiserliche Soldaten unter Führung des katholischen Oberbefehlshabers Tilly, belagern die Stadt Magdeburg, die eine der bedeutendsten Städte in Deutschlands ist und in der rund 35.000 Menschen leben.
17. 5 1631 - Die Bestürmung von Magdeburg beginnt
Magdeburg * Die katholische Liga beginnt mit der Bestürmung Magdeburgs.
20. 5 1631 - Die Kaiserlichen bereiten Magdeburg ein grausliches Blutbad an
Magdeburg * Es kommt zu einem ersten schweren Geschützfeuer auf die Stadt Magdeburg und die umliegenden Dörfer. Am frühen Morgen dringen die katholischen Kaiserlichen, angeführt vom katholischen Oberbefehlshaber Graf Johann Tserclaes von Tilly und General Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim, in die Stadt ein und richten ein grausliches Blutbad an. Magdeburg versinkt in einer Orgie aus Gewalt, Zerstörung und Plünderung. Entsetzte Offiziere bitten Graf von Tilly dagegen einzuschreiten und erhalten die knappe Antwort: „Der Soldat muss etwas haben für seine Gefahr und Mühsal.“
Gegen Mittag fängt die Stadt zu Brennen an. Ob planmäßige Feuer gelegt worden sind, womöglich durch die Verteidiger der Stadt, wird nie geklärt. Jedenfalls verlieren dabei mehr als 15.000 Menschen - nach anderen Quellen sogar bis zu 30.000 Menschen - ihr Leben.
Die sogenannte „Magdeburger Hochzeit“ gilt als das größte und schlimmste Massaker während des Dreißigjährigen Krieges, über das man in ganz Europa entsetzt ist. Es heißt, die Taten und der Schrecken sind in ihrer Entsetzlichkeit „nicht in Worte zu fassen und nicht mit Tränen zu beweinen“.
1. 7 1631 - Der Gründungsbrief für den Karmeliter-Orden
München * Kurfürst Maximilian I. erlässt einen Gründungsbrief für die Niederlassung des Karmeliter-Ordens in München. Sie sollen für ihren Klosterbau ein Gelände außerhalb der Stadtmauern erhalten, gelegen zwischen Angertor und Schiffertor. Doch diese Pläne zerschlagen sich im Verlauf des Krieges.
15. 9 1631 - Graf Tilly zieht in Leipzig ein und lässt ausgiebig plündern
Leipzig * Der kaiserlich-katholische Oberbefehlshaber Tserclaes Johann Graf von Tilly zieht in Leipzig ein und lässt dort ausgiebig plündern.
17. 9 1631 - Bei Breitenfeld werden die Kaiserlichen vernichtend geschlagen
Breitenfeld * In der Schlacht bei Breitenfeld [6 Kilometer von Leipzig entfernt] besiegen die Truppen des schwedischen Königs Gustav II. Adolf die Kaiserlichen vernichtend. 12.000 Kaiserliche bleiben tot auf dem Schlachtfeld, 7.000 geben sich gefangen und werden ohne weiteres in die Reihen der Schweden aufgenommen. Außerdem gehen die Kriegskasse und sämtliche Geschütze verloren. Die schwedischen Verbündeten verlieren etwa 3.000 Mann.
12 1631 - Albrecht von Wallenstein kehrt wieder auf die Schlachtfelder zurück
Deutschland * Albrecht von Wallenstein kehrt wieder auf die Schlachtfelder zurück.
13. 2 1632 - Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld wird geboren
München ? * Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld wird geboren.
4. 4 1632 - Kurfürst Maximilian I. verlässt München in Richtung Regensburg
München - Regensburg * Kurfürst Maximilian I. verlässt München in Richtung Regensburg, um sich dort seinen Truppen anzuschließen.
7. 4 1632 - Gustav II. Adolf überquert die Donau bei Donauwörth
Donauwörth * Der schwedische König Gustav II. Adolf überquert mit 35.000 Mann die Donau bei Donauwörth.
8. 4 1632 - Die kurfürstliche Familie flieht vor den Schweden nach Salzburg
<p><strong><em>München</em></strong> * Kurfürstin Elisabeth Renata und ihr Schwager, Herzog Albrecht VI. mit Familie, verlassen aus Angst vor den Schweden München, um sich in Salzburg in Sicherheit zu bringen.</p> <p>Die kurfürstliche Schatzkammer, kirchliche Schätze und die städtische Barschaft im Wert von 32.449 Gulden werden im Ausland, im Erzbistum Freising, in Sicherheit gebracht. Münchner Bürger und Adelige, die es sich finanziell leisten können, suchen Schutz in Tirol oder Italien.</p>
14. 4 1632 - Schwedenkönig Gustav Adolf erreicht den Lech
<p><strong><em>Rain am Lech</em></strong> * Der Schwedenkönig Gustav II. Adolf erreicht den Lech. Gegenüber bei dem Dorf Rain hat Graf von Tilly mit 27.000 Mann sein Lager aufgeschlagen.</p>
15. 4 1632 - Schwedens König Gustav Adolf erkämpft den Lechübergang
<p><strong><em>Rain am Lech</em></strong> * In der <em>„Schlacht bei Rain am Lech“</em> werden die Kaiserlichen unter Führung des katholischen Oberbefehlhabers Johann Tserclaes Graf von Tilly von den Truppen des Schwedenkönigs Gustav II. Adolfs besiegt. Dadurch können die Schweden den Lech überschreiten, womit ihnen das ganze Kurfürstentum Baiern offen steht. Die Baiern müssen jetzt die leidvollen Erfahrungen mit dem Durchzug feindlicher Heere durchleben.</p> <p>Graf von Tilly wird in der Schlacht durch einen Schuss schwer am Bein verwundet. Kurfürst Maximilian I. zieht sich daraufhin in das stark befestigte Ingolstadt zurück. </p> <p>Die Erfolge des schwedischen Königs, den seine Anhänger <em>„Löwe aus Mitternacht“</em> und <em>„Gideon des Nordens“</em> nennen, von seinen Feinden aber als <em>„Schneekönig“</em> verspottet wird, machen seinen katholischen Kriegsgegnern Angst. Besonders nach dem <em>„Massaker von Magdeburg“</em>. </p>
24. 4 1632 - Der Schwedenkönig Gustav II. Adolf zieht in Augsburg ein
Augsburg * Der Schwedenkönig Gustav II. Adolf zieht in Augsburg ein.
30. 4 1632 - Johann Tserclaes Graf von Tilly stirbt in Ingolstadt
<p><strong><em>Ingolstadt</em></strong> * Der Oberbefehlshaber der katholisch-kaiserlichen Truppen, Graf Johann Tserclaes von Tilly, stirbt wenige Tage nach seiner Schussverletzung in Ingolstadt. </p>
14. 5 1632 - Geldzahlungen statt Plünderung und Mord
München - Freising * Der kurfürstliche Kriegsrat Johann Küttner und die Münchner Bürgermeister Friedrich Ligsalz und Ferdinand Barth sowie der Stadtrat Paulus Parsdorfer reisen nach Freising. Dort treffen sie den Schwedenkönig Gustav Adolf und bitten ihn
- um Schonung der Stadt vor Brand und Plünderung,
- die Sicherung der Personen und Eigentum und
- die Bewahrung von Religion und politischer Verfassung.
Sie bieten dafür die Bezahlung einer Kontribution [Geldzahlung] an.
15. 5 1632 - Die schwedische Schutzgarde wird nach München verlegt
München * Die schwedische Schutzgarde wird nach München verlegt und nimmt Einquartierungen in den „Klöstern und Häusern der Vornehmen in München, deren Insassen meist nach Tirol oder Italien geflohen waren“.
Die innerhalb der Stadtummauerung lebenden Münchner kommen wieder einmal glimpflich davon. Die Soldateska plündert, verwüstet, drangsaliert und vergewaltigt dafür um so stärker in den Vororten - besonders in der bevölkerungsreichen Au und in Haidhausen.
19. 5 1632 - Schwedenkönig Gustav II. Adolf fordert von der Stadt 300.000 Reichstaler
München * König Gustav II. Adolf besucht die Michaelskirche und lässt sich das Gottesdienstritual genauestens erklären. Der schwedische König fordert von der Stadt 300.000 Reichstaler, um München vor der Zerstörung zu verschonen. Die in der Stadt verbliebene Bürgerschaft versucht daraufhin, soviel wie möglich von der geforderten Summe zusammenzutragen.
Selbst die Ärmsten der Stadt müssen sich daran beteiligen. Und auch die schon so stark gebeutelten Einwohner der Au, Haidhausens und Giesings haben für die Zahlungen ihr Schärflein beizutragen. Exakt 940 Gulden und 43 Kreuzer steuern sie aus ihren sowieso schon begrenzten Mitteln bei. Und dennoch reicht es nicht.
Gerade mal 144.273 Gulden bringt die Geldeintreibung ein. Das ist nicht mal ein Drittel der geforderten Summe, worauf der Schwedenkönig je 22 weltliche und geistliche Geiseln verlangt.
Nach dem 20. 5 1632 - Kurfürst Maximilian I. will „ein gottgefälliges Werk“ schaffen
München * Nachdem die Schweden im Dreißigjährigen Krieg die baierische Haupt- und Residenzstadt München besetzt haben, gelobt Kurfürst Maximilian I. „ein gottgefälliges Werk anzustellen, wenn die hiesige Haupstadt und auch die Stadt Landshut vor des Feinds endlichem Ruin und Zerstörung erhalten würde“.
7. 6 1632 - Die Schwedengeiseln verlassen die Stadt in Richtung Augsburg
München * Statt 44 verlassen insgesamt 42 Priester, Mönche, Brauer, Gastwirte, Ratsherren und Meister als Schwedengeiseln die Stadt in Richtung Augsburg. Zwei weltliche Gefangene sind erkrankt. Mit den Geiseln verlassen auch die Schweden die baierische Haupt- und Residenzstadt München.
16. 6 1632 - Die Schwedengeiseln werden wie Gefangene behandelt
Augsburg * Die Schwedengeiseln, auch die aus anderen baierischen Städten, werden in der alten Bischöflichen Residenz in Augsburg untergebracht und wie Gefangene behandelt.
21. 6 1632 - Die Schwedengeiseln wollen eine Votivtafel spenden
Augsburg * Die Schwedengeiseln leisten ein Gelübde. Sie wollen nach ihrer Befreiung eine Wallfahrt und einen „Dankgottesdienst zu Ehren der Gottesmutter“ ausrichten und eine Votivtafel spenden.
7. 8 1632 - Viel Geld für die Schweden-Geiseln
Augsburg * 73.000 Reichstaler werden in der Hoffnung nach Augsburg gebracht, dass die Schweden die Hälfte der Geiseln freilassen. Die Geiselnehmer fordern aber zunächst weitere 37.000 Reichstaler.
16. 11 1632 - Der Schwedenkönig Gustav II. Adolf verliert sein Leben
Lützen - Wien * Der Schwedenkönig Gustav II. Adolf verliert in der Schlacht von Lützen sein Leben. Sein Widersacher, Albrecht von Wallenstein, setzt dem geschwächten Gegner nicht nach, sondern zieht sich danach ins Winterquartier nach Böhmen zurück.
In Wien stoßen diese Entscheidungen auf Unverständnis, denn hier herrscht eine unbeschreibliche Freude „wegen der Königlichen Majestät zu Schweden Todesfall“.
29. 11 1632 - Der Winterkönig Friedrich V. stirbt in Mainz
Mainz * Der als Winterkönig in die Geschichte eingegangene Friedrich V. stirbt in Mainz.
Um den 10. 6 1633 - Zwei „Schwedengeisel“ kehren nicht mehr zurück
Augsburg * Eine Münchner und eine Landshuter Schwedengeisel kehren trotz ihres gegebenen Ehrenwortes von einem Verhandlungsauftrag nicht mehr zurück. Das verärgert die Schweden noch mehr.
17. 6 1633 - Die Schweden bringen die Geiseln unter Misshandlungen nach Nördlingen
Nördlingen * Die Schweden bringen die Geiseln unter Misshandlungen nach Nördlingen.
5. 8 1633 - Ein nachweisbarer Einsturz der Münchner Isarbrücke
München * Ein nachweisbarer Einsturz der heutigen Ludwigsbrücke ereignet sich. Es gibt zwar kein amtliches Dokument, dafür aber ein Mirakelbild an der südlichen Außenmauer der Tuntenhausener Kirche.
„Bei dem theilweisen Einsturze der Isarbrücke zu München am 5. August 1633 kam Jakob Oefele, Zimmermann von der Au, in große Todesgefahr, indem er mit noch 50 Personen ins Wasser fiel, nach gemachten Gelöbnis wurde er errettet”. Über die Zahl der Opfer dieses Brückeneinsturzes ist allerdings nichts Näheres bekannt.
27. 8 1633 - Die Schwedengeiseln werden wieder nach Augsburg verlegt
Augsburg * Die Schwedengeiseln werden wieder nach Augsburg zurück verlegt.
17. 9 1633 - Die Paulanermönche kommen in den Besitz der Lärchlbrauerei
München-Hackenviertel * Die Paulanermönche kommen in den Besitz der Lärchlbrauerei in der Neuhausergasse. Mit kurfürstlicher Genehmigung dürfen sie ihren Haustrunk brauen.
1634 - Ein Protestbrief gilt als Geburtsurkunde der „Paulaner-Brauerei“
München - Au * Weil sich die Paulanermönche nicht an die Abmachungen halten und ihr Bier auch außerhalb des Klosters verkaufen, beschweren sich die Münchner Brauer beim Magistrat der Stadt und bitten „um entschiedene Abhilfe des klösterlichen Brau- und Ausschankunwesens“.
Dieser Protestbrief gilt als Geburtsurkunde der „Paulaner-Brauerei“.
Die Paulaner verstoßen aallerdings auch in den kommenden 165 Jahren immer wieder ganz bewusst gegen Vorschriften und Gesetze.
1634 - Herzog Victor Amadeus I. siedelt den Theatinerorden in Turin an
Turin • Herzog Victor Amadeus I. von Savoyen siedelt den Theatinerorden in Turin an. Sie übernehmen die geistliche Erziehung der Herzogskinder Henriette Adelaide, Margarete Jolande und Carl Emanuel.
18. 2 1634 - Augsburger Geldgeber verbessern die Lage der Schweden-Geiseln
Augsburg * Bei Verhandlungen zwischen baierischen und schwedischen Vertretern einigt man sich, dass der Rest der Brandschatzungssumme in Salz abgegolten werden kann. Augsburger Geldgeber erklären sich bereit, für 49.765 Scheiben Salz den Schweden die Summe von 140.000 Reichstaler zu bezahlen. Damit verbessert sich die Lage der Schweden-Geiseln.
25. 2 1634 - Albrecht von Wallenstein wird in Eger ermordet
Eger * Albrecht von Wallenstein wird in Eger ermordet.
7 1634 - Kaiserliche Truppen schleppen die „Pest“ nach München ein
München * Kaiserliche Truppen halten in Baiern Quartier.
Dieser hauptsächlich aus Italienern bestehende Personenkreis schleppt die „Pest“ nach München ein.
12. 8 1634 - Die schwerste Pest, die München je erlebt hat, beginnt
München * Mit dem Todesfall der Bäckerswitwe Gebhartin in der Sendlinger Gasse beginnt die schwerste Pest, die München je erlebt hat. Sie dauert bis Februar 1635.
6. 9 1634 - Die Schweden werden bei Nördlingen vernichtend geschlagen
Nördlingen - Augsburg * Die Schweden werden bei Nördlingen vernichtend geschlagen. Anschließend beginnt die Belagerung Augsburgs durch die kaiserlich-baierische Armee.
Nach dem 7. 9 1634 - Kurfürst Maximilian I. will sein Gelöbnis erfüllen
München * Nachdem München
- von der drohenden Besetzung und Plünderung durch Kontributionen freigekauft werden und
- das kaiserlich-ligistische und durch spanische Truppen verstärkte Heer in der Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634 einen entscheidenden Sieg über die Schweden erringen konnte,
beauftragt Kurfürst Maximilian I. nach seiner Rückkehr eine Kommission zu überlegen, „was es für ein werkh sein [...] möchte“, mit dem er sein Gelöbnis erfüllen könne. Der hochrangige Beraterkreis schlägt die Stiftung eines jährlichen Lobamtes in der Frauenkirche und die Errichtung eines neuen Altars in der entsprechenden Kapelle vor. Sie bewegen sich damit im damals üblichen Rahmen für ein Exvoto.
1635 - Bogenhausens erstes Adelsschlösschen
Bogenhausen * Auf einem Teil des Grundes des „Zaichingerhofs“ entsteht Bogenhausens erstes Adelsschlösschen.
1635 - Besitzer der „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Vater und Sohn Schmid besitzen die „Giesinger Mühle“.
Diesen folgen bis zum Jahr 1800 die Familien der Streicher, Brand und Loiblmayer.
4. 1 1635 - Kurfürstin Elisabeth stirbt in Ranshofen bei Braunau an der Pest
Ranshofen bei Braunau • Die baierische Kurfürstin Elisabeth Renata stirbt im Alter von 40 Jahren in Ranshofen bei Braunau, wohin sie vor der Pest geflüchtet ist. Sie wird in der Michaelskirche in München beigesetzt. Die Ehe des baierischen Herrscherpaares war kinderlos geblieben.
12. 2 1635 - Die Pest wird für beendet erklärt
München * Da nur noch wenige Münchner an der Pest erkrankt sind, wird die Seuche für beendet erklärt. Rund 7.000 Münchner sind daran gestorben. Das entspricht einem Drittel der Einwohnerzahl.
13. 3 1635 - Die Gefangenschaft der Schwedengeiseln endet
<p><strong><em>Augsburg</em></strong> * Augsburg wird an die kaiserlich-baierische Armee übergeben. Damit endet die Gefangenschaft der Schwedengeiseln.</p>
3. 4 1635 - Die Schwedengeiseln kehren nach München zurück
Augsburg - München * Die 38 Schwedengeiseln kehren wieder nach München zurück. Vier von ihnen sind in der Gefangenschaft gestorben, ein Franziskanerpater ist zum Luthertum übergetreten. Die Überlebenden hatten dabei Glück im Unglück, da sie durch ihre Gefangenschaft der großen Pestepidemie in München entkommen konnten.
Um den 15. 5 1635 - Nach 3-jähriger Abwesenheit kommt Maximilian I. wieder nach München
Braunau - München * Nach über dreijähriger Abwesenheit kehrt Kurfürst Maximilian I. wieder nach München zurück. Zuletzt residierte er in Braunau.
30. 5 1635 - Der Prager Frieden wird geschlossen
<p><strong><em>Prag</em></strong> * Der Kaiser, die katholische Liga und Kursachsen schließen in Prag einen Frieden, dem bald die meisten deutschen Reichsstände beitreten. Im Prager Frieden wird das Restitutionsedikt für vierzig Jahre ausgesetzt.</p>
15. 7 1635 - Kurfürst Maximilian I. heiratet Maria Anna von Österreich
Wien • Der 62-jährige Kurfürst Maximilian I. heiratet - ohne Einhaltung des Trauerjahres, ein halbes Jahr nach dem Tod seiner ersten Ehefrau Elisabeth Renata - die 25-jährige Maria Anna. Sie ist die Tochter seiner Schwester Maria Anna und des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II.. Maximilian I., schon Vetter und Schwager des Kaisers, wird damit auch noch sein Schwiegersohn.
Die Eile ist verständlich. Der Baiernregent hat zwar die erbliche Kurfürstenwürde errungen, aber noch immer keinen Thronfolger gezeugt. In seinem Alter ist es also höchste Zeit.
9 1635 - Kurfürst Maximilian I. entscheidet sich für ein „Madonnen-Monument“
München * Kurfürst Maximilian I. entscheidet sich auf Anregung des „Hofkammerpräsidenten“ Johannes Mandl von Deutenhofen, „zu Ehren Gottes und Mariens“
- ein „Madonnen-Monument“ zu errichten,
- alljährlich eine „Prozession“ und
- wöchentlich eine „Messe“ abzuhalten.
- Dazu kommen noch „Almosen“ und andere religiöse Verpflichtungen.
20. 9 1635 - Verbot der heimlichen Zusammenkünfte von Manns- und Weibspersonen
München * Kurfürst Maximilian I. untersagt per Dekret die „heimlichen Zusammenkünfte von Manns- und Weibspersonen“ auf das Strengste. Vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, selbst Tabakrauchen auf der Straße, führen zu Schandstrafen.
1. 10 1635 - Ein kurfürstlicher Befehl untersagt die Fuchsjagd
München * Ein kurfürstlicher Befehl untersagt die Fuchsjagd. Durch den ständigen Hunger der Stadtbevölkerung hat sich der Bestand an Katzen und Hunden stark reduziert. Dadurch nimmt die Mäuse- und Rattenplage stark zu.
1636 - Ein „Pestfriedhof“ in Obergiesing
Obergiesing * Auf dem heutigen Standort der „Heilig-Kreuz-Kirche“ befindet sich ein Friedhof für die Toten der in diesem Jahr grassierenden „Pest“.
15. 9 1636 - Ferdinand III. wird zum deutsch-römischen König gewählt
Regensburg * Kaiser Ferdinand II. eröffnet erneut einen Regensburger Kurfürstentag. Er wird bis zum 22. Dezember dauern. Die Kurfürsten wählen dieses Mal Ferdinands Sohn Ferdinand III. einstimmig zum deutsch-römischen König.
31. 10 1636 - Kurprinz Ferdinand Maria kommt in München zur Welt
München • Die österreichische Kaisertochter und baierische Kurfürstin Maria Anna bringt den Kurprinzen Ferdinand Maria in München zur Welt. Sein Vater ist Kurfürst Maximilian I. von Baiern.
6. 11 1636 - Henriette Adelaide von Savoyen wird in Turin geboren
Turin • Zwei schwächliche Mädchen, Henriette Maria Adelaide und ihre Zwillingsschwester Caterina Beatrice von Savoyen, werden in Turin geboren. Ihre Eltern sind Herzog Victor Amadeus I. von Savoyen und dessen Gemahlin Christine Marie von Frankreich.
22. 12 1636 - Ferdinand III. wird römisch-deutscher König
Regensburg * Ferdinand III. wird auf dem Regensburger Kurfürstentag römisch-deutscher König.
15. 2 1637 - Kaiser Ferdinand II. stirbt in Wien
Wien * Kaiser Ferdinand II. stirbt in Wien.
Nachfolger auf dem Thron des Kaisers des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ wird sein Sohn Ferdinand III..
13. 10 1637 - Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn wird geboren
Augsburg * Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn, der spätere Hofmarkherr von Haidhausen, wird als 15. Kind von Graf Otto Heinrich Fugger, dem Herren zu Mickhausen Grönenbach und Mattsies und Maria Elisabeth, Freiin von Waldburg, in Augsburg geboren.
26. 10 1637 - Caterina Beatrice stirbt mit zehneinhalb Monaten in Turin.
Turin • Caterina Beatrice, die Zwillingsschwester von Henriette Maria Adelaide, der späteren Kurfürstin von Baiern, stirbt mit zehneinhalb Monaten in Turin.
12. 12 1637 - Angekündigte Grundsteinlegung für die Mariensäule
München * Kurfürst Maximilian I. teilt dem Münchner Rat - ohne Rücksicht auf dessen Bestimmungsrecht über den Marktplatz - selbstherrlich mit, er werde „der Heiligen Himlkönigin zu Ehrn, und ewiger gedechtnus, ein offentliches Monumentum, von einer Seulen, und darauf stehenden unnser lieben Frauen Bildtnus, mitten deß Plazs, aufrichten“. Die Arbeiten beginnen zwei Tage später.
Er begründet dies mit der „unbezweifelbaren Fürbitte der Himmelskönigin und Muttergottes“, die als Patronin und Beschützerin das Land und die Stadt „von Brand und anderm feindlichen Verderben behütet und errettet“.
Der Rat der Stadt, der zu dieser Entscheidung nicht herangezogen worden ist, muss dies unwidersprochen hinnehmen, obwohl die Stadt seit dem Jahr 1315 das Privileg Kaiser Ludwigs des Baiern besitzt, alleine über die Bebauung des Platzes bestimmen zu dürfen. Auf dem zentralen Platz der Bürgergemeinde München ist künftig der Landesherr mit einer persönlichen Votivgabe präsent.
22. 8 1638 - Philipp Holzhauser darf eine Kapelle in Haidhausen errichten
Haidhausen * Der „Churfürstlich Baierische Rechnungs-Commissarius und Preibeamte zu München“, Philipp Holzhauser, erhält vom Freisinger Bischof Veit Adam Gebeck die Genehmigung, dass er „in seiner aigentumblichen Behausung vnnd Gartten zu Haidthausen negst München Bogenhauser Pfarr“ eine Kapelle zu Ehren des Heiligen Kreuzes errichten und mit Paramenten und allem zur Feier des hl. Meßopfers Notwendigen versehen darf.
Außerdem erhält er und seine Ehefrau auf Lebenszeit das Recht zugesprochen, dass sie - so oft sie sich in ihrer Besitzung in Haidhausen aufhalten - an einem Messopfer beiwohnen dürfen, das von einem geweihten Priester gehalten wird. Ausgenommen von diesem Recht sind lediglich die Hochfeste Ostern, Pfingsten und Weihnachten.
Philipp Holzhauser muss viel für die Kirche getan haben, dass er solche Privilegien überhaupt erhalten kann. Und tatsächlich treten er und seine Gattin mehrfach als Taufpaten in Erscheinung. Zudem vermacht er der Haidhauser Kirche mehrmals hohe Geldbeträge.
5. 9 1638 - Der spätere französische König Ludwig XIV. wird geboren
Saint Germain en Laye • Der spätere französische König Ludwig XIV. wird auf Schloss Saint Germain en Laye geboren. Er ist ein Prinz aus dem Hause Bourbon.
30. 9 1638 - Prinz Maximilian Philipp Hieronymus wird geboren
München • Herzog Maximilian Philipp Hieronymus, der zweitgeborene Sohn des Kurfürsten Maximilian I. und der Kaisertochter Maria Anna, wird in München geboren.
7. 11 1638 - Die Mariensäule wird feierlich eingeweiht
München-Graggenau * Am ersten Sonntag nach Allerheiligen weiht der Freisinger Fürstbischof Veit Adam von Gepeckh das Marien-Monument auf dem Schrannenplatz feierlich ein. Das ist jener Tag, an dem alljährlich in einer großen Gedächtnis-Prozession der Sieg Maximilians I. in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag, im Jahr 1620, gegen die aufständischen Böhmen, gefeiert wurde. Auf den Tag genau ist das jetzt 18 Jahre her.
Die Münchner Mariensäule ist die erste Madonnen-Säule nördlich der Alpen. Der baierische Kurfürst hat die Madonnen-Säule als Symbol des durch den Dreißigjährigen Krieg wieder erstarkten katholischen Glaubens und als Ausdruck seiner eigenen tiefen Marienverehrung errichten lassen. Er legt damit ein öffentliches Bekenntnis für seine Religion und seine politische Überzeugung ab. Die Münchner Mariensäule wird zum Vorbild vieler ähnlicher Monumente in Baiern und Österreich.
1639 - Die Kirche für die Auer Marienwallfahrt wird fertiggestellt
Au * Die Kirche für die Auer Marienwallfahrt wird fertiggestellt.
Den Namen „Unserer lieben Frauen Bild Von der Hülff“ erhält das Gnadenbild jedoch erst später.
1640 - Die Zahl der Mitglieder der „Weinschenkzunft“ wird begrenzt
München * Kurfürst Maximilian I. beschränkt die Zahl der Mitglieder der „Weinschenkzunft“ auf 24 „Weinwirte“ und 2 „Weinzäpfler“.
Von den 24 festgesetzten „Weingasthöfen“ befinden sich alleine fünf in der Kaufingerstraße.
1640 - Der „Adelssitz Stepperg mit Niedergerichtsbarkeit“
Bogenhausen * Georg Schobingers „gemauertes Haus“ in Bogenhausen wird unter dem Namen „Stepperg“ zum „Adelssitz mit Niedergerichtsbarkeit“.
1640 - Herzog Albrecht Sigismund wird zum Freisinger „Koadjutor“ gewählt
München - Freising * Herzog Albrecht Sigismund von Baiern wird auf Druck des baierischen Kurfürsten Maximilian I. zum „Koadjutor“ (= Nachfolger) des Freisinger Fürstbischofs Veit Adam von Gepeckh gewählt.
1640 - Kurfürst Maximilian I. lässt seinen Sohn Ferdinand Maria in Wachs nachbilden
München-Kreuzviertel * Kurfürst Maximilian I. lässt seinen vierjährigen Sohn Ferdinand Maria Ignatius Wolfgang lebensgroß in Wachs nachbilden um am „Benno-Altar“ in der „Frauenkirche“ aufstellen, um ihn so unter seinem Schutz zu stellen.
1640 - Der „Schweizer Wirt“ an der Tegernseer-Landstraße wird erwähnt
Obergiesing * Der „Schweizer Wirt“ an der Tegernseer-Land-Straße wird erwähnt.
9. 6 1640 - Der spätere Kaiser Leopold I. wird in Wien geboren
Wien * Leopold I., der spätere deutsch-römische Kaiser, wird in Wien geboren.
1641 - Ermittlungen wegen des Auftauchens von „Werwölfen“
Straubing * Im „Rentamt Straubing“ gibt es Ermittlungen wegen des Auftauchens von „Werwölfen“ im „Baierischen Wald“.
Dort hat sich in der Zeit des Krieges „allerhandt zauberische abergläubische Khünstten und sonderlich zwar das Paizen (wodurch Vich und Leithen an Leib und Leben khan Schaden zuegefüegt werden) so starkh eingerissen und überhandt genommen, das der gemaine ainfeltige Burger und Baursmann in die Gedankhen gleichsamb gerathen, er sich beregter abergläubischer Khünsten ohne Sindt und befahrende Bestraffung gebrauchen und bedienen khönne“.
Um die Verdächtigten verhaften zu können, wird ein eigenes „Gefängnis“ erbaut.
16. 1 1641 - Jeder Bürger hat sich mit Proviant einzudecken
München * Kurfürst Maximilian I. erlässt den Befehl, wonach sich jeder Bürger mit Proviant einzudecken hat. Dieser Vorrat muss ausreichend sein, dass „er selbst und seine Tisch-, Brot- und Kostgenossen“ fünf Monate lang zu essen haben. Die eingelagerten Lebensmittel sollen bis zu einem eventuellen Notfall unangetastet bleiben.
24. 1 1641 - Der Andechser Heiltumsschatz soll nach München gebracht werden
<p><strong><em>Andechs</em></strong> * Maurus Friesenegger, der Abt des Klosters Andechs, erhält den Befehl, den Heiltumsschatz nach München zu bringen.<br /> Wegen der Schneefälle und der extremen Kälte unterbleibt der Transport einstweilen. </p>
13. 2 1641 - Der Andechser Heiltumsschatz trifft in München ein
<p><strong><em>Andechs - München</em></strong> * Der <em>„Andechser Heiltumsschatz“</em> wird auf Befehl des Kurfürsten Maximilian I. nach München gebracht. Die Heiltümer, Reliquien und Hostien werden in der Gruft des Klosters Andechs in der Gruftgasse und in der kurfürstlichen Münzstätte untergebracht. </p>
18. 4 1641 - Der Andechser Heiltumsschatz kommt wieder ins Kloster
<p><strong><em>München - Andechs</em></strong> * Der <em>„Andechser Heiltumsschatz“</em> wird wieder ins Kloster Andechs zurückgebracht. </p>
14. 5 1641 - Kaiser Ferdinand III. und die Kaiserin besuchen München
München * Kaiser Ferdinand III. und die Kaiserin besuchen München, „wo er wahrhaft kaiserlich bewirtet wurde“. Pechpfannen beleuchten nachts die Straßen (sicherlich nur wenige ausgesuchte).
25. 9 1641 - Befehl zur Beteiligung an den kirchlichen Prozessionen
München * Die Mitglieder des Äußeren Rats wird bei Strafandrohung befohlen, den „wöchentlichen Umgang“ [= Prozession] fleißig zu besuchen und „den Himmel zu tragen“.
1642 - Der Brauer Philipp Hölzl kauft die spätere „Singlspielerbrauerei“
München-Angerviertel * Der Brauer Philipp Hölzl kauft die spätere „Singlspielerbrauerei“, nachdem er sie seit 1635 gepachtet hatte.
1642 - Maximilian Heinrich wird „Koadjutor“ seines Onkels Ferdinand gewählt
Köln * Maximilian Heinrich, Neffe des Kölner Kurfürsten und Fürstbischofs, wird zum „Koadjutor“ (= Nachfolger) seines Onkels Ferdinand gewählt.
8. 9 1642 - Johann Philipp von Schönborn untersagt die Hexenverfolgungen
Würzburg * Johann Philipp von Schönborn untersagt nach seinem Amtsantritt die Hexenverfolgungen gänzlich.
1643 - Die „Kongregation Maria, Königin der Engel“ wird kirchlich bestätigt
Rom-Vatikan * Die „Marianische Kongregation Maria, Königin der Engel“ erhält ihre kirchliche Bestätigung.
1643 - Die ersten „Kaffeeschenken“ begegnen uns in Paris
Paris * Die ersten „Kaffeeschenken“ begegnen uns in Paris.
Ab 1643 - Der letzte große „Hexenprozess“ in Rain am Lech im Kurfürstentum
Rain am Lech * Im Kurfürstentum Baiern kam es unter der Regierung Maximilians I. in den Jahren 1643/44 zum letzten größeren „Hexenprozess“ in Rain am Lech, der die ungeheuerliche Summe von 3.141 Gulden verschlingt.
Die immensen Kosten, die auch aus den Hinterlassenschaften der „Hexen“ nicht finanziert werden können, lassen den „Hofrat“ von weiteren „Hexen-Verfolgungen“ Abstand nehmen.
Auch die weitgehend beachteten Beschränkungen der „Folter“ und die „Strategie des Widerrufs“ steuern ihren Teil dazu bei.
Der Tatbestand der „Hexerei“ reicht alleine nicht mehr zur Rechtfertigung eines „Todesurteils“ aus.
Hingerichtet werden „Zauberer“ und „Hexen“ im Kurfürstentum Baiern nur noch dann, wenn zudem andere Delikte wie „Giftmord, Kindsmord“ oder „Diebstahl“ nachgewiesen werden können.
14. 5 1643 - Ludwig XIV. besteigt den französischen Thron
Paris * König Ludwig XIV. besteigt den französischen Thron.
1644 - Kurfürst Maximilian I. lässt Maximilian Philipp in Wachs nachbilden
München-Kreuzviertel * Kurfürst Maximilian I. lässt auch seinen fünfjährigen Sohn Maximilian Philipp Hieronymus lebensgroß in Wachs nachbilden und ebenfalls am „Benno-Altar“ der „Frauenkirche“ aufstellen, um ihn so unter seinem Schutz zu stellen.
1645 - In Mittenwald entsteht ein zweites „Ballenhaus“
Mittenwald * Für die aufgespeicherten Waren wird ein Mittenwald ein zweites gemeindliches „Ballenhaus“ gebaut.
1645 - Auch Venedig hat nun „Kaffeeschenken“
Venedig * Auch Venedig hat nun „Kaffeeschenken“.
25. 12 1645 - Giovanni Antonio Viscardi wird in San Vittore geboren
San Vittore * Giovanni Antonio Viscardi wird in San Vittore bei Roveredo in Graubünden geboren.
Vor 1648 - Die „Weingärten“ werden von feindlichen Truppen verwüstet
Kurfürstentum Baiern * In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges werden die „Weingärten“ oftmals von feindlichen Truppen verwüstet.
1648 - Der „Kalender“ wird zur „weltlichen Angelegenheit“ erklärt
Osnabrück * Bei den „Osnabrücker Friedensverhandlungen“ wird der „Kalender“ zur „weltlichen Angelegenheit“ erklärt.
1648 - Im „Westfälischen Frieden“ wird das „Restitutionsedikt“ aufgehoben.
Westfalen * Im „Westfälischen Frieden“ wird das „Restitutionsedikt“ aufgehoben.
20. 5 1648 - Schutzsuche hinter den mächtigen Befestigungsanlagen
München - Haidhausen * Im letzten Jahr des Dreißigjährigen Krieges ziehen Schweden und Franzosen vom Lech her in Richtung München. Menschenscharen aus allen Landesteilen suchen Schutz hinter den mächtigen Befestigungsanlagen der Stadt.
Aus Angst, dass Krankheiten ausbrechen könnten, werden 2.934 Menschen mit einem „geringen Almosen“ aus der Stadt gewiesen. Auf Haidhausen treffen insgesamt 418 Personen, darunter 89 Familien mit 99 Frauen und 230 Kindern.
4. 10 1648 - Freifrau Maria Jakobäa von Lerchenfeld stirbt in Salzburg
Salzburg - Berg am Laim * Freifrau Maria Jakobäa von Lerchenfeld stirbt in Salzburg, wo sie auch am Petersfriedhof begraben wird. Ihr Herz wird in einer Zinnurne in der Loretokapelle in Berg am Laim beigesetzt.
28. 8 1649 - In vier Häusern der Stadt sind Fälle der Pest aufgetreten
München * In vier Häusern der Stadt sind Fälle der Pest aufgetreten.
1. 9 1649 - Der Rat der Stadt erlässt ein Pestmandat
München * Der Rat der Stadt erlässt ein Pestmandat. Nach der Sitzung bittet er in einem Gottesdienst um Abwendung der laidigen Sucht der Pest.
10. 9 1649 - Ferdinand Maria soll eine savoyische Prinzessin heiraten
München - Wien • In einem Brief informiert Kurfürst Maximilian I. den in Wien residierenden Kaiser Ferdinand III. über seine Absicht, seinen ältesten Sohn Ferdinand Maria mit einer Prinzessin von Savoyen zu verheiraten. Begründung: „Im Deutschland unserer Tage gibt es keine katholische Prinzessin mehr, die nicht nicht nur von ihrer Person, sondern auch von ihrem Haus her besser geeignet wäre, um das Ansehen [des Hauses Baiern] zu erhöhen.“
um 1650 - Erst jetzt begegnen wir in München dem „Rheinwein“
München * Erst jetzt begegnen wir in München dem „Rheinwein“.
14. 5 1650 - Kurprinz Ferdinand Maria soll Henriette Adelaide von Savoyen heiraten
München - Turin • Entgegen dem ursprünglichen Ansinnen der savoyischen Herzogin Christine Marie, den baierischen Kurprinzen Ferdinand Maria mit der ein Jahr älteren Margarete Jolande zu verheiraten, einigte man sich schließlich auf den baierischen Vorschlag, die gleichaltrige, hübschere, intelligentere Henriette Adelaide zu nehmen.
An diesem 14. Mai 1650 wird gleichzeitig in München und Turin der Ehevertrag unterzeichnet. Er enthält die Zusage einer Mitgift von 200.000 Goldscudi, die bis zum Jahr 1669 in Raten abbezahlt werden soll.
14. 5 1650 - Kurprinz Ferdinand Maria soll Henriette Adelaide von Savoyen heiraten
München - Turin • Entgegen dem ursprünglichen Ansinnen der savoyischen Herzogin Christine Marie, den baierischen Kurprinzen Ferdinand Maria mit der ein Jahr älteren Margarete Jolande zu verheiraten, einigte man sich schließlich auf den baierischen Vorschlag, die gleichaltrige, hübschere, intelligentere Henriette Adelaide zu nehmen.
An diesem 14. Mai 1650 wird gleichzeitig in München und Turin der Ehevertrag unterzeichnet. Er enthält die Zusage einer Mitgift von 200.000 Goldscudi, die bis zum Jahr 1669 in Raten abbezahlt werden soll.
14. 5 1650 - Kurprinz Ferdinand Maria soll Henriette Adelaide von Savoyen heiraten
München - Turin • Entgegen dem ursprünglichen Ansinnen der savoyischen Herzogin Christine Marie, den baierischen Kurprinzen Ferdinand Maria mit der ein Jahr älteren Margarete Jolande zu verheiraten, einigte man sich schließlich auf den baierischen Vorschlag, die gleichaltrige, hübschere, intelligentere Henriette Adelaide zu nehmen.
An diesem 14. Mai 1650 wird gleichzeitig in München und Turin der Ehevertrag unterzeichnet. Er enthält die Zusage einer Mitgift von 200.000 Goldscudi, die bis zum Jahr 1669 in Raten abbezahlt werden soll.
14. 8 1650 - In Hamburg wird ein städtisches Leihhaus eröffnet
Hamburg * In Hamburg wird ein städtisches Leihhaus mit einem Beschluss der Bürger eingeführt.
13. 9 1650 - Der Kölner Kurfürst Ferdinand stirbt in Arnsberg
Arnsberg * Ferdinand, der Kölner Kurfürst und Bischof von Köln, Lüttich, Hildesheim, Münster und Paderborn, stirbt in Arnsberg/Westfalen. Sein Neffe, Maximilian Heinrich, übernimmt die Kurwürde sowie die Bistümer Köln, Lüttich und Hildesheim. Die Bistümer Münster und Paderborn gehen dem Hause Wittelsbach für einige Jahre verloren.
Wilhelm Freiherr von Höllinghofen, der gemeinsame Sohn des Fürstbischofs Ernst und seiner Mätresse Gertrud von Plettberg, übernimmt von ihm die Reichsabtei Stablo-Malmedy.
11. 12 1650 - Eine Hochzeit „kraft Vollmacht“ in Turin
Turin * Die 14-jährige savoyische Prinzessin Henriette Adelaide wird in Turin „per procurationem“, also kraft Vollmacht, mit dem gleichaltrigen baierischen Kurprinzen Ferdinand Maria verheiratet. Die Stelle des abwesenden Bräutigams nimmt ihr Bruder Carl Emanuel II. ein.
1651 - Ferdinand Maria genehmigt den Paulanern den Bau eines Brauhauses
Au * Kurfürst Ferdinand Maria gestattet den Paulanern den Bau eines Brauhauses im Auer Kloster.
Das Jahr gilt als Geburtsjahr des weltweit bekannten „Salvator-Bieres“.
16. 1 1651 - Wolfgang Holzer kommt in Warngau bei Miesbach zur Welt
Warngau * Wolfgang Holzer, der spätere Abt der im Lehel beheimateten Ordensgemeinschaft der Hieronymiten, kommt in Warngau bei Miesbach zur Welt.
24. 1 1651 - Anna Maria Katharina di San Germano d‘Agliè wird geboren
Piemont * Anna Maria Katharina di San Germano d‘Agliè, die spätere Besitzerin der Hofmark Haidhausen, wird geboren.
1. 6 1651 - Caspar von Schmid erhält eine Anstellung als Hofrat
München * Caspar von Schmid erhält eine Anstellung als Hofrat in der Haupt- und Residenzstadt München.
9 1651 - Kurfürst Maximilian Heinrich wird in Bonn zum Priester geweiht
Bonn * Kurfürst Maximilian Heinrich von Köln, Bischof von Münster und Hildesheim, wird in Bonn zum Priester geweiht.
Damit ist er nach mehr als einhundert Jahren der erste zum Bischof geweihte Erzbischof von Köln.
27. 9 1651 - Kurfürst Maximilian I. stirbt in Ingolstadt
Ingolstadt - München-Kreuzviertel * Kurfürst Maximilian I. stirbt in Ingolstadt. Er wird in der Münchner Michaelskirche beigesetzt.
Sein Nachfolger wird Kurprinz Ferdinand Maria, dessen Regentschaft bis zu seiner Volljährigkeit seine Mutter, die Kaisertochter Maria Anna, übernimmt.
8. 12 1651 - Der Freisinger Bischof Veit Adam von Gepeckh stirbt
Freising * Der Freisinger Bischof Veit Adam von Gepeckh stirbt. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird der 28-jährige Baiernherzog Albrecht Sigismund. Ihm gehört damit - neben seiner Residenzstadt Freising samt ihrem Burgfrieden - die Grafschaft Ismaning, die Herrschaft Isen-Burgrain und die Grafschaft Werdenfels.
1652 - In London werden „Kaffeeschenken“ eröffnet
London * In London werden „Kaffeeschenken“ eröffnet.
16. 5 1652 - Die savoyische Prinzessin Henriette Adelaide begibt sich nach München
Turin - München * Die savoyische Prinzessin Henriette Adelaide zieht mit einem Tross mit 350 Personen von Turin in Richtung München.
17. 6 1652 - Henriette Adelaide von Savoyen trifft in Kufstein ein
Kufstein * Henriette Adelaide von Savoyen trifft in Kufstein ein. Dort kommt es zur ersten inoffiziellen Begegnung der jungen Braut mit ihrem gleichaltrigen Bräutigam Ferdinand Maria.
18. 6 1652 - Vor Wasserburg am Inn treffen sich die Brautleute erstmals offiziell
Wasserburg am Inn * Vor Wasserburg am Inn findet die offizielle Begegnung des baierischen Hofstaats mit dem Brautzug der savoyischen Prinzessin Henriette Adelaide zusammen. Die hohen Herrschaften begeben sich anschließend ins Wasserburger Schloss zum Abendessen.
21. 6 1652 - Die savoyanische Prinzessin Henriette Adelaide trifft in München ein
München * Die savoyanische Prinzessin Henriette Adelaide trifft nach einer gut fünfwöchigen Reise in München ein, wo sie mit dem Donnern von 170 Geschützen begrüßt wird.
25. 6 1652 - Die Ehe wird in München erneut geschlossen
München * Die Ehe des 15-jährigen Kurprinzen Ferdinand Maria und der gleichaltrigen Henriette Adelaide von Savoyen wird in München erneut geschlossen.
8 1652 - Kurfürstin Henriette Adelaide pilgert nach Altötting
Altötting • Kurfürstin Henriette Adelaide pilgert gemeinsam mit ihrem Gatten, Kurfürst Ferdinand Maria, nach Altötting, um sich dort den Segen der Gottesmutter für ihre Ehe zu erbitten.
17. 11 1652 - Caspar von Schmid heiratet die Hofbeamtenstochter Katharina von Imsland
München-Angerviertel * Caspar von Schmid heiratet die Hofbeamtenstochter Katharina von Imsland. Die feierliche Trauung findet am späten Abend in der Peterskirche statt, wie es in vornehmen Kreisen des Barocks damals Brauch war.
1653 - Der „Reichstag“ will eine „Kalendervereinheitlichung“
Regensburg * Der „Reichstag“ formuliert die Notwendigkeit einer „Kalendervereinheitlichung“.
Der er sich aber nicht auf einen Beschluss einigen und vertagt die Angelegenheit auf die nächste „Reichsversammlung“.
3. 5 1654 - Der Grundstein für das Karmelitenkloster wird gelegt
München-Kreuzviertel * Der Grundstein für das Karmelitenkloster neben der Wilhelminischen Veste [= Herzog-Max-Burg] wird von Herzog Albrecht VI. gelegt.
31. 10 1654 - Kurprinz Ferdinand Maria wird volljährig
München • Kurfürst Ferdinand Maria wird volljährig. Damit erlischt die Vormundschaft seiner Mutter Maria Anna und er kann die Regentschaft selbst übernehmen.
1655 - Kurfürst Ferdinand Maria soll zum Kaiser kandidieren
Paris - München * Der französische Kardinal Jules Mazarin trägt Kurfürst Ferdinand Maria die Kandidatur für die Nachfolge des am 9. Juli 1654 verstorbenen Kaisers Ferdinand IV. an.
19. 7 1655 - Heiligsprechung des Ordensgründers Kajetan von Thiene unterstützt
München - Wien • In einem Brief der Kurfürstin Henriette Adelaide an Kaiser Ferdinand III. unterstützt sie die Bitte des Theatinerordens, die Heiligsprechung des Ordensmitbegründers Kajetan von Thiene zu unterstützen.
28. 7 1655 - Bitte um Heiligsprechung des seligen Kajetan
München - Rom • Kurfürstin Henriette Adelaide bittet in einem Brief Papst Alexander VII. um die Heiligsprechung des Mitbegründers des Theatinerordens Kajetan von Thiene.
9 1656 - Caspar von Schmid wird zum „Geheimen Rat“ ernannt
München * Caspar von Schmid wird „in Ansehung seiner bis dato zu Ihrer kurfürstlichen Durchlaucht gnädigsten Satisfaction und Gefallen“ zum „Geheimen Rat“ ernannt.
1657 - „Weingärten“ im Bereich der heutigen Baader- und Erhardtstraße
München-Isarvorstadt * Ein Kupferstich von Matthäus Merian zeigt „Weingärten“ im Bereich der heutigen Baader- und Erhardtstraße.
10. 2 1657 - Wilhelm Freiherr von Höllinghofen stirbt
Schloss Höllinhofen * Wilhelm Freiherr von Höllinghofen, der Fürstabt der Reichsabtei Stablo-Malmedy und gemeinsame Sohn des Fürstbischofs Ernst und seiner Mätresse Gertrud von Plettberg, stirbt auf Schloss Höllinghofen. Maximilian Heinrich, der Fürstbischof und Kurfürst von Köln, wird Abt der Reichsabtei Stablo-Malmedy.
2. 4 1657 - Kaiser Ferdinand III. stirbt
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Kaiser Ferdinand III. stirbt in Wien. </p>
24. 8 1657 - Kurfürst Ferdinand Maria verzichtet auf die Kaiserkrone
München - Wien • Der baierische Kurfürst Ferdinand Maria lässt - die Vor- und Nachteile der Kaiserkrone abwägend - die politische Vernunft siegen und erklärt gegenüber Wien, dass er die Krone zurückweisen und seine Stimme nur einem Habsburger geben werde. Die Begründung fasst er in einem Brief zusammen:
- die „zur Erhaltung der Kays. Hochheit und Reputation“ unumgänglichen Kosten,
- die heillosen Zustände im Reich,
- die Verantwortung, die dabei auf den Kaiser falle und die Gefahren für das eigene Land.
- Den zu erwartenden Kampf mit Habsburg auf sich zu nehmen, lohnt sich nicht.
Das heißt allerdings nicht, dass man begeistert ist, dass wieder ein Habsburger die Krone bekommen soll und Österreich seine Macht behaupten oder gar erweitern kann.
24. 9 1657 - Maria Anna Lindmayr wird geboren
München-Angerviertel * Maria Anna Lindmayr wird als Tochter eines betuchten Münchner Bürgers unweit der Heilig-Geist-Kirche geboren und noch am selben Tag in der zuständigen Pfarrkirche St.-Peter getauft.
12. 1 1658 - Ferdinand Maria verpflichtet sich zur Kaiserwahl Leopolds I.
München - Wien * Kurfürst Ferdinand Maria verpflichtet sich in einem Vertrag zur Kaiserwahl Erzherzogs Leopolds [I.].
12. 1 1658 - Kurfürst Ferdinand Maria erhält das Amt des Reichsvikars
Waldmünchen • Kurfürst Ferdinand Maria verpflichtet sich im Vertrag von Waldmünchen die Wahl des Habsburgers Leopold [I.] zum Kaiser zu unterstützen. Im Gegenzug entscheiden die Habsburger den langwierigen Streit zwischen dem baierischen Kurfürsten Ferdinand Maria und seinem Vetter Carl Ludwig von der Pfalz um das Amt des Reichsvikars zugunsten Ferdinand Marias.
18. 7 1658 - Leopold I. wird zum Kaiser gewählt
Frankfurt am Main • Nachdem Kurfürst Ferdinand Marias Wahlkapitulation unterzeichnet worden ist, wird der erst achtzehnjährige Erzherzog Leopold I. in Frankfurt am Main zum Kaiser gewählt und gekrönt. Leopold ist ein engstirniger und dumpf-katholischer Habsburger.
Mit der Wahl endete das längste Interregnum [= kaiserlose Zeit] der neueren Zeit. Der Verzicht des baierischen Kurfürsten auf die Kaiserkrone erspart dem Reich und Baiern unabsehbare Wirren.
1. 8 1658 - Leopold I. wird in Frankfurt am Main zum Kaiser gekrönt
Frankfurt am Main * Erzherzog Leopold wird im Kaiserdom St. Bartholomäus zu Frankfurt zum Kaiser Leopold I. des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt.
28. 8 1658 - Ein Festumzug zu Ehren des neugekrönten Kaisers
München-Maxvorstadt * Kurfürst Ferdinand Maria veranstaltet zu Ehren des neu gekrönten Kaisers Leopold I. den Festumzug „Applausi festivi barriera“ mit anschließendem Turnier. Kaiser Leopold I. macht auf seiner Rückreise von den Krönungsfeierlichkeiten in Frankfurt vom 26. August bis 4. September in München Station.
5. 6 1659 - Ein Kuraufenthalt in Heilbrunn soll der Kinderlosigkeit Einhalt gebieten
Heilbrunn * In Heilbrunn trifft das Kurfürstenpaar Ferdinand Maria und Henriette Adelaide, begleitet von einem Hofstaat von über 150 Personen ein. Die Ehe des gleichaltrigen, 22-jährigen Paares ist auch im achten Jahr kinderlos geblieben. Das beunruhigt den Adel und wird als Zeichen der Schwäche ausgelegt.
Ein Kuraufenthalt in Heilbrunn soll der Kinderlosigkeit Einhalt gebieten. Fünf Wochen, bis 10. Juli, dauert die Kur an. Danach kehrt die Kurfürstin gestärkt und bei guter Gesundheit wieder nach München zurück.
7 1659 - Bischof Albrecht Sigismund von Freising will heiraten
Bergen-op-Zoom - Freising • Die Heiratspakte für den heiratslustigen Bischof Albrecht Sigismund von Freising mit Henrika Franziska Fürstin von Zollern werden ausgetauscht. In der Folge wäre Bischof Albrecht Sigismund aus dem geistlichen Stand ausgeschieden, hätte eine jährliche Beihilfe von 18.000 Gulden erhalten und wäre nach dem Tod seines Vaters in die Rechte eines Herzogs von Leuchtenberg eingetreten.
1660 - Zwölf Quellen führen dem „Brunnhaus im Brunnthal“ das Wasser zu
Bogenhausen * Zwölf Quellen führen dem unterhalb „Neuberghausen“ gelegenen „Brunnhaus im Brunnthal“ das Wasser zu.
1660 - Hofmedicus Dr. Johann Joachim Becher wird Kaiserlicher Hofrat
Wien * Der ehemalige Hofmedicus Dr. Johann Joachim Becher wird Kaiserlicher Hofrat.
Er ist der bedeutendste Kameralist des 17. Jahrhunderts. Er wettert schon seit Langem gegen die Einfuhr fremder Industrieerzeugnisse und meint, es wäre für ihn „sicherlich verdienstvoller, das Seidenwerk zu fördern, als wenn er etliche alte Weiber im Spital etwan ¼ Jahr eher dem Tod entnommen, noch als wan er etlichen Bauern aus dem Urin propheceyet hätte“.
Dr. Becher wird als „unruhiger, immer mit Chimären, aber vielen Kenntnissen und guten Einfällen beschäftigter Kopf“ beschrieben.
9. 6 1660 - König Ludwig XIV. heiratet die spanische Infantin Maria Theresia
Versailles * Der französische König Ludwig XIV. heiratet die spanische Infantin Maria Theresia.
26. 6 1660 - Dem Haidhauser Kleinwirt wird das Weißbierschankrecht genommen
Haidhausen * Dem Haidhauser Mesner und Kleinwirt Georg Pockmayer wird das Weißbierschankrecht genommen. Damit verliert er vorübergehend seine Konkurrenzfähigkeit, da der Großwirt Weißbier, Braunbier und Branntwein ausschenken darf.
5. 9 1660 - Die Karmeliten-Kirche wird eingeweiht
München-Kreuzviertel * Die Karmeliten-Kirche neben der Wilhelminischen Veste wird eingeweiht. Die von Kurfürst Maximilian I. noch zu seinen Lebzeiten gestiftete Votivkirche ist die erste baierische Barockkirche.
17. 11 1660 - Maria Anna Christina Victorie wird in München geboren
München * Maria Anna Christina Victorie, die Tochter des baierischen Kurfürsten Ferdinand Maria und seiner Gemahlin Henriette Adelaide, wird in München geboren. Das freudige Ereignis tritt ein Jahr nach der Kur ihrer Mutter in Heilbrunn ein.
1661 - Die Türkenkriege flammen wieder auf
Kroatien * Die Türkenkriege flammen wieder auf. Sie dauern bis 1664.
16. 7 1661 - Unterstützung durch den Theatinerpater Agostino Bozomo
Rom - München • Der Theatiner-Ordensgeneral Agostino Bozomo sagt der Kurfürstin Henriette Adelaide seinen besonderen Einsatz für ihr Anliegen zur Niederlassung der Theatiner in München zu.
5 1662 - Caspar von Schmid wird baierischer Vizekanzler
München * Caspar von Schmid wird baierischer Vizekanzler.
10. 7 1662 - Obersthofmeister Maximilian Graf Kurz von Senftenau stirbt
München-Graggenau • Der Obersthofmeister Maximilian Graf Kurz von Senftenau stirbt und hinterlässt seiner Witwe einen aus mehreren Gebäuden bestehenden Baukomplex an der Vorderen Schwabinger Gasse [= Residenzstraße 2].
11. 7 1662 - Max Emanuel, der spätere Kurfürst, wird in München geboren
München • Der Kurprinz Maximilian II. Maria Emanuel, genannt Max Emanuel, der spätere baierische Kurfürst, wird in München geboren. Seine Eltern sind Kurfürst Ferdinand Maria und Henriette Adelaide.
Um den 12. 7 1662 - Der Kurfürst lässt ein Churbaierisches Freudenfest organisieren
München * Unverzüglich nach der Geburt des Kurprinzen Max Emanuel befiehlt Kurfürst Ferdinand Maria die Vorbereitung „underschidlich herrliche[r] freuden- und jubel festiviteten mit ainer herrlich magnificenz und schöne niemahln vorher gesechnen inventionen ins werkh zubringen“. Die Konzeption des Festes, das Oper, Turnier und Feuerwerk erstmals zur thematischen Einheit verschmilzt, macht den kurbaierischen Hof zum Vorreiter europäischer Hofkultur.
10. 8 1662 - Kurfürst Ferdinand Maria lehnt die Bitten der Theatiner ab
München-Kreuzviertel • Da die Rochus-Kapelle seit ihrer Niederlassung den Augustiner-Eremiten anvertraut worden war, galten ihre Vorrechte auch noch, als die Theatinerpatres die Kirche für ihre Zwecke nutzen. Denn die Augustiner lesen hier wöchentlich zwei Messen. Dass das die Theatiner als störend empfinden, kann nachvollzogen werden. Entsprechend unzufrieden sind sie deshalb auch mit dieser Situation. Deshalb bitten sie den Ferdinand Maria um Erweiterung der Kirche und des Wohnhauses. Der Kurfürst verweigert in Anbetracht des geplanten Neubaus dieses Ansinnen.
25. 8 1662 - Das erste Haus auf dem Bauplatz der Theatinerkirche gekauft
München-Kreuzviertel • Für das erste Haus auf dem künftigen Bauplatz für die Theatinerkirche zahlt Kurfürstin Henriette Adelaide 7.000 Gulden.
20. 9 1662 - Der Salzburger Fürstbischof Max Gandolph zieht feierlich in München ein
München * Der Salzburger Fürstbischof Max Gandolph zieht feierlich in München ein. Er soll am nächsten Tag den Kurprinzen Max Eanuel taufen. Am Abend wird auf dem Hirschanger ein „architektonisches Feuerwerk“ gezündet. Dazu ist extra eine Bühne mit flankierenden Pyramiden und feuerspeienden Türmen aufgebaut worden. Mit dem Feuerwerk beginnt ein pompöses Geburtstags- und Freudenfest. Es endet am 3. Oktober mit der Abfahrt der Gäste und dient der Demonstration baierischen Machtanspruchs.
21. 9 1662 - Der Kurprinz wird auf die Namen Maximilian Emanuel getauft
München • Kurprinz Max Emanuel wird in der Frauenkirche vom Salzburger Fürsterzbischof Guidobald von Thun und Hohenstein auf die Namen Maximilian Emanuel Ludwig Maria Joseph Cajetan Antonius Nikolaus Franziskus Ignatius Felix getauft. Er stellt sich damit als Erbe der bedeutendsten Vertreter der Häuser Wittelsbach und Savoyen vor. Als Taufpaten werden der Cousin Ferdinand Marias, der Erzbischof und Kurfürst von Köln, Maximilian Heinrich, sowie Henriette Adelaides Bruder, Carl Emanuel, erwählt.
21. 9 1662 - Salzburg soll eine Kajetan-Kapelle erhalten
München • Aus Anlass der Taufe des Kurprinzen Max Emanuel äußert sich der Salzburger Fürstbischof Guidobald von Thun und Hohenstein gegenüber dem baierischen Kurfürsten Ferdinand Maria, dass er die Verehrung des seligen Kajetan von Thiene auch in Salzburg einführen und dazu dem Ordensgründer eine Kapelle in seiner Kathedrale weihen lassen wird.
22. 9 1662 - Die hohen Herrschaften vergnügen sich bei der Jagd
München • Im Rahmen des Churbaierischen Freudenfestes aus Anlass der Geburt des Kurprinzen Max Emanuel vergnügen sich die hohen Herrschaften an diesem und am nächsten Tag bei der Jagd.
26. 9 1662 - Die Fortsetzung der Festtriologie mit einem Turnierspiel
München-Graggenau * Die Fortsetzung der Festtriologie findet mit dem Turnierspiel „Antiopa Giustificata“ statt, das im überdachten Brunnenhof der Residenz beginnt und am Nachmittag im Turnierhaus am Hofgarten fortgesetzt wird. Dort hat man zwei gegenüberliegende Bühnen aufgebaut:
- Eine männliche mit dem baierischen Wappen und
- eine weibliche mit dem Wappen von Savoyen.
Eine Sphinx tritt mit einem Spiegel auf, in dem Kurfürst Ferdinand Maria die „herrlichen Taten“ seines Sohnes erkennen könne, mit denen Max Emanuel „die Welt überraschen“ werde: Die „Siege über die Barbaren“ und den „Triumph über die Türken“, der den „Untergang des Halbmondes“ zur Folge haben wird.
1. 10 1662 - Das Churbaierische Freudenfest erreicht seinen Höhepunkt
München * Mit der abschließenden - drei Stunden dauernden - Feueroper „Medea Vendicativa“ erreicht das Churbaierische Freudenfest seinen Höhepunkt.
Erstmals in der Münchner Festgeschichte wird die Isar in das festliche Geschehen einbezogen. Auf der Isar schwimmen - „ungefer ein musquetenschus ausser der statt underhalb der stattmihl“ - dekorierte Bühnenflöße. Dadurch kann man die Bühne schnell teilen und so Platz schaffen für Seegefechte. Dass man die Isar als Festort einbezogen hat, liegt jedoch weniger an der Freude am feuchten Element. Vielmehr sind feuerpolizeiliche Gründe dafür ausschlaggebend.
Die Zuschauer erleben eine regelrechte Wasserschlacht, die damit endet, dass der Kurprinz in einer Triumphbogenarchitektur erscheint und eine Schlange erwürgt. Die Botschaft lautet: Die Niederwerfung der Osmanen kann nur mit Max Emanuel gelingen!
3. 10 1662 - Das Churbaierische Freudenfest ist beendet
München * Das Churbaierische Freudenfest zur Geburt des Thronfolgers Max Emanuel endet mit der Abfahrt der Gäste.
18. 10 1662 - Prinz Eugen von Savoyen wird in Paris geboren
Paris * Prinz Eugen von Savoyen wird in Paris geboren.
12 1662 - Kurfürst Ferdinand Maria gibt den Bucintoro in Auftrag
Starnberg * Kurfürst Ferdinand Maria gibt den „Bucintoro“, das große Leibschiff der kurfürstlichen Flotte, in Auftrag. Die Anregung für den „Bucentaur“ kommt aus dem Roman „Clélie“, der Lieblingslektüre der Kurfürstin Henriette Adelaide. In dieser Geschichte schildert Madeleine de Scudery ein rauschendes Fest, das eine fürstliche Gesellschaft auf einer luxuriösen Galeere zu Ehren der Göttin Venus feiert. Die selbe Lektüre war auch der Anstoß für das Herzkabinett in der Münchner Residenz.
Der schwimmende Palast entsteht unter Beteiligung venezianischer Schiffsbau-Meister. Die Leitung hat der „welsche ingeniere“ Francesco Santurini aus Venedig, der für den Kurfürsten schon als Theater-Architekt tätig ist und der sich deshalb den eigentümlichen Titel eines „Schifmaisters zu Starnberg“ einhandelt. Neben den zwei venezianischen Meistern beteiligte sich noch eine große Zahl einheimischer Arbeitskräfte am Schiffsbau. Selbst aus der Au kommen Zimmerleute.
20. 1 1663 - Beginn des Immerwährenden Reichstags in Regensburg
Regensburg * Der Reichstag trifft im Regensburger Rathaus zusammen, um über die durch die Türken heraufbeschworene Gefahr an der Ostgrenze des Reiches zu beraten. Kaiser Leopold I. benötigt Geld für die bevorstehende Verteidigung des Landes.
Daneben geht es um den schon länger schwelenden Streit um die Ausarbeitung einer Wahlkapitulation und die Königswahl. Bei den Auseinandersetzungen um die Wahlkapitulation geht es um das Recht, Gesetze zu erlassen und um deren Inhalte. Außerdem soll sich der Reichstag mit den liegengebliebenen Problemen des Dreißigjährigen Krieges befassen.
Der Reichstag wird sich bis Februar 1803 nicht mehr auflösen und geht als Immerwährender Reichstag in die Geschichte ein. Regensburg wird damit zum Sitz von etwa 70 Komitialgesandtschaften ausländischer Staaten. Dies auch deshalb, weil seit der Umwandlung des Reichstags in den Immerwährenden Reichstag die Landesfürsten kaum noch selbst teilnehmen, sondern sich durch Gesandte vertreten lassen.
6 1663 - Der Rumpf des Bucentaur ist fertig
Starnberger See * Der Rumpf des Bucentaur, des Leibschiffs des Kurfürsten Ferdinand Maria, ist fertig und kann auf Walzen ins Wasser gebracht werden. Umgehend beginnen nun die Arbeiten an den Aufbauten und dem Innenausbau.
10. 8 1663 - Planungen für das Schlosses Nymphenburg
München - Turin • Kurfürstin Henriette Adelaide bittet ihre Mutter Christine Marie ihr bei der Planung der „Vier Appartements Nobles“ zu helfen. Es geht um um Planungen für das Schlosses Nymphenburg.
20. 8 1663 - Abmessung des Bauplatzes für Schloss Nymphenburg
Nymphenburg • Baumeister Agostino Barelli und Maurermeister Lorenzo Perti begeben sich für drei Tage zur Abmessung des Bauplatzes für Schloss Nymphenburg nach Mentzing.
Ab 2 1664 - Der Bucentaur kostet 20.040 Gulden
Starnberger See * Die Kistler können die Verkleidung der Wände und Decken sowie die Parkettböden des Bucentaur fertigen. Danach wird vertäfelt, gemalt, gefasst und vergoldet. Das Schiff kostet am Ende insgesamt 20.040 Gulden, wovon die Kosten für die 268.000 Nägel noch den geringsten Anteil ausmachen. Der größte Posten an der Gesamtrechnung ist - mit 4.600 Gulden - der Aufwand für die Vergolder und Maler.
Francesco Santurini baut für Kurfürst Ferdinand Maria jene Staatsgaleere des venezianischen Dogen nach, mit der dieser jedes Jahr am Himmelfahrtstag auf das Meer hinaus fährt, um symbolisch die Vermählung Venedigs mit der Adria zu vollziehen und dabei - mit feierlichem Zeremoniell - einen goldenen Ring ins Wasser wirft. Die Galeere des Dogen nennt man wegen ihrer Goldpracht „Buzo d’oro“ oder „Bucintoro“. Das venezianische Staatsschiff wird zum Vorbild der Bucentaur, der aber, mit über dreißig Meter Länge und drei übereinander liegenden Decks ein Stück größer und prächtiger ist.
13. 2 1664 - Die Grafen von Taxis übernehmen das bairische Postwesen
Regensburg * Die Grafen von Taxis aus Regensburg übernehmen die Errichtung einer regulären Postverbindung im Kurfürstentum Baiern.
19. 3 1664 - Kurfürst Ferdinand Maria erklärt den Josephstag zum Feiertag
München-Kreuzviertel * Kurfürst Ferdinand Maria erklärt den „Josephstag“ zum Feiertag. Nach der Heiligenlegende arbeitet Joseph als Zimmermann und verlobt sich als achtzigjähriger Witwer mit der zwölfjährigen Maria.
Die Anfang des 17. Jahrhunderts entwickelte Wirtschaftsideologie des Merkantilismus besagt, dass die Anzahl der Bevölkerung die Wirtschaftskraft eines Staates bestimmt. Um den Geburtenzuwachs zu erhöhen, müssen die Herrscher das eheliche Leben fördern. Als Vorbild des „Hausvaters“ dient ihnen dafür der heilige Joseph. Demzufolge wird aus dem achtzigjährigen Greis ein Mann mittleren Alters mit christusähnlichen Gesichtszügen. Joseph wird aber nicht nur zum Patron der Ehepaare und Familien, sondern auch der der Arbeiter und Handwerker.
4. 5 1664 - De heilige Josef wird zum Patron des Baiernlandes ernannt
München-Kreuzviertel * Kurfürst Ferdinand Maria ernennt den Heiligen Josef in der Karmelitenkirche zum Patron des Baiernlandes.
31. 5 1664 - Eine Türkensteuer wird erhoben
München * Eine Türkensteuer wird durch Kurfürst Ferdinand Maria erhoben, nachdem die Türken in Ungarn wieder unruhig geworden sind.
9. 7 1664 - Theatiner-Ordensniederlassung in Praggenehmigt
Wien - Prag * Die Erlaubnis zur Niederlassung des Theatiner-Ordens in Prag wird von Kaiser Leopold I. ausgestellt.
10. 7 1664 - Agostino Barelli kehrt nach Bologna zurück
München • Agostino Barelli darf nach Bologna zurückkehren. In einem Enpfehlungsschreiben [= Zeugnis] der Kurfürstin Henriette Adelaide drückt sie ihre „uneingeschränkte Zufriedenheit“ aus.
3. 8 1664 - Anna Maria Cammerloher kauft den Edelsitz Wagegg in der Au
Au * Der Rat des Inneren und Aufschlagseinnehmer der Landschaft in Baiern, Georg Benno Schobinger von Steppberg, verkauft den Edelsitz Wagegg in der Au an Anna Maria Cammerloherin, der Ehefrau des Hofkammerrats Johann Christoph Cammerloher.
10. 8 1664 - 20-jährigen Waffenstillstand mit den Türken vereinbart
Vasvár-Eisenburg * Kaiser Leopold I. schließt in Vasvár-Eisenburg mit den Osmanen den Friedensvertrag von Eisenburg für die Dauer von zwanzig Jahren ab.
27. 9 1664 - Der Waffenstillstand von Vasvár-Eisenburg wird gültig
Vasvár-Eisenburg * Der zwischen Kaiser Leopold I. und den Türken unter Führung von Sultan Mehmed IV. in Vasvár-Eisenburg ausgehandelte 20-jährige Waffenstillstand wird nach der Ratifizierung des Vertrags vom 10. August gültig.
1665 - Das „Landgebot gegen Aberglauben und Hexerei“ wird erneuert
München * Das „Baierische Mandat gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“ wird durch Kurfürst Ferdinand Maria erneuert.
Es handelt sich dabei um eine fast wörtliche Wiederholung des Textes aus dem Jahr 1611.
25. 9 1665 - Kurfürstin Maria Anna von Baiern stirbt
München • Die Kurfürstin-Witwe Maria Anna stirbt. Sie wird in der Münchner Michaelskirche beigesetzt. Durch den Tod der Kaisertochter gelingt es Kurfürst Ferdinand Maria und Henriette Adelaide ihren Wirkungskreis am Münchner Hof deutlich auszudehnen und zu festigen.
30. 11 1665 - Kurfürst Ferdinand Maria gründet die Churbaierische Seidencompagnie
München * Aufgrund seiner bohrenden Forderungen von Dr. Johann Joachim Becher erlässt Kurfürst Ferdinand Maria ein Mandat zur Gründung der Churbaierischen Seidencompagnie. Dort heißt es: „Wir haben mit sonderß angelegenen Vleiß unsere sorgfälltigen gedankhen dahin gewendet, wie die negoiten und manufacturen zu nuz Unserer Underthanen in ein besseres eße [Sein] und Flor gebracht werden“ kann.
Kurfürst Ferdinand Maria will mit der eigenen Seidenproduktion „das heuffig hinaußgehende gelt im land erhalten, alß auch den Armen und müssig gehenden betlern, welche anderen Ehrlichen leuthen überlästig vor den heusern ligen, eine ehrliche Underhaltung verschaffen“.
Und weiter meint der Kurfürst, in der Manufaktur „soll aus roher, anderwerts hergeschaffter Seide Zwirn, Stepp-, Nehe-, und allerhand andere Seide, auch Seidenbender und Zeuge gemacht werden“.
7. 1 1666 - Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn heiratet Maria Claudia
??? * Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn heiratet Freiin Maria Claudia Hausmann von Namedy.
9. 1 1666 - Der 78-jährige Greis Simon Altseer wird als Hexer hingerichtet
München * Der 78-jährige Greis Simon Altseer aus der Hofmark Rottenbuch wird - wegen seiner Gefährlichkeit - in München als Hexer hingerichtet. Er wird auf der Gerichtsstatt mit glühenden Zangen gezwickt und ihm dann - wegen seiner Diebstähle - die rechte Hand abgehackt. Schließlich wird er auf dem Scheiterhaufen erdrosselt und anschließend sein Leichnam zu Asche verbrannt.
7 1666 - Die Söhne Albrechts VI. verzichten auf das Erbe der Hofmark Neudeck
Au * Wegen der hohen Unterhaltskosten verzichten die Söhne Albrechts VI. auf das Erbe der Hofmark Neudeck. Es soll lieber dem kurfürstlichen Haus offeriert werden.
5. 7 1666 - Herzog Albrecht VI. stirbt in München
München * Herzog Albrecht VI. stirbt in München. Sein Grab befindet sich in der Wallfahrtskirche in Altötting.
Um 8 1666 - Kurfürst Ferdinand Maria überlässt den Paulanern den Neudecker Garten
Au * Kurfürst Ferdinand Maria überlässt den Paulanern den Neudecker Garten.
4. 8 1666 - Ein weiterer Kurprinz wird in Dachau geboren
Dachau • Ein weiterer Sohn des baierischen Kurfürstenpaares Henriette Adelaide und Ferdinand Maria wird in Dachau geboren. Er stirbt noch am selben Tag.
23. 12 1666 - Der Transport der Briefe erfolgt ab sofort mit der Reichspost
München * Nach einem Befehl von Kurfürst Ferdinand Maria wird das Botenwerk aufgehoben. Ab sofort wird der Transport der Briefe - bei Strafandrohung - an die Reichspost übergeben.
13. 4 1667 - Caspar von Schmid übernimmt die baierischen Regierungsgeschäfte
<p><strong><em>München</em></strong> * Nach der Entlassung des Kanzlers Johann Georg von Oexl übernimmt Vizekanzler Caspar von Schmid als Vorsitzender des Geheimen Rates die Regierungsgeschäfte. </p> <ul> <li>Die gesamte Innen- und Außenpolitik liegt seither in seinen Händen. </li> <li>Er genießt das volle Vertrauen des Kurfürsten, der die klare Zielsetzung seiner Politik schätzt. </li> </ul>
1668 - Nach dem Dreißigjährigen Krieg verwalden die Weinberge
Donaustauf * 20 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg sind bei Donaustauf noch 110 Weinberge „zu Holz und Stauden erwachsen“.
Um das Jahr 1668 - Der „Kleinwirt“ spendiert ein Grundstück für die neue „Wolfgangs-Kapelle“
Haidhausen * Der „Kleinwirt“ von Haidhausen, Georg Pockmayer, übergibt Kurfürst Ferdinand Maria ein Grundstück neben seinem Haus, auf dem der Landesherr die neue „Wolfgangskapelle“ errichten will.
Das alte, aus Holz erbaute Kircherl ist im Laufe der Jahre baufällig geworden.
Auf „unterthänigstes anhalten etlicher gewißer persohnen, welche auß Irer zu den heyligen Wolfgang tragenden Devotion, dessen im Dorff Haidhausen stehende vnd Paufellige kleine Capelle zu reparieren vnd zu erweitern vorhabens“.
Nun erteilt Kurfürst Ferdinand Maria die Genehmigung zum Neubau und bewilligt darüber hinaus fünfhundert Gulden.
Und unser „Kleinwirt“ war eben nicht nur ein „frommer Mann“, sondern auch ein cleverer Geschäftsmann.
Kein Wunder, dass nach dieser „sozialen Tat“ das „Schankrecht für Braunbier“ nicht mehr lange auf sich warten ließ.
1668 - Ein Teilungsvertrag zwischen Österreich und Frankreich
Wien - Paris * Ein Teilungsvertrag wird zwischen Österreich und Frankreich, das spanische Erbe betreffend, abgeschlossen.
Um den 1668 - Die Privilegien der Churbaierischen Seidencompagnie
München * Dr. Johann Joachim Becher ist zwischenzeitlich zum kurbaierischen Leibmedicus und kurfürstlichen Rat erhoben worden, hat sich aber nach einem zweijährigen Aufenthalt in Baiern - wegen der „erfahrenen Schmähungen“ - verärgert nach Wien zurückgezogen, wo er sich der dortigen Seidenmanufaktur widmet. Das Wiener Unternehmen entwickelt sich bald zur großen baierischen Konkurrenz.
Zu Bechers Nachfolger als Direktor der Churbaierischen Seidencomapgnie wird der kurfürstliche Revisionsrath Dr. Jobst ernannt. Die Churbaierische Seidencompagnie ist - wie alle merkantilistischen Unternehmen - mit besonderen Freiheiten und Privilegien ausgestattet worden. Alleine die Gesellschaft ist befugt, „die roh eingeführte oder im Land erzeugte Seide verarbeiten“ zu lassen. Nur sie darf die Seide in grosso verkaufen.
Das heißt, dass alle baierischen Kaufleute ihren Bedarf an Seide bei der Churfürstlichen Seidencompagnie decken müssen. Wer gegen diese Vorgaben verstößt und fremde Seidenwaren einführt, muss die Confiscation der Ware hinnehmen und dem Staat eine Strafe von 1.000 Reichstalern bezahlen.
1. 6 1668 - Albrecht Sigismund wird Bischof von Regensburg
Freising - Regensburg - Salzburg * Guidobald Graf von Thun und Hohenstein, der Fürsterzbischof von Salzburg und Regensburg stirbt in Salzburg.
Mit Unterstützung seines Vetters, Kurfürst Ferdinand Maria, wird Herzog Albrecht Sigismund, der Bischof von Freising, aus der wittelsbachischen Linie der Leuchtenberger zusätzlich zum Bischof von Regensburg gewählt. Gleichzeitig übernimmt er das Amt des Domprobstes in Konstanz und das des Stiftungsprobstes in Altötting.
30. 7 1668 - Albrecht Sigismund wird zum Bischof von Regensburg gewählt
Regensburg • Der Freisinger Fürstbischof Albrecht Sigismund wird einstimmig auch zum Bischof von Regensburg gewählt. Es dauert ganze zwölf Jahre, bis sich der Bischof zum ersten Mal in seinem Bistum Regensburg sehen lässt.
1669 - In der Au ein „Seidenhaus“ eingerichtet
<p><strong><em>Au</em></strong> * Unter Kurfürst Ferdinand Maria wird in der Au ein <em>„Seidenhaus“</em> eingerichtet. Doch als Arbeitskräfte werden dann - zum Teil sogar gegen den ernsten Willen der Eltern - auch Kinder eingestellt und nicht arbeitsuchende Stadtarme. Das Seiden-Unternehmen ist allerdings bereits im Jahr 1676 finanziell wieder am Ende.</p>
1669 - Kaffee wird in Porzellanschalen gereicht
Versailles * Soliman Aga, der „Abgesandte des türkischen Sultans“ Mohammed IV., stattet dem Hof des französischen Königs Ludwig XIV. einen Besuch ab.
Dabei bietet er den Gästen ein exotisches Heißgetränk in Form einer Tasse Kaffee an. Das ist an und für sich noch nichts Besonderes.
Das Außergewöhnliche daran ist, dass das anregende Getränk in Porzellanschalen gereicht wird.
Der französische Hof ist von den zum Genuss verwendeten Gefäßen derart begeistert, dass in der französischen Landeszentrale eine neue Modeerscheinung - „à la turque“ - geboren wird, die von hier aus ihren Siegeszug durch ganz Westeuropa antreten soll.
1669 - Mit Hilfe von Urin den Stein der Weisen finden
xxx * Der Alchemist Hennig Brand versucht mit Hilfe von Urin den Stein der Weisen zu finden und stößt dabei auf den selbstleuchtenden Phosphor mirabilis [= wundersamer Lichtträger], der bald darauf an den Fürstenhöfen und an den Theatern für Spezialeffekte benutzt wird.
1 1669 - Die „Landstände“ treten das letzte Mal zusammen
München * Die „Landstände“, die baierische Volksvertretung mit ihren 567 Mitgliedern, treten das letzte Mal zusammen.
Sie sind eine unrepräsentative Vertretung, der nur drei „Stände“ (Adel, Kirche und Städte) angehören.
Der „Landtag“ dauert bis März.
1. 1 1669 - Die Churbaierische Seidencompagnie nimmt ihre Tätigkeit auf
München * Die Churbaierische Seidencompagnie nimmt endlich ihre Tätigkeit auf. Der in Venedig geborene und dort lebende Holländer Lucca van Uffele wird zum Fabrikdirektor erkoren. Er besitzt wertvolle Beziehungen zur venezianischen Seidenindustrie und bekommt schon deshalb den Titel eines Directore Complimentario und Scriptuali Generali übertragen.
In seinen umfangreichen Conditiones heißt es unter anderem: „Van Uffele ist schuldig, der Seidenkompagnie alle nötige Seide von auswärts zu bestellen und auf sein Risiko nach München liefern zu lassen“. Darüber hinaus wird er verpflichtet, „so oft eine gefertigte Quantität vorhanden ist, sie gegen Bargeld zu verschleißen“. Liegt der Gewinn unter acht Prozent, hat van Uffele den Schaden zu tragen. Überhaupt ist der Venezianer verpflichtet worden, die Einlagen pro Jahr mit fünf Prozent zu verzinsen.
Außerdem soll er die maestranzen [= Meister] aus Italien holen und „eine Anzahl von 2.000 Personen hierländische Arbeitsleuth unterrichten lassen“.
Ab dem 1. 1 1669 - Maulbeerplantagen in den kurfürstlichen Hofgärten
München - Au * Da es noch an ergiebigen Maulbeerplantagen mangelt, muss die Rohseide aus dem Ausland bezogen werden. Zusätzlich lässt Kurfürst Ferdinand Maria „im großen Hofgarten, im Residenzgarten, Krautgarten, Kuchlgarten zu München, in den Hofgärten zu Dachau, Berg am Laim, Bogenhausen, Schleißheim und Nymphenburg“ eine große Menge Maulbeerbäumeanpflanzen.
Den Kapitalstock für das Unternehmen liefern sowohl Privatleute als auch die frühen Sozialeinrichtungen wie das Heiliggeistspital, das Städtische Waisenhaus oder das Leprosenhaus am Gasteig.
Eine barocke Gründerzeit-Mentalität ist zu verzeichnen. In grenzenlosem Vertrauen fließt das Geld in erstaunlichen Mengen, sodass bald mehrere Tausend Gulden zur Verfügung stehen, um in Italien Seidenspinner-Eier zu bestellen. Das übrige Kapital wird in den Neubau für ein Seidenhaus in der Au investiert.
18. 1 1669 - Die spätere baierische Kurfürstin Maria Antonia wird in Wien geboren
Wien * In Wien wird die Kaisertochter und spätere baierische Kurfürstin Maria Antonia geboren.
Um den 20. 1 1669 - Lucca van Uffele wirbt in Venedig Seidenarbeiter an
München - Venedig * Lucca van Uffele reist nach Venedig, um dort Arbeitskräfte anzuwerben. Es kommt zu einem heftigen Konflikt mit dem italienischen Staat wegen „beabsichtigter Ausbeutung italienischer Fabrikgeheimnisse“, sodass Kurfürst Ferdinand Maria höchstpersönlich den Streit schlichten muss. Erst danach kann van Uffele mit einem Meister und zwei Arbeitern nach München zurückkehren.
Später kann er noch Seidenarbeiter aus Venedig zur Übersiedlung nach München überreden. Nun ist auch die Herstellung von venezianischen Gold- und Silberbrokaten möglich.
Um den 1. 2 1669 - Das Auer Seidenhaus entsteht
Au * Als Bauplatz für das Auer Seidenhaus hat Direktor van Uffele das Gelände an der Stelle der späteren Wagnerbrauerei auserkoren. Eine Abbildung des Seidenhauses ist leider nicht überliefert. Die auf dem Kupferstich von Michael Wening gezeigte Fabricca in der Au entstand zwar aus der Seidenfabrik, wurde aber erst später im großen Stil um- und neu gebaut.
21. 10 1669 - Der Kleinwirt erhält die Bewilligung zum Ausschank von Braunbier
Haidhausen * Der Kleinwirt und Mesner Georg Pockmayer von Haidhausen erhält durch Kurfürst Ferdinand Maria die Bewilligung zum Ausschank von Braunbier. Allerdings muss er seinen Gerstensaft ausschließlich von den Münchner Brauern beziehen.
1670 - Ein Charivari gegen eine gefallene stolze Jungfer
Straß bei Samerberg * 17 junge Burschen - davon mehr als die Hälfte „Knechte“ - ziehen vor das Haus einer „Kindsmutter“ und veranstalten dort „mit Pfeifen und Gloggen“ sowie sonstigen Lärminstrumenten - wie beim französischen „Charivari“ - einen „Mordspektakel“. In den Akten wird aber weder von einem „Haberfeldtreiben“, noch von einen „Charivari“ oder einer „Katzenmusik“ gesprochen.
Das „Rügeverfahren“ der jungen Burschen richtete sich nicht ausdrücklich gegen das „sexuelle Fehlverhalten“ eines Mädchens, eine sogenannte „Leichtfertigkeit“, sondern gilt einer „gefallenen stolzen Jungfer“.
Der Grund für die „Rüge“ liegt - wie auch in späteren „Haberfeldtreiben“ - im „Standesunterschied“ zwischen dem „sündigen Mann“ und dem „leichtfertigen Mädchen“, in diesem Fall zwischen einem „Bauern“ und seiner „Dirn“.
1670 - Goldrubinglas als eine Vorstufe des Steins der Weisen
xxx * Der Alchemist Johann Rudolph Glauber ist der Auffassung, dass er mit der Herstellung von Goldrubinglas eine Vorstufe des Steins der Weisen gefunden hat und preist sein Glas in zerriebener Form als Medizin an.
1670 - Ein zweites Seidenhaus am Jakobsplatz
München-Angerviertel * Vor lauter Begeisterung für die Seidenfabrikation lässt man bereits im Jahr 1670 ein zweites Seidenhaus am Jakobsplatz erstellen.
Um das Jahr 1670 - Anwerbung von Seidenarbeitern und einer Seidenmeisterin
München - Lyon * Nachdem Kurfürstin Henriette Adelaide auch eine Seidenherstellung nach französischer Art wünscht, entsendet Lucca van Uffele einen Agenten nach Lyon.
Dieser kann dreißig Seidenarbeiter anwerben, wird dann aber - wegen „befürchteter Verletzung französischer Fabrikgeheimnisse“ - mitsamt den Arbeitern verhaftet. Durch List und Bestechung gelingt ihm und sieben Arbeitern die Flucht nach München, später glückt ihm noch die Anwerbung einer berühmten Meisterin aus Lyon, zur Erzeugung von Spitzen in Seide, Silber und Gold.
17. 2 1670 - Frankreich und Baiern schließen ein geheimes Bündnis
Paris - München * Zwischen Frankreich und Baiern wird ein auf zehn Jahre befristeter geheimer Bündnisvertrag geschlossen. Kurfürst Ferdinand Maria verpflichtet sich darin, das französische Königshaus in seinen Ansprüchen auf das Spanische Erbe zu unterstützen. Dafür zahlt Frankreich unter König Ludwig XIV. 180.000 Taler und stellt jährlich 400.000 Taler in Aussicht, falls sich Baiern an Kriegshandlungen beteiligen sollte.
Ferdinand Maria gelingt es - trotz des Vertrags und gegen den Wunsch seiner Gemahlin Henriette Adelaide - im Holländischen Krieg von 1672 neutral zu bleiben. Der Vertrag beinhaltet auch die spätere Heirat der damals neunjährigen Baiern-Prinzessin Maria Anna Christina mit dem ein Jahr jüngeren französischen Kronprinzen Ludwig, Dauphin de Viennois.
Um 4 1670 - Aus Wolfgang Holzer wird Onuphrius vom heiligen Wolfgang
Meran - Trient * Wolfgang Holzer, den späteren Abt der im „Lehel“ beheimateten „Ordensgemeinschaft der Hieronymiten“, geht von seiner Einsiedelei bei Meran nach Trient, wo er bei den „Karmeliten“ das Kleid ihres Dritten Ordens und den Namen „Frater Onuphrius vom heiligen Wolfgang“ erhält.
Schon sehr früh zieht es ihn zum Leben eines Einsiedlers, zunächst in die Wälder bei Zorneding und Tegernsee, dann nach Tirol.
29. 4 1670 - Ein erneutes Gesuch um Heiligsprechung des seligen Kajetan
München - Rom • Da sich in dem nur zwei Jahre dauernden Pontifikat des Papstes Clemens IX. in der Frage der Heiligsprechung des Theatinerorden-Gründers Kajetan von Thiene noch kein Ergebnis vorliegt, richtet das baierische Kurfürstenhaus erneut ein entsprechendes Gesuch an Papst Clemens X..
2. 5 1670 - Prinz Kajetan Maria Franz wird geboren
München • Kajetan Maria Franz, Sohn des baierischen Kurfürstenpaares Henriette Adelaide und Ferdinand Maria, wird in München geboren.
13. 11 1670 - Der Haidhauser Kleinwirt erhält das Weißbierschankrecht
Haidhausen * Der Kleinwirt von Haidhausen, Georg Pockmayer, erhält nach dem Schankrecht auch die Genehmigung „zum Setzen von Gästen“ und den Weißbierausschank.
Er darf die Gäste nur bei Tag bedienen, sie jedoch nicht in der Nacht beherbergen. Außerdem ist ihm versagt Hochzeiten, Stuhlfeste und Goldene Tage abzuhalten. Eine Ausnahme von dieser Regelung gibt es allerdings dann, wenn Freunde oder Verwandte aus München diese Bitte äußern.
15. 11 1670 - Das Heiligsprechungsverfahren ist abgeschlossen
Rom - München • Der Theatinergeneral Pietro Paolo Nobilioni berichtet der baierischen Kurfürstin Henriette Adelaide: „Der Fall Ihrer so herbeigesehnten Heiligsprechung [des Mitbegründers des Theatinerordens, Kajetan von Thiene] ist abgeschlossen und Sie haben viel dazu beigetragen.“
7. 12 1670 - Prinz Kajetan Maria Franz stirbt in München
München • Kajetan Maria Franz, Sohn des baierischen Kurfürstenpaares Henriette Adelaide und Ferdinand Maria, stirbt in München im Alter von sieben Monaten.
1671 - Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld wird „Hofratspräsident“
München * Kurfürst Ferdinand Maria ernennt Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld zum „Hofratspräsidenten“.
3 1671 - Lucca van Uffele flieht nach Augsburg
München * Lucca van Uffele hat die Münchner Seidenfabriken technisch und personell bestens ausgestattet. Doch nur wenige Monate später wird ihm vorgeworfen, er betreibe „bedenkliche Speculation [...], macht Schulden auf die Compagnie, Seperatgeschäfte“ und „Prellerey“. Er sieht sich zur Flucht nach Augsburg gezwungen. Dort wird er festgenommen und anschließend „in das Chettenstibl im Münchner Falkenthurm iberpracht“, wo er fünfeinhalb Jahre in Haft sitzt.
12. 4 1671 - Papst Clemens X. spricht Kajetan von Thiene heilig
Rom • Papst Clemens X. spricht Kajetan von Thiene, den Mitbegründer des Theatiner-Ordens, heilig. Seine Reliquien werden in der Kirche von St. Paul zu Neapel aufbewahrt.
4. 8 1671 - Der Heilige Stuhl gewährt einen Vollkommenen Ablass
Rom - München • Der Heilige Stuhl gewährt aus Anlass der Heiligsprechung von Kajetan von Thiene einen Vollkommenen Ablass in den Kirchen des Theatinerordens.
7. 8 1671 - Das Heiligenfest für Kajetan von Thiene wird erstmals begangen
München • Das Heiligenfest für Kajetan von Thiene wird am Todestag des Heiligen in München erstmals begangen.
5. 12 1671 - Joseph Clemens Cajetan wird als als 7. Kind geboren
München * Joseph Clemens Cajetan, der spätere Kurfürst und Erzbischof von Köln sowie Inhaber zahlreicher anderer kirchlicher Würden, wird in München als 7. Kind von Kurfürst Ferdinand Maria und dessen Ehefrau Henriette Adelaide geboren.
1672 - Der „Alte Rathausturm“ wird renoviert und erhält einen Zwiebelturm
München-Graggenau * Der „Alte Rathausturm“ wird renoviert und mit einem Zwiebelturm abgeschlossen.
1672 - Der Brauer Philipp Hölzl übergibt seine Brauerei an seine Tochter Katharina
München-Angerviertel * Der Brauer Philipp Hölzl übergibt die spätere „Singlspielerbrauerei“ an seine Tochter Katharina.
1672 - Erhebung des „Edelsitzes Wageck“ zur „Hofmark Wageck“
Au * Anna Maria Cammerloherin erreicht die Erhebung des „Edelsitzes Wageck“ zur „Hofmark Wageck“.
Sie lässt die Mühle zu einer „zweigängigen Mahlmühle“, die später sogar zur sechsgängigen aufgestockt wird, ausbauen.
Sie fährt zur „Schranne“, kaufte Getreide und bringt das Mehl wieder in die Stadt. Diese Handlung zieht heftige Beschwerden der städtischen Müller nach sich, „weil diese Concurrenzmacherei sie [die städtischen Müller] mit Weib und Kind an den Bettelstab bringe“.
1673 - Sebastian Gaißreitter lässt am „Gaisberg“ eine Kapelle errichten
Au * Der „Prunnknecht“ Sebastian Gaißreitter lässt am „Gaisberg“, dem heutigen „Lilienberg“, eine „Capellen aufrichten und darin zu seiner privaten Andacht und zur Erwirkhung der vorbeygehenten Leuth Andacht ein Figur vom Passion Christi“ aufstellen.
1673 - Katharina Hölzl heiratet den Münchner Metzgersohn Franz Singlspieler
München-Angerviertel * Katharina Hölzl heiratet den ihrer Brauerei den Namen gebenden Münchner Metzgersohn Franz Singlspieler.
1673 - Anna Maria Cammerloherin fügt ihrem Anwesen eine „Nagelschmiede“ hinzu
Au * Anna Maria Cammerloherin fügt noch eine „Nagelschmiede“ an ihr Anwesen hinzu.
Jetzt bestreitet ihr das Handwerk der Nagelschmiede das Recht dazu und fordert die Einschränkung, dass sie wenigstens nur kleine Nägel machen darf.
14. 1 1673 - Baiern schließt einen Subsidienvertrag mit Frankreich
München - Paris * Das Kurfürstentum Baiern schließt einen Subsidienvertrag mit Frankreich.
1674 - Der „Haidhauser Friedhof“ ist überfüllt
Haidhausen * Der „Haidhauser Friedhof“ ist „so erfüllt, dass kein Platz mehr übrig vorhanden“.
1674 - Philipp Holzhauser verkauft sein Anwesen an Franz Pongraz von Leiblfing
Haidhausen * Der „geweste Churfürstliche Rechnungs-Commissarij und Preuverwalter zu München“, Philipp Holzhauser, verkauft sein gesamtes Anwesen an den „Churfürstlichen geheimen Rath, Kämmerer und Pfleger von Waldmünchen in der Oberpfalz“, Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing.
Auch der neue Haidhauser Grundbesitzer erhält vom Freisinger Kirchenoberhaupt die Genehmigung zugesprochen, dass er „in der Holzhauserischen Kapelle möge super ara mobile celebrieren lassen“.
1674 - Bischof Albrecht Sigismund lässt eine „Mariensäule“ errichten
Freising * Bischof Albrecht Sigismund lässt am Freisinger Marktplatz - nach Münchner Vorbild - eine „Mariensäule“ errichten.
1674 - Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld wird „Oberhofmeister“
München * Kurfürst Ferdinand Maria ernennt Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld zum „Oberhofmeister“.
Ab 1674 - Giovanni Antonio Viscardi arbeitet als „Palier“
Giovanni Antonio Viscardi ist für Enrico Zuccalli als „Palier“ auf verschiedenen Baustellen tätig.
9. 4 1674 - Beim nächtlichen Brand der Residenz hält man die Stadttore geschlossen
<p><strong><em>München - Au - Haidhausen</em></strong> * Beim nächtlichen Brand der Residenz hält man die Stadttore geschlossen. Zu groß erscheint den Münchnern die Gefahr, dass sich Bettler, Tagediebe und Kranke aus der Au und Haidhausen einschleichen könnten.</p>
1675 - Die Legende des Heiligen Georg wird ausführlich publiziert
München * Die Legende des Heiligen Georg wird in der „Acta Sanctorum“ ausführlich publiziert.
1675 - Der Turm der „Johannes-Baptist-Kirche“ erhält seine heutige Höhe
Haidhausen * Der Turm der Haidhauser „Sankt-Johannes-Baptist-Kirche“ erhält seine heutige Höhe und - vermutlich - die zwiebelförmige Kuppel, die Michael Wening im Jahr 1704 darstellte.
Ab 1675 - Der „Zauberer-Jackl-Prozess“ im „Fürstbistum Salzburg“
Salzburg * Im „Fürstbistum Salzburg“ wird in den Jahren von 1675 bis 1690 der „Zauberer-Jackl-Prozess“ durchgeführt.
Er betrifft vor allem umherziehende „Bettler- und Vagantenkinder“ aus der Bande des nie gefassten „Zauberer-Jackls“.
90 Prozent der hingerichteten Kinder und Jugendlichen, die überwiegend unter 21 Jahre alt sind - das jüngste ist 11Jahre - sind männlich und stammen fast durchweg aus den „unteren sozialen Schichten“.
Auf Unterstützung aus der bäuerlichen Bevölkerung können sie nicht hoffen, im Gegenteil:
Die „vagierenden Bettlergruppen“ sind verhasst, weil man ihnen unterstellt, sie würden „schlechtes Wetter, Missernten und Hungersnöte“ herbeizaubern können.
1675 - Giovanni Antonio Viscardi wird Hofmaurermeister
München * Giovanni Antonio Viscardi übernimmt die Stelle eines Hofmaurermeister.
8. 5 1675 - Vorbereitung zur Weihe der Theatinerkirche
Freising • Mit dem Freisinger Bischof Albrecht Sigismund werden die Details zur Weihe der Theatinerkirche abgesprochen.
11. 7 1675 - Die Theatinerkirche wird feierlich eingeweiht
München-Kreuzviertel • Die Theatinerkirche wird feierlich eingeweiht. Die Aufgabe übernimmt der Freisinger Weihbischof Johann Kaspar Kühner, weil der Fürstbischof Albrecht Sigismund kurzfristig erkrankt ist.
Ab dem 12. 7 1675 - Die Seitenaltäre der Theatinerkirche werden eingeweiht
München-Kreuzviertel • Zwischen dem 12. und dem 18. Juli 1675 werden die Seitenaltäre der Theatinerkirche eingeweiht.
2. 8 1675 - Der Bau des Westflügels des Theatinerklosters beginnt
München-Kreuzviertel * Der Bau des Westtrakts des Theatinerklosters wird auf dem Gelände des ehemaligen Falkenhofs begonnen.
20. 8 1675 - Die Särge der Theatiner kommen in die neue Gruft
München-Kreuzviertel * Die sterblichen Überreste der bis dahin in der Kapelle des Palazzo Kurz in der Vorderen Schwabinger Gasse beigesetzen Theatinerpatres werden in die Theatinerkirche überführt.
1676 - Der Prozess gegen Lucca van Uffele wird neu aufgerollt
München * Erst nach einer umfangreichen Bittschrift von Lucca van Uffele an den Kurfürsten Ferdinand Maria wird der Prozess gegen ihn erneut aufgerollt und die Vorwürfe gegen den Seidencompagnie-Direktor noch einmal eingehend verhandelt.
4. 3 1676 - Die spätere baierische Kurfürstin Therese Kunigunde wird geboren
Warschau * Die polnische Königstochter und spätere baierische Kurfürstin Therese Kunigunde wird in Warschau geboren.
18. 3 1676 - Kurfürstin Henriette Adelaide stirbt in München
<p><strong><em>München-Graggenau - München-Kreuzviertel</em></strong> * Die 39-jährige Kurfürstin Henriette Adelaide stirbt in München. Sie wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche beigesetzt. </p>
12. 4 1676 - Die vier Bauernhöfe von Haidhausen
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Nach einem Bericht des Gerichts ob der Au negst München besteht Haidhausen aus zwei der Stadtkammer München gehörenden halben Höfen zum <em>„Gronimus“</em> und zum <em>„Lenzbauern“</em>, und einem weiteren halben Hof, dem <em>„Kotterhof“</em>, der dem Leprosenhaus am Gasteig gehört.</p> <p>Zu den drei Höfen in Pächterhand kommt noch der Dreiviertelhof der dem Hansen Rattenhueber <em>„ganz freyledig aigen angehörig“</em> ist und <em>„Zum Zeugner“</em> heißt.</p>
7 1676 - Der Bau des Theatinerkloster-Nordbaus wird begonnen
München-Kreuzviertel * Mit dem Bau des Nordtrakts des Theatinerklosters, der die Bibliothek und den Kapitelsaal enthält, wird begonnen.
10 1676 - Lucca van Uffele wird als „Unschuldig“ freigesprochen
München * Lucca van Uffele wird als „Unschuldig“ freigesprochen und in die Freiheit entlassen.
Das Gericht stellt in seiner Urteilsbegründung allerdings fest, dass das Seidenunternehmen schon deshalb scheitern musste, da von der Unternehmensleitung zu viel Kapital in zu große und unnötige Gebäude investiert worden seien. Damit fehlte das Geld für die laufenden Kosten der Seidenfabrikation. Nachdem die Manufaktur nicht mit dem erwarteten Gewinn arbeitet, fordern die Geldgeber ihre Kapitaleinlagen zurück. Auch vom kurfürstlichen Hof können keine Investitionen mehr erwartet werden, da kurz zuvor ein Brand Teile der Residenz zerstört hatte. Damit ist das vorläufige Ende der Churfürstlichen Seidencompagnie - nach nur elf Jahren - gekommen.
Die Auer Seidenfabrik ist noch bis anno 1680, die am Jakobsplatz bis 1705 betriebsbereit.
1677 - Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld wird „Wirklicher Geheimer Rat“
München * Kurfürst Ferdinand Maria ernennt Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld zum „Wirklichen Geheimen Rat“.
1677 - Caspar von Schmid wird baierischer „Kanzler“
München * Caspar von Schmid wird baierischer „Kanzler“.
1677 - Giovanni Antonio Viscardi lässt sich in München nieder
München * Der Graubündner Giovanni Antonio Viscardi siedelt auf Empfehlung des Kurfürsten Ferdinand Maria mit der Familie nach München über.
19. 8 1677 - Die ersten Novizen beziehen das Theatinerkloster
München-Kreuzviertel * Die ersten Theatinernovizen können in das Obergeschoss des Westflügels des Klosters ziehen.
1678 - Maximilian II. Johann Franz von Preysingerwirbt ein Anwesen in Haidhausen
Haidhausen * Reichsgraf Maximilian II. Johann Franz von Preysing-Hohenaschau erwirbt das Anwesen des späteren „Preysing-Schlosses“ in Haidhausen und erweitert es 1690 durch weitere Zukäufe.
1678 - Die „Altöttinger-Kapelle“ am Gasteig wird erbaut
Haidhausen * Die „Loretto-Kapelle“ oder später „Altöttinger-Kapelle“ am Gasteig wird aus Mitteln des verstorbenen „Verwalters des Leprosenhauses“, Schauermayr, erbaut.
Das winzige Kircherl reicht gerade bis zur heutigen ersten Bankreihe.
1678 - Kurfürst Ferdinand Maria von Baiern verlangt Zusagen für seinen Sohn
München - Freising - Regensburg • Kurfürst Ferdinand Maria von Baiern verlangt von Herzog Albrecht Sigismund, Fürstbischof von Freising und Regensburg, die schriftliche Zusage, dass der Baiernprinz Joseph Clemens allen anderen Bewerbern als Koadjutor [= Nachfolger] auf den Bischofsstühlen in Freising und Regensburg vorgezogen wird.
2. 2 1678 - Frater Onuphrius vom heiligen Wolfgang erhält die Priesterweihe
Meran * Der Bischof von Brixen erteilt Frater Onuphrius vom heiligen Wolfgang in seiner Klause nahe Meran seine Priesterweihe. In der Folge kommt Bruder Onuphrius auf Reisen nach Wien und München mit höchsten Adelskreisen in Verbindung. Sie fördern das Eremitenleben als romantisierende religiöse Modeerscheinung.
Der Eremit gewinnt unter anderem die tatkräftige Unterstützung der Kurfürstin Maria Antonia, die Onuphrius die Wahl einer geeigneten Niederlassung in Baiern anbietet.
17. 6 1678 - Fürstbischof Albrecht Sigismund kauft die Hofmark Berg am Laim
Berg am Laim • Der Freisinger Fürstbischof Albrecht Sigismund, aus der wittelsbachischen Linie der Leuchtenberger, kauft um 29.300 Gulden vom Reichsfreiherrn Georg Konrad von Lerchenfeld die Hofmark Berg am Laim. Mit dem Besitzerwechsel unterstehen nun auch die Berg am Laimer Dorfbewohner einer geistlichen Grundherrschaft. Sie teilen damit das Schicksal der Hälfte der baierischen Untertanen nach dem Dreißigjährigen Krieg.
Der Freisinger Bischof lässt das Lerchenfeld‘sche Schlössl in ein repräsentatives Gebäude umgestalten. Dazu wird es um ein Stockwerk erhöht, mit einem Walmdach eingedeckt und an jeder Ecke mit einem Zwiebelturm ausgestattet.
26. 7 1678 - Joseph I., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Joseph I., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren.
Um 1679 - Die Paulaner erwerben eine Scheune zur Einlagerung des Bieres
Obergiesing * Zur Einlagerung ihres Märzenbieres erwerben eine Scheune, die Teil des „Lambacher-Bauernhofs“ in Obergiesing war und zur „Salvator-Stiftung“ gehört.
Ab 1679 - In der Au entsteht eine „Tuchfabrik für Militäruniformen“
Au * In der Au entsteht - am Standort des „Seidenhauses“ - eine „Tuchfabrik für Militäruniformen“.
1679 - Das „Militärbudget“ im Kurfürstentum Baiern liegt bei 440.000 Gulden
München * Das „Militärbudget“ im Kurfürstentum Baiern liegt seit Jahren konstant bei 440.000 Gulden.
1679 - Der „Bozener Markt“ wird wieder nach Bozen zurückverlegt
Mittenwald - Bozen * Der „Bozener Markt“ wird von Mittenwald wieder nach Bozen zurückverlegt.
26. 1 1679 - Attentat auf Kanzler Caspar von Schmid
München-Kreuzviertel * Auf den baierischen Kanzler Caspar von Schmid wird im Jesuiten-Colleg ein Attentat verübt. Er kommt mit einer tiefen Fleischwunde glimpflich davon. Der unter Wahnvorstellungen leidende Attentäter wird für den Rest seines Lebens weggesperrt.
26. 5 1679 - Kurfürst Ferdinand Maria stirbt in Schleißheim
Schleißheim • Kurfürst Ferdinand Maria stirbt in Schloss Schleißheim im Alter von 42 Jahren. Er wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche - neben seiner Ehefrau Henriette Adelaide - beigesetzt.
Sein Nachfolger auf dem Thron wird sein erstgeborener Sohn Max Emanuel, der aber aufgrund seiner noch nicht erreichten Volljährigkeit noch bis zu seinem 18. Geburtstag [11. Juli 1680] von seinem Onkel Maximilian Philipp Hieronymus bevormundet wird.
24. 8 1679 - Westflügel des Theatinerkloster fertiggestellt
München-Kreuzviertel * Der Westflügel des Theatinerkloster ist nun gänzlich vollendet.
Um 10 1679 - Maximilian Ferdinand von Törring-Seefeld in der „Geheimen Konferenz“
München * Ferdinand Graf von Törring-Seefeld wird in die „Geheime Konferenz“ berufen.
Von diesem Gremium lässt sich zunächst der Vormund des noch nicht volljährigen Kurprinzen Max Emanuel, Herzog Maximilian Philipp, beraten.
Ab etwa 1680 - Das „Wöhrl oberhalb der Isarbrücke“ wird befestigt
München-Lehel * Das „Wöhrl oberhalb der Isarbrücke“ wird mit Bauschutt aufgefüllt, vergrößert und befestigt.
1680 - Ein „Narrenhäusl“ zur Bestrafung von „Prostituierten“
München * Zur Bestrafung von „Prostituierten“ verwendet man ein so genanntes „Narrenhäusl“.
Es handelte sich dabei um einen Käfig „mit weiblichen Inhalt“, der auf einer Drehscheibe befestigt ist.
„Auf der Straße offen aufgestellt, findet sich immer Gesindel, das heftig dreht und spuckt und gar Kot auf die Weibsperson wirft“.
1680 - Graf Maximilian Ferdinand von Törring-Seefeld wird „Oberstkämmerer“
München * Graf Maximilian Ferdinand von Törring-Seefeld gehört zu den engsten Vertrauten des jungen Kurfürsten Max Emanuels.
Der Baiernherrscher ernennt den Grafen gleich nach seinem Amtsantritt zum „Oberstkämmerer“.
1680 - Goldrubinglas wird als Luxusartikel verkauft
xxx * Der Alchemist Johannes Kunckel, der aus einer Glasmacher-Familie stammt, war als Goldmacher im Dienste eines Fürsten gescheitert, erfindet aber im Jahr 1680 Goldrubinglas in der Masse gleichmäßig rot zu färben und daraus Gefäße in größeren Dimensionen herzustellen. Die Gläser werden in der Folge zum begehrten Luxusartikel.
16. 1 1680 - Baierisch-französische Heiratsverhandlungen
Versailles - München * Herzog von Croque wirbt als außerordentlicher Botschafter König Ludwigs XIV. von Frankreich in München um die Hand der Prinzessin Maria Anna Christina für den französischen Thronfolger Ludwig, Dauphin de Viennois.
28. 1 1680 - Prokuravermählung der baierischen Prinzessin Maria Anna Christina
München-Graggenau * Prokuravermählung der baierischen Prinzessin Maria Anna Christina mit dem französischen Thronfolger Ludwig, Dauphin de Viennois, im Herkules-Saal der Residenz. Begleitet von ihrem Bruder Max Emanuel, als Vertreter des französischen Kronprinzen Louis, betritt die Prinzessin den festlich geschmückten Saal.
Nach der Vermählung ertönt das Te Deum, während draußen 50 Böllerschüsse abgefeuert werden. Danach erhellt ein prächtiges Brillantfeuerwerk den nächtlichen Himmel über München. Glanzvolle Opernaufführungen und Hofbälle begleiten dieses kurbaierische Freudenfest.
5. 2 1680 - Prinzessin Maria Anna Christina Victorie verlässt München
München - Versailles * Prinzessin Maria Anna Christina Victorie verlässt mit zwölf Karossen unter festlichen Glockengeläute die kurfürstliche Haupt- und Residenzstadt München in Richtung Versailles.
7. 3 1680 - Maria Anna Christina Victorie heiratet Ludwig, Dauphin de Viennois
Châlons-sur-Marne * Die baierische Prinzessin Maria Anna Christina Victorie, Tochter des Kurfürstenpaares Ferdinand Maria und Henriette Adelaide, heiratet in Châlons-sur-Marne ihren Cousin 2. Grades, den französischen Thronfolger Ludwig, Dauphin de Viennois.
11. 7 1680 - Max Emanuel übernimmt die Regentschaft und die Regierungsgeschäfte
München * An seinem 18. Geburtstag übernimmt Max Emanuel die Regentschaft und die Regierungsgeschäfte im Kurfürstentum Baiern.
1681 - Ein Fest zu Ehren des jungen baierischen Kurfürsten Max Emanuel
Freising * Albrecht Sigismund, der Freisings Bischof und „Hofmarkherr“ von Berg am Laim, lässt in Freising zu Ehren des jungen baierischen Kurfürsten Max Emanuel eine Feierlichkeit mit „Feuerwerk, Wolfshatz, Komödie und Ball“ veranstalten.
Die Feier verschlingt 30.000 Gulden.
Das ist mehr als die „Hofmark Berg am Laim“ gekostet hat.
1. 2 1681 - Geplante Altötting-Wallfahrt mit kleinem Hofstaat
Wien - München * In einem Brief teilt Kaiser Leopold I. dem baierischen Kurfürsten mit, dass er „mit kleinem Hofstaat“ die Wallfahrt nach Altötting unternehmen wird und bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, den Kurfürsten am Ziel treffen zu können
„Kleiner Hofstaat“ bedeutete 455 Personen, 297 Pferde, 16 Kutschen und 16 Maultiere. Im kaiserlichen Gefolge befinden sich unter anderem 15 Köche und zusätzlich zwei extra für die Kaiserin, dazu ein Küchentürhüter und der Kammerzwerg, der Hofnarr. Im Hofstaat der Kaiserin ist neben den Hofdamen, Garderobendamen, Kammerzofen und sonstigem, meist weiblichen Personal, auch ein „Extraweib“ aufgeführt. Ihre Funktion ist ungeklärt.
13. 2 1681 - Max Emanuel geht auf Brautschau nach Eisenach
<p><strong><em>Eisenach</em></strong> * Max Emanuel bricht - inkognito - zur Brautschau nach Eisenach auf, wo er sich für die protestantische Prinzessin Eleonore Erdmute von Sachsen-Eisenach interessiert.</p>
5. 3 1681 - Der kaiserliche Tross trifft in Altötting ein
Burghausen - Altötting * Der kaiserliche Tross überschreitet die österreichisch-baierische Grenze. Über Burghausen geht es nach Altötting, wo das Kaiserpaar von einer Prozession des gesamten örtlichen Klerus empfangen und unter Glockengeläut zur Heiligen Kapelle geführt wird.
6. 3 1681 - Kurfürst Max Emanuel trifft in Altötting ein
Altötting * Der baierische Kurfürst Max Emanuel trifft gemeinsam mit seinem Onkel Maximilian Philipp und dessen Ehefrau Maurita Febronia in Altötting ein.
Die Etikette hätte eigentlich verlangt, dass der Kurfürst den Kaiser persönlich empfängt. Doch für den dann zu erwartenden „Empfang mit großem Zeremoniell“ wäre in Altötting nicht ausreichend Platz vorhanden gewesen. So lautet jedenfalls die offizielle Begründung.
10. 3 1681 - Bündnisverhandlungen am Wallfahrtsort
<p><em><strong>Altötting</strong></em> * Es kommt zu einem Gespräch zwischen dem Kaiserpaar und den drei Wittelsbachern. Zum Abschied übergibt Leopold I. dem Kurfürsten Max Emanuel einen mit Diamanten besetzten Degen. Nach einem gemeinsamen Besuch der heiligen Messe in der Gnadenkapelle nimmt man auf dem Kapellplatz öffentlich voneinander Abschied.</p> <p>Die vielen Freundlichkeiten, die Leopold I. dem Kurfürsten erwiesen hat, verfehlen nicht den Zweck, für den sie berechnet waren: Max Emanuel lässt sich politisch auf die Seite Habsburgs ziehen, weg von Frankreich. </p>
1682 - Johann Ignaz Ridler baut ein Schloss südlich des „Preysing-Schlosses“
Haidhausen * Der „Landschaftszinsmeister“ Johann Ignaz Ridler von Johanneskirchen erwirbt das Gut südlich des „Preysing-Schlosses“ in Haidhausen und erbaut ein Schlösschen mit vier flankierenden spitzen Ecktürmen, das im Volksmund den Namen „Ridlerschlössl“ erhält.
1682 - Sebastian Gaißreitter erwirbt am „Gaisberg“ ein kleines Stück Land
Au * Sebastian Gaißreitter erwirbt am „Gaisberg“ neben seiner winzigen, höchstens drei bis vier Betern Platz bietenden und auffällig rot angemalten Kapelle ein kleines Stück Land in dem er einen Garten anlegt und das Ganze umzäunt.
1682 - Der Staat kauft einen großen Platz von „Wageck“ für einen Fabrikbau
Au * Nach dem Tod der aktiven Freiin von Cammerloher geht das Geschäft stark zurück, mit der Mühle ging’s abwärts.
Zum Glück kauft der Staat im Jahr 1682 einen großen Platz von „Wageck“ für den Fabrikbau des „Wollwerck-Hauß“ an.
1682 - Der „Franziskanerfriedhof“ fasst 451 Grabstellen
München-Graggenau * Nach einem „Friedhofsplan“ fasst der „Franziskanerfriedhof“ 451 Grabstellen.
1682 - Der elfjährige Joseph Clemens soll zum „Koadjutor“ gewählt werden
Freising - Regensburg * Der zwanzigjährige baierische Kurfürst Max Emanuel fordert von den „Domkapiteln“ in Freising und Regensburg die vier Jahre zuvor gegebene Zusage ein, dass sein elfjähriger Bruder Joseph Clemens als „Koadjutor“ (= Nachfolger) von Bischof Albrecht Sigismund gewählt wird.
15. 1 1682 - Bündnisverhandlungen wegen der Türkengefahr
München - Wien * Kurfürst Max Emanuel erklärt dem kaiserlichen Gesandten in München seine Bereitschaft zu Bündnisverhandlungen. Nicht verkennen darf man dabei freilich, dass dies auch im elementaren Interesse Baierns war, schließlich trennten nur die Länder des Hauses Habsburg damals das kleine Kurfürstentum vom Machtbereich der gefürchteten Türken.
4. 6 1682 - Kurfürst Max Emanuel lässt ein kurfürstliches Zuchthaus bauen
München-Angerviertel * Kurfürst Max Emanuel lässt ein kurfürstliches Zuchthaus bauen. In ihm sollen „übermütige Herrendiener, schlechte Ehehalten [Dienstboten], liederliche Handwerksburschen, ungeratene Kinder, freche Menscher [Mägde], langsame Zimmer- und Maurergesellen, faule Tagwerker und Müßiggänger untergebracht werden, nach Umständen in Eisen und Band, bei geringer Nahrung und Karbatschenhieben“.
Das Korrektions- und Arbeitshaus befindet sich an der Stadtmauer und nimmt die ganze Südseite des heutigen Viktualienmarktes ein.
1683 - Im „Brunnthal“ entsteht ein „Militärwaisenhaus und Militärlazarett“
Bogenhausen * Im „Brunnthal“ in Bogenhausen entsteht ein „Militärwaisenhaus und Militärlazarett“.
1683 - Die Militärausgaben steigen dramatisch an
München * Nach dem Regierungsantritt des Kurfürsten Max Emanuel erhöhen sich die Kosten für das Militär von 440.000 Gulden im Jahr 1679 innerhalb von nur vier Jahren auf 1.848.000 Gulden.
1683 - Kölns Kurfürst Maximilian Heinrich wird Landesherr von Münster
Münster * Der Kölner Kurfürst Maximilian Heinrich, Herr über die drei Bistümer Köln, Lüttich und Hildesheim, wird mit Hilfe hoher Bestechungsgelder noch zum Bischof von Münster gewählt.
Doch Papst Innozenz XI. erkennt die Wahl aufgrund der Vorfälle nicht an, sodass Maximilian nur Landesherr, nicht aber Bischof ist.
1683 - Der „Geigenbau“ kommt nach Mittenwald
Mittenwald * Matthias Klotz führt in Mittenwald den „Geigenbau“ ein.
1683 - Die ersten Wiener „Kaffeeschenken“ werden eröffnet
Wien * Gleich nach der Befreiung von der türkischen Belagerung eröffnen in Wien die ersten „Kaffeeschenken“.
26. 1 1683 - Ein österreichisch-baierisches Bündnis gegen die Osmanen
München - Wien * Dem Treffen von Altötting vom März 1681 folgen langwierige Verhandlungen zwischen den kaiserlichen und den baierischen Abgesandten, die letztlich in einem Defensivbündnis enden, in dem sich das Kurfürstentum Baiern verpflichtet, in den bevorstehenden Auseinandersetzungen mit den Osmanen ein Truppenkontingent von 8.000 Mann zu stellen.
Baiern kann die Zusage aushandeln, dass das Land jährlich Subsidienzahlungen in Höhe von 250.000 Gulden, im Kriegsfall von 450.000 Gulden, erhält.
Da jedoch vorhersehbar ist, dass Wien - in Anbetracht der politischen Lage, der sonstigen Verpflichtungen und der verstärkten Kriegsanstrengungen gegen die Osmanen - diese Summe nie aufbringen kann, verlangen die kurfürstlichen Verhandlungsführer Sicherheiten. Das waren die Einkünfte der Grafschaft Neuburg am Inn, der Markgrafschaft Burgau und des Mautamtes Tarvis. Das Ziel ist eine spätere Gebietserweiterung um die Ämter Kufstein und Rattenberg.
Der Bündnisvertrag bedeutet jedoch keinesfalls die völlige Abkehr von Frankreich. Zwar werden sich die politischen Beziehungen zwischen München und Paris ein wenig abkühlen, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Beziehungen wurden jedoch kaum beeinträchtigt.
10. 3 1683 - Das Regensburger Domkapitel wählt den 12-jährigen Joseph Clemens
Regensburg • Das Regensburger Domkapitel wählt den zwölfjährigen Joseph Clemens einstimmig zum Koadjutor [= Nachfolger] von Albrecht Sigismund auf dem Regensburger Bischofsstuhl.
Jeder Domkapitular erhält dafür 600, der Domdechant 800 und der Domprobst 1.000 Gulden, insgesamt 10.500 Gulden.
31. 3 1683 - Die türkische Armee sammelt sich bei Adrianopel
<p><em><strong>Edirne</strong></em> * Die Osmanische Armee sammelt sich bei Adrianopel [= heute: Edirne] mit 168.000 Mann und 300 Geschützen. Es ist das größte Heer, das die Türken jemals aufgestellt haben. Der baierisch-österreichische Vertrag vom 26. Januar 1683 war damit - wenn auch nach langen und zähen Verhandlungen - gerade noch rechtzeitig zustande gekommen. </p>
31. 3 1683 - Ein breites Devensivbündnis gegen die Osmanen
<p><em><strong>Rom - Wien - Warschau</strong></em> * Der päpstlichen Diplomatie gelingt es Ende März 1683, Kaiser Leopold I. und den polnischen König Johann III. Sobieski zum Abschluss eines Defensivbündnisses gegen die Osmanen zu bringen. Auch Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen erklären sich zum Beistand des Kaisers bereit. </p> <p>Papst Innozenz XI. unterstützt die christlichen Herrscher in ihrem Kampf gegen die vorrückenden Türken mit 1,5 Millionen Gulden - und seinem Segen. Er selbst sieht sich als <em>„Streiter für die Reinhaltung des katholischen Glaubens“</em>. Schon deshalb bemüht er sich während seines ganzen Pontifikates, die Fürsten zu einer <em>„Heiligen Liga“</em> zum <em>„Kampf und zur Abwehr der Osmanen“</em> zu gewinnen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche bittet mit einem päpstlichen Aufruf die Gottesmutter unter der Parole <em>„Maria hilf!“</em> um ihre Unterstützung. </p>
3. 5 1683 - Großwesir Kara Mustafa vor Belgrad
Belgrad * Großwesir Kara Mustapha stößt an der Spitze seines fast 250.000 Mann starken osmanischen Heeres bis Belgrad vor.
Er will über das seit Jahren zwischen Türken und Habsburgern umstrittene Ungarn in die österreichischen Erblande eindringen.
13. 6 1683 - Die Osmanen überschreiten die Brücke bei Esseg
Esseg * Die Osmanen überschreiten die Brücke bei Esseg.
1. 7 1683 - Die osmanische Armee trifft in Raab ein
Raab * Die osmanische Armee trifft in Raab ein.
4. 7 1683 - Die Osmanen stehen an der österreichischen Grenze
Österreich * Die Osmanen stehen an der österreichischen Grenze.
Um den 5. 7 1683 - Eine erste osmanische Vorhut vor Wien
Wien * Die erste Vorhut des osmanischen Heeres taucht vor Wien auf. Großes Kopfzerbrechen bereitet den Bewohnern Wiens das Verhalten des Kaisers, der sich auch weiterhin seinem Jagdvergnügen widmet und die Türkengefahr scheinbar ignoriert. Will er lediglich verharmlosen oder zeigen, dass die Angst vor der Gefahr übertrieben ist? Doch je näher die Hauptstreitmacht des türkischen Heeres auf die kaiserlichen Hauptstadt zukommt, desto mehr wächst auch bei Kaiser Leopold I. die Angst.
7. 7 1683 - Die Kaiserfamilie verlässt Wien fluchtartig
Wien - Krems - Melk - Linz - Passau * Kaiser Leopold verlässt fluchtartig - gemeinsam mit seiner Gemahlin Eleonore von Pfalz-Neuburg - seine Residenzstadt. 69 Kaleschen [= vierrädrige leichte Kutschen] und 32 schwere Wagen für den Kaiser und 33 Kaleschen, 22 schwere Wagen und 203 leichte Wagen für die Prinzessinnen und Prinzen verlassen samt dem Hofstaat die vor der Belagerung stehende Stadt.
Die Flucht führte zunächst nach Krems und von dort über Melk und Linz per Schiff nach Passau.
14. 7 1683 - Beginn der Belagerung Wiens durch die Türken
Wien * Die Belagerung Wiens durch die Türken beginnt. Die Stadt ist von allen Seiten eingeschlossen.
16. 7 1683 - Die Lebensbedingungen verschlechtern sich täglich
Wien * Die Türken haben die Kaiserstadt Wien vollkommen eingeschlossen. Die Lebensbedingungen für die Belagerten verschlechtern sich von Tag zu Tag.
- Die Vorräte werden knapp,
- es mangelt an Frischwasser,
- in den Straßen häuft sich der Unrat und
- eine Ruhrepidemie dezimiert die Einwohner und die Verteidiger der Stadt.
23. 7 1683 - Die Türken bestürmen das erste Mal die Stadt Wien
Wien * Die Osmanen bestürmen das erste Mal die Stadt Wien, um danach in rascher Abfolge immer heftiger anzugreifen.
Die Kaiserstadt ist von allen Seiten eingeschlossen, sodass der Befehlshaber der Kaiserlichen Truppen, Herzog Carl von Lothringen, angesichts der türkischen Übermacht, mit seinem 33.000 Männer umfassenden Heer den Rückzug antreten muss. Er bezieht jenseits des Wiener Waldes Stellung. Das Abendland steht dadurch vor der Gefahr, von dem Türkenheer überrannt zu werden.
27. 8 1683 - Belagerung und Übergabe der Festung Gran
Gran * Belagerung und Übergabe der Festung Gran an das Osmanische Heer.
31. 8 1683 - König Johann III. Sobieski trifft auf dem Tullner Feld ein
Wien * König Johann III. Sobieski trifft mit 13.000 Polen auf dem Tullner Feld bei Wien ein.
Um den 1. 9 1683 - Baierische Soldaten machen der Landbevölkerung Angst
Österreich - Tulln * Die baierischen Truppen haben sich auf den Weg nach Wien gemacht. Die bunt zusammengewürfelte Soldateska verübt beträchtliche Exzesse. Haben die Wiener angesichts der Belagerung ihrer Stadt berechtigte Angst vor den Türken, so fürchtet sich die Landbevölkerung mehr vor den durchziehenden befreundeten Soldaten, die sich nehmen, was sie begehren. Und wer den Forderungen der baierischen Soldaten nicht freiwillig nachkommt, der wird mit Schlägen dazu gebracht. Die harte Behandlung der durchziehenden Soldaten und die zusätzliche Belastung der Bevölkerung führen zwar zu Protesten, die jedoch vergeblich sind.
Bis Anfang September sammeln sich die Verteidigungstruppen im Tullner Becken, etwa 25 Kilometer von Wien entfernt.
3. 9 1683 - Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen trifft auf dem Tullner Feld ein
Wien * Kurfürst Johann Georg III. trifft mit 10.000 Sachsen auf dem Tullner Feld bei Wien ein.
7. 9 1683 - Kurfürst Max Emanuel kommt mit dem Schiff in Linz an
Linz * Kurfürst Max Emanuel kommt mit dem Schiff in Linz an. Kaiser Leopold I. empfängt ihn persönlich am Ufer und führt ihn zum Schloss, wo die Kaiserin ihren Gatten „mit einer Prinzessin erfreut“ hat. Das Mädchen wird noch am Nachmittag getauft. Kurfürst Max Emanuel fungiert als Taufpate, bevor er am Abend nach Wien weiter reist.
8. 9 1683 - Kurfürst Max Emanuel trifft auf dem Tullner Feld bei Wien ein
Wien * Der 21-jährige baierische Kurfürst Max Emanuel trifft an der Spitze von 11.300 Baiern auf dem Tullner Feld bei Wien ein.
12. 9 1683 - Mit „Maria hilf!“ in die Schlacht gegen die Türken
Wien * Ein knapp 67.000 Mann starkes Christenheer zieht in den entscheidenden Kampf gegen die Osmanen und befreien Wien von den als Reichsfeinden bezeichneten Türken. Dann tobt vor den Toren der belagerten und inzwischen höchst bedrohten Stadt Wien die Schlacht zwischen den Osmanen und den mit Habsburg Verbündeten Baiern, Polen und Sachsen. Die christlichen Befehlshaber haben am Vortag ihre Untergebenen eingeschworen, „mit gesamter Hand und Macht auf die gottesunwürdigen Bösewichter loszugehen“. Der Kapuzinerpater Marco d’Aviano fordert im Anschluss die christlichen Soldaten auf, mit dem Ruf „Maria hilf!“ in die Schlacht zu ziehen.
Der Oberbefehl des etwa 67.000 Mann starken Entsatzheeres liegt in den Händen des Polenkönigs Johann III. Sobieski. Den Angriff leitet Herzog Cal von Lothringen. Baierns 21-jähriger Kurfürst Max Emanuel befehligt das Zentrum, dem zusammen mit dem linken Flügel unter Herzog Carl von Lothringen der entscheidende Durchbruch gelingt. Das Entsatzheer kann die Türken vernichtend schlagen. Die geschlagenen Osmanen müssen fliehen. Kurfürst Max Emanuel hat sich seine ersten militärischen Sporen verdient und kann sich vor den Augen Europas als Kriegsheld präsentieren.
Die Sieger dringen in das riesige Zeltlager der Osmanen ein und bemächtigen sich der gewaltig großen Beute. Darunter befinden sich unter anderem auch viele Säcke gefüllt mit Kaffee, die die heutige Wiener Kaffeehaus-Tradition begründen. Doch vor lauter Plündern vergessen die Befreier die Fliehenden zu verfolgen. Und während die christlichen Fürsten ihren Sieg feiern, bleibt den Türken noch genügend Zeit über 83.000 Menschen in die Sklaverei zu verschleppen. Es sind 8.000 Männer, 25.000 Frauen und 50.000 Kinder aus Niederösterreich und der Steiermark.
25. 9 1683 - Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld stirbt in Wien
Wien * Maximilian Ferdinand Graf von Törring-Seefeld stirbt in Wien.
23. 11 1683 - Das Haidhauser Schloss kommt zu ersten Würden
Haidhausen * Zu ersten Würden kommt das von Freiherr Franz Pongraz von Leiblfing errichtete Haidhauser Schloss, nachdem Kurfürst Max Emanuel als Türkenbefreier aus Wien zurückkehrt. Adelige, Hofbedienstete und einflussreiche Münchner Bürger haben sich auf dem Anger vor dem Landgut - auf dem heutigen Johannisplatz - versammelt, um ihrem Helden einen feierlichen Empfang zu bereiten. Leiblfing darf den Kurfürsten in seinem prächtig geschmücktem Schlösschen noch bewirteten, bevor sich der Triumphzug - zur weiteren Huldigung - in Richtung München in Bewegung setzt.
Der Freiherr versteht es natürlich, aus diesem Umstand seinen Nutzen zu ziehen. Da „sein armes Haus und Garten“ so glücklich gewesen sei, den Kurfürsten bei seiner Rückkehr „so freundlich und frohlockend zu empfangen“, wendet sich Franz Pongraz von Leiblfing an den Landesherrn, damit der dieses zum adeligen Sitz erheben und ihm die dem Hofkastenamt zinsbaren 44 Untertanen in der Schwaig mitsamt der Jurisdiktion abtreten soll. Die dort zinspflichtigen Haus- und Herbergenbesitzer haben jährlich 11 Gulden und 32 Kreuzer zu versteuern.
Mit der Bitte des Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing ist jedoch die Abtrennung der Schwaige von Haidhausen und damit vom Bezirk des Gerichts ob der Au verbunden. Dies führt zwangsläufig zu verwaltungstechnischen Problemen, da der Gerichtsbezirk erst im Mai 1610 aufgrund seiner besonderen Sozialstruktur geschaffen worden ist.
1684 - Die Behausung des Haidhauser „Ziegelmeisters“
Haidhausen * Die Behausung des Haidhauser „Ziegelmeisters“ befindet sich am Ende des Dorfes, an der Straße, „wo man nach Loretto geht“.
1684 - Gräfin Maria Claudia von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn stirbt
Schloss Mickhausen ? * Gräfin Maria Claudia, die Ehefrau von Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn stirbt.
Aus dieser 18 Jahre andauernden Ehe sind elf Kinder hervorgegangen.
5. 3 1684 - Gründung einer Heiligen Liga zum Kampf und zur Abwehr der Osmanen
Rom * Mit Unterstützung von Papst Innozenz XI., der sich selbst als „Streiter für die Reinhaltung des katholischen Glaubens“ sieht, gelingt die Gründung einer Heiligen Liga zum „Kampf und zur Abwehr der Osmanen“. König Johann III. Sobieski von Polen, Kaiser Leopold I. und die Republik Venedig schließen dazu ein Bündnis, dem zwei Jahre später auch Russland beitreten wird.
Durch die Heilige Liga fließen umfangreichere Subsidien, sodass die baierische Armee auf eine Sollstärke von 18.000 Mann erhöht werden kann.
16. 6 1684 - Die Stadt Gran wird von den Kaiserlichen erobert
Gran * Durch die türkische Niederlage in der Schlacht am Kahlenberg am 12. September 1683 sieht Kaiser Leopold I. die Chance zum Gegenschlag gekommen. Am 16. Juni 1684 wird die Stadt Gran von den Kaiserlichen erobert.
27. 6 1684 - Den kaiserlichen Truppen fällt Waitzen/Vác in die Hände
Waitzen/Vác * Den kaiserlichen Truppen fällt Waitzen/Vác in die Hände.
30. 6 1684 - Die kaiserliche Hauptarmee rückt in die Stadt Pest ein
Pest * Die kaiserliche Hauptarmee rückt in die Stadt Pest ein, die die Türken zuvor in Brand gesteckt haben.
7 1684 - Enrico Zuccalli reist für Studienzwecke nach Paris
München - Paris * Enrico Zuccalli reist für Studienzwecke nach Paris. Er bleibt dort bis März 1685.
14. 7 1684 - Die Belagerung von Buda durch die Kaiserlichen beginnt
Buda/Ofen * Am Jahrestag des Anfangs der Belagerung Wiens, beginnen die Kaiserlichen mit der Belagerung von Buda.
Zwar schaffen es die Belagerer die Unterstadt von Buda einzunehmen, doch die türkischen Verteidiger wehren alle weiteren Angriffe ab. Und nachdem die Zahl der diensttauglichen kaiserlichen Soldaten von 34.000 auf 12.500 gesunken ist, sinkt die Motivation und Kampfmoral auf ein extrem niedriges Niveau ab.
8 1684 - Gründung einer Theatiner-Niederlassung in Salzburg gefordert
Salzburg * Der Münchner Theatinerpater Johann Baptist Lerchenfeld fragt beim Salzburger Fürstbischof Max Gandolf von Kuenburg wegen der Gründung einer Theatiner-Niederlassung in der dortigen Residenzstadt nach. Es sollen zunächst sechs Geistliche auf Kosten der Familie Lerchenfeld installiert und mit 30.000 Gulden finanziert werden. Das Ziel ist die Installierung eines weiteren Priesterseminars.
18. 8 1684 - Franz Pongraz von Leiblfings Haus wird zum Adelssitz
Haidhausen * Kurfürst Max Emanuel erfüllt die Bitte des Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing in einem Gnadenbrief und erhebt „sein in Haidhausen habentes Haus“ zu einem „der Landtafel einverleibten adeligen Sitz“. Gleichzeitig überlässt der Kurfürst dem Freiherrn die „Vogtei und Niedergerichtsbarkeit über Haus und Garten des Wirtes Georg Krünner und über 43 namentlich aufgeführte Untertanen“, die bislang dem Hofkastenamt unterstanden.
Lediglich das Jagdscharwerk behält sich der Landesherr auch weiterhin vor. Der baierische Kurfürst begründet diesen Schritt mit der „In Ansehung seiner - also Leiblfings - langjährigen und ersprießlichen guten Dienste“.
9. 9 1684 - Max Emanuel trifft vor Ofen ein und übernimmt den Oberbefehl
Buda/Ofen * Max Emanuel trifft mit seinen Truppen vor Buda/Ofen ein und übernimmt den Oberbefehl.
11. 9 1684 - Unterstützung für die Belagerer von Buda/Ofen
Buda/Ofen * Die Belagerer erhalten durch ein kaiserliches Hilfskorps personelle Unterstützung, weshalb sie die Belagerungsaktivitäten sofort wieder verstärken.
22. 9 1684 - Die Belagerung von Buda/Ofen wird nach 109 Tagen abgebrochen
Buda/Ofen • Ein türkisches Entsatzheer erreicht Buda und greift die Belagerer umgehend an. Die folgenden Auseinandersetzungen bringen zwar keine Entscheidung, dennoch zeigen die ständigen Angriffe des Entsatzheeres und die Ausfälle der türkischen Stadtbesatzung ihre Wirkung und zermürben die Belagerer.
- Durch die osmanischen Ausfälle,
- durch Ruhr und Fieberepidemien,
- durch schlecht angelegte Laufgräben sowie
- durch taktische Fehler bei der Belagerung selbst schrumpft die Streitmacht um mehr als die Hälfte.
Bei den christlichen Alliierten sind nach diesem gescheiterten Unternehmen 23.000 Mann an Verlusten zu beklagen. Und nachdem das Wetter im Oktober auch immer schlechter wird, bricht man die Belagerung nach 109 Tagen ab.
Um 10 1684 - Die „Heiratsverhandlungen“ beginnen
Wien - München * Die „Heiratsverhandlungen“ der baierischen Räte über eine Verehelichung des Kurfürsten Max Emanuel mit der Erzherzogin Maria Antonia beginnen.
Sie dauern bis zum Frühjahr 1685.
30. 10 1684 - Die kaiserliche Armee zieht sich aus Buda/Ofen zurück
Buda/Ofen * Die kaiserliche Armee zieht sich unter Beteiligung der baierischen Regimenter aus Buda/Ofen zurück. Die Schuld am Misslingen der Belagerung von Buda wird Ernst Rüdiger von Starhemberg aufgebürdet, obwohl er am Anfang als Einziger gegen diese Belagerung war.
27. 11 1684 - Joseph Clemens wird einstimmig zum Koadjutor für Freising gewählt
Freising • Der 13-jährige Herzog Joseph Clemens wird vom Freisinger Domkapitel einstimmig zum Koadjutor [= Nachfolger] von Bischof Albrecht Sigismund gewählt.
Um 12 1684 - Franz Pongraz von Leiblfing ist mit dem Erreichten noch nicht zufrieden
Haidhausen * Freiherr Franz Pongraz von Leiblfing ist mit dem Erreichten allerdings noch lange nicht zufrieden, weshalb er sich nur wenige Monate später erneut an Max Emanuel wendet und darstellt, dass die vom Regenten erwiesene Gnade „von gar geringer Ergiebigkeit“ sei und er deshalb für sich die „ganze Dorfschaft Haidhausen“ - mitsamt dem „Kirchenschutz“ - als „geschlossene Hofmark“ erbittet.
Um seinen Anspruch zu unterstreichen, hebt er die „in 27 Jahren geleisteten treuen und untertänigst geleisteten Dienste“ hervor.
Daraufhin forderte der Baiernherrscher vom „Gericht ob der Au negst München“ eine Stellungnahme.
22. 12 1684 - Der Einrichtung eines Theatiner-Priesterseminars zugestimmt
Salzburg * Der Salzburger Fürsterzbischof Max Gandolf von Kuenburg stimmt der Einrichtung eines weiteren, von den Theatinern betriebenes Priesterseminar zu.
1685 - Giovanni Antonio Viscardi wird Hofbaumeister
München * Giovanni Antonio Viscardi wird zum Hofbaumeister ernannt.
1685 - Hugenotten als Spezialisten der Seidenverarbeitung
Potsdam - Frankfurt an der Oder * Preußen nimmt viele aus Frankreich geflüchtete Hugenotten auf und verzeichnet dadurch große Erfolge.
Die Hugenotten bringen aus Frankreich Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten der Seidenzucht und der Seidenverarbeitung mit. So entstehen in Potsdam und Frankfurt an der Oder die ersten Maulbeerplantagen.
12. 4 1685 - Ehevertrag zwischen Max Emanuel und Maria Antonia
<p><em><strong>München - Wien</strong></em> * Gleich nach dem Abzug aus Buda/Ofen am 30. Oktober 1684 beginnen die Heiratsverhandlungen über eine Vermählung Max Emanuels mit der österreichischen Erzherzogin Maria Antonia, der Tochter Kaisers Leopolds I.. Am 12. April 1685 wird der Ehevertrag unterzeichnet. </p>
18. 4 1685 - Schwere Bedenken gegen eine geschlossene Hofmark Haidhausen
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Der Auer Gerichtsherr, Dr. Georg Jobst, äußert schwere Bedenken gegen das Leiblfing‘sche Ansinnen, Haidhausen in eine geschlossene Hofmark umzuwandeln. Das Ausscheiden Haidhausens aus dem Verband des Gerichts ob der Au würde zu einem Einnahmeausfall führen, der dem eh schon so kleinen und armen Gericht durch den Entzug von 77 Einwohnern entstehen würde und dass dadurch die Bewohner der Au und Niedergiesings für die gesamten Kosten aufkommen müssten. </p>
15. 6 1685 - Kurfürst Max Emanuel und Erzherzogin Maria Antonia heiraten
Wien * Kurfürst Max Emanuel und Erzherzogin Maria Antonia heiraten in Wien.
20. 6 1685 - Die Hofkammer spricht sich gegen eine geschlossene Hofmark aus
Haidhausen * Auch die Hofkammer spricht sich in ihrer Stellungnahme gegen die Bitte des Haidhauser Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing aus, Haidhausen in eine geschlossene Hofmark umzuwandeln. Die Errichtung einer Leiblfing‘schen Hofmark bedeutet nämlich die Ausgliederung aus dem Gericht ob der Au.
7 1685 - In den Südturm der Theatinerkirche werden vier Glocken aufgezogen
München-Kreuzviertel * Nachdem der Südturm der Theatinerkirche seine endgültige Höhe von 64,6 Meter erreicht hat, wird der Glockenstuhl eingebaut und vier Glocken aufgezogen.
19. 7 1685 - Neuhäusl wird erobert
Neuhäusl * Neuhäusl wird erobert.
16. 8 1685 - Die Entsatzschlacht von Gran
Gran * Es kommt zur Entsatzschlacht von Gran. Ein Kavallerie-Angriff unter Max Emanuel bringt die Entscheidung.
19. 8 1685 - Neuhäusl wird von der kaiserlichen Armee erobert
Neuhäusl - München - Wien * Auf die Entsatzschlacht von Gran folgt die Eroberung von Neuhäusl. Wieder ist Max Emanuel am Erfolg der Schlachten wesentlich beteiligt. Baierns Kurfürst hat schon am Beginn der Allianz mit Kaiser Leopold I. ein selbstständiges Kommando verlangt. Dass er sich der Befehlsgewalt einem in der Hierarchie unter ihm stehenden Herzog Carl von Lothringen unterordnen muss, wird von ihm als auf Dauer nicht hinnehmbar angesehen und führt deshalb zu steten Protesten.
Je länger der Krieg dauert und je häufiger Kurfürst Max Emanuel entscheidend in die Kämpfe eingreift, desto lauter fordert er den Oberbefehl über alle kaiserlichen Truppen. Als Schwiegersohn hat sich die Beziehung zum Kaiser inzwischen besonders intensiviert, was die Ansprüche des Kurfürsten zusätzlich erhöht.
Doch genau jene militärischen Tugenden, die Max Emanuel bisher auszeichneten, sprechen in Wien gegen die Übertragung einer so großen Verantwortung an den Kurfürsten, auch wenn er durch seine Kühnheit, Risikofreude, Spontanität und seiner Lust zum Handstreich ohne Rücksicht auf das eigene Leben die wichtigsten Siege für den Kaiser errang. Den Wiener Kriegsplanern ist Max Emanuel einfach zu ungestüm.
29. 8 1685 - Joseph Clemens wird Koadjutor der Probstei Berchtesgaden
Berchtesgaden * Joseph Clemens wird zum Koadjutor (= Nachfolger) als Fürstprobst der Probstei Berchtesgaden erwählt.
9. 9 1685 - Haidhausen erlebt erneut ein aufwändiges Fest
Haidhausen * Aus Anlass der Hochzeit des Kurfürsten Max Emanuels mit der österreichischen Kaisertochter Maria Antonia erlebt Haidhausen erneut ein aufwändiges Fest. Nachmittags um drei Uhr versammeln sich auf dem Anger vor dem Besitztum des Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing die Kavaliere mit Kutschen und Handpferden. Auch die kurfürstliche Leibgarde zu Pferd und eine Kompagnie der Bürgerschaft zu Pferd ist angetreten.
Nach dem Eintreffen der frisch vermählten Eheleute, die zuvor ihr Mittagsmahl in Schloss Berg am Laim eingenommen haben, werden sie nun am Haidhauser Schlossanger von den dort versammelten Anwesenden feierlich empfangen. Nach einer ausführlichen Huldigung des jungen Ehepaares erfolgte der triumphale Einzug in die nahe Residenzstadt München.
Für die erwiesene Gastfreundschaft wird Kurfürst Max Emanuel dem Haidhauser Schlossbesitzer wieder ein kleines Stück entgegenkommen. Der Landesherr akzeptiert zwar die von seiner Hofkammer gemachten Einschränkungen, wonach Haidhausen nicht zur geschlossenen Hofmark ernannt werden darf, weil dort auch andere die Jurisdiktion ausüben, nämlich:
- das Leprosenhaus am Gasteig über den Kotterhof,
- Graf Preysing, die Ridler und die Jesuiten über ihre Gartengüter sowie
- der Kurfürst selbst über das Brunnhaus und den Jäger im Brunntal.
Außerdem, so die Hofkammer weiter, darf der Kurfürst die Jurisdiktion für eine so große Ortschaft nahe der Landeshauptstadt nie vergeben, da er sich sonst bei auftretenden Unregelmäßigkeiten zuerst an den Hofmarkherren wenden muss, statt sofort selbst einzuschreiten. Dies könnte besonders beim Ausbrechen der Pest oder bei der unerwünschten Ansiedelung von Bettlern und vagierendem Gesindel nötig sein.
1. 10 1685 - Carl VI., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Carl VI., der spätere Kaiser und Bruder von Kaiser Joseph I., wird in Wien geboren.
9. 10 1685 - Kurfürst Max Emanuel zieht mit Maria Antonia in München ein
München * Kurfürst Max Emanuel zieht mit der neuen baierischen Landesherrin Maria Antonia in München ein.
20. 10 1685 - Haidhausen wird ungeschlossene Hofmark
Haidhausen * Kurfürst Max Emanuel verleiht - trotz der von seiner Hofkammer dargelegten Einwände mit einem 2. Gnadenbrief dem Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing die Jurisdiktion über die übrigen Häuser und Gründe in Haidhausen, als ungeschlossene Hofmark.
Max Emanuel behält sich wiederum das Jagdscharwerk vor und verlangt außerdem für sich und seine Nachkommen das Recht, die Abtretung der Hofmark gegen ein anderes Aquivalent, ein gleichwertiges Objekt, zu verlangen.
4. 11 1685 - Bischof Albrecht Sigismund stirbt in Freising
Freising - Berg am Laim * Der Freisinger und Regensburger Bischof Albrecht Sigismund stirbt in Freising und wird in der dortigen Domkirche beigesetzt. Die Hofmark Berg am Laim erbt sein älterer Bruder Maximilian Heinrich, Kurfürst von Köln und Bischof der Bistümer Köln, Lüttich, Hildesheim und Münster.
Nachfolger auf den Bischofsstühlen in Freising und Regensburg wird der jüngere Bruder des baierischen Kurfürsten Max Emanuel, der 13-jährige Herzog Joseph Clemens.
Um den 1686 - Freskierung der Klostergänge durch den Paulanermönch Joseph Schwaiger
Au * Freskierung der Klostergänge im Kloster Neudeck durch den in der Au gebürtigen Paulaner-Mönch Joseph Schwaiger.
1686 - Franz Pabenstuber taucht als „Schulmeister daselbst“ auf
Haidhausen * Ein Franziskus Pabenstuber taucht in einer Aufstellung der Haidhauser Hausbesitzer als „Schulmeister daselbst“ auf.
1686 - In Nürnberg und in Regensburg werden „Kaffeeschenken“ eröffnet
Nürnberg - Regensburg * In Nürnberg und in Regensburg, wo seit dem Jahr 1663 der „Immerwährende Reichstag“ stattfindet, werden „Kaffeeschenken“ eröffnet.
12. 3 1686 - Die Dorfgemeinde Haidhausen fühlt sich in ihren Rechten verletzt
Haidhausen * Die Dorfgemeinde Haidhausen fühlt sich durch die Ausdehnung der Hofmarkgerechtigkeit für den Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing auf alle Häuser und Gründe in ihren Rechten verletzt und schreibt dies dem Kurfürsten.
3. 6 1686 - Max Emanuel trifft mit seinen Truppen im Lager vor Ofen ein
Buda/Ofen * Kurfürst Max Emanuel trifft mit seinen baierischen Truppen im Lager vor Buda/Ofen ein.
9. 6 1686 - Ofen wird unter Zusammenfassung aller verfügbaren Kräfte belagert
Buda/Ofen * Der Kriegsrat trifft auf Max Emanuels Betreiben hin im Feldlager von Parkany die Entscheidung die von den Türken besetzte Stadt Buda/Ofen unter Zusammenfassung aller verfügbaren Kräfte zu belagern.
Um den 15. 6 1686 - Die erneute Belagerung von Buda/Ofen beginnt
Buda/Ofen * Zwei Jahre nach der erfolglosen Belagerung von Buda/Ofen wird ein wiederholter Feldzug zur Einnahme der ungarischen Hauptstadt gestartet, an der diesmal mit 75.000 bis 80.000 Mann eine doppelt so starke christliche Streitmacht teilnimmt. Die erneute Belagerung beginnt.
17. 6 1686 - Baierische Truppen bemächtigen sich der Stadt Pest
Pest * Baierische Truppen bemächtigen sich der ungarischen Stadt Pest.
22. 6 1686 - In der Stadt Buda explodiert ein Pulvermagazin
Buda/Ofen * In der Stadt Buda explodiert ein Pulvermagazin. 8.000 Zentner Pulver fliegen in die Luft und bringen den christlichen Angreifern erhebliche Vorteile.
22. 6 1686 - Ein getaufter Türke erzählt
Buda/Ofen - Au * Ein getaufter Türke erzählt in August Kühn´s Roman „Die Vorstadt“ folgende Geschichte über den, in seiner Muttersprache Mavi Kral genannten Blauen Kurfürsten Max Emanuel: „Den 22. ist das Pulvermagazin in unserer Stadt in die Luft geflogen und hat uns großen Schaden getan, aber der Mavi Kral hat seine Soldaten im Graben vor den Mauern gehalten noch sechs Wochen lang.
Mein Aga hat mir von der auf dem Hügel gelegenen Citadelle der Stadt gezeigt, wie es im Christenlager zuging. Wenn sie dort einen von unserer Seite gefangen haben, ist ihm die Haut abgezogen und die gedörrt worden. Nun weiß ich ja, daß die als ‚Mumia‘ den Ärzten und Apothekern als Heilmittel verkauft wurde, wie das gedörrte Menschenfleisch auch. Damals habe ich, wie viele Türken, die Soldaten des Mavi Kral für Menschenfresser gehalten, für gefährliche Wilde.
Noch mehr haben wir das glauben können, wie es zur Eroberung der Unterstadt am Wasser kam. Dabei sind auch die Frauen und sogar viele Kinder erschlagen worden. Ein- und zweijährige Kinder spießten sie auf Lanzen oder warfen sie gegen die Mauer, bis sie tot waren. Zwei Tage danach mußte auch die Citadelle übergeben werden, aber der Mavi Kral lud meinen Beg zu Tisch und hat ihn umbringen lassen.“
9. 7 1686 - Die Gründung der Augsburger Liga gegen Frankreich
Augsburg * Unter der Führung des Kaisers Leopold I. kommt es zur Gründung der Augsburger Liga gegen Frankreich.
27. 7 1686 - Die türkischen Verteidiger wehren den großen Angriff ab
Buda/Ofen * Ein großer Angriff des christlichen Heeres kann von den türkischen Verteidigern abgewehrt werden.
2. 9 1686 - Buda/Ofen wird von der kaiserlichen Armee gestürmt
Buda/Ofen * Mittags um ein Uhr, kommt es zum erfolgreichen Generalsturm auf die Festung. Grausame Szenen spielen sich bei der Eroberung von Buda/Ofen ab. Der ganze Zorn der siegreichen christlichen Soldaten entlädt sich nun gegen die Heiden.
Die Wut über die angeblichen Gräueltaten der Osmanen gegen die Zivilbevölkerung und der von Kirche und Glauben angefachte religiöse Hass entladen sich nun an der Bevölkerung von Buda/Ofen. Alles was sich den Christen entgegen stellt, muss sterben. Selbst Kinder und Säuglinge werden ein Opfer der zügellosen Soldateska.
Ein brandenburgischer Augenzeuge berichtet: „Ich bin erstaunet, was da ist vorgegangen, daß auch Menschen viel grausamer als Bestien gegeneinander sich bezeigeten“. Nur Wenigen gelingt die Flucht auf die Burg.
4. 9 1686 - Auch die Burg von Buda/Ofen muss kapitulieren
Buda/Ofen * Auch die Burg von Buda/Ofen, der letzte Zufluchtsort der Verteidiger, muss kapitulieren.
27. 9 1686 - Cosmas Damian Asam wird geboren
Benediktbeuern * Cosmas Damian Asam kommt in Benediktbeuern zur Welt.
1 1687 - Kurfürst Max Emanuel vergnügt sich beim „Karneval in Venedig“
Venedig * Kurfürst Max Emanuel vergnügt sich bis Februar beim „Karneval in Venedig“.
3 1687 - Auseinandersetzungen über Ziele und Verfahren des Türken-Feldzugs
Wien * Nach der Rückkehr Kurfürst Max Emanuels vom „Karneval in Venedig“ kommt es zwischen der kaiserlich-lothringischen und der badisch-baierischen Partei zu Auseinandersetzungen über Ziele und Verfahrensfragen des Feldzugs gegen die Türken.
12. 8 1687 - Ein glänzender Sieg der Kaiserlichen Armee
Mohács * Bei einer der seltenen Feldschlachten des Türkenkriegs stehen 60.000 Türken etwa 50.000 Verbündeten des Kaisers am Berge Harsán bei Mohács gegenüber. Die Schlacht endet mit einem glänzenden Sieg der Kaiserlichen.
Der von Kurfürst Max Emanuel befehligte linke Flügel erzwingt den Sieg, indem er zuerst den ersten Angriff der türkischen Reiterei abwehrt, danach mit einem Gegenangriff den Gegner zurückwirft und so lange beschäftigt, bis Herzog Carl von Lothringen die türkischen Verschanzung gewinnen kann.
9. 12 1687 - Joseph I. wird zum ungarischen König gekrönt
Ungarn * Joseph I. wird zum ungarischen König gekrönt.
1688 - Sebastian Gaißreitter kauft am „Gaisberg“ zusätzlichen Grund
Au * Sebastian Gaißreitter kauft am „Gaisberg“ zusätzlichen Grund und erweitert damit sein Anwesen um die Kapelle.
1688 - Kurfürst Joseph Clemens erhält die „niederen Weihen“
München * Kurfürst Joseph Clemens erhält die „niederen Weihen“.
7. 1 1688 - Papst Innozenz XI. kennt das Ergebnis der Wahl nicht an
Köln * Die Kölner Domherren legen sich - auf Wunsch des Fürstbischofs Maximilian Heinrich - einstimmig für Wilhelm Egon von Fürstenberg als Koadjutor [= Nachfolger] für den Kölner Bischofsstuhl fest.
- Kaiser Leopold I. erklärt die Wahl für ungültig und auch
- Papst Innozenz XI. erkennt das Ergebnis der Wahl nicht an und zögert die Sache so lange hinaus, bis Kurfürst Maximilian Heinrich stirbt.
26. 5 1688 - Türkische Kriegsgefangene als Sesselträger
München - Au * Eine Gruppe der türkischen Kriegsgefangenen muss als Sänftenträger dienen. Die Sesselträger bilden eine eigene Organisation, an deren Spitze ein einheimischer Sesselmeister steht, der für den funktionierenden Ablauf verantwortlich ist und für das Wohlergehen seiner Untergebenen zu sorgen hat.
Damit der Sesselmeister Christoph Wegele nicht nach Gutdünken mit seinen Beschäftigten umspringen kann, erhält er am 26. Mai 1688 genaue Instruktionen, die alles, von der Verpflegung bis zur Entlohnung, regeln.
1. 6 1688 - Bischof Joseph Clemens wird in Berg am Laim erbberechtigt
Köln * In seinem Testament bestimmt der Kölner Kurfürst Maximilian Heinrich die Erbberechtigung der in Baiern regierenden kurfürstlichen Familie über seine Eigengüter - und damit auch über die Hofmark Berg am Laim. Die Nutznießung soll „Seine Durchlaucht Herzog Joseph Clemens, Bischof von Freising und Regensburg“ haben. Und falls künftige Herzöge „in geistlichem Stande vorhanden wärn“, so sind auch diese in der Erbfolge bevorzugt.
5. 6 1688 - Der Kölner Kurfürst Maximilian Heinrich stirbt
Köln - Berg am Laim - Berchtesgaden * Der aus der baierisch-wittelsbachischen Linie stammende Kölner Kurfürst Maximilian Heinrich stirbt. Damit ist die Konkurrenz über die Wahl des Nachfolgers auf dem Kölner Bischofsstuhl wieder offen. Angeführt von Kaiser Leopold I. sammeln sich alle frankreichfeindlichen Kräfte hinter dem 17-jährigen baierischen Kandidaten Joseph Clemens.
Die Hofmarkherrschaft über Berg am Laim geht an Maximilian Heinrichs Neffen Joseph Clemens über. Joseph Clemens wird zudem Fürstprobst der Probstei Berchtesgaden.
19. 6 1688 - Ein Ehevertrag zwischen Baiern und Toskana wird geschlossen
München - Florenz • Der Ehevertrag zwischen der baierischen Prinzessin Violante Beatrix, der jüngsten Tochter des baierischen Kurfürstenpaares Henriette Adelaide und Ferdinand Maria, und dem Ferdinando de‘ Medici, Erbgroßherzog der Toskana, wird unterzeichnet.
6. 7 1688 - Kurfürst Max Emanuels Soldaten stürmen Belgrad
Belgrad * Kurfürst Max Emanuels Soldaten stürmen Belgrad und nehmen die Festung ein.
19. 7 1688 - Joseph Clemens wird Kölner Erzbischof und Kurfürst
Köln - Rom-Vatikan * Es kommt zur Wahl zum Kölner Erzbischof und Kurfürsten.
- Bei der Kampfabstimmung erhält der Straßburger Bischof Wilhelm Egon von Fürstenberg 13 der 24 Stimmen.
- Bischof Joseph Clemens von Freising und Regensburg erhält dagegen nur neun Stimmen.
Dennoch bestätigt Papst Innozenz XI. den unterlegenen Kandidaten in der Funktion des Kölner Fürstbischofs und Kurfürsten. Daraufhin lässt der französische König Ludwig XIV. Köln besetzen. Der frisch gekürte 17-jährige Kurfürst Joseph Clemens kann dadurch die nächsten neun Jahre nicht in Köln residieren.
25. 7 1688 - Max Emanuel trifft mit seinen baierischen Truppen bei Peterwardein ein
Peterwardein * Kurfürst Max Emanuel trifft mit seinen baierischen Truppen bei Peterwardein ein und überquert die Save.
26. 7 1688 - Der Grundstein für das neue Eremitorium am Walchensee wird gelegt
Walchensee * Am Fest der von der Kurfürstin Maria Antonia verehrten heiligen Mutter Anna, wird der Grundstein für das neue Eremitorium am Walchensee gelegt.
28. 7 1688 - Die Belagerung Belgrads durch Max Emanuel beginnt
Belgrad * Die Belagerung Belgrads durch Baierns Kurfürst Max Emanuel beginnt.
6. 9 1688 - Kurfürst Max Emanuels Soldaten stürmen Belgrad
Belgrad * Nachdem dem Kurfürsten Max Emanuel die Belagerung Belgrads nicht schnell genug voranschreitet, gibt er den Befehl zum Sturm. Nach einem langen und heftigen Kampf und erheblichen Verlusten auf beiden Seiten können die christlichen Truppen Belgrad erobern. Zahlreiche Offiziere und hunderte von Soldaten lassen „ihr Leben der Christenheit zum unbeschreiblichen Nutzen und ihrem selbsteigenen unsterblichen Ruhm“. Ein Pfeilschuss hat Max Emanuel im Gesicht verletzt.
Die Sieger verhalten sich wie bei allen vorangegangenen Feldzügen und ermorden alles, was ihnen in den Weg kommt. Und wenn die Helden keinen Degen mehr haben, erstechen sie die „verfluchten Türcken mit Brotmessern“ und schicken sie „solcher gestalt zu ihrem Mahomet“. Die Verwundeten erschlagen die Christen mit ihren Äxten und Gewehrkolben. Das Gemetzel dauert Stunden. Ihm folgt die Plünderung und daran anschließend der Dankgottesdienst. Der 26-jährige Kurfürst Max Emanuel verlässt den ungarischen Kriegsschauplatz nach der Befreiung Belgrads für immer.
13. 9 1688 - Kurfürst Max Emanuel reist nach der Befreiung Belgrads ins kaiserliche Wien
Belgrad - Wien * Kurfürst Max Emanuel reist nach der Befreiung Belgrads ins kaiserliche Wien.
10 1688 - Was tun mit einer abgelegten Mätresse ?
Belgrad - München * Als Kurfürst Max Emanuel nach seinem „tollkühnen Sturm auf Belgrad“ nach München zurückkehrt, befindet sich in seinem Gefolge die 16-jährige Italienerin Adelheid Felicitas Canossa.
Der Kurfürst bietet Max Cajetan von Törring-Seefeld die Hand der aparten - allerdings als Mätresse abgelegten - Adelheid Felicitas an.
1689 - Der „Wasserkrieg“ zwischen den Münchner und den Auern
München - Au * Der Jahrhunderte lange „Wasserkrieg“ zwischen den Münchner und den Auern erreicht seinen Höhepunkt.
Nach einer der vielen überschwemmungen nutzen die Auer die Gelegenheit, möglichst viel Wasser in ihren Mühlbach zu leiten. Als Antwort zerstören die Münchner die Auer Wehranlagen.
1689 - Giovanni Antonio Viscardi wird aus dem Hofdienst entlassen
München * Nach einem Streit mit seinem Vorgesetzten Enrico Zuccalli um die Nutzung des gemeinsamen Gartens vor dem Schwabinger Tor wird Giovanni Antonio Viscardi aus dem Hofdienst entlassen.
Viscardi ist in den nächsten Jahren als „freier Baumeister-Architekt“ tätig und unter anderem am Bau des Jesuitenklosters in Landshut, an Erweiterungsbauten im Kloster Fürstenfeld und an der Theatinerkirche beteiligt.
Weitere Aufträge folgen. Für den Reichsgrafen Ferdinand Franz Lorenz Xaver von Tilly zu Breitenegg übernimmt Viscardi verschiedene Bauaufträge.
4. 5 1689 - Allianzvertrag zwischen Österreich und Baiern
München - Wien * Ein neuer Allianzvertrag zwischen Österreich und Baiern wird geschlossen. Darin verpflichtet sich Kurfürst Max Emanuel, Kaiser Leopold I. 8.000 Mann für den Kampf gegen Frankreich zur Verfügung zu stellen.
22. 5 1689 - Der erste Sohn des Kurfürstenpaares
München * Dem baierischen Kurfürstenpaar Max Emanuel und Maria Antonia wird mit Leopold Ferdinand ein Sohn geboren.
25. 5 1689 - Kurprinz Leopold Ferdinand stirbt nach drei Tagen
München * Kurprinz Leopold Ferdinand, der erstgeborene Sohn des Kurfürsten Max Emanuel und dessen Gemahlin Maria Antonia, stirbt nach nur drei Tagen.
31. 5 1689 - Kurfürst Max Emanuel übernimmt das Kommando über die Truppe
Bretten * Kurfürst Max Emanuel trifft im Lager bei Bretten ein und übernimmt das Kommando über die Truppe.
8. 9 1689 - Der Krieg gegen Frankreich am Rhein
Mainz * Kurfürst Max Emanuel beteiligt sich mit den baierischen Truppen im Krieg gegen Frankreich am Rhein an der Belagerung von Mainz. Der französische Kommandant von Mainz kapituliert vor den baierischen Truppen.
30. 9 1689 - Das Kirchlein der Eremiten am Wallersee wird geweiht
Walchensee * Durch großzügige Spenden der Kurfürstin und Dritter kann das Kirchlein der Eremiten am Wallersee vom Freisinger Weihbischof zu Ehren der heiligen Anna geweiht werden.
Zur selben Zeit bevollmächtigt der Freisinger Generalvikar Pater Onuphrius zur Spendung der Sakramente. Die wenigen Siedlungen der abgelegenen Gegend sehen in den Waldbrüdern nämlich willkommene Seelsorger.
13. 10 1689 - Bonn wird von den Franzosen befreit
Bonn * Die deutschen Truppen unter Kurfürst Max Emanuel ziehen im französisch besetzten Bonn ein.
5. 11 1689 - Der siegreiche Kurfürst Max Emanuel wieder in München
München * Kurfürst Max Emanuel trifft nach seinem siebten Feldzug - gegen die Franzosen am Rhein, in Mainz und Bonn - wieder in München ein.
6. 11 1689 - Der Haidhauser Schulmeister Franziskus Pabenstuber stirbt
Haidhausen * Der Haidhauser Schulmeister Franziskus Pabenstuber stirbt.
18. 12 1689 - Ein Nachfolger für den Haidhauser Schulmeister
München * Der Nachfolger des Haidhauser Schulmeisters, Melchior Eizinger, muss zunächst die Witwe Pabenstuber heiraten, um die Lehrerstelle überhaupt erwerben zu können. Das Schulhaus befindet sich an der südlichen Preysingstraße, gegenüber der Einmündung der Wolfgangstraße.
1690 - Ein „Brothäusl“ der Münchner Bäcker auf dem Gasteigberg
Au * Die Münchner Bäcker errichten - sehr zum Ärger der Auer Bäcker - ein „Brothäusl“ auf dem innerhalb des „Münchner Burgfriedens“ gelegenen Gasteigbergs.
1690 - 2.000 Personen finden Brot und Lohn in der „Tuchfabrik für Militäruniformen“
Au * Alleine die „holländische Tuchmacherei“ in der „Tuchfabrik für Militäruniformen“ gibt fast 2.000 Personen Brot und Lohn.
Neben „erstklassigen gelernten Arbeitern“ beschäftigt man „ausgediente Soldaten, arme Weiber und Kinder“, dazu kommen „eingewiesene Bettler und Nichtsnutze“. Anno 1682 schrieb die „Hofkammer“, dass „Arme im Wollhause zu München Beschäftigung finden, Faulenzer dagegen ins Zuchthaus“ eingeliefert würden.
Auch dieser Unternehmung war kein langes Leben beschieden.
Ab 1696 ging es auch mit der „Fabricca“ wieder bergab. Anno 1720 war sie am Ende.
Um 1690 - Fortunatus Hueber, ein wortgewaltiger und hochgebildeter Prediger
Berg am Laim * Zu den bedeutendsten Vertretern der „Franziskaner“ gehört der aus Neustadt an der Donau stammende Fortunatus Hueber, ein wortgewaltiger, hochgebildeter und erfahrener Ordensmann und Prediger, der in mehrere hohe Ämter berufen wird.
Ihn erwählt der 22-jährige Kölner Erzbischof und Kurfürst Joseph Clemens für die Organisation, Werbung und Betreuung der von ihm am 8. Mai beziehungsweise am 29. September 1693 gegründeten „Michaels-Bruderschaft“ und des „Michaels-Ritterordens“.
1690 - Erste Planungen für die Berg am Laimer Josephsburg
Berg am Laim * Der aus Rovereto in Graubünden stammende Architekt Enrico Zucalli legt seinen ersten Planungsentwurf für die Berg am Laimer Josephsburg für den Kölner Kurfürsten Joseph Clemens vor.
Zucalli hatte gerade seine Arbeiten an der Theatinerkirche beendet, Schloss Nymphenburg weitergebaut und die Schlösser Lustheim und Schleißheim begonnen.
24. 1 1690 - Joseph I. wird römisch-deutscher König
Frankfurt am Main * Joseph I. wird römisch-deutscher König.
20. 4 1690 - Maria Anna Christine Victorie stirbt in Versailles
Versailles * Maria Anna Christine Victorie, die ältere Schwester des Kurfürsten Max Emanuel und Gemahlin von Ludwig, dem Dauphin von Frankreich, stirbt in Versailles.
18. 6 1690 - Bischof Joseph Clemens trifft in Freising ein
Freising * Bischof Joseph Clemens trifft in Freising ein, wo ihn Deputierte des Domkapitels in einem Zeltlager vor der Stadt begrüßen. Anschließend formiert sich ein Festzug, in dem „Ihro kurfürstliche Durchlaucht von Köln, unser gnädigster Herr“ in der blausamtenen, mit Gold reich verzierten Leibkutsche - begleitet von „zwei kleinen, getauften Türken“ - sitzt und mit großem Gefolge zum Domberg zieht. Kein anderer Freisinger Fürstbischof leistet sich einen solchen Aufwand für die feierliche Gestaltung der Einnehmung von Freising.
19. 6 1690 - Bischof Joseph Clemens ergreift Besitz von Freising
Freising * In einer fünfteiligen Zeremonie ergreift Bischof Joseph Clemens Besitz von seiner Bischofskirche und der Bischöflichen Residenz. War der am Tag zuvor vollzogene Einzug nach Freising eine Darstellung des Freisinger Hofstaates und des Militärs, so gestaltet sich die Übernahme des Freisinger Dombezirks als eine Prozession des Hofstaates und der Geistlichkeit.
Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein großes Freyschiessen, an dem sich zweihundertsechzig Schützen und Schützenkompanien in vier Durchgängen beteiligen. Acht Tage dauert das Schützenfest. Bei den Umzügen stehen römische Gottheiten und die vier Elemente im Mittelpunkt. Fürstbischof Joseph Clemens tritt darin in der Rolle des „Capo der Sonnenquadrille“ auf.
25. 6 1690 - Kurfürstin Maria Antonia kommt nach Freising zu Besuch
Freising * Selbst die baierische Kurfürstin und Kaisertochter Maria Antonia kommt nach Freising zu Besuch. Zu ihren Ehren wird ein Turnier mit Lanzen, Pfeilen, Pistolen und Degen veranstaltet.
26. 6 1690 - In den Freisinger Isarauen findet eine Hirschjagd statt
Freising * In den Freisinger Isarauen findet eine Hirschjagd mit Pistolen statt. Es ist eine der beliebten „eingestellten Jagden“, bei denen die zuvor zusammengetriebenen Tiere in einem eigens erbauten Parcur von den anwesenden hohen Herrschaften reihenweise hingeschlachtet werden.
1691 - Die Paulaner stellen trotz kurfürstlichen Verbots Weißbier her
Au * Die Paulaner-Mönche stellen trotz kurfürstlichen Verbots Weißbier her.
1691 - Kurfürst Joseph Clemens lässt den „Kölner Ziegelstadel“ bauen
Berg am Laim - Ramersdorf * Der Kölner Kurfürst und Erzbischof, Joseph Clemens, lässt den „Kölner Ziegelstadel“ erbauen.
Er befindet sich zwischen der Straße nach Ramersdorf (Rosenheimer Straße) und dem Weg nach Berg am Laim (Berg-am-Laim-Straße).
An der Rosenheimer Straße entstehen noch drei weitere „Ziegelstadel“.
Einer gehört der „Stadtkammer“, ein Anderer ist in Privatbesitz, der Dritte gehört dem „Paulaner-Kloster“.
5. 1 1691 - Weder Spül- noch anderes Wasser darf auf die Gasse geschüttet werden
München * Die Bürgerschaft wird darauf aufmerksam gemacht, dass weder Spül- noch anderes Wasser auf die Gasse geschüttet werden darf.
22. 2 1691 - Die Englischen Fräulein erhalten ihr bewohntes Haus zum Geschenk
München-Graggenau * Kurfürst Max Emanuel schenkt den Englischen Fräulein das von ihnen seit dem Jahr 1628 bewohnte Haus in der Weinstraße.
6. 4 1691 - Bischof Joseph Clemens bestätigt das „Augenwunder“
<p><strong><em>Freising - München-Hackenviertel</em></strong> * Bischof Joseph Clemens stellt zur „Augenwende“ in der Herzogspitalkirche eine Approbationsurkunde aus. </p> <p>In dieser bestätigt er, dass dieses und andere Wunder <em>„als der Wahrheit gemäße und von der wunderthätigen Hand Gottes und seiner werthen Mutter Fürbitte herrührende Gnadenzeichen den Christgläubigen billig vorgetragen und von Jedermann sicherlich können geglaubt werden“</em>. </p>
8. 8 1691 - Kurfürst Max Emanuel bricht zu einem Feldzug nach Savoyen auf
München-Hackenviertel - Turin * Nach einem Gottesdienst in der Herzogspitalkirche bricht Kurfürst Max Emanuel zu einem kaiserlichen Feldzug nach Savoyen auf.
11. 8 1691 - Kurfürstin Maria Antonia reist auf dem Wasserweg nach Wien
München - Wien * Kurfürstin Maria Antonia reist mit kleinem Gefolge auf dem Wasserweg nach Wien.
17. 8 1691 - Kurfürst Max Emanuel zieht in Mailand ein
Mailand * Kurfürst Max Emanuel zieht zusammen mit dem Herzog von Savoyen in Mailand ein.
19. 8 1691 - Kurfürst Max Emanuel zieht prunkvoll in Turin ein
Turin * Kurfürst Max Emanuel zieht prunkvoll - in der Heimatstadt seiner Mutter Henriette Adelaide - in Turin ein.
15. 10 1691 - Maria Anna Lindmayr wird Tertiarin
München * Maria Anna Lindmayr wird am Fest der großen Theresia von Avila, vom Prior des Karmeliterklosters als Tertiarin in die Ordensgemeinschaft aufgenommen. Sie erhält das Drittordenskleid und führt fortan für sich ein strenges Büßerleben.
31. 10 1691 - Auch andere Zünfte sollen den Transport der Geschütze übernehmen
München * Die Weinwirte, Gastgeben und Bierbrauer bitten den Inneren Rat künftig auch die Zunft der Handelsleute sowie das Handwerk der Köche, Metzger, Landkutschiere und Branntweiner am Transport der Geschütze auf die Wälle heranzuziehen.
Bei feierlichen Anlässen und Einzügen müssen die „Stuckh“ genannten Geschütze zum Salutschießen auf die Wälle gebracht werden. Diese Aufgabe wird bisher von den Weinwirten und Bierbrauern wahrgenommen.
12. 12 1691 - Max Emanuel wird Generalstatthalter der Spanischen Niederlande
Madrid - Brüssel * Baierns Kurfürst Max Emanuel wird durch Spaniens König Carl II. zum Generalstatthalter der Spanischen Niederlande ernannt.
22. 12 1691 - Mit dem Schutt des Schäfflerturms das Wöhrl aufgefüllt
Haidhausen - Giesing - Zamdorf - München-Lehel * Die Bauern aus Haidhausen, Giesing, Zamdorf und anderen Orten haben die 455 Fudern Bauschutt des abgebrochenen Schäfflerturms an der Weinstraße auf das Wöhrl oberhalb der Isarbrücke [= Museumsinsel] gebracht. Der Abbruch des ehemaligen Stadttores war wegen des Neubaus der Englischen Fräulein notwendig geworden.
1692 - Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn wird „Obristhofmeister“
München * Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn zum „Obristhofmeister“ befördert, womit er als „Vorsitzender des kurfürstlichen Geheimen Rats“ das höchste Hofamt bekleidet.
1692 - Die Gemeinschaft der „Eremiten am Wallersee“ umfasst neun „Klausner“
Walchensee * Bald zählt die Gemeinschaft der „Eremiten am Wallersee“ - gegen alle Abmachungen - bereits neun „Klausner“, woraufhin der Ordensgeneral der „Karmeliten“ die „Tertiaren-Gemeinschaft am Walchensee“ aus dem Orden entlässt.
3. 3 1692 - Kurfürst Max Emanuel erklärt Haidhausen zur geschlossenen Hofmark
Haidhausen * Da Graf Franz Pongraz von Leiblfing in seinem Bestreben, die Erhöhung seines Besitzes in Haidhausen zur geschlossenen Hofmark, nicht nachlässt, erklärt Kurfürst Max Emanuel schließlich die Hofmark des Geheimen und Conferenzrates, Kämmerers, Revisionsrates und Pflegers von Waldmünchen, des inzwischen in den Reichsstand erhobenen Reichsgrafen von Leiblfing - wegen der „vill vnd lange Jar trew geleisteter Dienst vnd aus absonderlichen gnaden“ - mitsamt dem Brunnthal für geschlossen. Damit ist der Haidhauser Schlossbesitzer endlich am Ziel seiner langjährigen Bemühungen.
In seiner geschlossenen Hofmark unterstehen ihm nun alle dem „Hofkastenamte zinsbaren Unterthanen zu Haidhausen“ und nicht nur die Bauern und Dienstboten, die seine Güter bearbeiteten. Neben riesigen landwirtschaftlichen Flächen besitzt der Graf auch das Recht Scharwerke, Bodenzins und sonstige Steuern und Abgaben - also die gesamten Einkünfte aus Haidhausen - einzutreiben. Selbst die Vergabe der Gerechtsamkeiten“ also die Erlaubnis innerhalb der Hofmark ein bestimmtes Handwerk oder Gewerbe ausüben zu dürfen, unterliegen nun ausschließlich seiner Entscheidung.
- Dem Hofmarkherrn unterstehen „im Dorfe 85 Hausbesitzer, die Scharwerkgeld zu entrichten haben.
- In der Schwaige nimmt er von 42 Untertanen Scharwerkgeld und Bodenzins ein.
- Der Großwirt hat Stift und Gilt zu entrichten und Melber, Metzger, Schmid, Hufschmid und Schneider haben unterschiedliche Beträge abzuführen.
- Der jährliche Ertrag der Hofmark beläuft sich auf 188 Gulden 11 Kreuzer“.
- Die Konsequenz aus der Erhebung Haidhausens zur geschlossenen Hofmark ist der Austritt aus dem Verband des Gerichts ob der Au.
Während der Leiblfing‘schen Hofmarkszeit wird die Ansiedlung minderbemittelter Leute stark begünstigt. Jeder, der die Gebühren entrichten und eine Herberge erwerben kann, darf sich niederlassen und heiraten. Zeitgenossen merken kritisch an, dass der Hofmarkherr nur auf seinen Vorteil bedacht ist und sein Streben einzig der Erhöhung seiner Einnahmen gilt. Er ergreift „jede Gelegenheit Geld aus den Untertanen zu pressen, z.B. durch offenbare Begünstigung der Herbergskäufe und Ansässigmachungen und Verehelichungen, wegen der anfallenden Laudemien, Verbriefungs- und anderer Taxen und Sporteln“.
5. 3 1692 - Max Emanuel macht sich auf den Weg in die Spanischen Niederlande
München - Brüssel * Max Emanuel macht sich - ohne seine schwangerne Ehefrau Maria Antonia - auf den Weg von München in die Spanischen Niederlande.
13. 3 1692 - Max Cajetan von Törring-Seefeld und Adelheid Felicitas Canossa heiraten
<p><strong><em>München</em></strong> * Graf Max Cajetan von Törring-Seefeld und Adelheid Felicitas Canossa heiraten. Er erhält dafür vom Kurfürsten Max Emanuel:</p> <ul> <li>einmalig 30.000 Gulden plus eine jährliche Pension von 4.000 Gulden,</li> <li>dazu die Niedergerichtsbarkeit über verschiedene Untertanen im Landgericht Weilheim und Starnberg,</li> <li>vier ganze und drei halbe Höfe, vier Güter und zwei Sölden</li> <li>sowie eine neue Braugerechtigkeit für Seefeld.</li> <li>Außerdem die Garantie für Max Cajetans militärischen Aufstieg.</li> </ul>
26. 3 1692 - Kurfürst Max Emanuel zieht feierlich in Brüssel ein
Brüssel * Kurfürst Max Emanuel zieht feierlich in Brüssel ein.
27. 10 1692 - Geburt des baierischen Kurprinzen Ferdinand Joseph in Wien
Wien - Brüssel * Baierns Kurfürstin Maria Antonia bringt in der Wiener Hofburg einen Sohn zur Welt. Das Kind wird noch am selben Tag vom päpstlichen Nuntius im Beisein des Kaiserpaares in feierlicher Zeremonie auf den Namen Joseph Ferdinand Leopold getauft.
Kurfürst Max Emanuel, der Vater des Kindes, ordnet - nachdem er von der Geburt seines Sohnes erfahren hat - in Brüssel eine Festbeleuchtung an - und gibt ein Galadiner. Er nutzt schließlich jeden sich bietenden Grund zum Feiern.
27. 10 1692 - Kurprinz Joseph Ferdinand Leopold wird in Wien geboren
Wien - Brüssel * Baierns Kurfürstin Maria Antonia bringt in der Wiener Hofburg einen Sohn zur Welt. Das Kind wird noch am selben Tag vom päpstlichen Nuntius im Beisein des Kaiserpaares in feierlicher Zeremonie auf den Namen Joseph Ferdinand Leopold getauft.
Kurfürst Max Emanuel, der Vater des Kindes, ordnet - nachdem er von der Geburt seines Sohnes erfahren hat - in Brüssel eine Festbeleuchtung an - und gibt ein Galadiner. Er nutzt schließlich jeden sich bietenden Grund zum Feiern.
12. 12 1692 - Max Emanuels Enterbung
Wien * Kurfürstin Maria Antonia unterzeichnet in Wien ihr Testament und schließt darin ihren Ehemann Max Emanuel vom Erbe aus.
24. 12 1692 - Kurfürstin Maria Antonia stirbt in Wien
Wien - Brüssel * Baierns Kurfürstin Maria Antonia stirbt in Wien. Kurfürst Max Emanuel, ihr Ehemann und Gouverneur der Spanischen Niederlande, nimmt die Todesnachricht in Brüssel gelassen und ungerührt entgegen. An den Begräbnisfeierlichkeiten im weit entfernten Wien nimmt er natürlich nicht teil.
1693 - Neben der „Gaißreitterischen Kapelle“ entsteht ein kleines Haus
Au * Das „Patrizier-Ehepaar“ Johann Maximilian von Alberti und seine Ehefrau Maria Franziska, die aus dem angesehenen Hause Prielmeyer stammt, werden auf die Gebäude des zur Au gehörenden „Gaisberges“ aufmerksam und lassen neben der „Gaißreitterischen Kapelle“ ein kleines Haus errichten.
1693 - Kurfürst Max Emanuel kämpft mit im „Krieg gegen Frankreich am Rhein“
Neerwinden * Kurfürst Max Emanuel beteiligt sich mit den baierischen Truppen im „Krieg gegen Frankreich am Rhein“ an der „Schlacht von Neerwinden“.
1693 - Die Gräfin von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn kauft das „Palais Portia“
München-Kreuzviertel * Ihr ererbtes und erworbenes Vermögen ermöglichte es Anna Maria Katherina Gräfin von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn das Haus des Grafen Aheim - das jetzige „Palais Portia“ - in der heutigen Kardinal-Faulhaber-Straße 12 zu kaufen.
8. 5 1693 - Fürstbischof Joseph Clemens gründet die Michaels-Bruderschaft
Berg am Laim * Der Kölner Kurfürst Joseph Clemens gründet die „Bruderschaft des Hl. Ertzengel und Himmelsfürsten Michael“ in der Berg am Laimer Michaelskirche der Josephsburg. Auf die Idee kam er, weil die Vorbereitungen zum 100. Jahrestag der Einweihung der Michaelskirche in der Neuhauser Gasse am 6. Juli 1697 bevorstand.
22. 5 1693 - Kurprinz Ferdinand Joseph trifft in München ein
Wien - München * Der baierische Kurprinz Ferdinand Joseph wird von Wien nach München gebracht, wo er am 22. Mai eintrifft.
8. 9 1693 - Caspar Freiherr von Schmid stirbt im Alter von 71 Jahren
Schönbrunn * Caspar Freiherr von Schmid stirbt im Alter von 71 Jahren. Er wird in der Schlosskirche der Hofmark Schönbrunn in der Familiengruft bestattet.
29. 9 1693 - Fürstbischof Joseph Clemens gründet den Michaels-Ritterorden
Berg am Laim * Der Kölner Kurfürst Joseph Clemens gründet einen Ritterorden mit dem Titel „Hl. Ertzengel Michael, Beschützer der göttlichen Ehre“ in der Berg am Laimer Michaelskirche der Josephsburg. Er will damit den apostolischen Stuhl in Rom in der Auseinandersetzung um den Lütticher Bischofssitz wohlgesonnen stimmen.
23. 10 1693 - Pater Onuphrius lernt die Eremiten vom seligen Petrus von Pisa kennen
Pisa * Pater Onuphrius hat inzwischen auf einer Romreise die Eremiten vom seligen Petrus von Pisa kennengelernt, die sich die „Armen Eremiten des heiligen Hieronymus“ nennen. An diesem Tag werden die inzwischen vierzehn Einsiedler vom Walchensee in diesen Orden aufgenommen.
Die Hieronymiten tragen einen schwarzen Habit mit Gürtel und hohem Kragen, mit Kapuze und Birett. Die Vereinigung ist den Bettelorden angeglichen worden und führt ein strenges Leben, allerdings ohne auf die ausgeprägte Eigenwilligkeit, die die Einsiedler zu allen Zeiten auszeichnen und der geistlichen Obrigkeit so manchen Kummer bereiten, zu verzichten.
Die Äbte von Benediktbeuern beschweren sich über die Klausner, die sich nur wenig an die Abmachungen halten. Und als die Gemeinschaft auf sechs Mitglieder zurückgeführt werden soll, versucht Pater Onuphrius nach Schönbach in Niederösterreich oder Pobenhausen bei Ingolstadt auszuweichen, was allerdings der Fürstbischof von Augsburg zu verhindern weiß.
Anno 1694 - Auf dem Mariahilfplatz werden Linden angepflanzt
Au * Auf dem Mariahilfplatz werden „zum Schutze der Andächtigen vor Regen und Sonnenbrand“ Linden gepflanzt.
1694 - In dem kleinen „Albertinischen Haus“ siedeln drei „Jungfrauen“
Au * In dem kleinen „Albertinischen Haus“ auf dem „Gaisberg“ siedeln drei „Jungfrauen“, die als Laienschwestern hier ein gottgefälliges Leben führen wollen.
1694 - Das Altargemälde „Michaels Triumpf über Lucifer“ entsteht
Berg am Laim * Das Altargemälde „Michaels Triumpf über Lucifer“ entsteht.
Es wird anno 1767 erweitert und am Hochaltar der Berg am Laimer „Michaelskirche“ eingesetzt.
Um 1694 - Das „Hofkrankenhaus“ wird an den heutigen Kolumbusplatz verlegt
Au * Das „Hofkrankenhaus für kurfürstliche Hofbedienstete“ wird von Bogenhausen an den heutigen Kolumbusplatz verlegt.
Das „Hofkrankenhaus“, mit dem großen, im Süden anschließenden Gartenanlagen, wird mehrmals erweitert.
Um 1694 - Simon Troger, Elfenbeinschnitzer, wird im Pustertal geboren
Pustertal * Simon Troger, der als Elfenbeinschnitzer bekannt gewordene Bildhauer, wird im Pustertal geboren.
18. 1 1694 - Kurfürst Joseph Clemens wird zum Koadjutor in Hildesheim
Hildesheim * Der Kölner Kurfürst Joseph Clemens wird zum Koadjutor [= Nachfolger] für den Bischof von Hildesheim gewählt.
1. 2 1694 - Der Lütticher Fürstbischof stirbt völlig unerwartet
Lüttich * Der Lütticher Fürstbischof Johann Ludwig von Elderen stirbt völlig unerwartet. Baierns Kurfürst Max Emanuel, der zu diesem Zeitpunkt Generalstatthalter der Spanischen Niederlande ist, fordert seinen Bruder Joseph Clemens auf, unter Hintansetzung „aller gemächtlichkeit, auch etwa sonst vorzustellen habender anderwerttigen erinderungen“ sofort nach Lüttich aufzubrechen, um dort persönlich in den Wahlkampf einzugreifen.
19. 3 1694 - Kurfürst Joseph Clemens und Kurfürst Max Emanuel treffen in Lüttich ein
<p><strong><em>Lüttich</em></strong> * Kölns Kurfürst Joseph Clemens und der baierische Kurfürst Max Emanuel treffen in Lüttich ein. Pfalzgraf Ludwig Anton, Koadjutor des Bistums Mainz und Hochmeister des Deutschritterordens, hat inzwischen enormen Eindruck im Lütticher Domkapitel hinterlassen. Er wird auch von Kaiser Leopold I. gefördert.</p>
19. 4 1694 - Bestechungsgelder erleichtern die Abstimmung
<p><strong><em>Lüttich</em></strong> * Am Vorabend der Wahl zum Bischof von Lüttich zählt die<em> „baierische Partei“</em> 24 Stimmen. Das sind zwei Stimmen mehr als die <em>„pfälzische Partei“</em> hat. Kurfürst Max Emanuel hatte seinem Unterhändler die Order gegeben, Parteigängern seines Bruders zu <em>„beliebiger Summe zu kaufen“</em>.</p>
20. 4 1694 - Kurfürst Joseph Clemens zum neuen Lütticher Bischof gewählt
<p><strong><em>Lüttich</em></strong> * Unmittelbar vor Beginn der Bischofswahl ziehen die für Pfalzgraf Ludwig Anton eingestellten kirchlichen Würdenträger aus dem Kapitelsaal aus. Die <em>„baierische Partei“</em> wählt daraufhin Kurfürst Joseph Clemens zum neuen Lütticher Bischof.</p>
21. 4 1694 - Die „pfälzische Partei“ wählt ihren Kandidaten Ludwig Anton
Lüttich * In einem eigenen Wahlakt wählt die „pfälzische Partei“ ihren Kandidaten Ludwig Anton.
4. 5 1694 - Joseph Clemens erhält das Amt des Fürstbischofs von Lüttich
Lüttich * Pfalzgraf Ludwig Anton stirbt an einer in Lüttich grassierenden Seuche. Damit ist der Pfalzgraf als Konkurrent um das Bistum Lüttich ausgeschieden. Papst Innozenz XII.kann dadurch Kurfürst Joseph Clemens - ohne auf die Vorgänge der Wahl eingehen zu müssen und ohne Stellung zu Fragen der besseren Legitimität des baierischen Bewerbers zu nehmen - das Amt des Fürstbischofs von Lüttich übertragen.
Um sich nicht dem Vorwurf der Nachgiebigkeit gegenüber dem Haus Baiern und der Parteilichkeit aussetzen zu müssen, entzieht Papst Innozenz XII. daraufhin Bischof Joseph Clemens die Bistümer Freising und Regensburg, indem er sie für „vakant“ erklärt und die dortigen Domkapitel zur Wahl eines neuen Bischofs auffordert. In Erinnerung an die Reformbeschlüsse des Konzils von Trient, welche die Anhäufung von geistlichen Pfründen als „unerträglichen Missstand“ brandmarkten, sieht sich der Papst zum Handeln gezwungen.
Um den Besitzstand des 22-jährigen Kurfürsten ein wenig zu beschneiden, greift der Papst zum Mittel der Einziehung der eher unbedeutenden Bistümer Freising und Regensburg. Gleichzeitig sichert er ihm aber die Nachfolge in Hildesheim zu.
19. 5 1694 - Ein Ehevertrag wird unterschrieben
München * Der Ehevertrag über die Vermählung Kurfürst Max Emanuels mit der polnischen Prinzessin Therese Kunigunde wird unterzeichnet.
19. 8 1694 - Die Prokuravermählung des baierischen Kurfürstenpaares
Warschau * Die Prokuravermählung zwischen Baierns Kurfürsten Max Emanuel und der polnischen Prinzessin Therese Kunigunde findet in Warschau statt.
1695 - Die „Jungfrauen vom Gaisberg“ erhalten Garten und Kapelle zum Geschenk
Au * Sebastian und Agathe Gaißreitter überlassen den drei „Jungfrauen vom Gaisberg“ ihren Garten und die Kapelle schenkungsweise.
Damit ist der Weg zum Bau eines richtigen Klosters frei.
1695 - Der dreibändige Kommentar zum kurbaierischen Rechtswesen erscheint
München * Der dreibändige Kommentar zum kurbaierischen Rechtswesen und eine Historia des 17. Jahrhunderts des verstorbenen „Altkanzlers“ Caspar von Schmid erscheint.
2. 1 1695 - Kurfürstin Therese Kunigunde zieht in Brüssel ein
Brüssel * Kurfürstin Therese Kunigunde zieht in Brüssel ein.
12. 1 1695 - Max Emanuel heiratet Therese Kunigunde
Wesel am Rhein * Kurfürst Max Emanuel heiratet in Wesel am Rhein die polnische Königstochter Therese Kunigunde.
17. 2 1695 - Joseph Clemens zum zweiten Mal zum Regensburger Bischof gewählt
Regensburg * Das Domkapitel in Regensburg wählt Joseph Clemens zum zweiten Mal zu ihrem Bischof. Papst Innozenz XII. überträgt ihm daraufhin das Bistum, verbindet es aber mit einer Klausel, wonach er bei einem Regierungsantritt in Hildesheim endgültig auf das Bistum Regensburg verzichten muss.
2. 9 1695 - Baierische Truppen im Krieg gegen Frankreich am Rhein
Namur * Kurfürst Max Emanuel beteiligt sich mit den baierischen Truppen im Krieg gegen Frankreich am Rhein an der Eroberung von Namur.
1696 - Baugenehmigung für ein „Kloster am Gaisberg“
Au * Johann Maximilian von Alberti holt beim Freisinger Bischof die Baugenehmigung für ein „Kloster am Gaisberg“ ein, erwirbt den noch notwendigen Baugrund und lässt einen Garten anlegen.
1696 - Fortunatus Hueber wird „Präses der Michaels-Bruderschaft“
Berg am Laim * Der angesehene „Franziskaner-Pater“ Fortunatus Hueber übernimmt die Funktion des „Präses der Michaels-Bruderschaft“, verfasst das „Bruderschaftsbüchlein“ und schafft es, dass sich die „Michaels-Bruderschaft“ so schnell ausbreiten kann, dass ihr anno 1696 bereits 60.000 Menschen angehörten.
Der „Franziskaner-Ordensmann“ erzählt dabei so eindringlich von seiner Errettung durch den „Erzengel Michael“ aus türkischer Gefangenschaft im Jahr 1687 und dass ihn - zwei Tage vor der Gründung der „Bruderschaft“ - der „heilige Michael“ im Traum erschien und ihn von den seine Person bedrängenden bösen Geister befreite.
Das kommt gut an.
„Fürstbischof“ Joseph Clemens will ursprünglich zwölf Pater an die „Josephsburg“ setzen und dort ein „Hospitium“ zur Besorgung der „Bruderschaft“ bauen lassen.
Seine Flucht anno 1704, seiner langer Aufenthalt in Frankreich und schließlich sein Tod im Jahr 1723 verhinderten dies jedoch.
1696 - Veräußerungsverbot der „Jurisdiktion“ und des „Scharwerks“
München - Haidhausen * Einen kurfürstlicher Erlass verfügt, dass in einer Entfernung von vier bis fünf Meilen um die Hauptstadt keine weitere „Jurisdiktion“ und kein „Scharwerk“ veräußert werden darf und die bereits veräußerten wieder einzuziehen sind.
Dies trifft freilich auch auf die „Hofmark Haidhausen“ zu.
1696 - Im vierten Schritt wird aus dem „Lehen“ das „Lehel“
München-Lehel * Der vierte Schritt, vom „Lehen“ zum „Lehel“ vollzieht sich in einem Steuerbuch aus dem Jahr 1696.
Dort hieß es: „Auf dem Lehel in gemainer Statt München Burgfridt entlegene und sich befindende Inwohner“.
8. 5 1696 - Joseph Clemens gründet in Lüttich eine Michaels-Bruderschaft
Lüttich * Kurfürst Joseph Clemens gründet in Lüttich eine weitere Michaels-Bruderschaft.
22. 7 1696 - Ein kurfürstliches Mandat gegen das Kammerfensterln
München * Mit einem kurfürstlichen Mandat des Kurfürsten Max Emanuel wird sogar das Kammerfensterln verboten.
14. 9 1696 - Ein Testament zu Gunsten des baierischen Kurprinzen Ferdinand Joseph
Madrid * König Carl II. von Spanien regelt in seinem Testament die Erbfolge. Trotz Geheimhaltung sickert durch, dass es zu Gunsten des baierischen Kurprinzen Joseph Ferdinand lautet. Spanien hat bis zu diesem Zeitpunkt immer am Prinzip der Unteilbarkeit der spanischen Monarchie festgehalten. Prinz Joseph Ferdinand von Baiern hat im Stammbaum - als Urenkel des spanischen Königs Philipp IV. und Maria Anna von Österreich - den höchsten Anteil spanisch-habsburgischen Blutes.
Doch auch Österreich schiebt einen Universalerben für den spanischen Thron vor: Erzherzog Carl, den jüngsten, im Jahr 1685 geborenen Sohn Kaiser Leopolds I. aus dessen dritter Ehe.
1697 - Der Bogenhausener Adelssitz kommt an Johann Antonio Gumpp
Bogenhausen * Der aus dem Bogenhausener „Kögelhof“ entstandene Adelssitz „Neuberghausen“ kommt unter die Fittiche des „Hofmalers“ Johann Antonio Gumpp.
1697 - Ein Gremium, das sich mit der „Modifizierung des Kalenders“ befasst
Wien * Kaiser Leopold I. richtet ein Gremium ein, das sich mit der „Modifizierung des Kalenders“ befassen und einen im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ gültigen Kalender berechnen soll.
1697 - Kurfürst Joseph Clemens kann nach 9 Jahren endlich in Köln einziehen
Versailles - Köln * Nach dem „Frieden von Rijswijk“ versucht Ludwig XIV. die nicht im Kriegsverlauf für Frankreich eroberten Gebiete durch „Subsidienzahlungen“ an sich zu binden.
Auch „Kurköln“ und Kurfürst Joseph Clemens erhalten Gelder, die den Wiederaufbau der zerstörten Residenzen ermöglichen sollen.
Außerdem kann Kölns Kurfürst Joseph Clemens nach neun Jahren endlich in Köln einziehen und in Bonn seine Residenz nehmen.
16. 2 1697 - Franz Pongraz von Leiblfing stirbt
München-Graggenau * Reichsgraf Franz Pongraz von Leiblfing, der Haidhauser Hofmarkherr, wird im Franziskaner-Friedhof beerdigt.
6. 8 1697 - Kurprinz Carl Albrecht wird in Brüssel geboren
Brüssel * Carl Albrecht, der spätere baierische Kurfürst und nachmalige Kaiser Carl VII. Albrecht, wird in Brüssel geboren.
9 1697 - Paulus von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn kauft die „Hofmark Haidhausen“
Haidhausen * Die Erben des Freiherrn Franz Pongraz von Leiblfing verkaufen die „Hofmark Haidhausen“ an den „Obristhofmeister“ Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn.
15. 9 1697 - August der Starke wird polnischer König
Krakau * Der wettnische Kurfürst von Sachsen, August der Starke, erhält die polnische Königskrone.
1698 - Eine neue „Fasanerie“ entsteht auch in der „Hirschau“
Moosach - Hirschau - Perlach * Kurfürst Max Emanuel lässt die „Fasanerie“ in Moosach ausbauen und weitere in der „Hirschau“ und bei Perlach anlegen.
1 1698 - Der baierische Kurprinz Ferdinand Joseph erkrankt schwer
München * Der baierische Kurprinz Ferdinand Joseph erkrankt schwer.
24. 5 1698 - Kurprinz Ferdinand Joseph wird nach Brüssel gebracht
Wien - Brüssel * Der baierische Kurprinz Ferdinand Joseph wird nach Brüssel gebracht, wo er am 24. Mai eintrifft.
Ab 8 1698 - Die Haidhauser „Sankt-Johannes-Baptist-Kirche“ wird umgebaut
Haidhausen * Die Haidhauser „Sankt-Johannes-Baptist-Kirche“ wird umgebaut.
Die Arbeiten dauern bis 1700 an.
24. 9 1698 - Frankreich und England einigen sich auf einen Teilungsplan
Versailles - London * In einem Geheimvertrag einigen sich Frankreichs König Ludwig XIV. und Englands König Wilhelm III. von Oranien auf einen Teilungsplan. Demnach soll Kurprinz Joseph Ferdinand von Baiern Spanien und Südamerika erhalten, während die italienischen Besitzungen unter Frankreich und Österreich aufgeteilt werden sollen.
Eine Indiskretion lässt die Abmachung in Madrid und Wien bekannt werden, was in der Folge einen Sturm der Entrüstung auslöst.
11. 11 1698 - König Carl II. von Spanien ernennt Joseph Ferdinand zum Alleinerben
Madrid * König Carl II. von Spanien ernennt den sechsjährigen baierischen Kurprinzen Joseph Ferdinand zum „Prinzen von Asturien“ und damit zum alleinigen Erben der spanischen Monarchie.
Nun gibt sich der baierische Kurfürst Max Emanuel, der inzwischen Therese Kunigunde, die Tochter seines ehemaligen Waffengefährten, des polnischen Königs Johann III. Sobieski, geheiratet und im Mai 1698 seinen Sohn nach Brüssel hat bringen lassen, zu weiteren hochfliegenden Zukunftsträumen hin.
Wenn er großzügig den Besitz des Gesamthauses Wittelsbach zusammen zählt, dann sind die großen europäischen Dynastien überflügelt: Baiern, Spanien, beide Indien, Niederlande, Mailand, Neapel, Sizilien in einer Hand - Schweden, Kurpfalz, Jülich und Berg, Neuburg, Köln, Lüttich und Berchtesgaden sind von Verwandten besetzt.
Das Testament des spanischen Königs stößt aber auf den Widerstand von Frankreich und Österreich. Damit kann die politische Zukunft für den Thronfolger keineswegs als gesichert angesehen werden.
1699 - Die Familie Ridler erhält die „Niedergerichtsbarkeit“ für das „Ridlerschlößl“
Haidhausen * Die Familie Ridler erhält die „Edelmannsfreiheit“ genannte „Niedergerichtsbarkeit“ für das „Ridlerschlößl“ in Haidhausen.
1699 - Am „Gaisberg“ entsteht eine aufwändige Klosteranlage
Au * Am „Gaisberg“ entsteht eine aufwändige Klosteranlage mit zentraler Kapelle und zwei Seitenflügeln, die mit ihren Terrassen und Gärten eher einem noblen Schloss als der Niederlassung von geistlichen und der Armut verpflicheten Schwestern gleicht.
Anno 1699 - Noch immer befinden sich zehn „Hieronymiten“ am Walchensee
Walchensee * Noch immer befinden sich zehn „Einsiedler-Brüder der Hieronymitaner“ am Walchensee.
15. 1 1699 - Kurprinz Ferdinand Joseph erkrankt erneut
Brüssel * Kurprinz Ferdinand Joseph erkrankt erneut schwer.
24. 1 1699 - Der Gesundheitszustand des Kurprinzen verschlechtert sich
München * Der Gesundheitszustand des baierischen Kurprinzen Ferdinand Joseph verschlechtert sich.
26. 1 1699 - Die Türkenkriege enden im Frieden von Karlowitz
Karlowitz * Mit dem Frieden von Karlowitz endet der Große Türkenkrieg.
6. 2 1699 - Kurprinz Ferdinand Joseph stirbt im Alter von sechs Jahren
Brüssel * Kurprinz Ferdinand Joseph stirbt in Brüssel im Alter von sechs Jahren.
9. 2 1699 - Kurprinz Joseph Ferdinand findet in Brüssel seine letzte Ruhestätte
<p><strong><em>Brüssel</em></strong> * Der baierische Kurprinz Joseph Ferdinand findet in der Kirche Ste-Gudule in Brüssel seine letzte Ruhestätte. </p>
10. 7 1699 - Kurfürst Max Emanuel verzichtet auf sein Einlösungsrecht
Haidhausen * Kurfürst Max Emanuel verzichtet in einem Dekret zugunsten des Grafen Paulus von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn - „auf dessen Lebenszeit“ - auf sein Einlösungsrecht der Hofmark Haidhausen.
23. 9 1699 - Die protestantischen Stände übernehmen den Gregorianischen Kalender
Regensburg • Die protestantischen Stände beschließen in Regensburg die Annahme eines „verbesserten Kalenders“, eben den Gregorianischen Kalender, der in den katholischen Gebieten schon lange eingeführt ist. Damit endet ein 117 Jahre andauernder Streit.
Um 1700 - Eine „Pflegeanstalt für bresthafte Frauen“
Bogenhausen * Das „Militärwaisenhaus und -lazarett“ wird in eine „Pflegeanstalt für bresthafte Frauen“ umgewandelt.
Um 1700 - Jeder 8. Münchner ist „Sodale“ einer „Marianischen Kongregation“
München * Jeder achte Münchner ist „Sodale“ [Mitglied] einer der sechs Münchner „Marianischen Kongregationen“.
Sie nehmen großen Einfluss auf die Stärkung und Förderung des katholischen Lebens in der Stadt.
Jeder der „Kongregation“ neu beitretende „Sodale“ hat nach Ablegung seiner „Lebensbeichte“ sich in einem feierlichen Weiheakt seiner Patronin zu lebenslangem Dienst zu verpflichten.
Er hat häufig beim jesuitischen Beichtvater seine Sünden darzulegen, muss täglich Gewissensforschung betreiben, hat ein geregeltes Gebetsleben einzuhalten und strenge Bußübungen - vor allem an Kartagen - zu vollziehen.
Zum regelmäßigen Besuch der Konvente und der Lektion frommer Schriften gehört auch der gemeinsame Empfang der Kommunion.
Das demonstrative öffentliche Auftreten bei Prozessionen und Wallfahrten, sowie bei prunkvollen Festgottesdiensten und Theateraufführungen „zur höheren Ehre Gottes und der allerseligsten Jungfrau“ gehören ebenso zur selbstverständlichen Pflicht des „Sodalen“ wie die, seinen Mitbrüdern im Leben und Sterben beizustehen und sie auf ihrem letzten Gang zu begleiten.
1700 - München hat 24.000 Einwohner
München * München hat 24.000 Einwohner.
18. 2 1700 - Mit der Kalenderumstellung ist die einheitliche Tageszählung erreicht
Deutschland * Auf den protestantischen Gebieten folgt auf den 18. Februar der 1. März 1700. Damit ist die einheitliche Tageszählung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation endgültig wieder erreicht. Bis zur Kalenderumstellung in den protestantischen Ländern werden alle Dokumente mit zwei Daten versehen.
14. 7 1700 - Der Hofrat will alle Hurerey- und Gaukelhäuser ausrotten
München - Haidhausen - Au * Ein Befehl des Hofrats fordert dazu auf, bei „behöriger Straff“ endlich alle „Hurerey- und Gaukelhäuser auszurotten“. Doch die Hopfengärten rings um die Stadt, die finsteren Bögen an der Südseite des Marktplatzes, die Ziegelöfen in Haidhausen und die Herbergen in der Au sind beliebte Liebesnester und Schlupflöcher vagierender Mädchen.
An den genannten Plätzen werden immer wieder sogenannte „Schrannenmentscher“ aufgegriffen.
8 1700 - Viscardi beginnt den Bau der Wallfahrtskirche Maria Hilf
Freystadt * Giovanni Antonio Viscardi beginnt mit dem Bau einer neuen Wallfahrtskirche Maria Hilf in Ferdinand Franz Lorenz Xaver von Tilly zu Breiteneggs Herrschaft Freystadt in der Oberpfalz.
17. 8 1700 - Clemens August, der spätere Kurfürst von Köln, wird in Brüssel geboren
Brüssel * Clemens August Maria Hyazinth von Baiern, der spätere Kurfürst von Köln und Inhaber mehrerer Bistümer, wird als vierter Sohn des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern in Brüssel geboren, wo sein Vater Statthalter der Spanischen Niederlande ist.
2. 10 1700 - König Carl II. von Spanien fasst ein neues Testament ab
Madrid * Eine weitere Verschlechterung seines Gesundheitszustandes zwingt den 39-jährigen König Carl II. von Spanien zur Abfassung eines neuen Testaments. Er vermacht darin sein gesamtes Vermögen an Herzog Philipp von Anjou, dem zweitältesten Enkel des Franzosenkönigs Ludwig XIV..
Da der ebenfalls aus dem Hause Habsburg stammende Kaiser Leopold I. Teile des spanischen Weltreichs für sich und seine Familie beansprucht, wird es im Mai 1701 zum sogenannten Spanischen Erbfolgekrieg kommen.
1. 11 1700 - König Carl II. stirbt in Madrid ohne Nachkommen
Madrid * König Carl II., der letzte spanische Habsburger, stirbt in Madrid ohne Nachkommen.
2. 11 1700 - Das Testament des spanischen Königs Carl II. wird eröffnet
Madrid - Versailles * Das Testament des spanischen Königs Carl II. wird eröffnet. Er vermacht darin die gesamte spanische Monarchie an Herzog Philipp von Anjou, dem zweitältesten Enkel des Franzosenkönigs Ludwig XIV.. Ludwig XIV. stellt daraufhin sofort seine bislang verfolgten Teilungsabsichten hinten an und unterstützt seinen Enkelsohn, der schon im Februar 1701 in Madrid einziehen kann.
Die Seemächte akzeptieren Philipp V. als spanischen König nicht - und Kaiser Leopold I. lehnt das Testament aus grundsätzlichen Erwägungen ab, da es faktisch den deutschen Zweig der Familie enterben würde.
2. 11 1700 - Kurfürst Max Emanuel befindet sich in einem Dilemma
Brüssel - München * Baierns Kurfürst Max Emanuel befindet sich nun in einem Dilemma.
- Der neue spanische König ist zwar sein Neffe, aber wie sollte er sich als Statthalter der spanischen Niederlande gegenüber einem König verhalten, der von mehreren Seiten nicht anerkannt wird?
- Wie soll er sich mit seinen bisherigen Waffenbrüdern verständigen?
- Und vor allem, wie kann er in dieser Situation noch das Maximalste herausholen?
Um seinen Wünschen nach Rangerhöhung doch noch ein Stück näher zu kommen, bereitet der baierische Kurfürst einen Bündniswechsel in Richtung Frankreich vor.
Bis zum Jahr 1701 - Noch mindestens 100 Personen im Verdacht der „Hexerei“
München * In München geraten bis zum Jahr 1701 noch mindestens einhundert Personen in den Verdacht der „Hexerei“.
Mindestens 55 von ihnen erhalten Strafen, die unterhalb der „Todesstrafe“ lagen, hingerichtet werden etwas mehr als zehn.
18. 1 1701 - Kurfürst Friedrich III. wird preußischer König
Königsberg * Der hohenzollerische Kurfürst von Brandenburg , Friedrich III., erhält die Königskrone für Preußen.
27. 1 1701 - Den Paulanern sollen die pfarrlichen Rechte am Gaisberg zustehen
Freising * Der Geistige Rat in Freising beschließt, dass den Paulanern die pfarrlichen Rechte am Gaisberg zustehen. Dagegen wehrt sich Johann Maximilian von Alberti.
13. 2 1701 - Kurköln und Frankreich schließen einen Allianzvertrag
<p><strong><em>Köln</em></strong><em> * </em>Kurköln unter Kurfürst Joseph Clemens schließt mit Frankreich einen Allianzvertrag, der Kölns <em>„bewaffnete Neutralität“ </em>beinhaltet. Die Folgen sind verheerend: Das Erzstift Köln wird zum ersten Kriegsschauplatz im Spanischen Erbfolgekrieg. </p>
18. 2 1701 - König Philipp V. nimmt Besitz vom spanischen Thron
Madrid * Philipp von Anjou, der Enkelsohn des französischen Königs Ludwig XIV., zieht als König Philipp V. in Madrid ein und nimmt Besitz vom spanischen Thron.
9. 3 1701 - Kurfürst Max Emanuel schließt mit Frankreich eine Allianz
Versailles * Frankreich und Baiern unterzeichnen einen „Bündnisvertrag zur Sicherung der Neutralität Süddeutschlands“. Baierns Kurfürst Max Emanuel sieht nach dem Tod seines Sohnes Joseph Ferdinand eine neue Chance, durch eine geschickte Bündnispolitik dem Hause Wittelsbach.
7. 4 1701 - Kurfürst Max Emanuel kehrt aus Brüssel nach München zurück
Brüssel - München * Kurfürst Max Emanuel kehrt aus Brüssel nach München zurück.
27. 4 1701 - Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn stirbt in München
Haidhausen * Paulus Graf von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn, der „Hofmarkherr“ von Haidhausen, „Reichshofrat“ und „kurbaierischer Obersthofmeister“, stirbt in München.
Er wird in der Pfarrkirche von Mickhausen begraben.
Die „Hofmark Haidhausen“ erbt seine Ehefrau Anna Maria Katherina de Saint German, eine verwitwete Gräfin Törring-Seefeld.
Anfang 5 1701 - Kurfürstin Therese Kunigunde kehrt nach München zurück
München * Die Kurfürstin Therese Kunigunde und der "Hofstaat" kehren ebenfalls nach München zurück.
7. 9 1701 - In Den Haag wird die Haager Große Allianz gegründet
Den Haag * England, die Vereinigten Niederlande und Österreich schließen sich in Den Haag zur Haager Großen Allianz gegen Frankreich und Spanien zusammen. Die ungeschickte und aggressive Politik von Frankreichs König Ludwig XIV. führten zu diesem Zusammenschluss.
17. 9 1701 - Die 17-jährige Maria Theresia Käser wird als Hexe hingerichtet
München * Die 17-jährige Wachtmeisterstocher Maria Theresia Käser aus Pfaffenhofen als Hexe auf der Richtstatt enthauptet und ihr geschundener Körper anschließend verbrannt.
Maria Käser wird früh elternlos und ist auf Betteln und Stehlen angewiesen. Das armselige und heruntergekommene Mädchen ist aufgrund ihrer niedrigen sozialen Stellung zur Hexe geradezu geboren. Die junge Frau wird von einem verschmähten Liebhaber der Hexerei bezichtigt. Unter der Folter gesteht sie, am Hexensabbat teilgenommen, sich dem Teufel mit „Leib und Seele“ ergeben sowie ihr Amulett und einen geweihten Gürtel mit Füßen getreten zu haben.
22. 10 1701 - Amalia Maria Josepha Anna wird in Wien geboren
Wien * Die Kaisertochter und spätere baierische Kurfürstin sowie Kaiserin Amalia Maria Josepha Anna wird in Wien geboren.
1702 - Die „Rekrutierungsverfahren“ werden verschärft
München * Die „Rekrutierungsverfahren“ zur Gewinnung von Soldatennachwuchs werden verschärft.
Sogar der „Hofkriegsrat“ stellt in einem Gutachten fest, dass das Verfahren negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Steuerkraft des Landes haben wird.
Die kurbaierischen „Zwangsaushebungen“ unterscheiden sich kaum von den „Zwangsrekrutierungen“ der österreichischen „Kaiserlichen Administration“ im Jahr 1705.
1702 - Kurfürst Joseph Clemens erhält die „Bischofswürde“ des Bistums Hildesheim
Hildesheim * Kurfürst Joseph Clemens erhält die „Bischofswürde“ über das Bistum Hildesheim übertragen.
15. 2 1702 - Die „Haager Große Allianz“ erklärt Frankreich und Spanien den Krieg
Den Haag - Wien - London - Paris - Madrid - München - Köln * Die „Haager Große Allianz“ erklärt Frankreich und Spanien den Krieg.
25. 3 1702 - Die Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria wird eröffnet
München-Burgfrieden * Die Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria am Gaisberg wird eröffnet.
6. 6 1702 - Die erste Messe in der Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria
Au * In der Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria am Gaisberg (Lilienberg) wird die erste Heilige Messe gefeiert.
18. 8 1702 - Kurfürst Max Emanuel unterzeichnet den Bündnisvertrag mit Frankreich
München - Versailles * Kurfürst Max Emanuel und seine Berater treffen die Entscheidung für die Unterzeichnung des Bündnisvertrages mit Frankreichs König Ludwig XIV..
1. 9 1702 - Kurfürst Max Emanuel erneuert sein Bündnis mit Frankreich
München - Versailles * Kurfürst Max Emanuel erneuert sein Bündnis mit Frankreich. König Ludwig XIV. verspricht ihm für die aktive Kriegsteilnahme territoriale Gewinne und die mögliche Anerkennung der Königswürde.
8. 9 1702 - Mit dem Überfall auf Ulm beginnt der Spanische Erbfolgekrieg
Ulm * Mit dem Überfall auf die Reichsstadt Ulm beginnt die militärische Aggression Max Emanuels. Damit beginnt der Spanische Erbfolgekrieg zwischen Frankreich und Österreich. Der baierische Kurfürst Max Emanuel steht gemeinsam mit seinem Bruder Joseph Clemens, dem Kurfürsten von Köln, als einzige Reichsfürsten auf der Seite der Franzosen.
30. 9 1702 - Der Reichskrieg gegen Frankreich wird beschlossen
Regensburg * Der Reichskrieg gegen Frankreich und seinen Verbündeten - also auch Baiern - wird im Reichstag in Regensburg beschlossen. Das Kurfürstentum Baiern ist nun von allen Seiten von Feinden umgeben.
10 1702 - Baierische Truppen erobern Memmingen, Lauingen und Dillingen
Memmingen - Lauingen - Dillingen * Die "Reichsstädte" Memmingen, Lauingen und Dillingen werden von den baierischen Truppen eingenommen.
11 1702 - Kaiserliche Truppen marschieren in der Oberpfalz ein
Oberpfalz * Kaiserliche Truppen marschieren in der Oberpfalz ein.
1 1703 - Angriffe der „Kaiserlichen Armee
Wien - Kurfürstentum Baiern * Beginn der konzentrierten Angriffe der „Kaiserlichen Armee" gegen Baiern.
2 1703 - Baierische Truppen überfallen die „Reichsstadt
Neuburg an der Donau * Baierische Truppen unter Führung des Kurfürsten Max Emanuel überfallen die „Reichsstadt" Neuburg an der Donau.
15. 3 1703 - Bonn muss sich den Truppen von John Churchill ergeben
Bonn * Die kurkölnische Haupt- und Residenzstadt Bonn muss sich den Truppen von John Churchill, dem Herzog von Marlborough ergeben.
8. 4 1703 - Baierische Truppen besetzen Regensburg
<p><strong><em>Regensburg</em></strong> * Baierische Truppen unter Führung des Kurfürsten Max Emanuel besetzen die Reichsstadt Regensburg.</p>
6 1703 - Die baierische Armee überschreitet bei Kufstein die Grenze nach Tirol
Kufstein * Kurfürst Max Emanuel und seine Armee überschreiten bei Kufstein die Grenze nach Tirol.
7 1703 - Die Tiroler erheben sich gegen die Besetzung durch die baierische Armee
Kufstein - Mittenwald * Im Juli und August 1703 erhebt sich das Volk gegen die Besetzung durch die baierische Armee.
Max Emanuel und seine Truppen ziehen sich rasch über Mittenwald zurück.
2. 7 1703 - Baierischen Truppe besetzen die Reichsstadt Innsbruck
Innsbruck * Die baierischen Truppen unter Führung des Kurfürsten Max Emanuel besetzen die Reichsstadt Innsbruck.
4. 9 1703 - Baierische Truppen besetzen die Reichsstadt Augsburg
Augsburg * Baierische Truppen unter der Führung ihres Kurfürsten Max Emanuel besetzen die Reichsstadt Augsburg.
20. 9 1703 - Baierisch-französische Truppen besiegen die Kaiserliche Armee
Höchstädt * Baierisch-französische Truppen besiegen bei Höchstädt die Kaiserliche Armee.
31. 12 1703 - Ein Sechstel München gehört der Kirche
München * Eine im Jahr 1703 von den städtischen Behörden erstellte Untersuchung über den Anteil der Kirchen und Klöster auf dem Stadtgebiet hat ergeben, dass von den 237,5 Tagwerk Grund und Boden innerhalb der Stadtumwallung Münchens 38,375 Tagwerk - oder ein Sechstel - kirchlichen Einrichtungen gehören.
1704 - Gräfin Adelheid Felicitas von Törring-Seefeld kauft „Schloss Neuberghausen“
Bogenhausen * In Geldnot verkauft Johann Antonio Gumpp das Bogenhausener „Schloss Neuberghausen“ an die Gräfin Adelheid Felicitas von Törring-Seefeld.
1704 - „Kloster Lilienthal“ wird von zwei Nonnen bezogen
Au * Zwei „Jungfrauen vom Kloster am Lilienberg“ beziehen unten im Tal ein Haus mit Garten.
Ihrer Ansiedelung geben sie den Namen „Kloster Lilienthal“.
1704 - Ein französischer Schauspieler ist der erste Münchner „Kaffeesieder“
München * Ein französischer Schauspieler, genannt Brieder, ist der erste Münchner „Kaffeesieder“.
1704 - Die Visionen der Maria Anna Lindmayr
München * Maria Anna Lindmayr leidet an rätselhaften Krankheiten und hat immer wieder religiöse Visionen, die sich mit dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges verstärken. Im Jahr 1704 erreichen die Visionen ihren vorläufigen Höhepunkt.
Die Lindmayr spricht nun von einem „kommenden Strafgericht“, wenn sich die Menschen, allen voran der kurfürstliche Hof, nicht bessern und bekehren würden.
9. 1 1704 - Die Stadt Passau kapituliert vor den baierischen Truppen
Passau * Die Stadt Passau kapituliert vor den baierischen Truppen. Anschließend fällt die Baiern-Armee in Oberösterreich ein.
12. 2 1704 - Der Prinzentod als göttliche Strafe
München * Als Wilhelm, einer der kurfürstlichen Prinzen im Alter von zweieinhalb Jahren stirbt, sieht die „fromme Jungfer Marianndl“ [= Maria Anna Lindmayr] darin die göttliche Strafe für das höfische Faschingstreiben.
18. 5 1704 - Wildeste Gerüchte verbreiten sich in der Stadt
München * Durch die Visionen und Prophezeiungen der Maria Anna Lindmayr verbreiteten sich bald in der ganzen Stadt die wildesten Gerüchte. Die - berechtigten - Ängste der Bevölkerung vor einem drohenden Krieg und den daraus resultierenden Auswirkungen führen noch am Dreifaltigkeitstag, am 18. Mai, zu einem Volksauflauf.
Der Kurfürstliche Geheime Rat lässt daraufhin die Prediger anweisen, sie sollen gegen die „Ausstreuungen einer gewissen Person“ vorgehen und die Bevölkerung zu „Buße, Tugend und Frömmigkeit“ anhalten.
Die „fromme Marianndl“ wendet sich nun an den Freisinger Fürstbischof Franz von Eckher von Kapfenberg und Lichteneck, der sie von einer „Kommission hochangesehener Geistlicher“ untersuchen lässt. Die Kommission stellt in ihrem Gutachten fest, dass die Lindmayr „in etlich sachen eine mehr als natürliche erkandnuß“ habe.
War die Lindmayrin zuvor in der Stadt noch umstritten, so ist nun die Mehrheit von der Mystikerin überzeugt. Maria Anna Lindmayr ist sich sicher, dass Gott die schlimmsten Gefahren nur dann von der Stadt abwende, wenn man ihm eine „Kirche zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit“ geloben würde. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, erklärt sie, dass ihr dies schon mehrmals geoffenbart worden sei.
20. 5 1704 - Der Marsch in Richtung Süddeutschland beginnt
Bedburg * John Churchill, Herzog von Marlborough, tritt von Bedburg - nahe Köln - den Marsch in Richtung Süddeutschland an.
2. 7 1704 - Prinz Eugen und der Herzog Marlborough von erobern den
Donauwörth * Die Truppen des Prinzen Eugen von Savoyen und Herzog John Churchill von Marlborough erobern den Schellenberg bei Donauwörth.
17. 7 1704 - Ein Gelöbnis zur Abwehr der Zerstörung Münchens
München * Die drei Stände - Adel, Klerus und die Bürgerschaft Münchens - legen in der Frauenkirche ein „Gelöbnis zur Abwehr der Zerstörung Münchens im Spanischen Erbfolgekrieg“ ab.
Die Vision der Maria Anna Lindmayr, wonach Gott die schlimmsten Gefahren nur dann von der Stadt abwende würde, wenn man ihm eine „Kirche zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit“ baut, wird im „Gelübde der drei Stände“ nicht einmal erwähnt.
3. 8 1704 - Das Gelöbnis von Straubing
Straubing * In Straubing wird - wenige Tage nach dem Münchner Gelöbnis - ein „Gelübde zur Abwehr der Belagerung durch die Habsburger“ abgelegt. Daraus entsteht 1709 eine Dreifaltigkeitssäule.
13. 8 1704 - Vernichtende Niederlage in der Schlacht von Höchstädt
Höchstädt * Es kommt zur Schlacht von Höchstädt, die mit der vernichtenden Niederlage der französisch-baierischen Armee durch die kaiserlichen Truppen endet. Baiern wird aufgegeben. Die französischen Truppen ziehen sich zurück.
- Kurfürst Max Emanuel flieht nach Frankreich.
- Kurfürst Joseph Clemens hält sich in Lille auf.
17. 8 1704 - Therese Kunigunde wird Regentin des Kurfürstentums Baiern
München * Nachdem Kurfürst Max Emanuel die Schlacht von Höchstädt verloren hat, tritt er seinen Rückzug auf das linke Rheinufer an. Die Regentschaft über das Kurfürstentum Baiern überträgt Max Emanuel seiner Gemahlin Therese Kunigunde.
7. 11 1704 - Der Waffenstillstandsvertrag von Ilbesheim
Ilbesheim * Therese Kunigunde, seit 17. August 1704 Regentin Baierns, schließt mit Kaiser Leopold I. den Waffenstillstandsvertrag von Ilbesheim, durch den Baiern aus dem Spanischen Erbfolgekrieg ausscheidet. Der Kurfürstin verbleibt der größte Teil des Rentamtes München. Das gesamte restliche Kurfürstentum wird von der habsburgischen Kaisermacht besetzt.
Außerdem beinhaltet der Ilbesheimer Vertrag
- die Auflösung des baierischen Heeres mit Ausnahme einer 400 Mann starken Garde,
- die Übergabe der Festungen an die Kaiserlichen sowie
- die Verpflichtung der Kurfürstin „gegen Sr. kaiserl. Majestät und das heilige römische Reich nichts Nachtheiliges oder Schädliches gestatten, hegen und noch weniger vernehmen [zu] lassen.“
15. 12 1704 - Gewaltige Kontributionszahlungen für baierische Rentämter
Straubing - Landshut - Burghausen * Den Rentämtern Straubing, Landshut und Burghausen wird die gewaltige Kontribution [= Zahlungen für den Unterhalt der Besatzungstruppen] von 3,15 Millionen Gulden auferlegt.
- Das ist mehr als das Doppelte des gewöhnlichen Steueraufkommens ganz Baierns.
- Zudem wird eine außerordentliche Landsteuer ausgeschrieben, um damit die Auflösung des baierischen Heeres zu finanzieren.
- Darüber hinaus erhalten die kaiserlichen Truppen ihr Winterquartier in den besetzten Rentämtern.
1705 - Ein „Benediktiner-Mönch“ betreut das „Kloster Lilienberg“
Au * Johann Maximilian von Alberti lässt die „Sakramentspendung“ der „Frauen vom Gaisberg“ durch einen „Benediktiner“ erledigen.
Dieser liest täglich die Messe und nimmt den Ordensfrauen die „Osterbeichte“ ab.
Selbst die Regeln, nach denen die Klosterfrauen leben, sind stark der „Benediktiner-Regel“ angepasst worden.
1705 - Der „Templerorden“ kann die „Ordensstatuten“ neu verabschieden
Schottland - Portugal - Norditalien * Da der „Templerorden“ in Schottland, Portugal und Norditalien nie offiziell aufgelöst wird, kann er sich als „militärisch-christlicher Laienritterorden“ neu formieren und die „Ordensstatuten“ neu verabschieden.
Ab 1705 - Der „wittelsbachische Hausschatz“wird bei den „Franziskanern“ versteckt
München-Graggenau * Nach der Niederlage des Kurfürsten Max Emanuel im „Spanischen Erbfolgekrieg“ findet der „wittelsbachische Hausschatz“ in der Zeit von 1705 bis 1715 ein sicheres Versteck bei den „Franziskanern“.
16. 2 1705 - Kurfürstin Therese Kunigunde reist nach Venedig
München - Venedig * Kurfürstin Therese Kunigunde reist zu ihrer Mutter nach Venedig. Das ist für die Kaiserliche Adimistration Anlass genug, dies als Verstoß gegen den Ilbesheimer Vertrag zu werten.
20. 3 1705 - Kaiser Leopold I. setzt eine Administration ein
<p><strong><em>Wien</em></strong><em> * </em>Hofkriegspräsidenten, Geheimräte und hohe Kanzleibeamte beraten in Wien über eine zentrale Administration für ganz Baiern. Prinz Eugen <em>„der edle Ritter"</em> führt den Vorsitz dieser streng geheimen Besprechung. Mit Argwohn beobachtet man die rege Korrespondenz zwischen München und Brüssel.</p> <p>Schließlich setzt Kaiser Leopold I. - zur zivilen und militärischen Verwaltung Baierns - die Kaiserliche Administration mit Sitz in Landshut ein. Zum Landesadministrator wird der Diplomat Graf Maximilian Carl von Löwenstein-Wertheim-Rochefort bestellt.</p>
5. 5 1705 - Die Landbevölkerung ist am stärksten betroffen
Wien * Kaiser Leopold I. stirbt in Wien. Sein 27-jähriger Sohn Joseph I. wird zum Kaiser gewählt. Der neue Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation will, dass „auf Bainern Keine andere reflexion zu machen sein, als selbiges in soweith genießen zu Können, das es hinkünftig dem Churfürsten Unnutz seyn solle“.
Von dieser Politik ist die Landbevölkerung am stärksten betroffen.
- Sie hat - neben den drastischen Steuererhöhungen - besonders unter den drückenden Quartierlasten und den Schikanen der hier stationierten oder durchmarschierenden kaiserlichen Regimenter zu leiden.
- Hinzu kommt die Disziplinlosigkeiten und Exzesse der Soldaten, die der Landbevölkerung oft zusätzliche Leistungen abpressten.
- Die Bauern müssen für die Militaristen Dirnen besorgen und bezahlen.
- Häufig zwingt man sie bei Vergewaltigungen der eigenen Frau, der Töchter und Anverwandten zuzusehen.
- Selbst von jungen Mädchen und Schwangeren nehmen die Soldaten keinen Abstand.
- Plünderungen gefährden die Lebensmittelversorgung der ländlichen Bevölkerung und der Bewohner der Städte.
15. 5 1705 - Kurfürstin Therese Kunigunde wird die Rückreise verweigert
München * Die Kaiserliche Administration verweigert der Kurfürstin Therese Kunigunde die Rückreise nach München.
8.000 Soldaten marschieren um 7 Uhr vor den Stadttoren auf und drohen mit Bombardierung. Die Münchner kapitulieren. Nun ist die baierische Hauptstadt München, das Rentamt München und damit ganz Baiern besetzt. In der Folge verlegt man den Sitz der Kaiserlichen Administration in die Herzog-Max-Burg.
Nach dem 16. 5 1705 - Münchens Kaffeehäuser erleben einen enormen Aufschwung
München * Mit der österreichischen Besatzung Münchens erleben die Kaffeehäuser einen enormen Aufschwung.
16. 5 1705 - Die Kaiserlichen besetzen auch das Rentamt München
München * Nachdem Kurfürstin Therese Kunigunde am 16. Februar 1705 zu ihrer Mutter nach Venedig reiste, besetzen die Kaiserlichen auch das Rentamt München und verweigerten der Kurfürstin die Einreise nach Baiern. 8.000 Soldaten marschieren um 7 Uhr vor den Stadttoren auf und drohen mit Bombardierung. Die Münchner kapitulieren.
Zur Besetzung des Rentamtes München kommt es auch deshalb, weil man in München keinen großen Eifer zeigt, die vereinbarten Abrüstungsmaßnahmen aus dem Ilbesheimer Vertrag umzusetzen. Eine Kaiserliche Administration unter Reichsgraf Maximilian Carl von Löwenheim-Wertheim-Rochefort bemüht sich nun um eine ordnungsgemäße Verwaltung des Kurfürstentums Baiern.
24. 5 1705 - Die Deportation der kurbaierischen Prinzen wird geplant
München * Graf Maximilian Carl von Löwenstein-Wertheim-Rochefort schlägt Kaiser Joseph I. - zur "Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung" in Baiern - die Deportation der kurbaierischen Prinzen in die österreichischen Stammlande vor.
25. 5 1705 - Die Kaiserliche Administration schreibt erneut eine Kriegssteuer aus
München * Die Kaiserliche Administration schreibt erneut eine außerordentliche Kriegssteuer aus, an der sich korrupte Beamte durch erhöhte Forderungen noch bereichern.
6. 6 1705 - Die baierischen Beamten leisten einen Treueid auf den Kaiser
München * Am 6. und 8. Juni leisten die baierischen Beamten einen Treueid auf den deutsch-römischen Kaiser Joseph I..
16. 6 1705 - Je vier Höfe müssen einen tauglichen Mann für die Armee stellen
München * Die Kaiserliche Administration ordnet an, dass jeweils vier Höfe einen tauglichen Mann für die Armee zu stellen haben.
1. 7 1705 - Die baierischen Stände leisten ihren Treueid auf den Kaiser
München * Die baierischen Stände leisten ihren Treueid auf den Kaiser.
24. 7 1705 - Alle ledigen Bauernburschen sind dem Militärdienst zuzuführen
München * Die Kaiserliche Administration befiehlt, alle ledigen und herumziehenden Bauernburschen aufzugreifen und dem Militärdienst zuzuführen.
9. 9 1705 - Die Kaiserliche Administration ordnet Rekrutierungen an
München * Die Kaiserliche Administration ordnet an, jeden dritten Mann der ursprünglich zu reinen Landesverteidigungszwecken aufgestellten Landfahnen zu rekrutieren.
Um den 2. 10 1705 - Zwangsrekrutierungen werden angeordnet
München * Da sich weiterhin die meisten jungen Männer der Rekrutierung durch Flucht entziehen, ordnet die Kaiserliche Administration Zwangsrekrutierungen zur Auffüllung ihrer stark gelichteten Regimenter an. Verwaltungsbeamte und Rekrutierungskommandos greifen wehrfähige Männer auf, wo immer sie sie finden. Söhne und Knechte von Bauern werden während der Feldarbeit oder nachts aus den Betten weggeschleppt. Sogar aus den Kirchen werden sie gezogen, auf Wagen gefesselt nach Ungarn oder Italien entführt.
Den Bauern fehlen dadurch die Arbeitskräfte. Bis zu den Zwangsrekrutierungen beschränkte sich die Bevölkerung auf Beschwerden an die Kaiserliche Administration. Erst ab jetzt wird tätlicher Widerstand anzutreffen sein.
Um den 10. 10 1705 - Erste Unruhen wegen der Zwangsrekrutierungen
Niederbaiern - Oberpfalz * Im Innviertel, an Vils und Rott sowie in Teilen der Oberpfalz kommt es wegen der Zwangsrekrutierungen zu ersten Tumulten.
15. 10 1705 - Lenggrieser Proteste gegen die Zwangsrekrutierungen
Lengries * Bei Lenggries im Isarwinkel protestieren die Menschen gegen die Zwangsrekrutierungen.
16. 10 1705 - Die Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria wird geweiht
Au * Die Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria am Gaisberg wird geweiht. Von jetzt an dürfen Messen in der Kapelle gelesen, das Allerheiligste jedoch noch nicht darin aufbewahrt werden.
Um den 25. 10 1705 - Der Aufstand gegen die kaiserliche Besatzungsmacht bricht los
Oberpfalz - Niederbaiern * In der Oberpfalz und in Niederbaiern bricht der Aufstand gegen die kaiserliche Besatzungsmacht los.
Um den 3. 11 1705 - Aufruhr im Rentamt Burghausen
Burghausen * Im Rentamt Burghausen bricht der Aufruhr aus.
10. 11 1705 - Verstärkung für die Kaiserliche Administration
Altötting - Burghausen * Die Kaiserliche Administration schickt 100 Grenadiere, 300 Rekruten, je 100 Husaren und Kürassiere sowie vier Regimentsgeschütze unter Oberst de Wendt in den Raum Altötting-Burghausen.
13. 11 1705 - Der Kampf um Burghausen beginnt
Burghausen * Der Kampf um Burghausen beginnt.
14. 11 1705 - Einsatz von Truppen gegen Tumultuanten angekündigt
Wien * Ein kaiserliches Mandat kündigt den Einsatz von Truppen gegen die Tumultuanten an.
16. 11 1705 - Burghausen fällt den Aufständischen in die Hände
Burghausen * Burghausen kapituliert vor den Aufständischen. Sie ist die erste Stadt, die den Aufständischen in die Hände fällt. In den Kapitulationsverhandlungen verlangen die Unterländer,
- dass „der Landmann bei seinen alten Privilegien verbleibe,
- dass man von ihm nicht mehr fordere als unter dem Kurfürsten geschehen, damit die Bauern [...] ihre schuldigen Abgaben entrichten können;
- alle Bauernsöhne und Knechte sollen zu Hause verbleiben und allein zur Verteidigung des Landes dienen.“
Die Bauern erheben sich also zunächst nur gegen die allzu maßlosen Forderungen der Kaiserlichen Administration, nicht gegen die Besatzungsherrschaft. Weil sie zu Verteidigung der Heimat bereit sind, wehren sie sich gegen den Missbrauch der Landfahnen zum kaiserlichen Militärdienst. Die Aufständischen verstehen sich als „ganze Gemein der Kurlande Baiern“.
Um ihnen die Legitimation des gesamten Kurfürstentums zu geben, wird der Regierungsrat Franz Bernhard von Prielmayer zum Kriegskommissär der Landesdefension gezwungen. Prielmayer versucht mäßigend auf die Aufständischen einzuwirken. Doch der Erfolg der Rebellen verändert deren Ziele, weshalb sie schon bald die Beseitigung der Kaiserlichen Administration fordern, weil sie für die „unerträglichen Lasten“ verantwortlich zeichne.
22. 11 1705 - Georg Sebastian Plinganser ruft alle Baiern zu den Waffen
Kurfürstentum Baiern * Unter dem Pseudonym „J. H. Wormbs“ erlässt Georg Sebastian Plinganser ein Mandat, dass „alle nichtadligen und unverheirateten kurbaierischen Untertanen“ zu den Waffen ruft. Als Ziel nennt das Mandat, man solle „mit vereinten Kräften auf die Feinde losgehen, solche aus dem Lande völlig zu vertreiben, nächstdem die alt churbaierische Libertät empor zu heben“.
Damit wird der Volksaufstand gegen die Ausplünderung der Landbevölkerung zur Erhebung gegen die Besatzungsherrschaft des Kaisers.
23. 11 1705 - Kaiserliche Truppen befreien Wasserburg von den Aufständischen
Wasserburg * Mit brutaler Härte gelingt es den Kaiserlichen Truppen ein Belagerungsheer der Aufständischen vor Wasserburg zu zerschlagen. Oberst Johann Baptist de Wendt hat einen Teil der 4.000 Bauern, die Wasserburg eingeschlossen hatten, „wie das wilde Vieh zerfetzt und zerhauen“. Die Bauern verlieren 300 Mitstreiter durch den Tod und ebenso viele Gefangene.
25. 11 1705 - In Benediktbeuern kommt es zu Tumulten
Benediktbeuern * Wegen den Zwangsrekrutierungen kommt es in Benediktbeuern zu Tumulten.
27. 11 1705 - Die Aufständischen nehmen Vilshofen ein
Vilshofen * Die Aufständischen nehmen Vilshofen ein.
28. 11 1705 - Die Aufständischen nehmen die Festung Braunau ein
Braunau * Die Aufständischen nehmen die Festung Braunau ein. Die Belagerungsarmee ernennt den Mitterschreiber des Gerichts Reichenberg, Georg Sebastian Plinganser, zum Kriegskommissär.
28. 11 1705 - Die Kaiserlichen erobern Neuötting zurück
Neuötting * Die Kaiserlichen erobern das von den Aufständischen besetzte Neuötting zurück.
28. 11 1705 - Die Kaiserliche Administration will die Zwangsrekrutierungen einstellen
München * Auf Bitten der Landschaftsverordnung sagt die Kaiserliche Administration die Einstellung der Zwangsrekrutierungen zu.
Obwohl sich die Landschaftsverordnung deutlich von den „yblen aufstandt under dem paurs volkh“ distanziert, zeigt sie dennoch Verständnis für die bäuerlichen Belange, weshalb sie sich beim Kaiser vehement über „das unnß schon so lang truckhente Ellent“ beklagt. Sie tritt auch für eine Verständigungslösung zwischen den Aufständischen und der kaiserlichen Obrigkeit ein.
29. 11 1705 - Sorgen um das rebellische Volk in Baiern
Regensburg * Der in Regensburg stattfindende Reichstag des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation macht sich Sorgen um „das rebellische Volk“ in Baiern.
Um den 1. 12 1705 - Oberst de Wendt verfügt jetzt über 1.300 Mann
München * Oberst Freiherr Johann Bapist de Wendt verfügt jetzt über 1.300 Mann, darunter 400 Reiter.
Um den 2. 12 1705 - In Valley kommt es zu Tumulten
Valley * In Valley kommt es zu Tumulten wegen den Zwangsrekrutierungen.
Um den 3. 12 1705 - Pfarrer Florian Sigismund Miller wirbt Truppen für die Aufständischen an
Oberpfalz - Oberviechtach * Der Oberviechtacher Pfarrer Florian Sigismund Maximilian Miller von Ammenthal und Fraunhofen wirbt in der südlichen Oberpfalz Truppen für die Aufständischen an.
4. 12 1705 - Ausweitung der Rebellion übers ganze Land geplant
Braunau * Der frühere baierische Kriegskommissär Matthias Ägidius Fuchs kommt nach Braunau. Gemeinsam mit Plinganser plant er die Ausweitung der Rebellion übers ganze Land und die Einnahme Münchens.
- Lokale Erhebungen im Bairischen Wald, an der unteren Isar und im Raum Kehlheim sollen Teile der kaiserlichen Besatzungstruppen binden,
- während das starke Unterländer Defensionsheer über Mühldorf und Ebersberg auf die baierische Hauptstadt vorstoßen soll.
Flankierend sollen aus den Gerichten nördlich und südlich von München zwei Unterstützungsangriffe gegen die Stadt erfolgen.
4. 12 1705 - Die Aufständischen erobern Schärding
Schärding * Die Aufständischen erobern Schärding.
Um den 8. 12 1705 - Die Aufständischen erzielen bedeutende Erfolge
Burghausen * Die Aufstandsbewegung unter der Führung des Pfarrkirchner Gerichtsschreibers Georg Sebastian Plinganser erzielt bedeutende Erfolge und kontrolliert nach der Einnahme der Städte Burghausen, Braunau und Schärding die Innlinie und große Teile des Rentamtes Burghausen.
Als sich die Rentamtsregierung notgedrungen auf die Seite der Aufständischen stellt, breitet sich die Rebellion über das Rott- und das Vilstal weiter aus.
9. 12 1705 - Ein gefälschter Brief vom Kurfürsten aus dem Exil
Tölz * Der ehemalige baierische Kriegskommissär Matthias Ägidius Fuchs begibt sich von Braunau nach Tölz, wo er den dortigen Pflegskommissär Johann Ferdinand Dänkel für die Aufstandspläne gewinnen kann. Die Bevölkerung des Oberlands steht dem Aufstand positiv gegenüber. Fuchs legt dazu ein angebliches Mandat des Kurfürsten Max Emanuel vor. Diese Fälschung war vermutlich von der Braunauer Führungsgruppe um Plinganser gefertigt worden. Es lautet:
„Wir, von Gottes Gnaden Maximilian Emanuel, Churfürst zu Baiern etc. etc..
Nachdem Wir mit Schmertzen vernommen, dass ihr, meine Liebe, Getreue, seit unser Abwesenheit mehr und mehr beschweret werdet, und man euch eine Million nach der andern abpresset, benebst den Teutschen Krieg aus euren Mitteln fortsetzen wolle, wodurch dann die Armuth bey auch dermassen zugenommen, dass ihr die unerträglichen Lasten, sowohl in Geld, als Mannschafft, freye Einquartierung, und hin= und wider= Marches nicht länger ertragen könnet, dass ihr auch eur Vieh und Hauß-Zierathe zu Gelde gemacht, und nichts mehr als die leere Wohnung übrig habt, so haben wir nach der allzeit gegen euch erwiesenen und noch habenden Güt und Vorsorge rathsam und gut befunden, euch solchen vorzustellen und zu ermahnen, dass ihr solche unchristliche Beschwerungen nicht länger duftet, sondern hingegen- gesamter Hand einander beystehet, mit Gewehr euch versorget und auf alle Arth und Weise das Land selbst zu beschirmen trachtet, und solches um soviel mehr, da man noch über dem die bequeme Mannschafft zu dem Kriegesdienst mit Gewalt zwingen und wegführen will.
Zu dem Ende wollen wir auch nicht unterlassen, euch, soviel möglich ist, beyzustehen, und unser Winter-Lager nahe bey euch zu nehmen, biß ihr einen festen Fuß ins Land haben werdet.
Womit wir, wie vor diesem, euch in Gnaden und Gunst gewogen verbleiben.“
Um den 10. 12 1705 - Die Gerüchtekücheum die baierischen Prinzen brodelt
München * Die Gerüchte, wonach die baierischen Prinzen nach Österreich gebracht werden sollen, werden lauter.
Um den 10. 12 1705 - Die Erhebung im Landgericht Tölz
Tölz * Die abgedankten Leutnants Johann Georg Aberle und Johann Houis kommen nach Tölz. Ebenso der aus Lenggries stammende Adam Schöttl, damals Hofmarksjäger in Iffeldorf, genannt Jägeradam. Sie propagieren gemeinsam mit dem Tölzer Pflegskommissär Johann Ferdinand Dänkel die Erhebung im Landgericht Tölz.
10. 12 1705 - Der Kongress von Anzing vereinbart einen zehntägigen Waffenstillstand
Anzing * Zwischen gemäßigten Burghauser Delegierten und Vertretern der Landschaft kommt es - mit Einverständnis der Kaiserlichen Administration zum Kongress von Anzing, der die Beschwerden der Aufständischen formuliert und einen zehntägigen Waffenstillstand vereinbart.
Die Braunauer Aufständischen um Georg Sebastian Plinganser bleiben jedoch auf Konfrontationskurs.
12. 12 1705 - Angedrohung der Sippenhaft für die Aufständischen
München * Die Kaiserliche Administration erlässt für München ein Abmahnungsmandat, das den Aufständischen und ihren Familien mit Sippenhaft droht.
12. 12 1705 - Oberst Johann Baptist de Wendt wird Stadtkommandant
Wasserburg - Burghausen - München * Die Besatzung in Wasserburg wird auf 1.700 Mann verstärkt und dem Generalwachtmeister Georg Friedrich von Kriechbaum übertragen, nachdem die Kaiserliche Administration mit de Wendts Operationen gegen Burghausen unzufrieden war. Oberst Johann Baptist de Wendt wird als Stadtkommandant nach München zurückberufen.
13. 12 1705 - Vorbereitung des Aufstands
Tölz * Tölzer und Benediktbeurer Bauern treffen sich in Stallau, drei Kilometer entfernt von Tölz, zur Vorbereitung des Aufstands. Anwesend sind auch der Tölzer Pflegskommissär Johann Ferdinand Dänkel und der Bendiktbeurer Klosterrichter Wendenschlegel.
13. 12 1705 - Die Eroberung von Kelheim
Kelheim * Unter der Führung des Metzgermeisters Matthias Kraus gelingt den Aufständischen die Eroberung von Kelheim.
15. 12 1705 - Das Oberland macht beim Aufstand mit!
Braunau * Der ehemalige baierische Kriegskommissär Matthias Ägidius Fuchs berichtet nach Braunau: „Das Oberland macht mit.“ Damit ist der Countdown eingezählt!
15. 12 1705 - Mobilisierung der Gerichte Erding, Schwaben und Haag
München * Der Anzinger Posthalter Franz Kaspar Hierner trifft in der baierischen Hauptstadt mit einer kleinen Gruppe ansässiger Verschwörer zusammen. Diese sind der Weinwirt, Mitglied im Äußeren Rat und Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters von Tölz, Johann Jäger; der Weinwirt Johann Georg Küttler und der Bierbrauer Georg Hallmayr. Hierner verspricht die Mobilisierung der Gerichte Erding, Schwaben und Haag.
15. 12 1705 - Die Aufständischen erobern Landau an der Isar
Landau an der Isar * Die Aufständischen erobern Landau an der Isar - und verlieren es kurz darauf wieder.
16. 12 1705 - Treffen der Münchner Aufständischen mit den Oberländern
Königsdorf * Die drei Münchner Wirte Johann Jäger, Johann Georg Küttler und Georg Hallmayr nehmen Verbindung mit den Oberländern auf. In Königsdorf treffen sie sich mit Adam Schöttl, dem „Jägeradam“, und drei Tölzer Bürger, dem Weinwirt Franz Jäger, der Bruder des Münchner Jägerwirts, und den beiden Bierbrauern Michael Schaindl und Anton Fiechtner. Man beschließt ein Manifest, das den Aufstand begründen soll:
- Es sind dies die hohen Steuern und Kriegsumlagen sowie die Quartierlasten und Ausschreitungen der Soldaten;
- die vertragswidrige Besetzung des Rentamtes München sowie
- die Verweigerung der Rückkehr der Kurfürstin;
- die Beschlagnahme kurfürstlichen Eigentums und
- die befürchtete Deportation der Prinzen.
Weil die Landschaftsvertretung die Interessen des Landes nicht ausreichend unterstützt, ist die Vertreibung der „eingedrungenen frembden Regierungs Göst“ das einzige Mittel.
Um den 16. 12 1705 - Der Münchner Verschwörerkreis erweitert sich
München * Der Münchner Verschwörerkreis hat sich um den Eisenhändler und Mitglied des Äußeren Rats Sebastian Senser, den Gastwirt Franz Mader, die Hofköche Kaspar Eckart und Sebastian Engelhart, den Registratur-Adjukt Ignaz Haid, dem Studenten Anton Passauer und den im Lehel wohnenden Aujäger Franz Daiser erweitert. Eine weitere Anwerbung findet weder bei den Studenten, noch bei den Hofbediensteten Anklang.
16. 12 1705 - Der vereinbarte Waffenstillstand wird gebrochen
Niederbaiern * Der auf dem Kongress von Anzing vereinbarte Waffenstillstand wird von den niederbaierischen Bauern gebrochen und die Kampfhandlungen wieder aufgenommen.
17. 12 1705 - Die Unterländer greifen die kaiserlichen Truppen an
Niederbaiern * Der Zulauf zu den aufständischen Unterländern ist so groß, dass deren Oberkommandant Johannes Hoffmann den Anzinger Waffenstillstand bricht und die kaiserlichen Truppen des Freiherrn Johann Baptist de Wendt angreift.
18. 12 1705 - Eine Mischung aus Halbwahrheiten und maßlosen Übertreibungen
Tölz * Im Tölzer Franziskanerkloster treffen sich die Beamten und Gemeindeobmänner des Gerichts Tölz und Umgebung. Mit anwesend sind der Pflegskommisär Maximilian Alram aus Valley, der ehemalige baierische Kriegskommissär Matthias Ägidius Fuchs und die Offiziere.
Den Anwesenden wird in einer Mischung aus Halbwahrheiten und maßlosen Übertreibungen eröffnet, dass die Kaiserliche Administration die kurfürstlichen Prinzen aus München entführen möchte, weshalb einige Adelige und die Münchner Bürgerschaft dringend bitte, dass man im Oberland zu den Waffen greifen und die Kaiserlichen aus München vertreiben soll.
- Aus dem Rentamt München wären dazu 20.000 Mann bereit.
- Und aus dem Unterland erwartet man weitere 8.000.
- Außerdem haben die Münchner versprochen, dass sie die Aufständischen ohne Verlust eines einzigen Mannes und ohne einen Schuss Pulver in die Stadt schleusen würden.
- Den Beamten erklärt man, dass der „Marsch nach München“ den Intensionen des Kurfürsten entspräche, wie der Brief vom 9. Dezember 1705 beweise.
- Es wird für die Gerichte südlich von München ein Aufgebotsbefehl erlassen.
19. 12 1705 - Die Chur-Bairische Landts-Defension Oberlandt erlässt das Tölzer Patent
Tölz * Die „Chur-Bairische Landts-Defension Oberlandt“ erlässt das Tölzer Patent. Es beinhaltet den Aufruf zur Versammlung der Mannschaften für den 22. Dezember 1705 in Hohenschäfftlarn, 18 Kilometer südlich von München.
19. 12 1705 - Die Kaiserliche Administration befiehlt, die Waffen niederzulegen
München * Die Kaiserliche Administration erlässt ein Mandat, in dem sie der „rottirten rebellischen Baurschaft“ befiehlt, die Waffen niederzulegen. Zudem sollen die Bauern die Anführer der Aufstandbewegung zur Anzeige bringen.
Die Kaiserliche Administration warnt davor, „daß diejenige Dörffer, Höf und Häuser, wo die Bauerschafft sich abwesend befindet, ohne alle Gnad und Bedenken verbrennet und in Asche geleget, diejenige Mannschaft aber, so in Wöhr und Waffen verblieben, und darinne erdappet werden wird, als Rebellen angesehen, und mit Galgen und Schwerdt, Vertreibung ihrer Haab und Gütter gestraft“ werden.
Auch die Eltern der Aufständischen würden „der Straff des Brands und Plünderung, als wann sie selbsten dabey wären, underworffen seyn“. Keiner könne sich damit entschuldigen, nur unter Zwang gehandelt zu haben.
21. 12 1705 - Der politische Höhepunkt des Baierischen Volksaufstands ist erreicht
Braunau - München * Der Höhepunkt der politischen Phase des Baierischen Volksaufstands ist erreicht. In Braunau konstituiert sich ein Parlament, der Landesdefensionskongress. Ein Direktorium, die provisorische Regierung, wird gebildet.
Die Kurbaierische Landes-Defension Oberland und Unterland unternimmt den Marsch nach München, um mit der Landeshauptstadt beginnend ganz Baiern zu befreien.
22. 12 1705 - Die Aufständischen treffen sich in Hohenschäftlarn
Hohenschäftlarn * Aufgrund des Tölzer Patents treffen gegen 18 Uhr die Tölzer, Benediktbeurer und Reichersbeurer Kontingente in Hohenschäfftlarn ein. Dort nehmen sie eine zehn Mann starke kaiserliche Reiterpatrouille gefangen, die sie nach Wolfratshausen bringen.
22. 12 1705 - Verurteilung wegen Verkostung der Aufständischen
Schäftlarn * Die Prämonstratenserabtei Schäftlarn verköstigt die Aufständischen bei deren Marsch in Richtung München. Sie wird dafür später von der Kaiserlichen Administration zu einer Geldstrafe in Höhe von 8.000 Gulden verdonnert.
23. 12 1705 - Ein bäuerliches Aufgebot trifft sich in Schäftlarn
Schäftlarn * Ein bäuerliches Aufgebot von rund 3.000 Mann aus den verschiedensten Gerichtsbezirken und Hofmarken treffen sich in Schäfftlarn.
- Vom Landgericht Tölz 500 Mann,
- vom Klostergericht Benediktbeuern 200 Mann,
- vom Klostergericht Tegernsee 200 Mann,
- aus den Hofmarken Reichersbeueren, Sachsenkam und Dietramszell 100 Mann,
- vom Landgericht Aibling und der Grafschaft Hohenwaldeck 600 Mann,
- aus der Grafschaft Valley 300 Mann,
- vom Landgericht Rosenheim 70 Mann,
- vom Landgericht Starnberg 200 Mann und
- vom Landgericht Wolfratshausen 600 Mann.
Etwa ein Drittel der Männer haben Gewehre, der Rest ist mit den typischen Bauernwaffen ausgestattet. Das Aufgebot umfasst 300 Reiter und verfügt über sechs Geschütze.
Am Nachmittag treffen sich in Schäfftlarn die Anführer der Aufständischen zu ihrer ersten Beratung. Das Kommando über den gesamten Heerhaufen wird dem kurbaierischen Hauptmann Matthias Mayer übertragen. Er weigert sich und übernimmt den Oberbefehl erst nach massivem Druck.
Zum Unterkommandanten wird Leutnant Johann Houis ernannt. Die Schützen führt der „Jägeradam“ Schöttl, die Reiterei der Tölzer Pflegskommissär Joseph Ferdinand Dänkel an.
Als am Abend ungünstige Nachrichten aus München eintreffen, wollen Hauptmann Matthias Mayer und eine ganze Reihe von Beamten das ganze Vorhaben abblasen. Doch Pflegskommissär Dänkel, Kriegskommissär Fuchs und der Münchner Weinwirt Jäger setzen sich mit aller Kraft für den „Marsch nach München“ ein.
23. 12 1705 - Der Freisinger Bischof warnt vor einem Aufstand
<p><em><strong>Freising</strong></em> * Der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher ordnet in einem Rundschreiben an, dass alle Pfarrer ihre Pfarrkinder vor einem höchst schädlichen Aufruhr warnen sollen, da dieser dem schuldigen Gehorsam gegen die Obrigkeit widerspricht. Der Aufruhr wird <em>„unausbleiblich“</em> die Strafe Gottes nach sich ziehen.</p> <p>Der Fürstbischof hat als eigenständiger Reichsfürst keinen Anlass, mit den Ambitionen des Kurfürsten zu sympathisieren. </p>
24. 12 1705 - 16.000 Unterländer schlagen in Steinhöring ihr Hauptquartier auf
Steinhöring * Durch die Verstärkung aus dem nördlichen Rentamt München ist die Unterländer-Armee unter dem Kommando von Johannes Hoffmann auf 16.000 angewachsen. Ihr Hauptquartier schlagen sie in Steinhöring bei Ebersberg auf.
Die Kaiserliche Armee unter der Führung des Generalwachtmeisters Georg Friedrich Freiherr von Kriechbaum muss sich bis nach Anzing zurück ziehen.
24. 12 1705 - Der Zug der Aufständischen kommt in Baierbrunn an
Baierbrunn * Gegen 16 Uhr kommt der Zug der Aufständischen in Baierbrunn an. Dort findet eine weitere Besprechung statt. Vom Anzinger Posthalter Hierner ist die Nachricht eingetroffen, dass die Unterländer nicht nach München marschieren können, weil ihnen das Korps Kriechbaum in Anzing den Weg versperrt.
Erneut rät Hauptmann Mayer zur Umkehr. Er will über die Schäfftlarner Brücke nach Valley, um sich mit den Unterländern zu vereinigen. Mayer kann sich erneut nicht durchsetzen, weshalb der „Marsch nach München“ fortgesetzt wird.
24. 12 1705 - Die Masse der Oberländer trifft in Solln ein
Solln * Gegen 20 Uhr trifft die Masse der Oberländer in Solln ein. Zur gleichen Zeit nimmt die Schützenvorhut ein etwa 80 Mann starkes kaiserliches Reiterdetachement unter Beschuss. Die Kaiserlichen, die von Oberst de Wendt zur Aufklärung in Richtung Schäfftlarn geschickt worden waren, werden zwar verjagt, können aber trotzdem ausreichend Informationen sammeln.
Der Starnberger Pfleger Johann Joseph Öttlinger verlässt nach der Schießerei in Solln die Aufständischen, begibt sich nach München und informiert den Kaiserlichen Administrator Maximilian Carl Graf von Löwenstein-Wertheim-Rochefort über die Unternehmung.
Oberst Johann Baptist de Wendt leitet Sicherheitsmaßnahmen ein. Er ersucht das Korps Kriechbaum zum Rückmarsch nach München und macht in Aufrufen bekannt, dass „jede Unterstützung der Aufständischen durch die Einwohner Münchens mit dem Tode bestraft“ werden würde.
24. 12 1705 - Der Zug der aufständischen Bauern bewegt sich in Richtung München
Schäftlarn * Ab Mittag bewegt sich der Zug der Bauern in Richtung München.
- Die Schützen unter Leutnant Houis und dem „Jägeradam“ bilden die Vorhut.
- In einigem Abstand folgen die Spießler und Stängler, bei denen sich die sechs Böllerkanonen befinden.
- Den Abschluss bildet die Reiterei.
24. 12 1705 - Weitere bedenkliche Nachrichten treffen aus München ein
Solln * Am Abend treffen weitere bedenkliche Nachrichten aus München in Solln ein. Die Münchner Verschwörer raten den Aufständischen eindringlich, den Angriff abzubrechen, da die Kaiserlichen zu stark seien und die Münchner Bürgerschaft nichts unternehmen kann (will).
Hauptmann Matthias Mayer gibt den Befehl zum Rückzug. Nach einer halben Stunde - bei Pullach - wird er auf Betreiben des „Jägeradam“ und der von ihm geführten Schützen aufgehalten und die Kolonne - unter tumultartigen Szenen - zum Umkehren bewegt. Dem sich weigernden Hauptmann Mayer wird daraufhin der Oberbefehl entzogen. Er selbst wird gefangen genommen.
24. 12 1705 - Gegen 22 Uhr erreicht der Tross Thalkirchen
Thalkirchen * Gegen 22 Uhr erreicht der Tross Thalkirchen. Weil sich etwa 400 Bauern abgesetzt haben, ist die Abteilung auf rund 2.300 Kämpfer geschrumpft. Auch Kriegskommissär Matthias Ägidius Fuchs und der Tölzer Weinwirt Franz Jäger, der Bruder des Münchner Jägerwirts haben das Aufgebot verlassen.
In Thalkirchen wird unter der Leitung von Leutnant Johann Houis der Angriff auf München vorbereitet. Die verbliebene Streitmacht wird dazu in drei Gruppen aufgeteilt.
- Die erste Gruppe mit 800 Mann, darunter der größte Teil der Schützen, soll unter der Führung von Leutnant Johann Georg Aberle den Roten Turm einnehmen und den Flussübergang sperren.
- Die zweite Gruppe mit ebenfalls 800 Männern, aus der Masse der Spießler und Stängler bestehend, soll unter der Leitung von Leutnant Johann Clanze gegenüber dem Angertor Stellung beziehen, um einen Ausbruch der Kaiserlichen zu verhindern.
- Der Rest, die am schlechtesten Bewaffneten, sowie die Reiterei und die Artillerie, etwa 700 Mann stark, sollen in dem nahe gelegenen Dorf Untersendling Stellung beziehen.
- Dieser Gruppe schließt sich auch die Führungsgruppe der Aufständischen an. Sie bezieht im dortigen Wirtshaus ihr Hauptquartier.
Um Mitternacht treten die einzelnen Gruppen den „Marsch auf München“ an.
25. 12 1705 - Das Massaker vor München nimmt seinen Lauf
München * Ein von vornherein aussichtsloser Kampf beginnt. Der Angriffsplan der Aufständischen zeigt zugleich die Unfähigkeit ihrer Anführer.
Wie sollen die Oberländer - ohne Unterstützung der Münchner Bevölkerung und der wesentlich zahlreicheren Unterländer - die mit starken Befestigungen versehene Stadt stürmen?
- Die Münchner Befestigung besteht aus den beiden 10 und 7 Meter hohen Mauerringen.
- Denen vorgelagert liegt ein 25 Meter breiter Wassergraben mit gemauerten Böschungen.
- Jenseits des Grabens befindet sich ein 5 bis 7 Meter hoher Erdwall mit Palisadenwand.
- Das Isartor wird zudem durch einen vorgeschobenen Ravelin gesichert.
25. 12 1705 - Die Aufständischen erobern Landau an der Isar
Landau an der Isar * Erneut erobern die niederbaierischen Aufständischen Landau an der Isar. Doch auch dieser Erfolg wird nur von kurzer Dauer sein.
25. 12 1705 - Die Aufständischen eröffnen das Feuer in Richtung Isartor
München * Gegen 4 Uhr verschanzen sich die Aufständischen hinter Erdwällen und Baumstämmen und eröffnen das Feuer in Richtung Isartor. Als die Kaiserlichen zwei Salven abfeuern, bricht der Angriff der Oberländer schon wieder zusammen.
25. 12 1705 - Die Kaiserliche Kavallerie trifft am Gasteig ein
München * Gegen 7 Uhr trifft die vorausgeschickte Kaiserliche Kavallerie unter der Führung von Oberst Johann Graf von Eckh am Gasteig ein. Da die Isarbrücke versperrt ist, zieht seine Reiterei in die Au und sucht beim Radlwirt eine Furt durch den Gebirgsfluss.
Etwas später erreicht die Infanterie des Generalwachtmeisters Freiherr Georg Friedrich von Kriechbaum den Gasteig. Mit vier Kanonen wird nun der von den Aufständischen besetzte Rote Turm beschossen.
25. 12 1705 - Die Kaiserlichen hören die Aufständischen nicht mal an
München * Gegen 6 Uhr wird ein Tambour von den Anführern der Aufständischen vor das Sendlinger Tor geschickt. Er soll die Kaiserliche Administration zur Übergabe der Stadt auffordern, wird aber von den Kaiserlichen nicht angehört und muss unverrichteter Dinge wieder abziehen.
Die Beamtenführung in Untersendling gibt das Unternehmen daraufhin verloren und zieht ab. Mit ihnen auch Hauptmann Jean Philipp Gauthier, Leutnant Johann Houis, der Tölzer Pflegskommissär Joseh Ferdinand Dänkel und die gesamte Bauernreiterei. Nur der Münchner Jägerwirt Johann Jäger, der Student Anton Passauer, Hauptmann Matthias Mayer und Landleutnant xxxxxx Heller verbleiben bei den Oberländern.
25. 12 1705 - Oberst de Wendt befiehlt einen Ausfall aus dem Isartor
München * Um 8 Uhr befiehlt Oberst Johann Baptist de Wendt einen Ausfall aus dem Isartor. Die völlig überraschten oberländischen Bauern fliehen in Richtung Lehel und verstecken sich dort. Von ihnen werden 32, darunter Leutnant Johann Georg Aberle, gefangen genommen. Hofkoch Sebastian Engelhart und der Jägeradam Schöttl können entkommen.
- Die 100köpfige Besatzung des Roten Turms leistet heftigen Widerstand, wird aber „ungeacht deß starckhen feuers“ niedergemacht.
- Bei den kriegerischen Auseinandersetzungen am Roten Turm und vor dem Isartor kommen 400 Aufständische ums Leben, 200 werden gefangen genommen.
25. 12 1705 - Die Oberländer werden von zwei Seiten angegriffen
München * Gegen 8:30 Uhr lässt Oberst Johann Baptist de Wendt die am Sendlinger Tor stehende Kavallerie gegen die Abteilung Clanze ausbrechen. Gleichzeitig verfolgt vom Isartor aus die Companie Lüttig die fliehenden Bauern vom Roten Turm. Damit werden die Oberländer von zwei Seiten angegriffen.
- Von den Aufständischen, mit den Flüchtenden vom Roten Turm, etwa 900 Mann stark, fallen 200.
- Weitere 200 Mann werden gefangen genommen,
- 300 erreichen mit Leutnant Johann Clanze Untersendling.
- 200 Mann eilen dem Forstenrieder Wald und Thalkirchen zu.
Inzwischen hat Oberst von Eckhs Kavallerie von der Au aus die Isar überquert und nimmt ebenfalls die Verfolgung der Aufständischen in Richtung Untersendling auf.
Die Kaiserliche Administration erfährt erst jetzt, dass Untersendling von den Oberländern besetzt gehalten wird. Daraufhin rückt General Georg Friedrich von Kriechbaum und Oberst Johann Baptist de Wendt mit insgesamt fünf Bataillonen Infanterie durch das Sendlinger Tor gegen Untersendling vor.
25. 12 1705 - Die Aufständischen in Untersendling sind vollkommen eingeschlossen
Untersendling * Gegen 10 Uhr sind die Aufständischen in Untersendling vollkommen eingeschlossen. Angesichts der anrückenden Kaiserlichen Armee ergreift der Student Anton Passauer die Flucht. Der Jägerwirt Johann Jäger aus München legt sich als Kranker in der Wirtschaft ins Bett.
In dieser Notsituation wird Hauptmann Matthias Mayer wieder das Oberkommando der Aufständischen-Armee übertragen. Ihm bleibt nur noch die undankbare Aufgabe, sein eigenes und das Leben seiner Mitstreiter zu retten.
- Dazu lässt er Chamade schlagen und durch einen Tambour an Generalwachtmeister Georg Friedrich von Kriechbaum melden, dass sich die Führer auf „Gnade oder Ungnade“ ergeben.
- Er bittet zudem, den Bauern das Leben zu schenken.
- General von Kriechbaum fordert daraufhin die Anführer der Oberländer auf, ihre Waffen niederzulegen.
Als Matthias Mayer, Johann Clanze und Landleutnant xxxxx Heller das Dorf verlassen, drängen auch die Bauern hinter ihnen auf das freie Feld, legen ihre Waffen nieder und bitten um Gnade.
Die Kaiserliche Kavallerie stürzt sich nun aber auf die Wehrlosen und haut sie nieder. Im Anschluss daran feuert die Infanterie auch noch zwei oder drei Salven in den Haufen. Diejenigen, die noch leben oder fliehen können, werden von den Kaiserlichen gnadenlos verfolgt und niedergestreckt. Selbst die Kirche ist kein sicherer Zufluchtsort.
25. 12 1705 - Gegen 11 Uhr ist alles vorbei
München * Gegen 11 Uhr ist alles vorbei. Es werden noch 36 Gefangene gemacht sowie sechs Kanonen, drei Munitionswagen, fünf Fahnen, zwei Dragoner-Standarten und ein paar Pauken sowie 150 Pferde eingesammelt.
Auf kaiserlicher Seite zählt man 40 Gefallene und Verletzte. Die Aufständischen aus dem Oberland müssen demgegenüber eine Vielzahl von Toten beklagen.
- Alleine in München werden 1.066 Oberländer beerdigt.
- Insgesamt sind es etwa 1.100 Tote aus Oberbaiern.
- 609 Aufständische werden verwundet,
- nur 107 werden unverletzt in Gefangenschaft gekommen.
Die Münchner Einwohnerschaft hat während der gesamten Kämpfe brav den Anordnungen der Kaiserlichen Administration Folge geleistet und sich ruhig verhalten.
Der Stadtmagistrat übermittelt noch in der Nacht die „allerunderthenigste treue devotion“ der Bürgerschaft an die kaiserliche Obrigkeit. Die ermordeten Aufständischen vor den Stadttoren bezeichnet er verächtlich als „paurs rott“.
26. 12 1705 - Der Volksaufstand der Oberländer bricht zusammen
Steinhöring * Mit der Münchner Mordweihnacht bricht der Volksaufstand der Oberländer sofort zusammen. Der in Steinhöring stehende Oberbefehlshaber der Unterländer, Johannes Hoffmann, gibt daraufhin den Befehl zum Rückzug.
Nun machen sich in dem niederbaierischen Heerhaufen Unsicherheit, Angst und Diszplinlosigkeit breit. Reihenweise begeben sich die Unterländer Aufständischen auf den Weg nach Hause.
28. 12 1705 - Gnade für die Aufständischen
München * Die Kaiserliche Administration sagt allen am Aufstand Beteiligten - mit Ausnahme der Rändelsführer - Gnade zu.
31. 12 1705 - Die Armee der Unterländer Aufständischen zerfällt
Steinhöring * Von den 16.000 Unterländer Aufständischen in Johannes Hoffmanns Truppe sind gerade noch 1.100 übrig geblieben.
31. 12 1705 - Cham wird von den Aufständischen eingenommen
Cham * Unter der Führung des Oberviechtacher Pfarrers Florian Sigismund Maximilian Miller wird die Stadt Cham von den Aufständischen eingenommen.
1706 - Die „Hofmark Haidhausen“ umfasst 233 Familien
Hofmark Haidhausen * Die „Fugger‘sche Hofmark“ in Haidhausen umfasst 233 Familien.
1706 - Dionysius Michael wird als „Kaffeesieder“ bezeichnet
München * Der „Branntweinschenk“ Dionysius Michael wird auch als „Kaffeesieder“ bezeichnet.
1706 - Enrico Zuccalli wird aus dem Hofdienst entlassen
München * Enrico Zuccalli wird wie alle Gefolgsleute des Kurfürsten Max Emanuel aus dem Hofdienst entlassen.
Zuccallis Aufgaben und Aufträge werden nun Giovanni Antonio Viscardi übertragen. Seine Tätigkeiten in dieser Funktion sind vor allem weite Kontrollreisen zur Überwachung von Kasernen- und Festungsneubauten.
2. 1 1706 - Gnade für die meisten der am Aufstand Beteiligten
Wien * Kaiser Joseph I. ordnet an, nach der „Niederwerfung der Erhebung“ gnädig gegen die Beteiligten vorzugehen, sofern sie nicht zu den Urhebern und Anführern des Aufstands gehören.
8. 1 1706 - Das Massaker von Aidenbach
Aidenbach * Das Massaker von Aidenbach beginnt. Die Unterländer werden niedergeschlagen. Freiherr von Gemmel berichtet:
„Es haben sich aber die Rebellen, ehe man die Höhe gar besteigen können, gleichsam in dem Augenblick, ohne Verlierung des geringsten Feuers, in den hinter sich gehabten Wald gezogen; ihr Kommandant und andere Offiziere sind, gleich wie sie schelmischer Weise ihr rebellisches Kommando angetreten, wieder solchergestalten auf ihren Pferden mit der wenig gehabten Kavallerie durchgegangen und haben ihre Hauptarmee im Stich gelassen, welche der verbitterte Soldat sowohl zu Pferd als zu Fuß sogleich umringt und in den Wäldern und Feldern aufgesucht, alles, was sich nur blicken lassen, gegen einen wenigen Widerstand solchergestalten niedergemacht und massakriert, daß der wenigere Teil davongekommen.
Teile von ihnen haben sich in einige unweit von dieser Niederlage gelegene Bauernhäuser retiriert und sonderbar aus einem auf die Kaiserlichen mit kleinem Gewehr stark Feuer gegeben, daher diese Häuser sämtliche in Brand gesteckt und was nicht darinnen verbrennen, sondern entlaufen wollen, ohne Unterschied niedergemacht worden ist.“
Der Volksaufstand bricht zusammen.
14. 1 1706 - Schärding wird den Aufständischen geräumt
Schärding * Schärding wird den Aufständischen geräumt.
16. 1 1706 - Die Aufständischen räumen Cham
Cham * Die Aufständischen räumen Cham.
16. 1 1706 - In verschiedenen Scharmützeln gegen 10.000 Mann massakriert
München - Wien * Graf Maximilian Carl von Löwenstein-Wertheim-Rochefort berichtet an den Kaiser: „Nachdem von diesem Gesindel bei Sendling und Aidenbach, auch bei Wiedergewinnung von Kelheim, Vilshofen und anderen Orten und in verschiedenen Scharmützeln gegen 10.000 Mann massakriert worden, haben sie kein corpo mehr zu Felde [...].“
17. 1 1706 - Braunau wird den Aufständischen geräumt
Braunau * Braunau wird den Aufständischen geräumt.
18. 1 1706 - Die „Aufständischen“ räumen Burghausen
Burghausen * Die Aufständischen räumen Burghausen.
27. 1 1706 - Anführer des Aufstands sollen höchstens Geldstrafen erhalten
Salzburg - Wien * Auf Bitten des Salzburger Fürsterzbischofs befiehlt Kaiser Joseph I., dass auch gegen alle nach dem 11. Januar 1706 verhafteten Anführer des Aufstands höchstens Geldstrafen auszusprechen sind.
29. 1 1706 - Die Münchner Anführer werden hingerichtet
München-Graggenau * Am Münchner Schrannenplatz ist eine Schaubühne errichtet worden, auf der der Eisenhändler Sebastian Senser, der Weinwirt Johann Georg Küttler, die ehemaligen Leutnante Johann Clanze und Johann Georg Aberle wegen Hochverrats durch das Schwert hingerichtet werden. Küttler wird zudem gevierteilt. Seine Leichenteile werden an den vier Stadttoren zur Abschreckung aufgehängt.
17. 2 1706 - Ein kaiserlicher Erlass beendet die Zwangsrekrutierungen
Wien * Ein kaiserlicher Erlass beendet die Zwangsrekrutierungen. Kein baierischer Rekrut darf mehr mit Zwang zum Militärdienst berufen werden.
6. 3 1706 - Marchesa Anna Maria Katharina besitzt die Hofmark Haidhausen
Hofmark Haidhausen * Erst nach einer gerichtlichen Auseinandersetzungen mit einem Sohn Fuggers aus erster Ehe und durch einen Vergleich kommt Anna Maria Katharina Gräfin von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn in den vollständigen Besitz der Hofmark Haidhausen.
Doch noch immer steht das vom Kurfürsten Max Emanuel beanspruchte Einlösungsrecht im Raum. Die clevere Witwe nutzt jedoch die Zeichen der Zeit.
17. 3 1706 - Der „Jägerwirt“ Johannes Jäger wird hingerichtet und gevierteilt
<p><strong><em>München</em></strong> * Der <em>„Jägerwirt“</em> Johannes Jäger wird in München durch das Schwert hingerichtet und gevierteilt. Zur Abschreckung werden seine vier Leichenteile an den Haupttoren der Stadt aufgehängt.</p>
17. 3 1706 - Matthias Kraus wird in Kelheim hingerichtet
<p><strong><em>Kelheim</em></strong> * Matthias Kraus wird in Kelheim hingerichtet. Der Galgen steht an der Stelle, an der bis wenige Tage zuvor seine Haus stand. Es wurde geschleift. Auch Matthias Kraus wird gevierteilt.</p>
21. 4 1706 - Reichsacht über die wittelsbachischen Kurfürsten
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Die Reichsacht wird über die beiden wittelsbachischen Kurfürsten Joseph Clemens und Max Emanuel verhängt.</p>
29. 4 1706 - Das Ächtungsverfahren gegen Kurfürst Max Emanuel ist abgeschlossen
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Das Ächtungsverfahren gegen Kurfürst Max Emanuel ist abgeschlossen. Kaiser Joseph I. verhängt in einer eindrucksvollen Zeremonie die Reichsacht wegen <em>„Fried-Bruchs und Majestät-Verletzung“ </em>über den baierischen Kurfürsten und erklärt ihn seiner Ämter enthoben. Damit ist er vogelfrei.</p> <p>Sein Rang und seine Kurfürstenwürde werden zusammen mit dem Besitz der Oberpfalz dem Kurfürsten der Pfalz zuerkannt.</p>
5 1706 - Die baierischen Kurprinzen werden nach Klagenfurt gebracht
Klagenfurt * Die vier ältesten baierischen Kurprinzen Carl Albrecht (* 1697), Philipp Moritz (* 1698), Ferdinand Maria Innozenz (* 1699) und Clemens August (* 1700) werden nach Klagenfurt gebracht.
Prinzessin Maria Anna (* 1696) und die jüngeren Prinzen Johann Theodor (* 1703) sowie Max Emanuel Thomas (* 1704) bleiben in München.
10. 5 1706 - Die Reichsacht über Max Emanuel wird ausgerufen
München-Graggenau * Der Reichsherold verkündet auf dem Münchner Schrannenmarkt unter Trommelwirbel das „Achtpatent“ für den baierischen Kurfürsten Max Emanuel. In diesem heißt es: „Max Emanuels unglücklicher Leib wird jedermänniglich frei gelassen und jeder darf sich an ihm ohne Strafe verfreveln.“
23. 5 1706 - Max Emanuel wird in der Schlacht bei Ramillies vernichtend geschlagen
Ramilies * Kurfürst Max Emanuel stößt in der Schlacht bei Ramillies auf die holländisch-englische Armee unter dem Oberbefehl des Herzogs von Marlborough.
- Max Emanuel wird - wie in der Schlacht von Höchstädt - vernichtend geschlagen.
- Dadurch verliert er Flandern und Brabant.
- Ihm bleibt nur mehr ein Schloss bei Mons.
- Die französische Front bricht zusammen.
- Brüssel wird aufgegeben.
15. 8 1706 - Kurfürst Joseph Clemens wird in Lille zum Subdiakon geweiht
Lille * Kölns Kurfürst Joseph Clemens wird in Lille zum Subdiakon geweiht.
8. 12 1706 - Kurfürst Joseph Clemens wird in Lille zum Diakon ernannt
Lille * Kurfürst Joseph Clemens von Köln wird in Lille zum Diakon ernannt.
25. 12 1706 - Der Kölner Kurfürst Joseph Clemens erhält die Priesterweihe
Lille * Der Kölner Kurfürst Joseph Clemens erhält die Priesterweihe.
1. 1 1707 - Kölns Kurfürst Joseph Clemens liest in Lille seine erste Messe
Lille * Joseph Clemens, der Kölner Kurfürst, liest - mit großem Aufwand - seine erste Messe. Zu diesem Ereignis werden eigens silberne und kupferne Medaillen herausgegeben.
3. 10 1707 - Joseph Wüst wird Schulmeister in Haidhausen
Haidhausen * Als der Haidhauser Schulmeister Melchior Eizinger stirbt, übernimmt der aus Braunau stammende Joseph Wüst die Stelle. Auch er muss zuvor die Witwe Pubenstuber heiraten.
10. 12 1707 - Lille ergibt sich den Alliierten Truppen
Lille * Lille, der Aufenthaltsort von Kurfürst Joseph Clemens, ergibt sich den Alliierten Truppen. Er wählt daraufhin Mons als Zufluchtsort.
1708 - Obrigkeitliches Einschreiten gegen die „neu aufgerichtete Caffeehäuser“
München * Die Obrigkeit sieht sich zum Einschreiten gegen die „neu aufgerichtete Caffeehäuser“ veranlasst.
Als „ordentlich konzessionierte und berechtigte Caffeesieder“ werden genannt: der „Hofzuckerbäcker“ Claudi Surat, André Bellini und Johann Koller.
Spätestens 1 1708 - Giovanni Antonio Viscardi wird „kayserlicher Hofpaumeister“
Wien - Freystadt - München * Giovanni Antonio Viscardi wird aufgrund seiner vom ihm gebauten Wallfahrtskirche Maria Hilf bei Freystadt spätestens im Januar 1708 zum „kayserlichen Hofpaumeister“ ernannt.
Für Giovanni Antonio Viscardi bedeutete die Ernennung die höchstmögliche Anerkennung. Denn in Diensten des Kaisers zu stehen war - neben einer Anstellung beim Papst - durch nichts mehr zu toppen.
22. 10 1708 - Kurfürst Max Emanuel muss sich ins französische Exil begeben
Lille * Lille ergibt sich. Kurfürst Max Emanuel muss sich ins französische Exil begeben.
8. 12 1708 - Franz I. Stephan von Lothringen wird in Nancy geboren
Nancy * Franz I. Stephan von Lothringen, der spätere Kaiser und Gemahl von Maria Theresia, wird in Nancy geboren.
1709 - Kurfürst Joseph Clemens verlegt seine Zufluchtsstätte nach Valenciennes
Valenciennes * Kurfürst Joseph Clemens verlegt seine Zufluchtsstätte nach Valenciennes.
Notdürftig von Frankreichs König Ludwig XIV. ausgehalten, fristet er ein tristes Emigranten-Dasein.
1709 - Giovanni-Antonio Viscardi errichtet die Bürgersaalkirche
München-Kreuzviertel * Mit dem Bau des Bürgersaals und der Bürgersaalkirche für die Jesuiten erhält Giovanni Antonio Viscardi in München einen neuen zivilen Bauauftrag.
Der Bürgersaal ist eine gestreckte rechteckige Halle von 46,6 m Länge, 14,3 m Breite und 13,3 m Höhe.
Wieder ist es die kaiserliche Besatzungsmacht, die mit Viscardis Ernennung enormen Einfluss auf den Bau der Bürgersaalkirche und der Dreifaltigkeitskirche und deren Aussehen ausübt.
1709 - Die Straubinger Dreifaltigkeitssäule entsteht
Straubing * Die Straubinger Dreifaltigkeitssäule entsteht zu einem Zeitpunkt, als der baierische Kurfürst Max Emanuel durch Abwesenheit glänzt und München sowie ganz Baiern durch eine Kaiserliche Administration regiert wird.
1. 5 1709 - Kurfürst Joseph Clemens erhält in Mons die Bischofsweihe
<p><strong><em>Mons</em></strong> * Kurfürst Joseph Clemens erhält vom Bischof von Cambrai, François de Salingnac de la Mothe-Fénelon, in Mons die Bischofsweihe. Dabei erklärt er feierlich, dass er künftig keinerlei intimen Beziehungen mit seiner Mätresse unterhalten will. Sein zweiter Sohn wird jedoch vier Jahre später geboren. </p>
11. 9 1709 - Kurfürst Max Emanuel muss immer weiter fliehen
Compiègne * Nach der Schlacht bei Malplaquet muss sich Kurfürst Max Emanuel nach Compiègne zurückziehen. Später nach Marly und Suresnes.
14. 10 1709 - Eine päpstliche Genehmigung ist notwendig
Au - Freising * Johann Maximilian von Alberti wendet sich an den ihm gewogenen Bischof von Freising, um „das hochwürdigste Gut für ständig in der Kapelle einsetzen und zeitweilig zur öffentlichen Anbetung aussetzen“ zu dürfen. Da es sich bei dem Kirchlein am Gaisberg um eine Privatkapelle handelt, ist dazu die Zustimmung durch die höchste katholische Instanz notwendig, den Papst.
12 1709 - Die Verhandlungen Max Emanuels über einen „Seperatfrieden“ beginnen
??? * Die Verhandlungen Max Emanuels über einen „Separatfrieden“ beginnen.
Sie dauern bis Anfang 1710 - und scheitern.
19. 12 1709 - Papst Clemens XI. ist für die ständige Aufbewahrung des Allerheiligsten
Rom-Vatikan - Au * Papst Clemens XI. gibt sein Einverständnis für die ständige Aufbewahrung des Allerheiligsten in der Kapelle am Gaisberg.
1710 - Die „Konvente“ der „Marianischen Männerkongregation“ im „Bürgersaal“
München-Kreuzviertel * Die zunächst im „Jesuitenkolleg“ durchgeführten „Konvente“ der „Marianischen Männerkongregation“ werden nach dem Erwerb und Umbau eines vergrößerten Anwesens am Ort der heutigen „Bürgersaalkirche“ dorthin verlegt.
Für die Zusammenkünfte muss aber das „Allerheiligste“ jeweils von der „Michaelskirche“ in feierlicher Prozession in den „Konventssaal“, den „Bürgersaal“, übertragen werden.
1710 - Einweihung der Wallfahrtskirche Maria Hilf
Freystadt * Aufgrund des Übergreifens des Spanischen Erbfolgekriegs auch auf die Oberpfalz - kann die von Giovanni Antonio Viscardi errichtete Wallfahrtskirche in Freystadt in der Oberpfalz erst im Jahr 1710 eingeweiht werden.
Die Wallfahrtskirche Maria Hilf bei Freystadt wird als der „einheitlichste Zentralbau des bayrischen Hochbarocks“ bezeichnet. Das Bauwerk beeinflusste die „Weiterentwicklung der Sakralbaukunst“ im 18. Jahrhundert nachhaltig.
23. 1 1710 - Kurfürst August der Starke gründet Europas erste Porzellanmanufaktur
Meißen * Kurfürst August der Starke von Sachsen und König von Polen gründet Europas erste Manufaktur für Hartporzellan, nachdem es dem Alchymisten Johann Friedrich Böttger im Jahr zuvor gelungen war, erstmals Porzellan herzustellen.
29. 5 1710 - Das Allerheiligste kommt aus der Haidhauser Johann-Baptist-Kirche
Haidhausen - Au * Nachdem es mit den Paulaner-Patres zu Problemen wegen der Überführung des Allerheiligsten gekommen ist, wendet sich Johann Maximilian von Alberti erneut an den Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck. Dieser erlaubt ihm die Übertragung des Allerheiligsten aus der Haidhauser Sankt-Johann-Baptist-Kirche.
Die eifersüchtig auf ihre Rechte pochenden Paulaner befürchten, dass auf sie eine Schmälerung ihrer Einnahmen durch Lesen von Messen in der Kapelle am Gaisberg, aber auch bei den Spenden im Opferstock zukommen und letztlich für die Mariahilf-Wallfahrt eine starke Konkurrenz erwachsen würde.
1. 6 1710 - Das Allerheiligste wird zum Gaisberg übertragen
Haidhausen - Au * Unter Beteiligung höchster Herrschaften wird das Allerheiligste von der Haidhauser Sankt-Johann-Baptist-Kirche in die von Johann Maximilian von Alberti erbaute Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Maria am Gaisberg übertragen.
30. 8 1710 - Johann Maximilian von Alberti und die nächste Phase der Klosterwerdung
Au * Mit der Erbschaft seiner verstorbenen Frau nimmt Bürgermeister Johann Maximilian von Alberti die nächste Phase der Klosterwerdung auf dem Gaisberg in Angriff. Er stellt einen mit 12.000 Gulden dotierten „Fundationsbrief zur Aufrichtung eines Jungfrauenklosters nach der Regel des hl. Benedikt“ aus.
16. 11 1710 - Johann Maximilian von Alberti heiratet Maria Katharina von Joner
Au * Johann Maximilian von Alberti heiratet in der Gaisberg-Klosterkirche die 22-jährige Maria Katharina von Joner, nachdem seine Frau in der Zwischenzeit verstorben ist.
1711 - Das „Kloster auf dem Gaisberg“ wird erweitert
Au * Johann Maximilian von Alberti lässt den noch fehlenden Flügel rechts von der Kapelle ausführen.
Damit bietet das „Kloster auf dem Gaisberg“ Platz für zwölf „Jungfrauen“.
1711 - Die „Alte Isarkaserne“ entsteht zwischen Großer und Kleiner Isar
München-Isarvorstadt * Auf der Insel zwischen Großer und Kleiner Isar entsteht eine „Kavallerie-Kaserne“, die „Alte Isarkaserne“.
17. 4 1711 - Kaiser Joseph I. stirbt überraschend
Wien * Kaiser Joseph I. stirbt überraschend. Josephs Bruder Carl, der als König Carl III. den Thron Spaniens beanspruchte, wird sein Nachfolger in Österreich und als Kaiser Carl VI. im Reich.
25. 4 1711 - Der neue Haidhauser „Kleinwirt“ Kaspar Öttl erhält das „Schankrecht“
Haidhausen * Der neue „Kleinwirt“ von Haidhausen, Kaspar Öttl, kann den Erhalt der Wirtschaft sichern, nachdem er von der Hofsmarkherrin, der Gräfin Anna Maria von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn, das „Schankrecht für Weiß-, Braunbier und Branntwein“ sowie das Recht zur „Haltung von Spielleuten“, „Kegelplätzen“ und der Abhaltung von „Kindsmählern“ erhalten hat.
Der „Kleinwirt“ und der „Großwirt“ sind bis in das 19. Jahrhundert hinein die einzigen Wirte in Haidhausen, das heißt, nur die Beiden besitzen das „Schankrecht“, können also Getränke weitergeben.
11. 5 1711 - Zustimmung für den Klosterbau der Karmelitinnen
Wien - München * Die Kaiserwitwe Eleonore Magdalena Theresia aus Wien gibt ihre Zustimmung, in München ein „Karmelitinnenkloster der theresianischen Reform“ für zwanzig Frauen zu bauen und das Haus der Nonnen mit der gelobten Dreifaltigkeitskirche zu verbinden.
Als Architekt soll Giovanni Antonio Viscardi tätig werden.
17. 9 1711 - Gründung des Münchner Karmelitinnenklosters
München * Das Karmelitinnenkloster in München wird gegründet. Die ersten vier aus Österreich kommenden Karmelitinnen werden am 14. Oktober eintreffen.
12. 10 1711 - Carl VI. wird römisch-deutscher König
Frankfurt am Main * Carl VI. wird römisch-deutscher König.
14. 10 1711 - Maria Anna Lindmayr wird Karmelitin
München-Kreuzviertel * Maria Anna Lindmayr wird in das am 17. September 1711 gegründete Karmeltinnenkloster aufgenommen. Damals treffen die ersten vier aus Österreich kommenden Karmelitinnen in München ein. Sie finden ihre vorläufige Unterkunft Ecke Pacellistraße/Promenadeplatz, wo ihnen die Lindmayrin ein provisorisches Kloster eingerichtet hat. Das war noch bevor mit dem Bau der Dreifaltigkeitskirche begonnen wurde.
11. 12 1711 - Die Paulaner-Patres verzögern die Kloster-Genehmigung
Au * Die Eifersüchtig auf ihre Einkünfte achtenden Paulaner-Patres verzögern die Genehmigung des Klosters auf dem Gaisberg über ein Jahr. Erst dann kann der Papst die Konzessionsurkunde ausstellen.
1712 - Die Hofhaltung der baierischen Kurprinzen wird nach Graz verlegt
Klagenfurt - Graz * Die Hofhaltung der baierischen Kurprinzen Carl Albrecht, Philipp Moritz, Ferdinand Maria Innocenz, Clemens August und Johann Theodor wird von Klagenfurt nach Graz verlegt.
Ihre Schwester Maria Anna Carolina bleibt weiterhin in München.
Das Nesthäkchen Max Emanuel ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben.
1712 - Über die „Hieronymiten“ am Walchensee wird das „Interdikt“ verhängt
Walchensee * Der Abt von Benediktbeuern erreicht, dass über das Kloster der „Einsiedler-Brüder der Hieronymitaner“ am Walchensee das „Interdikt“, die „Gottesdienstsperre“, verhängt wird.
22. 5 1712 - Einkleidung der Maria Anna Lindmayr
München * Am Dreifaltigkeitsfest erhält Maria Anna Lindmayr die Zulassung zum Noviziat, verbunden mit der Einkleidung.
1713 - „Pater Onuphrius“ erreicht die römische Anerkennung seiner Gemeinschaft
Walchensee * Das „Interdikt“, die „Gottesdienstsperre“, über die „Hieronymitaner“ wird bald wieder aufgehoben und „Pater Onuphrius“ erreicht endlich die römische Anerkennung seiner Gemeinschaft.
Im Gegenzug beginnt der „Abt“ von Benediktbeuern nun ein „Priorat“ unmittelbar neben den „Klausen“ am Walchensee zu errichten, um die „Dahergelaufenen Waldbrüder“ auszuschalten.
1713 - „Die ganz ungescheucht in der Au sich aufhaltenden Huren“ weggejagt
München - Au * Der „Hofoberrichter“ Pistorini brüstet sich damit, er habe „die ganz ungescheucht in der Au sich aufhaltenden Huren“ mit öffentlichen Spott davongejagt.
22. 3 1713 - Der Ordensprofess der Maria Anna Lindmayr
München * Maria Anna Lindmayr kann die feierliche Ordensprofess ablegen und den Namen „Josepha a Jesu“ annehmen.
11. 4 1713 - Friedensverhandlungen von Utrecht ohne den Kaiser
<p><strong><em>Utrecht</em></strong> * Großbritannien nimmt mit Frankreich Friedensverhandlungen auf. Während Frankreich, England, Holland, Savoyen, Portugal und Preußen den Vertrag von Utrecht unterzeichnen, verweigert der kaiserliche Gesandte die Unterschrift. </p> <ul> <li>Das spanisch-habsburgische Riesenreich wird nicht wiederhergestellt.</li> <li>Spanien bleibt in den Händen der französischen Bourbonen, darf aber keinesfalls mit Frankreich vereinigt werden.</li> <li>Die Spanischen Niederlande fallen an den Kaiser, Holland erhält einige Sperrfestungen gegenüber Frankreich und besetzt die Gegenküste zum Inselreich.</li> <li>Die italienischen Besitzungen Spaniens fallen an Österreich, Sizilien aber an das Haus Savoyen.</li> <li>Der baierische Kurfürst wird wieder - mit dem Rang eines neunten Kurfürsten - in seine Herrschaft und Länder - außer der Oberpfalz - eingesetzt.</li> <li>Die Erhebung Preußens zum Königreich wird anerkannt.</li> </ul>
10. 6 1713 - Das Schleierfest der Maria Anna Lindmayr
München * Maria Anna Lindmayr feiert ihr Schleierfest. Um Gott näher zu kommen geißelt sie sich mit Ruten, hungert, trägt Stachelketten oder schläft auf Brennnesseln.
8 1713 - Max Emanuel übersiedelt nach „Saint Cloud“
Saint Cloud * Der verfolgte baierische Kurfürst Max Emanuel übersiedelt nach „Saint Cloud“.
13. 8 1713 - Obergiesing und die Lohe kommen zum Gericht ob der Au
Obergiesing * Obergiesing und die Lohe werden dem Gericht ob der Au negst München zugeschlagen. Das geschieht auch, um die dort „eindringenden Fremden und Bettelleut“ besser überwachen zu können.
9 1713 - Vitus Rambold wird Haidhauser „Schulmeister“
Haidhausen * Vitus Rambold wird Haidhauser „Schulmeister“.
27. 9 1713 - Giovanni Antonio Viscardi stirbt
München * Giovanni Antonio Viscardi stirbt.
Den Bau der Dreifaltigkeitskirche beenden sein Palier Johann Georg Ettenhofer und der neue Hofbaumeister Enrico Zucalli.
1714 - Kurfürst Joseph Clemens gründet in Lille eine „Michaels-Bruderschaft“
Lille * Kurfürst Joseph Clemens gründet in Lille eine „Michaels-Bruderschaft“.
Ab 1714 - Die neue „Franziskaner-Provinz“ erreicht ihre höchste Blüte
München * Die neue „Franziskaner-Provinz“ kann sich aufgrund der Rahmenbedingungen günstig entfalten und erreicht ihre höchste Blüte in den Jahren von 1714 bis 1738.
20. 2 1714 - Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Baiern geschlossen
München - Versailles * Zwischen dem baierischen Kurfürsten Max Emanuel und Frankreichs König Ludwig XIV. wird ein Freundschaftsvertrag unterzeichnet.
6. 3 1714 - Der „Frieden von Rastatt“
Rastatt * Da der Kaiser dem Frieden von Utrecht nicht beigetreten ist, bleibt der Oberrhein Kriegsschauplatz. Hier finden die Friedensverhandlungen zwischen Frankreich und dem Kaiser statt. Die beiden Heerführer, Prinz Eugen von Savoyen für den Kaiser und der französische Marschall Claude-Louis-Hector de Villars, führen ihre Verhandlungen im badischen Rastatt.
Kaiser Carl VI. sieht sich dann aber gezwungen, auf der Grundlage des Utrechter Friedens den Frieden von Rastatt abzuschließen. Das bedeutet, dass das Elsass bei Frankreich bleibt, Österreich dafür die Herrschaft über die Lombardei, Neapel und Sardinien behält.
Kurfürst Max Emanuel wird wieder in seine Rechte und Ehren eingesetzt, ja selbst die Oberpfalz bekommt er wieder. Und er darf wieder nach Baiern zurückkehren; doch das stellt für ihn die am wenigsten wünschenswerte Option dar. Auch Sein Bruder Joseph Clemens, Kurfürst von Köln, kann wieder seine Funktionen ausüben.
26. 6 1714 - Der Utrechter Frieden wird geschlossen
Utrecht * Der Utrechter Frieden wird geschlossen. Philipp V. wird als spanischer König anerkannt, muss aber auf große Gebietsteile verzichten. Einzig Auflage: Er darf seine Krone niemals mit der Frankreichs vereinigen.
1. 8 1714 - Georg Ludwig von Hannover wird englischer König
London - Hannover * Die englische Königswürde geht gemäß den Bestimmungen des Act of Settlement an Georg Ludwig von Hannover über. Damit endete die Herrschaft des Hauses Stuart.
5. 8 1714 - Die Vision der Maria Anna Lindmayr
München * Die erste schriftliche Niederlegung der Vision der Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr stammt von diesem Tag und wird von der Lindmayrin selbst verfasst. Im „Gelübde der drei Stände“ vom 17. Juli 1704 wird die Vision nicht einmal erwähnt.
Das zeigt wie falsch es ist, dass auch in der aktuellen Literatur immer wieder darauf hingewiesen wird, dass der Bau der Dreifaltigkeitskirche und das damit verbundene Gelöbnis der drei Münchner Stände „zur Abwehr der Zerstörung Münchens im Spanischen Erbfolgekrieg“ auf Veranlassung der Maria Anna Lindmayr erfolgt sei.
7. 9 1714 - Der Friede von Baden beendet den Spanischen Erbfolgekrieg
Baden * In Baden im Aargau wird der Friede von Baden geschlossen. Er ist einer der Friedensschlüsse zum Ende des Spanischen Erbfolgekriegs, der den Frieden von Utrecht und dem Frieden von Rastatt bestätigt. Damit ist der Spanische Erbfolgekrieg endgültig beendet. Kurfürst Max Emanuel wird erneut in seine alten Rechte eingesetzt, weshalb sich die Kaiserliche Administration nach Wien zurückzieht.
27. 9 1714 - Die geächteten Kurfürsten können wieder in ihre Länder zurückkehren
Rastatt * Die im Frieden von Rastatt getroffenen Vereinbarungen werden auf das Reich übertragen.
Damit können die geächteten Kurfürsten
- Max Emanuel von Baiern und
- Joseph Clemens von Köln
wieder in ihre Länder zurückkehren.
8. 10 1714 - Das neue Kloster der Karmelitinnen
München-Angerviertel - München-Kreuzviertel * Die Karmelitinnen werden durch die Klarissin Emanuela Theresia a Corde Jesu aus dem Angerkloster, der einzigen Tochter des baierischen Kurfürsten Max Emanuel, in ihr neues Kloster eingeführt.
22. 11 1714 - Die fehlende Zustimmung des Landesherrn trifft ein
Saint Cloud - Au * Die fehlende Zustimmung des Landesherrn aus Schloss Saint Cloud für das Kloster am Gaisberg trifft ein. Dort lebt Kurfürst Max Emanuel im Exil.
1715 - Auf dem Nordteil der „Isarinsel“ entsteht ein „Militärholzgarten“
München-Lehel * Auf dem Nordteil der „Isarinsel“ entsteht ein „Militärholzgarten“.
1715 - Die Münchner Kasernen bieten Unterkunft für 1.568 Mann
München * Die Münchner Kasernen bieten Unterkunft für 1.568 Mann.
1715 - Die Walchenseer „Einsiedler-Brüder“ kommen in Bedrängnis
Benediktbeuern - Walchensee * Als der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck Benediktbeuern besucht, wird zur allgemeinen Belustigung ein „Drama melodico-satyricum“ aufgeführt, ein satirisches Singspiel mit dem Titel „Eremitae Walchenseenses“.
In dieser Bedrängnis kommt den „Einsiedler-Brüdern“ Hilfe aus dem „Lehel“, da sich die dort ansässigen zweitausend, meist einfachen und ärmeren Bewohner seelsorglich vernachlässigt fühlen.
1715 - Der große baierischen „Kinderhexenprozess“ in Freising
Freising * Der große baierischen „Kinderhexenprozess“ geht in Freising, in zwei Teilen vonstatten.
Die „Bettelkinder“ Andre, genannt der „Drudenfanger“, und Lorenz werden unter der Beschuldigung, „Ferkel und Mäuse“ hergezaubert zu haben, verhaftet.
Die Verhöre ergeben weitere Beschuldigungen.
18. 1 1715 - Die kaiserlichen Truppen verlassen München wieder
München * Die letzten kaiserlichen Truppen verlassen nach dem Frieden von Rastatt vom 27. September 1714 die baierische Haupt- und Residenzstadt.
23. 3 1715 - Max Emanuel verlässt Versailles in Richtung Baiern
Versailles - München * Max Emanuel verlässt Versailles und reist nach Baiern zurück.
8. 4 1715 - Kurfürst Max Emanuel trifft nach elf Jahren seine Familie wieder
<p><strong><em>Lichtenberg am Lech</em></strong> * In Lichtenberg am Lech treffen Kurfürst Max Emanuel, Kurfürstin Therese Kunigunde und ihre Kinder nach elf Jahren wieder zusammen. Die Ehefrau kommt aus Venedig, die Kinder aus Graz. </p>
Nach dem 11. 4 1715 - Kurfürst Max Emanuel lässt er alle Juden aus dem Land weisen
<p><strong><em>München</em></strong> * Nachdem Kurfürst Max Emanuel aus seinem Exil wieder nach Baiern zurückgekehrt ist, lässt er alle Juden aus dem Land weisen.</p> <ul> <li>Dabei hat die Kurbaierische Landschaftsverordnung, die Vertretung der Landstände, in den letzten Monaten der kaiserlichen Besatzungsherrschaft auf jüdische Finanzmittel zurückgegriffen.</li> <li>Um den Abzug der kaiserlichen Besatzungstruppen zu beschleunigen, hat sie die ausstehenden kaiserlichen Forderungen und alle Landesausgaben übernommen.</li> <li>Diese Aufwendungen hat sich die Landschaftsverordnung von jüdischen Geldgebern finanzieren lassen. </li> <li>Als Gegenleistung gesteht man den Kreditgebern den freien Aufenthalt im Kurfürstentum bis zur Zurückzahlung der Schulden zu.</li> </ul>
Ab 5 1715 - Die bestraften „Anführer des Volksaufstands“ werden begnadigt
München * Kurfürst Max Emanuel begnadigt zum großen Teil die bestraften „Anführer des Volksaufstands“ und setzt sie wieder in ihre Ämter ein.
5 1715 - Ignaz Haid kommt nach der Rückkehr des Kurfürsten wieder frei
München * Ignaz Haid wird anno 1706 zu lebenslanger Haft verurteilt.
Auch er kommt nach der Rückkehr des Kurfürsten Max Emanuel wieder frei.
5 1715 - „Hauptmann“ Matthias Mayer wird „ehrlich“ gesprochen
München * „Hauptmann“ Matthias Mayer wird 1706 zu einer Haftstrafe verurteilt und kommt nach der Rückkehr des Kurfürsten Max Emanuel wieder frei.
Er wird „ehrlich“ gesprochen und wieder in der baierischen Armee aufgenommen.
8. 5 1715 - Joseph Clemens gründet in Berchtesgaden eine Michaels-Bruderschaft
Berchtesgaden * Kurfürst Joseph Clemens gründet in der Franziskanerkirche in Berchtesgaden eine Michaels-Bruderschaft.
11. 7 1715 - Offizielle Einzug der kurfürstlichen Familie in die Stadt
München * Am 53. Geburtstag von Kurfürst Max Emanuel wird der offizielle Einzug der kurfürstlichen Familie in die Stadt nachgeholt.
1. 9 1715 - König Ludwig XIV. von Frankreich stirbt
Versailles * König Ludwig XIV. von Frankreich stirbt.
21. 11 1715 - Das Kloster am Lilienberg wird eine Benediktinerinnen-Niederlassung
Au * Die ersten zwei Klosternonnen vom Kloster Niedernburg treffen am Gaisberg ein. Maria Agnes Dascher wird als Priorin das Kloster leiten, Maria Antonia von Eiseneck als Wirtschaftsleiterin die Geschicke der Klostergemeinschaft lenken.
Danach unterstellt man ihnen die sechs schon vorhandenen Nonnen und erhebt die Gemeinschaft zum Benediktinnerinnenkloster, für das sich bald der Name Lilienberg einbürgert.
23. 12 1715 - Über die Anzahl der Kaffee- und Teesieder muss berichtet werden
München * Die Anzahl der Kaffee- und Teesieder in München sowie den Ursprung ihrer Konzession muss an den Hofrat berichtet werden.
26. 3 1716 - Kurfürst Joseph Clemens wird Bischof von Hildesheim
<p><strong><em>Hildesheim</em></strong> * Kölns Kurfürst Joseph Clemens wird zum Bischof von Hildesheim gewählt. Er übergibt das Bistum Regensburg, das er aufgrund des Regierungsantritts in Hildesheim abgeben muss, an seinen 15-jährigen Neffen Clemens August.</p>
5. 8 1716 - Prinz Eugen von Savoyen besiegt die Türken bei Peterwardein
Peterwardein * Prinz Eugen von Savoyen besiegt die Türken bei Peterwardein.
22. 12 1716 - Das erste urkundlich nachgewiesene Haberfeldtreiben
Vagen bei Bruckmühl * Das erste urkundlich nachgewiesene Haberfeldtreiben findet in Vagen bei Bruckmühl statt. Man treibt der Ursula Steindl wegen Leichtfertigkeit. In dieser Nacht erscheinen 20 bis 30 Burschen und Männer vor dem Haus des Hannes Steindl und haben „seine Tochter zum spot in das sogenante haaber veld getriben, das sie mit allerhand iniuriosen geschray, schnalzen und stain werfen samt and. Rumorereyen veriebet“.
1717 - Der der „Hexerei“ beschuldigte Andre erhängt sich in seiner Zelle
Freising * Der der „Hexerei“ beschuldigte Andre erhängt sich in seiner Zelle.
Ein weiterer Junge stirbt in der Zelle.
7. 2 1717 - Der Regensburger Bischof Clemens August trifft in Rom ein
Rom * Der 16-jährige Regensburger Bischof Clemens August trifft in Begleitung seines älteren Bruders Philipp Moritz in Rom ein.
Sie erhalten eine Audienz beim Papst, unter dessen Aufsicht sie auch studieren dürfen.
Die Kontakte zum Papst und der römischen Kurie sollen die kanonischen Hürden bei der Besetzung von weiteren Bischofsstühlen erleichtern.
13. 5 1717 - Maria Theresia wird in Wien geboren
Wien * Maria Theresia, die künftige Kaiserin und Gemahlin von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, wird in Wien geboren.
16. 8 1717 - Belgrad wird durch Prinz Eugen von Savoyen zurückerobert
Belgrad * Belgrad wird durch die Truppen des Prinzen Eugen von Savoyen zurückerobert.
12. 11 1717 - Drei Jungen werden mit Schwert und Feuer hingerichtet
<p><strong><em>Freising</em></strong> * Drei Jungen, die in der Bischofsstadt Freising der Hexerei beschuldigt werden, werden mit Schwert und Feuer hingerichtet, zwei andere Buben müssen dabei zusehen. </p>
1718 - Maximilian II. Johann Franz von Preysing-Hohenaschau stirbt
München - Haidhausen * Reichsgraf Maximilian II. Johann Franz von Preysing-Hohenaschau stirbt.
Sein Haidhauser Anwesen hat er bis dahin zu einem 6 Tagwerk großen Landsitz ausbauen und erweitern können.
1718 - Bischof Clemens August wird zum
Altötting * Bischof Clemens August wird zum "Probst von Altötting" ernannt.
5. 5 1718 - Das „Schloss Suresnes“ wird ein „Adelssitz mit Niedergerichtsbarkeit“
Schwabing * Kurfürst Max Emanuel lässt das Schlösschen seines „Geheimen Rats“ und „Kabinettsekretärs“ Ignaz von Wilhelm unter dem Namen „Sourenne“ zu einem „adeligen Sitz erheben und mit der Niedergerichtsbarkeit“ ausstatten.
Das Schloss mit seinem Garten an der Werneckstraße in Schwabing ist noch erhalten und trägt den Namen „Suresnes“.
2. 9 1718 - Kurfürst Max Emanuel erteilt dem Pferdehändler Joseph Mändle Hofschutz
München * Kurfürst Max Emanuel erteilt dem Pferdehändler Joseph Mändle als erstem Juden den Hofschutz und damit eine Aufenthaltsberechtigung in München. Die Geschäftsbeziehungen zwischen Mändle und Kurbaiern werden mit der Zeit immer intensiver.
1719 - Joseph Joachim Singlspieler übernimmt den „Singlspielerbräu“.
München-Angerviertel * Franz Singlspielers Sohn Joseph Joachim übernimmt den „Singlspielerbräu“.
1719 - Die Witwe des „Jägerwirts“ Johannes Jäger stirbt völlig verarmt
München * Die Witwe des „Jägerwirts“ Johannes Jäger stirbt völlig verarmt in München.
1719 - Fortführung der Bauarbeiten am neuen „Schloss Schleißheim“
Schloss Schleißheim * Die Bauarbeiten am neuen „Schloss Schleißheim“ werden fortgesetzt.
1719 - Herzog Ferdinand Maria Innocenz heiratet Maria Anna Carolina von Neuburg
München * Herzog Ferdinand Maria Innocenz ehelicht die Tochter des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg, Maria Anna Carolina.
Ihr gemeinsamer Sohn, Clemens Franz, ist neben dem Kurfürsten Max III. Joseph der einzige Vertreter der letzten baierisch-wittelsbachischen Generation.
1719 - Maria Anna Lindmayr wird erneut Priorin
München-Kreuzviertel * Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr wird für weitere drei Jahre in ihrem Amt als Priorin des Karmelitinnenklosters bestätigt.
12. 3 1719 - Kurprinz Philipp Moritz von Baiern stirbt in Rom
Rom * Kurprinz Philipp Moritz von Baiern stirbt in Rom überraschend an den Plattern.
14. 3 1719 - Philipp Moritz wird in Paderborn einstimmig zum Fürstbischof gewählt
Paderborn * In Unkenntnis seines Todes wird Philipp Moritz in Paderborn einstimmig zum Fürstbischof gewählt.
21. 3 1719 - Philipp Moritz wird in Münster einstimmig zum Bischof gewählt
Münster * Der baierische Kurprinz Philipp Moritz wird in Münster einstimmig zum Bischof gewählt. Die Nachricht vom Tod des jungen Wittelsbachers war in Münster noch nicht eingetroffen.
26. 3 1719 - Der 18-jährige Clemens August wird Bischof in Münster
Münster * Mit Unterstützung des Papstes wird der 18-jährige Clemens August anstelle seines Bruders Philipp Moritz Bischof in Münster.
27. 3 1719 - Bischof Clemens August wird Bischof von Paderborn
<p><strong><em>Paterborn - Regensburg</em></strong> * Clemens August wird anstelle seines verstorbenen Bruders Philipp Moritz Bischof von Paderborn. Er muss dafür sein Bistum Regensburg aufgeben.</p>
7 1719 - Johann Theodor muss als 16-jähriger das Bistum Regensburg übernehmen
Regensburg * Johann Theodor, der jüngste Sohn des baierischen Kurfürsten Max Emanuels muss als 16-jähriger das Bistum Regensburg von seinem älteren Bruder Clemens August übernehmen, obwohl er überhaupt keine Neigung zum geistlichen Stand in sich fühlt.
Der übermächtige Vater droht ihm - mit unbeugsamer Härte - mit der rechtlichen Zurücksetzung innerhalb der Familie. Damit bewegt er seinen Sohn zur Annahme dieses hohen und einträglichen Kirchenamtes.
Obwohl Johann Theodor bis zu seinem Tod im Jahr 1763 das Bistum Regensburg insgesamt 44 Jahre als Erzbischof regiert, glänzt er dort durch Abwesenheit und hält sich bevorzugt in den väterlichen Schlössern, später in seinem "Jagdschloss in Ismaning" auf.
Die tatsächliche Bistumsverwaltung übernehmen die vom Fürstbischof eingesetzten geistlichen Ratskollegien, Generalvikare und Weihbischöfe. Ungeachtet seiner Untätigkeit für die ihm anvertrauten Aufgabengebiete macht der Wittelsbacher Herzog dennoch Karriere.
1720 - Bischof Clemens August wird „Kölner Domherr“
Köln * Bischof Clemens August wird „Kölner Domherr“.
Ab 1720 - Von England aus entwickelt sich ein neuer Gartenstil
Großbritannien * Von England aus entwickelt sich ein neuer Gartenstil.
Philosophen, Dichter und Landschaftsmaler propagieren ein neues Persönlichkeitsbewusstsein und Naturgefühl. „Landschaftsgärten“ entsprechen immer mehr dem neuen „Gartenideal“.
1720 - Kurfürst Max Emanuel verschuldet sich bei jüdischen Geldgebern
München * Die prunkvolle Hofhaltung von Max Emanuel lassen den Finanzbedarf in gewaltige Dimensionen anwachsen und treibt den Kurfürsten verstärkt in die Arme jüdischer Geldgeber.
Auch deshalb, weil Baiern bei anderen Bankhäusern kaum noch als kreditwürdig angesehen wird.
Erstmals stellt ihm der burgauische „Hoffaktor“ Gerson Daniel Oppenheimer Geldmittel zum Teil in bar und zum Teil durch die Einlösung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung.
1721 - Nepomuk wird von Papst Innocenz XIII. „selig“ gesprochen
Rom-Vatikan - Prag * Nepomuk, der Beichtvater der böhmischen Königin Sophie, wird von Papst Innocenz XIII. „selig“ gesprochen.
1721 - Die Anklage von „Diebstahl“ in „Hexerei“ umgewandelt
Freising * Der Jugendliche Veit Adlwart kommt unter „Diebstahlsverdacht“ in Gewahrsam.
Kurzfristig wandelt man die Anklage von „Diebstahl“ in „Hexerei“ um.
Im weiteren Verlauf verhaften die Freisinger Behörden über 100 Personen, von denen die meisten jedoch wieder frei kommen.
1721 - In München lodert das letzte „Hexenfeuer“
München * In München lodert das letzte „Hexenfeuer“.
Die Tochter des „Hofstallknechts“ Dellinger wird erwürgt, bevor man ihren leblosen Körper dem Feuer übergibt.
Der „Geschichtsschreiber“ Andreas Felix Oefele bezeichnet sie als „ein elendes Mädchen, schwach und seiner Sinne nicht mächtig“.
17. 1 1721 - Elisabeth Auguste wird in Mannheim geboren
Mannheim * Elisabeth Auguste, die spätere pfalz-baierische Kurfürstin, wird in Mannheim geboren.
1. 12 1721 - Clemens August soll Nachfolger auf dem Kölner Bischofsstuhl werden
Köln * Kölns Kurfürst Joseph Clemens schlägt seinen Neffen Clemens August zu seinem Nachfolger auf dem Kölner Bischofsstuhl vor.
Mit Blick auf die Jugend und die fehlende Erfahrung in Regierungsangelegenheiten gibt es Unstimmigkeiten aus dem kaiserlichen Wien. Man gibt dem 21-jährigen Bewerber zu verstehen, dass er im Falle des Regierungsanttritts in Köln auf mindestens eines der beiden Bistümer (Freising oder Regensburg) verzichten muss.
1722 - Maria Anna Lindmayr wird Novizenmeisterin
München-Kreuzviertel * Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr lehnt eine weitere Wiederwahl zur Priorin des Karmelitinnenklosters ab. Sie wird aber von ihren Mitschwestern gedrängt, das Amt der Novizenmeisterin anzunehmen.
9. 5 1722 - Bischof Clemens August wird Koadjutor seines Onkels Joseph Clemens
Köln * Bischof Clemens August wird einstimmig zum Koadjutor [= Nachfolger] seines Onkels Joseph Clemens auf den Kölner Bischofsstuhl gewählt.
23. 5 1722 - Ein Te Deum zu Ehren des seligen Nepomuks
München-Kreuzviertel * In der Frauenkirche wird ein Te Deum [= Lob-, Dank- und Bittgebet] zu Ehren des „seligen“ Nepomuks gehalten.
6. 8 1722 - Geburtstags-Party in der Badenburg
<p><em><strong>Nymphenburg</strong></em> * Kurfürst Max Emanuel lädt zur Feier des 25. Geburtstags des Kurprinzen Carl Albrecht zu einem Souper und festlicher Illumination in das soeben vollendete Lustschloss Badenburg. </p>
18. 9 1722 - Das Privileg des Kaffeesiedens
München * Das „Privileg des Kaffeesiedens“ darf nur durch die kurfürstliche Regierung erteilt werden, nicht aber durch den Magistrat der Stadt.
25. 9 1722 - Kurprinz Carl Albrecht heiratet die Kaisertochter Maria Amalie
München * Baierns Kurprinz Carl Albrecht heiratet die Kaisertochter Maria Amalie.
5. 10 1722 - Kurprinz Carl Albrecht heiratet Erzherzogin Maria Amalia von Österreich
Wien * Der baierische Kurprinz Carl Albrecht heiratet in Wien die Erzherzogin Maria Amalia von Österreich, Tochter Kaiser Josephs I..
Zur Finanzierung der Hochzeitsfeierlichkeiten, aber auch für sonstige Luxusbedürfnisse des Hofes und zur Behebung der finanziellen Engpässe der kurfürstlichen Behörden gewährt der pfalz-sulzbachische Oberfaktor Noe Samuel Isaak aus Mergentheim dem Land gewaltige Finanzvorschüsse. Die Rückzahlung der Schulden wird in erster Linie einigen Salzämtern und der Landschaft übertragen.
Auch der Wiener Oberhoffaktor und Bankier Simon Wolf Wertheimer wird Gläubiger des kurfürstlichen Hauses.
Anno 1723 - Die Auer Marien-Kapelle erhält den Namen „Mariahilf-Kirche“
Au * Eine Erweiterung und Erneuerung der Auer Marien-Kapelle ist nicht mehr zu umgehen.
Erst jetzt erhält das Gebetshaus den Namen „Mariahilf-Kirche“.
1723 - Bischof Johann Franz Eckher schlägt Johann Theodor als Nachfolger vor
Freising * Der Freisinger Bischof Johann Franz Eckher von Kapfing, der im Jahr 1695 die Wahl gegen Joseph Clemens gewonnen hatte, schlägt den 20-jährigen Baiernherzog Johann Theodor zu seinem Nachfolger auf dem Bischofsstuhl vor.
1723 - Kurfürst Max Emanuel verkauft „öde Gründe“ in der „Schwabinger Hayd“
Schwabing * Der sich ständig in Geldnöten befindliche Kurfürst Max Emanuel verkauft „öde Gründe“ in der „Schwabinger Hayd“ - oberhalb des „Schwabinger Fischweihers“ - an sogenannte „Kulturanten“, die hier Gärten und Häuser errichten wollen.
Bis zum Jahr 1723 - Weitere Hinrichtungen im „Freisinger Prozess“
Freising * Zwischen 1721 und 1723 werden acht Burschen und junge Männer im Alter zwischen 14 und 23 Jahren und drei „Bettlerinnen“ mittleren Alters in Freising hingerichtet.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Zenit der „Hexen-Verfolgungen“ allerdings längst überschritten.
Der „Freisinger Prozess“ ist ein Auslaufmodell, was aber den „Hingerichteten“ allerdings nicht hilft.
9. 8 1723 - Simon Wolf Wertheimer wird zum geheimen Hofjuwelier ernannt
München * Kurfürst Max Emanuel ernennt den Wiener Oberhoffaktor und Bankier Simon Wolf Wertheimer zum geheimen Hofjuwelier. Wertheimer verlegt daraufhin den Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit nach München.
Joseph Mändle, Noe Samuel Isaak, Simon Wolf Wertheimer und Nathan Moyses, der dem Kurfürsten ebenfalls einen Kredit gewährt, werden die ersten „kurbaierischen Hofjuden“.
18. 8 1723 - Kurfürst Max Emanuel verkauft den Falkenhof in der Au
Au * Kurfürst Max Emanuel verkauft den Falkenhof in der Au an den kurfürstlichen Rat und „Admodiateur der Bräuhäuser“, also den für die Vergabe der Braugerechtigkeiten zuständigen Verwaltungsmann, Johann Georg Messerer aus Aibling. Die auf Münchner Boden befindlichen Falkenhäuser waren das älteste beim Alten Hof und das neuere beim Kosttor.
Der ehemalige Falkenhof in der Au befand sich an der heutigen Falkenstraße 36 und unterstand einem Aumeister. Nachdem die dort gehaltenen Falken und die anderen wertvollen Vögel unter der Feuchtigkeit des Bodens sehr litten und in großer Zahl zugrunde gingen, ließ Kurfürst Max Emanuel ein zweckmäßigeres Falkenhaus vor dem Neuhauser Tor neu erbauen.
Der Falkenhof in der Au wird zwar sofort zum adeligen Sitz erhoben, doch darf ihn Johann Georg Messerer erst nutzen, nachdem der dort wohnende Falkner den Neubau an der Arco-, Barer- und Karlstraße beziehen kann. Messerer muss den neuen Falkenhof zu einem nicht unerheblichen Teil finanzieren. Dennoch erwirbt der kurfürstliche Rat in der Zwischenzeit alles käufliche Land um seinen Hof, darunter die Riegermühle und das Säggängerl.
23. 8 1723 - Das Kloster am Lilienberg soll in den Münchner Burgfrieden
Au * Johann Maximilian von Alberti richtet eine Bitte an der Kurfürsten. Er soll das Benediktinnerinnenkloster am Lilienberg in den Münchner Burgfrieden einbeziehen.
12. 11 1723 - Kurfürst Joseph Clemens stirbt in Köln
Köln * Kurfürst Joseph Clemens, Fürstbischof der Bistümer Köln, Lüttich und Hildesheim stirbt in Köln und wird in der dortigen Domkirche beigesetzt.
Der 23-jährige Clemens August tritt das Amt eines Kurfürsten und Erzbischofs von Köln an, ohne das Bistum Münster oder Paderborn abgeben zu müssen.
1724 - Im Kurfürstentum wird eine „Tanzsteuer“ eingeführt
München * Im Kurfürstentum wird eine „Tanzsteuer“ eingeführt.
Die Weinwirte in München, Landshut, Straubing, Burghausen und Ingolstadt müssen 4 Gulden im Jahr bezahlen, in den übrigen Städten und Märkten 2 Gulden.
Die „Bierbrauer“ zahlen nur einen Gulden „Tanzsteuer“.
1724 - Der Münchner Rat wünscht die Eingemeindung der Au und der „Lohe“
München - Au - Untergiesing * Der Münchner Rat wünscht - aufgrund der Neufestsetzung des erweiterten Burgfriedens - die Eingemeindung der Au und der „Lohe“.
1724 - Carl Meichelbeck veröffentlicht den „Augsburger Schied“
München - Freising * Carl Meichelbeck veröffentlicht den „Augsburger Schied“, Münchens Gründungsurkunde, in seiner lateinischen „Historia Frisingensis“ und dem gleichzeitig erschienenen Buch mit dem Titel „Kurtze Freysingische Chronic“.
13. 1 1724 - Erweiterung des Burgfriedens um das Kloster am Lilienberg
München - Au * Gegen den Willen des Stadtrats erfüllt Kurfürst Max Emanuel die Bitte von Johann Maximilian von Alberti und stimmt der Erweiterung des Münchner Burgfriedens um das Kloster am Lilienberg zu.
8. 2 1724 - Der Kölner Kurfürst Clemens August wird Bischof in Hildesheim
<p><strong><em>Hildesheim</em></strong> * Die Domherren von Hildesheim wählen den 23-jährigen Kölner Kurfürsten Clemens August zu ihrem Bischof. Damit ist dieser Herr über vier Bistümer.</p>
15. 5 1724 - Die Wittelsbachische Hausunion wird gegründet
München - Köln - Trier - Pfalz * Die Kurfürsten von Baiern, Köln, Trier und der Pfalz schließen sich zur Wittelsbachischen Hausunion zusammen. Mit vier Kurstimmen und einem Heer von 30.000 Mann verfügen die verbündeten Fürsten über eine ansehnliche politische und militärische Macht.
18. 8 1724 - Johann Georg Messerer erhält die Weißbiergerechtigkeit
Au * Johann Georg Messerer erhält die Weißbiergerechtigkeit und bald darauf auch die Braunbier- und Branntwein-Ausschank-Gerechtigkeit. Messerer muss viel Geld in den Umbau des Hauses und die Urbarmachung seiner Gründe investieren.
Die Falkenau ist noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Isarau. Auch einige Häuser sind entstanden. Da aber Herzog Ferdinand Maria Innocenz, der Bruder des Kurfürsten Carl Albrecht, um das Jahr 1730 die Falkenau zur Hühnerjagd nutzen will, dürfen auf den öden Gründen keine weiteren Häuser errichtet werden. Man überlegt sogar, die vorhandenen Tagwerkerhäuser abzutragen, „weil in den Gebüsch der Auen allerhandt herrnlose Pursch und zimblich ybl renomiertes Angesindl zu großer Beschwerdte vnd besorglichen Unhäyls der ganzen Nachbarschaft“ sich aufhält.
7. 11 1724 - Im Burgfriedensbrief wird der Münchner Burgfrieden neu festgelegt
München * Im Burgfriedensbrief wird der Münchner Burgfrieden neu festgelegt. Ursprünglich reichte der zum Hoheitsgebiet der Stadt zugerechnete Burgfrieden im Norden bis unmittelbar vor das Dorf Schwabing. Das Leprosenhaus am heutigen Nicolaiplatz gehörte noch zum Stadtgebiet. Von dort aus zieht sich die Stadtgrenze etwas südöstlich zur heutigen Veterinärstraße, überquert hier den Schwabinger Bach und in schnurgerader Richtung die Hirschau bis zur Isar.
Da aber Kurfürst Max Emanuel souverän über die Hirschau als Jagdgebiet verfügen will, klammert er das Gebiet aus dem Münchner Burgfrieden aus und erklärt: „Wür aber ersagte Hirschau Uns zu Unseren fürstlichen Jagden und Lust specialiter gnädigst reserviert haben.“
Mit der Ausgemeindung der Hirschau aus dem Burgfrieden der Stadt verläuft nun die Stadtgrenze vom Schwabinger Bach aus stark südöstlich bis etwa an die Stelle des heutigen Monopteros, in dessen Nähe sich heute auch die Burgfriedenssäule mit der Nummer 12/13 befindet.
Für die Ausgemeindung der Hirschau aus dem Stadtgebiet Münchens wird die Stadt durch die Eingemeindung der drei Mühlen am Dreimühlenbach, der Schwalbensteinmühle, der Au- oder Papiermühle und der Brudermühle entschädigt. Gleichzeitig wird das Lehel der städtischen Gewalt unterstellt. Eine schriftliche Fixierung des Münchner Burgfriedens erfolgt aber erst zwölf Jahre später.
7. 11 1724 - Das Lehel wird der Stadt offiziell als Vorstadt eingegliedert
München-Lehel * Durch eine kurfürstliche Neubestätigung der Burgfriedensgrenze zugunsten Münchens wird das Lehel offiziell als Vorstadt eingegliedert. Der Münchner Magistrat übernimmt damit die grundherrliche Zuständigkeit über das Gebiet und seiner Bewohner und weitet dadurch seine Gerichtsbarkeit auf den vor den Stadttoren gelegenen Bezirk aus. Die städtische Verwaltung nimmt eine eigens dafür eingesetzte Lehel-Deputation wahr.
Für die Lechler ist das genau der richtige Zeitpunkt, den Bau einer Kirche mit eigenen Zuständigkeiten für die Betreuung der damals etwa zweitausend Einwohner der Vorstadt zu fordern. Die Bewohner des Lehels gehören trotz ihrer Lage vor der Stadtmauer seit jeher zur Graggenau und damit zur Pfarrei Unserer Lieben Frau. Doch diese Zugehörigkeit ist mit allerhand Schwierigkeiten verbunden, da die Lechler durch Graben, Wall und Mauer von ihren Seelsorgern getrennt sind.
Muss ein Schwerkranker in der Nacht mit den Sterbesakramenten versehen werden, so führt dies ausnahmslos zu Problemen, da die Stadttore nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Münchner Bürgermeisters geöffnet werden dürfen. Die Lechler holen in einem solchen Fall einen Paulanerpater vom Kloster Neudeck in der Au herbei.
Das nimmt aber schon unter normalen Witterungsbedingungen einen Zeitaufwand von mindestens zwei Stunden in Anspruch. Bei den schwierigen Wegeverhältnissen ist das gerade im Winter äußerst umständlich und schwierig. Zum Leidwesen der Hinterbliebenen stirbt deshalb so mancher Lechler ohne Sakrament und geistlichen Trost.
Um 12 1724 - Die „Lechler“ wollen die „Hieronymiten“ vom Walchensee haben
München-Lehel * Der „kurfürstliche Aumeister“ Johann von Daiser und weitere sieben hochangesehene „Lechler“ stellen ein Gesuch an Kurfürst Max Emanuel.
Sie haben erfahren, dass die „Hieronymiten“ vom Walchensee eine andere Niederlassung suchen und beantragen deshalb die Verlegung der „Patres“ in die Münchner Vorstadt.
11. 12 1724 - Kurprinz Carl Theodor wird auf Schloss Drogenbusch geboren
Schloss Drogenbusch * Kurprinz Carl Theodor, der spätere pfalz-baierische Kurfürst, wird auf Schloss Drogenbusch bei Brüssel geboren.
1725 - Beginn der Bauarbeiten an der Magdalenenklause
<p><strong><em>Schloss Nymphenburg</em></strong> * Joseph Effner beginnt mit dem Bau der <em>„Magdalenenklause“</em> im Nymphenburger Schlosspark. Die Arbeiten dauen bis 1728 an.</p>
4. 3 1725 - Kurfürst Clemens August lässt sich zum Priester weihen
Markt Schwaben * Kurfürst Clemens August lässt sich von seinem Freisinger Bischofskollegen Franz von Eckher von Kapfenberg und Lichteneck in der Hofkapelle des Schlosses Schwaben zum Priester weihen.
19. 3 1725 - Kurfürst Max Emanuel genehmigt den Klosterneubau der Hieronymiten
<p><strong><em>München-Lehel</em></strong> * Kurfürst Max Emanuel genehmigt den Klosterneubau der Hieronymiten im Lehel. Im Gegenzug verlangt der Baiernherrscher von den Hieronymiten </p> <ul> <li>einen Nachweis über ihr Vermögen, </li> <li>Mitteilungen über den Bauplatz für Kirche und Kloster, </li> <li>den Baufonds, </li> <li>den Verzicht auf das Almosensammeln und </li> <li>die Festlegung, dass im Kloster nie mehr als sechs Patres und zwei bis drei Laienbrüder wohnen sollen. </li> </ul> <p>Als vorläufige Unterkunft stellt der kurfürstliche Kammerdiener von Delling sein - rechts neben der späteren Sankt-Anna-Kirche liegendes - Wohnhaus zur Verfügung. </p>
4. 7 1725 - Die Hieronymiten-Mönche beziehen das zur Verfügung gestellte Wohnhaus
<p><strong><em>München-Lehel - Benediktbeuern</em></strong> * Nachdem die Regularien abgestimmt waren, beziehen die Hieronymiten-Mönche das vom kurfürstlichen Kammerdiener von Delling zur Verfügung gestellte Wohnhaus. Das Haus enthält einen Saal, für den der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck die Erlaubnis erteilt, diesen als provisorische Kirche einzurichten und darin die Messe zu feiern. Die Zimmer dienen drei Patres und einem Bruder als Wohnung. </p> <p>Das Klösterl am Walchensee geht anschließend um 6.000 Gulden in den Besitz des Klosters Benediktbeuern über. </p>
11. 10 1725 - Die neue Münchner Burgfriedensgrenze
<p>München * Eine Hofkommission und Vertreter der Stadt umreiten die neue Münchner Burgfriedensgrenze. </p>
1726 - Wolfgang Matthias Pindl wird Schulmeister in Haidhausen
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Wolfgang Matthias Pindl wird Schulmeister<em> </em>in Haidhausen.</p>
1726 - In München gibt es sieben Kaffeehäuser
<p><strong><em>München</em></strong> * In München gibt es sieben Kaffeehäuser. </p> <ul> <li>Davon sind drei bürgerlich: André Bellini, Rossignol und Bernath.</li> <li>Vier stehen unter Hofschutz. Das sind Claudi Surat, Johann Koller, Tibo und Maria Schönwein. </li> </ul>
28. 1 1726 - Simon Troger heiratet die kurfürstliche Carbinerstochter Maria Clara Saffran
München * Der aus dem Pustertal stammende Bildschnitzer Simon Troger heiratet die kurfürstliche Carbinerstochter Maria Clara Saffran (Saffren) von München.
26. 2 1726 - Kurfürst Max Emanuel stirbt hochverschuldet in München
München * Kurfürst Max Emanuel stirbt in München. Er wird in der Fürstengruft in der Theatinerkirche beigesetzt. Sein Sohn Carl Albrecht wird sein Nachfolger.
Zu diesem Zeitpunkt ist Baiern mit 5.218.460 Gulden bei jüdischen Gläubigern verschuldet. Das sind etwa zwanzig Prozent der damaligen baierischen Gesamtschuldenlast von 26,8 Millionen Gulden.
6. 12 1726 - Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr stirbt
München-Kreuzviertel * Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr stirbt.
17. 12 1726 - Maria Anna Lindmayr wird beigesetzt
München-Kreuzviertel * Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr wird in der Gruft des Münchner Karmeltinnenklosters beigesetzt.
1727 - Herzog Johann Theodor wird zum Bischof von Freising gewählt
Freising * Der Baiernprinz und Fürstbischof von Regensburg, Johann Theodor, wird zum Bischof von Freising gewählt.
1727 - Die Münchner „Weinwirte“ kämpfen gegen die „Kaffeehäuser“
München * Die Münchner „Weinwirte“ kämpfen in einer Eingabe an den Kurfürsten Carl Albrecht gegen die „Kaffeehäuser“.
Denn: „Zum luxuriösen Leben wird viel beigetragen durch die Vermehrung der Kaffeehäuser und weißen Bierzäpflereien, die Tag und Nacht dem Übermut offen stehen und wo die unnötigen und wolllüstigen Getränke wie Kaffee, Tee, Rosoglio [Likor, hauptsächlich Orangenlikör], Wein etc., jederzeit angeboten werden“.
Der Kurfürst verspricht, keine neuen „Kaffeehäuser“ zu genehmigen und die bestehenden „absterben“ zu lassen.
19. 1 1727 - Seligsprechungsverfahren für Maria Anna Lindmayr
München-Kreuzviertel * Für Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr wird ein Seligsprechungsverfahren eingeleitet - aber nie zu Ende geführt.
28. 3 1727 - Der spätere Kurfürst Max III. Joseph wird geboren
München * In München wird der spätere Kurfürst Max III. Joseph geboren.
9. 11 1727 - Kurfürst Clemens August erhält die Bischofsweihe
Viterbo * Kurfürst und Fürsterzbischof Clemens August von Köln erhält von Papst Benedikt XIII. im Kloster San Maria della Querica in Viterbo die Bischofsweihe.
1728 - Wolfgang Schmid übernimmt die Haidhauser „Schulmeister-Stelle“
Haidhausen * Wolfgang Schmid übernimmt die Haidhauser „Schulmeister-Stelle“.
1728 - In München leben 17 Juden in acht Haushalten
München * In München leben 17 Juden in acht Haushalten.
Langsam etabliert sich wieder jüdisches Leben in der Stadt.
28. 1 1728 - Der Brauer Bernhardt Rüdt will einen Bierkeller erbauen lassen
München-Ludwigsvorstadt * Der Bierbrauer Bernhardt Rüdt will einen Bierkeller an der heutigen Landsberger Straße erbauen lassen. Der Märzenkeller ist beim Stadtrat nicht erwünscht, weshalb durch eine Expertenrunde Argumente gegen das Bauwerk gesucht werden sollen.
15. 4 1728 - Der „Hohe Ritterorden St. Georgii“ erhält seine kirchliche Bestätigung
Rom-Vatikan - München * Mit einer päpstlichen Bulle erhält der „Churbaierische hohe Ritterorden St. Georgii“ seine kirchliche Bestätigung.
6 1728 - Die neuen „Burgfriedenssäulen“ werden aufgestellt
München * Die neuen „Burgfriedenssäulen“ werden unter Beteiligung einer Kommission aus kurfürstlichen „Hofräten“ und aus städtischen Abgeordneten aufgestellt.
Begleitet werden sie von 37 Bürgersöhnen im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren, die Kohlen aus Eichenholz und Glasscherben zum Einlegen in die Grundsteine der Säulen mittragen.
Jeder der Knaben erhält zur Erinnerung an dieses denkwürdige Ereignis einen „Gedenkpfennig“ und eine „Maulschelle“, die an das alte baierische Recht erinnert, bei dem die Zeugen an den Ohren gezogen wurden.
Ähnlich einem Bildstock wird die „Stele“ oben von einer halbrunden Bekrönung abgeschlossen.
Die Säulen sind aus Tuffstein, der aus der Gegend um Valley stammt.
Sie zeigen auf der einen Seite einen Mönch, auf der anderen das Rautenwappen, das Stadt- und das Landeswappen.
29. 8 1728 - Die spätere baierische Kurfürstin Maria Anna Sophie wird geboren
Dresden * In Dresden wird die sächsische Kurfürstentochter und spätere baierische Kurfürstin Maria Anna Sophie geboren.
4. 11 1728 - Clemens August wird Bischof in Osnabrück
Osnabrück * Das Domkapitel von Osnabrück wählt den 28-jährigen Clemens August zu ihrem Bischof. Damit ist der Kölner Kurfürst Herr über die fünf Bistümer Köln, Münster, Paderborn, Hildesheim und Osnabrück.
1729 - Ein Hochstapler will in München Porzellan erzeugen
München * Kurfürst Carl Albrecht stellt den Dresdner „Glas- und Spiegelmacher“ Elias Vater an, weil dieser behauptet, er könne Porzellan herstellen.
Wie sich bald herausstellt, ist Vater aber nur ein Hochstapler.
12. 3 1729 - Graf Max Cajetan von Törring-Seefeld erbt die Hofmark Haidhausen
München * Die Gräfin Anna Maria Katharina von Fugger-Kirchberg-Weißenhorn stirbt. Sie wird in der Gruft der Münchener Damenstiftskirche begraben, wo man ihr „auf das Grab selbsten eine weiße Steinplatten“ errichtet.
- Ihr Palais hat sie ihrem jüngeren Sohn aus erster Ehe, Philipp Josef von Törring-Seefeld, vermacht,
- die Hofmark Haidhausen erhält Max Cajetan Graf von Törring-Seefeld.
19. 3 1729 - Johannes von Nepomuk wird von Papst Benedikt XIII. „heilig“ gesprochen
<p><strong><em>Rom-Vatikan - München</em></strong> * Johannes von Nepomuk wird von Papst Benedikt XIII. <em>„heilig“</em> gesprochen und auf Wunsch des Kurfürsten Carl Albrecht zum Landespatron Baierns ernannt.</p>
28. 3 1729 - Kurfürst Carl Albrecht setzt die Statuten des Georg-Ritterordens in Kraft
München * Kurfürst Carl Albrecht setzt die Statuten des Georg-Ritterordens in Kraft. Voraussetzung für die Aufnahme in den Orden ist ein 300jähriger Adelsbesitzstand und 15 altadelige Ahnen väterlicher- und mütterlicherseits.
24. 4 1729 - Gründung des Georgs-Ritterordens durch Kurfürst Carl Albrecht
München-Graggenau * Kurfürst Carl Albrecht begründet mit dem ersten Ritterschlag den Georgs-Ritterorden in einer feierlichen Zeremonie.
Um 1730 - Auf der Isarbrücke entsteht eine „Johannes-von-Nepomuk-Kapelle“
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Auf der heutigen „Ludwigsbrücke“ entsteht eine Kapelle zur Verehrung des „Heiligen Johannes von Nepomuk“.
1730 - „Hofoberrichter“ Pistorini vertreibt die Prostituierten aus der Au
München - Au * „Hofoberrichter“ Pistorini rühmt sich damit, er habe „die ganz ungescheucht in der Au sich aufhaltenden Huren“ mit öffentlichen Spott davongejagt.
Um das Jahr 1730 - Der „Viehmarkt auf den Lüften“ wird vom „Lüftenwirt“ organisiert
Haidhausen - Au * Aus Beschwerden des „Münchner Rats“ wissen wir, dass „Auf den Lüften“, in der Gegend des heutigen Rosenheimer Platzes, ein „Viehmarkt“ entstanden ist.
Der sich aus „wilder Wurzel“ entwickelnde „Viehmarkt auf den Lüften“ wird vom „Lüftenwirt“ organisiert und macht dem Münchner „Viehmarkt am Anger“ erhebliche Konkurrenz.
Dagegen läuft der „Münchner Rat“ Sturm.
Weil aber die Gegend der „Lüften“ zu dieser Zeit noch in den Grenzen des „Pfleggerichts Wolfratshausen“ und damit außerhalb des „Münchner Burgfriedens“ liegt, ist sie der Gerichtsbarkeit und dem Zugriff der Münchner Obrigkeit entzogen.
Der „Stadtrat“ fordert deshalb durch seinen „Amtmann“ Jakob Röderer alle Viehhändler und Viehtreiber auf, ihre Tiere auf den „Münchner Viehmarkt am Anger“ hereinzutreiben.
Doch es hilft nichts.
1730 - Simon und Maria Clara Troger lassen sich in Haidhausen nieder
Haidhausen * Der aus dem Pustertal stammende Bildschnitzer Simon Troger und seine Ehefrau Maria Clara lassen sich in Haidhausen nieder, wo sie das Haus Nr. 50 an der Wolfgangstraße neben der „Wolfgangskapelle“ erwerben.
Seine Arbeiten erregen die Aufmerksamkeit des Kurfürsten Max III. Joseph.
Troger spezialisiert sich auf die Elfenbeinschnitzerei.
6. 2 1730 - Januarius Zick wird im ehemaligen Jagdschloss Neudeck geboren
Au * Januarius Zick wird als drittes von fünf Kindern im ehemaligen Jagdschloss Neudeck geboren und in der Auer Carl-Borromäus-Kirche getauft.
10. 3 1730 - Kurfürstin Therese Kunigunde stirbt in Venedig
Venedig * Kurfürstin Therese Kunigunde stirbt in Venedig.
8. 4 1730 - Fürstbischof Johann Theodor wird zum Priester geweiht
<p><strong><em>Ismaning</em></strong> * Fürstbischof Johann Theodor von Freising und Regensburg lässt sich in seiner Ismaninger Schlosskapelle zum Priester weihen.</p>
1. 10 1730 - Fürstbischof Johann Theodors erhält die Bischofsweihe
Köln * Fürstbischof Johann Theodors erhält durch seinen Bruder Clemens August, dem Kurfürsten von Köln, in Köln die Bischofsweihe.
Ab 1731 - Kurfürst Clemens August lässt ein „neues Hofmarkschloss“ erbauen
Berg am Laim * Auf seinem Berg am Laimer „Hofanger“ lässt sich Kurfürst Clemens August ein „neues Hofmarkschloss“ erbauen.
Es dient allerdings nicht ihm, sondern seinem älteren Bruder Ferdinand Maria Innocenz „zur Jagdlust und zum Gebrauch“. Dieser war - als drittgeborener Sohn - vom Kurfürstenvater Max Emanuel nicht in eine geistliche Laufbahn gedrängt worden, bekleidete damit auch keine einträglichen und einflussreichen Ämter.
Das neue Schloss liegt mit seiner Längsseite an der heutigen Josephsburgstraße und lehnt sich an das alte Schloss an. An der südlich gelegenen Gartenseite des Zentralbaues befand sich ein Pavillon. Im Inneren erstreckt sich der Salon über zwei Stockwerke. An beiden Seiten des Haupttrakts schließen sich doppelgeschossige Flügel mit großen Stallungen für jeweils 16 Pferde an. Sie beinhalten zusätzlich die Zimmer für die Stallknechte und zwei Heukammern.
Herzog Ferdinand Maria Innocenz unternimmt von hier aus die damals so beliebten „Parforcejagden“. Die Zwinger für die dazu notwendige große Hundemeute waren jedenfalls vorhanden. Neben der „Parforcejagd“ ist Ferdinand Maria Innocenz ein großer Liebhaber der „Falknerei“. Wie sein Bruder Clemens August benutzt der Herzog die im heutigen Untergiesing gelegenen „Falkenau“ zur Jagd mit den verschiedenen Greifvögeln auf Reiher und sonstiges Getier.
31. 10 1731 - Ausweisung von 20.000 Protestanten aus Salzburg
Salzburg * Der Salzburger Fürstbischof und Landesherr, Leopold Anton von Firmian, befiehlt die Ausweisung der in seinem Land lebenden Protestanten. Über 20.000 Salzburger müssen ihre Heimat verlassen.
Den Besitzenden wird eine Frist von drei Monaten eingeräumt; die Besitzlosen - Tagelöhner, Knechte, Mägde - müssen sich innerhalb von acht Tagen auf den Weg machen. Mitnehmen dürfen sie nur das, was sie auf dem Leib tragen oder auf einer Karre hinter sich herziehen können.
1732 - Der „Viehmarkt Auf den Lüften“ ist eine starke Konkurrenz
Haidhausen - Au * Der „Viehmarkt Auf den Lüften“ ist derart ausgebildet, dass die „kurfürstliche Hofkammer“ in einem Schreiben an den „Münchner Rat“ feststellt, dass die Münchner Metzger ihr Schlachtvieh „nicht mehr am gewöhnlichen Ort auf dem Anger, wo dieser Markt seit jeher stattgefunden hat, sondern bei dem sogenannten Lüftenhaus auf dem Isarberg” kaufen.
Anschließend treiben sie die gekauften Tiere in Richtung Schwabing auf die Weide an der „Stadtbleiche“ und mischen es unter das dortige Weidevieh, um es am Abend mit den anderen Tieren in die Stadt hineintreiben zu lassen.
Damit können die Münchner Metzger den so genannten „Viehaufschlag“, eine Steuer, umgehen.
Dass der Ausfall der Steuereinnahmen dem „Münchner Rat“ nicht gefällt, sei hier nur der Form halber erwähnt.
Für die Stadtherren grenzt diese Verfahrensweise an Betrug, weshalb diese nicht länger geduldet werden darf.
Dennoch bleibt der „Viehmarkt“ bestehen.
Die Münchner müssen sich vom „Pfleggericht Wolfratshausen“ sogar den Vorwurf gefallen lassen, dass es ihnen lediglich um die Einnahmen aus dem Pflaster- und Brückenzoll geht und sie den „Viehmarkt auf den Lüften“ nur als Vorwand nutzen, um den „Burgfrieden“ wieder erweitern zu können.
17. 7 1732 - Clemens August wird Hochmeister des Deutschen Ordens
Mergentheim * Der 31-jährige Kölner Kurfürst Clemens August wird in Mergentheim zum Hochmeister des Deutschen Ordens gewählt. Trotz der kurbaierischen und der französischen Unterstützung unterliegt Fürstbischof Johann Theodor seinem Bruder, dem Kölner Kurfürsten Clemens August, bei der Wahl zum Hoch- und Deutschmeister.
1733 - Der Name „Falckhenau“ für den Auer „Edelsitz“ taucht erstmals auf
Au - Untergiesing * Der Name „Falckhenau“ für den „Edelsitz“ des Johann Georg von Messerer taucht erstmals auf.
Ab 1733 - Graf Ignaz Felix Joseph von Toerring-Jettenbach erwirbt einen Bauplatz
München-Graggenau * Der „Generalfeldzeugmeister“, „Konferenzminister“ und enge Vertraute des Kurfürsten Carl Albrecht, Graf Ignaz Felix Joseph von Toerring-Jettenbach, erwirbt den Bauplatz in der heutigen Residenzstraße 2 für sein „Palais“.
Zwar liefert François Cuvilliés für die Adels-Nobelunterkunft die modernsten Pläne, doch der Stararchitekt ist gerade beim neuen Kurfürsten Max III. Joseph in Ungnade gefallen. Und so erhält der städtische „Oberbaumeister“ Ignaz Anton Gunetzrhainer den Auftrag.
30. 1 1733 - Ludwig Joseph Graf von Arco wird in München geboren
München * Ludwig Joseph Graf von Arco, der spätere Ehemann der Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine, wird in München geboren.
11. 2 1733 - Das Einfangen streunender Hunde wird angeordnet
München * Das Einfangen streunender Hunde wird angeordnet. Metzger und Köche werden aufgefordert, ihre Hunde an Stricken zu führen und nicht frei herumlaufen zu lassen.
Im Jahr 1734 - Die „Nepomuk-Kapelle“ auf dem Mariahilfplatz wird eingeweiht
Au * Die „Johann-von-Nepomuk-Kapelle“ auf dem Mariahilfplatz wird eingeweiht.
1734 - Die älteste Maulbeerallee in Deutschland
Heidelberg - Schwetzingen * In der klimatisch besser begünstigten Pfalz gibt es seit dem Jahr 1734 eine Seidenbaugesellschaft, die innerhalb von nur vier Jahren 12.000 Maulbeerbäume entlang der Straße zwischen Schwetzingen und Heidelberg anpflanzen lässt. Es dürfte damit die älteste Maulbeerallee in Deutschland sein.
Da die Maulbeerbäume bei den Pfälzern nicht sonderlich beliebt sind, nennt man die Bäume im Volksmund „Zwing-uff“, also „aufgezwungene Bäume“.
22. 10 1735 - Der Wasenmeister erschlägt 115 herrenlose und 8 tollwütige Hunde
München * Der Wasenmeister von Neumarkt hält sich 19 Tage in München auf. Er fängt und erschlägt 115 herrenlose und 8 tollwütige Hunde.
13. 2 1736 - Maria Theresia und Franz I. Stephan von Lothringen heiraten
Wien * Maria Theresia von Österreich und Franz I. Stephan von Lothringen, der spätere Kaiser, heiraten.
24. 9 1736 - Die Burgfriedens-Grenzen werden schriftlich niedergelegt.
München * Die Burgfriedens-Grenzen werden endlich schriftlich niedergelegt.
1737 - Die Schwestern vom „Kloster Lilienthal“ leben nach der Regel der Paulaner
Au * Die „Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis“ vom „Kloster Lilienthal“ leben seither nach der strengen Regel der Paulaner.
1737 - Caspar Gregor von Lachenmayr kauft das Bogenhausener Törring-Schloss
Bogenhausen * Das Bogenhausener Törring-Schloss kommt in den Besitz des „Hofkammerrats“ Caspar Gregor von Lachenmayr.
19. 10 1737 - 150 herrenlose und 13 tollwütige Hunde werden erschlagen
München * 150 herrenlose und 13 tollwütige Hunde werden gefangen und erschlagen.
1738 - „[...] Wo der Essig von selbst wächst“
München * Wiguläus Xaver Alois Freiher von Kreittmayr spottet in seinen „Anmerkungen zum Baierischen Landesrecht“ über den saueren baierischen Wein: „[...] wo der Essig, der anderswo mit großer Mühe bereitet werden muss, von selbst wächst“.
Dem Bier hingegen bescheinigte er den Stellenwert eines „fünften Elements“.
1738 - Die „Georgs-Kirche“ als „eine der schöneren Landkirchen“ beschrieben
Bogenhausen * In einem „Visitationsbericht“ wird die Bogenhausener „Sankt-Georgs-Kirche“ als „eine der schöneren Landkirchen im guten Zustand“ beschrieben.
1738 - Das „Falkenmeisteramt“ mit seiner Ausstattung
München * Kurfürst Carl Albrecht hat das „Falkenmeisteramt“ mit einem „Oberstfalkenmeister“, einem „Vize-Oberstfalkenmeister“, einem „Falkenamtsgegenschreiber“ und weiteren „Reiher- und Milanmeistern“, Knechten und einer Anzahl von „Wind- und Wachthundjungen“ besetzt.
4. 2 1738 - Philipp Jakob Köglsberger löst Johann Michael Fischer als Architekt ab
Berg am Laim * Vertrag mit Philipp Jakob Köglsberger über den Neubau der „Michaelskirche“ in Berg am Laim.
Köglsberger löst Johann Michael Fischer als Architekt ab.
28. 4 1738 - Papst Clemens XII. verbietet die Freimaurer
Vatikan * Papst Clemens XII. ist ein hochbegabter Jurist und Finanzexperte, der - blind und Krank - die katholische Welt mit einem eisernen Willen vom Bett aus regiert. Er erlässt die Verdammungsbulle „In eminenti apostolatus specula“, die den Freimaurern aus ihrer Geheimniskrämerei einen Strick dreht. „Wenn sie nichts Böses täten, würden sie nicht so sehr das Licht hassen“, argumentiert der greise Papst. Die Zugehörigkeit zur Freimaurerei wird bei Strafe der Exkommunikation verfolgt.
Während man in Spanien, Portugal und Polen Logenbrüder foltert und hinrichtet, bekleiden in Frankreich viele Priester hohe freimaurerische Ämter. In Deutschland gehören Domherren, Äbte und Kardinäle den Logen an, darunter der Kölner Kurfürst und Fürsterzbischof Clemens August.
10. 5 1739 - Cosmas Damian Asam stirbt in München
München * Cosmas Damian Asam, Maler und Architekt, stirbt in München.
26. 5 1739 - Ein Kreuzpartikel für die Haidhauser Sankt-Johannes-Baptist-Kirche
Haidhausen * Der aus Haidhausen stammende Augustiner-Eremiten-Laienbruder Jodok Zächerl schenkt der Sankt-Johannes-Baptist-Kirche einen in einem silbernen Kreuz gefassten und mit einem Echtheitszertifikat versehenen Kreuzpartikel.
27. 5 1739 - Kostenaufteilung für die Erweiterung des Haidhauser Friedhofs
Haidhausen * Die Kosten für die Erweiterung des Haidhauser Friedhofs wird dreigeteilt. Ein Drittel soll die Hofmarkherrschaft, ein Drittel die Gemeinde und ein Drittel die Kirche bezahlen.
15. 7 1739 - Ein Lattenzaun statt einer Mauer um den Friedhof?
Haidhausen * Maria Antonia von Pfitschenthal, die Haidhauser Hofmarkherrin, will für den Haidhauser Friedhof keine teuere Mauer, sondern nur ein Tüll, einen Lattenzaun. Dadurch würden die Kosten für sie, die Kirche und die Gemeinde massiv reduziert werden.
1740 - „Neuberghausen“ wird zum „Adeligen Sitz mit Patrimonialgerichtsbarkeit“
Bogenhausen * Das Bogenhausener Schlössl des „Hofkammerrats“ Caspar Gregor von Lachenmayr wird zum „Adeligen Sitz mit Patrimonialgerichtsbarkeit“ erhoben.
Es trägt seither den Namen „Neuberghausen“.
Um 1740 - Maria Klara von Messerer heiratet Josef Anton von Kern
Au * Maria Klara von Messerer, die Witwe des „Hofkammerrats“ Johann Georg von Messerer, eine aus Rosenheim stammende Bernlocher-Bräuerstochter, heiratet in zweiter Ehe Josef Anton von Kern und bringt ihre zwei Söhne aus erster Ehe in die neue Beziehung ein.
Josef Anton Kern ist „Hofkammerrat“, Brauer“ und „Salzkommissär“.
Er übernimmt den gesamten Grundbesitz der Messerers in Höhenrain, Urfarn und „Falkenau“.
1740 - Der Theatiner-Konvent umfasst dreißig Mitglieder
München-Kreuzviertel * Der Theatiner-Konvent umfasst dreißig Mitglieder.
1740 - Im Hieronymiten-Kloster leben acht Patres und drei Laienbrüder
München-Lehel * Entgegen der Abmachung leben in dem kleinen Hieronymiten-Kloster neben der Sankt-Anna-Kirche“acht Patres und drei Laienbrüder.
Zu dieser Zeit ist die Ausstattung der Rokoko-Kirche fast vollendet.
Über dem Tabernakel des Hochaltars ist eine Marien-Ikone aus den Türkenkriegen aufgestellt worden, vor dem die Mönche täglich die Lauretanische Litanei beten, wofür sie als kurfürstliche Stiftung jeden Tag zwölf Maß Weißes Bier erhielten.
1740 - Kurfürst Clemens August gründet den Mopsorden
Köln * Der Kölner Kurfürst und Fürsterzbischof Clemens August gründet - nach dem päpstlichen Verbot der Freimaurer - als Ersatz den Mopsorden. Es handelt sich dabei um einen für Männer und Frauen gleichsam zugänglichen Orden, der vermutlich auch am Münchner Hof Verbreitung findet.
Um den Papst nicht erneut zu erzürnen, ersetzt man den Eid der Freimaurer durch das Ehrenwort der Geheimhaltung und nimmt - am Anfang - nur Katholiken in den Logen auf. Um die ganze Angelegenheit als harmlos und ungefährlich hinzustellen, befürwortet man den Zutritt der Damen. Dabei ist gerade dies eine fast revolutionäre Tat, da den Möpsinnen alle Grade der Loge offen stehen und die Ämter paritätisch besetzt werden.
Der Name Mopsorden geht auf die im 18. Jahrhundert vorhandene Begeisterung für die gleichnamigen Hunde zurück. Zugleich steht die französische Bezeichnung für die Ehefrau eines Freimaurers Pate: Mopse. Das Brauchtum ist von „einer gewissen galanten Laszivität, wie sie dem Geschmacke des Rokoko entsprach“.
Der Zirkel in der Mopsloge soll Folgendes lehren: „Gleich, wie alle Durchschnitte des Kreises durch seinen Mittelpunkt gehen, müssen alle Handlungen eines Mopses aus einer Quelle gehen, nämlich der Liebe.“
20. 10 1740 - Kaiser Carl VI. stirbt ohne männlichen Nachkommen in Wien
Wien * Kaiser Carl VI. stirbt ohne männlichen Nachkommen in Wien.
22. 10 1740 - 190 herrenlose und 13 tollwütige Hunde werden erschlagen
München * 190 herrenlose und 13 tollwütige Hunde werden in München gefangen und erschlagen.
13. 3 1741 - Joseph II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Joseph II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren.
24. 4 1741 - Die Aufnahme von Geistlichen in den Georgs-Ritterorden wird möglich
München-Graggenau * Die Aufnahme von sechs Geistlichen in den Georgs-Ritterorden wird beschlossen. Sie müssen aber die gleiche Ahnenprobe wie die weltlichen Mitglieder erfüllen.
14. 7 1741 - Maria Josepha Gräfin Fugger auf Zinneberg kauft die Falkenau
Au * Josef Anton von Kern verkauft den in der Au gelegenen Grundbesitz Falkenau an Fräulein Maria Josepha Gräfin Fugger auf Zinneberg. Diese kauft noch eine Wirtschaft dazu.
19. 12 1741 - Kurfürst Carl Albrecht wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt
Prag * Kurfürst Carl Albrecht wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt.
1742 - Joseph Fackler wird Haidhauser „Schulmeister“
Haidhausen * Joseph Fackler wird Haidhauser „Schulmeister“.
1742 - Janus de Garnerin Freiherr von Montgelas tritt in baierische Dienste ein
München * Janus de Garnerin Freiherr von Montgelas tritt in baierische Dienste ein, wo er dem „Regiment Grenadiers à cheval“ angehört und es bis zum „General“, Kammerherrn“ und „Obermundschenk“ bringt.
Begonnen hat er seine militärische Laufbahn als Major in der österreichischen Armee.
17. 1 1742 - Kurfürst Carl Theodor heiratet in Mannheim Elisabeth Auguste
Mannheim * Der pfälzische Kurfürst Carl Theodor heiratet in Mannheim Elisabeth Auguste.
24. 1 1742 - Kurfürst Carl Albrecht wird einstimmig zum Kaiser gewählt
Frankfurt am Main * Der baierische Kurfürst Carl Albrecht wird einstimmig zum Kaiser gewählt.
12. 2 1742 - Österreichische Truppen ziehen in die Stadt ein
München * In der Nacht vom 12. zum 13. Februar 1742 ziehen österreichische Truppen über die Isarbrücke in die Stadt ein.
12. 2 1742 - Kurfürst Carl Albrecht wird in Frankfurt am Main zum Kaiser gekrönt
Frankfurt am Main * Der baierische Kurfürst Carl Albrecht wird in Frankfurt am Main feierlich zum Kaiser Carl VII. Albrecht gekrönt.
14. 2 1742 - Österreichische Husaren rücken in München ein
<p><em><strong>München</strong></em> * Zwei Tage nach der Kaiserkrönung des baierischen Kurfürsten Carl Albrecht zum Kaiser Carl VII. rücken österreichische Husaren in München ein. </p>
6. 10 1742 - Die österreichischen Truppen verlassen München
München * Die österreichischen Truppen verlassen München. Sie legen noch Feuer an das Tor des Roten Turms und an die Isarbrücke.
Anno 1743 - Johann Zick fertigt das Deckengemälde für die „Mariahilf-Kirche“
Au * Johann Zick fertigt das Deckengemälde für die „Mariahilf-Kirche“.
9. 9 1743 - Johann Theodor wird in das Kardinalskollegium aufgenommen
Rom-Vatikan * Papst Benedikt XIV. nimmt den Freisinger und Regensburger Fürstbischof Johann Theodor als „Kardinal in pectore“ [= unter Geheimhaltung] in das Kardinalskollegium auf.
23. 1 1744 - Fürstbidchof Johann Theodor wird zum Bischof von Lüttich gewählt
Lüttich - Berg am Laim * Mit Unterstützung seines älteren Bruders Clemens August wird der Fürstbischof von Freising und Regensburg, Johann Theodor, zum Bischof von Lüttich gewählt. Auch bei der Wahl zum Bischof von Lüttich hat Clemens August - trotz seiner Ämterfülle - die besseren Chancen.
Johann Theodor setzt sich gegen den ranghöheren Bruder nur deshalb durch, weil er sich standhaft weigert, in der neuen Berg am Laimer Michaelskirche die Kirchenweihe zu vollziehen. Der Regensburger und Freisinger Bischof Johann Theodor bekämpft gemeinsam mit dem Baumkirchner Pfarrer diesen Neubau. Die Wende kommt erst mit dem Verzicht Clemens Augusts auf das Bistum Lüttich zu Gunsten seines Bruders.
18. 10 1744 - Mit vollem Arbeitseinsatz die Isarbrücke wieder hergestellt
München * Mit einem Arbeitseinsatz von 39 Männern kann die Isarbrücke bis zum 24. Oktober wieder hergestellt werden.
1745 - Johann Paul Reiz wandelt seine Malztenne in einen „Komödienstadl“ um
München-Hackenviertel * Johann Paul Reiz, der Besitzer des „Faberbräu“ in der Sendlinger Straße, wandelt seine Malztenne in einen „Komödienstadl“ um.
Ab 1745 - Simon Trogers Arbeiten erfreuen sich großer Beliebtheit
Haidhausen * Simon Trogers fruchtbarste Zeit als Elfenbeinschnitzer liegt in den Jahren zwischen 1745 und 1760.
Seine Arbeiten erfreuen sich großer Beliebtheit.
Die Eigenart seiner Arbeiten beruht auf der Verbindung von Elfenbein mit anderem Material (Holz und Metall).
Zumeist verwendete er für die Fleischteile seiner Schnitzereien Elfenbein, für die Gewandung aber das dunkelbraune Holz der afrikanischen Zuckertanne oder Buchs.
Reine Elfenbeinschnitzereien sind selten.
Im „Bayerischen Nationalmuseum“ haben sich eine Reihe seiner Arbeiten erhalten.
20. 1 1745 - Kaiser Carl VII. Albrecht stirbt in München
München * Kaiser Carl VII. Albrecht [= Kurfürst Carl Albrecht] stirbt in München. Er wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche beigesetzt. Der Kaiser hinterlässt seinem 17-jährigen, politisch vollkommen unerfahrenen Sohn, Max III. Joseph, den Krieg gegen Österreich und durch seine unglückliche Großmachtpolitik total zerrüttete Staatsverhältnisse.
15. 4 1745 - Zu Verteidigungszwecken wird die Isarbrücke abgerissen
<p><strong><em>München</em></strong> * Als das Kurfürstliche Leibregiment aus der Stadt marschiert, wird - zu Verteidigungszwecken - die Isarbrücke abgerissen.</p>
24. 8 1745 - Gräfin Maria Josepha Gräfin Fugger gerät in Zahlungsrückstand
Untergiesing * Die Gräfin Maria Josepha Gräfin Fugger auf Zinneberg gerät in Zahlungsrückstand. Josef Anton von Kern nimmt daraufhin den Besitz wieder unter seine Verwaltung, zahlt die bereits ausgezahlten 12.000 Gulden zurück und legt weitere 3.000 Gulden für die neue Wirtschaft drauf.
13. 9 1745 - Franz I. Stephan von Lothringen wird zum Kaiser gewählt
Frankfurt am Main * Franz I. Stephan von Lothringen, Gemahl von Maria Theresia, wird zum Kaiser gewählt.
4. 10 1745 - Franz I. Stephan wird in Frankfurt am Main zum Kaiser gekrönt
Frankfurt am Main * Franz I. Stephan von Lothringen, Gemahl von Maria Theresia, wird in Frankfurt am Main zum Kaiser gekrönt.
1746 - Das „Landgebot gegen Aberglauben und Hexerei“ wird erneut veröffentlicht
München * Das „Baierische Mandat gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“ wird durch Kurfürst Max III. Joseph erneuert.
Es handelt sich dabei um eine fast wörtliche Wiederholung des Textes aus dem Jahr 1611 beziehungsweise 1665.
1746 - Kurfürst Max III. Joseph erlässt ein Hexenmandat
München * Das „Baierische Mandat gegen Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere sträfliche Teufelskünste“ wird durch Kurfürst Max III. Joseph erneuert. Es handelt sich dabei um eine fast wörtliche Wiederholung des Textes aus dem Jahr 1611 beziehungsweise 1665.
1746 - Das Faberbräu-Theater entsteht
<p><strong><em>München-Hackenviertel</em></strong> * Johann Paul Reiz, der Besitzer des Faberbräuhauses in der Sendlinger Straße, ließ im Hof seines Wirtshauses einen <em>„Komödienstadel“</em> für Wander-Schauspieler-Truppen einrichten. Durch die Bereitstellung der stehenden Bühne machte er die Schauspieltruppen, die mit ihren Thepsiskarren durch München zogen, seßhaft.</p> <p>Zu Beginn waren es noch Gaukler und Komödianten, der Stärke über das Niveau der <em>„Hanswurstiarden“</em> nicht hinaus ging. Humorvolles stand im Vordergrund. Im <em>„Komödienstadel“</em> saßen die aus dem einfachen Volk stammenden Zuschauer an langen Biertischen und Bänken. Jedermann lebte und spielte lauthals mit den Komödianten, nebenbei wurde getrunken und gegessen.</p> <p>Unter einem Thespiskarren oder Thespiswagen versteht man den Wohnwagen wandernder Schauspieler oder für eine Wanderbühne. Der Name stammt von Thespis, dem ersten griechischen Tragödiendichter. Dies lässt sich jedoch nicht belegen.</p>
17. 1 1746 - Der Freisinger Fürstbischof Johann Theodor wird zum Kardinal befördert
Rom-Vatikan - Freising - Lüttich * Die bereits am 9. September 1743 durch Papst Benedikt XIV. erfolgte Ernennung des Freisinger, Regensburger und Lütticher Fürstbischofs Johann Theodor zum Kardinal wird erst jetzt offiziell publiziert.
Was zunächst wie eine Rangerhöhung aussieht ist aber in Wirklichkeit das Karriere-Ende des an Macht und Einfluss Gefallen findenden Wittelsbachers. Denn kein noch so „handgesalbtes“ Domkapitel würde einen Kardinal zum Bischof küren. Das verbot schon der Standesdünkel.
Johann Theodor geht deshalb als „Kardinal von Baiern“ in die Geschichte ein. Seine Zeit verbringt der Kardinalswürden- und Purpurträger bis zu seinem Lebensende in Lüttich.
1747 - Franz Joseph Schnabel wird „Schulmeister“ in Haidhausen
Haidhausen * Franz Joseph Schnabel wird „Schulmeister“ in Haidhausen.
26. 4 1747 - Aron Elias Seligmann wird in Leimen geboren
Leimen * Aron Elias Seligmann, der spätere „jüdische Hoffaktor“ und Finanzier des Bayerischen Staates, wird in Leimen geboren.
5. 5 1747 - Leopold II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren
Wien * Leopold II., der spätere Kaiser, wird in Wien geboren.
13. 5 1747 - Der Grundstein für das Palais Toerring-Jettenbach wird gelegt
München-Graggenau * Der Grundstein für das Palais Toerring-Jettenbach in der heutigen Residenzstraße 2 wird gelegt. Der Rokoko-Adelspalast entsteht in den Jahren von 1747 bis 1756 auf den Grundflächen einer ganzen Reihe von Häusern.
Bauherr ist der 65jährige Graf Ignaz Felix Joseph von Toerring-Jettenbach, der während seiner Auslandsaufenthalte die fremden Höfe und Adelspaläste begutachtet und so ganz nebenbei mit den bekanntesten Architekten Kontakt aufnehmen kann.
Inzwischen liegen elf verschiedene Pläne für ein prächtiges Stadtpalais in seinem Schubladen, gezeichnet von dem Wiener Hofbaumeister Joann Lukas von Hildebrandt, dem französischen Adelsarchitekten Bottrand, dem Münchner Hofbaumeister François Cuvilliés und den Gebrüdern Johann Baptist und Ignaz Anton Gunetzrhainer.
Der Graf nimmt schon während der Planungsphase und auch bei der Bauausführung regen Anteil und lässt sich selbst jede kleinste Kleinigkeit zur Genehmigung vorlegen.
9. 7 1747 - Kurfürst Max III. Joseph heiratet Maria Anna Sophie
München * Kurfürst Max III. Joseph heiratet die sächsische Kurfürstentochter Maria Anna Sophie.
1. 11 1747 - Erste Versuche zu Herstellung von Hartporzellan
Au * Im ehemaligen Hofmarkschloss Neudeck beginnt der Münchner Hafnermeister Franz Ignatz Niedermayer mit der Herstellung von Hartporzellan. Er kommt aber über feine Hafnerware nicht hinaus. Das Datum gilt trotzdem als Gründungsdatum der Nymphenburger Porzellanmanufaktur.
1748 - Die „Bettelordnung“ beinhaltet Strafen für „Bettler und Vaganten“
München * Nach der unter Kurfürst Max III. Joseph erlassenen „Bettelordnung“ werden aufgegriffene „Bettler“ zuerst mit 15 bis 20 „Stockhieben“ bestraft und dann für ein halbes Jahr in das „Zuchthaus“ gebracht.
Ausländische „Bettler und Vaganten“, darunter versteht man alle „nichtbaierischen“, werden nach ihrer Festnahme mit einem „B“ gebrandmarkt.
Verlassen sie nicht innerhalb von vier Tagen das Land, droht ihnen die Todesstrafe.
1748 - Die Au wird an den „Almoseneingängen“ der Stadt München beteiligt
Au - München * Die Vorstadt Au wird an den „Almoseneingängen“ der Stadt München beteiligt.
1748 - Josef Anton von Kern erweitert seinen Besitz in der „Falkenau“
Au - Untergiesing * Josef Anton von Kern erweitert seinen Besitz in der „Falkenau“ noch einmal durch Zukauf.
28. 6 1748 - Der Brauer Mathias Porttenlenger darf einen Märzenkeller bauen
Haidhausen * Der Bierbrauer Mathias Porttenlenger vom Hallmaierbräu erhält vom Stadtrat die Erlaubnis, am Isarberg, heute etwa Rosenheimer Straße 13, einen „eichenen Stadel zur Unterbringung von Fässern“ und gleichzeitig auch einen Märzenkeller zu erbauen.
- Der jährliche Bodenzins beträgt 10 Gulden.
- Der Bau einer Wohnung wird verweigert.
- Ohne Genehmigung der Stadtkammer dürfen die Baulichkeiten weder erweitert noch an einen anderen Besitzer übergeben werden.
- Die gleiche Einschränkung gilt auch für die Aufnahme einer Hypothek.
1749 - Johann Jochner kauft den „Singlspielerbräu“
München-Angerviertel * Johann Jochner, der „Braumeister des Klosters Wessobrunn“, kauft den „Singlspielerbräu“.
Nach 1749 - Josepha von Kern verkauft Grundstücke in der „Falkenau“
Au - Untergiesing * Da sich „Oberleutnant“ Anton Josef von Kern, der Besitzer der „Falkenau“ , überschuldet hat, übernimmt seine Frau Josepha, eine geborene von Pitzl auf Eberstall, die Betreuung der Besitzungen.
Nachdem sie Witwe geworden ist, muss sie für ihre fünf minderjährigen Söhne sorgen.
Gegen den entschiedenen Widerstand ihrer Gläubiger verkauft sie einige Grundstücke der „Falkenau“ nahe dem „Kühbächl“ an den „Schrafnagelmüller“ Loiblmeier und an den „Hofbankier“ und „Kommerzienrat“ Franz Anton von Pilgram, der schon weitere Grundstücke in der Gegend besitzt.
1749 - Benjamin Franklin: „Blitze nichts anderes als riesige Funken
USA * Nach Benjamin Franklins Theorie sind Blitze nichts anderes als Funken in riesigem Maßstab.
19. 2 1749 - Beschluss für einen Neubau des Klosters am Lilienberg
Au * Priorin und Konvent beschließen die Erweiterung des Klosters am Lilienberg durch einen Neubau. Der Konvent der Benediktinerinnen umfasst inzwischen 23 Professen und 4 Schwestern.
Um 1750 - Der Rat der Stadt lässt 19 Brunnen „nach französischer Art“ umbauen
München * Der Rat der Stadt lässt 19 Ketten-, Zieh- und Galgenbrunnen „nach französischer Art“ umbauen.
Die neue Form der „Pumpbrunnen“ bezeichnet man als „Leyrerbrunnen“ oder „Leyrergumpter“.
Ab 1750 - Die Pfeiler der „Inneren Ludwigsbrücke“ werden erstmals aus Stein erbaut
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Die Pfeiler der „Inneren Ludwigsbrücke“ werden erstmals aus Stein erbaut.
Die Arbeiten dauern bis 1752.
Um 1750 - Die „Franziskaner-Provinz“ in Kurbaiern
Kurfürstentum Baiern * In Kurbaiern gibt es 25 „Franziskaner-Konvente“, neun „Hospize“ und drei „Residenzen“, worunter man kleine Niederlassungen verstand.
Der Personalbestand liegt bei 700 „Patres“, 100 „Kleriker“ und 200 „Laienbrüder“. Dazu sind der „Provinz“ noch etwa 300 Nonnen - „Klarissen“ und „Tertianerinnen“ - unterstellt.
1750 - Der Maria Pauer wird der Prozess wegen „Schadenszauber“ gemacht
Mühldorf * In Mühldorf am Inn, das zu diesem Zeitpunk zum „Fürstbistum Salzburg“ gehört, wird der 16-jährigen Maria Pauer der Prozess wegen „Schadenszauber“ gemacht.
Im Mühldorfer „Hexenkammerl“ hält man sie monatelang wie ein Tier gefangen.
Am Ende des „Hexen-Prozesses“ wird sie zum Tode durch „Verbrennen“ verurteilt, dann aber „gnadenhalber“ zuvor geköpft.
Maria Pauer müsste die letzte „Hexenverbrennung“ auf bayerischem Boden gewesen sein.
23. 8 1750 - Das neue Haus des Klosters am Lilienberg wird eingeweiht
Au * Der Abt von Andechs weiht das neue Haus des Klosters am Lilienberg.
6. 10 1750 - Stephan von Stengel kommt in Mannheim zur Welt
Mannheim * Stephan von Stengel kommt in Mannheim zur Welt. Seine Mutter Maria Christina ist eine geborene Edle von Hauer, sein Vater Johann Georg von Stengel. Gerüchte sagen allerdings, Stephan von Stengel sei ein illegitimes Kind des Kurfürsten Carl Theodor.
1751 - Graf Hieronimo von Spreti kauft das „Schloss Neuberghausen“
Bogenhausen * Das „Schloss Neuberghausen“ in Bogenhausen geht in den Besitz des Grafen Hieronimo von Spreti über.
1751 - Landesverweisung und schärfere Strafen gegen die Prostitution
München * Der „Codex Juris Bavarici Criminalis“ droht:
„Gemeine und offenbare Hurerey, welche mit jedermann ohne Scheu um Gewinns willen getrieben wird, oder auch in Gestalt der Ehe gepflogener Beyschlaf, ist mit der Landesverweisung, oder da das Handwerck schon lange dauert, noch schärfer zu bestraffen“.
1751 - Das „Kriminalrecht“ des Freiherrn Wiguläus von Kreittmayr
München * Im „Kriminalrecht“ des Freiherrn Wiguläus von Kreittmayrs steht auf „Ketzerei, Zauberei und Hexerei“ noch der „Feuertod“.
1751 - Das „Palais Toerring-Jettenbach“ wird fertiggestellt
München-Graggenau * Das „Palais Toerring-Jettenbach“ in der heutigen Residenzstraße 2 ist unter Dach.
Das elf Fenster breite Gebäude mit seinem vorgebuchteten Mitteltrakt unterscheidet sich durch seine eher zurückhaltend gestaltete Rokokofassade von den älteren Münchner Adelspalästen.
Mit den Stuckarbeiten ist Johann Baptist Zimmermann betraut worden. Die Innenausstattung übernimmt Johann Baptist Gunetzrhainer.
Die Baurechnungen belaufen sich auf 55.170 Gulden, wobei die Gesamtkosten sicherlich wesentlich höher sind.
1751 - Das Strafgesetzbuch bestimmt auch über Hexen
München * Das Strafgesetzbuch bestimmt: „Bündnisse und fleischliche Vermischung mit dem Teufel oder dessen Anbetung und Verunehrung der Hostien werden mit lebendiger Verbrennung bestraft“.
12. 2 1751 - Wieder ist der Hundefänger auf der Jagd
München * Wieder ist der Hundefänger auf der Jagd nach streunenden Hunden.
11. 3 1751 - Errichtung eines Exerzitienhauses für die Franziskaner
Berg am Laim * Joseph Clemens’ Nachfolger und Neffe, Kurfürst Clemens August von Köln, plant mit dem Neubau der Berg am Laimer Michaelskirche gleichzeitig die Errichtung eines Exerzitienhauses für die Franziskaner. Auch hier gibt es Widerstände des Ortspfarrers von Baumkirchen, die den Pfarrer einsetzenden St.-Veit-Chorherren in Freising und des Freisinger Ordinariats, an dessen Spitze Bischof Johann Theodor, ein Bruder Clemens Augusts.
Auch der andere Bruder, Baierns Kurfürst Carl Albrecht, will diese Aufgabe lieber von den Jesuiten als von den Franziskanern ausgeführt sehen, weshalb noch nach seinem Tod die Kaiserin-Witwe Maria Amalia die in Berg am Laim gelegene Josephsburg - im Geheimen und ohne den Kölner Bischof in die Entscheidung einzubeziehen - den Jesuiten übertragen will.
Nach langem Hickhack kommen drei Franziskaner doch noch nach Berg am Laim. Am 11. März 1751 wird das Hospiz in Anwesenheit von drei Wittelsbachern - dem kurkölnischen Fürstbischof Clemens August, dem Freisinger Bischof Johann Theodor und dem neuen baierischen Kurfürsten Max III. Joseph - eingeweiht. Clemens August hatte zuvor schriftlich zu bestätigen, dass die „Franziskaner nirgends betteln, noch den Pfarrern die Messen wegnehmen und den pfarrlichen Funktionen Eintrag tun“.
31. 3 1751 - Die Paulaner erhalten eine weitere Ausnahme vom Schankverbot
<p><strong><em>Au</em></strong> * Kurfürst Max III. Joseph erteilt den Paulanern eine weitere Ausnahme vom Schankverbot. Zum Festtag des Ordensgründers am 2. April dürfen sie insgesamt 8 Tage lang ihr Bier öffentlich verkaufen.</p>
1752 - Ein „Geißbock“ auf Rädern zum Herumführen von „Huren“
München * Der Rat der Stadt lässt einen „Geißbock“ auf Rädern, zum Herumführen von „Huren“, fertigen.
6 1752 - Benjamin Franklin erfindet den Blitzableiter
USA * In einem lebensgefährlichen Experiment lässt Benjamin Franklin bei einem sommerlichen Gewitter einen Drachen an einem Metalldraht aufsteigen und kann so beweisen, dass Blitze elektromagnetische Entladungen sind.
Damit ist der Blitzableiter erfunden.
1753 - Das „Kloster am Lilienberg“ erreicht mit 32 Schwestern seinen Höchststand
Au * Das „Kloster am Lilienberg“ erreicht mit 32 Schwestern - 24 „Professen“ und 8 „Laienschwestern“ - seinen Höchststand.
1753 - Noch viele Opfer, bis die „Hexenprozesse“ enden
München * Bis zum letzten „Hexenprozess“ müssen sich seit dem Jahr 1701 noch weitere 17 Personen vor Gericht verantworten.
26. 3 1753 - Benjamin Thompson, der spätere Graf Rumford, wird geboren
Woburn * Benjamin Thompson, der spätere Graf Rumford, wird in Woburn, einer kleinen Stadt im Staate Messachusetts im Nordosten der USA, in der Nähe von Boston, als Sohn eines Farmers geboren.
9 1753 - Joseph Jakob Ringler kennt die Zusammensetzung der Porzellanmasse
Au * Joseph Jakob Ringler aus der Wiener „Kaiserlichen Porzellanmanufaktur“ kommt in die Au.
Er kennt die richtige Zusammensetzung der Rohporzellanmasse und versteht etwas vom Bau der Brennöfen.
30. 11 1753 - Matthias Trost wird Schulmeister in Haidhausen
Haidhausen * Die Witwe Katharina Schnabel heiratet Matthias Trost, der dadurch die Aufgabe des Schulmeisters in Haidhausen übernehmen kann.
1754 - Die Wildnis in der „Falkenau“ wird ausgerottet
Au - Untergiesing * Die ganze „Falkenau“ wird als „Rittersitz des kurfürstlichen Rats“ Josef Anton von Kern bezeichnet.
Damit verbunden ist die Erlaubnis, die ganze Wildnis auszurotten.
14. 1 1754 - Eine Probe aufs Klima für Maulbeerbäume
München * Der Hofgärtner Anton Häußler erhält den Auftrag, im Lustheimer Garten 800 kleine Maulbeerbäume zu pflanzen und damit „eine Probe aufs Klima“ zu machen. Nach der ersten Überwinterung kann Häußler berichten, dass Aprikosen und andere Bäume trotz Stroheindeckung erfroren seien, die uneingedeckten Maulbeerbäume es dagegen überstanden haben.
1. 5 1754 - Die Seidenmanufaktur des Anton Häußler
München * Anton Häußler erhält das „Privilegium zur Errichtung einer Seidenmanufaktur in baierischen Landen“.
14. 7 1754 - Janus de Garnerin Freiherr von Montgelas heiratet Maria Ursula von Trauner
München * Janus de Garnerin Freiherr von Montgelas vermählt sich mit Maria Ursula Gräfin von Trauner. Ihr gemeinsamer Sohn ist der spätere Staatsminister Joseph Maximilian von Montgelas.
2. 9 1754 - Münchens erstes Pfandhaus wird eröffnet
München * Das erste Münchner Pfandleihhaus wird eröffnet, nachdem Kurfürst Max III. Joseph seinem Kammerdiener Sebastian Hueber die Erlaubnis erteilt, Geld gegen Pfänder auszuborgen. Es befindet sich in der Hofstetterschen Behausung an der Rosengasse.
Es ist noch keine städtische Einrichtung, sondern untersteht der kurfürstlichen Verwaltung. Später zieht das Versatzamt in das Haus in der Löwengasse 6, bis der Standort im Jahr 1803 aufgelöst und an die Rochusstraße verlegt wird.
ab 1755 - Die Münchner Brauer lassen Bierkeller ins Isarhochufer graben und mauern
Haidhausen - Au * Trotz erheblichen Widerstands von den Behörden lassen die ersten Münchner Brauer mit erheblichen Kostenaufwand am Gasteigberg Bierkeller ins Isarhochufer graben und mauern.
Zunächst werden auf dem gekiesten Untergrund Linden, später Kastanien angepflanzt.
27. 1 1756 - Wolfgang Amadeus Mozart kommt in Salzburg zur Welt
Salzburg * Johannes Chrystostomos Wolfgang Gottlieb, genannt Wolfgang Amadeus Mozart, kommt in Salzburg zur Welt.
27. 5 1756 - Der spätere König Max I. Joseph wird in Mannheim geboren
Mannheim * Der spätere König Max I. Joseph wird in Mannheim geboren.
11. 12 1756 - Kaiserin Amalia Maria Josepha Anna stirbt in München
München - München-Kreuzviertel * Kaiserin Amalia Maria Josepha Anna stirbt in München. Sie wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche beigesetzt.
1758 - Der „Singlspielerbräu“ wird an Lukas Pruckmayr verkauft
München-Angerviertel * Der „Singlspielerbräu“ wird an Lukas Pruckmayr verkauft, der zuvor als „Brauknecht im Kurfürstlichen Weißen Bräuhaus“ gearbeitet hatte.
1758 - In der „Falkenau“ stehen erst zehn Häuser
Au - Untergiesing * In der „Falkenau“ stehen erst zehn, meist mit kleinen Gärten umgebene Häuschen.
1759 - Der Dachstuhl der „Georgskirche“ wird als „fast völlig verfault“ bezeichnet
Bogenhausen * Der Dachstuhl der „Georgskirche“ in Bogenhausen wird als „fast völlig verfault“ bezeichnet.
12. 9 1759 - Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas wird in München geboren
München * Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas wird in München geboren. Sein Vater, Janus de Garnerin Freiherr von Montgelas, stammt aus dem französisch sprechenden Teil des Herzogtums Savoyen. Seine Mutter Maria Ursula ist eine geborene Gräfin von Trauner und Tochter eines Geheimen Rates des Fürstbischofs von Freising. Bis zu ihrer Eheschließung ist Maria Ursula Gräfin von Trauner als Hofdame der Kurfürstin Maria Anna eingebunden. Sein Taufpate ist der baierische Kurfürst Max III. Joseph, von dem er auch seinen Vornamen hat.
1760 - August Joseph Graf von Törring-Jettenbach kauft „Schloss Neuberghausen“
Bogenhausen * August Joseph Graf von Törring-Jettenbach kauft „Schloss Neuberghausen“ und lässt es von François Cuvilliès und dem „Stadtoberbaumeister“ Ignaz Anton Gunetzrhainer umbauen.
Als Mitglied des „Georgs-Ritterordens“ finanziert er auch Teile des Umbaus der Bogenhausener „Georgskirche“.
1760 - Im „Kriechbaumhof“ leben neun Familien
Haidhausen * Im „Kriechbaumhaus“ in Haidhausen leben neun Tagelöhner-Familien.
1760 - 279 Familien leben in der „Hofmark Haidhausen“
Haidhausen * Die „Hofmark Haidhausen“ umfasst 279 Familien, die in 138 Häusern leben.
Um 1760 - Hofbankier von Pilgram erweitert seinen Besitz zum „Adelssitz Pilgramsheim“
Untergiesing * Der „Hofbankier“ und „Kommerzienrat“ Franz Anton von Pilgram erweitert seine Grundstücke durch weitere Zukäufe.
Er baut auf seinem Grund - „am Weg nach Harlaching“ - ein Schlösschen mit einer herrlichen Gartenanlage und beantragt anschließend beim Kurfürsten Carl Theodor die Erhöhung seines Hauses zu einem „Edelsitz“.
In seinem Antrag führt der „Hofbankier“ aus, dass er ein „nächst Obergiesing nahe der Isar liegendes, dem Revier Ehre machendes und denen Baulauten zu Gutem gediehenes Gebäude und Garten in einem Umfang von 5 - 6 Tagwerk“ besitzt, worauf er „bei seinen treibenden konfiderablen Geschäften ein und andere Täge mit Beschaulichkeit des nützlichen Landlebens verbringe und welchen Besitz er seinen Erben als ehrendes Andenken hinterlassen möchte“.
Dann folgt die Bitte, dem bestehenden und durch Zukäufe noch zu erweiternden Besitz zum „Adelssitz Pilgramsheim“ zu erheben.
1760 - Eine Seidenzucht-Kommission zur Förderung der Seide
München * Um die Seidenzucht zu fördern, ernennt Kurfürst Max III. Joseph eine „Seidenzucht-Commission“. Die „Ministris und Räthe“ sollten die verschiedenen Aktivitäten koordinieren.
Um 3 1760 - Maximilian Joseph von Montgelas‘ Mutter Maria Ursula stirbt
Maximilian Joseph von Montgelas‘ Mutter Maria Ursula, eine geborene Gräfin von Trauner, stirbt ein halbes Jahr nach seiner Geburt.
Da sich der Vater häufig auf Dienstreisen befindet, wächst er zunächst bei seiner Großmutter in Freising auf.
6. 2 1761 - Kölns Kurfürst Clemens August stirbt
Köln * Der Kölner Kurfürst Clemens August stirbt in Köln und wird in der dortigen Domkirche beigesetzt. Die Hofmark Berg am Laim erbt der Freisinger und Lütticher Fürstbischof Johann Theodor, der freilich auch aus der wittelsbachischen Familie stammt.
11. 3 1761 - Kardinal Johann Theodor darf nicht Kölner Erzbischof werden
Rom-Vatikan - Köln * Papst Clemens XIII. verweigert seine Zustimmung zur Wahl des Kardinals Johann Theodor zum Kölner Erzbischof. Er begründet dies mit dem „skandalösen und ungeistlichen Lebenswandel“ des Kirchenfürsten.
15. 6 1761 - Pfundschwere Hagelkörner fallen vom Himmel
Berg am Laim * Bei einem „förchterlichen Hagelsturz“ fallen „pfundschwere Hagelkörner“ nieder.
1762 - „Einzünftung“ der Auer, Loher und Giesinger Schneider
München - Au - Giesing * Mindestens seit 1571 besteht bei den Schneidern und anderen Gewerben ein Konkurrenzkampf zwischen den Münchnern und den Auern beziehungsweise den Haidhausern.
Mit der „Einzünftung“ der Auer, Loher und Giesinger Schneider gibt die Münchner Zunft jetzt scheinbar nach.
In Wirklichkeit sichert sie sich den Einfluss auf die Vororte.
1762 - Im „Kriechbaumhaus“ sind elf „Herbergen“ verzeichnet
Haidhausen * In den drei Häusern des „Kriechbaumhauses“ sind elf „Herbergen“ verzeichnet.
1762 - Die „Alte Isarkaserne“ auf der „Isarinsel“ brennt ab
München-Isarvorstadt * Die „Alte Isarkaserne“ auf der „Isarinsel“ brennt ab und wird neu aufgebaut.
1762 - Rousseau: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“
Genf * In seiner Publikation „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechte“ schreibt Jean-Jaques Rousseau: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“.
12. 1 1762 - Die Mozarts kommen nach München
Salzburg - Wasserburg - München * Leopold Mozart macht sich mit seinen beiden Kindern Nannerl und Wolfgang Amadeus zu einer Kunstreise auf den Weg nach München. Für die Fahrt von Salzburg in die baierische Residenzstadt braucht die Postkutsche 21 bis 22 Stunden, weshalb sie in Wasserburg einen Zwischenaufenthalt einlegen.
13. 1 1762 - Wolfgang Amadeus und Nannerl Mozart musizieren vor dem Kurfürstenpaar
München-Graggenau * In München angekommen musiziert der fünfjährige Wolferl und seine zehnjährige Schwester Nannerl in der Residenz vor den kritischen Ohren des kurfürstlichen Ehepaars. Wolfgang Amadeus Mozart wird Zeit seines Lebens München insgesamt achtmal besuchen.
1. 2 1762 - Herrenlose Hunde werden vom Schinder eingefangen und abgestochen
München * Nach einer kurfürstlichen Verordnung werden alle Hunde, die man herrenlos auf der Gasse antrifft, vom „Schinder“ eingefangen und abgestochen.
24. 3 1762 - Förderung der Maulbeerbaum-Pflanzungen
München * Kurfürst Max III. Joseph ordnet an, dass das bereits begonnene Pflanzen von Maulbeerbäumen fleißig fortgesetzt wird, wozu „Wir Samen und Pflanzen unentgeltlich abfolgen, annebens auch die Art und Weiss, wie die Plantage zu unterhalten, und nützlich zu gebrauchen sey, gleichfalls durch öffentlichen Druck bekannt machen lassen werden.“
27. 1 1763 - Fürstbischof Johann Theodor stirbt in Lüttich
Lüttich - Berg am Laim * Nach dem Tod des Freisinger Fürstbischofs Johann Theodor in Lüttich fällt die Hofmark Berg am Laim an das kurfürstliche Haus. Der Berg am Laimer Hofmarkherr ist jetzt Kurfürst Max III. Joseph.
18. 4 1763 - Franz Anton Bustelli stirbt
<p><strong><em>München-Nymphenburg - Neuhausen</em></strong> * Franz Anton Bustelli stirbt im Alter von 40 Jahren. Er wird am Friedhof an der Winthirstraße beigesetzt.</p>
13. 6 1763 - Wolfgang Amadeus Mozart kommt zum zweiten Mal nach München
Schloss Nymphenburg * Der siebenjährige Wolfgang Amadeus Mozart kommt zum zweiten Mal nach München. Es ist die erste Station einer dreijährigen Konzertreise der Mozarts, deren Hauptziele die Höfe von Paris und London sein werden. Die kurfürstliche Familie empfängt die Mozarts im Schloss Nymphenburg. Nannerl schreibt darüber:
„Zu münchen hab ich gesehen das ninfenburg, daß schlosse und den garten und die vier schlösser, nemlich amalienburg, badenburg, bagotenburg und die ermitage. das amalienburg ist das schönste, worinen das schöne bett ist und die küchel, wo die kurfürstin selbst gekocht hat. badenburg ist das gröste, wo ein sall ist von lauter spiegeln, das bad von marmor. bagotenburg ist daß kleinste, wo die maueren von meolika ist. und die ermitage ist das Sitzamste, wo die capel von muschel ist.“
1764 - Maximilian Joseph von Montgelas kommt nach Nancy
Nancy * Der fünfjährige Maximilian Joseph von Montgelas kommt nach Nancy, wo man ihm in einem „Jesuitenkolleg“ eine standesgemäße Erziehung angedeihen lässt.
27. 3 1764 - Joseph II. wird zum römisch-deutschen König gewählt
Frankfurt am Main * Joseph II. wird zum römisch-deutschen König gewählt.
3. 4 1764 - Joseph II. wird zum römisch-deutschen König gekrönt
Frankfurt am Main * Joseph II. wird zum römisch-deutschen König gekrönt.
1765 - Friedrich der Große schafft in Preußen alle „Hurenstrafen“
Berlin - München * Während König Friedrich der Große im aufgeklärten Preußen alle „Hurenstrafen“ abgeschafft hat, wird die „Prostitution“ in München erst wieder zu Beginn des 19.Jahrhunderts offiziell etabliert.
Doch bis in München wieder ein „Bordell“ eröffnet werden kann, werden noch Jahre vergehen.
Man bekämpft hier nicht nur die „Huren“, die „durch ihr geiles Hingeben und Toben [auf dem Tanzboden] die Achtung und Ehrfurcht der Männer längst verloren hatten“, sondern sogar den „Wiener Walzer“.
14. 4 1765 - Auguste Wilhelmine Maria von Hessen-Darmstadt wird geboren
Darmstadt * Auguste Wilhelmine Maria von Hessen-Darmstadt, die spätere erste Ehefrau von Max I. Joseph und Mutter von König Ludwig I., wird in Darmstadt geboren.
18. 8 1765 - Kaiser Franz I. Stephan stirbt in Innsbruck
Innsbruck * Kaiser Franz I. Stephan stirbt in Innsbruck. Sein Nachfolger als Kaiser wird Joseph II..
31. 8 1765 - Kurfürst Max III. Joseph will die Fassade der Theatinerkirche fertigstellen
München * Kurfürst Max III. Joseph informiert den Probst der Theatiner, Johannes Edlweckh, dass er die Fassade der Theatinerkirche fertigstellen möchte.
27. 9 1765 - François Cuvilliés legtden Plan für die Fassade der Theatinerkirche vor
München-Kreuzviertel * François Cuvilliés d.Ä. legt den Theatinern den Plan für die Fassade der Theatinerkirche vor.
1766 - Montgelas' Unterrichtsschwerpunkte verschieben sich
Nancy * Mit der erfolgten Vertreibung und Enteignung der „Jesuiten“ in Nancy geht die Leitung des Kollegs an ein weltgeistliches Gremium über.
Seit dieser Zeit stehen „Realien“ im Mittelpunkt des Unterrichts von Maximilian Joseph von Montgelas, also Naturwissenschaften, Geschichte, Geographie und neue Sprachen.
3 1766 - Beginn der Umbauarbeiten an der „Georgskirche“
Bogenhausen * Die Umbauarbeiten an der Bogenhausener „Georgskirche“ beginnen.
1. 4 1766 - Das Parsberger Haberfeldtreiben
<p><em><strong>Parsberg bei Miesbach</strong></em> * In der Nacht vom 1. zum 2. April 1766 findet in Parsberg bei Miesbach das <em>„Parsberger Treiben“</em> statt. Das Opfer ist Maria Aignmann, die Tochter des Sterzlbauern, die sich mit dem ledigen Bauernsohn Anton Preißl aus dem gleichen Dorf eingelassen und ein Kind geboren hat.</p> <p>An dem Haberfeldtreiben sind 23 Männer beteiligt, von denen nur einer verheiratet ist. Sie sind zwischen 16 und 26 Jahre alt. Die dargebrachten Spottverse sind sowohl für die Tochter des Sterzlbauern, aber auch einigen Bauern aus Parsberg und Bürgern vom nahen Miesbach gewidmet. </p>
25. 4 1766 - Die Arbeiten an der Fassade der Theatinerkirche beginnen
München-Kreuzviertel * Die Baumaßnahmen an der Fassade der Theatinerkirche werden nach den Plänen von François Cuvilliés begonnen.
20. 8 1766 - Die erste Verfolgung eines Haberfeldtreibens
Miesbach - München * Der Gerichtspfleger von Miesbach leitet eine Untersuchung ein, die umgehend zur Inhaftierung von neun Haberern des Parsberger Treibens vom 1./2. April 1766 führt. Der folgende kurfürstliche Erlass vom 20. August 1766 stellte das erste Dokument der Verfolgung des Haberfeldtreibens durch die baierischen Behörden dar.
22. 9 1766 - Baiern und Pfalz beschließen eine Erbverbrüderungs-Erneuerung
München • Der baierische Kurfürst Max III. Joseph und sein wittelsbachischer Verwandter Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz schließen eine „Erbverbrüderungs-Erneuerung“. Darin werden Baiern und Pfalz erstmals als „unteilbarer Gesamtbesitz des Hauses Wittelsbach“ bezeichnet.
13. 10 1766 - Don Ferdinand von Sterzinger hält Reden gegen den Hexenwahn
München * Der Theatiner-Pater Don Ferdinand von Sterzinger hält eine Rede gegen den Hexenwahn. Sein Vortrag befasst sich mit „dem gemeinen Vorurteil der wirkenden und tätigen Hexen“. Er geht als Vertreter der Aufklärung gegen Aberglauben und Unwissenheit vor.
Seine Schriften gegen Hexen sowie das Zauber- und Gespensterwesen bringen ihm grenzüberschreitende Achtung und Anerkennung ein. Der Theatinerpater bricht damit eine langwierige Diskussion vom Zaun, die als Baierischer Hexenkrieg bekannt wird. Im weiteren Verlauf streitet man in 28 Streitschriften um das Für und Wider.
Als besondere Gegner des Theatinerpaters offenbaren sich die Benediktiner von Scheyern, deren Kreuzreliquie angeblich gegen Verhexung wirksam ist und die in der Demontage des Zauberei-Tatbestands ihr Geschäft mit den von ihnen vertriebenen heiligen Gegenständen gefährdet sehen.
Doch Dank der Stellungnahme der Akademie der Wissenschaften kommt es in Churbaiern zu keinen Hexenverfolgungen mehr. Auch in anderen süddeutschen Territorien erlahmen schließlich die Hexenverfolgungen.
9. 11 1766 - Die Mozartkinder geben ihr erstes Hofkonzert in München
München * Auf der Rückreise von der großen Konzertreise geben die Mozartkinder ihr erstes Hofkonzert in München.
21. 11 1766 - Mozarts zweites Hofkonzert in München
München * Wolfgang und Nannerl Mozart geben ihr zweites Hofkonzert in München.
Ab 1767 - Die „Innere Ludwigsbrücke“ wird in Steinbauweise ausgeführt
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Die „Innere Ludwigsbrücke“ wird in Steinbauweise erbaut.
1767 - „Kapellmeister“ Josef Sulzbeck wird geboren
München * Joseph Sulzbeck, später als „Kapellmeister Sulzbeck“, als Urvater der Münchner „Volkssänger“ bekannt, wird in München geboren.
25. 4 1767 - Maximilian Joseph von Montgelas‘ Vater stirbt
München * Maximilian Joseph von Montgelas‘ Vater, Janus de Garnerin Freiherr von Montgelas, stirbt.
10. 12 1767 - Die Fassade der Theatinerkirche ist fertiggestellt
München-Kreuzviertel * Die Arbeiten an der Fassade der Theatinerkirche nach den Plänen von François Cuvilliés sind fertig gestellt.
1768 - Die Statuten des „Georgs-Ritterordens“ werden geändert
München * Die Statuten des „Georgs-Ritterordens“ werden geändert.
Es müssen jetzt 17 statt 15 altadelige Ahnen väterlicher- und mütterlicherseits vorgewiesen werden.
Man wollte eben - als elitäre Clique - unter sich bleiben.
1768 - Theresina Kurz leitet das Faberbräu-Theater
<p>München-Hackenviertel * Unter der Leitung von Theresina Kurz hielt ein gehobeneres Niveau im <em>„Komödienstadel“</em> im Faberbräuhaus Einzug, obwohl noch immer die Figur des Lipperls vorherrschte.</p>
12. 2 1768 - Der spätere Kaiser Franz II. wird in Florenz geboren
Florenz * Der spätere Kaiser Franz II. bzw. Franz I. Joseph Karl, aus dem Hause Habsburg-Lothringen, wird in Florenz geboren.
14. 4 1768 - François Cuvilliés stirbt in München
München * François Cuvilliés stirbt in München.
30. 5 1768 - Alois Reichl wird Hofmarkuntertan, Schulmeister und Gerichtszeuge
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Alois Reichl wird vom Haidhauser Hofmarksherrn als Hofmarkuntertan, Schulmeister und Gerichtszeuge aufgenommen.</p>
25. 9 1768 - Simon Troger stirbt im Alter von 74 Jahren an einem Schlaganfall
Haidhausen * Simon Troger stirbt im Alter von 74 Jahren an einem Schlaganfall. Das Pfarramt widmete ihm im Totenbuch den folgenden ehrenden Eintrag: „Hervorragender Bildhauer, dem in ganz Baiern keiner ähnlich war - Wie an Kunst und Wissen, so an Tugenden hell leuchtend.“
16. 12 1768 - Das neue Haidhauser Schulmeisterhaus
Haidhausen * Schulmeister Alois Reichl kauft eine benachbarte Herberge auf, lässt beide Häuser abtragen und an ihrer Stelle ein neues Gebäude erbauen. Das sogenannte Schulmeisterhaus befand sich an der heutigen Einsteinstraße, gegenüber der Unionsbrauerei.
1769 - „Handwerks-Gerechtigkeiten“ können vererbt oder verkauft werden
München * Der Rat genehmigt dem „Münchner Zunfthandwerk“, dass sie ihre an die Person gebundene „Gerechtigkeit“ vererben oder verkaufen können.
Das führt dazu, dass der „Erwerb einer Gerechtigkeit“ immer unerschwinglicher wird und sich vermögende Handwerker „Gerechtigkeiten“ kaufen und „ruhen“ lassen.
1769 - Der erste Blitzableiter in Deutschland
Hamburg * Der erste Blitzableiter in Deutschland wird auf der Hamburger „Sankt-Jacobi-Kirche" installiert.
21. 4 1769 - Thersina Kurz schließt einen Vertrag für Aufführungen im Opernhaus
<p><strong><em>München</em></strong> * Hoftheaterintendant Graf Seeau schließt auf Anordnung des Kurfürsten Max III. Joseph einen Vertrag mit Theresina Kurz, der es ihr und ihrer Truppe erlaubt, viermal wöchentlich auf der Bühne des Opernhauses am Salvatorplatz aufzutreten. Der Hof lässt sich für die Vorstellungen sogar fünf Logen reservieren. </p>
1. 8 1769 - Kurfürst Max III. Joseph richtet ein Bücherzensurkollegium ein
München * Kurfürst Max III. Joseph richtet ein Bücherzensurkollegium ein, das alle Druckschriften untersucht.
15. 8 1769 - Napoleon Bonaparte wird auf Korsika geboren
Ajaccio * Napoleon Bonaparte, der spätere französische Kaiser Napoleon I., wird in Ajacco auf Korsika geboren.
10 1769 - Die Kurz‘sche Theatertruppe gastiert im Opernhaus
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Die Kurz’sche Wander-Theatergruppe gastiert viermal wöchentlich im Opernhaus am Salvatorplatz. Das Engagement dauert bis Ende April 1770 an. </p> <p> </p>
1770 - Die „Hausnummern“ werden eingeführt
München * Die „Hausnummern“ werden in München eingeführt.
Um 1770 - Max V. Franz Xaver von Preysing erweitert den Haidhauser Besitz
Haidhausen * Max V. Franz Xaver von Preysing-Hohenaschau erweitert den Haidhauser Besitz auf 11 Tagwerk, wovon alleine der „Hopfengarten“ 2½ Tagwerk groß ist.
Der Graf lässt eine Pappelallee vom Schloss bis zu den Bierkellern am Gasteig pflanzen.
1770 - Das „Almosengeben“ wird unter Strafe gestellt
München * Das traditionelle „Almosengeben“ wird unter Strafe gestellt, lässt sich aber nicht rasch ausrotten.
Um 1770 - Niedergang der „Falkenbeize“ im Kurfürstentum Baiern
Au - Untergiesing * Mit dem Niedergang der „Falkenbeize“ im Kurfürstentum Baiern ist auch in der „Falkenau“ der Weg zu einer stärkeren Besiedelung frei geworden.
Hatte die „Falkenau“ bis dahin nur wenige Bewohner, so nehmen die künftigen „Hofmarkbesitzer“ nun „alles verrufene Gesindel und alle der Gemeinde Au und München lästigen Leute“ in ihrem Besitztum auf.
Seit dem Jahr 1770 - Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas studiert in Straßburg
Straßburg * Bis 1776 studiert Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas in Straßburg „Jurisprudenz“ und hört „Öffentliches Recht“ bei Christoph Wilhelm von Koch.
Dieser lehrt, dass „die Ordnung mit modernen Methoden erhalten, aber im Geist des Rationalismus gestaltet werden muss. Dies sollt durch einen ‚aufgeklärten Absolutismus‘ geschehen, der von oben für alle den Fortschritt und für jeden das Glück zu verordnen habe“.
Die Ansicht, dass dem Staat die Hoheit über die Kirche zusteht, gefällt dem jungen Montgelas ganz besonders.
5 1770 - Theresina Kurz verlässt München
<p><strong><em>München</em></strong> * Theresina Kurz verlässt mit ihrer Schauspielertruppe München. </p>
26. 6 1770 - Mozart erhält von Papst Clemens XIV. den Orden vom Goldenen Sporn
Rom-Vatikan * Wolfgang Amadeus Mozart wird durch Papst Clemens XIV. mit dem Orden vom Goldenen Sporn ausgezeichnet. Der Träger ist berechtigt, sich cavaliere, Chevalier oder Ritter zu nennen.
Selbst der sonst so geschwätzige Leopold Mozart schweigt auffällig über die Auszeichnung seines Sohnes. Der Grund liegt bei den adeligen Ruperti-Rittern in Salzburg, die dem bürgerlichen musicus diesen gesellschaftlichen Aufstieg nicht vergönnen.
1771 - Das „Lehen Schmalzhof“ wird dem Grafen Marquart von Kreuth verliehen
Au * Das „Lehen Schmalzhof“ wird dem Grafen Marquart von Kreuth verliehen.
1771 - Der Turm der „Georgskirche“ erhält seine charakteristische Kuppel
Bogenhausen * Der Turm der „Sankt-Georgs-Kirche“ in Bogenhausen wird erhöht und mit der charakteristischen Kuppel bekrönt.
1771 - Noch mehr Maulbeerbäume
München * Kurfürst Max III. Joseph gibt erneut einen Erlass heraus, wonach überall Maulbeerbäume anzupflanzen sind.
Schon wenige Jahre später gibt es tatsächlich mehrere Zehntausend junge Maulbeerbäume, darunter auch im „Hasen- und Hopfengarten im Schloss Nymphenburg“ oder im Schlossgarten der Burg Trausnitz in Landshut.
10. 10 1771 - Johann Nießer übernimmt das Faberbräu-Theater
<p><strong><em>München-Hackenviertel</em></strong> * Johann Baptist Joachim Nießer, ehemaliges Mitglied der Kurz‘schen Schauspielertruppe, kehrt mit dem Ensemble nach München zurück und übernimmt die Leitung des Faberbräu-Theaters. Mit Unterstützung der Baierischen Akademie der Wissenschaften eröffnet er hier die <em>„Deutsche Schaubühne“</em>, was als ein <em>„Markstein auf dem Weg zu einem Münchner Nationaltheater“</em> gilt. </p> <p>Mit ausgebildeten Schauspielern finden seither regelmäßige Vorstellungen im Faberbräu statt. Der Publikumserfolg stellt sich bald ein, sodass er auch die Anerkennung des Grafen Seeau gewinnen kann. </p> <p>Durch das gebotene hohe Niveau der Schauspielkunst strömt nun auch die gehobene Münchner Bürgerschaft in Scharen in das Faberbräu-Theater. Dadurch erhöhen sich die Eintrittspreise, sodass sich das einfache Publikum den Theaterbesuch einfach nicht mehr leisten kann und so aus dem Kulturbetrieb verdrängt wird. Die Bürger der unteren Schichten suchen ihr Vergnügen nun wieder in den Bretterbuden und <em>„Hanswurst-Theatern“</em> in den Münchner Vorstädten. </p>
27. 12 1771 - Der Feiertag des heiligen Johann Evangelist wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag des heiligen Johann Evangelist wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
28. 12 1771 - Der Feiertag der Unschuldigen Kinder wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag der Unschuldigen Kinder wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
1772 - Stephan Selmayr heiratet auf den Hanslmarterhof ein
Bogenhausen * Der vom Sedlhof in Finsing (Landkreis Erding) stammende Stephan Selmayr heiratet auf den Bogenhausener Hanslmarterhof ein.
1772 - Ein bescheidenes Jahresgehalt für Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg * Der neue „Fürstbischof“ von Salzburg, Hieronymus Colloredo, gewährt Wolfgang Amadeus Mozart ein bescheidenes Jahresgehalt von 150 Gulden.
1772 - Maria Clara Troger, die Witwe des Elfenbeinschnitzers Simon Troger, stirbt
Haidhausen * Maria Clara Troger, die Witwe des Elfenbeinschnitzers Simon Troger, stirbt.
23. 4 1772 - Der „Feiertag des heiligen Georg“ wird letztmals gefeiert
München * Der „Feiertag des heiligen Georg“ wird letztmals gefeiert.
Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche „Breve“ vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
16. 5 1772 - Die Menschen sollen arbeiten, nicht feiern!
München - Rom-Vatikan * Papst Clemens XIV. hebt auf Bitten der baierischen Regierung zwanzig kirchliche Feiertage auf. Bisher gibt es 124 Sonn- und Feiertage, die sich aufteilen in 52 Sonntage, 53 übliche und 19 gebotene Feiertage, was im Schnitt einer Fünf-Tage-Woche entspricht. Abgeschafft werden
- acht Apostelfeste,
- dazu die Festtage der Heiligen Anna (26. Juli),
- Laurentius (10. August),
- Michael (29. September),
- Johann Evangelist (27. Dezember),
- Georg (23. April),
- Magdalena (22. Juli),
- Martin (11. November),
- Katharina (25. November),
- Nikolaus (6. Dezember),
- Unschuldige Kindlein (28. Dezember).
- Dann noch der Osterdienstag und
- der Pfingstdienstag.
Mit der Aufhebung der Feiertage entfällt die Verpflichtung zum Besuch der heiligen Messe am Vormittag und das Fastengebot am Vorabend. Andererseits müssen an den aufgehobenen Feiertagen die Werkstätten und Läden geöffnet werden. Weil die Einhaltung der Verordnung nicht überprüft wird, wird sie auch nicht eingehalten.
12. 6 1772 - Die Nießer‘sche Theatertruppe wird angepriesen
<p><strong><em>München</em></strong> * In einem Schreiben an Kurfürst Max III. Joseph preist Hoftheaterintendant Graf Seeau die Leistungen der inzwischen stadtbekannten Nießer‘schen Theatergruppe. </p> <p> </p>
22. 7 1772 - Feiertag der heiligen Magdalena letztmals gefeiert
München * Der Feiertag der heiligen Magdalena wird letztmalig gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
26. 7 1772 - Der Feiertag der heiligen Anna wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag der heiligen Anna wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
10. 8 1772 - Der „Feiertag des heiligen Laurentius“ wird letztmalig gefeiert
München * Der „Feiertag des heiligen Laurentius“ wird letztmals gefeiert.
Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche „Breve“ vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
29. 9 1772 - Der Feiertag des heiligen Michael wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag des heiligen Michael wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
11 1772 - Der Schulmeister Benjamin Thompson heiratet Sarah Rolfe
Concorde * Der 19-jährige wandernde Schulmeister Benjamin Thompson heiratet die elf Jahre ältere Sarah Rolfe.
Sie ist die reichste Witwe von Concorde, dem früheren Rumford, und die Tochter des betuchten und einflussreichen Pfarrers Timothy Walker.
Thompson ist jetzt ein wohlhabender Landedelmann und Verwalter eines großen Gutes.
11. 11 1772 - Der Feiertag des heiligen Martin wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag des heiligen Martin wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
25. 11 1772 - Der Feiertag der heiligen Katharina wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag der heiligen Katharina wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
6. 12 1772 - Der Feiertag des heiligen Nikolaus wird letztmals gefeiert
München * Der Feiertag des heiligen Nikolaus wird letztmals gefeiert. Er wird am 14. Dezember 1772 durch eine vorausgehende päpstliche Breve vom 16. Mai 1772 abgeschafft.
1773 - Peter von Osterwald kauft einen Acker für ein „Observatorium“
Haidhausen * Peter von Osterwald kauft vom „Leprosenhaus“ einen Acker, um darauf ein astronomisches „Observatorium“ zu errichten.
1773 - Der Hochaltar der „Georgskirche“ von Johann Baptist Straub ist vollendet
Bogenhausen * Der Hochaltar der Bogenhausener „Georgskirche“ von Johann Baptist Straub ist vollendet.
1773 - Johann Peyrl wird als „Kotterbauer und Unterthan“ bezeichnet
Haidhausen * Ein Johann Peyrl wird als „Kotterbauer und Gasteigischer Unterthan zu Haidhausen“ bezeichnet.
1773 - Wozu denn soll der Bauer Lesen und Schreiben lernen?
München * Die staatlich angestrebte „Schulreform“ stößt auf harten Widerstand.
Der „Erzpriester“ Martin Joseph Jacabin meint: „Wozu denn sollte der Bauer Lesen und Schreiben lernen! [...]
Der Allmächtige Gott hat auch dem des Lesens und Schreibens unkundigen Landvolk genügsame Kräfte gegeben, dasjenige begreifen zu können, was zu seiner zeitlichen und ewigen Wohlfahrt erforderlich ist. [...] So lang man, sozusagen, ein einziges Buch gehabt, war fast alles fromm und heilig“.
1773 - Kurfürst Max III. Joseph reduziert die „Feiertage“
München * Kurfürst Max III. Joseph reduziert die „Feiertage“ von rund einhundert auf 22.
1773 - Kurfürst Carl Theodor schickt Friedrich Ludwig Sckell nach England
Schwetzingen - Großbritannien * Zum Studium des neuen „Gartenstils“ schickt Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz den Sohn des Schwetzinger „Hofgärtners“, Friedrich Ludwig Sckell, nach England.
1773 - Der „Franziskaner-Friedhof“ wird gesperrt
München-Graggenau * Der vor dem „Klostergebäude“ und seitlich der „Franziskanerkirche“ befindliche „Franziskaner-Friedhof“ wird gesperrt.
1. 3 1773 - Die Nießer‘sche Theatertruppe tritt im Opernhaus auf
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Im Opernhaus am Salvatorplatz gibt Johann Baptist Joachim Nießer mit seinem Ensemble erstmals eine Vorstellung. Der gesamte kurfürstliche Hof ist dabei anwesend. </p>
21. 7 1773 - Das Aufhebungsdokument für den Jesuitenorden
Rom-Vatikan * Papst Clemens XIV. stellt das Aufhebungsdokument für den Jesuitenorden aus. Es tritt einen Monat später in Kraft.
21. 7 1773 - Die Marianische Männerkongregation unter weltlicher Obhut
München-Kreuzviertel * Bis zur Auflösung der Gesellschaft Jesu durch Papst Clemens XIV. liegt die geistliche Leitung der Marianischen Männerkongregation unter jesuitischer Obhut. Die Betreuung geht nun auf Weltgeistliche über.
3. 8 1773 - Erbauung der Bierkeller außer dem Burgfrieden und Verleitung des Biers
München * Ein kurfürstliches Mandat befasst sich mit der Erbauung der Bierkeller außer dem Burgfrieden und Verleitung des Biers. Das in den genannten Märzenkellern“gelagerte Bier darf nur an Gäuwirte und nur in grosso oder Fassweise verkauft werden. Der Minutoverschleiß, das Abgeben des Bieres massweise ist verboten. Das Bier muss vom Bräu in die entsprechende Stadt oder den Markt gebracht werden.
21. 8 1773 - Papst Clemens XIV. hebt den Jesuitenorden auf
Rom-Vatikan * Papst Clemens XIV. hebt - auf Drängen mehrerer katholischer Monarchien - den Jesuitenorden auf.
1774 - Ignaz Günther arbeitet an der Kanzel des Bogenhausener „Georgskircherls“
Bogenhausen * Seit dem Jahr 1770 Ignaz Günther an der Kanzel des Bogenhausener „Georgskircherls“.
1774 - Peter Paul Maffei kommt nach München
München * Peter Paul Maffei kommt nach München.
24. 3 1774 - Giovanni Pietro Salti eröffnet ein Café unter den Arkaden des Hofgartens
München-Maxvorstadt * Der kurfürstliche Lottokollekteur Giovanni Pietro Sarti, genannt „Pantalon“, aus Venedig erhält die Genehmigung zur Eröffnung einer „Boutique“ unter den Arkaden des Hofgartens. Dort darf er „coffee“, „chocolats“, „lemonats“ und andere „refraichissements“ [Erfrischungen] anbieten.
5. 4 1774 - Kurfürst Max III. Joseph will die Friedhofsfrage neu regeln
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * Kurfürst Max III. Joseph fordert den Stadtmagistrat auf, einen Standort für einen neuen Friedhof zu finden oder die Erweiterung des bestehenden <em>„Friedhofs vor dem Sendlinger Tor“</em>, des heutigen <em>„Alten südlichen Friedhofs“</em>, zu überdenken.</p> <ul> <li>Die bestehenden Friedhöfe innerhalb der Stadtmauer sollen aufgelassen, gekalkt und gepflastert werden. </li> <li>Auch die Grüfte in den Kirchen, diese <em>„stinkenden, vergifteten Vorratskeller ansteckender Luft“</em>, sollen aufgelassen werden.</li> </ul> <p>Sofort organisiert sich Widerstand gegen diese kurfürstlichen Maßnahmen, wobei das einfache, ärmere Volk davon weniger betroffen ist, weil sie schon seit längerer Zeit ihre Toten vor das Sendlinger Tor begleiten müssen. </p>
18. 10 1774 - Sally Thompson wird geboren
Concorde * Benjamin Thompsons Tochter Sarah, allgemein Sally genannt, wird geboren.
7. 12 1774 - Dritter Aufenthalt Mozarts in München
München * Wolfgang Amadeus Mozart hält sich bis 5. März 1775 anlässlich der Uraufführung der Opera buffo „La finta giardiniera“ zum dritten Mal in München auf.
29. 12 1774 - Uraufführung wegen Zahnschmerzen verschoben
München * Die Uraufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „La finta giardiniera“ muss wegen Zahnschmerzen des Komponisten und der damit verkürzten Probezeiten des Ensembles verschoben werden.
1775 - Die „Hofkammer“ kauft am Gasteig einen Bierkeller für das „Hofbräuhaus“
Au * Die „Kurfürstliche Hofkammer“ erwirbt von dem Münchner Bürger und Maurermeister Caspar Trisberger den an der Ecke Rosenheimer- und Hochstraße gelegenen Braukeller für das „Hofbräuhaus“.
1775 - Der „Friedhof des Franziskanerklosters“ wird geschlossen
München-Graggenau - München-Isarvorstadt * Der „Friedhof des Franziskanerklosters“ wird lange vor dem „Specialreskript“ von Kurfürst Carl Theodor aus dem Jahr 1788, das die Auflösung aller innerstädtischen Friedhöfe vorschreibt, geschlossen.
Die Gebeine der Verstorbenen bringt man auf den neuen „Gesamtfriedhof“, der weit vor den Toren der Stadt liegt, dem „Südlichen Friedhof“ an der Thalkirchner Straße.
13. 1 1775 - Mozarts Oper La finta giardiniera wird in München uraufgeführt
München-Kreuzviertel * Der - als „Gärtnerin der Liebe“ eingedeutschte - Geniestreich des 18-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart - „La finta giardiniera“ - wird im Opernhaus am Salvatorplatz, dem ersten freistehenden Opernhaus nördlich der Alpen, uraufgeführt.
2. 2 1775 - Mozarts Oper „La finta giardiniera“ wird zum zweiten Mal aufgeführt
München-Kreuzviertel * Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „La finta giardiniera“ wird im Redoutenhaus an der Prannerstraße 8, während einer maskierten Akademie zum zweiten Mal aufgeführt.
4. 4 1775 - Die als Hexe verurteilte Anna Maria Schweglin soll hingerichtet werden
<p><em><strong>Kempten</strong></em> * Die zum Tode mit dem Schwert wegen <em>„Schadenszauber und Teufelsbuhlschaft“</em> verurteilte Hausmagd Anna Maria Schweglin aus Kempten soll hingerichtet werden. Sie gilt als die letzte hingerichtete bayerische Hexe. Doch sie stirbt - wie man erst 1995 entdeckt - anno 1781 im Gefängnis. </p>
19. 4 1775 - Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg bricht aus
<p><strong><em>Boston</em></strong> * In der Gegend um Boston bricht der amerikanische <em>„Unabhängigkeitskrieg“</em> aus. Benjamin Thompson kämpft als Oberst auf der Seite der Briten.</p>
29. 4 1775 - Marquart Graf von Kreuth kauft den Kotterhof in Niedergiesing
Au * Der Kotterhof in Niedergiesing (= heute: Nockherberg) geht ebenfalls an Marquart Graf von Kreuth und wird zum Adelssitz Marquartskreith erhoben.
1776 - München bekommt seinen ersten „Blitzableiter“
München * München bekommt seinen ersten „Blitzableiter“.
Die Zeit des „Wettersegens“ ist vorbei.
5. 2 1776 - Franz Ferdinand Edler von Setzger kauft den ehemaligen Jesuitengarten
Haidhausen * Der kurfürstliche Rat und Doktor beider Rechte, Franz Ferdinand Edler von Setzger, des Heiligen Römischen Reiches Ritter, kauft den ehemaligen Jesuitengarten in Haidhausen.
Nach dem 17. 3 1776 - Benjamin Thompson flieht nach London
<p><strong><em>USA - London</em></strong> * Benjamin Thompson beteiligt sich am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Nachdem sich die Briten aus Boston zurückziehen, müssen rund 10.000 Soldaten und Zivilisten das Land verlassen. Benjamin Thompson flieht mit englischen Truppen nach London, wo er rasch Karriere macht. Seine Frau und seine Tochter lässt er in Concorde zurück. </p>
17. 4 1776 - Johann Jakob Hemmer entwickelt den „Hemmerschen Fünfspitz“
Trippstadt * Im süddeutschen Raum entwickelte Johann Jakob Hemmer, Leiter des Physikalischen Kabinetts am Hof des Kurfürsten Carl Theodor in Mannheim, den „Hemmerschen Fünfspitz“. Der erste „Blitzableiter hemmerscher Art“ wird auf dem Schloss des Freiherrn von Hacke in Trippstadt/Pfalz installiert.
Die weitere Entwicklung des Blitzableiters wird durch eine Verordnung des Kurfürsten Carl Theodor beschleunigt. Er bestimmt, dass alle Schlösser und Pulvertürme des Landes mit Blitzableitern auszurüsten sind.
1. 5 1776 - Johann Adam Weishaupt gründet den Geheimbund der Illuminaten
<p><strong><em>Ingolstadt</em></strong> * Der Ingolstädter Professor für Kirchenrecht und praktische Philosophie, Johann Adam Weishaupt, gründet den Geheimbund der Illuminaten, dem ein Großteil der baierischen Beamtenschaft, zahlreiche Mitglieder der Landstände und Geistliche angehören und dessen Ziel die Errichtung eines fürsten- und religionslosen Weltstaates ist. </p> <p>Die Vereinigung hat von den Freimaurern wesentliche aufklärerische Grundpositionen, Organisationsformen und Rituale übernommen. Weishaupts Motive bewegen sich durchaus in die Richtung eines gesellschaftspolitischen Umsturzes.</p> <p>Auch Maximilian Joseph von Montgelas gehört den Illuminaten unter dem Ordensnamen <em>„Musäus“</em> an. Obwohl der Freiherr zum <em>„Illuminatus maior“</em> aufsteigt, spielt er innerhalb des Geheimbundes nie eine größere Rolle. </p>
4. 7 1776 - Die amerikanische Unanhängigkeitserklärung
USA * Dreizehn britische Kolonien in Amerika unterzeichnen die Unanhängigkeitserklärung.
4. 7 1776 - Die europäische Aufklärung will den Menschen befreien
München * Freiherr Maximilian von Montgelas erfährt seine politische Prägung in der Zeit der Aufklärung, die der Philosoph Immanuel Kant als den Ausgang des Menschen aus seiner Unmündigkeit beschreibt.
Die europäische Aufklärung will den Menschen emanzipieren und ihn von den geistigen und gesellschaftlichen, den kirchlichen und staatlichen Zwängen befreien. Ihre Philosophen und Publizisten sprechen dem Menschen eine gottgegebene Würde und natürliche Rechte zu: So auch das Recht, kraft seiner Vernunft und Dank seiner Erfahrung sein Leben zu gestalten.
Außerdem soll der freie Mensch sich mit seinesgleichen zusammentun und die alten Gewalten - Monarchie und Aristokratie - in die Schranken weisen, wenn nicht sogar beseitigen. Die befreiten Menschen sollen eine neue Gesellschaft bilden und einen neuen Staat gründen, welcher die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen ermöglicht und somit dem Fortschritt Aller dient.
In Amerika werden diese Gedanken in Taten umgesetzt, als sich am 4. Juli 1776 die dreizehn englischen Kolonien zu „freien und unabhängigen Staaten“ erklären. Die Grundlage bildete die Erkenntnis, dass alle Menschen gleich geschaffen, sowie von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden sind. Dazu gehört Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Freie und gleiche Menschen wählen sich eine Regierung, die, wenn sie nicht mehr ihre Zustimmung hat, durch eine andere ersetzt werden muss.
13. 7 1776 - Caroline Friederike Wilhelmine von Baden wird in Karlsruhe geboren
Karlsruhe * Caroline Friederike Wilhelmine von Baden wird in Karlsruhe geboren.
Um 9 1776 - Maximilian Joseph von Montgelas studiert an der „Universität Ingolstadt“
Straßburg - Ingolstadt * Im Anschluss an sein Straßburger Studium geht Freiherr Maximilian Joseph von Montgelas für ein Jahr an die „Universität Ingolstadt“, wo er sich noch in das baierische Staats-, Zivil- und Strafrecht einarbeitet.
Sein Examen legte er „mit außerordentlichem Lob“ ab.
10. 12 1776 - Maria Leopoldine wird in Mailand geboren
Mailand * Maria Leopoldine, die spätere bairische Kurfürstin und Ehefrau von Kurfürst Carl Theodor, wird in Mailand geboren. Ihr Vater ist Ferdinand Carl Anton, Erzherzog von Österreich-Este und Generalgouverneur der Lombardei, ihre Mutter Maria Beatrix, eine Prinzessin von Modena d‘Este und Herzogin von Massa und Carrara.
1777 - Mit Kurfürst Carl Theodor kommen Pfälzer und der Pfalzwein
München * Im Gefolge des neuen pfalz-baierischen Kurfürsten Carl Theodor kommen etwa 3.000 Menschen aus der Pfalz nach München - und damit auch verstärkt der „Pfalzwein“.
1777 - Die Innenausgestaltung der „Georgskirche“ istabgeschlossen
Bogenhausen * Mit den zwei Seitenaltären ist die Innenausgestaltung der „Georgskirche“ in Bogenhausen abgeschlossen.
1777 - Ignaz Mayer kommt nach München
München * Die Familie des Ignaz Mayer kommt nach München, als Kurfürst Carl Theodor das Erbe der baierischen Regentschaft antritt.
Er wird später dem erlauchten Kreis der Kreditgeber des baierischen Königs zählen.
Alleine in den Jahren 1807 und 1808 gewährt er der königlichen „Centralkasse“ Anleihen in Höhe von 100.000 Gulden.
Um 2 1777 - Benjamin Thompson wird „Sekretär für die Provinz Georgia“
Georgia * Benjamin Thompson wird in London „Sekretär für die Provinz Georgia“.
Das unbedeutende Ehrenamt ist mit einem ansehnlichen Jahresgehalt von einhundert Pfund dotiert.
16. 8 1777 - Anton Clemens von Toerring-Seefeld tritt den Jesuitengarten ab
Hofmark Haidhausen * Der Haidhauser Hofmarkherr Graf Anton Clemens von Toerring-Seefeld tritt an Franz Ferdinand von Setzger die Niedergerichtsbarkeit über den Jesuitengarten ab.
18. 8 1777 - Maximilian Joseph von Montgelas erhält einen Staats-Job
München * Im Alter von nur 18 Jahren hat Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas seine Ausbildung beendet und wird von seinem Taufpaten Max III. Joseph zum - unbesoldeten - „Wirklichen Hofrat auf der Ritterbank“ ernannt.
22. 8 1777 - Der ehemalige Jesuitengarten wird zum Edelsitz Haidenberg
Haidhausen * Der ehemalige Jesuitengarten in Haidhausen wird zu einem Edelsitz mit Niedergerichtsbarkeit erhoben und erhält den Namen Haidenberg.
9 1777 - Wolfgang Amadeus Mozart verlässt Salzburg
Salzburg * Wolfgang Amadeus Mozart hält es nicht mehr in Salzburg.
Er hat von dem strengen und sparsamen „Fürstbischof“ Hieronymus Coloredo die Schnauze voll, ist gerade aus dem verhassten salzburgischen „Hofdienst“ entlassen worden und sucht nun an einem anderen Ort ein ihm gemäßes Wirkungsfeld.
Gemeinsam mit seiner Mutter macht er sich auf Reisen.
24. 9 1777 - Mozart logiert im Gasthof Zum schwarzen Adler
München-Kreuzviertel * Wolfgang Amadeus Mozart und seine Mutter kommen in München an und logieren im Gasthof Zum schwarzen Adler des Weinschenks Franz Joseph Albert in der Kaufingergasse.
30. 9 1777 - Die fehlende Vakatur verhindert Mozarts Anstellung in München
München-Graggenau * Wolfgang Amadeus Mozart antichambriert mit Kurfürst Max III. Joseph in der Residenz. Den Verlauf des Gesprächs schreibt Wolfgang Amadé an seinen Vater:
„Als der Kurfürst an mich herankam, sagte ich:
„Euer Kurfürstliche Durchlaucht erlauben, daß ich mich untertänigst zu Füßen lege und meine Dienste antragen darf“ –
„Ja, völlig weg von Salzburg? –
„Ja, Euer Kurfürstliche Durchlaucht“ –
„Ja, warum denn, habts enck z‘kriegt?“ –
„Ei, beileibe, Eurer Durchlaucht: ich habe nur um eine Reise gebeten, er [der Salzburger Fürstbischof] hat sie mir abgeschlagen, mithin war ich gezwungen, diesen Schritt zu machen; obwohl ich schon lange im Sinn hatte, wegzugehen, denn Salzburg ist kein Ort für mich.“ -
„Mein Gott, ein junger Mensch! Aber der Vater ist noch in Salzburg?“ -
„Ja, Euer Kurfürstliche Durchlaucht. Ich bin schon dreimal in Italien gewesen, habe drei Opern geschrieben, bin Mitglied der Akademie in Bologna, habe müssen eine Probe ausstehen, wo viele Maestri 4 bis 5 Stunden gearbeitet und geschwitzt haben, ich habe es in einer Stund verfertigt: das mag zum Zeugnis dienen, daß ich im Stande bin, in einem Hofe zu dienen.“ –
„Ja, mein liebes Kind, es ist keine Vakatur da. Mir ist es leid, wenn nur eine Vakatur da wäre“ –
„Ich versichere Euer Durchlaucht, ich würde München gewiß Ehre machen“ –
„Ja, das nutzt alles nichts. Es ist keine Vakatur da“ -
Dies sagte er gehend. Nun empfahl ich mich zu höchsten Gnaden.“
Gerade weil der Kurfürst so musikverständig war, müssen andere Gründe als die fehlende Planstelle der Anstellung Mozarts im Wege gestanden haben. Hätte Baierns Kurfürst Max III. Joseph die Anstellung Wolfgang Amadeus Mozarts wirklich gewollt, so hätte er die Planstelle für den Hofmusiker auch durchgesetzt und Mittel und Wege der Finanzierung gefunden. Es trifft freilich zu, dass im Bereich der Hofmusik damals die Ämter des Kapellmeisters, des Kammerkompositeurs und der Konzertmeister besetzt waren.
Und dennoch war die Aussage mit der fehlenden Vakatur eine typische Sachzwang-Argumentation. Guten Willen vorausgesetzt, hätte der baierische Herrscher den Komponisten aus seiner Kabinettskasse bezahlen können, wie er es schon mehrmals bei bedeutenden Sängerinnen und Sängern machte. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, Mozart den Auftrag für eine Oper zu erteilen.
Es scheint naheliegend, dass Mozarts Musik nicht dem kurfürstlichen Geschmack entsprochen hat. Kurfürst Max III. Joseph war ein überzeugter Anhänger der älteren neapolitanischen Virtuosenoper. Mozarts Musik dürfte ihm zu wenig traditionell, zu reich, zu vielschichtig, kurz - zu modern gewesen sein. Seine eigenen, etwas altväterlichen Kompositionen scheinen dies zu bestätigen.
Die Ursachen liegen aber zweifellos am Salzburger Bischofshof. Denn wer, wie Mozart, gegen den Bischof von Salzburg aufmümpfige Reden führt und es nicht versteht sich den hergebrachten ständischen Normen und hierarchischen Strukturen zu unterwerfen, für den ist auch am baierischen Hof kein Platz. Da kommt Kurfürst Max III. Joseph die Argumentation, dass er jeden ausgegebenen Gulden seinen Untertanen vom Mund absparen muss, nur gelegen.
4. 10 1777 - Weinwirt Franz Joseph Albert will Mozart an München binden
München-Kreuzviertel * Im Weingasthof Zum schwarzen Adler kommen unter Wolfgang Amadeus Mozarts Leitung mehrere Werke zur Aufführung. Mit einem vorgetragenen Violinsolo beeindruckt Mozart ganz besonders: „Da schaute alles groß drein, ich spielte, als wenn ich der größte Geiger in ganz Europa wäre.“ Mozart und Albert sind zufrieden.
Der Musik liebende Weinwirt Franz Joseph Albert hat schon lange erkannt, welcher Gewinn Mozart für München wäre und entwickelt ein interessantes Projekt, das er dem stellenlosen Musiker unterbreitet:
- Er solle in München bleiben und von guten Freunden monatlich mit 50 Gulden unterstützt werden.
- Wenn er für Kompositionen vom Hofintendanten Graf Joseph Anton von von Seeau nur 200 Gulden bekäme, so wären das 800 Gulden im Jahr.
Wolfgang Amadé ist begeistert, nur sein Vater nicht einverstanden, da er seinen Sohn in einer gesicherten Stellung wissen will.
11. 10 1777 - Mozart reist weiter nach Augsburg und Mannheim
München - Augsburg - Mannheim * Wolfgang Amadeus Mozart reist mit seiner Mutter weiter nach Augsburg und Mannheim.
30. 12 1777 - Kurfürst Max III. Joseph stirbt
München * Kurfürst Max III. Joseph stirbt in München. Sein Nachfolger wird der aus der pfälzisch-wittelsbachischen Linie stammende Carl Theodor. Als Regierungssitz des neuen pfalz-baierischen Kurfürsten ist in einem Hausvertrag München festgelegt worden.
30. 12 1777 - Die Hofmark Berg am Laim fällt an den baierischen Staat
Berg am Laim * Mit dem Ableben des kinderlosen baierischen Kurfürsten Max III. Joseph fällt die Hofmark Berg am Laim an den baierischen Staat.
30. 12 1777 - Montgelas wartet zehn Jahre vergeblich auf eine feste Besoldung
München * Da Kurfürst Max III. Joseph stirbt, muss Freiherr von Montgelas unter dem neuen Landesherrn Carl Theodor zehn Jahre vergeblich auf eine feste Besoldung warten.
1778 - Nur mehr ein geringer Weinumsatz
München-Graggenau * Der „städtische Weinmarkt“ schlägt gerade noch 268 Eimer Wein um. Das sind knapp 17.000 Liter.
Vorbei sind die Zeiten, als nahezu tagtäglich Flöße mit bis zu 2.000 Litern Wein an Bord die Isar heruntergeschwommen waren.
Ab 1778 - Die Fassade des „Alten Rathauses“ wird erneut umgestaltet und bemalt
München-Graggenau * Die Fassade des „Alten Rathauses“ wird erneut umgestaltet und bemalt.
1778 - Peter von Osterwald stirbt
Haidhausen * Peter von Osterwald stirbt und hinterlässt seinen gesamten Besitz am Gasteig seiner Frau Regina.
1778 - Benjamin Thompson wird „Unterstaatssekretär für die amerikanischen Kolonien“.
London * Benjamin Thompson erhält in London das Amt eines „Unterstaatssekretärs für die amerikanischen Kolonien“.
1778 - Kurfürst Carl Theodor regiert Pfalz-Baiern von München aus
München * Nach dem Tod des bairischen Kurfürsten Max III. Joseph regiert der pfälzische Kurfürst Carl Theodor Pfalz-Baiern von München aus.
13. 5 1778 - Der Bürgersaal wird zur Kirche
München-Kreuzviertel * Der Bürgersaal wird vom Freisinger Bischof Ludwig Joseph von Welden als Kirche konsekriert.
28. 8 1778 - Franz Carl von Hompesch wird Hofmarkherr
Berg am Laim * Die Hofmark Berg am Laim geht in das Eigentum von Franz Carl von Hompesch über. Hompesch ist im Gefolge des pfälzischen Kurfürsten Carl Theodor nach München gekommen und war zuvor Kanzler in Düsseldorf, der Hauptstadt der jetzt nach Baiern gehördenden Herzogtümer Cleve und Berg. In München wird er wegen seiner Verdienste zum Staats- und Konferenzminister der Finanzen ernannt.
9. 10 1778 - Das neue Kurfürstenpaar aus der Pfalz zieht in München ein
München * Das Kurfürstenpaar Carl Theodor und Elisabeth Auguste ziehen feierlich in ihre neue Residenzstadt München ein.
31. 10 1778 - Wieder kommt ein Trupp Hundefänger in die Stadt
München * Wieder kommt ein Trupp Hundefänger in die Stadt.
Ende 12 1778 - Wieder keine Anstellung für Wolfgang Amadeus Mozart
München * Wolfgang Amadeus Mozart kehrt von Paris nach München zurück, wo Kurfürst Carl Theodor inzwischen die Erbfolge in der baierischen Hauptstadt angetreten hat.
Doch auch Carl Theodor engagiert den Musiker und Komponisten nicht.
Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich wieder in den Dienst des verhassten „Fürstbischofs“ Hieronymus Colloredo zu begeben.
1779 - Im Münchner und Auer „Bäckerstreit“ wird ein Vergleich geschlossen
München - Au * Im Münchner und Auer „Bäckerstreit“ wird ein Vergleich geschlossen.
Seither dürfen die Auer jeden Mittwoch und Samstag ihr „Schwarzbrot“ am „Rindermarkt“ verkaufen.
1779 - Katharina Pruckmayr heiratet den Brauer Johann Messner
München-Angerviertel - Au * Lukas Pruckmayrs Witwe Katharina heiratet den aus Rottach am Tegernsee stammenden Brauer Johann Messner.
Dieser kauft zum "Singlspielerbräu" noch den „Märzenkeller vor dem Isarthor an der Ramersdorfer Straße“ dazu.
1779 - Thompson wird „Mitglied der Britischen Akademie der Wissenschaften“
London * Benjamin Thompson wird „Mitglied der Königlichen Britischen Akademie der Wissenschaften“.
1779 - Eine kleine jüdische Gemeinde
München * Die jüdische Gemeinde in München besteht aus 15 Haushalten.
1779 - Benjamin Thompson wird Mitglied der „Royal Society“
London * Benjamin Thompson wird Mitglied der „Royal Society“, der 1660 gegründeten Gelehrtengesellschaft Englands.
Seinen Namen darf er jetzt mit dem Kürzel „FRS“ [„Fellow of the Royal Society“] zieren.
Ende 1779 - Benjamin Thompson stattet „britische Streitkräfte in den Kolonien“ aus
London * Benjamin Thompson wird zum „Bevollmächtigten für die Ausstattung der britischen Streitkräfte in den Kolonien“.
Er kauft die Uniformen oder den Stoff, aus dem sie hergestellt werden, in London und verkauft sie der Armee in den Kolonien zum besten Preis, den er erzielen kann.
Bei diesem höchst spekulativen Geschäft verdient Thompson sehr viel Geld.
1779 - Baron Carl von Aretin kauft ein Grundstück in der „Schwabinger Hayd“
Schwabing * Baron Carl Albert von Aretin kauft vom „Kurfürstlichen Hofkuchelschreiber und Triftverwalter“ Josef Seemüller ein Grundstück in der „Schwabinger Hayd“, auf dem später „Schloss Biederstein“ entstehen wird.
5. 7 1779 - Ernestine Rupertina Walburga von Arco wird geboren
Oberköllnbach * Ernestine Rupertina Walburga Gräfin von Arco, die spätere Ehefrau von Maximilian Joseph Freiherr wird von Montgelas, wird in Oberköllnbach geboren.
Ihr Vater, Ignatz Graf von Arco, ist der Sprecher der Baierischen Landschaft, mit dem Montgelas bereits vor seinem Weggang von München zusammengearbeitet hat. Ihre Mutter, Antonia Rupertina Gräfin von Trauner, ist eine Nichte seiner Mutter, Maria Ursula Gräfin von Trauner. Sie ist die Schwester von Carl Graf von Arco, dem Hof- und Generalkommissär in Tirol sowie Ludwig Graf von Arco, der die Witwe Carl Theodors, Maria Leopoldine von Österreich-Este heiraten wird.
1780 - Der „Hofgarten“ wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
München-Graggenau * Kurfürst Carl Theodor lässt den „Hofgarten“ der Öffentlichkeit zugänglich machen.
1780 - Montgelas wird Mitglied des „Bücherzensurkollegiums“
München * Maximilian Joseph von Montgelas wird, im Alter von 21 Jahren, Mitglied des „Bücherzensurkollegiums“.
Der Freiherr führt seine Tätigkeit als „Zensor“ eher kontraproduktiv im Sinne seines Auftraggebers aus.
So lässt er „Aufgeklärtes“ passieren, hält aber diesem Entgegengesetztes auf.
Das macht er beispielsweise mit Gebetsbüchern mit „übertriebenen Verehrungen der Heiligen, gar zu sinnlichen Andächteleien, in ungeheurer Menge versprochenen Ablässen“.
Außerdem sind die Angehörigen der „Zensurbehörde“ Mitglieder oder zumindest Sympathisanten des Geheimbundes der „Illuminaten“.
1780 - Genehmigung zum Bau eines „Kaffeehauses“ an der „Hofgartenmauer“
München-Graggenau * Giovanni Pietro Sarti erhält die kurfürstliche Genehmigung zum Bau eines „Kaffeehauses“ an der „Hofgartenmauer vor der Reitschule“.
26. 2 1780 - Die Paulaner-Patres dürfen ihr Bier öffentlich verkaufen
Au * Kurfürst Carl Theodor erteilt den Paulaner-Patres die „allgemeine Ausschankgenehmigung“ und sanktioniert damit den öffentlichen Verkauf ihres Bieres in der Au.
9 1780 - Thompson wird „Unterstaatssekretär für die britischen Kolonien“
London * Benjamin Thompson wird zum „Unterstaatssekretär für die britischen Kolonien“ ernannt.
5. 11 1780 - Wolfgang Amadeus Mozart reist von Salzburg nach München
Salzburg - München * Wolfgang Amadeus Mozart reist von Salzburg nach München. Er hat die begonnene Partitur von „Idomeneo“ in der Tasche.
6. 11 1780 - Wolfgang Amadeus Mozart arbeitet an seiner Oper „Idomeneo“
München-Graggenau * Wolfgang Amadeus Mozart trifft in München ein. In einem Hotel an der Burgstraße, dem späteren Gasthaus zum Mozart, steigt er ab, um im Eckzimmer des zweiten Stockwerks an der Vollendung seiner Oper „Idomeneo“ zu arbeiten.
Er bleibt bis zum 12. März 1781. Die Oper kommt am 29. Januar 1781 - unter der Stabführung von Mozart selbst - im neuen Opernhaus von François Cuvilliés zur Uraufführung.
29. 11 1780 - Kaiserin Maria Theresia stirbt in Wien
Wien * Kaiserin Maria Theresia stirbt in Wien. Ihr Sohn, Kaiser Joseph II., übernimmt jetzt die Titel der Könige von Böhmen, Kroatien und Ungarn.
27. 12 1780 - Mozart probt Idomeneo im Schwarzen Saal der Residenz
München-Graggenau * Kurfürst Carl Theodor besucht die Proben von „Idomeneo“ im Schwarzen Saal der Residenz. Dabei macht er über Wolfgang Amadeus Mozart den berühmten Ausspruch: „Man sollte nicht meinen, dass in einem so kleinen Kopf so was Großes stecke.“
1781 - Von 986 „Handwerksgerechtigkeiten“ ruhen insgesamt 66
München * Von 986 „Handwerksgerechtigkeiten“ ruhen insgesamt 66 - oder 6,7 Prozent.
Damit sind „Handwerksgesellen“ oder „auswärtige Handwerker“, die sich in München niederlassen wollten, gezwungen, sich unter „Hofschutz“ zu stellen, als „Pfuscher“ zu arbeiten oder sich in den Vororten niederzulassen, in denen kein „Zunftzwang“ besteht.
1781 - 4.243 Militärpersonen sind in München stationiert
München * Die Zahl der in München stationierten Militärpersonen beträgt 4.243.
Die Mannschaften sind in Kasernen unergebracht.
1781 - Kurfürst Carl Theodor lässt „vaterländische“ Stücke verbieten
München * Der pfalz-baierische Kurfürst Carl Theodor lässt einige „vaterländische“ Stücke aus politischen Gründen verbieten.
Ein Verbot folgt dem anderen. Dabei spielen die „Vorstadttheater“ gerade diese „Volksstücke“ mit Vorliebe.
Die Gründe für diese restriktiven Maßnahmen der Regierung liegen zum einen in der „Unsittlichkeit“ der Stücke, zum anderen im Bestreben der Obrigkeit, angebliche „öffentliche Unruheherde“ zu unterbinden.
1781 - Die „Gemäldegalerien“ werden für das Volk frei zugänglich
München-Graggenau - München-Maxvorstadt * Die „Gemäldegalerien“ in den nördlichen „Hofgartenarkaden“ werden für das Volk frei zugänglich.
Sie werden zu einem Anziehungspunkt und Ausflugsort für die mondäne Münchner Bevölkerung und der städtischen Eleganz.
In den Arkaden hat Kurfürst Carl Theodor Anschläge anbringen lassen, wonach es verboten ist, im „Hofgarten“ zum Grüßen den Hut zu ziehen.
Sommer 1781 - Thompson legt seinen Posten als „Unterstaatssekretär“ nieder
London * Benjamin Thompson legt seinen Posten als „Unterstaatssekretär für die britischen Kolonien“ überraschend nieder.
1781 - Der Beginn von gesellschaftspolitischen und sozialen Umwälzungen
Königsberg * Immanuel Kant veröffentlicht seine „Kritik der reinen Vernunft“.
Doch auch wenn Immanuel Kant in seinen Aufsätzen schreibt: „Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“, so bleiben solche Gedankengänge in Europa noch lange Zeit pure Theorie.
Doch auch hier ändert die „Aufklärung“ sowie der Fortschritt der Naturwissenschaften und der Technik - langsam - das Weltbild.
Die Welt wird plötzlich erklärbar.
Für viele Phänomene, die man zuvor dem direkten Eingreifen Gottes zugeschrieben hat, findet man jetzt logische Erklärungen.
So macht beispielsweise die Erfindung des „Blitzableiters“ den bislang üblichen „Wettersegen“ überflüssig. Damit waren die Zeiten, in denen der Blitz als Zeichen oder gar als „Strafe Gottes“ galten, endgültig vorbei.
Schriftsteller der „Aufklärung“, darunter Lorenz Westenrieder, versuchen die neuen Denkanstöße in zahlreichen Artikeln zu verbreitern. Sie benutzen dazu die in dieser Zeit neu entstandenen Zeitschriften und Journale, aber auch Flugschriften.
Westenrieders Schriften widersprechen oft der Lehrmeinung der katholischen Kirche und werden deshalb verboten.
Und selbst wenn die verbreiteten Denkansätze zum Teil die Unterstützung des Kurfürsten finden, so sollen die Inhalte - schon aus reinen Machterhaltungsbestrebungen heraus - kanalisiert werden.
Die Gedanken der „Aufklärung“ zu Ende gedacht bedeuten diese aber auch, dass sich die Menschen früher oder später nicht mehr in ihre Untertanenrolle fügen, sondern die Teilnahme am politischen System einfordern werden.
Das ist der Beginn von gesellschaftspolitischen und sozialen Umwälzungen.
1781 - Das „Kaffeehaus“ an der „Hofgartenmauer“ ist fertiggestellt.
München-Graggenau * Das „Kaffeehaus“ an der „Hofgartenmauer vor der Reitschule“ des Giovanni Pietro Sarti ist fertiggestellt.
1781 - Bald mehr Kaffee- als Bierschenken ?
München * In einer Münchner Zeitung ist zu lesen, dass es mit dem „verwünschten Kaffeeplempern und mit dem täglich anwachsenden Bohnenröstergewerbe“ noch so weit kommen wird, dass die „großen Städte bald mehr Kaffee- als Bierschenken“ zählen werden.
1781 - Anna Maria Schweglin stirbt im Gefängnis
Kempten * Die „Hausmagd“ Anna Maria Schweglin aus Kempten, die 1775 zum „Tode mit dem Schwert“ wegen „Schadenszauber und Teufelsbuhlschaft“ verurteilt wurde, stirbt im Gefängnis.
Sie gilt als die letzte hingerichtete bayerische „Hexe“.
Ihr Tod im Gefängnis wird erst 1995 entdeckt.
29. 1 1781 - Uraufführung der Mozart-Oper „Idomeneo“
München-Graggenau * Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Idomeneo“ kommt im Cuvilliès-Theater unter der Leitung des Komponisten zur Uraufführung. Sie wird zwei Mal wiederholt.
2 1781 - Benjamin Thompson lässt sich zum „Oberstleutnant“ ernennen
London * Benjamin Thompson lässt sich gegen Bezahlung von 4.500 Pfund zum „Oberstleutnant“ des von ihm noch zu rekrutierenden „Königlichen Amerikanischen Dragoner-Regiments“ ernennen.
12. 3 1781 - Wolfgang Amadeus Mozart verlässt München in Richtung Wien
München - Salzburg - Wien * Wolfgang Amadeus Mozart verlässt München wieder. Ein Befehl seines Dienstherren, des Fürstbischofs von Salzburg, Hieronymus Graf von Colloredo, zitiert ihn nach Wien.
7. 10 1781 - Benjamin Thompson reist nach New York
New York - Südkarolina * Benjamin Thompson reist mit dem Schiff nach New York. Widrige Winde bringen ihn aber nach Südkarolina, wo er erst am 29. Dezember ankommt.
13. 10 1781 - Katholisches Glaubensmonopol in Österreich aufgehoben
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Kaiser Joseph II. hebt in Österreich mit einem <em>„Toleranzpatent“</em> das Glaubensmonopol der katholischen Kirche auf. </p> <p> </p>
28. 11 1781 - Kurfürst Carl Theodor gründet eine Seidenbau-Direktion
München * Kurfürst Carl Theodor gründet eine Seidenbau-Direktion. Trotzdem geht Geld auf verschlungenen Wegen verloren. So haben es sich die privaten Seidenzüchter angewöhnt, ihren Bedarf an Maulbeerbäumen heimlich von den kurfürstlichen Pflanzungen zu holen.
Der Mitarbeiterstab der Seidenbau-Direktion wächst immer weiter an und belastet dadurch den Jahresetat entsprechend. Besonders die ungezügelten Gehaltsforderungen der Seidenbaudirektions-Vorstände fressen einen erheblichen Teil der Einkünfte auf.
1782 - Das Bier hat den Wein als Volksgetränk verdrängt
München * Lorenz von Westenrieder stellt fest:
„Allgemein nimmt der Bürger und Handwerker kein Frühstück.
Man setzt sich um 11 Uhr zur ersten und um 6 Uhr nachmittags zur zweiten Mahlzeit.
Rind-und Kalbfleisch, Bier und Brot sind das gewöhnlichste, was er genießt. Schweine-, Kalbs- und Gänsebraten sind seine besten Gerichte und Bier sein bester Trank.
Wein und Branntwein werden ordentlicherweise nicht getrunken, auch kein Toback geschmaucht“.
So ist seit Aventin in den unteren Schichten des Volkes der Wein völlig vom Bier verdrängt worden.
1782 - Ein „Dekret“ gegen die allzu zahlreichen Handwerker
München - Au - Haidhausen - Giesing * Kurfürst Carl Theodor erlässt ein „Dekret“ gegen die allzu zahlreichen Handwerker des Münchner „Ostends“, in dem es heißt:
„Sie nehmen den bürgerlichen Handwerksleuten die Nahrung weg und verfallen doch bald dem Bettel und dem Almosen“.
1782 - Beliebtes Freizeitvergnügen aller bürgerlichen Stände
<p><strong><em>München</em></strong> * In seinen <em>„Beschreibungen der Haupt- und Residenzstadt München“</em> bezeichnet Lorenz von Westenrieder das Buden- und Wandertheater als ein beliebtes Freizeitvergnügen aller bürgerlichen Stände. Besonders das einfache Volk findet Gefallen an den derben Späßen und Spektakelstücken.</p> <p>Der Schauspieldirektor des Dulttheaters, Lorenz Lorenzini, macht mit seiner Kreuzerkomödie - so genannt, weil der Eintritt nur einen Kreuzer kostet - Furore. Pathos und Rührung, Zoten und <em>„Hanswurstiaden“</em> beherrschen das Stück. </p>
1782 - Die „kurfürstlich privilegierte Tabakfabrique“ wird gegründet
München-Englischer Garten - Lehel * Die „kurfürstlich privilegierte Tabakfabrique“ wird gegründet.
Eine der zwei Zufahrtsstraßen führt über die „Hofwiese“ und wird im Jahr 1789 Teil des „Englischen Gartens“.
1782 - Philipp Apians „Baiernkarte“ wird als „wertloser Plunder“ verbrannt
München * Die aus dem Jahr 1563 stammende, rund sechs mal sechs Meter große „Baiernkarte“ des Philipp Apian wird als „wertloser Plunder“ verbrannt.
Zum Glück haben sich die 24 verkleinerten Holzschnitte der Karte erhalten, die als „Baierische Landtafeln“ bekannt sind.
1782 - Die letzte „Hexe“ im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“
Glarus * Im evangelischen Glarus in der Schweiz wird die „pflichttreue Dienstmagd“ Anna Göldi als letzte „Hexe“ auf dem Boden des „Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation“ hingerichtet.
1782 - Ein großer Verlust an Maulbeerbäumen
München * Als man für ganz München die Zahl der noch vorhandenen Maulbeerbäume ermittelt, muss man ernüchternd feststellen, dass nur noch 2.494 Bäume vorhanden sind. Dabei waren nur wenige Jahre zuvor alleine in Nymphenburg 4.000 Maulbeerbäume gestanden, weswegen der dortige Hasengarten in Maulbeergarten umbenannt worden war.
Als Ursache für den Baumverlust werden das ungewohnt kalte Klima, die übermäßige Entlaubung und mutwillige Beschädigungen genannt. Es wird aber auch die nachlässige Arbeit der Gärtner in den Plantagen gerügt.
1782 - Im Königreich Preußen wachsen drei Millionen Maulbeerbäume
Königreich Preußen * Im Königreich Preußen wachsen drei Millionen Maulbeerbäume.
12. 1 1782 - Kaiser Joseph II. säkularisiert 738 Klöster
Wien * Kaiser Joseph II. hebt in seinen Erblanden 738 Klöster auf. Alle Klöster, die sich nicht der Schulbildung oder Krankenpflege widmen, sind von diesem Erlass betroffen.
11. 4 1782 - Thompson rekrutiert sein Königliches Amerikanisches Dragoner-Regiment
<p><strong><em>New York</em></strong> * Benjamin Thompson trifft in New York ein und kümmert sich um die vollständige Rekrutierung seines Königlichen Amerikanischen Dragoner-Regiments.</p>
18. 5 1782 - Hunde dürfen nicht in den Hofgarten mitgenommen werden
München-Graggenau * Laut einer Verordnung dürfen Hunde nicht in den Hofgarten mitgenommen werden.
1. 8 1782 - Thompsons Amerikanisches Dragoner-Regiment ist kampfbereit
New York * Das von Benjamin Thompson rekrutierte Königliche Amerikanische Dragoner-Regiment ist kampfbereit.
17. 9 1782 - Carl von Fischer wird in Mannheim geboren
Mannheim * Der Architekt Carl von Fischer wird in Mannheim geboren.
27. 9 1782 - Amerikanisches Dragoner-Regiment greift in Kriegshandlungen ein
Amerika * Benjamin Thompsons Königliches Amerikanisches Dragoner-Regiment wird erstmals in Kriegshandlungen verwickelt.
23. 10 1782 - Die Hundefänger erschlagen 83 streunende Hunde
München * Die Hundefänger erschlagen 83 streunende Hunde in München.
30. 11 1782 - Großbritannien und die USA unterzeichnen einen Friedensvertrag
Großbritannien - USA * Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnen einen Friedensvertrag, der allerdings erst am 3. September 1783 rechtskräftig wird.
31. 12 1782 - In München soll es weit über fünfzig Kaffeehäuser geben
München * Laut Lorenz von Westenrieder gibt es in München „nebst den pfuschenden und heimlichen“ weit über fünfzig Kaffeehäuser.
Um 1783 - Lorenz Westenrieder lobt das „Hofkrankenhaus“ am heutigen Kolumbusplatz
Au * Lorenz Westenrieder lobt das „Hofkrankenhaus“ am heutigen Kolumbusplatz in seinen „Beschreibungen des kf. Gerichts Au“ in den schillerndsten Farben:
„Es hat für epidemische Kranheiten eine vortreffliche Lage an einem reinen Isarkanal, genießt der gesündesten Luft, und hat eine musterhafte Einrichtung.
Anfangs waren fünf Krankenzimmer, jedes mit sieben Betten vorhanden, wozu aber durch die Sorgfalt des itzigen Pflegers im Jahre 1782 von großmüthigen Gutthätern noch zwey schöne Zimmer mit 14 Betten errichtet wurden, welche zuverläßig unter die reinlichsten, und niedlichsten Krankenzimmer in ganz Deutschland zu rechnen sind“.
1783 - Der „Hundemarkt“ wird auf den „Viehmarkt“ an der Herrenstraße verlegt
München * Der „Hundemarkt“ wird von der „Schranne“ auf den „Viehmarkt“ an der Herrenstraße verlegt.
30. 4 1783 - Das Privilegium des Pfandhauses
<p><em><strong>München</strong></em> * Kurfürst Carl Theodor überträgt das <em>„Privilegium des Pfandhauses“</em> an die Heiliggeistspitalverwaltung.,Die jährlichen Einnahmen kommen der Hebammenschule zugute und dienen der <em>„Verpflegung hilfloser Kinder“</em> und <em>„verunglückter armer Weibspersonen“</em>. </p>
19. 8 1783 - Schlechtes Märzenbier wird in ihren Kellern ausgeschenkt
Au - Haidhausen * Der Schleibinger Bräu und andere namentlich nicht genannte Brauer werden beschuldigt, schlechtes Märzenbier in ihren Kellern auszuschenken.
Nach dem 3. 9 1783 - Benjamin Thompson muss Amerika verlassen
USA * Der königstreue Benjamin Thompson muss Amerika verlassen. Mit ihm emigrieren schätzungsweise weitere 80.000 Menschen.
3. 9 1783 - Amerikanischer Befreiungskrieg nach acht Jahren beendet
USA * Nachdem sich England mit Frankreich, Spanien und Holland geeinigt haben, wird der amerikanische Befreiungskrieg nach acht Jahren beendet und die Vereinigten Staaten von Amerika völkerrechtlich anerkannt.
17. 9 1783 - Benjamin Thompson trifft Prinz Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken
Dover - Straßburg - Wien * Mit dem Ende des Unabhängigkeitskrieges muss sich der 30-jährige Benjamin Thompson um eine neue Tätigkeit bemühen. Von Dover aus reist er mit Ziel Wien ab.
In Straßburg trifft er den wittelsbachischen Prinzen Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, Oberst im Regiment d'Alsace und Garnisonskommandant. Der junge General gibt Thompson ein Empfehlungsschreiben an seinen Onkel, den pfalzbaierischen Kurfürsten Carl Theodor mit.
1784 - Johann Perzl spottet über den Baierwein
München * Johann Perzl spottet über den Baierwein: „Es wächst zwar in Baiern selbst einiger Wein an den Gegenden der Donau, ober und unter Regensburg, bey Landshut und in der Gegend um Dingolfing.
Wenn er etwa an die zwanzig Jahre gelegen hat, dann soll er nicht ganz widerlich zu trinken seyn; sonst aber wird er gewöhnlich nur als Essig gebraucht“.
1784 - Sir Benjamin Thompson kommt nach Baiern
München * Sir Benjamin Thompson kommt in das Kurfürstentum Baiern und wird zunächst „Oberst“ eines Kavallerieregiments.
1784 - King George III. entlässt Sir Benjamin Thompsons in baierische Dienste
London - München * Der englische König George III. erteilt Sir Benjamin Thompsons Bitte zum Eintritt in baierische Dienste, eine Zusage.
Damit kann er „Leibadjutant“ von Kurfürst Carl Theodor und Mentor dessen außerehelichen Sohnes Graf Bretzenheim werden.
England verfolgt die Tauschpläne des baierischen Herrschers mit Argwohn.
Dieser will mit Baiern einen Teil seines Kurfürstentums gegen die „Österreichischen Niederlande“ eintauschen, um Herrscher des neuen „Königreichs Burgund“ zu werden.
Das Vorhaben hätte aus der zerstückelten Pfalz einen ansehnlichen Staat gemacht.
Während die Pläne in Österreich befürwortet werden, formiert sich in Baiern massiver Widerstand.
1784 - Das „Kaffeehaus“ an der „Hofgartenmauer“ wird aufgestockt
München-Graggenau * Giovanni Pietro Sarti darf sein „Kaffeehaus“ an der „Hofgartenmauer vor der Reitschule“ um ein Stockwerk erhöhen.
1784 - Baron von Aretin verkauft sein Grundstück an Kurfürst Carl Theodor
Schwabing * Nachdem Baron Carl Albert von Aretin eine Erbschaft macht, verkauft er sein Grundstück in der „Schwabinger Hayd“, auf dem später „Schloss Biederstein“ entstehen wird, an Kurfürst Carl Theodor.
9. 1 1784 - Die Wirte der Au beschweren sich über die Märzenkeller
Au * Die Wirte der Au beschweren sich über die auf dem Gasteigberg erbauten Märzenkeller. Die dortigen Bierbrauer bewirten im Sommer und Herbst ihre Gäste mit Bier, das mass- und halbmassweise ausgeschenkt wird. Außerdem gestatten sie das Musizieren und Tänzen und bieten Kugelplätze [= Billard] und Spieltische an. Die Oberlandesregierung soll im kurfürstlichen Auftrag diese Exzesse abstellen.
16. 1 1784 - Die Münchner Brauer beschweren sich über das Augustinerkloster
München - München-Kreuzviertel * Die Münchner Bierbrauer beschweren sich über die Brauerei des Augustinerklosters. Die Mönche haben wiederholt Bier innerhalb und außerhalb des Klosters ausgeschenkt und verkauft und dazu sogar eine Gaststube eingerichtet. Dem Kloster wird im Wiederholungsfalle eine Strafe von 100 Dukaten oder das Herausreißen der Braukessel angedroht.
19. 1 1784 - Der Stadtrat legt dazu eine Reihenfolge des Bierausschanks vor
München * Auswärtiges Bier darf erst dann eingeführt werden, wenn das Bier der Münchner Brauer verkauft ist. Der Stadtrat legt dazu eine Reihenfolge des Ausschanks vor.
- Im ersten Los darf nur das Bier aus den Kellern der Stadt ausgeschenkt werden.
- Im zweiten Los wird jedem Brauer freigestellt, ob er sein Bier in der Stadt oder am Gasteig ausschenkt. Die Stadtkeller müssen aber vor den Märzenkellern am Gasteig öffnen.
- Im dritten Los darf das Bier nur vor der Stadt ausgeschenkt werden.
- Der Brauer, der noch keinen Bierkeller hat, soll einen bauen oder mieten.
Außerdem sollen die Brauer über die einzusiedende Biermenge eine Übereinkunft treffen und diese dem Magistrat zur Genehmigung vorlegen.
28. 1 1784 - Ein tollwütiger Hund entkommt und verletzt dreizehn Personen
München * Ein tollwütiger Hund entkommt und verletzt dreizehn Personen. Daraufhin werden 250 Hunde erschossen. Laut einer Verordnung werden alle frei auf der Gasse herumlaufenden Hunde ohne Rücksicht erschossen. Das Verbot gilt zunächst bis 9. Februar.
2. 2 1784 - Münchner Erstaufführung von Friedrich Schillers „Die Räuber“
<p><strong><em>München-Hackenviertel</em></strong> * Im Faberbräu-Theater findet die Münchner Erstaufführung von Friedrich Schillers <em>„Die Räuber“</em> statt. </p>
26. 3 1784 - Metzger lassen ihre Hunde in den Fleischbänken das warme Blut trinken
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Stadtrat beauftragt den Wasenmeister Adam Kuisl mit einer heiklen Mission. Er soll den Unfug abstellen, dass die Metzger ihre Hunde in den Fleischbänken das warme Blut trinken lassen. </p>
31. 3 1784 - Der Stadtrat ermahnt die Bierbrauer und droht ihnen mit Strafen
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Stadtrat ermahnt die Bierbrauer und droht ihnen mit Geldstrafen und mit <em>„unliebsameren Strafen“</em>. Der Grund sind die Beschwerden der Auer Wirte. Die Brauer dürfen künftig nur noch in der Zeit, in der sie den <em>„ordentlichen Kranz“</em> besitzen, in ihren Märzenkellern Gäste mit Bier bewirten, Kugelplätze und Spieltische betreiben sowie durch Musikanten zum Tanzen aufspielen lassen. </p>
4 1784 - Zur Heilung wird die Stola des heiligen Hubertus aufgelegt
Geldern * Die dreizehn Münchner, die Ende Januar von dem tollwütigen Hund gebissen worden sind, werden nach „St. Hubert“ im österreichischen Geldern - „im Ardenner Wald“ - geschickt.
Dort wird ihnen zur Heilung die Stola des heiligen Hubertus aufgelegt oder ein Faden aus der Stola des Heiligen in die Kopfhaut einnäht.
Drei von ihnen sterben unterwegs.
22. 6 1784 - Kurfürst Carl Theodor verbietet die Illuminaten
München * Kurfürst Carl Theodor verbietet alle „Communitäten, Gesellschaften und Verbindungen“, die ohne seine landesherrliche Bestätigung gegründet worden sind. Damit wird auch der Geheimbund der Illuminaten verboten und seine Mitglieder mit der Verfolgung und Amtsenthebung bedroht.
So kommt auch Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas auf die Schwarze Liste. Auch wenn er nie persönlich verfolgt wird, so ist das Vertrauen Carl Theodors in Montgelas zerstört und damit seine Karriere am Hof des Kurfürsten am Ende. Seine Aussichten auf eine fest besoldete Stelle ist dadurch in weite Ferne gerückt.
23. 8 1784 - Österreich: Schließung der innerörtlichen Friedhöfe
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Kaiser Joseph II. verfügt aus Hygienegründen in Österreich die Schließung aller innerörtlichen Friedhöfe. </p>
9. 9 1784 - In der Klosterkasse der Paulaner fehlen 4.000 Gulden
Au * Bei der Überprüfung der Klosterkasse der Paulaner stellt man fest, dass die erwarteten 4.000 Gulden fehlen. Das Geld war in der Lotterie verspielt worden. Pater Maritius Lohr wird daraufhin von seinem Amt als Generalvikar entlassen.
5. 11 1784 - Pilgramsheim wird Adelssitz mit allen Rechten
Untergiesing * Kurfürst Carl Theodor erhebt - ohne allerdings die zuständigen Stellen einzubinden - das Anwesen des Franz Anton von Pilgram unter dem Namen Pilgramsheim zum Adelssitz mit allen Rechten.
Das bringt nun aber die Baronin von Kern auf die Palme, da die Rechte, insbesondere die Jurisdiktion über den ganzen Pilgramsheim-Sitz ja der Hofmark Falkenau untersteht. Die Baronin erhebt Einspruch und der Hofbankier Pilgram erhält den allerhöchsten Befehl, sich mit derselben zu vergleichen. Die Einigung kommt aber erst zustande, nachdem die Baronin von Kern ihren Besitz an die Gräfin von Toerring-Seefeld verkauft hat.
16. 11 1784 - Die Missstände im Paulanerkloster sollen beendet werden
Au * Kurfürst Carl Theodor erlässt eine Verfügung, die mit den Missständen im Paulanerkloster aufräumen soll.
1785 - Planungen, die Au als „Carlsvorstadt“ nach München einzugemeinden
München - Au * Um die Auer der polizeilichen und wirtschaftlichen Kontrolle der Stadt zu unterwerfen entsteht der Plan die Au als „Carlsvorstadt“ nach München einzugemeinden.
1785 - Sir Benjamin Thompson wird „kurpfalz-baierischer Kammerherr“
München * Sir Benjamin Thompson wird zum „Kammerherrn“ am „baierisch-pfälzisch kurfürstlichen Hof“ in München ernannt.
1785 - Kurfürst Carl Theodor lässt den „Rittersitz Biederstein“ erbauen
Schwabing * Kurfürst Carl Theodor lässt für seinen „Kabinettssekretär“ und - vermutlich - illegitimen Sohn Stephan Freiherr von Stengel den „Rittersitz Biederstein“ erbauen.
1785 - Erneut aufkommende Ländertauschpläne werden beendet
München - Wien - Berlin * Erneute Ländertauschpläne zwischen Österreich und Kurfürst Carl Theodor werden auf Initiative Preußens und dem „Fürstenbund“ durch die „Garantie der Eigenstaatlichkeit und Unversehrtheit Baierns“ beendet.
1785 - Carl Theodors Geschenke für eine ehemalige Mätresse
Mattsies - Kufstein * Kurfürst Carl Theodor schenkt seiner ehemaligen Mätresse Maria Josepha von Toerring-Seefeld, eine geborene Minucci, - fünf Jahre nach ihrer Eheschließung - das „Schlossgut und Bräuhaus Mattsies“ bei Mindelheim.
Im darauffolgenden Jahr erhält sie dann noch die „Pflege Auerburg“ bei Kufstein.
1785 - Ignaz Mayer heiratet Chaila Seligmann
München * Ignaz Mayer heiratet Chaila oder Caroline Seligmann.
Ihr Vater ist der im Jahr 1814 erste in den „Adelsstand“ erhobene Jude in Baiern, der dann Leonhard Freiherr von Eichthal heißt.
Ursprünglich hieß er Aron Elias Seligmann, war der „Tabak- und Salzhändler“, zugleich der bedeutendste „Hof- und Heereslieferant“ und außerdem „Hauptgläubiger“ der immer finanzschwachen Kurpfalz.
In den „Napoleonischen Kriegen“ avanciert er zum einzigen Heereslieferanten der baierischen Truppen, der die enormen Kosten für das Militär mit eigenen Anleihen finanziert und dafür ansehnliche Provisionen erhält.
1785 - Baiern erhält eine „Nuntiatur“
Rom-Vatikan - München * Der „Heilige Stuhl“ richtet im „Kurfürstentum Baiern“ eine „Nuntiatur“ ein.
Sie bleibt die Einzige auf deutschem Gebiet, bis ihr im Jahr 1920 in der „Reichshauptstadt Berlin“ eine zweite „päpstliche Gesandtschaft“ folgt.
1785 - Das „Hirschgehege“ in der „Hirschau“ wird aufgelassen
München-Englischer Garten - Hirschau * Nachdem die „Fasanenzucht“ in der „Hirschau“ schon bald aufgelöst wurde, wird jetzt auch das „Hirschgehege“ aufgelassen.
An seiner Stelle wird der „Hirschgarten“ bei Nymphenburg eröffnet.
1785 - Montgelas wird „Mitglied der baierischen Akademie der Wissenschaften“
München * Maximilian Joseph von Montgelas wird „Mitglied der baierischen Akademie der Wissenschaften“.
Anno 1785 - Den Auern, „Lechlern“ und Haidhausern wird das Fischen verboten
Au - Haidhausen - Lehel * Ein kurfürstliches Mandat verbietet den Auern, „Lechlern“ und Haidhausern das Fischen in der Isar.
Erstmals werden auch die Bewohner des „Lehels“ mit diesem Namen bezeichnet.
Nun ist das „Lehel“ ein echter Ort geworden, genauso wie die Au und Haidhausen.
18. 6 1785 - Die Mitgliedschaft bei den Illuminaten ist unvereinbar mit dem Glauben
Rom-Vatikan - Freising * Papst Pius VI. erklärt erstmals in einem Brief an den Bischof von Freising, dass die Mitgliedschaft bei den Illuminaten unvereinbar mit dem katholischen Glauben ist. Diese Auffassung unterstreicht er in einem weiteren Brief vom 12. November 1785 an den selben Empfänger.
30. 9 1785 - Herzog Max Joseph heiratet Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt
Darmstadt * Herzog Max Joseph, der spätere baierische König, heiratet Auguste Wilhelmine Maria von Hessen-Darmstadt in Darmstadt.
14. 12 1785 - Die 16-jährige Fanny von Ickstatt stürzt vom Turm der Frauenkirche
München-Kreuzviertel * Die 16-jährige Fanny von Ickstatt, Tochter eines Ingolstädter Professors, stürzt vom nördlichen Turm der Frauenkirche in die Tiefe. Ihr Körper wird auf das Dach des Dechanthofes geschleudert.
Der Stadtklatsch macht aus dem tragischen Unglücksfall eine unerfüllte Liebesgeschichte. Weil Fanny von Ickstatt den Ingolstädter Leutnant Franz von Vincenti nicht lieben darf, stürzt sie sich in den Tod, um damit einem Leben im Kloster zu entgehen. Fanny von Ickstatt wird auf dem Salvatorfriedhof beigesetzt.
17. 12 1785 - Kurfürst Carl Theodor beschenkt Stephan von Stengel
Schwabing * Kurfürst Carl Theodor überlässt den „gefreiten Sitz zu Manns- und Weibsritterlehen“ seinem Geheimen Kabinettssekretär Stephan von Stengel. Stengel erweitert seinen Besitz durch Zukäufe und nennt seinen Rittersitz mit Niedergerichtsbarkeit künftig Schloss Biederstein.
1786 - Peter Paul Maffei wird als Bürger in München aufgenommen
München * Der aus Trient stammende „Glockengießersohn“ Peter Paul Maffei wird als Bürger und Handelsmann in München aufgenommen.
Der Neubürger heiratet Walburga Mayer, die 5.400 Gulden als Aussteuer in die Ehe mitbringt.
Er selbst hat 2.000 Gulden und den ausgeprägten Willen, dieses Vermögen zu vermehren.
Als Tabakfabrikant in der Bruderstraße im Lehel, mit der er jährlich 25.000 Gulden Gewinn erwirtschaftet, und mit seinen Einkünften als Großhändler bringt es Maffei zu einem ansehnlichen Vermögen.
1786 - Calvinistischen Seide-Fachkräfte in Baiern unerwünscht
Königreich Preußen * Im Königreich Preußen werden 14.000 Pfund Seide gewonnen.
Kurfürst Carl Theodor will da nicht Abseits stehen, doch ist für Baiern die Aufnahme von nicht-katholischen Personen, noch dazu Calvinisten, einfach unvorstellbar und kommt nicht in Frage. Auch dann nicht, wenn die Fachleute im eigenen Land fehlen.
2 1786 - Franz Anton von Pilgram erhält die „Jurisdiktion“ für seine Besitzungen
Au - Untergiesing * Franz Anton von Pilgram erhält das Obereigentum und die „Jurisdiktion“ für seine Besitzungen.
Er muss dafür aber der Gräfin Toerring-Seefeld ein jährliches „Aversum“ bezahlen. Und weil das der Gräfin noch nicht reicht, verlangt diese nun vom Kurfürsten die „Jurisdiktion“ über weitere 24 bis 26 Häuser in der „Falkenau“, in denen 68 Familien leben und zum „Gericht ob der Au“ gehören.
Außerdem verlangt sie die Erhebung der „Falkenau“ zur „wirklichen und geschlossenen Hofmark“. Sie begründet die Forderungen damit, dass der Kurfürst nicht über das Recht verfüge, im „Bezirk der Falkenau“ eine neue „Conzession“ zu erteilen und damit der „Hofmark“ Schaden zugefügt hat.
Maria Josepha von Toerring-Seefeld ist eine geborene Minucci und ehemalige Mätresse des Kurfürsten.
25. 8 1786 - Ludwig I., der spätere bayerische König, wird in Straßburg geboren
Straßburg * Ludwig I., der spätere bayerische König, wird in Straßburg geboren.
30. 10 1786 - Jakob Keysser wird zum Henker ernannt
Würzburg * Jakob Keysser wird nach seinem Vater in Würzburg zum Henker ernannt. Er stammt aus der Familie des späteren Bayerischen Scharfrichters Johann Reichhart.
1787 - Die Auer wünschen die Eingemeindung nach München
Au - München * Die Auer wünschen die Eingemeindung nach München.
1787 - Kommerzienrat Fleischmann lässt eine Tabakfabrik anlegen
Au * Die Mühle und das mit kostbarer Malerei geschmückte Schloss, die Hammerschmiede und kleine bewohnte Gebäude, Gärten und Weiher gehen an den „churfürstlichen Kommerzienrath“ Fleischmann und dessen Frau Maria Anna über.
Mittlerweile ist das Gut ziemlich heruntergekommen und „Kommerzienrat“ Fleischmann versucht, das Gebäude wieder in einen besseren Zustand zu versetzen.
Fleischmann stockt die niedrigen Häuschen auf und setzt eine Tabakspflanzung an.
In der neuartigen und ersten „Rauchtobacks-Fabricke in Baiern“ - dieses Privileg hat ihm Kurfürst Carl Theodor übertragen - wird dadurch Arbeit und Broterwerb für viele Männer, Frauen und Kinder geschaffen.
Sie finden hier ein karges Einkommen.
1787 - Sir Benjamin Thompson wird zum „Geheimen Rat“ ernannt
München * Kurfürst Carl Theodor ernennt Sir Benjamin Thompson zum „Geheimen Rat“.
1787 - Montgelas tritt in den Dienst Herzog Carl II. August von Pfalz-Zweibrücken
München * Als Folge der „Illuminatenaffäre“, in deren Verlauf die Mitglieder dem Vorwurf „landesverräterischer und religionsfeindlicher Bestrebungen“ ausgesetzt sind, verlässt Maximilian Joseph von Montgelas das Kurfürstentum Baiern und tritt in den Dienst Herzog Carl II. August von Pfalz-Zweibrücken.
Dieser wird, je länger die Kinderlosigkeit des pfalz-baierischen Kurfürstenpaares andauert, als voraussichtlicher Erbe von Pfalzbaiern, der drittgrößten Ländermasse des Reiches, gehandelt, und von den fünf Großmächten umworben.
Kurfürst Carl Theodor hat sich aufgrund seiner Pläne, Kurbaiern gegen die österreichischen Niederlande einzutauschen, bei der baierischen Bevölkerung äußerst unbeliebt gemacht.
Und selbstredend liegt das Interesse der zweibrückischen Herzöge an der Verhinderung des Tauschprojekts. Und da kommt ihnen Freiherr Montgelas gerade recht.
Von Zweibrücken aus hält er die geheimen Verbindungen zu den baierischen Oppositionskreisen aufrecht. Dadurch kann - in Verbindung mit dem preußischen König Friedrich II. und der antiösterreichischen „Patriotenpartei“ am Münchner Hof - die Existenz Kurbaierns unangetastet erhalten werden.
Eine der wichtigsten Vorkämpferinnen ist die Witwe des Herzogs Clemens Franz de Paula, des Cousins des letzten baierischen Kurfürsten Max III. Joseph: Herzogin Maria Anna.
12. 3 1787 - Gräfin Maria Josepha von Toerring-Seefeld überspannt den Bogen
Untergiesing * Der Gräfin Maria Josepha von Toerring-Seefeld werden alle Forderungen gebilligt. Voraussetzung ist allerdings die Erfüllung von zwei Auflagen.
- Zum einen muss die Gräfin die dem Landrichter und dem Amtsknecht entgangenen Einnahmen in Höhe von 175 Gulden im Jahr ersetzen,
- zum anderen die Inleute der Falkenau gegen den herkömmlichen Lohn zur kurfürstlichen Jagdlust sowie zur Räumung der kurfürstlichen Fischweiher gebrauchen lassen.
Dagegen wehrt sich die Gräfin und verlangt nun ihrerseits die Überlassung des Paulanerstocks in der Au. Damit jedoch verärgert die Gräfin Maria Josepha von Toerring-Seefeld den Kurfürsten und die den Vorgang bearbeitende Administration massiv.
Sie kann nichts mehr erreichen und versucht nun, die Hofmark Falkenau an den Landesherren zu veräußern. Dafür verlangt sie 45.000 Gulden und begründet den Preis mit dem Argument, dass das Anwesen durch die Jurisdiktion so wertvoll geworden sei. Sie vergisst geflissentlich zu erwähnen, dass sie selbst genau diesen Preis bei ihrem Kauf bezahlen musste.
Am kurfürstlichen Hof empfindet man diese Preisvorstellungen als ungehörig hoch - und geht deshalb gar nicht darauf ein. Statt dessen wird ein Untersuchungsverfahrens eingeleitet, ob bei der Verleihung der Hofmarksrechte denn wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen war.
31. 3 1787 - Das alte Berg am Laimer Hofmarkschloss wird abgerissen
<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Die Abbruchsgenehmigung für das alte Berg am Laimer Hofmarkschloss wird erteilt und die Gebäude bald darauf zerstört.</p>
11. 8 1787 - Simon Aron Seligmann wird in Leimen geboren
Leimen * Simon Aron Seligmann, der spätere Baron Simon von Eichthal, Kgl. Bay. Hofbankier und Mitbegründer der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank wird in Leimen geboren.
16. 8 1787 - Todesstrafe für die Rekrutierung von Mitgliedern für Illuminaten
München * Kurfürst Carl Theodor führt für die Rekrutierung von Mitgliedern für Freimaurer und Illuminaten die Todesstrafe ein.
1788 - Die Brüder von Schneeweiß erben das Osterwald-Anwesen
Haidhausen * Nach Regina von Osterwalds Tod geht ihr Besitz am Gasteig an ihre beiden Neffen Peter Paul von Schneeweiß, „Hofrat“ und „Pflegsverweser von Hohenschwangau“, und Franz Joseph von Schneeweiß, der dem „Inneren Rat“ der Stadt München angehört, über.
Von den Brüdern erhält das Gebäude den Namen „Schneeweißschlösschen“ oder „Schneeweißenburg“. Man nennt es auch nach dem in der Nähe befindlichen „Gasthaus zum Schwane“ die „Schwanenburg“.
1788 - Piaggino will ein „Arbeitshaus für beschäftigungslose Menschen“ errichten
München - Au * Auf Initiative des „Hofkammerrats“ Piaggino soll in München ein „Arbeitshaus für beschäftigungslose arme Menschen“ errichtet werden.
Doch staatliche und städtische Stellen wollen kein Geld für dieses Projekt bereitstellen.
Stattdessen wird Piaggiono aufgefordert, selbst einen Vorschuss in Höhe von 8.000 Gulden zu leisten.
Als Gegenleistung soll er die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über alle Gewinne der Anstalt haben. - Und natürlich auch für alle Verluste haften.
1788 - Kaffee als Ursache für viele körperliche Erschlappungen und Gebrechen
München * Nach Meinung des Lorenz von Westenrieder ist „der allgemeine Gebrauch des Kaffees unstreitig die Ursache für so viele körperliche Erschlappungen, Gebrechen und Schwachheiten, auch für die Hämorrhoiden“.
1788 - München-Premiere von Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“
<p><strong><em>München-Hackenviertel</em></strong> * Im Faberbräu-Theater findet die Münchner Erstaufführung von München-Premiere von Friedrich Schillers <em>„Kabale und Liebe“</em> statt. </p>
2. 1 1788 - Der Knigge-Ratgeber erscheint
<p><em><strong>Hannover</strong></em> * Der Ratgeber <em>„Über den Umgang mit Menschen"</em> von Adolph Freiherr von Knigge erscheint. Der Verleger ist Philipp Reclam (der Ältere). </p> <p>Knigge wollte keinen Benimmratgeber im heutigen Sinn schreiben, sondern ein philosophisch-moralisches Werk, in deren Mittelpunkt stehen:</p> <ul> <li>der gegenseitige Respekt</li> <li>Toleranz</li> <li>Menschenkenntnis</li> <li>vernünftiger, aufgeklärter Umgang miteinander. </li> </ul> <p> </p> <p>Knigge wandte sich gegen:</p> <ul> <li>Standesdünkel</li> <li>blinde Autorität</li> <li>höfische Heuchelei </li> </ul> <p>Erst im 19. Jahrhundert wurde <em>„der Knigge“</em> fälschlich zum reinen Benimmkodex umgedeutet – eine Verkürzung, die bis heute anhält.</p>
1. 2 1788 - Die Soldaten-Besoldung wird erhöht
München * Die Besoldung der im Dienst stehenden pfalz-baierischen Soldaten wird erhöht. Außerdem wird ihnen ein Nebenerwerb als „Freywächter respect. Stadtarbeiter“ zugestanden.
7. 2 1788 - „Memorandum zur Neuorganisation der baierischen Armee“
München * Sir Benjamin Thompson legt Kurfürst Carl Theodor ein „Memorandum zur Neuorganisation der baierischen Armee“ vor.
Hauptziel und der Zweck der Reform „ist eine gute Armee bei geringen Kosten“.
Der begeisterte Baiernherrscher ernennt den Urheber der Reformvorschläge zunächst zum „Oberst“.
29. 3 1788 - Sir Benjamin Thompson wird Kriegsminister
<p><strong><em>München</em></strong> * Das von Sir Benjamin Thompson vorgelegte <em>„Memorandum zur Verbesserung des baierischen Militärwesens“</em> wird von der kurfürstlichen Kommission angenommen. Thompson wird zum Kriegsminister im Rang eines Generalmajors befördert. Sein Vorgänger, Freiherr Johann Ernst Theodor von Heyen gen. Belderbusch, wird <em>„ungnädig wegen missfälliger Verwaltung“</em> entlassen und als Militärgouverneur nach Mannheim versetzt.</p>
8 1788 - Neues Bekleidungssystem für Militär
München * Das neu eingeführte Bekleidungssystem versorgt jeden, vom Soldaten bis zum Feldwebel, unentgeltlich mit Bekleidung und Ausrüstung.
8. 11 1788 - Vorschlag zur Errichtung eines Arbeitshauses und eines Armen-Instituts
München * Sir Benjamin Thompson legt einen „Unterthänigsten Vorschlag zur Errichtung eines Militärischen Arbeitshauses und eines Armen-Instituts“ vor.
12 1788 - Vertrag zur Errichtung eines „Arbeitshauses“ geschlossen
München - Au * Zwischen „Hofkammerrats“ Piaggino und der „Oberlandesregierung“ wird ein Vertrag zur Errichtung eines „Arbeitshauses für beschäftigungslose arme Menschen“ geschlossen.
1789 - Die letzte Bererdigung auf dem „Frauenfriedhof“
München-Kreuzviertel * Die letzte Beerdigung findet - aufgrund der Beschießung Münchens durch die Österreicher - auf dem „Frauenfriedhof“ statt.
1789 - Haidhausen will eine eigenständige Pfarrei werden
Haidhausen - Bogenhausen * Mit ausdrücklicher Befürwortung des „Hofmarkherrn“ wird ein Antrag auf Loslösung des bisherigen „Pfarrverbandes“ mit Bogenhausen und die Errichtung einer eigenständigen „Pfarrei Haidhausen“ gestellt.
1789 - Das „Bettlerunwesen“ in München
München * Über das „Bettlerunwesen“ schreibt Sir Benjamin Thompson die nachfolgenden Zeilen:
„Man konnte in München nicht über die Straße gehen, ohne von Bettlern angefallen und gezwungen zu werden, ihren lärmenden Forderungen genüge zu leisten.
Die Kirchen waren überschwemmt von Bettlern, welche während des Gottesdienstes die Andächtigen so lange quälten, bis ihre Wünsche befriedigt wurden.
Der Kinderdiebstahl war im Schwunge.
Die Bettler stachen den armen Kleinen die Augen aus, verrenkten ihnen die Glieder, um das Mitleid der Vorübergehenden zu wecken.
Sie stellten ihre Kinder völlig nackt und fast verhungert in die Straßen, damit das jämmerliche Geschrei der Unglücklichen die Leute zum Almosengeben bewog“.
1789 - Antoine de Lavoisier veröffentlicht das erste Chemiebuch
xxx * Antoine de Lavoisier veröffentlicht seine „Elementare Abhandlung über die Chemie“ - das erste moderne Chemiebuch.
Er ist der erste wirklich so zu nennende Chemiker. Seine neue Methode, chemische Reaktionen nicht nur qualitativ zu beschreiben, sondern auch quantitativ zu messen, bildet die Grundlage der modernen Chemie.
1 1789 - Pläne zur Errichtung eines „Militärischen Arbeitshauses“
München - Au * Sir Benjamin Thompson stellt im Rahmen seiner „Militär-Reorganisation“ seine finanziell vielversprechenden Pläne zur Errichtung eines „Militärischen Arbeitshauses“ vor.
12. 1 1789 - Flächendeckende Pflanzung von Maulbeerbäumen im Englischen Garten
München * Kurfürst Carl Theodor erlässt eine Landesverordnung zur Seidenraupenzucht und Seidenraupenmanufaktur, da man sich von diesem Landwirtschaftszweig eine wirksame Maßnahme zur Beschaffung von Arbeit erhofft. Der neue Militärgarten an der Schönfeldstraße, im damals neu entstehenden Theodors-Park, dem Englischen Garten, soll zum Aufzuchtgebiet für flächendeckende Pflanzungen mit Maulbeerbäumen werden.
Im Zuge der ersten Maßnahmen zur Entfestigung der Stadt werden Maulbeerbäume außerdem „um die ganze Stadt herum“ angepflanzt.
16. 1 1789 - Aufhebung der Friedhöfe innerhalb der Stadtmauern
München - München-Isarvorstadt * Mit einer kurfürstlichen Verordnung beginnt die Aufhebung der Friedhöfe innerhalb der Stadtmauern. Einziger Friedhof ist bereits seit neun Monaten der heutige Alte südliche Friedhof vor dem Sendlinger Tor.
7. 2 1789 - „Die Aufhebung der sämmtlichen Freythöfe in der Stadt betreffend“
München * Eine neue Friedhofsverordnung „Die Aufhebung der sämmtlichen Freythöfe in der Stadt betreffend“ wird erlassen.
Auch die Friedhöfe der „Heiliggeistkirche“, der „Dreifaltigkeitskirche“ und der „Rochuskirche“ müssen aufgelassen werden.
12. 2 1789 - Die Namensgalgen werden abgeschafft
München * Die sogenannten Namensgalgen, an denen die Namen der Deserteure angeschlagen sind, werden abgeschafft.
21. 2 1789 - In jeder Garnisonsstadt sind Militärgärten anzulegen
München * Kurfürst Carl Theodor erlässt eine Anweisung, wonach in der Nähe einer jeden Garnisonsstadt Militärgärten anzulegen sind. Jeder Einheit wird ein eigener Destrikt zugewiesen. Die Soldaten sollen Gelegenheit erhalten zu graben und zu hacken, zu säen und zu ernten, sich aber auch auszuruhen und zu erholen.
Dennoch sollen die Gärten „nicht nur alleine zum Vorteil und Ergötzung des Militärs, sondern auch zum allgemeinen Gebrauch als ein öffentlicher Spaziergang dienen“ sowie „Nahe an der Stadt angelegt werden und in einer luftigen, gesunden Gegend und wo man von einem der Stadttore oder sonstigen Ausgängen der Stadt bis zum Garten eine Allee leicht anlegen kann“.
21. 2 1789 - Die freigewordenen Friedhofsplätze dürfen nicht verkauft werden
München * Die durch die Verlegung der Friedhöfe frei werdenden Plätze dürfen von der Stadt nicht verkauft werden.
2. 3 1789 - Thompsons Vorschlag für ein Militärisches Arbeitshaus wird angenommen
München * Vermutlich aus Kostengründen entscheidet sich Kurfürst Carl Theodor für Thompsons Vorschlag für ein Militärisches Arbeitshaus und ordnet die Errichtung „einstweilen in jeder Stadt und Garnison, in Zukunft aber sobald thunlich in jedem beträchtlichen Orte“ an. Militärische Arbeitshäuser entstehen aber nur in München und Mannheim. Die Arbeitshäuser sollen folgenden Zwecken dienen:
- Der Beschäftigung von Armen und Bettlern.
- Die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für verarmte Angehörige der unterständigen Schichten.
- Nicht an Arbeit gewöhnte Menschen sollen in diesen Anstalten die Arbeitsfähigkeit erlernen.
Gleichzeitig sollen Armenverwaltungen eingerichtet werden, die die „Hausarmen“ erfassen und in die Arbeitshäuser einweisen.
24. 3 1789 - Platzsuche für den geplanten Militärgarten
München-Englischer Garten * Kurfürst Carl Theodor fordert den Münchner Magistrat auf, für die Verwirklichung eines Militärgartens einen geschützten Platz ausfindig zu machen. Da es der Stadtverwaltung mit der Durchführung des von Thompson vorgelegten Planes nicht eilig ist, schreitet der Minister selbst zur Tat.
Er hält die Gegend um den Hirschanger vor dem Schwabinger Tor, ein bisher lediglich zur kurfürstlichen Jagd genutztes Stück Land, das zum Teil außerhalb des Münchner Burgfriedens liegt und damit dem Einfluss und der Polizeigewalt des Münchner Magistrats entzogen ist, als am besten geeignet.
4 1789 - Urheberstreit über das „Arbeitshaus“-Projekt
München - Au * „Hofkammerrat“ Piaggino gibt seine Pläne zur Errichtung eines „Arbeitshauses für beschäftigungslose arme Menschen“ auf.
In der Folge kommt es zwischen Piaggino und Thompson zur Auseinandersetzung über die Urheberschaft des „Arbeitshausplanes“.
20. 6 1789 - Kurfürst Carl Theodor ordnet die Verwirklichung der Militärgärten an
München-Englischer Garten * Kurfürst Carl Theodor beauftragt Sir Benjamin Thompson mit der Verwirklichung der Militärgärten. Er soll den Platz bestimmen, ausstecken, unter die Regimenter aufteilen und von ihnen bearbeiten lassen. Die Grundstückseigentümer werden finanziell entschädigt.
1. 7 1789 - Eine Militärgartenkommission wird gegründet
München * Sir Benjamin Thompson gründet eine Militärgartenkommission.
1. 7 1789 - Oberaufsicht für die Militärischen Arbeitshäuser in München und Mannheim
München * Sir Benjamin Thompson erhält die Oberaufsicht über die Militärischen Arbeitshäuser in München und Mannheim.
8. 7 1789 - Die ersten Pflanzungen werden im Militärgarten vorgenommen
München-Englischer Garten * Unter dem Kommando von Benjamin Thompson nehmen Soldaten die ersten Pflanzungen für den Militärgarten vor.
14. 7 1789 - Der Sturm auf die Bastille fördert den Englischen Garten
Paris * Mit dem Sturm auf die Bastille beginnt in Paris die Französische Revolution. Durch dieses Ereignis wird das Militärgarten-Projekt in München [= Englischer Garten] zu einem Politikum, das in aller Eile realisiert werden muss.
18. 7 1789 - Der Hofoberrichter erlässt Bestattungsvorgaben
München * Der Hofoberrichter erlässt für die künftigen Bestattungen einen Befehl, in dem es heißt:
- Das Grab muss mindestens 6 Schuh tief sein.
- Zwischen zwei Bestattungen in einem Grab müssen zwölf Jahre vergangen sein.
- Die Beerdigung darf erst 48 Stunden nach Eintritt des Todes erfolgen.
23. 7 1789 - Jakob Nockher kauft einen Teil von Marquartskreith
Au * Der Bankier und Münchner Ratsherr Jakob Nockher kauft einen Teil von Marquartskreith und errichtet darauf das Nockher-Schlösschen.
7. 8 1789 - Hofgärtner Friedrich Ludwig Sckell wird nach München berufen
München * Der Schwetzinger Hofgärtner Friedrich Ludwig Sckell wird von Kurfürst Carl Theodor nach München berufen, um unter der Oberaufsicht von Sir Benjamin Thompson Entwürfe zur Anlage des Englischen Gartens zu entwerfen. Sckell zeichnet „gleich in der Natur selbst“ den Verlauf des ersten Weges und steckt die Grenzen der Ehren Pflanzungen aus.
13. 8 1789 - Der Auftrag zur umgehenden Verwirklichung des Englischer Gartens
München-Englischer Garten - Hirschanger * Kurfürst Carl Theodor unterzeichnet ein Dekret, wonach er „den hiesigen Hirsch-Anger [...] zur allgemeinen Ergötzung für Dero Residenzstadt München herstellen zu lassen, und diese schönste Anlage der Natur dem Publikum in ihrem Erholungs-Stunden nicht länger vor zu enthalten gnädigst gesonnen“ sei.
Sir Benjamin Thompson erhält den Auftrag, den Landschaftspark unverzüglich zu verwirklichen. Der geplante Volksgarten wird zunächst Theodors-Park, später Englischer Garten genannt.
25. 8 1789 - Die Armen-Instituts-Deputation betreut auch die Vorstadt Au mit
Au * Kurfürst Carl Theodor ernennt eine Armen-Instituts-Deputation, die auch die Vorstadt Au mit betreut.
Um 9 1789 - Ein „Apollo-Tempel“ entsteht als Staffage-Bau im „Englischen Garten“
München-Englischer Garten - Lehel * Nach Planungen des „Ingenieur-Lieutenants beim Hofkriegsrat“, Johann Baptist Lechner, entsteht ein „Apollo-Tempel“ als Staffage-Bau im „Englischen Garten“.
Das von spiegelnden Wassern umgebene „Hein-Heiligtum“ befindet sich im alten „Hirschangerwald“ auf einer Halbinsel.
Der Rundtempel mit Dorischer Ordnung ist im wesentlichen eine Holzkonstruktion.
Die Gebälkzone und das Kuppelinnere sind zum Teil gemauert, zum Teil aus stuckiertem Holz.
Die Kuppelabdeckung besteht aus Blech.
Seinen Standort nimmt heute die „Steinerne Bank“ ein.
11. 9 1789 - Schriften mit revolutionären Inhalten
München * Kurfürst Carl Theodor verbietet alle Schriften mit möglicherweise revolutionären Inhalten. Ein im Herzogspital gefundenes Flugblatt in Form eines Gebetes wünscht sich sogar die französische Revolutionsarmee herbei.
21. 11 1789 - Kurfürst Carl Theodor öffnet die Hofbibliothek für jedermann
München * Kurfürst Carl Theodor öffnet die Hofbibliothek für jedermann.
23. 11 1789 - Die zweite Kunstausstellung der Zeichnungsakademie
München-Graggenau * Im Galeriegebäude am Hofgarten wird die zweite Kunstausstellung der Zeichnungsakademie, einer Vorläuferin der späteren Kgl. Akademie der bildenden Künste, durchgeführt.
28. 11 1789 - Eine Friedhof-Satzung für die beiden Haupt-Pfarrkirchen erlassen
München * Nachdem der Friedhof vor dem Sendlinger Tor endlich vollendet ist, wird eine Friedhof-Satzung für die beiden Haupt-Pfarrkirchen erlassen.
1. 12 1789 - Gründung eines Armeninstituts und einer Armen-Instituts-Deputation
München * Ein Armeninstitut wird gegründet und dazu eine Armen-Instituts-Deputation eingerichtet.
1790 - Die Münchner und die Auer „Armenpflegschaft“ wird vereinigt
München - Au * Die Münchner und die Auer „Armenpflegschaft“ wird wegen der chronisch leeren Kasse der Auer Gemeinde vereinigt.
1790 - Der zwei Kilometer lange „Isardamm“ ist fertig gestellt
München-Englischer Garten - Lehel * Der vom „Geometer“ Adrian von Riedl geplante, etwa 2 Kilometer lange „Isardamm“ ist fertig gestellt.
Er schützt den „Englischen Garten“ nicht nur vor Hochwasser, sondern ermöglicht auch die Entwässerung des Parkgeländes.
1790 - Der „Gotische Pavillon“ im „Englischen Garten“ entsteht
München-Englischer Garten - Lehel * In der Nähe der „Wirtschaft des Chinesischen Turms“ entsteht der „Gotische Pavillon“.
Der Holzbau wird von der Münchner Bevölkerung ebenso exotisch und bizarr betrachtet wie die chinesische Baukunst.
Er verschwindet - wie die meisten Holzkostruktionen - bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
1790 - Ein Bierausschank für die im „Englischen Garten“ beschäftigten Arbeiter
München-Englischer Garten - Schwabing * An der ursprünglichen nördlichen Grenze des „Englischen Gartens“ befinden sich zwei kleine „Holländische Bauernhäuser“, die dem „Parkwächter“ Josef Tax als Wohnung dienen.
Er hält Kühe und Esel und betreibt außerdem einen Bierausschank für die im „Englischen Garten“ beschäftigten Arbeiter und Tagelöhner.
Damit legt er den Grundstein für das später so beliebte Ausflugslokal „Kleinhesselohe“, das anfangs im Volksmund auch „Kleines Eselsloch“ genannt wird.
1790 - Die „Schwaige“ mit den „Ökonomiegebäuden“ wird erbaut
München-Englischer Garten - Lehel * Zwischen 1790 und 1791 wird die „Schwaige“ mit den „Ökonomiegebäuden“ hinter dem „Gasthaus am Chinesischen Turm“ nach Plänen von Johann Baptist Lechner erbaut.
Sie sind „zur Errichtung einer sogenannten Schweizerey [Hornviehzucht] von wenigstens 60 Stücken bestimmt“.
1790 - Der „Hirschgarten“ wird fürs Volk geöffnet
Hirschgarten * Kurfürst Carl Theodor lässt den „Hirschgarten“ für das Volk öffnen.
1790 - Kurfürst Carl Theodor führt den sogenannten „Illuminateneid“ ein
München * Kurfürst Carl Theodor führt den sogenannten „Illuminateneid“ ein.
Jeder Beamte und Geistliche muss versichern, dass er keiner „geheimen Gesellschaft“ angehört.
Zusätzlich gibt es „Inquisitorische Untersuchungsverfahren“ gegen verdächtige Personen und Gruppen.
Es herrscht „eine gewisse finstere Stimmung in Baiern, jener ähnlich, welche zu den Zeiten der Hexenprozesse durch ganz Deutschland geherrscht hatte.
Der geringste Verdacht, die unbedeutendste Veranlassung reichte hin, um für einen Illuminaten gehalten zu werden“.
1. 1 1790 - Bettlerhatz am Tag des Almosengebens
München * Am Tag des Almosengebens lässt Sir Benjamin Thompson in München 2.600 Bettler aufgreifen. Die Gesunden und Arbeitsfähigen müssen sich am nächsten Tag im Militärischen Arbeitshaus in der Au einfinden, „wo Arbeit, Verdienst und Verpflegung ihrer harrte“. Die Arbeitsunfähigen werden vom Armeninstitut unterstützt und verköstigt.
19. 2 1790 - Einfuhr und Verbreitung von revolutionären Schriften mit Strafe belegt
München * Die Einfuhr und die Verbreitung von Schriften mit revolutionärem Inhalt wird durch Kurfürst Carl Theodor verboten und mit Strafe belegt.
20. 2 1790 - Kaiser Joseph II. stirbt in Wien
Wien * Kaiser Joseph II. stirbt in Wien.
3 1790 - Benjamin Thompson wird „Geheimer Staatsrat“
München * Kurfürst Carl Theodor macht Sir Benjamin Thompson zum „Geheimen Staatsrat“.
3 1790 - Eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Maulbeerbaum-Zerstörers
München * Die Baumschule für Maulbeerbäume hat nur eine geringe Akzeptanz in der Münchner Bevölkerung.
Sir Benjamin Thompson schreibt eine Belohnung von 100 Golddukaten für die Ergreifung desjenigen Bösewichts aus, der nachts in die Militärgärten eingedrungen ist und knapp 500 Setzlinge mutwillig zerstört hat.
1. 3 1790 - Kurfürst Carl Theodor übernimmt das Reichsvikariat
Wien * Nach dem Tod Kaiser Josephs II. übernimmt Kurfürst Carl Theodor das Reichsvikariat. Er führt damit die laufenden Geschäfte bis zur Wahl beziehungsweise Krönung des neuen Kaisers.
1. 3 1790 - Joseph Konrad von Schroffenberg-Mös wird Freisinger Bischof
Freising * Joseph Konrad von Schroffenberg-Mös wird zum Bischof von Freising gewählt.
10. 3 1790 - Gründung der Thier-Arzney-Schule
<p><strong><em>München-Englischer Garten - Schwabing</em></strong> * Kurfürst Carl Theodor ruft in einem Dekret die <em>„Thier-Arzney-Schule“</em> ins Leben. Sie soll nicht nur Viehseuchen erforschen und bekämpfen, sondern auch Tierärzte und Schmiede für die Kavallerie ausbilden.</p>
26. 3 1790 - Kurfürst Carl Theodor gründet die „Thierartzney-Schule“
München-Englischer Garten - Schwabing * Kurfürst Carl Theodor gibt die Gründung einer „förmlichen Thierartzney-Schule (École vétérinaire)“ bekannt.
29. 3 1790 - Der Chinesische Turm bekommt seinen Abschlussknopf
<p><strong><em>München-Englischer Garten - Lehel</em></strong> * Auf den <em>„kinesischen thurn“</em> im Englischen Garten wird vom Kupferschmied Michael Leithner der Knopf angebracht. </p>
1. 5 1790 - Die „Thierartzney-Schule“ wird in der Gemeinde Schwabing eröffnet
<p><strong><em>München-Englischer Garten - Schwabing</em></strong> * Die<em> „Thierartzney-Schule“</em> wird unter der Leitung des Medizinalrats Professor Dr. med. Anton Will in der sogenannten <em>„Jesuitenwasch“</em> in der damals noch selbstständigen Gemeinde Schwabing eröffnet. Die Tierarzneischule beschäftigt sich mit der <em>„Bekämpfung einbrechender Viehseuchen“</em> sowie der Ausbildung <em>„geschickter Tierärzte“ </em>und <em>„guter Huf- und Kurier-Schmiede für die Kavallerie-Regimenter“</em>. Der Lehrbetrieb wird aber erst am 1. November aufgenommen. </p>
25. 5 1790 - Die erste groß angelegte Besichtigungsfahrt durch den Englischen Garten
München-Englischer Garten * Kurfürst Carl Theodor unternimmt eine erste groß angelegte Besichtigungsfahrt im offenen Gartenwagen durch den neu angelegten Englischen Garten. Doch noch ist der Park für die Öffentlichkeit gesperrt.
Der Bericht der ersten Spazierfahrt erwähnt eine Vieharzneyschule, eine Baumschule, eine Schweizerey, eine Schäferey und eine Ackerbauschule. Diese Einrichtungen sind als Lehr- und Musterbetriebe konzipiert und sollen die Landbevölkerung mit den neuesten Anbau- und Zuchtmethoden vertraut machen.
7. 7 1790 - Der Kunstgeschmack der Münchner soll gehoben werden
München * Durch jährlich abzuhaltende Ausstellungen junger Künstler soll der Kunstgeschmack der Münchnerinnen und Münchner angehoben werden.
14. 7 1790 - Dank- und Huldigungsadresse der Bürgerschaft an den Kurfürsten
München * Um den immer lauter werdenden Klagen über den „Missbrauch der Fürstenmacht“ und die „Missachtung der Bürgersorgen“ die Wirkung zu nehmen, tritt Benjamin Thompson die Flucht nach vorne an. Er organisiert für den ersten Jahrestag des Sturmes auf die Bastille eine öffentliche Dank- und Huldigungsadresse an den Kurfürsten.
Zu diesem Zwecke lässt er eine Druckschrift vorbereiten, die im Namen anonymer Bürger - in einer äußerst unterwürfigen Formulierung - die Reformmaßnahmen des vergangenen Jahres preisen und Kurfürst Carl Theodor als „Quelle aller wahrhaft bürgerlichen Glückseligkeit“ hervorhebt. Damit verletzt der Amerikaner die „magistratische Alleinvertretungskompetenz in Angelegenheiten der Bürgerschaft“.
Der Magistrat, den man bei der Formulierung der Adresse übergangen hat, sieht sich in seiner verfassungsrechtlichen Position als Sprecher der Bürger verletzt und distanziert sich von dem ganzen Vorgang.
21. 7 1790 - Gegen die Danksagung der Münchner Bürgerschaft an den Kurfürsten
München * Der Rat der Stadt befasst sich mit der gedruckten Danksagung der Münchner Bürgerschaft an den Kurfürsten. Der Magistrat verwehrt sich in keinster Weise gegen einen Dank für die neue Armeneinrichtung oder die Militärakademie, lehnt aber eine generelle Danksagung ab. Außerdem sollte die Danksagung aus eigenem Antrieb erfolgen und nicht „durch einen besonderen Auftrag“.
26. 7 1790 - Der Magistrat verwahrt sich gegen die Rechtsverletzung
München * Der Magistrat verwahrt sich in einer Resolution gegen die Rechtsverletzung durch die von Sir Benjamin Thompson veranlasste „öffentliche Dank- und Huldigungsadresse“ an den Kurfürsten.
27. 7 1790 - Die Huldigungsadresse der Münchner Bürgerschaft wird veröffentlicht
München * Die vermutlich von Sir Benjamin Thompson verfasste - aber anonym unter dem Datum vom 14. Juli 1790 erschienene - allgemeine „Dank- und Huldigungsadresse der Münchner Bürgerschaft“ an den Kurfürsten, kommt in der Stadt in Umlauf.
Außerdem sieht sich der Magistrat mit einer weiteren von Thompson veranlassten Druckschrift konfrontiert, in der er den „Undank“ der Stadträte anprangert.
28. 7 1790 - Der Magistrat greift die verfehlte Regierungspolitik des Landesherrn an
München * Der Magistrat, den man bei der Formulierung der „allgemeinen Dank- und Huldigungsadresse der Münchner Bürgerschaft an den Kurfürsten“ übergangen hat, sieht sich in seiner verfassungsrechtlichen Position als Sprecher der Bürger verletzt und distanziert sich von dem ganzen Vorgang.
Der Magistrat verbreitet eine Rechtfertigungsschrift, in welcher er die Intrige Sir Benjamin Thompsons aufdeckt und eine „Verbindung zwischen einer verfehlten Regierungspolitik und den revolutionären Vorgängen in Frankreich“ herstellt.
31. 7 1790 - Kurfürst Carl Theodor setzt den Magistrat ab
München * Kurfürst Carl Theodor empfindet die Rechtfertigungsschrift des Magistrats vom 28. Juli und die darin enthaltenen Angriffe auf die „verfehlte Regierungspolitik des Landesherrn“ als Majestätsbeleidigung und Hochverrat. Er lässt ein Exempel statuieren, den gesamten Inneren- und Äußeren Rat vor eine kurfürstliche Spezialkommission bringen und einzeln verhören. Bis zur nächsten Stadtratswahl überträgt er die Geschäfte einer kurfürstlichen Stadtadministrationskommission.
8 1790 - Sir Benjamin Thompson erhält eine lebenslange Pension
München * Kurfürst Carl Theodor stattet Sir Benjamin Thompson mit einer lebenslangen Pension aus.
10. 8 1790 - Die Verwaltung und Benutzung des „Englischen Gartens“ wird geregelt
München-Englischer Garten * Kurfürst Carl Theodor erlässt eine „Spezialresolution“, die die Verwaltung und Benutzung des „Englischen Gartens“ und aller darin befindlichen Grundstücke und Gebäude regelt.
11. 8 1790 - Der Friedhof an der Salatorkirche wird eine bequeme Zu- und Abfahrt
München-Kreuzviertel * Der vom Baierischen Staat aufgekaufte Friedhof an der Salatorkirche soll als bequemere Zu- und Abfahrt zum Nationaltheater im alten Opernhaus hergerichtet werden.
4. 9 1790 - Joseph Anton Maffei kommt in München zur Welt
München * Joseph Anton Maffei kommt in München zur Welt.
22. 9 1790 - Franz Schweiger darf weder in der Stadt noch im Burgfrieden auftreten
München • Der Antrag des Schauspieldirektors Franz Schweiger für ein Engagement im Kreuzlgießergarten wird vom Stadtrat abgelehnt. Er darf weder in der Stadt noch im Burgfrieden auftreten.
30. 9 1790 - Leopold II. wird zum Kaiser gewählt
Frankfurt am Main * Leopold II. wird zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt.
9. 10 1790 - Leopold II. wird in Frankfurt zum Kaiser gekrönt
Frankfurt am Main * Leopold II. wird in Frankfurt am Main feierlich zum Kaiser gekrönt. Damit endet das Reichsvikariat des pfalzbaierischen Kurfürsten Carl Theodor.
23. 10 1790 - Einfuhr von Büchern und Schriften aus Nürnberg verboten
München - Nürnberg * Kurfürst Carl Theodor untersagt die Einfuhr von Büchern und Schriften aus Nürnberg. Die Reichsstadt hatte sich nicht zu Zensurmaßnahmen bewegen lassen und wurde dadurch immer mehr zu einem Einfallstor für revolutionäres Gedankengut nach Baiern.
27. 10 1790 - Wiguläus Aloys von Kreitmair stirbt in München
München - Offenstetten * Wiguläus Aloys von Kreitmair stirbt in München. Sein Leichnam wird am 31. Oktober auf sein Gut Offenstetten überführt.
29. 10 1790 - Wolfgang Amadeus Mozart kommt zum letzten Mal nach München
München-Kreuzviertel * Wolfgang Amadeus Mozart kommt von der Rückreise der Kaiserkrönung Leopolds II. zum achten und letzten Mal nach München. Er wohnt wieder im Hotel Schwarzer Adler in der Neuhauser Gasse.
1. 11 1790 - Der Lehrbetrieb in der Veterinärschule wird aufgenommen
München-Englischer Garten - Schwabing * Der Lehrbetrieb in der Veterinärschule wird durch den Professor der Tierarzneikunst und Medizinalrat Anton Joseph Will aufgenommen.
4. 11 1790 - Mozarts Oper „Entführung aus dem Serail“ wird im Kaisersaal aufgeführt
München-Graggenau * Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Entführung aus dem Serail“ wird auf Einladung des Kurfürsten Carl Theodor in einer festlichen Hofakademie im Kaisersaal der Residenz aufgeführt. Der Musiker und Komponist freut sich, wie „stark das Gereiß“ um ihn ist.
Anwesend sind auch König Ferdinand IV. von Neapel und Sizilien mit seiner Gemahlin Maria Caroline von Österreich, einerSchwester des neugekürten Kaisers Leopold II..
6. 11 1790 - Wolfgang Amadeus Mozart verlässt München wieder
München * Wolfgang Amadeus Mozart verlässt München wieder.
15. 11 1790 - Kaiser Leopold II. wird in Preßburg zum König von Ungarn gekrönt
Pressburg * Kaiser Leopold II. wird in Preßburg zum König von Ungarn gekrönt.
22. 12 1790 - Kurfürst Carl Theodor verweigert die Bestätigung der Wahlmänner
München * Bei der turnusmäßig vorgenommenen Neuwahl der Stadträte verweigert Kurfürst Carl Theodor die Bestätigung der Wahlmänner und überträgt bis auf Weiteres die Führung der magistratischen Geschäfte einer landesherrlichen Kommission. Die Verfasser der Flugschrift werden lebenslang von den Ratsgeschäften ausgeschlossen.
1791 - Gabriel Zistl lässt an der Kellerstraße den „Zengerbräukeller“ bauen
Haidhausen * Gabriel Zistl lässt in der Kellerstraße auf dem Gasteigberg den „Zengerbräukeller“ erbauen.
1791 - Der „Apollo-Tempel“ erhält eine geschnitzte Statue
München-Englischer Garten - Lehel * Der „Apollo-Tempel“ im „Hirschangerwald“ erhält seine vom kurfürstlichen Hofbildhauer Josef Nepomuk Muxel geschnitzte Statue.
1791 - Titel in Hülle und Fülle
München * Sir Benjamin Thompson führt nachstehende Titel:
„Exzellenz Sir Benjamin Thompson Ritter, Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht zu Pfalzbaiern Kämmerer, Wirklicher Geheimer Rat, Generalmajor der Kavallerie und Generalleibadjutant, des Kgl. Polnisch Weißen Adlers- und Stanislausordens Ritter, der Kgl. Gesellschaft zu London, der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Kurfürstlichen Akademie der Wissenschaften zu Mannheim und zu München und der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften Mitglied“.
1791 - In der „Falkenau“ leben bereits rund dreihundert Familien
Au - Untergiesing * In der „Falkenau“ bestehen bereits achtzig Behausungen mit rund dreihundert Familien.
Der Ruf der „Falkenauer“ ist allerdings ein schlechter.
1791 - Giovanni Pietro Salti setzt Aloysia Lampert als Erbin ein
München * Der unverheiratete „Kaffeeschenk“ Giovanni Pietro Sarti beerbt durch ein Testament seine Haushälterin Aloysia Lampert.
18. 3 1791 - Maßnahmen zur Niederlegung der Stadtmauer werden eingeleitet
<p><strong><em>München</em></strong> * Kurfürst Carl Theodor leitet den Wandel Münchens von der befestigten barocken Residenzstadt zu einer offenen und modernen Hauptstadt ein. Er beauftragt dazu Sir Benjamin Thompson <em>„das Neuhauser Thor so herzustellen, daß die bißherigen Umwege und engen Durchgänge gänzlich vermieden, und der Thorweeg in gerader Linie mit der Neuhausserstrasse über den Wall und bis auf den Punkt, wo sich die Augsburger und Landsberger Strassen trennen, geführt werde“</em>. </p> <p>Damit wird die erste, von staatlichen Behörden geplante und vom Kurfürsten sanktionierte Maßnahme zur Niederlegung eines bedeutenden Teilstückes der barocken Festungswerke eingeleitet. Es hat eine für die Stadtentwicklung Münchens herausragende Bedeutung, deren zukunftsweisenden Aspekte man damals in ihrer Gesamtheit noch gar nicht erkennen kann.</p> <p>Zur Realisierung dieses Vorhabens muss die Neuhauser-Bastion eingeebnet, der Festungsgraben verfüllt und eine Fahrstraße mit Fußwegen auf beiden Seiten über das planierte Gelände hergestellt werden. Damit entsteht unmittelbar vor dem Stadttor ein großer Platz. </p> <p>Thompson lässt darüber hinaus auch einen ausgedehnten Sektor der Fortifikationen im Westen der Altstadt mit Wall und Graben niederlegen, sodass das eingeebnete Festungsgelände vom heutigen Lenbachplatz bis zur Herzogspitalstraße reicht. Damit wird eine breite Lücke in das System der Münchner Fortifikation geschlagen und so die Festungseigenschaft der Stadt aufgehoben.</p>
6. 4 1791 - Offener Protest gegen die Entfestigungsmaßnahmen
München * Naturgemäß erregen die eingeleiteten Entfestigungsmaßnahmen und das Einreißen der Stadtmauer die Gemüter der Münchner und führen umgehend zum offenen Protest gegen Kurfürst Carl Theodor.
In einem Protestschreiben, das von mehreren Hundert Münchner Bürgern unterschrieben worden ist, wird der Durchstich der Neuhauser Straße ausdrücklich begrüßt, doch die gänzliche Schleifung der Wallanlagen lehnen sie ab.
Die Unterzeichner betrachten es als „unverantwortlich, Wälle, welche fast eineinhalb Jahrhunderte stehen, und deren Herstellung mehr als drei Millionen gekostet hatte, ohne gewichtigen Nutzen, oder besondere Notwendigkeit einzuwerfen“.
1. 5 1791 - Im Englischen Garten wird ein Manöver abgehalten
<p><strong><em>München-Englischer Garten</em></strong> * Im Englischen Garten wird ein Manöver abgehalten. Aus ganz Baiern beteiligen sich von jedem Regiment eine Kompanie. Das sind 1.500 Mann, davon 300 zu Pferd. Das Manöver dauert bis zum 29. Juni. </p>
3. 5 1791 - Kurfürst Carl Theodor regelt die Ratswahlordnung neu
München * Kurfürst Carl Theodor regelt die Ratswahlordnung neu. Ein von den Zünften gewähltes Gremium von 36 „Ausschüssern“ sollen als Repräsentanten der gesamten Stadtgemeinde den Äußeren Rat und mit diesem gemeinsam den Inneren Rat jährlich komplett neu wählen.
9. 5 1791 - Carl Theodor will nichts tun, was gegen das Wohl der Stadt gerichtet ist
München * Kurfürst Carl Theodor dementiert die Gerüchte, wonach die ganze Stadt entfestigt werden soll und versichert, er werde nichts tun, was gegen das Wohl der Stadt gerichtet sei.
Gleichzeitig zeigt er sich über den Bürgerprotest verwundert, „da es ja gerade die Bürgerschaft gewesen ist, die im Jahre 1612, bei der Projektierung der neuen Wallanlage, sich gegen diese mit der Begründung aufgelehnt hätte, die neue Befestigung würde einst, bei veränderter Kriegsführung, unnütz und unbrauchbar“.
13. 5 1791 - Die Brauer dürfen in ihren Märzenkellern keine Gäste bewirten
Haidhausen - Au * Die Oberste Landesregierung verbietet aufgrund einer Beschwerde der umliegenden Bierbrauer „nachdrücklichst“, dass die Brauer in ihren Märzenkellern am Gasteig und am Lilienberg Gäste bewirten.
21. 5 1791 - Auf den Knien Abbitte leisten
München * Die Verfasser der Rechtfertigungsschrift des Magistrats vom 28. Juli 1790 werden lebenslang von den Ratsgeschäften ausgeschlossen. Die übrigen an der Aktion Beteiligten müssen in der Herzog-Maxburg - wie gewöhnliche Verbrecher - vor dem Porträt des Kurfürsten auf den Knien Abbitte für ihr Vorgehen leisten. Das gilt als ungeheure Schmach und stellt einen Tiefpunkt in der Geschichte des städtischen Ratsgremiums dar.
31. 5 1791 - Franz Ferdinand Edler von Setzger verkauft sein Schloss Haidenberg
Haidhausen * Hofrat Franz Ferdinand Edler von Setzger veräußert sein Schloss Haidenberg in Haidhausen an den bürgerlichen Salzburger Boten Anton Hiebl.
6. 9 1791 - Kaiser Leopold II. wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt
Prag * Kaiser Leopold II. wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt.
5. 12 1791 - Wolfgang Amadeus Mozart stirbt in Wien
Wien * Wolfgang Amadeus Mozart stirbt im Beisein seiner Frau Constanze, im Alter von 35 Jahren, in Wien. Der geniale Komponist wird auf dem einige Kilometer vor der Stadt gelegenen Sankt-Marxer-Friedhof beigesetzt.
Da nach den damals gültigen Begräbnisvorschriften weder Pomp noch Grabkreuze erlaubt sind und der Sarg erst nach sechs Uhr abends, also bereits während der Dunkelheit, überführt werden darf gehen kaum Trauergäste mit. Deshalb geht die Grabstelle Mozarts bis zum heutigen Tag in der Anonymität verloren.
1792 - Kommerzienrat Fleischmann verlegt die Tabakfabrik nach Landshut
Au - Landshut * Der „churfürstliche Commerzienrath“ Fleischmann verlegt die „Rauchtobacksfabrique“ nach Landshut, wo noch heute unter dem Namen „Pöschl“ Kau- und Schnupftabak hergestellt wird.
1792 - Die „Ökonomiegebäude“ bei der „Schwaige“ werden erweitert
München-Englischer Garten - Lehel * Die „Ökonomiegebäude“ bei der „Schwaige“ im „Englischen Garten“ werden erweitert.
1792 - Montgelas: „Ausweitung der grundlegenden Rechte auf alle Klassen“
München * Unter dem Eindruck der „Französischen Revolution“ schreibt Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas an seinen Münchner Freund, Maximilian Joseph Clemens Graf von Seinsheim:
Er wünscht sich „eine gerechtere Vertretung, eine Ausweitung der grundlegenden Rechte auf alle Klassen der Gesellschaft, gleiche Besteuerung ohne jede Unterscheidung“.
1792 - Der Konvent der Theatiner zählt 23 Mönche.
München-Kreuzviertel * Der Konvent der Theatiner zählt nur mehr 23 Mönche.
Um 1 1792 - Den Ausbau des „Torweges am Isartor“ angeordnet
München-Isarvorstadt * Sir Benjamin Thompson Reichsgraf von Rumford ordnet den Ausbau des „Torweges am Isartor“ an.
Rund einhundert Meter östlich des „Isartores“ - an der heutigen Einmündung der Rumford- und Thierschstraße - sollte ein „Torplatz“ entstehen, der als „Verkehrsknoten“, aber auch als „Fluchtplatz“ bei Feuer oder als „Marktplatz“ dienen soll.
Die letztgenannte Überlegung darf aber nicht ausgesprochen werden, da die Münchner befürchten, dass der wöchentliche „Getreidemarkt“ vom „Schrannenplatz“ auf den noch im Bau befindlichen „Karlsplatz“ verlegt werden wird.
Dieses Gerücht hatte bei der Bevölkerung und bei der Gemeindevertretung bereits Unmut und offenen Protest ausgelöst.
Das Projekt wird am 5. April 1792 wieder eingestellt.
1. 1 1792 - Der Kurfürst droht seinem Volk
München * In einem Erlass verbietet Kurfürst Carl Theodor die „höchst beleidigenden Zweifel gegen den Bestand des neu angenommenen Kriegssystems und alle spitzfindigen Bemerkungen über die erlassenen Verordnungen schärfstens und bey unvermeidlich hoher Strafe“.
2 1792 - Benjamin Thompson wird Chef des „Generalstabs“
München * Sir Benjamin Thompson wird zum Chef des „Generalstabs“ ernannt.
2 1792 - Konstruktion einer von Dr. Guillotin erdachten „Tötungsmaschine“
Paris * Der französische Chirurg Dr. Louis wird mit der Konstruktion der von Dr. Joseph Ignace Guillotin „aus humanitären Gründen“ erdachten „Tötungsmaschine“ beauftragt.
Die technisch-handwerkliche Ausführung übernimmt der deutsche „Klavierbauer“ Tobias Schmidt.
1. 3 1792 - Kaiser Leopold II. stirbt. Ihm folgt Franz II.
Wien * Kaiser Leopold II. stirbt in Wien. Sein Nachfolger - als Kaiser sowie als König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Österreich sowie Herr der übrigen Länder der Habsburgermonarchie - wird Franz II..
1. 4 1792 - Die Gaststätte beim Chinesischen Turm wird eröffnet
<p><strong><em>München-Englischer Garten - Lehel</em></strong> * Die Gaststätte beim Chinesischen Turm wird eröffnet. Damit steht die Gartenanlage endlich der Öffentlichkeit zur Verfügung.</p>
5. 4 1792 - Der Ausbau des Torweges am Isartor wird wieder eingestellt
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * Das Projekt <em>„Ausbau des Torweges am Isartor“</em> wird wieder eingestellt, nachdem sich weite Bevölkerungskreise gegen die Entfestigungsmaßnahmen ausgesprochen haben und der Ausbruch der Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich das Vorhaben in einem neuen Licht erscheinen lässt. </p>
20. 4 1792 - Frankreich erklärt Österreich und seinen Verbündeten den Krieg
<p><strong><em>München</em></strong> * Die französische Nationalversammlung erklärt Österreich und seinen Verbündeten den Krieg, um so die Errungenschaften der Revolution auch in den anderen Ländern durchzusetzen. </p> <p>Das Kurfürstentum Baiern versucht anfangs bei diesem Ersten Koalitionskrieg neutral zu bleiben.</p>
25. 4 1792 - Die „Guillotine“ wird erstmals in Paris in Gebrauch genommen
Paris * Die „Guillotine“ wird erstmals an dem Raubmörder Nicolas-Jacques Pelletier in Paris in Gebrauch genommen.
9. 5 1792 - Kurfürst Carl Theodor organisiert Sir Benjamin Thompsons Grafentitel
München - Wien * Kurfürst Carl Theodor führt nach dem Tod des Kaisers Leopold II. bis zur Ernennung seines Nachfolgers Franz II. das Reichsvikariat.
In dieser Zeit verleiht er dem englischen Ritter Sir Benjamin Thompson den Rang und die Würde eines Grafen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Aus Sir Benjamin Thompson wird Graf Rumford.
25. 5 1792 - Sir Benjamin Thompson wird zum Reichsgrafen von Rumford erhoben
München * Generalleutnant Sir Benjamin Thompson wird durch Kurfürst Carl Theodor zum Reichsgrafen von Rumford erhoben.
6. 6 1792 - Franz II. wird in Ofen zum König von Ungarn gekrönt
Ofen * Der deutsch-römische Kaiser Franz II. wird in Ofen zum König von Ungarn gekrönt.
7 1792 - Österreich und Preußen gegen Frankreich
Wien - Berlin - Paris * Das mit Österreich verbündete Preußen tritt in den Krieg gegen Frankreich ein.
5. 7 1792 - Franz II. wird zum Römischen König gewählt
Frankfurt am Main * Franz II. wird in Frankfurt zum Römisch-deutschen König gewählt.
8. 7 1792 - Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen wird geboren
Seidingstadt * Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, die spätere bayerische Königin, wird im Jagdschloss Seidingstadt im Herzogtum Sachsen-Hildburghausen geboren.
13. 7 1792 - Verbot des Gästesetzens in den Märzenkellern
Haidhausen - Au * Die Oberste Landesregierung erinnert erneut an ihr Verbot des „Gästesetzens in den Märzenkellern“ auf dem Gasteig und am Lilienberg vom 13. Mai des Jahres.
14. 7 1792 - König Franz II. wird im Frankfurter Dom zum Kaiser gekrönt
Frankfurt am Main * König Franz II. wird im Frankfurter Dom gekrönt und damit zum erwählten Römischen Kaiser als Franz II. proklamiert. Es wird die letzte Kaiserkrönung in Mitteleuropa sein. Die späteren österreichischen und deutschen Kaiser verzichten auf ihre Krönung.
26. 7 1792 - Kaiser Franz II. besichtigt den neu angelegten Englischen Garten
München-Englischer Garten * Kaiser Franz II. besichtigt den neu angelegten Englischen Garten.
31. 7 1792 - Das Paulanerkloster in der Au soll aufgehoben werden
München - Au * In einem Gutachten des Geistlichen Rates zum Paulanerkloster heißt es: Es sei „das allgemein Beste [...] so ein Kloster aufzuheben und die reichen Stiftungen und Einkünfte desselben [...] besser zu verwenden.“
9. 8 1792 - Kaiser Franz II. wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt
Prag * Kaiser Franz II. wird in Prag zum König von Böhmen gekrönt.
10 1792 - Die Franzosen annektieren die Pfalz
Pfalz * Die Franzosen fallen in das Rheinland ein und annektieren die Pfalz.
14. 12 1792 - Die 36 Ausschüsser erhalten ein Mitspracherecht
München * Die 36 Ausschüsser erhalten ein Mitspracherecht in allen Bürger- und Gemeindeangelegenheiten.
Um 1793 - Der „Metzgersprung“ findet nachweislich im „Fischbrunnen“ statt
München-Graggenau * Der „Metzgersprung“ findet nachweislich im „Fischbrunnen“ statt.
Die „Metzgerlehrlinge“ werden mit dem Sprung ins kalte Wasser „getauft“ und freigesprochen.
1793 - Der erste Führer „des neu angelegten Englischen Gartens“ erscheint
München-Englischer Garten * Der erste Führer „des neu angelegten englischen Gartens oder Theodors Park zu München“ erscheint.
1793 - Im „Englischen Garten“ entsteht ein „Diana-Tempel“
München-Englischer Garten - Lehel * Am östlichen Rand des „Englischen Gartens“ entsteht ein „Diana-Tempel“.
1793 - Das „Amphitheater“ im „Englischen Garten“ entsteht
München-Englischer Garten - Schwabing * Nördlich des „Rumford-Hauses“ im „Englischen Garten“ - in der Umgebung der Martiusbrücke nahe der Königinstraße - entsteht das „Amphitheater“ mit einem Durchmesser von 180 Fuß = ~ 60 Meter.
1793 - Die „Churpfalzbaierische Lazareth-Einrichtungsverordnung“
München * Die „Churpfalzbaierische Lazareth-Einrichtungsverordnung“ führt einmännige Bettgestelle ein.
Die Kranken werden nun nach Art der Krankheit und nicht regimentweise untergebracht.
Außerdem befasst man sich mit Maßnahmen zum Schutz vor Ungeziefer und mit der Beheizung, Lüftung und Reinigung der Krankenzimmer.
10. 2 1793 - Die französische Armee besetzt Zweibrücken
Zweibrücken - Mannheim * Die französische Armee marschiert in Zweibrücken ein und besetzt das Land. Herzog Carl II. August flieht nach Mannheim.
21. 2 1793 - Der französische König Louis XVI. stirbt auf dem Schafott
Paris * Der französische König Louis XVI. stirbt auf dem Schafott.
3 1793 - Graf Rumford macht Urlaub in Italien
München * Graf Rumford verlässt München in Richtung Italien.
Der Kurfürst hat ihm einen Erholungsurlaub gewährt.
7. 3 1793 - Der Englische Garten wird offiziell eröffnet
München-Englischer Garten * Der Englische Garten wird für die Bevölkerung offiziell zum allgemeinen Besuch geöffnet.
22. 3 1793 - Pfalz-Baiern tritt in den „Reichskrieg“ gegen Frankreich ein
München - Wien - Paris * Pfalz-Baiern tritt nach heftigen Drohungen der Österreicher in den „Reichskrieg“ gegen Frankreich ein.
Um genügend Soldaten zu rekrutieren zu können, werden zunächst in München und dann in den anderen Amtsbezirken „mit keinem hinreichend gewissen Nahrungsstand versehene oder übel beschriebene dienstlose und müßiggehende Personen ledigen Standes“ zwischen 17 und 42 Jahren zwangsweise für den Militärdienst eingezogen.
7 1793 - Ausweitung der „Zwangsaushebungen“
München * Die „Zwangsaushebungen“ zur Rekrutierung der Soldaten wird auf „liederliche Ehemänner [...] welche wegen ihrer verschwenderischen Hauswirthschaft und öfters corrigirt- oder fruchtlos ermahnten Schwärmerey und Liederlichkeit Weib und Kinder in das Verderben stürzen“ ausgeweitet.
16. 10 1793 - Die französische Königin Marie Antoinette stirbt durch das Schafott
Paris * Die französische Königin Marie Antoinette stirbt durch das Schafott.
27. 11 1793 - Das Mitspracherecht der Ausschüsser wird zurückgenommen
München * Aus Angst vor dem zunehmenden Selbstbewusstsein der Ausschüsser wird ihr Mitspracherecht in allen Bürger- und Gemeindeangelegenheiten wieder zurückgenommen.
1794 - Großes Fest im „Englischen Garten“
München-Englischer Garten * Widerwillig kehrt Sir Benjamin Thompson Graf von Rumford von seinem Erholungsurlaub von Italien nach München zurück.
Da ihn eine - hauptsächlich aus Bettlern bestehende - Menschenmenge freundlich empfängt, organisiert er zum Dank eine großes Fest im „Englischen Garten“.
30.000 Besucher kommen. Ochsen werden gebraten und Bierfässer angezapft, Musikkapellen spielen und Lampions brennen.
8 1794 - Ein anonymes Flugblatt gegen Kurfürst Carl Theodor
München * Ein anonymes Flugblatt wirft Kurfürst Carl Theodor vor, sein Land gewissenlos auszubeuten und warnt:
„Nehmt euch ein Beispiel aus der Zeit und schreibt's euch an die Wände:
in Frankreich köpft man Könige, in Polen hängt man Stände“.
17. 8 1794 - Kurfürstin Elisabeth Auguste stirbt in Weinheim
Weinheim * Die pfalz-baierische Kurfürstin Elisabeth Auguste stirbt in Weinheim. Ihre Grabstätte befindet sich in der Münchner Michaelskirche. Nun ist der 69-jährige Kurfürst Carl Theodor Witwer und begibt sich - ohne Einhaltung einer angemessenen Trauerzeit - umgehend auf Brautschau.
19. 9 1794 - Kurfürst Carl Theodor bittet um die Hand von Maria Leopoldine
München - Wien * Kurfürst Carl Theodor bittet Kaiser Franz II. um die Hand der 17-jährigen Maria Leopoldine von Österreich-Este. Er wendet sich mit dieser Bitte also nicht an den Vater der auserkorenen Braut, sondern an dessen Bruder.
11 1794 - Eine Revolte entwickelt sich
München * München wird zum Schauplatz einer Revolte:
Weil sie an einem Montag und nach einem darauffolgenden Feiertag morgens nicht rechtzeitig zur Arbeit erschienen sind, werden zwei Schlossergesellen ohne Lohn entlassen.
27. 11 1794 - 63 Schlossergesellen legen die Arbeit nieder
München * 63 Schlossergesellen legen aus Protest gegen die Kündigung und Lohnverweigerung der zwei Schlossergesellen die Arbeit nieder.
Der Stadtmagistrat lässt daraufhin zwei Rädelsführer und zwei Altgesellen einsperren.
Neun Gesellen verweigern die Arbeitsaufnahme weiterhin.
Sie werden zum Militärdienst verurteilt.
3. 12 1794 - Die Altgesellen solidarisieren sich
München * Die Altgesellen von 21 Zünften fordern die Zurücknahme des Urteilsspruchs gegen die verhafteten und zum Militärdienst verurteilten Schlossergesellen.
15. 12 1794 - Gesellen von 30 Zünften treten in den Streik
München * Nachdem der Magistrat und die inzwischen eingeschaltete Regierung die bis zu einem endgültigen Urteil geforderte Freilassung der inhaftierten Schlossergesellen verzögerten, treten die Gesellen von insgesamt dreißig Zünften in den allgemeinen Streik.
Der Kurfürst lässt ihnen daraufhin mitteilen, dass er in der Sache nicht nachgeben wird und sich die Gesellen umgehend an die Arbeit begeben und Gehorsam zeigen sollen.
16. 12 1794 - Der Streik weitet sich aus
München * Fast alle Zünfte schließen sich dem Streik an. Arbeitswillige Gesellen werden zum Teil mit Gewalt an ihrer Tätigkeit gehindert. Auch die Meister legen die Arbeit nieder. Zwischen 4.000 und 5.000 Handwerker streiken und gefährden damit die Versorgung Münchens.
17. 12 1794 - Der Streik der Gesellen und Meister eskaliert
München * Gesellen und Meister nehmen Ratsmitglieder im Rathaus fest und ziehen protestierend zur Residenz. Kurfürst Carl Theodor sieht sich zum Nachgeben gezwungen und gesteht den Handwerkern die Erfüllung ihrer Forderungen sofort zu. Die Inhaftierten werden umgehend in die Freiheit gelassen.
19. 12 1794 - Die zum Militärdienst verurteilten Gesellen werden wieder freigelassen
München * Die zum Militärdienst verurteilten Gesellen werden wieder freigelassen. Durch den Erfolg wächst das Selbstbewusstsein der Bevölkerung.
Um 1795 - Johann Jakob Paul kauft den „Kotterhof“
Haidhausen * Johann Jakob Paul, der „Großwirt“ von Haidhausen, kommt in den Besitz des „Kotterhofes“.
1795 - Josef Pruckmayr übernimmt die „Singlspielerbrauerei“
München-Angerviertel - Au * Katharina Messners Sohn aus erster Ehe, Josef Pruckmayr, übernimmt die „Singlspielerbrauerei“.
1795 - Ein neues Seidenhaus im Hofgarten
München-Graggenau * Kurfürst Carl Theodor lässt ein neues Seidenhaus am unteren Eingang des Hofgartens erbauen.
An dieser Stelle befand sich zuvor eine kostspielige Feigen-Baumpflanzung. Aus dem Gebäude wird später die Seidenhaus-Kaserne. Heute befindet sich an seiner Stelle die Bayerische Staatskanzlei.
Um den 6. 1 1795 - Die Vorzüge und Nachteile der Braut werden ausführlich beschrieben
Mailand * Graf Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil und Trauchburg trifft als von Kurfürst Carl Theodor beauftragter Brautwerber in Mailand ein. Die Braut, Maria Leopoldine, erhält ein reich mit Brillanten verziertes Porträt ihres künftigen Ehemannes.
Carl Theodor erhält einen Bericht seines Beauftragten, in dem die Vorzüge und Nachteile der Braut ausführlich beschrieben werden.
- Ihr Aussehen und ihre Charaktereigenschaften hebt der Brautwerber hervor, sodass der „kleine Defekt“ nicht ins Gewicht fällt: ihr linkes Bein war etwas kürzer als das rechte.
- Doch die Braut könne ohne Schwierigkeiten spazieren gehen und auch sei „im Tanzen von einer Ungemächlichkeit nicht das mindeste“ erkennbar.
- Durch eine Erhöhung des linken Stöckels an den Schuhen konnte dieser „Mangel“ letztlich aufgehoben werden.
1. 2 1795 - Der Heiratskontrakt wird unterzeichnet
München - Mailand * Der Heiratskontrakt für die Ehe zwischen dem baierischen Kurfürsten Carl Theodor und der Prinzessin Maria Leopoldine von Österreich-Este wird von den Bevollmächtigten unterschrieben.
- Das Heiratsgut wird auf 162.000 rheinische Gulden festgesetzt.
- Kurfürst Carl Theodor hat die gleiche Summe einzubringen und noch etwa 54.000 Gulden als „Morgengabe“ draufzulegen.
- Außerdem erhält die junge Kurfürstin zu Lebzeiten des Kurfürsten jährlich 30.000 Gulden in bar ausbezahlt.
- Das gesamte Geld wird angelegt und zu fünf Prozent verzinst.
Das soll ihr nach dem Ableben Carl Theodors jährlich etwa 17.000 Gulden einbringen.
4. 2 1795 - Kurfürst Carl Theodor gibt seine bevorstehende Heirat bekannt
München * Kurfürst Carl Theodor gibt in München seine bevorstehende Heirat mit Maria Leopoldine von Österreich-Este bekannt.
Um den 8. 2 1795 - Kurfürst Carl Theodor begibt sich nach Innsbruck
München - Innsbruck * Gut gelaunt und ausgeruht begibt sich Kurfürst Carl Theodor nach Innsbruck, wo er Maria Leopoldine von Österreich-Este ehelichen wird.
13. 2 1795 - Maria Leopoldine von Österreich-Este trifft in Innsbruck ein
Innsbruck * Maria Leopoldine von Österreich-Este trifft mit ihren Eltern und umfangreichem Gefolge in Innsbruck ein.
14. 2 1795 - Carl Theodor trifft erstmals mit seiner Braut zusammen
Innsbruck * Kurfürst Carl Theodor trifft erstmals mit seiner 18-jährigen Braut Maria Leopoldine von Österreich -Este, einer Enkelin Maria Theresias, und der erzherzoglichen Familie zusammen.
15. 2 1795 - Kurfürst Carl Theodor heiratet Maria Leopoldine von Modena-Este
Innsbruck * Der 70-jährige pfalzbaierische Kurfürst Carl Theodor heiratet am Faschingssonntag, um 18 Uhr, die 52 Jahre jüngere Maria Leopoldine von Österreich-Este.
Die Ehe wird im „Thronsaal der Innsbrucker Hofburg“ geschlossen.
Erzherzog Ferdinand, der Brautvater, bezahlt das „Heiratsgut“ von 162.000 rheinischen Gulden in einer Summe.
18. 2 1795 - Das ungleiche Brautpaar trifft in München ein
München * Das ungleiche Brautpaar - die 18-jährige „Landesmutter“ Maria Leopoldine und ihr 52 Jahre älterer Ehemann Kurfürst Carl Theodor - trifft am Nachmittag in München ein.
9. 3 1795 - Hunde dürfen nicht in die Kirche mitgenommen werden
München * Es ergeht ein wiederholtes Verbot, zur Mitnahme von Hunden in die Kirche.
12. 3 1795 - Bitte um Abschaffung der freien Ausfuhr des Getreides
München * Eine Delegation der Bürgerschaft und des Magistrats bittet den Kurfürsten um Abschaffung der freien Ausfuhr des Getreides. Da der fürs Finanzwesen zuständige Geheime Rat Stephan Freiherr von Stengel trotz der Beschwerden am Prinzip der freien Ausfuhr festhält, taucht in der selben Nacht ein aufrührerisches Flugblatt auf, dass den Freiherrn an den Galgen wünscht.
16. 3 1795 - Der freie Getreidehandel wird nicht aufgehoben
München * Trotz der unübersehbaren Unruhe unter der Bevölkerung lehnt Kurfürst Carl Theodor in einer landesherrlichen Erklärung die Aufhebung des freien Getreidehandels ab.
1. 4 1795 - Herzog Carl II. August von Pfalz-Zweibrücken stirbt
<p><strong><em>Mannheim</em></strong> * Herzog Carl II. August von Pfalz-Zweibrücken erliegt - vollkommen unerwartet - in Mannheim einem Schlaganfall. Er hinterlässt seinem Bruder Max Joseph, dem späteren ersten bayerischen König,</p> <ul> <li>ein von den Franzosen besetztes Land sowie</li> <li>einen Schuldenberg von neun Millionen Gulden.</li> <li>Dazu einen der fähigsten Staatsmänner, den Freiherrn Maximilian Joseph von Montgelas. </li> </ul>
5. 4 1795 - Preußen schließt mit Frankreich einen Separatfrieden
<p><em><strong>Basel - Berlin - Paris</strong></em> * Das Königreich Preußen schließt im Frieden von Basel mit Frankreich einen Separatfrieden und einen Neutralitätsvertrag - und lässt damit die anderen Reichsfürsten alleine. Außerdem wird in dem Vertrag das revolutionäre Frankreich als gleichberechtigte Großmacht anerkannt. </p>
13. 4 1795 - Das Kurfürstenpaar genießt das „Sankt-Vater-Bier“ in der Au
Au * Während seiner Flitterwochen besucht der 71-jährige pfalz-baierische Kurfürst Carl Theodor mit seiner frisch angetrauten 18-jährigen Frau Maria Leopoldine den Ausschank des „Sankt-Vater-Bieres“, ein Starkbier, im Paulaner-Kloster in der Au.
Drei Auer Bürger bitten den Landesherrn um die Abhaltung von zwei Jahrmärkten, als Ausgleich für die häufig zu erleidenden Hochwässer der Isar.
14. 4 1795 - Ein Armenversorgungshaus in der ehemaligen Sternwarte
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Die Brüder Peter Paul und Franz Joseph von Schneeweiß verkaufen die ehemalige Sternwarte an die Münchner Armendeputation. Diese will darin ein Armenversorgungshaus eröffnen.</p>
Um den 20. 4 1795 - Herzog Max Joseph besucht mit seiner Ehefrau Auguste München
<p><strong><em>München</em></strong> * Herzog Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld besucht mit seiner Ehefrau Auguste München. Der Herzog und die Kurfürstin Maria Leopoldine kommen sich dabei sehr nahe. </p> <p>Doch Kurfürst Carl Theodor hat seiner jungen Frau sehr früh deutlich gemacht, dass sie ruhig für Nachwuchs sorgen soll, egal wer der Vater ist, er werde ihn für <em>„legitim“</em> anerkennen. </p>
Um den 25. 4 1795 - Kurfürstin Maria Leopoldine erkrankt psychisch
München * Kurfürstin Maria Leopoldine erkrankt vermutlich psychisch.
Kurfürst Carl Theodor gibt ihr die Möglichkeit sich zurückzuziehen und ihm aus dem Weg zu gehen.
Um den 25. 5 1795 - „Es geht im Ehebett nicht ganz gut“
München - Wien * Der österreichische Gesandte berichtet dem Wiener Hof über die ehelichen Zustände des Kurfürstenpaares in München. Das Fazit lautet: „Es geht im Ehebett nicht ganz gut“. Vor Zeugen hat sich die jugendliche Kurfürstin und Ehefrau von Carl Theodor, Maria Leopoldine, künftig jede Annäherung ihres betagten Gattens, des baierischen Kurfürsten Carl Theodor, verbeten.
2. 6 1795 - München ist, kann und soll keine Festung sein
München * Kurfürst Carl Theodor macht deutlich, „daß München keine Festung seie, seyn könne noch seyn solle“.
11. 6 1795 - Herzog Max Joseph ernennt Montgelas zum Wirklichen Regierungsrat
Mannheim * Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, der Herzog ohne Land, ernennt den bisherigen Legationsrat Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas zum „Wirklichen Regierungsrat mit Sitz und Stimme im Herzoglichen Regierungscollegio“.
5. 8 1795 - Die Au will zur Carls-Vorstadt werden
Au * Die Auer stellen ein Gesuch, die Au als Carls-Vorstadt der Stadt München einzuverleiben.
9. 8 1795 - Eine festliche Veranstaltung im Englischen Garten
München-Englischer Garten * Aus Anlass der Vermählung des 70-jährigen pfalz-baierischen Kurfürsten Carl Theodor mit der 18-jährigen Erzherzogin Maria Leopoldine aus dem Hause Österreich-Este hält der kurfürstliche Hof im Englischen Garten eine festliche Veranstaltung ab. Ausgerichtet wird das Fest vom Reichsgrafen von Rumford.
Es gibt Lustfahrten auf dem See, einen „Tanz der neun Musen“ im Apollotempel, die „Vorstellung einer baierisch-ländlichen Nationalhochzeit“, Musik und Tanz und viele andere Vergnügungen. Zum Ausklang wird der ganze Park mit tausenden Lampions beleuchtet. Außerdem hält ein „Chinese im Nationalkostüm“ eine Huldigungsrede für das Kurfürstenpaar.
Die jugendliche „Landesmutter“ ist jedoch durch „eine Unpässlichkeit an der Teilnahme verhindert“.
23. 9 1795 - Einige Hundert verärgerte Münchner fordern eine Getreide-Ausfuhrsperre
München • Nachdem zwei Tage zuvor das Gerücht in Umlauf gesetzt worden war, dass mehrere Tausend Scheffel Getreide ausgeführt werden sollen, versammeln sich einige Hundert verärgerte Menschen vor dem Rathaus und fordern vom Magistrat das energische Eintreten für eine Getreide-Ausfuhrsperre.
Eine Delegation begibt sich zum Kurfürsten, der wegen der Vorgänge einen Theaterbesuch absagen muss und schon deshalb zu hartem Vorgehen entschlossen ist. Er lässt seine Truppen in Alarmbereitschaft versetzen, die Stadttore verschließen und in den Straßen berittenes Militär patroullieren.
Auf Vermittlung der Kurfürstin-Witwe Maria Anna empfängt Carl Theodor die Delegation.
Obwohl der Kurfürst die Verhandlungen verzögern möchte, können die Bürgervertreter dennoch Sofortmaßnahmen durchsetzen.
24. 9 1795 - Ausfuhrverbot für Getreide wird durchgesetzt
München * Das lange geforderte landesweite Ausfuhrverbot für Getreide, gemästetes Hornvieh, Schafe und Schweine wird umgesetzt. Dadurch verbessert sich die Angebotssituation und die Preise sinken.
13. 10 1795 - Reichsgraf von Rumford geht nach London
München - London * Mit der Erlaubnis des baierischen Kurfürsten Carl Theodor verlässt Sir Benjamin Thompson, Reichsgraf von Rumford, München in Richtung London.
4. 12 1795 - Carl Theodor akzeptiert das aufständische Verhalten der Bürger nicht
München * Trotz seiner Nachgiebigkeit ist der Kurfürst nicht gewillt, das aufständische Verhalten der Münchner Bürgerschaft zu akzeptieren. Eigens lässt er die Dragoner und das Leibregiment der verstorbenen Kurfürstin Elisabeth Auguste von Mannheim nach München verlegen.
Außerdem werden vier Verdächtige und als Revolutionsfreunde denunzierte Handwerker verhaftet. Sie waren angeblich die Haupträdelsführer der Vorgänge im 23. September 1793.
9. 12 1795 - Appell an die Großmut und Gnade des Kurfürsten
München * Der Stadtmagistrat appelliert an die Großmut und Gnade des Kurfürsten und bittet um Freilassung der vier als Haupträdelsführer verhafteten Handwerker.
30. 12 1795 - Unbefristeter Waffenstillstand mit Frankreich
Kreutznach * Österreich und seine süddeutschen Verbündeten vereinbaren mit Frankreich einen unbefristeten Waffenstillstand auf dem deutschen Kriegsschauplatz. Preußen tritt aus der Koalition aus.
1796 - Es hat den Anschein, „die ganze Au sei in der Stadt gewesen“
Au - München * Nach einer Stadtbeschreibung hat es an den Abenden den Anschein, „die ganze Au sei in der Stadt gewesen“.
1796 - Das „Kloster am Lilienberg“ von den „Kaiserlichen“ besetzt
Au * In den Auseinandersetzungen des „Ersten Koalitionskrieges“ wird das „Kloster am Lilienberg“ von den „Kaiserlichen“ besetzt und deshalb von den Franzosen beschossen.
1796 - Das „Rumford-Denkmal“ im „Englischen Garten“
München-Englischer Garten - Lehel * Das „Rumford-Denkmal“ im „Englischen Garten“ wird noch zu Lebzeiten Benjamin Thompson durch Franz Schwanthaler d.Ä. aus Kalktuff, Sandstein und Marmor geschaffen und befindet sich im Südteil des Parks.
1796 - „Über Speise und vorzüglich über Beköstigung der Armen“
München * Graf von Rumfords Essay „Über Speise und vorzüglich über Beköstigung der Armen“ erscheint.
Darin gibt er viele vernünftige und praktische Ratschläge zur Zubereitung von Speisen.
1796 - Ferdinand Leopold von Adrian-Werburg kauft den „Edelsitz Pilgramsheim“
Untergiesing * Franz Anton von Pilgram verkauft seinen „Edelsitz Pilgramsheim“ an den „Reichsfreiherrn“ Ferdinand Leopold von Adrian-Werburg.
1796 - Giovanni Pietro Sarti stirbt - Aloysia Lampert erbt
München-Graggenau * Giovanni Pietro Sarti stirbt unverheiratet.
Seine Haushälterin „Madame“ Aloysia Lampert übernimmt sein „Kaffeehaus“ an der „Hofgartenmauer vor der Reitschule“.
Um 1 1796 - Die französische Armee dringt bis nach Österreich vor
Paris * Die französische Republik stellt drei Armeen auf.
Diese dringen unter Napoleon Bonaparte über Norditalien, unter Baptiste Jourdan durch Franken und unter Jean-Victor Moreau durch Süddeutschland bis nach Österreich vor, um dort den Frieden zu erzwingen.
9. 1 1796 - Die vier Haupträdelsführer werden ohne Gerichtsurteil freigelassen
München * Da sich die Vorwürfe gegen die vier als Haupträdelsführer verhafteten Handwerker nicht erhärten lassen, werden sie ohne Gerichtsurteil wieder freigelassen.
12. 1 1796 - Eine Polizeioberdirektion für München und die Au wird eingerichtet
München - Au * In einem Mandat macht Kurfürst Carl Theodor deutlich, dass er Ereignisse wie im vergangenen Herbst (23. September 1795) nicht mehr tolerieren wird. Es wird eine Polizeioberdirektion für München und die Au eingerichtet.
Neben der Verhaftung von Verbrechern hat die Polizeioberdirektion die Aufgabe „alle tumultuarischen Aufläufe, Rumoren, und dergleichen sogleich mit aller Thätigkeit abzustellen, [...] vorzüglich aber auch den für die allgemeine Ruhe und Sicherheit verdächtigen, geheimen, oder öffentlichen Zusammenkünften mit aller Wachsamkeit nachzuspüren, und selbe gleich bey ihrem ersten Entstehen mit allem Ernste, jedoch auch mit der hiebey benöthigten Klugheit und Vorsichtigkeit zu zernichten“.
Zu diesem Zweck soll die Polizeioberdirektion regelmäßige Kontrollstreifen und Hausdurchsuchungen in München und der Au durchführen. 32 Mann Polizeiwache stehen ihr dafür zur Verfügung.
30. 3 1796 - Herzogin Auguste Wilhelmine Maria von Hessen-Darmstadt stirbt
Rohrbach * Auguste Wilhelmine Maria von Hessen-Darmstadt stirbt in Rohrbach bei Heidelberg.
6. 4 1796 - Das Armenversorgungshaus auf dem Gasteig wird bezogen
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Im Armenversorgungshaus auf dem Gasteig werden die ersten Pfründner untergebracht.</p>
21. 5 1796 - Der Waffenstillstand mit Frankreich wird aufgekündigt
Wien - Paris - München * Kaiser Franz II. kündigt den Waffenstillstand mit Frankreich wieder auf. Daraufhin ergreift Kurfürst Carl Theodor Partei gegen Frankreich, um Österreich keinen Vorwand zu einer Intervention zu bieten.
24. 6 1796 - Die Revolutionsarmee überschreitet den Rhein
Frankreich - München * Als Jean-Victor Moreau mit seiner 78.000 Mann starken französischen Revolutionsarmee den Rhein überschreitet, bricht in München eine Panik aus, da man nun eine baldige Besetzung der baierischen Hauptstadt befürchtet.
27. 7 1796 - Verhaltensinstruktionen im Falle eines Einmarsches fremder Truppen
München * Die Obere Landesregierung erlässt für die Beamten Verhaltensinstruktionen im Falle eines Einmarsches fremder Truppen. Österreicher und Franzosen [Freund und Feind] werden darin gleichgestellt.
28. 7 1796 - Die französischen Emigranten müssen das Land verlassen
München * Die bis dahin in München und dem restlichen Baiern geduldeten französischen Emigranten müssen das Land verlassen.
1. 8 1796 - München erstmals mit Kriegsereignissen konfrontiert
München * Die Bewohner der Residenzstadt München werden erstmals mit den Kriegsereignissen konfrontiert. Truppendurchmärsche sind jetzt an der Tagesordnung. Der Hass auf die verbündeten Österreicher übersteigt bei vielen Münchnern die Angst vor den herannahenden Revolutionssoldaten.
Die größte Abneigung hegt die Bevölkerung gegen die Condéischen Soldaten, die „in elenden Aufzügen“ durch München ziehen. Es handelt sich dabei um Hilfstruppen französischer Emigranten, zumeist aus dem Adelsstand, die unter dem Kommando des Prinzen Louis-Joseph de Condé stehen und sich nach den Niederlagen der letzten Tage in Auflösung befinden. Sie zeichnen sich durch außerordentliche Disziplinlosigkeit und besonders rücksichtsloses Betragen gegenüber der Zivilbevölkerung aus, das bis hin zu Misshandlungen und Plünderungen reicht.
9. 8 1796 - Kurfürstin-Witwe Maria Anna flüchtet nach Dresden
Dresden * Die Kurfürstin-Witwe Maria Anna flüchtet in ihre Heimatstadt Dresden.
12. 8 1796 - Kurfürst Carl Theodor erklärt Pfalz-Baiern zu „neutralem Gebiet“
München * Kurfürst Carl Theodor erklärt Pfalz-Baiern zu „neutralem Gebiet“.
13. 8 1796 - Graf Rumford wieder in München
München * Graf Rumford trifft wieder in München ein. Inzwischen hat Kurfürst Carl Theodor eine Kriegsdeputation unter dem Vizekanzler Franz von Pettenkofer und ein Landesdirektorium unter der Leitung des Freiherrn von Hertling eingerichtet. Damit können für die Kriegsdauer bei Abwesenheit des Herrschers die Staatsgeschäfte wahrgenommen werden.
18. 8 1796 - München wird von allen Seiten belagert
München * Die französischen Revolutionstruppen unter Jean-Victor Moreau nehmen München ein und besetzten das linke Isarufer. Der französische Befehlshaber Moreau gibt der Münchner Stadtbevölkerung die Zusage, dass die Stadt verschont bleibt. Zum Ausgleich plündern sie allerdings die umliegenden Dörfer.
Als Verteidiger belagern die Kaiserlichen und die Condéer das rechtsseitige Isarhochufer. Die Kämpfe dauern bis zum 8. September. Durch einen - von den Österreichern verursachten - Brand wird die Häuserzeile in der Kirchenstraße, vom Hofmarkschloss bis zum Mesmerhaus, in Schutt und Asche gelegt. Den geschundenen Vorstädtern ist es freilich vollkommen egal, ob sie ein Condéer terrorisiert, ein Österreicher drangsaliert oder ein Franzose ausplündert.
22. 8 1796 - Kurfürst Carl Theodor flieht als Graf von Haag nach Pillnitz
München - Schloss Pillnitz * Kurfürst Carl Theodor flieht - mit kleinem Gefolge und inkognito unter dem Namen eines Grafen von Haag - über Altötting, Linz und Prag nach Schloss Pillnitz, das von der sächsischen Verwandtschaft zur Verfügung gestellt wird.
26. 8 1796 - Bitte um Gnade für München
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Die kaiserlichen Truppen sperren die Isarbrücke. Gleichzeitig reitet eine sechsköpfige Delegation unter der Führung von Bürgermeister Philipp von Hepp der herannahenden französischen Revolutionsarmee entgegen und bittet um Gnade für München.
29. 8 1796 - München soll verschont bleiben
München * Die Delegation erhält vom französischen Oberbefehlshaber Jean-Victor Moreau die Zusage, dass München verschont wird und keine Gefahr für das Leben und das Eigentum der Bevölkerung besteht.
9 1796 - Herzog Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken flieht ins preußische Ansbach
Mannheim - Ansbach * Herzog Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken muss aus Mannheim fliehen und begibt sich - auf Einladung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. - in das seit dem Jahr 1791 preußische Ansbach.
Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas übernimmt die Leitung der Geschäfte und macht sich bald zum unentbehrlichen Ratgeber und Vertrauten des Herzogs.
1. 9 1796 - Revolutionstruppen wollen die Isarbrücke erstürmen
Haidhausen - München-Lehel * Die französischen Revolutionstruppen versuchen den ganzen Tag über vergeblich, die Isarbrücke zu erstürmen.
2. 9 1796 - Bürgermeister Philipp von Hepp kann wieder nach München zurückkehren
München * Die sechsköpfige Delegation unter der Führung von Bürgermeister Philipp von Hepp kann nach den Verhandlungen mit der französischen Revolutionsarmee wieder nach München heimkehren.
7. 9 1796 - Neuer Sturm auf die Isarbrücke
München - Pfaffenhofen * Die französische Revolutionsarmee eröffnet einen neuen Sturm auf die Isarbrücke. Zur gleichen Zeit handeln die Baierischen Landstände mit den Franzosen in Pfaffenhofen einen Waffenstillstand aus.
8. 9 1796 - Die Kämpfe um die Isarbrücke gehen weiter
München * Die Kämpfe um die Isarbrücke zwischen den französischen Revolutionstruppen und den Kaiserlichen gehen weiter. Die österreichische Armee schießt vom Isarhochufer auf München. Dabei erhält die Peterskirche zwei Treffer.
Auch einige Holzstöße im Lehel, hinter denen sich die Franzosen verschanzen, werden durch den Schusswechsel in Brand gesetzt. Das Feuer breitet sich auf benachbarte Gebäude und den durch Kanonenbeschuss bereits beschädigten Roten Turm aus - und zerstört ihn endgültig.
11. 9 1796 - Enteignungsmaßnahmen für die Rumfordstraße
München * Noch vor dem Abzug der französischen Revolutionsarmee und dem Kaiserlichen Heer lässt sich Reichsgraf von Rumford vom Landesdirektorium für die notwendigen Gegenmaßnahmen für rasche Truppendurchzüge ermächtigen. Gleichzeitig wird eine Kommission zur finanziellen Entschädigung der enteigneten Grundstücksbesitzer gebildet.
12. 9 1796 - Die Revolutionsarmee zieht sich aus Münchens zurück
München * Die französische Revolutionsarmee zieht sich aus der Umgebung Münchens zurück. Nur wenige Stunden später folgen ihnen auch die Österreicher und die Condéer. Durch den raschen Rückzug wird die Stadt von einer drohenden Hungersnot erlöst.
15. 9 1796 - Die Bauarbeiten für die heutige Rumfordstraße beginnen
München-Isarvorstadt * Graf Rumford lässt durch Militärkolonnen mit Arbeiten an einer Ringstraße, die heutige Rumfordstraße, beginnen. Er will das Gelände im unmittelbaren Vorfeld der Wälle räumen und zur leichteren Umfahrung der Stadt eine breite, verkehrstüchtige Straße anlegen lassen.
Noch bevor die Besitzer protestieren und ihre bewegliche Habe in Sicherheit bringen können, werden die auf der geplanten Trasse liegenden Gartengrundstücke enteignet. Nicht einmal die Ernte ihrer Anpflanzungen dürfen sie noch einholen.
So entsteht vor den Stadttoren die erste Umfahrung Münchens. Weil die Ringstraße als militärisch Straßenanlage begründet worden war, wehrt sich der Magistrat erfolgreich gegen jede finanzielle Beteiligung. Auch, als man die Straßenanlage als wesentlichen Beitrag zur Verschönerung Münchens ansah.
20. 9 1796 - Lebensmittelreserven werden angehäuft
München-Angerviertel * Im Stadthaus am Anger wird ein Getreidemagazin eingerichtet, das die Anlage von Lebensmittelreserven erleichtert.
29. 9 1796 - Rumford übernimmt das militärische Oberkommando in München
München * Auf Anordnung des Landesdirektoriums übernimmt Graf Rumford das militärische Oberkommando in München.
30. 9 1796 - Freiherr von Montgelas erarbeitet das umfangreiche Ansbacher Mémoire
Ansbach * Freiherr Maximilian Joseph von Montgelas legt Herzog Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken das „grundlegende Reformprogramm für die künftige Regierung des Kurfürstentums Baiern“ vor. Es trägt entscheidend zur Vertiefung des Vertrauensverhältnisses zwischen dem Herzog und dem Freiherrn bei.
Das Ansbacher Mémoire ist ein Konzept zur Anpassung der baierischen Verfassungs- und Verwaltungsverhältnisse an die Gegebenheiten der neuen Zeit. Auf sieben eigenhändig geschriebenen Doppelblättern beschreibt Montgelas die herrschenden Verhältnisse in Baiern und schlägt gleichzeitig Maßnahmen vor, die - nach seiner Meinung - für eine effektive und nach den Gesichtspunkten der Aufklärung gebildete Staatsverwaltung notwendig sind. Im Kern der Reformen fordert der Freiherr
- eine klar gegliederte Ministerialorganisation mit abgegrenzten Zuständigkeiten,
- eine neue Verwaltungsgliederung mit einheitlichen Instanzenwegen in Gesamtbaiern;
- eine gut ausgebildete, unbestechliche, ausreichend bezahlte und sozial abgesicherte Beamtenschaft;
- die steuerliche Gleichbehandlung aller Menschen;
- die Unabhängigkeit der Richter,
- die Trennung von Justiz und Verwaltung,
- die Überantwortung aller judikativen Bereiche in staatliche Oberaufsicht,
- die Reform des Straf- und Zivilrechts;
- die Möglichkeit für die Bauern, adeliges Obereigentum an Grund und Boden abzulösen;
- die Beschränkung der Kirche auf den religiösen Bereich,
- die Aufhebung der Bettelorden und die bessere Nutzbarmachung der Klöster;
- die religiöse Toleranz;
- die Aufhebung der Zensur;
- die Verbesserung der Universitäten und Schulen.
- In einer übergeordneten Instanz soll die Zusammenarbeit der Ministerien gefördert werden und eine Koordination der Einzelmaßnahmen erfolgen.
Am Ende steht ein geschlossenes Staatsgebiet, in dessen Ministerien sich alle staatliche Macht vereint.
Darüber hinaus will Montgelas ein baierisches, patriotisches Empfinden wecken, um die örtlichen Gebundenheiten des Einzelnen abzulösen und statt dessen eine Identifikation mit dem Kurfürstentum, später Königreich, herbeiführen.
Die Forderung nach einer Volksvertretung - nicht nur einer Ständeversammlung - wiederholt Montgelas im Ansbacher Mémoire nicht mehr. Wohl aber die Gleichheit aller vor dem Gesetz und die Abschaffung der Steuerprivilegien des Adels. Seine Adelspolitik nimmt später weitaus konservativere Züge an, vor allem nachdem er im Jahr 1803 selbst Grundbesitz erworben hat.
10 1796 - Montgelas: „Baiern ist das irdische Paradies Deutschlands
Ansbach * Freiherr Maximilan Joseph von Montgelas schreibt:
„Der sicherste Beweis dafür, dass Baiern das irdische Paradies Deutschlands ist, liegt in der Tatsache, dass diese Provinz [...] bisher imstande gewesen ist, eine Regierung zu ertragen, die allgemein als die schlechteste aller schlechten Regierungen Europas anerkannt ist“.
5. 10 1796 - Kurfürst Carl Theodor wieder in München
München * Kurfürst Carl Theodor kehrt von seiner Flucht nach Pillnitz wieder in seine baierische Haupt- und Residenzstadt zurück und wird von einer großen Menschenmenge - aber ohne jeden Beifall und Jubel - begrüßt.
6. 10 1796 - Das Landesdirektorium wird vom Kurfürsten wieder entlassen
München * Kurfürst Carl Theodor entlässt das Landesdirektorium, das in seiner Abwesenheit die Regierungsgeschäfte führte, wieder aus seiner Verantwortung.
17. 10 1796 - Graf Rumford wird Polizeiminister
München * Graf Rumford legt das Oberkommando über die Stadt nieder und wird Polizeiminister.
1797 - Ein „Weyher“ in der Nähe des heutigen „Wasserfalls“
München-Englischer Garten - Lehel * In der Nähe des heutigen „Wasserfalls“ im „Englischen Garten“ wird ein „Weyher“ angelegt.
17. 2 1797 - Die Kurfürstenwitwe Maria Anna Sophie stirbt in München
München-Kreuzviertel * Die Kurfürstenwitwe Maria Anna Sophie stirbt in München. Sie wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche beigesetzt.
9. 3 1797 - Herzog Max Joseph heiratet Caroline Friederike Wilhelmine von Baden
Karlsruhe * Max Joseph, der spätere baierische König, heiratet in Karlsruhe Caroline Friederike Wilhelmine von Baden.
16. 5 1797 - Die Rumfordchaussee wird dem Verkehr übergeben
München-Isarvorstadt * Die von Reichsgraf Rumford projektierte Ringstraße wird dem öffentlichen Verkehr übergeben. Auf der Trasse des heutigen Wittelsbacher Platzes, der Ottostraße, der westlichen Fahrbahn der Sonnenstraße, der Müllerstraße und der Rumfordstraße ist ein etwa 14 Meter breiter Damm angelegt worden. Zu ihrer Verschönerung wird die Straße zu beiden Seiten mit Pappeln bepflanzt.
Auf den nordöstlichen Abschnitt der Rumfordchaussee wird wegen der komplizierten Besitzverhältnisse im Lehel und dem unsicheren Gelände verzichtet.
27. 5 1797 - Reinhard Freiherr von Werneck tritt in baierische Dienste
München * Reinhard Freiherr von Werneck tritt als General-Leibadjutant und Oberst der Invanterie für ein Jahresgehalt von 400 Gulden in baierische Dienste.
14. 6 1797 - Reinhard Freiherr von Werneck muss den vorgeschriebenen Schwur leisten
München * Reinhard Freiherr von Werneck muss den vorgeschriebenen Schwur leisten, dass er nicht dem radikal aufklärerischen - und deshalb verbotenen - Geheimbund der Illuminaten angehört.
13. 10 1797 - Keine Veränderungen an den Schutzfunktionen der Stadtbefestigung
München * Um die Schutzfunktionen der Stadtbefestigung nicht vollständig aufzugeben, ordnet Kurfürst Carl Theodor an, dass im Bereich der Wälle und des Glacis keine Veränderungen mehr vorgenommen werden dürfen.
17. 10 1797 - Österreich schließt mit Frankreich einen Separatfrieden
Campo Formio * Österreich schließt mit Frankreich in Campo Formio einen Separatfrieden. In einem geheimen Zusatzabkommen wird Frankreich das linke Rheinufer zugestanden. Österreich erwirbt dafür Gebiete östlich des Inns, was eindeutig zu Lasten Baierns geht.
9. 12 1797 - Der Friedenskongress in Rastatt beginnt
Rastatt * Der Friedenskongress in Rastatt beginnt.
1798 - Die verbliebenen Reste des „Roten Turms“ werden beseitigt
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Die verbliebenen Reste des „Roten Turms“ werden beseitigt.
Übrig bleibt nur der nördliche der beiden Anbauten, der den Abbruch fast 100 Jahre überdauert.
1798 - Die erste große „Industrieausstellung“ findet in Paris statt
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Die erste große <em>„Industrieausstellung“</em> findet in Paris statt. Bewusst stellt man einen Bezug zur Französischen Revolution von 1789 her und will die engen Zusammenhänge zwischen der politisch-gesellschaftlichen und technisch-wirtschaftlichen Revolution darstellen und zeigen, zu welchen Leistungen der <em>„befreite menschliche Erfindungsgeist“</em> fähig sei.</p>
Um 1798 - Adrian von Riedl kauft ein trockengelegtes ödes Land
München-Englischer Garten - Lehel * Adrian von Riedl, der zuvor mit zwei Dämmen das weitverzweigte Wildflussbett der reißenden Isar zwischen Lehel und Ismaning gebändigt hatte, kauft einen Teil des von ihm trockengelegten ehemaliges Isarbetts, das als „ödes Land“ vom Kurfürst Carl Theodor freigegeben wurde.
Zunächst lässt er sich zwischen „Eisbach“ und „Schmiedbach“, am Rande des „Englischen Gartens“ ein stattliches Palais erbauen, das er mit einem kleinen „Englischen Garten“ mit allerlei Zubehör umgibt.
Sogar eine Brunnquelle, eine „Gloriette“ und ein kleiner „Chinesischer Turm“ dürften nicht fehlen.
Aus dieser Anlage entsteht später der „Paradiesgarten“, ein beliebtes Ausflugslokal.
Um das Jahr 1798 - Adam Freiherr von Aretin kauft ein „ödes“ Grundstück
München-Englischer Garten - Lehel * „Vizekanzler“ Adam Freiherr von Aretin kauft ein „ödes“ Grundstück an der Ostseite des „Englischen Gartens“ und baut dort einen Sommersitz mit zwei kleinen Häusern und einem „Lustgarten“ im französischen Stil.
1798 - Der „Edelsitz Pilgramsheim“ wird in der „Frankfurter Lotterie“ ausgespielt
Untergiesing * „Reichsfreiherr“ Ferdinand Leopold von Adrian-Werburg lässt den „Edelsitz Pilgramsheim“ in der „Frankfurter Lotterie“ ausspielen.
Gewinner der Lotterie ist der „churtrierische Kammerherr“ von Horben.
1798 - Münchens Gemäldesammlung vergrößert sich
Mannheim - München * Kurfürst Carl Theodor lässt 758 Bilder seiner Mannheimer Sammlung nach München bringen.
Er will die Gemälde vor den anrückenden Franzosen schützen.
27. 1 1798 - Neuorganisation des gesamten Polizeiwesens in München
München * Die Polizeioberdirektion wird wieder aufgehoben und die Neuorganisation des gesamten Polizeiwesens der Haupt- und Residenzstadt an Sir Benjamin Thompson als Polizeidirektor übertragen.
5 1798 - Die erste „Auer-Dult“ findet in der Lilienstraße statt
Au * Die erste „Auer-Dult“ findet in der Lilienstraße statt.
Erst ab dem Jahr 1799 wechseln sie auf den Mariahilfplatz.
11. 7 1798 - Kein Minutoverschleiß von Bier am Gasteig und am Lilienberg
München - Haidhausen - Au * Die Oberlandesregierung fordert den Magistrat eindringlich dazu auf, keinerlei „Minutoverschleiß“ von Bier, gemeint ist die mass- und halbmassweise Abgabe des Gerstensafts, am Gasteig und am Lilienberg zuzulassen. Auch darf das Bier nicht in den kleineren Halbeimer-Fässern [= 30 Mass] abgegeben werden.
24. 7 1798 - Die Rumford-Mühlen am Eisbach
München-Englischer Garten * Kurfürst Carl Theodor lässt 2.000 Gulden zum Bau der an der Kreuzung von Schwabinger Bach und Eisbach gelegenen Militär-Mühlen oder Rumford-Mühlen zur Verfügung stellen. Es handelt sich um eine Sägemühle und eine Mahlmühle für das Getreide des von Benjamin Thompson Verbesserten Kommissbrotes.
19. 8 1798 - Rumford wird Bevollmächtigter Minister Baierns am Großbritannischen Hof
München - London * Sir Benjamin Thompson Reichsgraf von Rumford wird zum „Bevollmächtigten Minister Baierns am Kgl. Großbritannischen Hofe“ ernannt und verlässt deshalb Baiern. Die Oberaufsicht über den Ausbau des Englischen Gartens gibt er gleichzeitig an seinen Nachfolger Reinhard Freiherr von Werneck ab.
19. 9 1798 - Rumford tritt in London seinen neuen Job an
London * Sir Benjamin Thompson, Reichsgraf von Rumford, tritt in London seinen neuen Job als Baierischer Generalbevollmächtigter an.
10 1798 - Errichtung einer süddeutschen Republik mithilfe französischer Bajonette
München * Eine auf 29 Seiten gedruckte anonyme Schrift taucht auf.
Ihr Titel: „Über Süddeutschland. Von einem süddeutschen Bürger im Oktober 1798 dem französischen Gouvernement zur Beherzigung vorgelegt“.
Der Verfasser versichert darin: „es Bedarf nur der französischen Bajonette, und in der Zeit von vier Wochen sind sie ins Herz von Baiern vorgedrungen und in München als dem Hauptplatz und wo alles am meisten reif und bereitsteht. Dann entwickelt sich alles von selbst“.
Frankreich soll Pate sein für ein neues staatliches System in Baiern.
11 1798 - Freiherr von Werneck erhält die „Intendanz des Englischen Gartens“
München-Englischer Garten * „Zur Ausfüllung seiner Mußestunden“ erhält Reinhard Freiherr von Werneck die „Intendanz des Englischen Gartens“ übertragen.
12. 11 1798 - Eine neue Koalition schließt sich zusammen
München * Im Verlauf des Jahres schließen sich England, Russland, Portugal, das Osmanische Reich und Österreich zu einer weiteren Koalition zusammen. Pfalz-Baiern tritt dieser Verbindung ebenfalls bei und unterstellt 15.000 Soldaten dem österreichischen Oberbefehl.
16. 11 1798 - Kurfürst Carl Theodor ist Kunde des Leihhauses
München * Selbst der baierische Regent und Herrscher ist Kunde des Leihhauses. Kurfürst Carl Theodor gibt an diesem Tag der magistratischen Leihhauskommission folgenden Befehl:
„Seine Churfürstliche Durchlaucht haben sich in der Verlegenheit, in welcher sich die Staatskassa bey dem schon so lange dauernden Krieg befindet, zur Verhütung größerer Übel bemüssigt gefunden, einen Teil des Schatzes der heiligen Kapelle in Altötting hierher bringen zu lassen, um auf denselben als Faustpfand schnell ein angemessenes Anlehen aufzubringen und Höchst dieselbe hat sich zu diesem Ende entschlossen, diesen bloss in Gold und Juwellen bestehenden Teil des Schatzes dem hiesigen, unter landesfürstlicher Oberaufsicht und Protektion stehenden Leihhaus, jedoch mit dem gegenwärtig schärfsten Befehle zu übergeben und aushändigen zu wollen, daß hievon nicht das mindeste veräußert oder verschmolzen werde, sondern sich das Leihhaus wegen gleichzeitiger und hiemit feyerlich erklärt werdender Mitverpfändung aller Churfürstlichen Renten und Gefälle mit dem richtigen Bezuge der jährlichen Zinsen sich begnügen solle und müsse.“
Durch die kurfürstliche Inanspruchnahme der Pfandleihanstalt ist die Kapitaldecke der Einrichtung allerdings wiederholt derart dünn geworden, dass Hilfesuchende aus den ärmeren Schichten oftmals abgewiesen werden mussten.
27. 12 1798 - Das Hundeverbot in den Kirchen wird erneuert
München * In einer Polizei-Erinnerung wird erneut verboten, Hunde in die Kirche mitzubringen. Begründet wird das Verbot mit der „schuldigen Ehrerbietung“ in den „Gott geheiligten Häusern“.
1799 - Die Klosterbrauerei der Paulaner kommt unter staatliche Aufsicht
Au * Die Klosterbrauerei der Paulaner kommt unter staatliche Aufsicht.
Ab 1799 - Zwischen 1799 und 1815 ist Baiern an sieben Kriegen beteiligt
München * Zwischen 1799 und 1815 ist Baiern an 7 Kriegen beteiligt, in denen Tausende baierischer Soldaten kämpfen und viele ihr Leben lassen müssen.
1799 - Eine Mädchenschule bei den „Benediktinerinnen am Lilienberg“
Au * Angesichts der drohenden „Säkularisation“ richten die „Benediktinerinnen am Lilienberg“ eine Mädchenschule im Kloster ein, um so ihr Überleben zu sichern.
1799 - Das Geheimnis eines guten Bieres herausfinden
München * Die baierische Staatsregierung schreibt ein Preisausschreiben aus.
Die erste Frage lautet: „Da die Bestandtheile des Biers Malz, Hopfen und Wasser sind, welches ist das nothwendige Verhältnis dieser Theile, damit das Bier gut genannt werden kann“.
1799 - Aron Elias Seligmann kommt nach München und wird „Hofagent“
Leimen - München * Aron Elias Seligmann aus Leimen bei Heidelberg kommt nach München und wird dort kurbaierischer „Hofagent“.
Seligmann betreibt seit 1779 eine Tabakmanufaktur und ist durch den Salzhandel sehr reich geworden.
In München ist er „Verpflegungsadmoniateur“ der baierischen Armee und „Anleihennegoziant“.
31. 1 1799 - Das Bücherzensurkollegium wird aufgelöst
München * Das im Jahr 1769 geschaffene Bücherzensurkollegium wird aufgelöst.
12. 2 1799 - Kurfürst Carl Theodor erleidet einen Schlaganfall
München-Graggenau * Gegen 21 Uhr erleidet Kurfürst Carl Theodor einen Schlaganfall, während er mit mit seinem Generaladjutanten Freiherr Friedrich von Hertling und dem Oberstjägermeister Theodor Reichsgraf von Waldkirch Karten spielt.
13. 2 1799 - Die Kurfürstin unterstützt das Haus Wittelsbach-Zweibrücken
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Der Vertreter des kaiserlichen Hauses, Joseph Anton August Graf von Seilern, eilt mit einem unterschriftsreifen <em>„Tauschvertrag“ </em>ans Sterbebett von Carl Theodor, um von dem Baiernherrscher in einem günstigen Moment doch noch die begehrte Unterschrift zu erhalten. Es ist die Kurfürstin, die ihn persönlich daran hindert, das Krankenzimmer zu betreten.</p> <p>Im Gegensatz dazu führt Maria Leopoldine Herzog Wilhelm von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen, der die Interessen von Pfalz-Zweibrücken vertritt, sofort in das Gemach des sterbenden Kurfürsten Carl Theodor. </p>
16. 2 1799 - Kurfürst Carl Theodor stirbt
München-Graggenau * Kurfürst Carl Theodor erliegt am Abend seinem am 12. Februar erlittenen Schlaganfall. Herzog Wilhelm von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen wohnt als Zeuge dem Tod des pfalz-baierischen Regenten bei.
Protokollarisch wird die 22-jährige Kurfürstin-Witwe von Herzog Wilhelm und vom Vertreter des kaiserlichen Hauses, Joseph Anton August Graf von Seilern, befragt, ob sie ein Kind vom verstorbenen Kurfürsten erwartet. Maria Leopoldine antwortet daraufhin mit einem klaren „Nein!“. Mit dieser Aussage entzieht sie den Österreichern die Gelegenheit, Baiern auf friedlichem Weg an sich zu ziehen.
Bei den Münchnern ruft das Ableben des Kurfürsten keine allzu große Trauerstimmung hervor. Im Gegenteil, als sich die Trauernachricht verbreitet, „frohlockte alles, und jeder wünschte dem anderen Glück“, schreibt Lorenz von Westenrieder.
Carl Theodors Nachfolger auf dem baierischen Thron wird Kurfürst Max IV. Joseph aus der wittelsbachischen Linie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, von dem sich die Baiern eine ganze Menge erwarten und der unter dem Jubel der Bevölkerung in München einzieht.
20. 2 1799 - Kurfürst Max IV. Joseph zieht umjubelt in München ein
München * Der neue Kurfürst Max IV. Joseph zieht unter dem Jubel der Bevölkerung in München ein. Der Neue will sich von seinem Vorgänger positiv abheben, aber auch das Land verändern. Er vertraut seinem Berater Maximilian Joseph von Montgelas und lässt ihn nach eigenem Ermessen schalten und walten.
Für Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas bedeutet das die Chance, das Kurfürstentum Pfalz-Baiern zu einem modernen Staat umzubauen. Da Kurfürst Max IV. Joseph stark zur Bequemlichkeit neigt, kommt ihm das Engagement Montgelas gelegen. Montgelas übernimmt bis 1817 die Aufgaben eines Ministers der Auswärtigen Geschäfte.
21. 2 1799 - Montgelas übernimmt das Département der Auswärtigen Angelegenheiten
München * Kurfürst Max IV. Joseph überträgt Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas als Geheimer Staats- und Konferenzminister das Département der Auswärtigen Angelegenheiten. Damit ist Montgelas Kabinettschef, weil es das Amt des Ministerpräsidenten noch nicht gibt.
28. 2 1799 - Johann Joseph Ignaz Döllinger wird in Bamberg geboren
Bamberg * Johann Joseph Ignaz Döllinger wird in Bamberg geboren.
3 1799 - Der „Englische Garten“ ist dem „kurfürstlichen Kabinett“ unterstellt
München-Englischer Garten * Der „Englische Garten“ ist inzwischen nicht mehr der „Militärbehörde“, sondern dem „kurfürstlichen Kabinett“ unterstellt.
Reinhard Freiherr von Werneck ist hauptamtlicher „Direktor“ des 375 Morgen großen „Englischen Gartens“.
Er untersteht aber dem zum „Gartenbaudirektor für die Rheinpfalz und ganz Baiern“ ernannten Friedrich Ludwig Sckell.
Werneck achtet hauptsächlich auf die wirtschaftliche Rentabilität der Gartenanlage.
Durch landwirtschaftliche Einrichtungen soll sich das Gartenprojekt selbst tragen - und möglichst sogar einen Gewinn erwirtschaften.
Dies will Werneck durch die Erweiterung der Wiesen- und Waldflächen, durch eine Vergrößerung des Viehbestandes und den Ausbau der Ökonomie und der Mühlen erreichen.
Die Ökonomie und die „Schweizerey“ wird dem „Englischen Garten“ einverleibt.
Um 3 1799 - Die Österreicher benehmen sich wie feindliche Besatzungstruppen
München * 100.000 Österreicher stehen im Land und benehmen sich wie feindliche Besatzungstruppen.
Die Bevölkerung ist vom neuen Baiernregenten enttäuscht. Diese hat aber - trotz seiner Sympathien für Frankreich - aufgrund der militärischen Präsenz der Österreicher im eigenen Land keine andere Wahl, als in der „Koalition“ gegen Frankreich zu bleiben.
1. 3 1799 - Der Zweite Koalitionskrieg beginnt
Frankreich - Deutschland * Französische Truppen überschreiten den Rhein. Der Zweite Koalitionskrieg beginnt.
12. 3 1799 - Kurfürst Max IV. Joseph zieht feierlich in seine Residenzstadt ein
München * Kurfürst Max IV. Joseph von Pfalz-Baiern vertritt den drittgrößten Staatenkomplex des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Er zieht mit der kurfürstlichen Familie feierlich durch das festlich geschmückte Karlstor in seine neue Residenzstadt München ein.
4 1799 - Das „Paulanerkloster in der Au“ wird aufgehoben
Au * Das „Paulanerkloster in der Au“ wird auf Wunsch des „Konvents“ aufgehoben.
Zur Ausübung der pfarramtlichen Funktionen beziehen die Mönche das ehemalige „Lustschloss Neudeck“.
Betroffen sind 13 Patres und zwei Laienbrüder.
9. 5 1799 - Die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine bezieht die Herzog-Max-Burg
München-Kreuzviertel * Die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine zieht von der Residenz in die Herzog-Max-Burg, die ihr als Witwensitz dient.
16. 6 1799 - Leere Staatskassen und unüberschaubare Schulden
München - Leimen * Kurfürst Max IV. Joseph erklärt öffentlich, dass er „die bayrischen Finanzen in großer Unordnung, alle Staatskassen ausgeleert und selbe überdies noch mit unerschwinglichen Rückständen belastet angetroffen habe“. In den baierischen Regierungskreisen erinnert man sich an den umtriebigen jüdischen Leimener Finanzier Aron Elias Seligmann.
28. 6 1799 - Der Leimener Finanzier Aron Elias Seligmann wird nach München gerufen
München * Kurfürst Max IV. Joseph erteilt dem Leimener Finanzier Aron Elias Seligmann „und dessen sämtliche Kinder sowohl Söhne als Tochtermännern das vollkommene Bürgerrecht nebst der Befugnis, dass sie in Churpfalz allenthalben sich niederzulassen, liegende Güter an sich zu bringen und überhaupt alle Gewerbe, die sonst ein Christlicher Unterthan nur zu unternehmen befähiget, nach ihrem gutfinden ebenfalls zu treiben befugt und ermächtigt seyn sollen“.
- Damit besitzt der Hoffaktor auch die Voraussetzungen für das Münchner Bürgerrecht und kann schließlich von Leimen an die Isar umsiedeln.
- Aron Elias Seligmann rettet den bayerischen Staat vor dem Ruin, besorgt weitere Darlehensgeber und kann damit Bayerns Finanznöte mildern und die Regierung stabilisieren.
Um den 7 1799 - Die junge Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine ist schwanger
München * Spätestens jetzt lässt sich nicht mehr verheimlichen, dass die junge Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine schwanger ist.
Und weil sie den Namen des Vaters nicht preisgeben will gibt es ausreichend Anlass zu den wüstesten Spekulationen, was wiederum den Münchner Hof in höchste Verlegenheit bringt.
5. 8 1799 - Auer Wirte beschweren sich über Münchner Brauer
Au - München * 16 Bierwirte aus der Au beschweren sich bei der Generallandesdirektion darüber, dass die Münchner Brauer auf dem Gasteig und dem Lilienberg - trotz Verbotes - in ihren Märzenkellern ihr Bier in kleinen Portionen abgeben. Gemeint ist damit der sogenannte Minuto-Verschleiß.
Die Generallandesdirektion droht bei nochmaligem Vorkommen mit Strafen von 60 Reichstalern.
8. 8 1799 - Die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine muss München verlassen
Laibach * Die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine wird „auf einige Zeit ins Friaulische versetzt“. Der Grund: Die Liebschaft zu dem Hof-Musikanten Franz Eck „wird immer größer und bedenklicher“. Dem Violisten im Hoforchester wird ein „schlechter Ruf“ nachgesagt. Maria Leopoldine wird in Laibach einen unehelichen Sohn zur Welt bringen.
17. 8 1799 - Metzgermeister Anton Sailer kauft den Haidhauser Schlossanger
Haidhausen * Graf Anton Clemens von Toerring-Seefeld verkauft den Haidhauser Schlossanger an den Metzgermeister Anton Sailer. Der heutige Johannisplatz heißt vorübergehend Metzgeranger oder auch Saileranger.
24. 9 1799 - Das Militärische Arbeitshaus wird aufgelöst
Au * Das Militärische Arbeitshaus in der Au wird bereits nach zehn Jahren wegen Unrentabilität wieder aufgelöst. Als Grund gibt Kurfürst Max IV. Joseph an, dass die „Monturstücke für die kurfürstlichen Regimenter, die aus dem Militärarbeitshaus geliefert werden, teurer als bei den bürgerlichen Gewerbeleuten“. Die Arbeiter überlässt man weitgehend ihrem Schicksal.
5. 10 1799 - Die Hundesteuer wird eingeführt
München * Kurfürst Max IV. Joseph genehmigt die Einführung einer Hundesteuer und der Hundemarke für „in hiesiger Haupt- und Residenzstadt München ohne Noth und blos zur Üppigkeit gehaltene Hunde“. Sie beträgt jährlich 2 Gulden. Bei Zuwiderhandlung ist eine Strafe in Höhe von 5 Gulden fällig.
18. 10 1799 - In der Au wird eine Spinnstube für Arme eingerichtet
Au * In der Au wird eine Spinnstube für Arme eingerichtet.
11 1799 - Die „Militärgärten“ werden vom „Englischen Garten“ abgetrennt
München-Englischer Garten * Die „Militärgärten“ werden abgeschafft, dem „Hoffuttermeisteramt“ unterstellt und vom „Englischen Garten“ abgetrennt.
9. 11 1799 - Napoleon Bonaparte stürzt in einem Staatsstreich das Direktorium
Paris * Napoleon Bonaparte nutzt die Wirren des Zweiten Koalitionskrieges und stürzt in einem Staatsstreich das Direktorium, um sie durch eine Konsulatsregierung mit ihm als Erstem Konsul einzuführen.
9. 12 1799 - Der Wirtschaftsbetrieb Englischer Garten
München-Englischer Garten * Die beiden im Jahr 1798 errichteten Säge- und Mahlmühlen werden ebenfalls dem Wirtschaftsbetrieb Englischer Garten einverleibt.
11. 12 1799 - Markus Sedlmair wird Großwirt von Haidhausen
Haidhausen * Markus Sedlmair folgt Johann Jakob Paul als Großwirt von Haidhausen und Besitzer des Kotterhofs. Im Kataster wird er als „Freistifter des Lazaretts am Gasteig“ bezeichnet.
20. 12 1799 - Der Bierzwang wird aufgehoben
München * Der Bierzwang wird aufgehoben. Damit entfällt die Verpflichtung der Münchner Wirte ihr Bier bei den Münchner Brauereien zu beziehen. Nur bei Biermangel oder wenn der neue Sud noch nicht angesetzt war, durften die Wirte bisher ihr Bier von auswärtigen Brauereien einführen.
23. 12 1799 - Der Englischen Garten wird um 300 Tagwerk erweitert
München-Englischer Garten - Hirschau * Kurfürst Max IV. Joseph schlägt dem Englischen Garten 300 Tagwerk der unteren Hirschau zu. Die Erweiterung erstreckt sich vom Kleinhesseloher See bis zum heutigen Aumeister.
1800 - Der Münchner Burgfrieden umfasst 1.600 Hektar
München * Der Münchner Burgfrieden umfasst 1.600 Hektar.
Zum Vergleich: Heute sind es 31.045 Hektar.
1800 - Das „Ridlerschlössl“ wird an die Comtesse de Hautfort verkauft
Haidhausen * Für den Preis von 10.000 Gulden geht das „Ridlerschlößl“ in Haidhausen an die Comtesse de Hautfort, eine geborene Bavière, über.
Um 1800 - Die „Wiederzulassung des Templer-Ordens“ in Frankreich
Paris * Napolèon Bonaparte gestattet die „Wiederzulassung des Templer-Ordens“ in Frankreich.
Die „katholische Kirche“ weigert sich aber, den „Orden“ offiziell wieder anzuerkennen.
Um das Jahr 1800 - Gewerbler und Tagelöhner lassen sich auf der „Ramersdorfer Lüften“ nieder
Haidhausen * Einige Gewerbler und Tagelöhner lassen sich auf der „Ramersdorfer Lüften“, in der Nähe des heutigen Rosenheimer Platzes, nieder.
Durch den Zuzug weiterer Siedlungswilliger in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überflügelt die Ansiedlung bald die Einwohnerzahl des Dörfchens Ramersdorf.
Um 1 1800 - Weitere Gemäldezuwächse für München
Zweibrücken - Düsseldorf * Kurfürst Max IV. Joseph lässt rund 1.000 Bilder der Zweibrücker Galerie nach München bringen.
Auch die 348 Gemälde aus Kurfürst Jan Wellems Düsseldorfer Sammlung - eine Kollektion besonders auserlesener Bilder - kommt nach München.
7. 1 1800 - Aus den Militärgärten wird die Schönfeldwiese
München-Englischer Garten * Das Gelände der Militärgärten wird wieder mit dem Englischen Garten vereinigt und daraus eine ausgedehnte längliche Wiesenfläche, die Schönfeldwiese, angelegt.
13. 1 1800 - In der Stadt und im Burgfrieden bestehen 163 Bierschenken
München * In der Stadt und im Burgfrieden bestehen 163 Bierschenken.
Um den 15. 3 1800 - Kurfürst Max IV. Joseph nimmt von den Engländern Subsidiengelder
<p><strong><em>München</em></strong> * Kurfürst Max IV. Joseph nimmt von den Engländern Subsidiengelder, die zwar den territorialen Bestand Baierns garantieren, doch der Preis ist das Festhalten am Militärbündnis mit Österreich und die Fortführung des Krieges gegen Frankreich. </p>
Um den 20. 3 1800 - Der Vertrauensvorschuss von Kurfürst Max IV. Joseph ist aufgebraucht
<p><strong><em>München</em></strong> * Das Stimmungsbild gegenüber Kurfürst Max IV. Joseph hat sich seit seinem Regierungsantritt massiv verschlechtert. Der Vertrauensvorschuss ist völlig aufgebraucht. Das bringt auch eine Flugschrift zum Ausdruck, in der es heißt: <em>„Der Bauer zahlt ja mit seinem Geld und Blute immer allein die Zeche, sie mag auch kosten, was sie wolle.“</em></p>
Um den 21. 3 1800 - Die Stimme der öffentlichen Meinung über Max Joseph
München * Die Schrift „Die Stimme der öffentlichen Meinung über Max Joseph“ beschuldigt die Regierung: „Sie entfernte zwar die Schurken, die unter Carl Theodor den Hass und den Fluch des Volkes auf sich geladen hatten, aber dabei blieb sie auch stehen und hatte nicht den Mut, dieselben zu strafen.
Zugleich offenbarte sich der Mangel an Grundsätzen immer deutlicher. Der Nepotismus, der Personalhass, die Intrigensucht lebten in voller Stärke wieder auf und schoben ihre untauglichen Kreaturen in die Reihe der schätzbaren Räte, deren Anstellung den Kollegien ihr ursprüngliches Ansehen wiedergegeben hatte“.
Zum Thema Englische Subsidien kommt die Schrift zum Ergebnis: „Geringschätzung gegen den Kurfürsten, Hass gegen die herrschenden Minister“. Es herrscht eine eisige Stimmung.
4 1800 - Eine evangelische „Hofkapelle“ in der Residenz wird eingeweiht
München-Graggenau * Eine evangelische „Hofkapelle“ im Flügelbau zwischen dem „Brunnenhof“ und dem „Küchenhof“ wird eingeweiht.
26. 4 1800 - „Ausnahmeprivilegien für Bürgersöhne“ bleiben auch weiterhin erhalten
München * Angesichts der englischen Subsidienzahlungen verbreitet sich in München das Gerücht, dass zur Erreichung der geforderten militärischen Mannschaftszahlen nun auch Bürgersöhne „ausgehoben“ werden.
„Polizeidirektor“ Anton Baumgartner erklärt, dass die „Ausnahmeprivilegien für Bürgersöhne“ auch weiterhin erhalten bleiben.
Um den 1. 5 1800 - Das Georgianum wird nach Landshut verlegt
<p><strong><em>Ingolstadt - Landshut</em></strong> * Das <em>„Collegium Georgianum“</em> wird mit der Universität von Ingolstadt nach Landshut verlegt.</p>
1. 5 1800 - General Jean-Victor Moreau überschreitet den Rhein
Frankreich - Deutschland * General Jean-Victor Moreau überschreitet mit einer Armee von 100.000 Mann den Rhein und marschiert in Richtung Osten.
28. 6 1800 - Kurfürst Max IV. Joseph flieht mit seiner Familie nach Amberg
München * Als die französische Armee mit 4.000 Mann vor den Toren Münchens steht, flieht Kurfürst Max IV. Joseph mit seiner Familie umgehend nach Amberg und überlässt seine Hauptstadt der feindlichen Invasion. Auch die österreichischen Soldaten ziehen sich - begleitet von feindseligen Parolen - eiligst zurück.
Dafür begrüßen die Münchner die Franzosen um so freundlicher. Der französische General Charles Matthieu Isidore Decaën notierte erfreut in sein Tagebuch: „[...] es schien mir, als ob wir vielmehr Befreier als Feinde waren.“
Um den 3. 7 1800 - Dankadresse von der baierischen Nation an Max Joseph IV.
München * Nach der Flucht des Kurfürsten Max IV. Joseph findet sich in einer weit verbreiteten Broschüre mit dem Titel: „Dankadresse von der baierischen Nation an Max Joseph IV.“ eine spöttische Kommentierung dieser Situation. Darin wird als größte Wohltat des Kurfürsten seine „Flucht aus München“ gepriesen, da er dadurch „die Stadt und das ganze Land der französischen Großmut preisgegeben und die Untertanen vollends überzeugt habe, dass sie sich auch ohne Fürsten und Militär selbst zu verteidigen, zu regieren und die Gefahren, in der sie ihr vielgeliebter Regent versetzt hat, mit männlicher Klugheit abzuwenden wissen“. Der Text will die Baiern in Stadt und Land davon überzeugen,
- dass die Nation reif ist für eine republikanische Staatsform nach französischem Muster und
- dass der Kurfürst als Oberhaupt des Staatswesen absolut entbehrlich sei.
Freilich gibt es auch Stimmen gegen die Härten, die die französischen Einquartierungen mit sich bringen. Doch es herrscht eine grundsätzliche Sympathie für die Franzosen und das republikanische Frankreich.
Die Verantwortung für die unerquickliche Lage lastet man jedenfalls weniger den französischen Besatzungstruppen, als vielmehr dem geflüchteten Kurfürsten Max IV. Joseph und seiner verfehlten Politik an, mit der er Baiern im kaiserlichen Lager festhält. Selbst regierungstreue Münchner sehen sich durch die republikanischen Soldaten immer noch besser behandelt als durch die verbündeten Österreicher.
Um den 10. 7 1800 - Ein Patrioten-Klub trifft sich in der Weinstraße
München * Ein Klub, der sich aus Mitgliedern des gehobenen Münchner Bürgertums zusammensetzt, hat sich inzwischen gebildet und trifft sich regelmäßig in der Weinstraße zu Zusammenkünften.
Die Mitglieder des Klubs bezeichnen sich selbst als Patrioten. Zu den führenden Vertretern zählen unter anderem der Referendar im Finanzministerium Joseph von Utzschneider, der Regierungsrat Joseph von Hazzi und der Buchhändler und Verleger Johann Baptist Strobl, von dessen Buchhandlung aus zahlreiche kritische Flugschriften verbreitet werden.
15. 7 1800 - Baiern lässt sich von Großbritannien seinen Besitzstand garantieren
London - Amberg * Das Kurfürstentum Baiern lässt sich im Subsidienvertrag von Amberg von Großbritannien seinen Besitzstand garantieren.
Um den 20. 7 1800 - Oppositionelle und regimekritische Kreise äußern ihren Unmut
München * Oppositionelle und regimekritische Kreise äußern auch weiterhin ihren Unmut am Kurfürsten Max IV. Joseph laut und heftig. Besonders nachdem deutlich wird, dass weder Österreich noch England an einem Friedensschluss mit Frankreich interessiert sind und sich Pfalz-Baiern sogar zu einer Erhöhung des Truppenkontingents verpflichtet hat, „weil England einige Millionen Geld, das weise Fürsten nicht ausschlagen und höher als das Blut der Untertanen schätzen müssen, welches keinen Wert hat, wohl aber den Grund und Boden düngt, auf dem selbe erschlagen werden, gezahlt und deinen treuen Ministern mit Brillanten besetzte Tobaksdosen geschenket hat“.
Der Kurfürst wird als Hofmetzger geschmäht, weil „er unsere Kinder verkauft wie‘s Vieh“.
1. 8 1800 - Franz Carl von Hompesch stirbt
Berg am Laim * Der Berg am Laimer Hofmarkbesitzer und Baierische Finanzminister Franz Carl von Hompesch stirbt.
Sein Nachfolger als Berg am Laimer Hofmarkbesitzer wird sein Sohn Johann Wilhelm von Hompesch. Die Aufgaben als Baierischer Finanzminister übernimmt - provisorisch bis 1803 - Theodor Heinrich Graf Topor Morawitzky.
Um den 4. 8 1800 - Eine republikanische Schrift an die Bevölkerung
München * Eine Anfang August erschienene Schrift wendet sich an die „Bewohner Baierns, Schwabens, Frankens, Tyrols und Salzburgs“ und fordert dazu auf,
- „daß wir diesem Unwesen einmal ein Ende machen und von dem alten verderblichen Reichsverbande uns loslösen,
- uns nach dem Drange aller politisch- und natürlichen Verhältnisse in einen freien, mächtigen Staatskörper [...] zusammenschließen [...] und uns so
- eine eigene, auf die natürlichen Rechte der Menschheit, auf die reine Religion, und den allgemeinen Wohlstand gegründete Konstitution geben“.
Alle Soldaten aus der Koalitionsarmee sollen zurückgerufen werden und anschließend Vertreter aus den Gemeinden und Distrikten „zu einer allgemeinen süddeutschen Nationalversammlung oder süddeutschem Landtage“ gewählt werden.
Um den 10. 8 1800 - Weitere Flugschriften werden baiernweit verteilt
München * Eine Flugschrift mit dem Titel „Wahrer Überblick der Geschichte der baierischen Nation, oder das Erwachen der Nationen nach einem Jahrtausend“ wirft Kurfürst Max IV. Joseph vor, „durch seinen Menschenverkauf, durch seine Verschwendung, durch die immerwährende Aushebung und gänzliche Entvölkerung des Landes, durch die volle Verwirrung, die er stiftete, alle Achtung, alles Zutrauen verloren“ zu haben. Gleichzeitig formuliert die Schrift ein in die Zukunft gerichtetes politisches Programm einer Republik in Süddeutschland:
- „Baiern, vereint mit Schwaben, wird das österreichische Joch abschütteln [...] und [...] vereinigt mit einem Teile Frankens [...] sich eine auf Unabhängigkeit, Freiheit und Gleichheit gegründete Verfassung geben“.
- Zur Umsetzung dieses Zieles erhofft sich die „Flugschrift“ die Unterstützung der „Republik Frankreich“.
Diese „Flugschriften“ finden nicht nur in der Stadt ihre Leser.
Da sie auf der „Schranne“ meist heimlich in die Säcke gesteckt wird, verbreitet sich der „revolutionäre“ Inhalt auch auf dem Land.
Durch die bloße Anwesenheit der Franzosen wagen sich die „Zensurbehörden“ nicht, entschlossen gegen die „Flugschriften“ vorzugehen.
Um den 15. 8 1800 - Die Münchner Patrioten wenden sich an General Decaën
München * Eine Delegation der Patrioten wendet sich an General Charles Matthieu Isidore Decaën und bittet ihn um Unterstützung für einen Aufstand gegen den Kurfürsten und seiner Regierung. Der General reagiert reserviert, da die französische Regierung keinen Aufstand unterstützen will, sondern vielmehr einen allgemeinen Frieden anstrebt. Er gibt zu Bedenken, dass eine Revolution zur Beseitigung von Missständen
- ein unabwägbares Risiko darstellt.
- Dagegen würde der weniger gewaltsame Weg von Reformen größere Erfolgsaussichten bieten. Bei einer Revolution wüsste man nie, was als Ergebnis herauskomme.
- Außerdem sei Baiern zu schwach, um alleine gegenüber Preußen und Österreich eine Veränderung seiner Staatsform durchzuführen.
Dass General Decaën mit seinen Aussagen strikt der französischen Konsulatsregierung Napoléons folgt, ist den Revolutionsführern, die sich selbst Münchner Jakobiner nennen, in keinster Weise bewusst. Sie sehen in den französischen Generälen noch immer die Repräsentanten der Revolution. Doch Frankreich hat sich schon längst von den politischen Zielen des Nationalkonvents entfernt, dem es im Jahr 1792 noch um die Verbreitung der revolutionären Ziele und um die Befreiung der unterdrückten Nationen gegangen ist. Im Gegenteil, Frankreich will inzwischen die Entstehung einer großen süddeutschen Republik mit allen Mitteln verhindern und stattdessen zu separaten Bündnissen mit den einzelnen deutschen Fürsten gelangen.
Um den 18. 8 1800 - Die Münchner Revolutionäre wenden sich an Marschall Moreau
München * Weil die - von überkommenen Voraussetzungen ausgehenden - Münchner Revolutionäre von dem Gesprächsergebnis mit General Decaën nicht einverstanden sind, wenden sie sich wenige Tage später an Decaëns Vorgesetzten, den Oberbefehlshaber Marschall Jean-Victor-Marie Moreau.
Der Franzose empfängt die Delegation, nimmt aber - bestürzt von der Entschlossenheit der Münchner Bürger - Kenntnis von deren Vorhaben, dem Kurfürsten und seiner Familie die Rückkehr nach München zu verwehren und dafür eine Tochterrepublik unter französischer Protektion zu errichten.
Marschall Moreau gibt zu Bedenken, dass er nach Baiern geschickt worden sei, um den Feind zu bekämpfen und nicht, um eine Republic zu gründen. Man sollte deshalb die Revolutionspläne doch noch einmal reiflich überdenken. Das war freilich genau das, was die hochmotivierten Revolutionäre nicht hören wollten.
Um den 20. 8 1800 - Der Plan eines republikanischen Umsturzes ist gescheitert
München * Als die Münchner Bürger-Delegation Moreau nochmal aufsuchen will, lässt er sie nicht mehr vor. Verärgert lässt ihnen der französische Oberbefehlshaber ausrichten, er würde sie, falls sie ihn nochmal belästigen sollten, die Treppe hinunterwerfen lassen. Schroffer kann die Abfuhr nicht ausfallen. Die französische Besatzungstruppe hat kein Interesse an einer Kooperation mit den Rebellen. Gegenüber dem Münchner Bürgerwehr-Kommandanten Felix Joseph Lipowsky ruft Moreau aus: „Mein Gott! Man weiß nicht was man will! Eine Republik kostet viel Blut, wir haben sie“.
Damit ist der Plan eines republikanischen Umsturzes gescheitert. Scheinbar ist die Unzufriedenheit über die kurfürstliche Politik doch nicht so stark und so verbreitet, dass sie eine Aufstandsbewegung wirklich getragen hätte.
8. 9 1800 - Marschall Moreau kündigt den Waffenstillstand von Parsdorf
München * General Jean-Victor-Marie Moreau kündigt den Waffenstillstand von Parsdorf. Nun sammeln sich in München erneut die französischen Truppen. Da die Kasernen sofort voll sind, quartiert man die Mannschaften im kurfürstlichen Seidenhaus, im ehemaligen Jesuiten-Seminar und in den Klöstern der Franziskaner, Theatiner und Karmeliter ein.
Neben den Besatzungssoldaten bevölkern auch zunehmend immer mehr Deserteure der kaiserlichen Armee die Stadt. Auch pfalz-baierische Soldaten, die sich schlecht behandelt fühlen und aus diesem Grund nicht mehr unter österreichischem Befehl kämpfen wollen, laufen den Kaiserlichen reihenweise davon. Zeitweise halten sich etwa 500 dieser Fahnenflüchtigen in München auf.
20. 9 1800 - Verlängerung des Waffenstillstands
München * Franzosen und Österreicher handeln eine Verlängerung des Waffenstillstands aus.
10. 11 1800 - Die Amberger Verordnung beendet Baierns ausschließliche Katholizität
Amberg * In der Amberger Verordnung schreibt Kurfürst Max IV. Joseph, dass die Meinung,
- wonach die katholische Religionszugehörigkeit eine wesentliche Bedingung der Ansässigmachung in Baiern sei, sich als nachteilig für die Industrie und Kultur im Land erwiesen habe und
- sich diese weder aus der Reichs- noch in der Landesverfassung begründen lasse.
Allerdings veröffentlicht er die Verordnung nicht in der üblichen Art, sodass der Magistrat der Haupt- und Residenzstadt dem Pfälzer Weinwirt Johann Balthasar Michel aus Mannheim das Münchner Bürgerrecht verweigert und so die Übernahme der Weingastwirtsgerechtsame der Eheleute Rasp verhindert.
22. 11 1800 - Die Franzosen verlegen ihr Hauptquartier wieder nach München
München * Die Franzosen verlegen ihr Hauptquartier wieder nach München. Marschall Jean-Victor-Marie Moreau bezieht die Herzog-Maxburg, seine Rheinarmee lagert um die ganze Stadt.
28. 11 1800 - Die Franzosen ziehen weiter nach Hohenlinden
München - Hohenlinden * Die Rheinarmee verlässt München und schlägt ihr Lager in Hohenlinden auf. Baiern dient - aufgrund seiner geographischen Lage - sowohl den Franzosen als auch den Österreichern als Aufmarschgebiet und Schlachtfeld, weshalb die Entscheidungsschlacht des Zweiten Koalitionskrieges dann auch auf baierischem Boden ausgetragen wird.
3. 12 1800 - In der Schlacht von Hohenlinden vernichtend geschlagen
Hohenlinden * In Hohenlinden stehen sich 60.000 Österreicher - samt den zwangsverbündeten Baiern - 56.000 französischen Soldaten gegenüber. Bei Schneetreiben und kaltem Wind besiegen die Franzosen unter Marschall Jean-Victor-Marie Moreau in der Schlacht von Hohenlinden die kaiserliche Armee unter der Führung von Erzherzog Johann vernichtend.
3. 12 1800 - Falsche Siegesmeldungen aus Hohenlinden
München * Da sich in München zunächst die Nachricht verbreitet, die Österreicher hätten in der Schlacht in Hohenlinden gewonnen, macht sich die Angst breit, nun könnten die zurückgebliebenen französischen Truppenteile Verteidigungsmaßnahmen ergreifen, die sich für die Stadt als gefährlich erweisen würden.
Um ihn davon abzubringen, bietet man dem Platzkommandanten Briant 100 Luisdors an. Briant lehnte das Ansinnen ab, weil diese Summe für einen Platzkommandanten zu „unwürdig“ sei, mit 200 Luisdors wäre er allerdings schon einverstanden gewesen. Der Magistrat lässt ihm daraufhin den Betrag überreichen. Erst später verbreitet sich die Siegesmeldung der Franzosen.
Anschließend ziehen sich die Österreicher hinter ihre Grenze zurück. Die Baiern haben dagegen die Franzosen als Besatzungsmacht im Land und müssen sechs Millionen Gulden Kontribution, die Staatseinnahmen eines Jahres, zahlen.
Die Landschaft verlangt daraufhin, dass das Kurfürstentum Baiern kein Bündnis gegen Frankreich mehr eingehen dürfe. Ein politisches Zusammengehen mit Österreich ist somit für die nächsten Jahre ausgeschlossen.
10. 12 1800 - Salzburgs Erzbischof Colloredo nimmt Exil in Wien
Salzburg * Der Salzburger Erzbischof Hieronymus Franz de Paula Graf von Colloredo verlässt die Stadt vor den anrückenden Franzosen und hält sich in Wien im Exil auf.
25. 12 1800 - Neuer Waffenstillstand zwischen Frankreich und Österreich
Steyr * In Steyr wird ein neuer Waffenstillstand zwischen Frankreich und Österreich geschlossen.
Nach der für die Revolutionstruppen siegreichen Schlacht von Hohenlinden am 3. Dezember 1800 ist Frankreich endgültig zur dominanten und im Südosten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation militärisch präsenten Macht geworden. Österreich muss erkennen, dass sich der Krieg gegen Frankreich nicht erfolgreich weiterführen lässt.
Ab 1801 - Napoleon Bonaparte fördert den Gebietszuwachs Baierns
Kurfürstentum Baiern * Napoleon Bonaparte fördert bis 1810 den Gebietszuwachs Baierns. Er will die deutschen Mittelstaaten, allen voran Baiern, Württemberg und Baden, so vergrößern, dass sie als Puffer gegenüber österreichischen Angriffen dienen können.
Gleichzeitig sollen die so Geförderten natürlich auf Dauer von der französischen Gunst abhängig bleiben.
1801 - Das „Hofkrankenhaus für kurfürstliche Hofbedienstete“ wird aufgelassen
Au * Das „Hofkrankenhaus für kurfürstliche Hofbedienstete“ am heutigen Kolumbusplatz wird aufgelassen.
1801 - Therese Feldmüller, geborene Schlutt, kommt in Schliersee zur Welt
Schliersee * Therese Feldmüller, geborene Schlutt, kommt in Schliersee zur Welt.
Ihr Vater ist der Wirt und Koch Andreas Schlutt aus Schliersee, ihre Mutter Anna stammt aus Zolling bei Freising.
1801 - Minister Montgelas plant die Verlegung der „Franziskaner“ in die Au
München-Kreuzviertel - Au * Minister Maximilian Joseph von Montgelas plant die Verlegung der Münchner „Franziskaner“ in die „Vorstadt Au“.
1801 - München hat 40.460 Einwohner
München * München hat 40.460 Einwohner.
9. 2 1801 - Linksrheinische Gebietsabtretungen an Frankreich
<p><em><strong>Lunéville</strong></em> * Im Friedensvertrag von Lunéville ist auch abschließend festgelegt worden, dass die linksrheinischen Gebiete an Frankreich abgetreten werden müssen. Napoleon Bonaparte erreicht damit ein Ziel jahrhundertelanger französischer Politik. </p> <p>Pfalzbaiern muss neben den bereits verloren gegangenen Herzogtümern Zweibrücken und Jülich sowie der linksrheinischen Kurpfalz nun auch noch die rechtsrheinische Kurpfalz um Mannheim und Heidelberg an Baden abgeben.</p> <p>Das bedeutete einen Verlust von 200 Quadratmeilen und 730.000 Einwohnern. Den von den Landverlusten betroffenen Fürsten wird allerdings ein Ausgleich zugestanden, der jedoch <em>„aus dem Schoß des Reiches“</em> kommen muss.</p> <p>Und weil dieses nur aus säkularisiertem Kirchenbesitz und aus den mediatisierten Reichsständen erfolgen kann, bedeutet das in der Konsequenz gleichzeitig das Ende des alten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. </p>
9. 2 1801 - Der Frieden von Lunéville
<p><em><strong>Lunéville</strong></em> * Der Waffenstillstand von Steyr vom 25. Dezember 1800 mündet in den Frieden von Lunéville. Österreich und seine deutschen Verbündeten scheiden damit aus dem Zweiten Koalitionskrieg aus.</p> <p>Bei diesen Friedensverhandlungen versuchen die Österreicher von Frankreich die Zustimmung für die Angliederung Baierns zu bekommen. Ob Preußen oder Österreich, alle schauen nur auf ihren eigenen Vorteil. Das Interesse der Verbündeten bleibt dabei freilich auf der Strecke.</p> <p>Als allerdings diese habsburgischen Annexionsbegehren in Baiern ruchbar wird, ist es verständlicherweise mit der Loyalität gegenüber dem Bündnispartner nicht mehr allzu weit her. Alte, tief verankerte Vorurteile kommen wieder hoch und verstärken sich. Das Kurfürstentum Baiern steht mit dem Rücken an der Wand und muss sich nun primär um seine Existenzsicherung kümmern. </p>
9. 2 1801 - Baiern als Gewinner des Friedensvertrages von Lunéville
<p><em><strong>Lunéville</strong></em> * Zu den Gewinnern des Friedensvertrages von Lunéville gehört auch der baierische Kurfürst Max IV. Joseph. Denn dem genannten Verlust von 200 Quadratmeilen und 730.000 Einwohnern steht ein Gewinn von 288 Quadratmeilen und 843.000 Einwohnern gegenüber.</p> <p>Das Kurfürstentum Baiern erhält die Hochstifte Freising, Augsburg, Bamberg und Würzburg, Teile der Hochstifte Eichstätt und Passau, dreizehn Reichsabteien und fünfzehn Reichsstädte in Franken und Schwaben. Freilich noch nicht die Großen: Augsburg und Nürnberg. Baiern kann sich dadurch jedoch territorial maßgeblich erweitern. </p>
9. 2 1801 - Die von Franzosen besetzten Gebiete müssen geräumt werden
<p><em><strong>Lunéville</strong></em> * Der Friedensvertrag von Lunéville legt auch fest, dass die Franzosen die von ihnen besetzten rechtsrheinischen Gebiete räumen. Dennoch lassen sich die französischen Soldaten mit ihrem Abzug aus München ausreichend Zeit.</p> <p>In ihrem Siegestaumel kommt es zu einer Vielzahl von Ausschreitungen. Mit ihren Räubereien, Erpressungen und sogar etlichen Mordtaten betrachten sie die Münchner bald als Plage.</p> <p>Auch, als sie als Wachen an den Stadttoren auf die Idee kommen, von jedem Passanten 24 Kreuzer Zoll zu verlangen. Erst nach wiederholten Protesten der Betroffenen verbietet der Platzkommandant diese Eigenmächtigkeit. Die aus dem Osten abrückenden französischen Militäreinheiten belasten die Münchner mit zusätzlichen Quartierlasten. </p>
9. 4 1801 - Die Rheinarmee verlässt München
<p><em><strong>München</strong></em> * Der größte Teil der Rheinarmee verlässt München wieder. </p>
12. 4 1801 - Auch das Besatzungsbataillon verlässt die baierische Landeshauptstadt
<p><em><strong>München</strong></em> * Auch General Charles Matthieu Isidore Decaën verlässt mit seinem Besatzungsbataillon die baierische Landeshauptstadt. Er droht umzukehren, falls sich vor dem 13. April auch nur ein kurbaierischer Soldat in der Stadt sehen lassen sollte. </p>
19. 6 1801 - Das Topographische Bureau wird gegründet
München * Das Topographische Bureau wird gegründet. Damit beginnt die allgemeine Landes- und Katastervermessung Baierns, das dadurch das erste exakt vermessene Land Europas werden wird.
Mit fünf jeweils fünf Meter langen Messstangen wird die 21.653,8 Meter lange Basislinie zwischen Oberföhring und Aufkirchen bei Erding gemessen. Die Verlängerung der Linie verläuft auf der einen Seite durch die Turmspitze der Aufkirchener Kirche und auf der anderen Seite durch die Spitze des nördlichen Turms der Frauenkirche, die zugleich den Nullpunkt des bayerischen Koordinatensystems bildet. Die Vermessung erfolgte in Metern, obwohl die Maßeinheit erst im Jahr 1872 im Deutschen Reich eingeführt wird.
29. 7 1801 - Einbürgerungsbefehl an den Stadtmagistrat
München - Mannheim * Verärgert und sehr deutlich im Ton schreibt Kurfürst Max IV. Joseph nach der Ablehnung des Münchner Bürgerrechts an den Pfälzer Weinwirt Johann Balthasar Michel aus Mannheim dem Stadtrat:
„Nach reifer Überlegung und mit der Gewißheit, daß das Recht auf meiner Seite ist, befehle ich hiermit dem meinen Stadtmagistrat, spätestens morgen Abends 6 Uhr, dem Handelsmann Michel von Mannheim, das Bürgerrecht zu ertheilen, widrigenfalls ich mich genöthigt sehen würde, die strengsten Mittel zu ergreifen.
Für den geringsten Exceß haftet jedes Magistratsglied persönlich“.
30. 7 1801 - Münchens erster Protestant wird eingebürgert
München - Mannheim * Zähneknirschend wird der Kaufmann Johann Baltasar Michel in die Münchner Bürgerschaft „gnädigst großgünstig an- und aufgenommen“. Gleichzeitig gibt der Magistrat der Stadt seine Zustimmung zum geplanten Kauf der Rasp’schen Gastwirtsgerechtsame an Johann B. Michel. Die zu entrichtende Aufnahmegebühr ist mit 470 Gulden allerdings deutlich überhöht.
24. 8 1801 - Baiern schließt mit Frankreich einen Vorvertrag
München - Paris * Baiern schließt mit Frankreich einen Vorvertrag ab, dem es Kurfürst Max IV. Joseph ermöglicht, seine in Aussicht gestellten Entschädigungsgebiete bereits vor der Verabschiedung des Reichsdeputationshauptschlusses in Besitz nehmen zu können. „In Paris begann ein Handel mit deutschen Bistümern, Abteien, freien Reichsstädten, wobei die fürstlichen Bewerber vor dem ersten Konsul […] in Regensburg um die Wette krochen. Es war ein höchst widerliches Schauspiel.“
Österreich will Baiern zuvor als Entschädigung für seine eigenen Kriegsverluste einverleiben. Dieses Ansinnen kann letztlich nur durch die Intervention von Russland und Großbritannien verhindert werden. Für Kurfürst Max IV. Joseph und seinen Minister Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas ist aufgrund dieser Erfahrung eine Annäherung an Frankreich naheliegend.
24. 8 1801 - Ein eigenständiges Baiern soll ein Erstarken Österreichs verhindern
Paris * Während Österreich Baiern nur als Manövriermasse ansieht, ist Napoleon an einem an seiner Seite stehenden eigenständigen Staat Baiern interessiert, der ein Erstarken Österreichs behindern soll. Dazu schließt der der baierische Kurfürst in Paris den separaten Friedensvertrag mit der Republik Frankreich ab.
Der Vertrag sagt Baiern die territoriale Unverletzbarkeit seiner rechtsrheinischen Gebiete sowie Unterstützung bei den Entschädigungsverhandlungen zu.
Nach dem 25. 8 1801 - Kurfürst Max IV. Joseph nimmt die Reform Baierns in Angriff
München * Mit tatkräftiger Unterstützung seines Ministers Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas nimmt Kurfürst Max IV. Joseph eine Reform seines Landes in Angriff. Zur dauerhaften Stabilisierung des Staates ist eine Umverteilung von Rechten, Pflichten und Chancen notwendig.
Zu dieser Revolution von oben gehört auch die revolutionäre Gleichbehandlung aller Baiern, mit dem Anspruch des Herrschers, „allen Untertanen, Reichen und Armen, Witwen und Waisen, Geistlichen und Weltlichen, gleiches Recht und Schirm zu verschaffen“.
Durch diese Reformen kann der Baiernregent einen Großteil der Kritik, die zu Beginn seiner Regierung die öffentliche Debatte geprägt hatte, den Boden entziehen. Vieles von dem wird beseitigt, was unter der Regentschaft des Kurfürsten Carl Theodor als willkürlich und korrupt angegriffen worden ist.
Gleichzeitig lässt er energisch eingreifen und setzt sich mit Militärgewalt durch, wenn seiner Politik offene Auflehnung entgegen schlägt. Beides, die umfangreichen und weitreichenden Reformen sowie das energische und harte Durchgreifen, lassen die heftige Kritik der Anfangsjahre und jedes Auflehnen gegen seine Politik allmählich verstummen.
Durch sein leutseliges Verhalten kann Kurfürst Max IV. Joseph sogar die Zuneigung der Münchnerinnen und Münchner erringen und sich so zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der Wittelsbacher hocharbeiten. Schon bald gehören die anfänglichen Differenzen zwischen dem Herrscher und dem baierischen Volk der Vergangenheit an.
5. 9 1801 - Die Kurfürsten-Witwe Maria Leopoldine kehrt nach München zurück
Laibach * Die inzwischen 24-jährige Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine kehrt aus ihrem Exil in Laibach nach München zurück.
2. 10 1801 - Der Reichstag beschließt das Entschädigungsverfahren
Regensburg * Der in Regensburg tagende Reichstag beschließt, dass die Durchführung des Entschädigungsplans aus dem Friedensvertrag von Lunéville durch eine Reichsdeputation erfolgen soll.
1802 - München verfügt über 1.397 „bürgerliche Gerechtigkeiten“
München * München verfügt über 1.397 „bürgerliche Gerechtigkeiten“, einschließlich des „Handels“.
Das bedeutet einen Rückgang von 374 „Gerechtigkeiten“ gegenüber dem Jahr 1618 - trotz des Anstiegs der Bevölkerungszahlen.
1802 - Peter Paul Maffei gründet die „Maffei-Bank“
München-Kreuzviertel * Peter Paul Maffei gründet die „Maffei-Bank“.
1802 - Staatsrat von Hazzi kauft den Edelsitz Pilgramsheim
Untergiesing * Der churtrierische Kammerherr von Horben verkauft den Edelsitz Pilgramsheim an den Staatsrat Joseph von Hazzi.
Der Staatsrat ist selbst davon überzeugt, dass der zwischenzeitlich verstorbene Kurfürst Carl Theodor nicht über das Recht verfügt hatte, eine Sitzgerechtigkeit zu verleihen und aus diesem Grund als Landesherr seine Machtbefugnisse überschritten habe. In diesem Selbstverständnis verzichtet er auf die Anerkennung von Pilgramsheim als Adelssitz.
1802 - Mit der „Säkularisation“ wird die „Praterinsel“ Eigentum des Staates
München-Lehel * Die heutige „Praterinsel“ ist vor der „Säkularisation“ der „Erholungsplatz der Franziskaner“, nachdem diese in ihrem Kloster für eine Stätte der Einkehr und Besinnung keinen ausreichenden Platz gefunden haben.
Mit der „Säkularisation“ kommt die Insel in das Eigentum des Staates.
1802 - Die „Rumford-Suppenanstalt“ wird gegründet
Au * Die „Rumford-Suppenanstalt“ wird gegründet.
Das Grundrezept der „Rumford-Suppe“ besteht aus Wasser, Kartoffeln, Graupen, Erbsen, Salz, Weinessig oder saueres Bier.
Auf tausend Portionen Suppe kommen drei Pfund gerstenkorngroß geschnittenes Fleisch.
Nach stundenlangem Kochen wird die Suppe gallertartig dick.
Dazu gibt es noch einige Stückchen hartes Brot, um das zur Verdauung notwendige Kauen zu fördern.
25. 1 1802 - Dekret zur Aufhebung der Bettelordensklöster in Baiern
Kurfürstentum Baiern * Das kurfürstliche Dekret zur Aufhebung der Bettelordensklöster in Baiern beginnt mit der Feststellung,
- dass die Bettelorden die „Fortpflanzung des Aberglaubens und der schädlichen Irrtümer“ begünstigen und
- die Entstehung und Entwicklung „richtiger Begriffe der moralischen Bildung im Volke“ verhindern,
- weshalb die fortdauernde Existenz der Mendikantenklöster zwecklos und schädlich für die Bürger ist.
In Altbaiern sind davon einundneunzig derartige kirchliche Einrichtungen betroffen. In München sind folgende Bettelorden betroffen: Kapuziner, Franziskaner, Karmeliten, Karmelitinnen, die Benediktinerinnen am Lilienberg , die Paulanerinnen im Lilienthal und das Pütrichkloster.
Zur zweckmäßigen Einrichtung der Bürger- und Landschulen wird ein Schulfonds eingerichtet, der aus dem Vermögen der aufgehobenen Orden gebildet wird, da es an anderweitigen staatlichen Mitteln mangelt.
Zur sofortigen Verminderung der Insassen werden
- alle Ausländer, das heißt, die nicht in Pfalzbaiern geborenen Klostermitglieder, in ihre Heimat geschickt,
- die Laienbrüder in die Prälatenklöster versetzt und
- Kleriker, die noch keine Profeß abgelegt haben, entlassen.
- Neuaufnahmen und das Überwechseln von Ordensangehörigen in andere Klöster wird streng untersagt.
- Priestermönche können unter bestimmten Voraussetzungen in den Weltpriesterstand übertreten, was dem Staat die Pensionskosten einsparen hilft.
- Alle übrigbleibenden Klosterindividuen sollen in Zentralklöster - in Wirklichkeit Aussterbeklöster - ihres Ordens verbracht werden.
- Außerdem ist den Franziskanern künftig nur noch Predigt und Beichthören in der eigenen Ordenskirche erlaubt, jedoch keinerlei Seelsorgeaushilfe.
- Dazu unterstehen sie der verschärften Aufsicht der zuständigen Landrichter.
Als Unterhalt für die Franziskaner setzt man, da ihnen das Almosensammeln verboten worden ist, jährlich 125 Gulden fest, zahlbar aus dem Vermögensfonds der nichtständischen Klöster.
- Der Inhalt des Aufhebungsdekretes wird öffentlich nicht bekannt gemacht.
- Die ganzen Vorbereitungen der staatlichen Klosteraufhebungen laufen bis zur Ausführung im Wesentlichen geheim.
- Das verstärkt die Unsicherheit und lässt jede Gegenwehr erlahmen.
- Ebenfalls besteht Unkenntnis über die Befugnisse der eingerichteten Spezialkommission.
Ausgenommen vom kurfürstlichen Aufhebungs-Dekret der Bettelordensklöster sind - aufgrund ihrer Tätigkeit in der Krankenpflege beziehungsweise im Schulwesen - die Klöster der Barmherzigen Brüder sowie der Englischen Fräulein und der Elisabethinerinnen. Das Kloster der Ursulinen in München wird mit den Nonnen de Notre Dame in Nymphenburg vereinigt.
In der Haupt- und Residenzstadt München gibt es nur ein ständisches Kloster: das Klarissen-Kloster zu Sankt Jakob am Anger.
2 1802 - Das „Hieronymiten-Kloster“ soll säkularisiert werden
München-Lehel * Der mit der Klosteraufhebung betraute „Rechnungskommissär“ Ilg findet Anfang Februar 1802 im Leheler Kloster zehn Patres und einen Frater vor.
Die „Hieronymiten“ werden den Bettelorden zugerechnet, weshalb man sie konsequenterweise in die Aufhebung der „nicht-ständischen Klöster“ mit einbezieht.
Weil aber die „Hieronymiten“ im Lehel auch die Seelsorge versehen, können sie die allgemeine Klosteraufhebung - trotz einiger Probleme - einige Jahre überdauern.
6. 2 1802 - Das Fanziskaner-Kloster wird säkularisiert
München-Graggenau * Graf Philipp von Arco beschlagnahmt im Franziskaner-Kloster das Bargeld und die Stiftungskapitalien. Im Franziskaner-Kloster leben dreißig Patres und fünf Laienbrüder. Sie sollen in das ehemalige Augustiner-Kloster in Ingolstadt gebracht werden.
7. 2 1802 - Das Karmeliten-Kloster wird säkularisiert
München-Kreuzviertel * Das Karmeliten-Kloster wird aufgehoben und das Bargeld sowie die Stiftungskapitalien eingezogen. Im Karmeliten-Kloster leben 31 Patres und vier Laienbrüder. Wer nicht in den Weltklerus wechselt, soll in das Franziskaner-Kloster in Straubing kommen, das zum Zentralkloster für die Karmeliten bestimmt worden ist.
17. 2 1802 - Graf Philipp von Arco wird Aufhebungskommissar für die Franziskaner
München-Graggenau * Graf Philipp von Arco wird zum lokalen Aufhebungskommissar für die Franziskaner bestimmt.
20. 2 1802 - Das Pütrich-Kloster wird säkularisiert
München-Graggenau * Das Pütrich-Kloster wird durch den Aufhebungskommissar von Kleber aufgehoben. 28 Chorfrauen und zehn Laienschwestern sind von dieser Maßnahme betroffen.
25. 2 1802 - Auflösung des ältesten Mönchskonvents der Stadt
München-Graggenau * Aufhebungskommissar Graf Philipp von Arco ist mit der Auflösung des ältesten Mönchskonvents der Stadt beauftragt worden. Ein genaues Inventar des Franziskaner-Klosters ergibt ein recht bescheidenes Kapitalvermögen. Umfangreich war hingegen der Bestand an Kunstwerken zur Ausstattung der Kirchen mit nicht weniger als fünfundzwanzig Altären.
Die Aufnahme des Personalbestandes ergibt,
- dass im Hauptkloster Sankt Anton dreißig Patres, drei Kleriker und vierzehn Laienbrüder leben,
- im Hospiz am Anger sind vier Patres und ein Laienbruder,
- im Hospiz Josephsburg drei Patres und ein Laienbruder untergebracht.
- Einen Laienbruder schickt man als Ausländer in seine Heimat Berchtesgaden zurück. Vier weitere Ausländer lässt man aus triftigen Gründen vorübergehend im Kloster.
- Für einen nicht transportfähigen alten und kranken Pater setzt sich Graf Arco nachdrücklich ein: „Ihn seinem Schicksal überlassen, hieße der ganzen Klosteraufhebung den Stempel der Grausamkeit aufdrücken und würde eine üble Wirkung bei dem Volke zurücklassen“.
- Fünf Laienbrüder werden in Abteien verwiesen, die übrigen Franziskaner sollen möglichst bald nach Ingolstadt gebracht werden.
Die Ordensmänner wissen zwar, dass ihr Kloster aufgehoben wird, darüber hinaus sind ihnen aber weder der genaue Zeitpunkt noch die besonderen Umstände mitgeteilt worden.
25. 2 1802 - Es ergeht eine wichtige Instruktion zur Klosteraufhebung
München-Graggenau * Es ergeht eine weitere wichtige Instruktion zur Klosteraufhebung. Sie ist unmittelbar für das Franziskanerkloster St. Anton in München bestimmt, wird aber richtungweisend für die tatsächliche Durchführung der Klosteraufhebungen.
Sofort nach Erhalt der Instruktion muss sich Graf Arco in das Kloster begeben, das Bargeld zählen und das übrige Klostervermögen feststellen. Anschließend haben sich alle Klostermitglieder im Refektorium zu versammeln, wo ihre Personalien, Beschäftigungen und besonderen Einsätze schriftlich festgehalten werden. Bei diesem überfallartigen Vorgehen geht es um Geld und sonstiges für die Staatskasse interessantes Vermögen und um weitere Einsparungen für den Staat.
Dem Kommissar ist eingeschärft worden, „diesen Auftrag in der vorgeschriebenen Ordnung mit allem Eifer, Schnelligkeit und der Sache angemessenen Anstand in Vollzug zu bringen“. Die Ergebnisse gehen an die Spezial-Klosterkommission.
Der weitere Inhalt der Instruktion lautet kurz gefasst:
- Alle Ausländer sind umgehend in ihre Heimat zu schicken; sie erhalten 25 Gulden Zehrgeld und einen Reisepass; aber Abreisetag und Reiseroute werden genau festgelegt.
- Wer gesund und nicht zu alt ist, muss drei Tage nach der Mitteilung auswandern; nur einige Alte und Gebrechliche erhalten Aufschub bis April.
- Das Sammeln auf der Reise ist den Mönchen strengstens verboten.
Alle inländischen Laienbrüder, die in das bürgerliche Leben zurückkehren wollen, erhalten zum Auszug 25 Gulden und die nötigen Kleider.
- Diejenigen, die den Ordensstand nicht verlassen wollen, sind - bis auf wenige, die noch zu den nötigsten Hausarbeiten als Gärtner, Köche, in der Brauerei und so weiter benötigt werden - auf die oberpfälzischen oder baierischen Prälatenklöster als Konventdiener oder Pfründner zu verteilen.
- Die nach Abzug der Kranken und Ausländischen verbliebenen sieben Laienbrüder des Münchener Franziskanerklosters sind in ständische Abteien zu schicken.
Die kurfürstliche Verordnung gibt auch Anweisung über den möglichen Rücktritt von Priestermönchen der Mendikantenorden in den Weltpriesterstand.
- Diese Mönche müssen sich einer Prüfung durch die Spezial-Klosterkommission unterziehen. Dabei werden weniger ihre theologischen Kenntnisse begutachtet, sondern vielmehr festgestellt, „ob die Austretenden auch im Sinne der Staatsauffassung genügend aufgeklärt“ sind.
- Haben die Aspiranten ihre Prüfung bestanden, erhalten sie von der Kommission die Erlaubnis zum Überwechseln mit einer jährlichen Pension von 125 Gulden.
26. 2 1802 - Die Säkularisation und die Michaels-Bruderschaft
Hofmark Berg am Laim * Die seit dem Jahr 1693 bestehende Zusammenarbeit zwischen der Michaels-Bruderschaft und dem Franziskaner-Orden dauerte bis zur Klosteraufhebung im Rahmen der Säkularisation an.
Bis diese staatlich verordnete Zwangsmaßnahme eintritt, verrichten die Münchner Franziskaner zum heiligen Antonius von Padua den Gottesdienst und die Seelsorge in den franziskanischen Frauenklöstern der Stadt und leiteten auch deren Wirtschaftsbetriebe. Bei den etwa sechzig Klarissen zu Sankt Jakob am Anger besitzen die Mönche eine ständige Niederlassung. Dieses Hospiz wird zumeist von zwei Patres und einigen Brüdern bewohnt.
3 1802 - Das Münchner „Augustinerkloster“ wird „Zentralkloster“
München-Kreuzviertel * Das Münchner „Augustinerkloster“ wird als „Zentralkloster“ für alle „Augustiner-Eremiten“ in „Kurbaiern“ genutzt.
So werden hier die vormaligen „Konvente“ aus Ingolstadt, Passau, Seemannshausen und Schönthal vereinigt.
Jene „Kleriker“, die noch nicht die „ewige Profess“ geleistet haben, werden freilich sofort aus dem Orden entlassen.
2. 3 1802 - Das Franziskaner-Hospiz Josephsburg wird aufgehoben
Hofmark Berg am Laim * Das Franziskaner-Hospiz Josephsburg in Berg am Laim wird aufgehoben.
3. 3 1802 - Freiherr von Leyden bereitet die Franziskaner auf die Abreise vor
München-Graggenau * Nachmittags um 16 Uhr erscheint Generallandesdirektionsrat Freiherr von Leyden mit einigen Amtspersonen im Franziskanerkloster und lässt alle Insassen ins Refektorium rufen. Dort teilt er den Ordensmännern mit, dass der Abtransport nach Ingolstadt unter den Bedingungen der „kurfürstlichen Instruktion“ am „kommenden Morgen um 3 Uhr, längstens 4 Uhr“, zu erfolgen hat.
Freiherr von Leyden hat die Weisung erhalten, dafür zu sorgen, dass „die hier bleibenden Individuen“ im Kloster verbleiben und nicht durch ihr „Ausgehen in die Stadt dem neugierigen Volke zu vielem Geschwätz Veranlassung“ geben.
4. 3 1802 - Die Franziskaner-Patres treten ihre Reise nach Ingolstadt an
München-Graggenau * Die Franziskaner-Patres treten - „ohne das geringste Hindernis“ - ihre Reise nach Ingolstadt an, wo das ehemalige Augustinerkloster für die Franziskaner als Aussterbekonvent bestimmt worden ist. In ihren Händen befindet sich der größte Schatz der Mönche, das Reliquiar des heiligen Antonius von Padua.
In Pfaffenhofen nehmen die Ordensmänner bei den dortigen Franziskanern das Mittagessen ein. Ohne Aufsehen zu erregen, haben sie „sofort nach eingenommenen Mittagsmahl die Reise ohne Aufschub weiter nach Ingolstadt fortzusetzen“.
17. 3 1802 - Aufforderung zur Gründung einer Kleinkinderbewahranstalt
<p><strong><em>München - München-Lehel - Au</em></strong> * Die Polizeidirektion wird mit der Gründung einer Einrichtung beauftragt, die dann als Kleinkinderbewahranstalt und heute - in der Weiterentwicklung - als Kindergarten oder Kinderhort bezeichnet wird. </p> <p>Im Focus stehen <em>„unbemittelte Eltern, die sich außer Haus begeben müssen, um sich vom täglichen Handlohn zu ernähren“</em>. Denn diese <em>„müssen häufig ihre kleinen Kinder einsperren oder unbesorgten Nachbarn anvertrauen, sie auch gar frei herumlaufen lassen, wodurch Unglücksfälle entstehen und die sittliche Erziehung benachteiligt wird“</em>. </p> <p>Eine solche Einrichtung soll in der Stadt und im Lehel eingerichtet werden. Auch das Gericht ob der Au und das Hofmarkgericht Haidhausen können Vorschläge einreichen. </p>
27. 3 1802 - 25 Kapuzinermönche werden nach Rosenheim gebracht
München-Kreuzviertel * In aller Frühe werden 25 Kapuziner in das Zentralkloster nach Rosenheim gebracht.
27. 3 1802 - Der Frieden von Amiens
<p><em><strong>Amiens</strong></em> * Der Zweite Koalitionskrieg wird mit dem Friedensschluss von Amiens zwischen Frankreich und England endgültig beendet. </p>
30. 3 1802 - Das Karmelitinnenkloster in Neuburg wird zum Zentralkloster
<p><em><strong>München</strong></em> * Kurfürst Max IV. Joseph bestimmt das Karmelitinnenkloster in Neuburg zum Zentralkloster des Frauenordens. </p>
Um den 1. 5 1802 - Im Benediktinerinnenkloster am Lilienberg leben 23 Nonnen
<p><strong><em>Au</em></strong> * Im Bendektinerinnenkloster am Lilienberg leben 17 Chorfrauen und sechs Laienschwestern im Konvent. Zwei Novizinnen werden sofort entlassen, eine 73-jährige geistesgestörte Nonne wird in die <em>„Irrenanstalt“</em> gebracht. </p>
22. 5 1802 - Den Benediktinerinnen vom Lilienberg wird ihre Versetzung mitgeteilt
Au * Den Benediktinerinnen vom Kloster Lilienberg wird ihre Versetzung mitgeteilt. Jeder wird erlaubt, ihr Bett und den übrigen Hausrat ihrer Zelle mitzunehmen. Um jegliches Aufsehen zu vermeiden wird einigen Nonnen erlaubt, ihre Eltern und Verwandten in München in geschlossenen Wägen zu besuchen.
24. 5 1802 - Geheimvertrag mit Frankreich über Landabtretungen
Kurfürstentum Baiern * Für Baiern beginnen die Landzugewinne. Kurfürst Max IV. Joseph hat mit Frankreich in einem Geheimvertrag vereinbart, dass er die vertraglich zugewiesenen Territorien noch vor der Verabschiedung des Reichsdeputationshauptschlusses militärisch in Besitz nehmen kann.
29. 5 1802 - Die ersten Benediktinerinnen vom Lilienberg kommen nach Geisenfeld
Au * In der Frühe um 4 Uhr werden die ersten der zwanzig verbliebenen Benediktinerinnen vom Kloster Lilienberg in das ständische Kloster der Benediktinerinnen nach Geisenfeld gebracht.
31. 5 1802 - Die restlichen Benediktinerinnen vom Lilienberg werden versetzt
Au * Die restlichen Benediktinerinnen vom Kloster Lilienberg werden in die ständischen Klöster der Benediktinerinnen nach Kühbach und Hohenwart gebracht. Die Mädchenschule wird von zwei weltlichen Lehrerinnen weitergeführt.
Anfang 6 1802 - Versteigerung des Mobiliars aus dem „Kloster am Lilienberg“
Au * Die Versteigerung des Mobiliars aus dem „Kloster am Lilienberg“ bringt 3.024 Gulden in die Staatskasse.
7. 6 1802 - Wallfahrer der Marianischen Kongregation nach Andechs
Andechs * Wallfahrer der Marianischen Kongregation halten sich an diesem Pfingstmontag auf dem heiligen Berg in Andechs auf.
8. 6 1802 - Ausschreitungen nach der Andechs-Wallfahrt
München-Kreuzviertel * Nachmittags um 17 Uhr kehren die Wallfahrer vom heiligen Berg in Andechs zurück. Sie ziehen feierlich durch das Sendlinger Tor in die Stadt ein. Nachdem der Pfingstdienstag als Feiertag und damit auch das Abhalten von Prozessionen bereits im Jahr 1771 abgeschafft worden war, schreitet das Militär ein.
Es kommt zu Ausschreitungen. Eine rund 300 Personen umfassende Gruppe stürmt zur Hauptwache am Schannenplatz und weiter in Richtung Bürgersaal. Das Militär kann sich durchsetzen und die Protestierer zurückdrängen.
9. 6 1802 - Die Ausschreitungen setzen sich fort
München * Über die ganze Stadt verteilt sind militärische Patrouillen zu Pferd und zu Fuß. Die ersten Handwerksgesellen treten in den Streik.
10. 6 1802 - Das Militär nimmt Handwerksgesellen fest
München * Das Militär durchstreift die Stadt und nimmt Handwerksgesellen fest. Um 11 Uhr wird mit Trommelschlag ausgerufen, dass man gegen jene Handwerksburschen militärische Gewalt anwenden wird, wenn sie sich nicht den Anordnungen fügen würden.
11. 6 1802 - Es ist wieder Ruhe in der Stadt eingekehrt
München * Es ist wieder Ruhe in der Stadt eingekehrt. Die Handwerksburschen dürfen sich auch wieder bis elf Uhr nachts in ihren Herbergen aufhalten.
15. 6 1802 - Die Karmelitinnen werden nach Neuburg an der Donau gebracht
München-Kreuzviertel - Neuburg * Um 4 Uhr früh wird ein Teil der zwanzig Karmelitinnen und zwei Novizinnen auf Wägen gesetzt und in ihre neue Niederlassung nach Neuburg gebracht, wo sie am späten Abend ankommen. Zu Protesten der Bevölkerung kommt es nicht.
19. 6 1802 - Die restlichen Karmelitinnen werden ins Zentralkloster gebracht
München-Kreuzviertel - Neuburg * Um 4 Uhr früh werden die restlichen Karmelitinnen in ihre neue Niederlassung nach Neuburg gebracht.
20. 6 1802 - Die Gräber auf dem Franziskaner-Friedhof werden geöffnet
München-Graggenau * Die Gräber auf dem Franziskaner-Friedhof werden geöffnet.
28. 6 1802 - Die Abbrucharbeiten am Franziskaner-Kloster beginnen
München-Graggenau * Die Abbrucharbeiten am Franziskaner-Kloster beginnen.
1. 7 1802 - Maria Leopoldine kauft das Landsassengut zu Stepperg
Stepperg * Die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine kauft das Landsassengut zu Stepperg mit den dazugehörenden Bauernhöfen in Rennertshofen und Mauern um den Preis von 71.200 Gulden.
18. 7 1802 - Aufhebung des Karmelitenklosters
München-Kreuzviertel * Die Regierung Montgelas ordnet die Aufhebung des Karmelitenklosters an. Anfangs bezieht das Militär die aufgelassenen und leerstehenden Klosterräume, bis Teile für das Neue Gymnasium, das spätere Ludwigs-Gymnasium, eingerichtet und andere Teile zum Königlichen Erziehungsinstitut für Studierende, dem sogenannten Hollandeum, ausgebaut werden können.
23. 7 1802 - Die Karmeliten werden nach Straubing gebracht
München-Kreuzviertel * Dreißig Karmeliten und vier Laienbrüder werden in das ehemalige Franziskaner-Kloster nach Straubing gebracht.
12. 8 1802 - Mühldorf soll von Salzburg abgetreten werden
Mühldorf * Siegmund Christoph von Hartmann, der Pfleger von Mühldorf am Inn, meldet dem Hofratsdirektorium in Salzburg, dass „Mühldorf an die weise und gerechte Regierung von Baiern“ abgetreten werden soll.
15. 8 1802 - Die Hieronymiten-Mönche sollen nach Indersdorf versetzt werden
München-Lehel * Es wird beschlossen, dass die Hieronymiten-Mönche am 21. August nach Indersdorf versetzt werden.
19. 8 1802 - Baierns Militär marschiert in Mühldorf ein
Mühldorf * Baierns Militär marschiert um 16:30 Uhr in das zum Fürstbistum Salzburg gehörende Mühldorf am Inn ein und nimmt die Stadt militärisch in Besitz.
19. 8 1802 - Die Grafschaft Werdenfels wird durch baierische Truppen besetzt
Werdenfelser Land * Kurfürst Max IV. Joseph lässt die zu Freising gehörende Grafschaft Werdenfels durch baierische Truppen besetzen.
19. 8 1802 - Die Stadt Salzburg und die Fürstprobstei Berchtesgaden werden besetzt
Salzburg - Berchtesgaden * Die Stadt Salzburg und die Fürstprobstei Berchtesgaden werden von den österreichischen Truppen für Ferdinand III. von Toskana, dem jüngeren Bruder von Kaiser Franz, militärisch besetzt.
20. 8 1802 - Aktiver Widerstand erscheint als nicht angemessen
Salzburg - Mühldorf * Das in Salzburg sitzende Hofratsdirektorium teilt dem Mühldorfer Pfleger Siegmund Christoph von Hartmann mit, dass für eine militärische Besetzung der Stadt keine rechtlichen Grundlagen vorhanden wären und diese einen massiven Rechtsbruch darstellen würde. Doch sei angesichts der Lage ein „aktiver Widerstand nicht angemessen“.
21. 8 1802 - Die ehemaligen Hieronymiten werden zu Weltpriester
München-Lehel * Entgegen der bisherigen Pläne können die ehemaligen Hieronymiten als Weltpriester in ihrem Kloster bleiben und auch weiterhin die Seelsorge im Lehel versehen. Das ist auch der Grund, weshalb die Paramente und Kirchengeräte nicht versteigert, sondern später der Pfarrkirche zugeteilt werden.
23. 8 1802 - Baierisches Militär marschiert in das Fürstbistum Freising ein
Freising * Kurfürst Max IV. Joseph lässt das Militär in das Fürstbistum Freising einmarschieren.
24. 8 1802 - Die Reichsdeputation tritt in Regensburg erstmals zusammen
Regensburg * Die Reichsdeputation, die Durchführung des Entschädigungsplans aus dem Friedensvertrag von Lunéville ausarbeiten soll, tritt in Regensburg erstmals zusammen.
14. 9 1802 - Die Auer Paulanerinnen werden in Aussterbeklöster gebracht
Au * Weil es kein zweites Paulanerinnen-Kloster in Baiern gibt, werden die 17 Schwestern in ständische Frauenklöster zur unentgeltlichen Verpflegung versetzt. Am 14. und 15. September werden die Paulanerinnen vom Kloster Lilienthal in der Au in ihre ihnen zugewiesene Klöster abtransportiert:
- sechs zu den Brigittinnen nach Altomünster,
- sechs ins Zisterzienserinnenkloster Niederschönenfeld und
- die restlichen fünf ins Augustinerinnenkloster Niederviehbach.
1. 10 1802 - Mühldorfer Bürger freuen sich auf die Einverleibung nach Baiern
München-Schloss Nymphenburg - Mühldorf * Eine Abordnung Mühldorfer Bürger überreicht dem Kurfürsten Max IV. Joseph im Schloss Nymphenburg eine Bittschrift, in der sie zum Ausdruck bringen, wie sehr sich die Bevölkerung freut „dem durchläuchtigsten Churhause Baiern einverleibt“ zu werden. Damit gehe „ein Wunsch, der schon Jahr Zehnte in unseren Herzen glühte in Erfüllung“.
4. 10 1802 - Eine weltliche Lehrerin betreibt die ehemalige Klosterschule am Lilienberg
Au * Eine weltliche Lehrerin betreibt die ehemalige Klosterschule am Lilienberg. Nachdem Ende Mai die Benediktinerinnen vom Kloster Lilienberg weggebracht worden waren, hatten achtzig Schülerinnen keine Lehrerin mehr.
11. 10 1802 - Das Paulaner-Bräuhaus erhält eine reale Bräugerechtigkeit
Au * Dem bisher als Klosterbrauerei geführten Paulaner-Bräuhaus wird eine „ordentliche und reale Bräugerechtigkeit“ bewilligt.
11 1802 - Der „Staat“ erhält die Entschädigung für die „Verlegung der Brücke“
Freising * Nach der „Säkularisierung Freisings“ erhält der „Baierische Staat“ die jährliche Pauschalsumme als „Rekognition für die Verlegung der Brücke“.
11 1802 - Die Gebäude des „Franziskanerklosters“ werden „auf Abbruch“ versteigert.
München-Graggenau * Die Gebäude des „Franziskanerklosters“ werden an die Meistbietenden „auf Abbruch“ versteigert.
Die „Franziskanerkirche“ erwirbt der „Hutmacher“ Johann Giglberger um 1.152 Gulden zur sofortigen „Demolierung“.
11 1802 - Auch das „Franziskaner-Klostergebäude“ verschwindet
München-Graggenau * Mit dem Abbruch der „Franziskaner-Klostergebäude“ verschwindet auch der Friedhof mit seinen Gruftkapellen und den Gräbern zahlreicher Persönlichkeiten.
Einige Grabplatten werden vorsorglich als historische Monumente an die „Frauenkirche“ übergeben.
Graf Törring-Gronsfeld lässt drei Epitaphen von Familienangehörigen in die Bogenhauser „Georgskirche“ bringen.
Das Epitaph des im Jahr 1594 verstorbenen Renaissancekomponisten Orlando di Lasso befindet sich im „Nationalmuseum“, den Schädel des Wilhelm von Occam erhielt die „Bayerische Akademie der Wissenschaften“.
Und noch beim Bau der Tiefgarage auf dem „Max-Joseph-Platz“ beförderten die Bagger eine große Zahl von Knochen zutage.
3. 11 1802 - Das Wilhelms-Gymnasium kommt ins ehemalige Karmeliten-Kloster
München-Kreuzviertel * Das ehemalige und inzwischen umgebaute Karmeliten-Kloster nimmt das Wilhelms-Gymnasium, das bisher im ehemaligen Jesuitenkolleg untergebracht war, auf. Es bleibt bis 1826 in diesen Räumen.
23. 11 1802 - Die Reichsdeputation beschließt den Reichsdeputationshauptschluss
Regensburg * Die Reichsdeputation beschließt in seiner 30. Sitzung den Reichsdeputationshauptschluss. Dieser bildet die Grundlage für die Aufhebung der Geistigen Staaten und der Landsässigen Klöster, die der „freien und vollen Disposition der respectiven Landesherren“ überlassen werden. Baiern vollzieht daraufhin offiziell die Inbesitznahme der ihm zugeteilten Territorien:
- Die Fürstbistümer Freising, Augsburg, Bamberg, Würzburg
- sowie Teile der Fürstbistümer Eichstätt, Passau und Salzburg.
Damit werden große Teile Schwabens und Frankens baierisch.
24. 11 1802 - Aretin übernimmt die Zivilbesitzergreifung des Hochstifts Freising
Freising - Mühldorf * Kurfürst Max IV. Joseph ernennt Johann Adam Freiherr von Aretin zum Generalkommissar für die Zivilbesitzergreifung des Hochstifts Freising sowie der Stadt Mühldorf und gibt ihm weitreichende Vollmachten.
26. 11 1802 - Freiherr von Aretin nimmt per Dekret die Stadt Mühldorf in Besitz
Mühldorf * Kurfürst Max IV. Joseph bevollmächtigt Johann Adam Freiherr von Aretin per Dekret die Stadt Mühldorf in Besitz zu nehmen.
27. 11 1802 - Freising und die Zugspitze werden bairisch
Freising * Da sich der kranke Freisinger Bischof Joseph Conrad Freiherr von Schroffenberg-Mös in Berchtesgaden aufhält, überreicht der kurfürstliche Generalkommissär Johann Adam von Aretin dem Freisinger Hofrat das Besitzergreifungspatent.
Damit nimmt er für das Kurfürstentum Baiern zivilrechtlich Besitz von Freising, wozu auch die Herrschaft Isen-Burgrain und die Grafschaft Werdenfels gehören. Dadurch werden nicht nur viele Untertanen, sondern auch die Zugspitze baierisch.
Für Freising bedeutet das das Ende der geistlichen Herrschaft. Die Stadt wird eine ganz normalen baierischen Municipalgemeinde.
1. 12 1802 - Mühldorf am Inn wird bairisch
Mühldorf * Der kurfürstliche Generalkommissar für die Zivilbesitzergreifung des Hochstifts Freising sowie der Stadt Mühldorf, Johann Adam Freiherr von Aretin, nimmt zivilrechtlich Besitz von der Stadt Mühldorf am Inn.
2. 12 1802 - Freiherr von Aretin trifft in Mühldorf ein und nimmt Besitz von der Stadt
Mühldorf * Johann Adam Freiherr von Aretin nimmt - unter großem Jubel der Bevölkerung - mit dem Besitzergreifungspatent vom 26. November offiziell Besitz von der Stadt Mühldorf am Inn. Er weist das Pfleggericht an, ab sofort keine Weisungen und Befehle mehr aus Salzburg entgegenzunehmen.
Nach der Vereidigung der Beamten findet ein feierlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche statt. Am Abend wird in der Stadt gefeiert.
3. 12 1802 - Aretin übernimmt die Zivilbesitzergreifung der Grafschaft Werdenfels
Werdenfelser Land * Freiherr Johann Adam von Aretin erhält den kurfürstlichen Auftrag, die „Zivilbesitzergreifung der Reichsgrafschaft Werdenfels“ nicht auf dem normalen Verwaltungsweg über Freising aus, sondern vor Ort durchzuführen.
5. 12 1802 - Johann Adam Freiherr von Aretin trifft in Mittenwald ein
Mittenwald - Garmisch * Um 10:30 Uhr vormittags trifft Johann Adam Freiherr von Aretin in Mittenwald ein. Er wird von einer jubelnden Menschenmenge begrüßt.
Gleiches passiert bei seiner Ankunft in Garmisch gegen 15 Uhr.
6. 12 1802 - Besitzergreifungsfeierlichkeiten in der Reichsgrafschaft Werdenfels
Werdenfelser Land * Freiherr Johann Adam von Aretin eröffnet um 8:30 Uhr mit einem Festgottesdienst die Besitzergreifungsfeierlichkeiten der Reichsgrafschaft Werdenfels. Damit endet die über 500 Jahre andauernde bischöfliche Herrschaft über das Werdenfelser Land. An den öffentlichen Gebäuden wird das kurbaierische Wappen angebracht und die „Zivilbesitzergreifung durch Verruf“ bekannt gemacht. An der großen mittäglichen Festtafel dürfen allerdings nur geladene Gäste teilnehmen.
12. 12 1802 - Die Hieronymitaner treten erstmals in der Kleidung der Weltpriester auf
München-Lehel * Die Hieronymitaner im Lehel treten erstmals in der Kleidung der Weltpriester auf. Das Kloster bleibt weiterhin bestehen.
13. 12 1802 - Das Karmelitinnen-Kloster wird der Pfandhausverwaltung überlassen
München-Kreuzviertel * Das ehemalige Karmelitinnen-Kloster am Rochusberg wird um 34.000 Gulden der Pfandhausverwaltung überlassen.
18. 12 1802 - 19 Pütrich-Nonnen begeben sich auf ihre Reise nach Reutberg
München-Graggenau * 19 der vierzig Nonnen aus dem Pütrich-Kloster und ihr Beichtvater begeben sich auf ihre Reise nach Reutberg.
23. 12 1802 - Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt
Kurfürstentum Baiern * Der Schulzwang, die allgemeine Schulpflicht, für „alle Kinder vom 6. bis 12. Lebensjahre“, wird eingeführt. Wöchentlich müssen von den Eltern dafür 2 Kreuzer bezahlt werden. An diese Grundschulzeit schließt sich für die 13- bis 18-jährigen eine Sonntagsschule an, in der ihnen der Katechismus und weiteres Grundwissen gelehrt wird.
Der Staat ist damit für die Erziehung verantwortlich, weshalb er neue Schulen und bessere Lehrer braucht. Dafür werden eigene Lehrerseminare eingerichtet. Die lokale Schulaufsicht liegt freilich weiterhin bei den Pfarrern.
29. 12 1802 - Die restlichen 21 Pütrich-Nonnen verlassen München
München-Graggenau * Die restlichen 21 Pütrich-Nonnen verlassen München in Richtung Reutberg.
1803 - Die „Mariahilf-Kirche“ wird zur Pfarrkirche der Au ernannt
Au * Die „Mariahilf-Kirche“ wird zur Pfarrkirche der Au ernannt.
1803 - Es bestehen noch zwei „Baierweinschenken“
München * Es bestehen noch zwei „Baierweinschenken“, die jedoch mit Rücksicht auf den Geschmack des Publikums zugleich als „Bierwirschaften“ zugelassen sind.
Um 1803 - Maximilian Joseph von Montgelas kauft den „Sitz Stepperg“
Bogenhausen * Staatsminister Maximilian Joseph von Montgelas kauft den „Sitz Stepperg“ in Bogenhausen.
1803 - Stephan Selmayr wird Eigentümer des „Hansmarterhofs“
Bogenhausen * Mit der „Säkularisation“ wird Stephan Selmayr Eigentümer des „Hansmarterhofs“ in Bogenhausen.
Bis 1803 - Das heutige Stadtgebiet gehört zu vier verschiedenen „Gerichtsbezirken“
München * Das heutige Stadtgebiet gehört - neben dem „Münchner Burgfrieden“ zu vier verschiedenen „Gerichtsbezirken“: den „Landgerichten“
- Dachau,
- Starnberg,
- Wolfratshausen und
- Kranzberg sowie
- der als Ausland geltenden „Grafschaft Ismaning“.
1803 - Die profanierte „Klosterkirche am Lilienberg“ dient als „Eisenfronfeste“
München - Au * Mit der Verstaatlichung des Münchner Gerichtswesens und der Polizei gibt die Stadt ihre „Fronfeste im Rathaus“ und die „Haftstube im Rathausturm“ an das nunmehr staatliche „Stadtgericht“ ab.
Die profanierte „Klosterkirche am Lilienberg“ und der nördlich daran anschließende Seitenflügel dient als „Eisenfronfeste“, als „Strafvollzugsanstalt“.
1803 - Kaspar Barthmann kauft die „Singlspielerbrauerei“ mit allen Zubehör
München-Angerviertel - Au * Der Auer Wirt Kaspar Barthmann kauft die „Singlspielerbrauerei“ mit allen Zubehör: von der Bettwäsche und den Zinntellern über Brauerei- und Schäfflerrequisiten, Wagen und Pferde, Häuser, Märzenkeller und Wiesengründe.
1803 - Max IV. Joseph gründet die „Musterlehranstalt für Landwirthschaft“
Weihenstephan * Kurfürst Max IV. Joseph gründet im säkularisierten Klostergut von Weihenstephan die erste baierische „Musterlehranstalt für Landwirthschaft“.
Damit wird das Bierbrauen erstmals zum wissenschaftlichen Lehrgegenstand erhoben.
1803 - Friedrich Ludwig Sckell übernimmt die Oberaufsicht über das „Gartenwesen“
München-Englischer Garten * Friedrich Ludwig Sckell wird die Oberaufsicht über das gesamte „Gartenwesen“ übertragen.
Der von Rumford angelegte „Theodor-Park“ war - wenn auch dem „allgemeinen Publikum“ gestiftet - in seiner Ausstattung doch auf eine Gesellschaft abgestimmt, die eher im höfischen Leben beheimatet ist.
1803 - Das „Hofkrankenhaus“ wird in eine „Irrenanstalt“ umgewandelt
Au * Das „Hofkrankenhaus für kurfürstliche Hofbedienstete“ am heutigen Kolumbusplatz wird in eine „Irrenanstalt“ umgewandelt.
Bis dahin sind die Geisteskranken im „Haus für Wahnsinnige“ im Münchner „Heiliggeistspital“ untergebracht. Da die Räume im „Heiligeistspital“ für die „Irren“ auf Dauer aber nicht ausreichen, kommt es zur Verlegung an den Kolumbusplatz, wo diese Einrichtung unter dem Titel: „Magistratisches Krankenhaus zu München“ oder auch „Irrenhaus Giesing“ zum schlechten Ruf der Vorstadt beiträgt.
Bis dahin befinden sich im Heiliggeist-Spital „22 Narren“. Im „Josephsspital“ sind neben anderen Kranken und „Pfründnern“ noch epileptische Patienten - die sogenannten „unschädlichen Narren“ - untergebracht.
Das Erdgeschoss des „Giesinger Irrenhauses“ ist für die „ganz Tollen“ bestimmt und enthält - neben dem Wärterzimmer - dreizehn Zellen. Jede Zelle hat zwei Türen: die dicke innere, welche von außen versperrt werden kann und die äußere Türe, die aus Holz ist und die „Ausbrüche der Tollheit“ weniger hörbar machen soll. Das obere Stockwerk ist für ruhige „Wahnsinnige“ bestimmt. Es enthält neun Zellen und ein Wächterzimmer. Im „Irrenhaus“ ist eine Kapelle eingerichtet, die mit einem „eisernen Vorhang“ vom „Speisezimmer der Irren“ abgetrennt ist. Besonders verehrt werden dort die „Haare der Muttergottes“. Das sind „Berührungsreliquien“, die die „echten Haare der Muttergottes“ - aus dem „Pantheon“ zu Rom - berührt haben.
1803 - Das „Kurfürstentum Baiern“ wird Eigentümer der „Giesinger Mühle“.
Untergiesing * Mit der „Säkularisation“ und der damit verbundenen Klosterauflösung wird der „Kurfürstentum Baiern“ Eigentümer der „Giesinger Mühle“.
1803 - Das „Dianabad“ beim „Englischen Garten“ öffnet seine Pforten
München-Englischer Garten * Das „Dianabad“ beim „Englischen Garten“ öffnet seine Pforten.
Zur luxuriösen Ausstattung gehören neben 51 Hotelzimmern auch zwei geräumige und mit viel Pomp ausgestattete „Festsäle“.
Die Badewannen bestehen aus innen verzinktem Kupfer.
Ab 1803 - Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas wird „Finanzminister“
München * Von 1803 bis 1806 übt Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas die Tätigkeit des „Finanzministers“ aus.
1803 - Im Kaffeehaus gibt es Erfrischungen aller Art
München-Graggenau * In einer Stadtbeschreibung wird über das Treiben im „Hofgarten“ folgendes berichtet:
„Hier wird an Sonn- und Feiertagen jeder neue Putz zur Schau getragen, hier ist der offene Markt der Reize, hier wird geschmachtet, geseufzt, getändelt und geliebäugelt. [...]
Zuckerwerk und andere Näschereien werden feilgeboten, das außen angebaute Kaffeehaus reicht Erfrischungen aller Art“.
10. 1 1803 - Das Religionsedikt bringt die Gleichberechtigung
München-Kreuzviertel * Das Religionsedikt bringt die Gleichberechtigung von Katholiken, Lutheraner und Reformierten. Aus Anlass der Aufnahme fränkischer und schwäbischer Gebiete in den immer größer werdenden baierischen Staat kommt es zu nachstehenden Bestimmungen:
„Bei künftiger Besetzung der Staatsämter werden Wir nur auf die Würdigsten, ohne Unterschied der im deutschen Reiche eingeführten drei christlichen Religionen [gemeint sind die Katholiken, Lutheraner und Reformierten] den landesväterlichen Bedacht nehmen. Keinem unserer Untertanen, von welcher Konfession er sei, soll je etwas zugemutet werden dürfen, welches seiner Religions- oder Gewissensfreiheit entgegen wäre."
Doch der Mann, der die positive Entwicklung der evangelischen Kirche in Bayern bremsen wird, steht in der Person des Kronprinzen Ludwig I. schon bereit.
19. 1 1803 - Die Gebeine der verstorbenen Karmelitinnen entfernt
München * In der Nacht des 19. Januar 1803 wirft man die Gebeine der Maria Anna Lindmayr zusammen mit den Überresten anderer verstorbener Klosterschwestern auf einen städtischen Müllwagen, transportiert das Ganze auf den Alten Südlichen Friedhof und verscharrt alles in einem Massengrab.
11. 2 1803 - Bischof Colloredo unterzeichnet die Abdankungserklärung für Salzburg
Wien - Salzburg * Der im Wiener Exil lebende Salzburger Erzbischof Hieronymus Franz de Paula Graf von Colloredo unterzeichnet die Abdankungserklärung und ruft seine Salzburger Untertanen auf, „dem neuen Herrn [..] die Treue und Anhänglichkeit künftig fort zu bewahren“.
Vom selben Tag stammt die Besitzergreifungsurkunde für Salzburg des Großherzogs Ferdinand III. von Toskana.
15. 2 1803 - Großherzogs Ferdinand III. von Toskana Besitz nimmt Besitz von Salzburg
Salzburg * Heinrich Freiherr von Crumpipen nimmt im Auftrag des Großherzogs Ferdinand III. von Toskana Besitz von Salzburg.
Der bisherige „Statthalter“ des Salzburger Erzbischofs Hieronymus Franz de Paula Graf von Colloredo, Sigmund Christoph Graf von Zeil-Trauchburg, wird von seinen weltlichen Regierungsaufgaben entbunden.
25. 2 1803 - Die letzte Tagung des Immerwährenden Reichstags
Regensburg * Die letzte Tagung des „Immerwährenden Reichstags“ befasst sich mit der Annahme des Reichsdeputationshauptschlusses. Es ist das letzte bedeutende Gesetz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und behandelt die Neuordnung des Reiches.
Im Reichsdeputationshauptschluss erfolgt die Kompensation für die Abtretung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich.
Grundlage für den Text ist ein im Juni 1802 zwischen Frankreich und Österreich vereinbarter Entschädigungsplan, der wiederum auf den am 9. Februar 1801 geschlossenen Friedensvertrag von Lunéville zurückgeht.
Die Wittelsbacher haben aber nicht nur die Herzogtümer Zweibrücken und Jülich sowie die linksrheinische Kurpfalz verloren, sondern müssen jetzt auch noch die rechtsrheinische Kurpfalz um Mannheim und Heidelberg an Baden abgeben.
Doch durch den § 2 des Reichsdeputationshauptschlusses erhält das kurfürstliche Baiern
- das Fürstbistum Freising mit der dazugehörigen Grafschaft Werdenfels und die Herrschaft Isen-Burgrain offiziell überschrieben;
- dazu die Fürstbistümer Augsburg, Bamberg und Würzburg sowie Teile von Eichstätt, Passau und Salzburg.
- Zu den genannten Territorien kommen noch 15 Reichsstädte und 13 Reichsabteien dazu. Freilich noch nicht die Großen: Augsburg und Nürnberg.
- Doch damit werden wesentliche Teile Schwabens und Frankens bairisch.
Insgesamt stehen dem Verlust von 200 Quadratmeilen und 730.000 Einwohnern ein Gewinn von 288 Quadratmeilen und 834.000 Einwohnern aus den aufgelösten geistlichen Staaten und wirtschaftliche Werte von über 43 Millionen Gulden von den Klöstern gegenüber.
3 1803 - Das „Pütrich-Kloster“ wird verkauft
München-Graggenau * Das „Pütrich-Kloster“ wird verkauft.
26. 3 1803 - Der Schulfond erhält das Paulanerinnen-Kloster im Lilienthal
<p><strong><em>Au</em></strong> * Das ehemalige Paulanerinnen-Kloster im Lilienthal wird dem Schulfond übergeben. Das Kloster wird zum Pfarrhof sowie ein Schulhaus für je eine Jungen- und eine Mädchenschule und einer weiblichen Feiertagsschule. </p>
27. 3 1803 - Maximilian Joseph von Montgelas erwirbt ein Barock-Palais
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Freiherr Maximilian Joseph von Montgelas erwirbt vom Grafen Maximilian Johann Nepomuk de la Perouse [Perusa] für 66.000 Gulden ein Barock-Palais. Da Freiherr von Montgelas seinen Wohnsitz zugleich auch als Ministerbüro und für repräsentative Zwecke nutzen will, gibt ihm sein Arbeitgeber Kurfürst Max IV. Joseph 53.000 Gulden als Geschenk dazu. </p> <p>Montgelas beauftragt für die Umbau- und Vergrößerungsplanungen den aus Portugal stammenden und gerade zum Oberbaukommissär beim Ministerium des Innern ernannten Emanuel Joseph von Herigoyen mit der Vergrößerung des Palais. Das palastartige Gebäude am Promenadeplatz 2/ Ecke Kardinal-Faulhaber-Straße trägt den Namen seines Erbauers: Palais Montgelas. </p>
4. 4 1803 - Der letzte Freisinger Bischof, Joseph Conrad von Schroffenberg-Mös, stirbt
<p><strong><em>Berchtesgaden</em></strong> * Joseph Conrad von Schroffenberg-Mös, der letzte Freisinger Bischof, stirbt in Berchtesgaden. Sein Bischofsstuhl wird erst 1818 wieder besetzt. </p>
24. 4 1803 - Katholische Traditionen werden als Unfug verboten
München * Die „zweckwidrigen Ceremonien am Himmelfahrtstag und Pfingstsonntag“ werden verboten. Gemeint sind das Aufziehen einer Christus-Figur und das Herablassen einer weißen Taube als heiliger Geist.
27. 4 1803 - Der „Reichsdeputationshauptschluss“ tritt in Kraft
Regensburg * Mit der „kaiserlichen Ratifikation“ tritt der „Reichsdeputationshauptschluss“ formell in Kraft.
28. 4 1803 - Den Bruderschaften wird das Tragen von Kutten verboten
München * Den Bruderschaften wird das Tragen von Kutten verboten.
29. 4 1803 - Großherzog Ferdinand III. von Toskana zieht in Salzburg ein
Salzburg * Großherzog Ferdinand III. von Toskana hält feierlichen Einzug in die Stadt Salzburg und wählt Schloss Mirabell zu seiner Residenz.
9. 5 1803 - Kurfürst Max IV. Joseph kauft von Stephan von Stengel Schloss Biederstein
Schwabing * Kurfürst Max IV. Joseph kauft von Stephan von Stengel um 18.000 Gulden den Edelsitz Biederstein. In der Folge wird das Schloss durch den Hofbaumeister Franz Thurn aufgestockt und um zwei Seitenflügel zu einem „Feensitz“ erweitert. Die Umgebung wird durch Friedrich Ludwig Sckell im englischen Stil zu einem Landschaftsgarten umgestaltet.
18. 5 1803 - Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten werden erlaubt
München * Kurfürst Max IV. Joseph erlaubt sogenannte Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten.
23. 5 1803 - England erklärt Frankreich den Krieg
London - Paris * Großbritannien erklärt Frankreich den Krieg. Die Kriegserklärung geht zwar von England aus, aber Napoleons Hegemonialpolitik hat stark zum Ausbruch des Krieges beigetragen.
17. 7 1803 - Salzburg wird Kurfürstentum
Wien - Salzburg * Der deutsch-römische Kaiser Franz II. erhebt Salzburg zum Kurfürstentum.
8 1803 - Eine royalistische Verschwörung gegen Napoleon wird aufgedeckt
Paris * Von der französischen Geheimpolizei wird eine royalistische Verschwörung aufgedeckt, die angeblich die Ermordung Napoleon Bonapartes und die Einsetzung von General Jean-Victor-Marie Moreau zum neuen Herrscher zum Ziel hat.
Dieser wird aber zu Unrecht beschuldigt.
23. 8 1803 - Die Heilige Stiege am Gasteigberg wird abgerissen
Haidhausen * Die Heilige Stiege zum Kruzifix am Gasteigberg wird abgerissen.
Nach dem 25. 8 1803 - Österreich zieht einen Gewinn aus der baierischen Säkularisation
München-Angerviertel - Wien * In der Haupt- und Residenzstadt München gibt es nur ein ständisches Kloster: das Klarissen-Kloster zu Sankt Jakob am Anger, dessen Äbtissin Mitglied der Landschaft ist. Es ist eines der siebzig Landsässigen Klöster in Altbaiern, das durch den verfassungsrechtlichen Schutz erst im Jahr 1803 aufgehoben werden kann.
Auch Österreich zieht - damals noch als baierischer Verbündeter - einen erheblichen Gewinn aus der Aufhebung der baierischen Klöster. Diese haben ihre Aktiva - aufgrund der in Baiern nicht vorhandenen Bankhäuser - bei der Wiener Bank angelegt. Nach der Klosteraufhebung kassiert Österreich diese Guthaben ein und beschlagnahmt deren Grundherrschaften, vor allem Weingüter in Südtirol und in anderen habsburgischen Gebieten. Baiern muss dagegen die Schulden der Klöster übernehmen.
9 1803 - Die „Mädchenschule“ im „Kloster Lilienberg“ wird geschlossen
Au * Die „Mädchenschule“ im ehemaligen „Benediktinerinnenkloster am Lilienberg“ wird geschlossen.
5. 9 1803 - Das Landgericht München zieht ins ehemalige Kloster Lilienberg
Au * Das Landgericht München bezieht die Räume im ehemaligen Kloster Lilienberg. Es umfasst neben den Orten des Gerichts ob der Au das Amt Perlach vom Landgericht Wolfratshausen, das Gebiet Neuhausen vom Landgericht Dachau, die Gebiete Gauting und Germering aus dem Landgericht Starnberg sowie Fröttmaning und Garching aus dem Landgericht Kranzberg. Dazu die Orte Ismaning, Ober- und Unterföhring, Daglfing und Englschalking aus dem kurz zuvor staatlich eigenständigen Fürstbistum Freising.
30. 9 1803 - Die Augustiner-Klosterkirche wird gesperrt
München-Kreuzviertel * Die Augustiner-Klosterkirche wird gesperrt. Die Klosterinsassen müssen das Kloster am nächsten Tag räumen.
1. 10 1803 - Aufhebung des Zentralklosters der Augustiner
München-Kreuzviertel * Die Aufhebung des Zentralklosters der Augustiner wird vollzogen. Bis auf drei alte Patres übernimmt nun auch der Rest des Konvents seelsorgerische Aufgaben außerhalb des Ordens.
Die Insassen des Augustiner-Klosters sollen umgehend die Gebäude verlassen. Weil die Augustiner in kein Aussterbekloster gebracht werden sondern Anstellungen als Weltgeistliche annehmen, müssen sie in der Stadt eine Unterkunft suchen. Dadurch verzögert sich die Räumung des Klosters bis Anfang November. Die Kirche wird in der Folge zur Mauthalle, zum Zollamt, umgebaut. Die dazu notwendigen Arbeiten werden umgehend begonnen.
Das heimatlose Augustiner Christkindl findet Obhut bei den Barmherzigen Schwestern der heiligen Elisabeth, die die Tradition der weihnachtlichen Verehrung des Gnadenbildes in ihrer Spitalkirche an der heutigen Mathildenstraße fortsetzen.
4. 10 1803 - Das denkmalartige Standbild des „Harmlos“ wird enthüllt
München-Graggenau * Auf dem Weg vom Hofgarten in den Englischen Garten wird das denkmalartige Standbild des „Harmlos“ von Franz Jakob Schwanthaler d.Ä. enthüllt. Es ist eine Stiftung des Ministers Theodor Graf von Morawitzky.
22. 10 1803 - Die Wieskirche, Münchens älteste Kirche, wird gesperrt
München-Graggenau * Die Wieskirche, Münchens wahrscheinlich älteste Kirche, wird gesperrt und zur städtischen Registratur umgewidmet. Sie wird 1880 abgebrochen.
14. 11 1803 - Verkauf der Heilige Stiege auf dem Gasteigberg
Haidhausen * Nachdem die Heilige Stiege auf dem Gasteig beseitigt worden ist, wird der Grund an den Kreuzbräu Mathias Rottenkolber und den Kreuzlgießergartenwirt Hagn verkauft. Für die beiden Figuren und das Kruzifix behält sich die Stadt das Eigentumsrecht vor.
27. 11 1803 - Der erste Teil der Klarissinnen vom Anger begibt sich nach Dietramszell
München-Angerviertel - Dietramszell * Der erste Teil der Klarissinnen vom Anger begibt sich in ihr Aussterbekloster nach Dietramszell.
28. 11 1803 - Die Johann-Nepomuk-Kapelle wird abgebrochen
München-Lehel * Die Johann-Nepomuk-Kapelle zwischen den Isarbrücken wird abgebrochen.
2. 12 1803 - Der zweite Teil der Klarissinnen macht sich auf den Weg nach Dietramszell
München-Angerviertel - Dietramszell * Der zweite Teil der Klarissinnen vom Anger macht sich auf den Weg in ihr Aussterbekloster nach Dietramszell.
26. 12 1803 - Das Augustiner-Christkindl im Kloster der Elisabethinerinnen
München * Viele Münchner besuchen das zur Verehrung ausgestellte Augustiner-Christkindl im Kloster der Elisabethinerinnen.
31. 12 1803 - Beschreibung der Hofmark Haidhausen
Haidhausen * In der Hofmark Haidhausen befinden sich 201 Häuser und 526 Familien.
1804 - Franz Maria Schweiger und Lorenz Lorenzoni's Schauspielertruppe
München * Franz Maria Schweiger gehört der Schauspielertruppe des Lorenz Lorenzoni an.
1804 - „Hofbaumeister“ Franz Thurn überarbeitet „Schloss Biederstein“
Schwabing * „Hofbaumeister“ Franz Thurn überarbeitet „Schloss Biederstein“.
Friedrich Ludwig Sckell legt den Garten neu an.
1804 - Aron Elias Seligmann übernimmt das „Rechnungswesen“
München * Aron Elias Seligmann wird das „Rechnungswesen des Ministerialauswärtigen Départements“ übertragen.
Das heißt, er übernimmt die Auszahlung der Gehälter an die Beamten des auswärtigen Dienstes des baierischen Kurfürsten Max IV. Joseph in München und im Ausland.
Gleichzeitig gründet Seligmann ein Bankhaus und gewährt dem wirtschaftlich zerrütteten Kurfürstentum Baiern Darlehen und Zuschüsse in Millionenhöhe.
Dadurch stabilisiert sich die wirtschaftliche Situation im durch Landzuwächse immer größer werdenden Kurfürstentum. Durch die bessere Finanzausstattung Baierns finden sich weitere Geldgeber.
Im Gegenzug werden der Familie die vollen „bürgerlichen Rechte“ zugestanden.
1804 - Untersuchungen über die Verleihung der „Hofmarksrechte“
Untergiesing * Die eingeleiteten Untersuchungen, ob bei der Verleihung der „Hofmarksrechte“ alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ziehen sich bis zum Jahr 1804 hin und werfen alles über den Haufen.
Sie kommen zum Ergebnis, dass sowohl die Erteilung der „Jurisdiktion“ über die 68 „Untertanenfamilien“, als auch die „Edelsitzverleihung“ an Franz Anton von Pilgram unstatthaft war und damit ungültig sei.
„Pilgramsheim“ muss wieder der „Niedergerichtsbarkeit“ der „Hofmark Falkenau“, die einverleibten Auer Häuser wieder der „Auer Gerichtsbarkeit“ unterstellt werden.
Im Laufe der Untersuchungen geht das Pilgram'sche Besitztum in mehrere Hände über.
1804 - Montgelas lässt bei Bogenhausen eine Holzbrücke über die Isar bauen
Bogenhausen * Freiherr Maximilian Joseph von Montgelas lässt unterhalb Bogenhausen durch Oberst Adrian von Riedl eine Holzbrücke über die Isar errichten, die er als bequeme Verbindung nach München nutzt.
Sie hält bis zum Jahr 1812.
1804 - Der „Ausbau des Torweges am Isartor“ wird wieder aufgegriffen
München-Isarvorstadt * Das Projekt „Ausbau des Torweges am Isartor“ wird wieder aufgegriffen.
Der Grund liegt in dem seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zunehmenden Verkehr durch das „Isartor“.
Sowohl München als auch die Gemeinden rechts der Isar sind enorm angewachsen.
Dem entsprechend erhöht sich auch der tägliche Pendelverkehr.
War die Ausfallstraße zu Rumfords Zeiten noch mit 28 Fuß [ca. 8,40 Meter] geplant worden, so fordert man jetzt eine Breite von 48 Fuß [ca. 14,40 Meter].
Die Regierung erhöht die Straßenbreite am 1. September 1807 sogar auf 100 Fuß.
Anno 1804 - Die „kurfürstliche Leibjägerei“ soll in das „Hieronymiten-Kloster“
München-Lehel * Die Regierung hat beschlossen, in den ehemaligen Klostergebäuden der „Hieronymiten“ die „kurfürstliche Leibjägerei“ und die „Gewehrkammer“ unterzubringen.
1804 - „Sie heiraten gern und sehr früh, erzeugen viele uneheliche Kinder“
Marquartstein * Joseph Hazzi berichtet in seinen „Statistischen Auffschlüsse über das Herzogthum Baiern“ über die Bewohner in dem Gebiet um Marquartstein bei Traunstein:
„Sie heiraten gern und sehr früh, erzeugen viele Kinder, mitunter eben so viele uneheliche, das man nicht nur für kein sündhaftes, sondern vielmehr für ein gutes Werk hält“.
1804 - Karmelitinnen im Aussterbekloster in Pielenhofen
München - Neuburg - Pielenhofen * Das ehemalige Zisterzienserinnen-Kloster in Pielenhofen an der Naab wird zum Aussterbekloster aller Karmelitinnen bestimmt.
Die letzte Karmelitin stirbt dort im Jahr 1844.
1804 - Verwilderte Maulbeerpflanzungen werden in Obstgärten umgewandelt
München * Kurfürst Max IV. Joseph erlässt die Anordnung, die inzwischen verwilderten Maulbeerpflanzungen in gewöhnliche Obstgärten umzuwandeln. Damit ist das Vorhaben, die Seidenzucht in München zu etablieren, wieder einmal gescheitert.
30. 1 1804 - Kurfürstin Caroline erhält Schloss Biederstein zum Geschenk
Schwabing * Das Schloss Biederstein kommt von Kurfürst Max IV. Joseph als Schenkung „in die Hände unserer vielgeliebten Frauen Gemahlin“ Caroline.
9. 3 1804 - Friedrich Ludwig Sckell übernimmt die Hofgartenintendanz in München
München * Friedrich Ludwig Sckell übernimmt die extra für ihn geschaffene Hofgartenintendanz mit Sitz in München. Zu diesem Zeitpunkt ist der Englische Garten bereits weitgehend angelegt.
Freiherr Reinhard von Werneck wird seiner Stellung als Direktor des Englischen Gartens enthoben. Er wird vom Kurfürsten zum Trost zum Generalmajor á la suite befördert und mit der Reorganisation des Kadettenkorps in München beauftragt.
Für den Englischen Garten treten nun ökonomische Gesichtspunkte zugunsten der Anlage eines großflächigen Landschaftsgartens in den Hintergrund. Friedrich Ludwig Sckell legt aus diesem Grund einen Plan A an, der den vom ihm vorgefundenen Zustand der Gartenanlage festhält.
11. 4 1804 - England und Russland schließen ein Bündnis
Petersburg - London * England und Russland schließen in Petersburg ein Bündnis, dessen erklärtes Ziel es ist, Frankreich auf die Grenzen von 1792 zu beschränken.
4. 5 1804 - Zar Alexander I. schließt ein Defensivbündnis mit Preußen
Petersburg - Berlin * Zar Alexander I. schließt ein Defensivbündnis mit Preußen.
18. 5 1804 - Napoleon Bonaparte wird als erblicher Kaiser von Frankreich proklamiert
Paris * Eine Änderung der Verfassung mit 74 Ja-Stimmen bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung bringt Frankreich das Kaisertum. Auf Betreiben Napoleons einigt man sich auf den Titel eines Kaisers [= französisch: Empereur], da ein monarchischer Titel nötig ist, jedoch der des Königs unliebsame Erinnerungen wecken würde.
24. 5 1804 - Der Grundstein für das Palais Salabert wird gelegt
München-Graggenau * Der Grundstein für das Palais Salabert, dem heutigen Prinz-Carl-Palais, wird gelegt. Das Gartenpalais wird nach Plänen von Carl von Fischer erbaut.
21. 7 1804 - Auf dem Franziskaner-Friedhof stampfen Soldatenstiefel
München-Kreuzviertel - München-Graggenau * In einem kurfürstliches Reskript an die Oberbaierische Militär-Inspektion“heißt es:
- „Wir haben gnädigst beschlossen, den bisherigen Parade-Platz dem Vergnügen des Publikums allein zu widmen, und zu diesem Zwecke verschönern zu lassen.
- Dagegen bestimmen Wir den Platz des ehemaligen Franziskaner-Klosters zur Zeit als Parade-Platz, und eröffnen solches Unserer oberbaierischen Militär-Inspektion zu Anweisung der hiesigen Kommandantschaft“.
Das Franziskanerkloster ist inzwischen abgerissen und der dazugehörige Friedhof eingeebnet worden. Der dadurch entstandene große Raum erhält bald darauf die Bezeichnung Max-Joseph-Platz. Über den Gräbern des Franziskanerfriedhofs stampfen seither Soldatenstiefel, vor allem aus der Kosttor-Kaserne und der Kreuzkaserne. Bis zum Frühjahr 1826 dient der heutige Max-Joseph-Platz als Exerzierplatz der Münchner Garnison, um sich auf einen potenziellen Einsatz sorgfältig vorbereiten zu können. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es keine militäreigenen großen Truppenübungsplätze. Die eigentliche Truppenausbildung muss daher auf den Kasernenhöfen und auf Exerzierplätzen stattfinden.
11. 8 1804 - Kaiser Franz erhebt sich zum Doppel-Kaiser
Wien * Der deutsch-römische Kaiser Franz II. nimmt - ohne Rücksprache mit den Reichsfürsten und unter Bruch der Reichsverfassung - als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation den Titel eines erblichen Kaisers von Österreich an. Damit ändert er auch seinen Namen in Franz I. Joseph Karl.
Gleichzeitig gliedert er seinem Kaiserreich sämtlichen Reichsbesitz ein, über den er ohne Zustimmung des Reichstags eigentlich gar nicht hätte verfügen dürfen.
Seine Absicht ist, seine kaiserliche Hausmacht zu erhalten und auch im Fall des Untergangs des alten Reichs die Ranggleichheit mit Napoleon Bonaparte zu wahren. Den Titel des Erwählten Römischen Kaisers trägt er unabhängig davon bis zum 6. August 1806.
11 1804 - Kronprinz Ludwig I. will auch ein Museum haben
Rom * Kronprinz Ludwig I. befindet sich bis Herbst 1805 auf seiner ersten Reise nach Rom.
Von der Stadt so beeindruckt, will er auch in München haben, „was zu Rom ‚museo‘ heißt“.
6. 11 1804 - Zar Alexander I. schließt ein Defensivbündnis mit Österreich und Schweden
Petersburg - Wien - Stockholm * Zar Alexander I. schließt ein Defensivbündnis mit Österreich und Schweden.
14. 11 1804 - Maria Leopoldine heiratet Ludwig Joseph Graf von Arco
München * Die Kurfürsten-Witwe Maria Leopoldine geht eine Ehe mit Ludwig Joseph Graf von Arco ein.
12 1804 - Napoleon will dynastische Verbindungen mit den europäischen Häusern
Paris - München - Wien * Napoleon Bonaparte will eine dynastische Verbindung zwischen seiner Familie und den großen europäischen Häusern.
Der baierische Minister Maximilan Joseph von Montgelas unterstützt den Gedanken, Napoleons Stiefsohn Eugéne Beauharnais, Vizekönig von Italien, mit Auguste Amalie, der Tochter des baierischen Kurfürsten, zu verehelichen.
2. 12 1804 - Napoleon Bonaparte krönt sich selbst zum französischen Kaiser
Paris * Napoleon Bonaparte krönt sich selbst zum „erblichen Kaiser von Frankreich“.
31. 12 1804 - Offiziell gibt es in München 31 Kaffeeschenken
München * Offiziell gibt es in München 31 Kaffeeschenken. Davon elf Realrechte und zwanzig persönliche Konzessionen. Der Unterschied zwischen den Kaffeeschenken und den Traiteurs wird beseitig. Beiden wird gestattet „Billards zu halten und nebst Kaffee und anderen Getränken auch Kost zu geben“.
1805 - Die „Hoffischerei“ in der Au wird aufgelöst
Au * Die „Hoffischerei“ wird aufgelöst.
Das Haus des Hoffischers geht an die „Strafarbeitshaus-Verwaltung“ über.
Ab 1805 - Beginn der Isarregulierung ab Bogenhausen
Bogenhausen * Durch die ab der „Bogenhausener Brücke“ in Richtung Oberföhring beginnende Isarregulierung durch Oberst Adrian von Riedl wachsen Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas 117 Tagwerk Grund zu.
Auf dem Gelände entsteht später der heutige „Herzogpark“.
Neben seinen Münchner Besitzungen hat Montgelas noch kleinere und größere Besitzungen über ganz Baiern verstreut.
1805 - Großzügige „Befreiung vom Wehrdienst“ für das Bürgertum
München * Die „Gesetze zur Ergänzung des stehenden Heeres“ von 1805 und 1812 gestatten dem Bürgertum großzügige „Befreiung vom Wehrdienst“.
1805 - Unhaltbare Zustände in Haidhausen
Haidhausen * Die „Baierische Landesregierung“ gibt der „Hofmarkverwaltung“ die Schuld an den unhaltbaren Zuständen in Haidhausen, da sie „ständig ganz unvermögenden Leuten die Ansiedlung und Verehelichung genehmige, sich aber dann nicht mehr um sie bekümmere, so daß sie in Armut gerieten und zum Bettel ihre Zuflucht nehmen müßten, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen“.
1805 - Joseph Sulzbeck tritt in verschiedenen Wirtschaften auf
München * Joseph Sulzbeck tritt mit seiner dreisaitigen Bassgeige in verschiedenen Wirtschaften auf.
1805 - Rumford wird „Präsident der Akademie der Wissenschaften“
München * Reichsgraf Rumford wird „Präsident der Akademie der Wissenschaften“ in München.
1805 - Adrian von Riedl wird mit 59 Jahren in den Ruhestand versetzt
München * Adrian von Riedl wird mit 59 Jahren in den Ruhestand versetzt.
Trotz seines grünen Paradieses am Rande des „Englischen Gartens“ behagt ihm die Ruhe nicht, weshalb er den Bau einer Mühle plant.
Der an seinem Grundstück vorbeifließende „Eisbach“ mit einem Wasserdurchlauf von 22 Kubikmetern pro Sekunde erscheint ihm dafür ideal.
1805 - Josef von Baader erfindet eine „Wassertretmaschine
Schloss Nymphenburg * Der „Oberstbergrat“ Josef von Baader erfindet eine „Wassertretmaschine", mit der er über die Nymphenburger Parkseen „radeln" kann.
Diese „Spielerei", wie er seine Erfindung selbst nennt, bringt ihn auf die Idee,ein ähnliches Fahrzeug auch für die Straße zu bauen.
Ganz aus Holz bastelt er dieses anno 1805 zusammen und unternimmt damit mehrere Versuchsfahrten zwischen München und Nymphenburg.
Baader gilt seither als der erste Mensch, der „sich mit Hilfe von zwei Rädern fortbewegen konnte".
1805 - Die „Post“ künftig als Staatsaufgabe selbst übernehmen
München * Im Zuge der bevorstehenden Auflösung des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ - ist Kurfürst Max IV. Joseph fest entschlossen, die „Post“ künftig als Staatsaufgabe selbst zu übernehmen.
Bestärkt wird der Wittelsbacher vom „Generallandesdirektor“ Joseph Maria von Weichs, der ihm den Rat gibt, „daß der gegenwärtige Zeitpunkt der schicklichste sey, das Postregal [der Thurn und Taxis] einzuziehen und unter landesherrlicher Verwaltung auszuüben“.
22. 3 1805 - Die Militärbehörde erhält das säkularisierte Kloster der „Hyronymiten“
München-Lehel * Kurfürst Max IV. Joseph überträgt der Militärbehörde das säkularisierte Kloster „der Hyronymitaner im Lehel nebst dem Garten, jedoch mit Ausnahme der Kirche, welche Wir zur Pfarrkirche bestimmt haben“.
Der Regent will das „Kadetten-Korps“ vom „Wilhelminum“, hierher verlegen.
Doch dazu müssen erst für die das Kloster noch bewohnenden drei „Hieronymiten“ und drei kurfürstliche Jäger eine Unterkunft gefunden werden.
Und selbst dann war das Gebäude noch höchst ungeeignet, da zwischen dem südlich der Kirche liegenden „Konventtrakt“ und dem an der Kirchen-Nordwand neu anzubauenden Erweiterungsbau das Gotteshaus liegt.
Die vorgelegten Baupläne stoßen auch wegen
- der zu gering bemessenen Kadettenplätze,
- der nicht ausreichenden Unterrichtsräume und
- des fehlenden Zimmers „für die physikalischen Apparaturen“ auf Kritik.
Vor allem missfällt dem „Kadettenerzieher“, dass die Schlafräume für die zivilen Dienstmägde mitten im Unterkunftsbereich der Kadetten liegen und so „die skandalösesten Auftritte und Ausschweifungen“ zu befürchten wären.
Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass „die Lage des Hieronymitaner-Klosters, sowohl wegen dessen Verbindung zu den übrigen Kasernen, und hauptsächlich wegen dem nahe vorbeifließenden Wasser ungemein vorteilhaft zu einer Kaserne“ ist.
11. 4 1805 - Russland und Großbritannien schließen in Petersburg ein Bündnis
Petersburg * Napoleons Ambitionen im Nahen Osten führt zur Annäherung von Russland und Großbritannien. Sie schließen in Petersburg ein Bündnis, dessen erklärtes Ziel es ist, Frankreich auf die Grenzen von 1792 zu beschränken. Dem Bündnis treten Schweden und Neapel bei.
25. 4 1805 - Das Kloster der Hieronymiten soll endgültig aufgehoben werden
München-Lehel * Durch ein Dekret wird das Kloster der Hieronymiten endgültig aufgehoben. Dennoch gibt es eine neue Verzögerung in der Ausführung.
23. 5 1805 - Großbritannien erklärt Frankreich den Krieg
London - Paris * Großbritannien erklärt Frankreich den Krieg. Das ist der Beginn des Dritten Koalitionskrieges. Österreich, Russland und England haben sich zur Dritten Koalition gegen Frankreich zusammengeschlossen.
Wie soll sich Baiern verhalten, wo doch ein österreichisches Kriegsziel die Annexion Baierns war? Neutralität kommt nicht in Frage, also müssen die Baiern ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen.
7. 6 1805 - Das Kurfürstentum Baiern führt die Wehrpflicht ein
München * Das Kurfürstentum Baiern führt die Wehrpflicht ein. Diese gilt jedoch nicht für alle Baiern, denn die Gesetze zur Ergänzung des stehenden Heeres aus den Jahren 1805 und 1812 gestatten dem städtischen Bürgertum „großzügige Befreiung vom Wehrdienst“.
19. 6 1805 - Die ehemaligen Hieronymiten-Mönche müssen ausziehen
München-Lehel * Die ehemaligen Hieronymiten-Mönche erhalten die Weisung, das Gebäude, „welches sie dermal bewohnen, weil es zu einem Staatszweck bestimmt ist“, schnellstmöglich zu räumen. Zum Unterhalt erhält der Prior eine Jahrespension von 300 Gulden, die übrigen Patres jeweils 275 Gulden. Zur Auflage wird ihnen gemacht, „die pfarrlichen Verpflichtungen im Lehel“ bis zur anderweitigen Verfügung pflichtgemäß zu versehen.
28. 6 1805 - Kurfürst Max IV. Joseph erklärt die Anna-Kirche zur Pfarrkirche
München-Lehel * Kurfürst Max IV. Joseph erklärt die Sankt-Anna-Kirche zur Pfarrkirche.
9. 8 1805 - Österreich schließt sich dem russisch-englischen Bündnis an
Wien - Petersburg - London - Berlin * Dem russisch-englischen Bündnis vom 11. April 1804 schließt sich Österreich an. Preußen bleibt neutral.
25. 8 1805 - Geheimverhandlungen im Bogenhausener Schloss Stepperg
Bogenhausen * Angesichts des heraufziehenden Dritten Koalitionskriegs erneuern Baiern und Frankreich ihr Bündnis im Vertrag von Bogenhausen. Ort der Verhandlungen ist Schloss Stepperg, das Minister Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas als Landsitz nutzt.
Die Geheimverhandlungen zwischen dem französischen Abgesandten und Minister Montgelas werden mit einem baierischen Bündniswechsel zu Frankreich in einem vorläufigen Vertrag abgeschlossen. Er beendet die Koalition mit Österreich und Russland. Napoleon sagt Baiern weitere Gebietszuwächse im Falle eines Sieges zu. Dafür verpflichtet sich das Kurfürstentum Baiern zur Stellung von 20.000 Mann.
Neben Baiern schließt Napoleon Verträge mit weiteren süddeutschen Mitgliedern des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Seine Verbündeten werden Baiern, Württemberg, Baden und Hanau. Napoleon Bonaparte schließt mit diesen die Verträge von Bogenhausen, Baden-Baden und Ludwigsburg.
Die baierische Regierung erhofft sich nach den Erfahrungen der beiden letzten Kriege von Frankreich eine wesentlich bessere Behandlung als von den kaiserlichen Österreichern. Um aber die Österreicher nicht unnötig herauszufordern, wird das Bündnis mit Frankreich zunächst noch geheim gehalten. Die baierische Abneigung gegenüber Österreich soll sich jedoch bald bestätigen.
25. 8 1805 - Napoleon Bonaparte lässt seine Große Armee abmarschieren
Frankreich - Österreich * Napoleon Bonaparte lässt seine Große Armee in Richtung Österreich abmarschieren. Ende September will er in Baiern ankommen.
9 1805 - Kurfürst Max IV. Joseph zögert, das Bündnis mit Frankreich zu ratifizieren
München * Als österreichische Truppen an den baierischen Grenzen aufziehen, zögert Kurfürst Max IV. Joseph das Bündnis mit Frankreich zu ratifizieren und war zeitweise sogar bereit, dem kaiserlichen Druck nachzugeben.
8. 9 1805 - Der Dritte Koalitionskrieg beginnt
Kurfürstentum Baiern * Der Dritte Koalitionskrieg beginnt mit dem Einmarsch der Österreicher nach Baiern. Rücksichtslos bestimmt Kaiser Franz II. Baiern zum Kriegsschauplatz. Noch sind die österreichischen Truppen im Glauben an ein gemeinsames Bündnis mit Baiern gegen Frankreich über die Landesgrenze gekommen, doch nun marschieren sie als Feinde nach München.
Die wertvollsten kurfürstlichen Besitztümer und die Gemäldesammlung können noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, um sie so vor feindlichen Beutezügen zu schützen. Auch der Kurfürst ist samt seiner Familie weit genug von der österreichischen Grenze entfernt, so dass er das Eintreffen der napoleonischen Truppen sicher abwarten kann.
Ab 12. 9 1805 - Österreichische Militärs quartieren sich in München ein
München * Ab dem 12. September 1805 quartieren sich immer mehr österreichische Militärs in München ein.
19. 9 1805 - Erzherzog Ferdinand trifft in München ein
München * Erzherzog Ferdinand, der den Oberbefehl über die österreichischen Truppen hat, trifft in München ein und nimmt im Gasthof Zum Goldenen Hirsch in der Theatinerstraße Quartier.
21. 9 1805 - Kaiser Franz II. bietet den Baiern den Königstitel an
München • Auch Kaiser Franz II. trifft in München ein und bietet als Oberhaupt des das Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation dem Kurfürstentum Baiern den Königstitel an, wenn es sich der Dritten Koalition anschließen würde.
Doch das hätte nicht gleichzeitig die Erringung der vollen staatlichen Souveränität bedeutet, wie sie Napoleon angeboten hat. Diese war aber für Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas die rechtliche Voraussetzung für die inneren Reformen der kommenden zwölf Jahre, insbesondere für die Ausschaltung der Stände und die Schaffung einer Konstitution. Denn noch ist die Ständeverfassung gültig, die durch das Reichsrecht und die Reichsgerichte geschützt ist.
22. 9 1805 - Kaiser Franz II. reist weiter nach Landsberg am Lech
München - Landsberg am Lech • Kaiser Franz II. reist nach einem Kirchgang in der Theatinerkirche weiter nach Landsberg am Lech.
23. 9 1805 - Napoleon Bonaparte erklärt Österreich den Krieg
Paris - Wien • Napoleon Bonaparte erklärt Österreich den Krieg.
24. 9 1805 - Kronprinz Ludwig I. beschwört seinen Vater
Bern * Kronprinz Ludwig I. hat die Taktik von Kurfürst Max IV. Joseph und seinem Minister Montgelas noch nicht durchschaut. Aus Bern schreibt er beschwörend an seinen Vater, er möge „unter keinen Umständen mit den Franzosen gehen. [...] Glauben Sie nicht, dass ich ein Österreicher bin, aber ich bin deutsch und bin ein Feind des Unrechts“.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Kurfürst das Unterzeichnungsdatum für den Bogenhausener Vertrag so weit nach vorne gelegt hat, dass das Schreiben des Kurprinzen als erst nach der Vertragsunterzeichnung eingetroffen angesehen werden konnte.
24. 9 1805 - Mx IV. Joseph datiert den Bogenhausener Vertrag vor
Würzburg * Obwohl Kurfürst Max IV. Joseph den Bogenhausener Vertrag erst am 28. September 1805 unterschrieben hat, datiert er ihn auf den 24. September vor.
25. 9 1805 - Die französische Armee überquert den Rhein
Rhein * Die französischen Revolutionstruppen überschreiten den Rhein an mehreren Stellen.
26. 9 1805 - Kaiser Franz zieht sich zurück
München - Wien * Nachdem die Franzosen am 25. September den Rhein überquert haben, zieht es der österreichische Kaiser Franz I. vor, vorsorglich die Rückreise nach Wien anzutreten. Mit ihm machen sich auch die ersten österreichischen Einheiten über München zum Rückzug bereit.
27. 9 1805 - Das französische und das baierische Heer vereinigen sich
Würzburg * Das französische Revolutionsheer trifft in Würzburg ein, wohin sich Kurfürst Max IV. Joseph zurückgezogen hat. Dort vereinigt sich dass Heer mit den baierischen Truppen.
28. 9 1805 - Kurfürst Max IV. Joseph ratifiziert den Geheimvertrag
Würzburg * Während Napoleon den Vertrag von Bogenhausen sofort nach Erhalt unterzeichnet hat, lässt Kurfürst Max IV. Joseph kostbare Zeit verstreichen. Das lag eventuell auch an der Kurfürstin Karoline, die sich für eine Allianz mit Österreich ausgesprochen hatte.
Erst nachdem sich das französische Heer mit den baierischen Truppen vereinigt hat, unterschreibt der baierische Kurfürst den Vertrag. Dabei datiert er ihn vorsichtshalber auf den 24. September zurück. Baiern ist damit Kriegspartei an der Seite Napoleon Bonapartes gegen Kaiser Franz II., dessen Truppen bereits das südliche Baiern besetzt haben.
29. 9 1805 - Kurfürst Max IV. Joseph antwortet seinem Sohn Ludwig
Würzburg - Bern * Kurfürst Max IV. Joseph antwortet auf ein Schreiben seines Sohnes Ludwig I., das dieser am 24. September in Bern verfasst hatte. Dem völlig ahnungslosen Prinzen Ludwig erklärt der Kurfürst einige Gründe seines Handelns:
- „Ich fühle genau wie ihr, daß es viel glücklicher wäre, nicht gezwungen zu sein, sich in einen Streit zu mischen, der das Deutsche Reich nichts angeht.
- Ich empfinde auch Euren Abscheu, mein Freund, und finde ihn ganz natürlich. Aber es gibt Fälle im Leben eines Herrschers, in denen er gezwungen ist, das eigene Gefühl zu unterdrücken im Interesse seiner Staaten.
- Ich habe mich nicht mit Napoleon verbündet, sondern mit Frankreich, das zu allen Zeiten der geborene Verbündete unseres Hauses war. […]
- Wenn Euch die Partei mißfällt, die ich gezwungenermaßen ergriffen habe, machet es nur mir zum Vorwurf, mein liebes Kind. Ich bin es allein, der es gewollt hat. Kein Minister, nicht einmal Montgelas, hat es mir geraten, ich schwöre es Euch bei meinem Gotte. […].“
6. 10 1805 - Französisch-baierische Militäreinheiten überqueren die Donau
Donauwörth - Neuburg - Ingolstadt * Das vereinigte französisch-baierische Heer umfasste 60.000 Mann. Es überquert am 6. Oktober die Donau bei Donauwörth, Neuburg und Ingolstadt.
8. 10 1805 - Die Schlacht von Wertingen
Wertingen * In der Schlacht von Wertingen kommt es zum ersten Gefecht zwischen den österreichischen und französisch-baierischen Truppen.
9. 10 1805 - Das siegreiche Gefecht bei Günzburg
Günzburg * Nach einem Gefecht bei Günzburg mit Truppen unter Erzherzog Ferdinand wird von dem vereinigtem französisch-baierischen Heer eine Donau-Brücke bei Günzburg gewonnen.
9. 10 1805 - Österreichische Truppen auf dem Rückzug in München
München * Der österreichische General Michael Freiherr von Kienmayer auf dem Rückzug mit seiner Division in München ein. Er lässt seine Truppen im Westen und Norden vor der Stadt lagern.
Ab 10. 10 1805 - Kämpfer aus dem Balkan erzeugen Angst und Schrecken
München * In München halten sich Soldaten aus den östlichen Teilen der Donaumonarchie auf. Die exotisch aussehenden Kämpfer aus dem Balkan erzeugen bei den Münchnern Angst und Schrecken
- einerseits durch ihr fremdartiges Aussehen,
- andererseits durch ihre schlechte Ausrüstung
- und ihre unzureichende, Mitleid erzeugende Bekleidung.
10. 10 1805 - Der Kurfürst rechtfertigt den Bündniswechsel
Würzburg * Kurfürst Max IV. Joseph gibt einen Aufruf „an sein Volk“ heraus, in dem er sich für sein Bündnis mit Napoleon rechtfertigt. Um den politisch umwälzenden Schritt ins französische Lager darzustellen, muss er eine überzeugende Begründung liefern. Also wird Österreich zum „Erbfeind“ erklärt, der Baierns Unabhängigkeit bedrohte und dessen Truppen plündernd durchs Land zogen, während „Frankreich […] zu allen Zeiten Baierns Unabhängigkeit schützte“.
Das Bündnis scheint damit als die einzige und alternativlose Konsequenz, um Baiern zu retten: „Der Kaiser der Franzosen, Baierns natürlicher Bundesgenosse, eilte mit seinen tapferen Kriegern herbei, um euch zu rächen, […], und bald, bald naht der Tag der Rettung.“ Der Aufruf endete siegesgewiss mit den Worten: „Unsere gute Sache steht unter dem Schutze eines gerechten Gottes und […] unter der eigenen Anführung eines unüberwindlichen Helden.“
11. 10 1805 - General Kienmayer befiehlt den Rückzug
München * Als General Kienmayer von der erfolgreichen Donauüberquerung der Franzosen bei Günzburg erfährt, befiehlt er noch am Abend den allgemeinen Aufbruch.
12. 10 1805 - München kann zurückerobert werden
München * Baierische Truppenkontingente unter der Führung des französischen Generals Bernadotte können München nahezu kampflos einnehmen. Die baierische Haupt- und Residenzstadt ist damit von allen Besatzungssoldaten befreit.
Nur wenige Stunden später treffen die ersten französischen Kavalleristen in München ein, um sofort die Verfolgung der Österreicher aufzunehmen.
14. 10 1805 - Die Schlacht bei Elchingen
Elchingen * In der Schlacht bei Elchingen kommt es zu einem weiteren Gefecht zwischen österreichischen und französisch-baierischen Militärs.
15. 10 1805 - Der französisch-baierische Angriff auf Spielberg und Michelsberg
Spielberg - Michelsberg - Ulm * Gefechte bei Spielberg und Michelsberg zwischen den baierisch-französischen und den österreichischen Truppen. Damit sind die letzten österreichischen Stellungen gefallen und die Stadt Ulm von französischen und baierischen Truppen eingeschlossen.
Ab 16. 10 1805 - Der Kampf um Ulm beginnt
Ulm * Die Beschießung von Ulm durch baierisch-französische Truppen beginnt. Ulm wird von den Österreichern verteidigt und will nicht kapitulieren.
17. 10 1805 - Napoleon bezwingt die österreichische Armee bei Ulm
Ulm * Napoleon bezwingt die österreichische Armee bei Ulm und befreit Baiern von den kaiserlichen Truppen.
20. 10 1805 - Die Kapitulation von Ulm
Ulm * Mit der Kapitulation von Ulm muss die eingeschlossene österreichische Deutschlandarmee kapitulieren. Baiern ist damit befreit. Napoleon Bonaparte hat damit den ersten wichtigen Sieg des Dritten Koalitionskrieges errungen.
Auch Baiern hat eine wichtige Schlacht geschlagen. Denn als Kaiser Franz II. vom baierisch-französischen Bündnis erfahren hat, lässt er sich zu der Äußerung hinreißen: „Ich werde Baiern nicht nehmen, ich werde es verschlingen.“
24. 10 1805 - Die Grande Armée marschiert nach Osten
München * Nach einem kurzen Aufenthalt in München rückt Napoleon Bonaparte mit seiner Grande Armée nach Osten vor.
25. 10 1805 - Die Presse berichtet über Napoleons Einzug in München
München * Die Kurpfalzbaierische Staats-Zeitung von München berichtet vom Einzug Napoleons:
„Endlich hatten wir gestern das sehnlich erwartete Vergnügen, Se. Majestät Napoleon Kaiser in Frankreich und König in Italien hier eintreffen zu sehen. Se. Majestät kamen von Augsburg, fuhren in einem 6-spännigen Reisewagen, welchen der Herr Reichs-Marschall Bernadotte, nebst noch einigen H.H. Reichsmarschallen zu Pferde begleitete, unter dem Donner der Kanonen, und dem Zusammengeläute aller Glocken durch die Neuhauser-Kaufinger- über den Platz durch die Diener- in die Residenz-Gasse heran, und stiegen […] in der kurfürstl. Residenz ab.
Die ganze Stadt war zur Tageshelle beleuchtet, und die Mittags zuvor angekommenen kaiserl. königl. Garde-Regimenter hatten sich durch die ganze Einzugsstrecke à la haie aufgestellt. Es war ½ 8 Uhr Abends, und die Menge des hier befindlichen, zum Theile noch mit der Einquartierung beschäftigten Militärs nebst dem zusammenströmenden Volke zeigte das Bild eines durch Ströme aufgetriebenen Meeres, das sich schwer und langsam dahinwälzt“.
26. 10 1805 - Die Grande Armée überschreitet den Inn
Inn * Napoleon Bonaparte überquert mit seiner Grande Armée den Inn.
28. 10 1805 - Braunau wird von der napoleonischen Armee eingenommen
Braunau * Napoleon Bonaparte nimmt mit seiner Grande Armée Braunau ein.
29. 10 1805 - Baierns Kurfürst muss sich beim französischen Kaiser entschuldigen
Würzburg - München * Der baierische Kurfürst Max IV. Joseph trifft aus Würzburg kommend in München ein und muss sich für seine Verzögerung beim französischen Kaiser entschuldigen.
29. 10 1805 - Die baierischen Truppen nehmen Salzburg ein
Salzburg - Kufstein * Die baierischen Truppen unter der Führung von General Bernhard Erasmus von Deroy nehmen Salzburg ein und dringen über Reichenhall und Lofer nach Kufstein vor.
5. 11 1805 - Französische Truppen erobern die Festung Scharnitz und Innsbruck
Scharnitz - Innsbruck * Französische Truppen erobern die Festung Scharnitz und Innsbruck.
8. 11 1805 - Zusage für eine Hochzeit
Linz * Baierns Kurfürst Max IV. Joseph gibt - im Beisein des Kurprinzen Ludwig - Napoleon Bonaparte in Linz die mündliche Zusage für die Hochzeit zwischen der baierischen Prinzessin Auguste Amalie mit dem Stiefsohn Napoleons, Eugène Beauharnais.
8. 11 1805 - Gebietserweiterungen und die volle Souveränität zugesichert
Linz * Im Vertrag von Linz sichert Napoleon Bonaparte Baiern neben Gebietserweiterungen erstmals die volle Souveränität zu.
10. 11 1805 - Die baierischen Truppen nehmen die Festung Kufstein
Kufstein * Die baierischen Truppen nehmen die Festung Kufstein ein.
13. 11 1805 - Französischen Truppen nehmen Wien kampflos ein
Wien * Napoleon erreicht mit seinen Soldaten Wien und nimmt die Stadt kampflos ein.
24. 11 1805 - Auch die kurfürstliche Familie kommt wieder in München an
München * Die kurfürstliche Familie trifft wieder in München ein.
29. 11 1805 - Baierische Truppen übernehmen die Besetzung Tirols
Tirol * Baierische Truppen übernehmen die Besetzung Tirols.
2. 12 1805 - Napoleon Bonaparte gewinnt die Dreikaiserschlacht bei Austerlitz
Austerlitz * Bei Austerlitz kommt es zur sogenannten Dreikaiserschlacht, an der der französische Kaiser Napoleon Bonaparte, Zar Alexander I. von Russland und der deutsch-römisch-österreichische Kaiser Franz II. persönlich auf dem Schlachtfeld anwesend sind.
Napoleon Bonaparte besiegt unter Mitwirkung baierischer Truppen die die österreichisch-russische Koalition entscheidend und erringt damit den glänzendsten Sieg seiner Laufbahn. Der Sieg der Dreikaiserschlacht von Austerlitz beendet den Dritten Koalitionskrieg.
3. 12 1805 - Der baierische General Siebenbein zieht in Tirol ein
Tirol * Der baierische General Siebenbein zieht in Tirol ein.
4. 12 1805 - Der Waffenstillstand von Znaim wird geschlossen
Znaim * Der Waffenstillstand von Znaim wird geschlossen.
5. 12 1805 - Kaiserin Joséphine trifft mit großem Gefolge in München ein
München * Frankreichs Kaiserin Joséphine trifft mit großem Gefolge in München ein. Sie bezieht die Steinzimmer der Residenz und bemüht sich im Interesse der Bündnispolitik Frankreichs erfolgreich um die Sympathien des kurfürstlichen Hofes und der Bevölkerung der Landeshauptstadt.
Die kaiserliche Gefolgschaft erregt gerade aufgrund ihrer prächtigen Ausstattung großes Aufsehen. Wegen des ungünstigen Münchner Wetters erkranken in den darauf folgenden Tagen viele der kaiserliche Hofdamen.
10. 12 1805 - Baierns Territorium soll erweitert und Königreich werden
Brünn * Im französisch-baierischen Vertrag von Brünn belohnt der Franzosenkaiser Baiern für seine Waffenhilfe und sichert ihm erneut zu, dass er im bevorstehenden Friedensvertrag mit Österreich Kaiser Franz II.
- die Abtretung Vorarlbergs, der Gebiete in Schwaben und der Reste von Eichstätt und Passau zugunsten Baierns auferlegen will.
- Außerdem soll der Kaiser in Wien auf jegliche Oberhoheit über den Kurfürsten von Baiern, der den Königstitel annehmen wird, verzichten.
- Zudem sichert der französische Kaiser im Vertrag von Brünn Baiern die erbliche Königswürde zu.
Bereits im Vertrag von Bogenhausen hatte sich Napoleon Bonaparte verpflichtet, im Falle eine siegreichen Kriegsausgangs für eine weitere Vergrößerung Baierns einzutreten.
14. 12 1805 - Tirol will beim Kaiserhaus bleiben
Tirol - Wien * Die Ständische Aktivität bittet den österreichischen Regenten um den weiteren Verbleib Tirols beim Kaiserhaus.
19. 12 1805 - Napoleon erklärt Baiern, Baden und Württemberg zu souveränen Staaten
Paris * In einem Tagesbefehl erklärt Napoleon Bonaparte Baiern, Baden und Württemberg zu souveränen Staaten.
20. 12 1805 - Karoline Murat triff in München ein
München * Karoline Murat, die Schwester Napoleons, kommt in München an.
21. 12 1805 - Die Freie Reichsstadt Augsburg fällt an Baiern
München - Augsburg * Das Kurfürstentum Baiern übernimmt die Freie Reichsstadt Augsburg.
26. 12 1805 - Baiern erhält die Souveränität und die erbliche Königswürde
Bratislava * Österreich schließt mit Napoleon den Frieden von Preßburg, in dem es die im Vertrag von Brünn vom 10. Dezember 1805 festgesetzten Bestimmungen anerkennt. Der Friedensvertrag von Pressburg beendet den Dritten Koalitionskrieg.
Das hat zur Folge, dass Baiern die Markgrafschaft Burgau im heutigen Bayerisch-Schwaben, die Reste der Hochstifte Eichstätt und Passau, die freien Reichsstädte Augsburg und Lindau zugesprochen bekommt.
Österreich muss die Rangerhöhung des baierischen Kurfürsten zum König und Gebietsabtretungen akzeptieren.
1806 - Die „Militärmühlen“ werden stillgelegt
München-Englischer Garten - Lehel * Auf Friedrich Ludwig Sckells Wunsch hin werden die „Militärmühlen“ an der Kreuzung von Schwabinger Bach und Eisbach stillgelegt und der Befehl zum Abbruch gegeben.
1806 - Weitere Flussregulierungsarbeiten an der Isar beginnen
München * Weitere Flussregulierungsarbeiten an der Isar beginnen.
Sie dauern bis 1812.
Die Isar wird in ein knapp 44 Meter breites Flussbett gezwängt.
Dabei gräbt sich die Isar so tief ein, dass man das Flussbett im Jahr 1889 wieder auf 60 Meter erweitern muss.
1806 - Johann Peter Langer soll die „Maler- und Bildhaueracademie“ leiten
Düsseldorf - München * Der „Historienmaler“ und bisherige „Direktor der Düsseldorfer Akademie und Gemäldegalerie“, Johann Peter Langer, siedelt mit seinem Sohn Robert nach München über.
Johann Peter Langer soll im neu erhobenen „Königreich Baiern“ die Leitung der seit dem Jahr 1770 bestehenden „Maler- und Bildhaueracademie“ übernehmen und auf europäisches Niveau anheben.
Untergebracht ist die „Akademie der Bildenden Künste“ in dem Teil des ehemaligen „Jesuitenkollegs“ neben der „Michaelskirche“ in der Neuhauser Straße, der zuvor vom „Wilhelmsgymnasium“ genutzt worden war und seit dem Jahr 1781 die „Münchner Zeichnungsschule“ [= „Maler- und Bildhaueracademie“] beherbergte.
1806 - Das Königreich Baiern beginnt Verhandlungen über ein „Konkordat“
München - Rom-Vatikan * Das Königreich Baiern beginnt mit dem Vatikan Verhandlungen über ein „Konkordat“.
Die Gespräche werden jedoch im darauffolgenden Jahr wieder abgesetzt.
1. 1 1806 - Der Georgs-Ritterorden wird zum Königlich-Bayerischen Hausritterorden
München * Mit der Erhebung Baierns zum Königreich wird der Georgs-Ritterorden zum Königlich-Bayerischen Hausritterorden.
1. 1 1806 - Baiern wird extrem emotionslos zum Königreich erhoben
Königreich Baiern - München-Graggenau * Das Kurfürstentum Baiern wird von Napoleon Bonaparte zum Königreich erhoben. Aus Kurfürst Max IV. Joseph wird König Max I. Joseph. Die Rangerhöhung Baierns wird extrem emotionslos vollzogen. Der nur wenige Minuten dauernde Akt der Königserhebung findet um 10 Uhr, in den Appartements der Kurfürstin Karoline in der Münchner Residenz statt.
Obwohl Napoleon Bonaparte am Abend des Vortages in München eingetroffen ist, nimmt er nicht an der Zeremonie teil. Auch der leitende Minister Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas ist aus uns nicht bekannten Gründen abwesend.
- Anwesend sind neben dem König und dem Kronprinzen Ludwig
- der Minister für geistliche Angelegenheiten, Heinrich Theodor Graf Topor Morawitzky,
- der Justizminister Johann Friedrich Freiherr von Hertling und
- Abbé Pierre de Salabert.
Dazu kommen die Chefs der Königlichen Hofämter,
- der Obersthofmeister Clemens Anton Graf von Toerring-Seefeld,
- der Oberstkämmerer Maximilian Emanuel Freiherr von Rechberg und Rothenlöwen,
- der Oberstmarschall Ludwig Joseph Freiherr von Gohren und schließlich
- der Oberststallmeister Carl Ludwig Freiherr von Kesling.
Dieser Männerrunde erklärt Max Joseph, er habe sich „durch die vielen Beweise von Treue und Anhänglichkeit der Baiern an ihren Fürsten und Vaterland bewogen befunden, Baierns Unabhängigkeit zu begründen, indem Allerhöchst Sie in dem gegenwärtigen Zeitpunkt, wo es durch die Vorsehung Gottes dahin gediehen, dass das Ansehen und die Würde des Herrschers in Baiern seinen alten Glanz und vorige Höhe zur Wohlfahrt des Volkes und zum Flore des Landes wieder erreicht, den dem Regenten Baierns angestammten Titel eines Königs von Baiern anzunehmen und öffentlich proklamieren zu lassen“.
Er fügt noch hinzu, dass künftig alle direkten Abkömmlinge den Titel Königliche Hoheit führen werden. Daraufhin bringen die Anwesenden ihre Glückwünsche und Huldigungen zum Ausdruck.
1. 1 1806 - Ein Königreich von Napoléons Gnaden ?
Wien - Berlin * Baiern ist ein Königreich. Österreicher und Preußen sprechen, ebenso wie die deutsch-nationalen Patrioten, von einem Königtum von Napoléons Gnaden. Dabei nimmt der baierische Kurfürst lediglich die gleichen Rechte in Anspruch, wie zuvor der Hohenzoller für Preußen und der Habsburger für Böhmen und Ungarn.
1. 1 1806 - Straßenbenennungen nach der Rangerhöhung
München * Die Erhebung Baierns zum Königreich ist alleine schon Grund genug, weshalb München nun einen Königsplatz, eine Königsstraße, eine Königinstraße und sogar einen Platz und eine Straße für den Kronprinzen Ludwig I. braucht.
1. 1 1806 - Die Proklamation des Königreichs Baiern
München * Der Landesherold Joseph von Stürzer verliest an verschiedenen Orten der Stadt die Proklamation des Königreichs Baiern und bringt ein Hoch auf König Max I. Joseph aus. Eskortiert wird er von dreißig berittenen Angehörigen der Bürgerwehr.
1. 1 1806 - Das Königreich Baiern erhält sein erstes Wappen
Königreich Baiern * Das Königreich Baiern erhält sein erstes Wappen, das radikal mit der heraldischen Tradition bricht. Vor 42 baierischen Rauten steht das Herzschild als Zeichen der Kurwürde, die ja bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation am 6. August 1806 weiterbesteht.
1. 1 1806 - Mit Kanonen und Kirchenglocken Aufmerksamkeit erregen
München * Am Nachmittag des Neujahrtages wird zur Feier der neuen Königswürde mit 200 Kanonenschüssen und dem Geläute sämtlicher Münchner Kirchenglocken die Öffentlichkeit auf das Ereignis aufmerksam gemacht.
Eine für den Abend vorgesehene Illumination der Stadt fällt sehr spärlich aus, weil die Zeit für die Vorbereitung zu kurz war. Andererseits verspüren die Münchner angesichts der zu erwartenden Einquartierungen französischer Soldaten wenig Lust zum Feiern.
1. 1 1806 - Das frischgebackene Königspaar besucht ein Hofkonzert
München-Graggenau * Am Abend des Krönungstages besuchen Napoleon und seine Gemahlin Joséphine gemeinsam mit dem frischgebackenen Königspaar ein Hofkonzert. Weitere Feierlichkeiten unter Anwesenheit des französischen Kaiserpaares folgen in den nächsten Tagen.
1. 1 1806 - Fehlende Kroninsignien und Salbung des Königspaares
München-Graggenau * Was fehlt, sind die Kroninsignien und natürlich die feierliche Krönung mit kirchlicher Salbung des Königpaares. Napoleon hätte gerne eine Krönung gesehen, die aber in München nicht gewollt ist. Begründet wird dies damit, dass im immer noch bestehenden Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation derartige Königskrönungen unbekannt sind.
Da aber Baiern, Württemberg, Baden und Frankreich bestrebt sind, die Bestimmungen des Friedens von Preßburg vom 26. Dezember 1805 schnellstmöglich umzusetzen und damit unumkehrbar zu machen, fehlt für eine Krönung sowohl in München als auch in Stuttgart die dazu notwendige Vorbereitungszeit. So findet lediglich die Proklamation der neu entstandenen Königreiche Baiern und Württemberg zeitgleich statt.
Freilich gibt es noch andere Gründe, die gegen eine Krönung sprechen, aber nicht laut ausgesprochen werden:
- Die Wittelsbacher wollen den Anschein vermeiden, die Königswürde sei dem militärischen Erfolg und dem Willen Napoleon Bonapartes zu verdanken.
- Dieser hat eine Rangerhöhung der süddeutschen Staaten nur deshalb angestrebt, um zuverlässige Bündnispartner gegen Österreich zu gewinnen und dessen Machteinfluss zu beschränken.
- Damit ist Napoleon auch dem Ziel, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zu zerschlagen und zu beerben, ein Stück näher gekommen.
- Und wenn man schon die baierische Unabhängigkeit und Souveränität als eine von Frankreich und Napoleon unabhängige legitimiert gewusst haben will, scheint eine Krönungszeremonie - noch dazu in Anwesenheit des französischen Kaisers - für absolut unakzeptabel.
Im Königlich-Baierischen Regierungsblatt vom 1. Januar 1806 wird deshalb angemerkt: „Unsere feyerliche Krönung und Salbung haben Wir auf eine günstigere Jahreszeit vorbehalten, welche Wir in Zeiten öffentlich bekannt machen werden.“ Geplant ist die Krönungszeremonie für Oktober 1806.
1. 1 1806 - München als Ort der Eheschließung
München-Graggenau * Der Brautvater, König Max I. Joseph, hat zwei Forderungen:
- Erstens soll der Ort der Trauung zwischen der baierischen Prinzessin Auguste Amalie mit dem Stiefsohn Napoleons, Eugène Beauharnais, soll München und nicht Paris sein.
- Zum Zweiten soll sein zukünftiger Schwiegersohn die Königskrone von Italien erhalten.
Mit der Verhandlung wird Minister Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas beauftragt, der München als Ort der Eheschließung durchsetzen kann, allerdings an der Erhebung Eugénes zum König Italiens scheitert. Immerhin bleibt er aber Vizekönig.
Um den 1. 1 1806 - Eugène Beauharnais wird von der geplanten Hochzeit informiert
München * Eugène Beauharnais wird selbst von Napoleon mit den knappen Worten „Ich bin in München angekommen, ich habe Ihre Heirat mit Prinzessin Auguste abgemacht; sie ist veröffentlicht worden“ über seine Rolle in diesem Spiel informiert. Damit er weiß, wie seine Künftige aussieht, ist dem Schreiben eine Tasse mit dem Porträt der Prinzessin beigefügt. In seiner Antwort führt Eugène aus, er werde alles tun, um das Vorbild glücklich zu machen.
1. 1 1806 - Eine Hochzeit als Preis für die Rangerhöhung zum Königreich
München - Paris * Der Preis für das Bündnis zwischen Baiern und Frankreich sowie die Erhebung in die Königswürde ist die Verehelichung der baierischen Prinzessin Auguste Amalie mit dem Stiefsohn Napoleons, Eugène Beauharnais. Mit der Münchner Hochzeit will sich Napoleon den Eintritt in eines der ältesten europäischen Adelshäuser ermöglichen.
Die mündliche Zusage für die Eheschließung hat Kurfürst Max IV. Joseph - im Beisein des Kurprinzen Ludwig - Napoleon Bonaparte bereits am 8. November 1805 in Linz gegeben.
Er hat dies dann aber mehrfach vor seiner Ehefrau vertuscht und abgestritten, da man den baierischen Kurfürsten eindringlich darüber aufgeklärt hat, dass eine Weigerung zum Verlust Baierns zugunsten eines „Napoleoniden“ führen würde. Die Auffassung vertrat sowohl Freiherr Maximilian Joseph von Montgelas, als auch der Gesandte im Hauptquartier Napoleons, Karl Ernst Freiherr von Gravenreuth.
Die Situation scheint aussichtslos. Kurfürstin Karoline, mit ihrer antifranzösischen Haltung, Prinzessin Auguste Amalie und Kurprinz Ludwig hoffen noch immer, dass sich die Heirat abwenden lassen würde. Das auch schon deshalb, weil sich Auguste Amalie mit dem Erbprinz Karl von Baden verlobt glaubt.
2. 1 1806 - Ein Militärspektakel mit erbeuteten Waffen
München * Ein ursprünglich für den Neujahrstag geplantes Militärspektakel muss wegen der Königsproklamation auf den 2. Januar verlegt werden.
Dabei werden Kanonen, Gewehre und Fahnen präsentiert, die einst von kaiserlichen Soldaten als Trophäen nach Wien gebracht und nun von Napoleon als Zeichen der Verbindung von Frankreich und Baiern sowie der gemeinsamen Abgrenzung gegenüber Österreich im Triumph zurückgeführt worden waren.
3. 1 1806 - Die erste Münchner Ziviltrauung
München-Angerviertel * Münchens erste Ziviltrauung wird im Kleinen Rathaus geschlossen, als sich der Stabsarzt Dr. Anderl und die Buchhalterstochter Caroline Leutner ihr Ja-Wort geben. Im Kleinen Rathaus befindet sich das erste und lange Zeit einzige Münchner Standesamt.
10. 1 1806 - Der Bräutigam Eugène Beauharnais kommt in München an
München * Drei Tage vor der Hochzeit, kommt der 23-jährige Bräutigam Eugène Beauharnais in München an. Seine 17-jährige Braut Auguste Amalie hatte „einen unkultivierten Protegé“ des französischen Kaisers erwartet. Doch nun erlebt sie zu ihrer Überraschung einen „liebenswürdigen Edelmann“.
12. 1 1806 - Eugène Beauharnais wird von Napoleon Bonaparte adoptiert
München * Um die für das Haus Wittelsbach nicht eben sehr ehrenvolle Eheverbindung etwas attraktiver zu machen, wird Eugène Beauharnais am 12. Januar 1806, am Tag vor der Eheschließung, vom französischen Kaiser adoptiert und erhält das Versprechen der Thronfolge in Italien, falls Napoleon keine Nachkommen haben sollte.
13. 1 1806 - Zivilhochzeit zwischen Eugéne de Beauharnais und Auguste Amalie
München-Graggenau * In der Grünen Galerie der Münchner Residenz findet die nach französischem Recht geforderte Ziviltrauung der Brautleute Eugène Beauharnais und Auguste Amalie, der ältesten Tochter des baierischen Königs, statt.
Karoline Murat, die Schwester Napoleons, bleibt, obwohl sie sich ja schon seit dem 20. Dezember in der Münchner Residenz aufhält, demonstrativ der Eheschließung fern. Sie gönnt der Familie Beauharnais die Verbindung mit dem Hause Wittelsbach nicht.
13. 1 1806 - Eine Ziviltrauung nur als Verlobung angesehen
München * Die Baiern betrachten die Ehe zwischen Auguste Amalie und Eugène Beauharnais schon aufgrund des fehlenden kirchlichen Segens lediglich als Verlobung.
14. 1 1806 - Max I. Joseph sichert Tirol die Beibehaltung der Landesverfassung zu
München - Tirol * Ein Schreiben Königs Max I. Joseph an die Tiroler Landstände sichert ihnen die Beibehaltung der Landesverfassung zu. Diese Zusicherung ist den Tiroler Deputierten bereits bei ihren Audienzen in München schriftlich gegeben worden. Im Besitzergreifungspatent vom 22. Januar wird sich allerdings kein Hinweis auf die Tiroler Landesverfassung und andere Sonderrechte finden lassen.
15. 1 1806 - Bezüge zu Napoleon und Frankreich werden ausdrücklich vermieden
München * In den ab dem 15. Januar 1806 versandten formellen Benachrichtigungen an die Fürsten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und in allen anderen baierischen Verlautbarungen zur Annahme der Königswürde werden Bezüge zu Napoleon und Frankreich für die Rangerhöhung ausdrücklich vermieden. Stattdessen knüpft Max I. Joseph an die Königswürde der Agilolfinger an, die er mit der Königskrönung ja bloß wiederherstelle.
22. 1 1806 - Baiern übernimmt die ehemals gefürstete Grafschaft Tirol
Tirol * Das Königreich Baiern übernimmt die ehemals gefürstete Grafschaft Tirol.
- Im Besitzergreifungspatent findet sich kein Hinweis mehr auf die gegebenen Zusagen zur Beibehaltung der Tiroler Landesverfassung und andere Sonderrechte.
- Dagegen wird die Gleichbehandlung aller Untertanen im Königreich hervorgehoben.
22. 1 1806 - Weitere Gebietserweiterungen für das Königreich Baiern
Schönbrunn * Im Vertrag von Schönbrunn erhält das Königreich Baiern weitere Gebietserweiterungen:
- Als Ersatz für das Herzogtum Berg erhält Baiern das Markgrafentum Ansbach,
- dazu sieben Herrschaften in Vorarlberg,
- die Grafschaften Hohenems und Königsegg-Rothenfels,
- die Herrschaften Tettnang und Argen am Bodensee sowie
- die ehemals gefürstete Grafschaft Tirol, die Baiern samt Trient und Brixen bekommt.
- Dafür müssen sie allerdings auf Würzburg verzichteten.
Um den 3 1806 - Madame Montgelas vergleicht die französischen Besatzer mit „Blutegeln“
München * Madame Ernestine Rupertina Walburga von Montgelas vergleicht die in Baiern stationierten Truppen - gegenüber dem französischen Außenminister Talleyrand - mit „Blutegeln“.
Sie schreibt:
„Hat man, seit die Welt besteht, je so gefräßige Verbündete gesehen wie euch, die ihr euch zu einem Aufenthalt ohne Ende niedergelassen habt, ohne eine Miene zu machen zu zahlen?
Aber wißt, daß man um diesen Preis auch Feinde dahaben könnte, und dann hätte man wenigstens das Vergnügen, den einen oder anderen oder allesamt umzubringen“.
4 1806 - Ins „Hieronymiten-Kloster“ soll ein „Dragoner-Regiment“
München-Lehel * Eine Entscheidung über die künftige Verwendung des „Anna-Klosterareals“ erfolgt jedoch erst, nachdem sich das „Dragoner-Regiment“ über die zerstreute Unterbringung seiner Pferde beklagt.
In der folgenden Entscheidung heißt es, dass „inwendig an die Garten Mauer des Hieronymitanerklosters eine doppelte Stallung, welche wenigstens für 250 Pferde, oder womöglich mehrere Platz geben kann, erbaut [...] werden soll. -
Das Kloster selbst ist alsdann zu der Unterbringung der Mannschaft zu verwenden“.
16. 4 1806 - General Chasteler trifft in Innsbruck ein
Innsbruck - Tirol * Der österreichische General Chasteler trifft in Innsbruck ein, hat aber nichts mehr zu „befreien“.
16. 4 1806 - Die Michaels-Kirche in Berg am Laim wird Pfarrkirche
Berg am Laim * König Max I. Joseph erhebt die vormalige Hof-, Erzbruderschafts- und Ritterordenskirche St. Michael zur Pfarrkirche und den Pfarrer zum Vorstand der Michaels-Bruderschaft. Die Stephanskirche in Baumkirchen, die ehemalige Pfarrkirche, wird Filialkirche der Michaelskirche.
5 1806 - Die baierischen Krönungs-Insignien werden in Paris gefertigt
München - Paris * Da man für die Königskrönung die entsprechenden Insigien braucht, wird der Pariser Juwelier Borgnis mit der Anfertigung der beiden Kronen, des Szepters, des Reichsapfels und des Reichsschwerts beauftragt.
5. 7 1806 - Die erste Protestantische Stadtpfarrei München
München * Kabinettsprediger Ludwig Friedrich Schmidt kann die Protestantische Stadtpfarrei München einrichten.
7. 7 1806 - Die Tortur wird abgeschafft
München * Die Tortur wird im Königreich Baiern abgeschafft.
12. 7 1806 - Der Rheinbund wird als Militärbündnis gegründet
München * Der Rheinbund als Konföderation von zunächst 16 Staaten wird als Militärbündnis gegründet. Die Unterzeichner verpflichten sich zum gegenseitigen Beistand im Kriegsfall. Baiern muss mit 30.000 Mann das stärkste Kontingent stellen.
Mit dem Beitritt zum pro-französischen Rheinbund verlässt das Königreich Baiern endgültig und offiziell das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.
Im Gegenzug erhalten die Bundesgenossen enorme territoriale Zuwächse. Das junge Königreich Baiern erhält die Reichsstadt Nürnberg und deren Territorien, darüber hinaus die bislang reichsunmittelbaren Herrschaften der Fürsten Hohenlohe, Öttingen, Fugger, Thurn und Taxis, der Grafen von Vastell, Pappenheim, Stadion und Schönborn sowie fränkische und schwäbische Reichsrittergüter.
1. 8 1806 - Die Rheinbundstaaten erklären ihren Austritt
Regensburg * Auf dem Reichstag in Regensburg erklären alle Rheinbundstaaten den Austritt aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
6. 8 1806 - Kaiser Franz II. muss das geschwächte Kaiserreich auflösen
Wien * Franz II. muss als deutsch-römischer Kaiser abdanken und das durch die Geschehnisse der zurückliegenden Jahre geschwächte sowie durch den Austritt der Rheinbundstaaten zerbrochene Heilige Römische Reich Deutscher Nation auflösen.
26. 9 1806 - Auf der Suche für ein Gefängnis
München-Graggenau * Der Lueg-ins-Land und der daneben stehende Scheibling werden als Fronfeste ins Auge gefasst.
1. 10 1806 - Franz Xaver Zacherl pachtet die Brauerei der Paulaner
<p><strong><em>Au</em></strong> * Der Hallerbräu Franz Xaver Zacherl pachtet die ehemalige Brauerei der Paulaner.</p>
20. 11 1806 - Bozen befindet sich in französischer Hand
Bozen * Bozen befindet sich in französischer Hand.
21. 11 1806 - Montgelas übernimmt zusätzlich das Innenministerium
München * Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas übernimmt zusätzlich das Innenministerium. Er wird das Amt bis 1817 ausüben. Das Ministerium der Finanzen, das Montgelas seit 1803 ausübt, geht an Johann Wilhelm Freiherr von Hompesch über.
1807 - Der öffentliche „Weinkeller“ im „Implerhaus“ wird aufgelöst
München-Graggenau * Der öffentliche „Weinkeller“ im „Implerhaus“ wird aufgelöst.
1807 - Zur „Festigung der inneren Ordnung“
München * Das bisher freiwilige „Bürgermilitär“ wird zur „Festigung der inneren Ordnung“ aufgestellt.
1807 - Das „Theater der breiten Masse“ wird heftig kritisiert
München * Im „Morgenblatt für gebildete Stände“ heißt es zum Theater der breiten Masse:
„Endlich sind die bretternen Bühnen, auf welchen Schweiger und Lorenzoni den Sommer hindurch unser Publikum belustigen, geschlossen. Trauriges Zeichen der Zeit, wenn solche Gesellschaften auf eine sichere und im Verhältnis zu ihrem Werte glänzende Unterstützung zählen dürfen!
Manches Stück, das auf unserem Nationaltheater nicht ohne allen Eifer gespielt ward, fand ein leeres Haus, indessen Lorenzonis und Schweigers Hütten mit Zuschauern aller Stände angefüllt waren. [...] Dass übrigens beide Banden auf den ästhetischen Sinn unseres Publikums nachteilig einwirken, ist nicht zu bezweifeln.
Der häufige Anblick des Rohen, Plumpen und Ungeschliffenen, die gänzliche Geschmacklosigkeit, die in der Komposition und Deklamation der Stücke liegt, die Misstöne, welche besonders in den Singspielen unzählig sind, erzeugen Nachlässigkeit im Urteil und jene ärgerliche Genügsamkeit, die immer nur um den billigen Preis lachen will“.
1807 - Das „Sommertheater vor dem neuen Maxthor“
München-Maxvorstadt * Franz Maria Schweiger erhält eine Konzession für ein „Sommertheater vor dem neuen Maxthor“, wo Improvisationen nach Stück- und Opernvorlagen gegeben werden.
1807 - Der „Hackerbräu“ hat den höchsten Malzverbrauch in München
München-Hackenviertel * Im Braujahr 1806/07 steht der „Hackerbräu“ mit einem Verbrauch von 2.368 Scheffel Malz an der Spitze in München.
Die zwölf erfolgreichsten Münchner Brauereien haben einen Malzverbrauch von zusammen 18.067 Scheffel.
1807 - Der „Kleinhesseloher See“ wird auf seine heutige Größe gebracht
München-Englischer Garten - Schwabing * Der künstlich auf einer Wiese angelegte „Kleinhesseloher See“ wird unter der Leitung von Friedrich Ludwig Sckell auf seine heutige Größe von acht Hektar gebracht.
Die Arbeiten dauern bis 1812.
1807 - Herr von Effner erwirbt den ehemaligen „Edelsitz Pilgramsheim“
Untergiesing * Der „Geheime Justizreferendar“ von Effner erwirbt das gesamte Anwesen des ehemaligen den „Edelsitzes Pilgramsheim“.
1807 - Ignaz Mayer gewährt der königlichen „Centralkasse“ 100.000 Gulden
München * Ignaz Mayer gewährt der königlichen „Centralkasse“ in den Jahren 1807 und 1808 Anleihen in Höhe von 100.000 Gulden.
2. 3 1807 - Die Kroninsignien treffen in München ein
Paris - München * Die in Paris angefertigten Kroninsignien treffen in München ein und werden in der Schatzkammer deponiert. Eine Königskrönung findet jedoch nie statt. Die baierischen Kroninsignien dienen ausschließlich dem Staatszeremoniell und werden bei der Eröffnung der Ständeversammlung dem König als Staatssymbol vorangetragen.
7. 3 1807 - Franz von Pocci wird in München geboren
München * Franz von Pocci wird in München geboren.
4 1807 - Die Linden und Kastanien auf dem Mariahilfplatz werden abgeholzt
Au * Die Linden und Kastanien auf dem Mariahilfplatz werden abgeholzt, da sie „für das Licht der benachbarten Häuser“ hinderlich geworden sind.
Dafür werden Obstbäume gepflanzt und die Kinder in Obstbaumzucht unterrichtet.
3. 4 1807 - Mandat zur Neuorganisation des Bürgermilitärs
<p><strong><em>München</em></strong> * Das <em>„Mandat über die Uniformierung und Organisation des bürgerlichen Militärs in den Städten, Flecken und Märkten des Königreichs“</em> wird erlassen. Es bildet eine allgemein verbindliche Rechtsgrundlage für den Wach- und Sicherheitsdienst des Bürgermilitärs, denn bisher hatten die Bürger diese Aufgabe ja freiwillig erfüllt. </p> <p>Wichtigster Punkt für den Staat ist die neue allgemeine Musterungspflicht aller Bürger zum Bürgermilitär. Untaugliche müssen eine Wehrersatzgebühr bezahlen. Als Gegenleistung gesteht der Staat den Offiziers- und Unteroffizierskorps der einzelnen Waffengattungen des Bürgermilitärs ihre Ergänzung und Beförderung zu höheren Chargen zu.</p> <ul> <li>Über die Aufgabe des <em>Bürgermilitärs</em> sagt das <em>Mandat</em> folgendes: <em>„[...] Nie kehrt der Bürger seine Waffen gegen den äusseren Feind. </em></li> <li><em>Seine Bestimmung bleibt ausschliessend, den friedlichen, rechtlichen Einwohner zu beschützen, und die Wirkungen des Gesetzes gegen polizeiliche Vergehungen und das Verbrechen zu unterstützen. </em></li> <li><em><em>Er übernimmt demnach bei dem Abzuge der Feldregimenter aus den Garnisonen den Dienst daselbst, besorgt denselben in jenen Städten, wo keine gewöhnliche Garnison liegt, für beständig, um durch auszusendende Sicherheits-Patrouillen die Umgebungen vor allem, der öffentlichen Ruhe und Sicherheit gefährlichen Gesindel rein zu halten.“</em></em></li> </ul> <p>Das unmittelbare Kommando über das lokale Bürgermilitär hat der jeweils ranghöchste beziehungsweise rangälteste Bürgeroffizier. Dieser untersteht wiederum in einer Garnisonsstadt der militärischen Stadtkommandantschaft, ansonsten dem zivilen Landrichter oder Polizeidirektor.</p> <p>Der Vorschlag für ein Pferderennen aus Anlass der Kronprinzenhochzeit (1810) kommt aus den Reihen der Königlich-Baierischen Nationalgarde III. Klasse. Diese entwickelte sich aus dem Städtischen Wehrwesen. </p> <p>Dieses Münchner Bürgermilitär gehört nicht im eigentlichen Sinne zur Münchner Garnison. Die traditionelle Abgrenzung von Armee und Bürgertum beziehungsweise von Garnison und Bürgerwehr bleibt bis weit ins 19. Jahrhundert bestehen.</p>
5 1807 - Das „Zucht-, Arbeits- und Korrekturhaus“ in der Au entsteht
Au * In der ehemaligen Paulaner-Klosteranlage entsteht das „Zucht-, Arbeits- und Korrekturhaus“ in der Au.
10. 8 1807 - Friedrich Ludwig Sckell ist unzufrieden mit dem „Englischen Garten“
München-Englischer Garten * Friedrich Ludwig Sckell fertigt einen „Plan B“, den er gemeinsam mit „Plan A“ samt einer erläuternden Denkschrift dem König überreicht.
Darin drückt er seine Unzufriedenheit mit der Art der Bepflanzung, der er das Fehlen von „pittoresken Ansichten“ vorwirft, und der architektonischen Gestaltung der zumeist aus Holz errichteten „Parkbauten“ aus.
Diese sind nach seiner Meinung weder stabil genug gebaut, noch entsprechen sie der „reinen Baukunst“.
Den „Chinesischen Turm“ will er sofort abreißen lassen, da „der Chinesische Geschmack der Baukunst keine Nachahmung verdienet, und wenn einst dieser ganz faul seyn wird, und abgebrochen werden muß, Kein anderer mehr erbauet werden dürfte“.
26. 8 1807 - Baiern führt die Pockenschutzimpfung ein
München * Das Königreich Baiern führt als erstes Land der Welt die Pockenschutzimpfung ein.
18. 10 1807 - Die Den-Haager-Friedenskonferenz beschließt Fragen des Kriegsrechts
Den Haag * Die Zweite Den-Haager-Friedenskonferenz beschließt Fragen des Kriegsrechts.
Ende 11 1807 - Napoleon beauftragt Montgelas mit dem „Statut für den Rheinbund“
München - Mailand - Paris * „Minister“ Maximilian Joseph von Montgelas wird von Napoleon bei einem Treffen in Mailand aufgefordert, einen Entwurf für ein „Fundamentalstatut für den Rheinbund“ auszuarbeiten.
Vorgegeben sind die wichtigsten Grundzüge, wie eine Bundesorganisation und die Regelung der Handelsbeziehungen sowie die Einführung des „Code Napoléon“.
Der von Montgelas ausgearbeitete und in Paris vorgelegte Entwurf beinhaltete nur ein absolutes Mindestmaß an Kompetenzen für den „Rheinbund“, der lediglich als lockerer Bund souveräner Staaten mit gemeinsamen Aufgaben auf militärischem Gebiet konzipiert ist.
Da Napoléon mit dem baierischen Entwurf nicht besonders einverstanden ist, beauftragt er seinen Außenminister mit einem neuen, wesentlich zentralistischer gestalteten Konzept.
12 1807 - Die Planungen für die „Maxvorstadt“ werden eingeleitet
München-Maxvorstadt * Die Planungen für die „Maxvorstadt“ werden eingeleitet.
21. 12 1807 - Die verbliebenen Hieronymiten-Patres müssen das Kloster räumen
München-Lehel * Die drei noch im Lehel verbliebenen Hieronymiten-Patres vom alten Konvent erhalten den Befehl „auf der Stelle die Wohnung zu räumen, indem noch diese Woche 236 Mann Militär einziehen“. Das Anna-Kloster wird nun für das Fuhrwesen benutzt.
Um den 23. 12 1807 - 250 Soldaten und 220 Pferde beziehen die neue Lehel-Kaserne
München-Lehel * Nachdem die Geistlichen aus dem Hieronymiten-Kloster ausgezogen sind, können schließlich 250 Soldaten und 220 Pferde die neue Lehel-Kaserne beziehen. Sie ist zwar nach der Bettenzahl die kleinste der fünf Münchner Kasernen, jedoch - mit Ausnahme der Alten Isarkaserne - die einzige Truppenunterkunft mit militäreigenen Stallungen.
1808 - Die Vorstadt Au erhält eine Wasserleitung
Vorstadt Au * Die Vorstadt Au erhält eine Wasserleitung.
Bis dahin entnehmen die Auer das Wasser dem Mühlbach, dem Grundwasser oder Zisternen.
1808 - Neben den 26 „Weinwirten und Weinzäpflern“ gibt es 113 „Weinhändler“.
München * Neben den im Jahr 1640 festgesetzten 26 „Weinwirten und Weinzäpflern“ gibt es in München 113 „Weinhändler“.
Ab 1808 - Durch die Isar-Regulierung entsteht der heutige „Herzogpark“
Bogenhausen * Durch die Regulierung der Isar ab der Bogenhausener Brücke fällt die „Bogenhausener Au“, der heutige „Herzogpark“, trocken.
Langsam entsteht Siedlungsland. Minister Maximilian Joseph von Montgelas wachsen dadurch 117 Tagwerk Grund zu.
1808 - Johann Wilhelm von Hompesch kauft „Schloss Neuberghausen“
Bogenhausen * Graf August Joseph von Törring-Jettenbach verkauft „Schloss Neuberghausen“ an Johann Wilhelm von Hompesch, weshalb der „Adelssitz“ später auch als „Hompesch-Schlössl“ oder „Villa Hompesch“ bezeichnet wird.
1808 - Angehörige der Familie Schweiger leiten vier „Münchner Vorstadttheater“
Vorstadt Au - München-Isarvorstadt * In den Jahren von 1808 bis 1865 leiten die Angehörigen der Familie Schweiger, eine „Münchner Theater- und Schauspielerdynastie“, vier „Münchner Vorstadttheater“.
1808 - Friedrich Ludwig von Sckell erhält den „Zivil-Verdienstorden“
München * Friedrich Ludwig von Sckell erhält den „Zivil-Verdienstorden der Baierischen Krone“, womit der persönliche Adel verbunden ist.
1808 - Die „Maffei-Bank“ zieht in das „Palais Seinsheim“ am Promenadeplatz
München-Kreuzviertel * Die Bank des Peter Paul Maffei zieht in das „Palais Seinsheim“ am Promenadeplatz.
Kein Wunder, dass ihn König Max I. Joseph im gleichen Jahr - in Anerkennung seiner Leistungen - adelt und in den erblichen Ritterstand erhebt.
1808 - Ignaz Mayer gründet die „Giesinger Lederfabrik“
Untergiesing * Das Anwesen des ehemaligen „Edelsitzes Pilgramsheim“ geht an Ignaz Mayer über, „welcher eine der größeren und im besten Betriebe stehende Lederfabrik Baierns daselbst etablirte“.
Die „Giesinger Lederfabrik“ ist nicht nur als „Großgerberei“ tätig, sondern produziert darüber hinaus in enormen Umfang Lederwaren für die „Königlich Baierische Armee“ - und das „im Accord“.
Das ist der Grund, weshalb die „Mayer'sche Militär-Lederfabrik“ bei den eingesessenen Sattlern und Schuhmachern, die sich durch diese um zusätzliche Verdienstmöglichkeiten gebracht und ihre Existenz gefährdet sehen, umstritten ist.
Ignaz Mayer entstammt einer angesehenen Mannheimer jüdischen Kaufmannsfamilie, die dem hochkarätigen Kreis der „Hoffaktoren“ des pfälzischen Kurfürsten angehörte.
Ab 1808 - Die „Hofmarkbesitzer“ Hompesch lassen Häuser bauen
Berg am Laim * Zwischen den Jahren 1808 und 1812 lassen Johann Wilhelm von Hompesch und sein Bruder und Nachfolger Ferdinand von Hompesch als „Hofmarkbesitzer“ elf Häuser an der St.-Michaels-, der Josephsburg- und in der Clemens- August-Straße und drei weitere Häuser am Westrand des Schlossangers erbauen.
Sie reagieren damit auf eine Forderung der königlichen „Edikte“ aus den Jahren 1808 und 1812, in denen es heißt, dass die „Patrimonialgerichtsbarkeit“, die „Hofmarkgesrichtsbarkeit“, nur dann erhalten bleiben kann, wenn in der „Hofmark“ mindestens fünfzig Familien wohnen.
Durch diese Baumaßnahme steigt die Zahl der Häuser in Berg am Laim bis ins Jahr 1813 auf 54 an.
Die Häuser für Tagelöhner und Handwerker sind ebenerdig und aus Ziegel gemauert.
Jedes Haus hat 1.000 qm Grund. Sie stammen aus einer „Vorbildersammlung“ = Musterhäuser.
1808 - Aloysia Lampert verkauft ihr „Kaffeehaus an der Hofgartenmauer“
München-Graggenau * „Madame“ Aloysia Lampert verkauft ihr „Kaffeehaus an der Hofgartenmauer vor der Reitschule“ samt der „realen Kaffeeschenk- und Traiteurgerechtigkeit“ um 13.000 Gulden an Johann Nepomuk Schuster aus Friedberg und an seine künftige Ehefrau Nannette Keil, einer „Kammerdienerin“ der Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine.
1808 - Unter den 100 Höchstbesteuerten Münchens befinden sich 14 Brauer
München * Unter den 100 Höchstbesteuerten Münchens befinden sich 14 Brauer.
1808 - Johann Weinmüllers Vorstadttheater
<p><strong><em>München-Vorstadt</em></strong> * Die Theatergruppe um Johann Weinmüller erhält eine Konzession für Schau- und Singspiele und eröffnet daraufhin in der Vorstadt seine neue Spielstätte. Ihr Spielplan enthält neben den <em>„Lipperliaden“ </em>auch <em>„regelmäßige Stücke“</em>, meist Ritter- und Schauerdramatik. Das waren verbürgerlichte Weiterentwicklungen barocker Stücke. </p>
20. 1 1808 - Die Landesfreiheitserklärung wird aufgehoben
München * Die Landesfreiheitserklärung, die das Verhältnis zwischen der Landschaft und dem Landesherrn bestimmt, wird aufgehoben.
20. 1 1808 - Ausarbeitung einer eigenen Verfassung für Baiern beschlossen
München * Der baierische Staatsrat beschließt die Ausarbeitung einer Konstitution für das Königreich Baiern.
- Man will die bereits vorgenommenen und noch geplanten Reformmaßnahmen absichern und den Zusammenhalt von Altbaiern und den neu hinzugekommenen Territorien Schwaben und Franken durch einen einheitlichen staatsrechtlichen Rahmen festigen.
- Außerdem soll verhindert werden, dass durch die geplante Verfassung des Rheinbundes die gerade erst errungene Souveränität des neuen Königreichs infrage gestellt wird.
Erleichtert wird dieser separatistische Schritt dadurch, dass die von Napoleon Bonaparte geforderten Reformen nicht im Widerspruch zu den Reformvorschlägen stehen, die Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas im Jahr 1796 im Ansbacher Mémoire formuliert hatte.
2 1808 - Der Familie Thurn und Taxis das „Erbpostgeneralat“ für Baiern entzogen
München - Regensburg * Gemeinsam mit seinem „Minister“ Maximilian Joseph von Montgelas verfasst König Max I. Joseph einen Brief, in dem er der fürstlichen Familie Thurn und Taxis das „Erbpostgeneralat“ für Baiern entzieht und ihr weiter mitteilt, dass künftig das „Königreich Baiern“ die „Post“ in eigener Regie übernehmen wird.
5. 2 1808 - Carl Spitzweg wird in München geboren
München * Carl Spitzweg wird in München geboren.
13. 2 1808 - Montgelas legt den Entwurf einer Verfassung vor
<p><strong><em>München</em></strong><em> * </em>Minister Maximilian Joseph von Montgelas legt dem Staatsrat den zum Teil skizzenhaften Entwurf einer Verfassung vor. Noch ist man sich in München nicht sicher, wie schnell Napoleon Bonaparte eine eigene zentralistische <em>„Verfassung für den Rheinbund“</em> durchsetzen wird. <br /> Eile war demzufolge angebracht. </p> <p>Und so kann die <em>„Konstitution des Königreichs Baiern“</em> bereits am 1. Mai 1808 verkündet werden. </p>
22. 2 1808 - Die Armenpflege wird zur Staatsaufgabe
Königreich Baiern * Die Armenpflege wird zur Staatsaufgabe, zur „Staatsanstalt der Wohltätigkeit“. Man unterscheidet in „volle Armut“ und „partielle Armut“, womit zugleich der Umfang der Unterstützung festgelegt wird.
Verwaltet wird das Armenwesen von der unteren Polizeibehörde. Finanziert wird das Armenwesen im Bedarfsfall durch eine Armensteuer, die im Kommunalbezirk erhoben wird. Die Gemeindeangehörigen müssen die notwendigen Mittel aufbringen, haben aber bei der Verwendung der Gelder kein Mitspracherecht und damit keine Mitwirkungsrechte.
1. 3 1808 - Die Thurn und Taxis lesen heimlich die ihnen anvertrauten Briefe
München - Regensburg * Minister Montgelas hat ausreichend belastendes Material gegen die Thurn und Taxis gesammelt und kann nun König Max I. Joseph handfeste Beweise auf den Tisch legen. Demnach öffnen und lesen die Thurn und Taxis in ihren „Schwarzen Kabinetten“ heimlich die ihnen anvertrauten Briefe. Das Material ist so erdrückend, dass man sich in Regensburg keine Mühe zur Entgegnung macht. Der Taxische Beamte Alexander von Vrints gibt alles zu und räumt ein, dass dies seit hundert Jahren bei den Taxis übliche Praxis sei.
Mit der Verordnung über die Einrichtung einer „General-Direktion der Königlichen Posten“ wird in Baiern die „Thurn und Taxischen Reichsposten“ beseitigt. Man unterstellt die Post dem Ministerium des Königlichen Hauses und des Äußeren.
Mathilde Therese, die Ehefrau des Fürsten Carl Alexander von Thurn und Taxis und Nichte von Max I. Joseph, erreicht noch, dass sie als Ablösesumme Teile des ehemaligen Regensburger Hochstifts erhält, nämlich Wörth, Donaustauf und Wiesent. Außerdem bekommt das Haus Thurn und Taxis 60.000 Gulden und die Würde eines baierischen Reichsoberpostmeisters mit der Funktion „der Oberaufsicht bei feierlichen Zügen und Auffahrten“ und die Befugnis, bei hochoffiziellen Anlässen den Reichsapfel zu tragen.
8. 3 1808 - München erhält ein neues Stadtwappen
München * München erhält ein neues Stadtwappen. Die neue Verfassung hat die Aufhebung der kommunalen Selbstständigkeit gebracht. Damit wird auch der Mönch aus dem Stadtwappen entfernt. Nun trägt ein Löwe ein Schild mit einem großen „M“, sozusagen als Vorläufer des Münchner Autokennzeichens. Allerdings steht das „M“ im Schild nicht für München, sondern für den Namen des Königs: „Max I. Joseph“.
1. 5 1808 - Die Konstitution für das Königreich Baiern tritt in Kraft
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Konstitution des Königreichs Baiern tritt in Kraft. Die erste einheitliche Verfassung des Königreichs Baiern besteht aus 45 Paragraphen, die auf acht Seiten Platz finden. </p> <p>Nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und dem großen Gebietszuwachs, den Baiern erfahren hat, ist es notwendig geworden, das Recht zu vereinheitlichen und die Rechtsgleichheit in den verschiedenen Landesteilen herzustellen. Nur Altbaiern war, bis auf wenige Enklaven, ein geschlossenes Staatsgebiet. Ansonsten gleicht das neue Baiern mit seiner Anhäufung von Besitzungen verschiedener Fürsten, Grafen, Herren und Ritter eher einem Fleckerlteppich. </p> <p>Baiern muss nun zusammenwachsen und nach einheitlichen gesellschaftlichen und verwaltungsrechtlichen Grundsätzen regiert werden. </p> <ul> <li>Damit werden <em>„alle besonderen Verfassungen, Privilegien, Erbämter und Landschaftliche Korporationen der einzelnen Provinzen“</em> aufgehoben. </li> <li>Die Verfassung garantiert die Gleichheit aller vor dem Gesetz und den Steuerbehörden sowie beim Zugang zu den Staatsämtern. </li> <li>Die Rechte des Adels werden darin eingeschränkt und deren bisherigen politischen Vorrechte ausdrücklich abgelehnt. In einer neu eingeführten „Adelsmatrikel“ muss der Adelstitel erst staatlich anerkannt werden. </li> <li>Die Leibeigenschaft wird ersatzlos abgeschafft.</li> <li>Die Sicherheit des Eigentums wird ebenso gewährleistet, wie die Gewissensfreiheit und die Pressefreiheit. Letztere wird allerdings durch Gesetze teilweise wieder eingeschränkt.</li> <li>Das Gesetz sieht ein stehendes Volksheer und eine Bürgermiliz vor.</li> </ul> <p>Mit 21 Jahren muss jeder Staatsbürger vor der Verwaltung seines Kreises einen Eid ablegen, dass er <em>„der Konstitution und den Gesetzen gehorchen - dem König treu sein wolle“</em>. Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Monarchen darf kein <em>Staatsbürger</em> auswandern oder ins Ausland reisen. </p> <p>Zum <em>„Königlichen Hause“</em> wird in der Konstitution festgelegt,</p> <ul> <li>dass die Krone erblich ist <em>„in dem Manns-Stamme des regierenden Hauses, nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatisch-linealischen Erbfolge“</em>.</li> <li>Die Prinzessinnen sind für immer von der Regierung ausgeschlossen, so lange noch männliche Nachkommen vorhanden sind.</li> <li>Sämtliche Familienmitglieder des königlichen Hauses stehen unter der Gerichtsbarkeit des Monarchen, und können bei Verlust Ihres Erbfolge-Rechts nur mit dessen Einwilligung zur Ehe schreiten. </li> </ul> <p>Nach den Bestimmungen der Konstitution besteht zur Verwaltung des Königreiches Baiern </p> <ul> <li>das Ministerium aus fünf Departements, dem des Äußeren, der Justiz, der Finanzen, des Inneren und des Kriegswesens. </li> <li>Zudem teilte sie das Königreich in Kreise ein, um so einen einheitlichen Beamten- und Verwaltungsstaat zu schaffen.</li> <li>Auch das Justiz- und Militärwesen werden neu organisiert. </li> </ul> <p>Ein Parlament ist in Form einer National-Repräsentation vorgesehen, kommt aber nicht zustande. <br /> Gleichwohl werden die Vertretungen der einzelnen Teilgebiete des Königreichs mit Inkrafttreten der Verfassung abgeschafft. </p> <ul> <li>Die National-Repräsentanten sollten für die Dauer von sechs Jahren gewählt werden. </li> <li>Dazu sollten in jedem der acht Kreise,von den 200 höchstbesteuerten <em>„Land-Eigenthümern, Kaufleuten und Fabrikanten“</em> von Wahlmännern sieben Mitglieder gewählt werden. Diese 56 Gewählten hätten dann die Reichs-Versammlung gebildet. </li> </ul> <p>Durch die Einführung der Konstitution verhindert Minister Maximilian Joseph von Montgelas, dass der auf Napoléon Bonapartes Drängen geschlossene Rheinbund die Souveränität des Königreichs Baiern zu stark einschränkt.</p>
19. 5 1808 - Die Lehel-Kaserne als Unterkunft für das Fuhrwesen-Bataillon
München-Lehel * König Max I. Joseph bestimmt die Lehel-Kaserne als Unterkunft für das Artillerie- und Armee-Fuhrwesen-Bataillon, für das eine große hölzerne Remise für sechzig Transportwagen im ehemaligen Klostergarten erbaut wird.
1. 6 1808 - Gründung der Königlichen Akademie der Bildenden Künste
München * Gründung der Königlichen Akademie der Bildenden Künste. Ihr erster Direktor ist der inzwischen in den Adelsstand erhobene, aus Düsseldorf stammende Johann Peter von Langer.
7 1808 - Die Münchner lieben Theater und Unterhaltung
München * Das „Journal des Luxus und der Moden“ berichtet, dass es in München bei allen Ständen üblich sei, sich von „Lipperltheatern, Menagerien, Automaten und italienischen Puppenspielern“ unterhalten zu lassen.
12. 7 1808 - Staatliche Vorschriften zur Verehelichung
München - Königreich Baiern * In einer erlassenen Verordnung zur „Beförderung der Heiraten auf dem Lande“ wird die Verehelichung von der „Bewilligung der ordentlichen Polizeiobrigkeit des Ortes“ abhängig gemacht, „wo die Heiratenden mit hinreichender Aussicht auf ihre Nahrung den Wohnsitz nehmen“. Damit wird den Gemeinden auch in Fragen der Verehelichung die Mitwirkung entzogen.
Zusätzliche Haftungsbestimmungen gegenüber den entscheidenden Beamten schränken die Wirksamkeit der Verordnung stark ein. Sollte sich die Familie doch nicht selbst ernähren können, fällt der Unterhalt der genehmigenden Behörde zur Last.
Wenn Geistliche eine Eheschließung ohne die vorherige staatliche Heiratsbewilligung vornehmen, haften sie „für Schäden und Kosten, welche hieraus irgendeiner Gemeinde zuwachsen“.
Eheschließungen außerhalb Baierns werden für ungültig erachtet und sind strafbar.
25. 7 1808 - Die bisherige Landgemeinde Au wird zur Vorstadt erhoben
Vorstadt Au * Die bisherige Landgemeinde Au wird zur Vorstadt erhoben bzw. als solche bestätigt. Sie erhält das Recht ein eigenes Wappen zu führen. Es zeigt drei Lilien auf drei Hügeln.
30. 8 1808 - Prinzessin Ludovica Wilhelmine wird in München geboren
München * Prinzessin Ludovica Wilhelmine, die spätere Herzogin in Bayern und Mutter der österreichischen Kaiserin Elisabeth „Sisi“, wird als Tochter des baierischen Königs Max I. Joseph und dessen zweiter Ehefrau Caroline von Baden in München geboren.
8. 9 1808 - Die Bestrafung der einfachen Unzucht wird abgeschafft
München - Königreich Baiern * Mit dem organischen Edikt wird die Fornikationsstrafe, die Bestrafung der einfachen Unzucht, abgeschafft. Dadurch sollen vor allem Abtreibungen und Kindermorde verhindert werden.
13. 9 1808 - Adrian von Riedl erbittet den Bau einer Mühle mit vier Gängen
München-Englischer Garten - Tivoli * Adrian von Riedl erbittet bei Kurfürst Max IV. Joseph den Bau einer Mühle mit vier Gängen. Sie soll auf seinen Wiesen unterhalb der Bogenhausener Brücke, zwischen Isardamm und Schwabinger Bach entstehen. Zum Betrieb der Mahlmühle will er „mittels eines Kanals durch seine Wiesen das Wasser aus dem Eisbach hereinleiten und unterhalb der Mühle wieder in denselben einlassen“.
24. 9 1808 - Die Regierung steht Adrian von Riedls Mühlenplanungen positiv gegenüber
München-Englischer Garten - Tivoli * Die Königliche Regierung steht Adrian von Riedls Mühlenplanungen positiv gegenüber, da damit die anliegenden Dörfer Schwabing, Bogenhausen und Föhring eine Mahlmöglichkeit erhalten würden.
Bisher mussten die Bewohner dieser Dörfer zwei bis drei Stunden zur nächsten Mühle fahren.
Doch die Kgl. General Direction des Wasser-, Brücken- und Straßenbaus hat Bedenken, dass dadurch der Eisbach zurückgestaut und damit die Geschwindigkeit es Baches und somit der Abfluss des Eises vermindert werden würde. Der Eisbach nimmt nämlich im Winter die Schneemassen der Münchner Straßen auf. Daher der Name.
Doch zuletzt wird Riedl der Mühlenbau mit der Auflage genehmigt, dass er das Abeisen von seinem Grundbaum bis aufwärts zur Bogenhausener Brücke auf eigene Kosten zu besorgen hätte. Damit wird Adrian von Riedl zum Gründer der Neumühle am Eisbach.
24. 9 1808 - Eigentum und Gewerbe zur Ansässigkeit
München - Königreich Baiern * Ein Gemeindeedikt erklärt alle Einwohner einer Gemeinde zu vollberechtigten Gemeindemitglieder, die in der Gemarkung
- besteuerte Wohnhäuser oder Gründe besitzen oder
- steuerpflichtige Gewerbe ausüben.
1. 10 1808 - Das Lehel wird selbstständiger Pfarrsitz und Pfarrsprengel
München-Lehel * Die neue Anna-Pfarrei wird mit ihren etwa dreitausend Seelen an einen Weltpriester übertragen und das Lehel damit zu einem selbstständigen Pfarrsitz und Pfarrsprengel. Das ist in München die erste Neuerrichtung einer Pfarrei seit dem 13. Jahrhundert. Der Pfarrhof entsteht an der heutigen Pfarrstraße, die dadurch ihren Namen ändert. Bis dahin hieß sie Große Badstraße. Zwanzig Jahre versehen weltgeistliche Pfarrer die neue Pfarrei St. Anna.
4. 12 1808 - Herzog Max in Baiern wird in Bamberg geboren
Bamberg * Herzog Max in Baiern wird in Bamberg geboren.
6. 12 1808 - Aloys (Louis) Nicolaus Graf von Arco-Stepperg wird geboren
Stepperg * Aloys (Louis) Nicolaus Graf von Arco-Stepperg wird auf Schloss Stepperg geboren. Seine Mutter ist die Kurfürsten-Witwe Maria Leopoldine, sein Vater Ludwig Joseph Graf von Arco.
20. 12 1808 - Das Königreich Baiern gibt sich ein neues Wappen
München * Das Königreich Baiern gibt sich ein neues Wappen. Die 42 baierischen Rauten bleiben. Die Symbole im Herzschild beziehen sich jetzt aber auf die Souveränität des Königreichs und zeigen Zepter, Schwert und Krone auf rotem Grund, der Farbe der Hochgerichtsbarkeit. Dieses Wappen bleibt bis 1835 gültig.
1809 - Die freiwillige „Bürgerwehr“ wird in die „Nationalgarde“ eingegliedert
München * Durch eine Neuorganisation des Militärs wird die bisher freiwillige „Bürgerwehr“ nach französischem Vorbild in die dreigliedrige „Nationalgarde“ eingegliedert.
Die „Nationalgarde I. Klasse“ bildet das „Stehende Heer“, die „II. Klasse“ wird zur „Landesverteidigung innerhalb des Königreichs“ verpflichtet.
Die „Nationalgarde III. Klasse“ war die ehemalige „Bürgerwehr“.
Sie untersteht jetzt den staatlichen Behörden für „polizeiliche Aufgaben“.
Seit dem Spätmittelalter hatte die „Bürgerwehr“ in zunehmenden Maße „repräsentative Funktionen bei festlichen Anlässen“ der Städte und des Fürstenhauses wahrgenommen.
Die vornehmsten Aufgaben - „Ehrengeleit und Ehrenwache für höchste Herrschaften“ blieb der „Bürger-Kavallerie“ vorbehalten.
Eine „Kavallerie-Division“ gibt es - neben dem „Invanterie-Regiment“ und der „Artillerie-Kompanie“ - auch in München.
Sie wird unter ihrem „Major“ Andreas von Dall‘Armi das „Pferderennen“ aus Anlass der Hochzeit von „Kronprinz“ Ludwig I. und „Prinzessin“ Therese von Sachsen-Hildburghausen austragen.
Eine „Schicki-Micki-Armee“.
1809 - Im Königreich Baiern gibt es 93 verschiedene Flüssigkeitseinheiten
München * In dem neuen Staatsgebilde „Baiern“ gibt es 93 verschiedene Flüssigkeitseinheiten.
Diese werden durch die „Einführung der baierischen Mass“ ersetzt.
Das „baierische Maaß“ fasst 1.069 Kubikzentimeter.
1809 - In Tirol kommt es zu Erhebungen gegen die Besatzungsmacht
Tirol * In Tirol kommt es zu Aufständen gegen die Besatzungsmacht
Dreimal wird Tirol „befreit“, ebenso oft von baierischen und französischen Truppen wieder eingenommen.
1809 - Pläne für eine „Walhalla“ im „Englischen Garten“
München-Englischer Garten * Pläne für eine zum Andenken der „großen Teutschen“, einer „Walhalla“ im „Englischen Garten“ entstehen.
1809 - Der „Konvent der Schwestern der heiligen Elisabeth“ wird aufgelöst
München-Ludwigsvorstadt * Der „Konvent der Barmherzigen Schwestern der heiligen Elisabeth“ wird aufgelöst.
Ihr Frauenspital wird in das „Allgemeine Krankenhaus“ eingegliedert.
Sechs ehemalige Nonnen kümmern sich auch weiterhin um das „Augustiner Christkindl“.
1809 - Der Weiler „Niedergiesing“ wird zur „Vorstadt Au“ eingemeindet
Vorstadt Au * Bis zu seiner Eingemeindung in die „Vorstadt Au“ ist der Weiler „Niedergiesing“, auch „Untergiesing“ genannt, selbstständig.
Er besteht aus drei großen Bauernhöfen: dem „Spießmüller“, dem „Jägerwirt“ und dem „Krebsbauernhof“.
1809 - Weinmüllers Gesuch um Errichtung eines Theaters
<p><em><strong>München</strong></em> * Johann Weinmüller reicht ein Gesuch für ein Theater in fester Bauweise in der Maxvorstadt ein. Die Münchner Polizeidirektion lässt sich aber nur zu einem Bau vor dem Isartor überreden. Es wird daraufhin eine provisorische hölzerne Hütte errichtet. Das Publikum des Theaters in der Bretterbude besteht zunächst aus Bürgern der unteren Einkommensschichten. </p>
Ende 1 1809 - Erzherzog Johann lädt die führenden Köpfe des Tiroler Widerstands ein
Wien - Tirol * Erzherzog Johann lädt drei der zu den führenden Köpfen des Widerstands zählenden Tiroler nach Wien.
Darunter ist Andreas Hofer, der „Sandwirt“ aus dem Passeier. In vertraulichen Gesprächen werden Informationen und Meinungen ausgetauscht und konkrete Vereinbarungen getroffen.
Um mögliche rechtlich-moralische Bedenken der Tiroler Bevölkerung im Aufstand gegen die baierische Landesherrschaft auszuräumen, will der Erzherzog gleich bei Kriegsbeginn ein „Besitzergreifungspatent“ unterzeichnen und damit Tirol wieder mit Österreich vereinen.
Damit wären die Tiroler keine baierischen Untertanen mehr, sondern Österreicher.
Und wer dann gegen die Baiern kämpft, wäre kein „Aufständischer“ sondern ein „Freiheitskämpfer“.
In der Folge wird die „Erhebung Tirols“ ins Rollen gebracht.
Es sind viele Gründe zusammengekommen, die den „Aufstand der Tiroler“ gegen die baierische Herrschaft letztlich auslösen.
Keiner allein hätte ausgereicht:
- weder die Aufhebung der alten Verfassung noch die Überheblichkeit baierischer Beamter,
- weder die drückende Steuerlast noch die religionspolitischen Maßnahmen;
- ja nicht einmal die verhasste Rekrutierung zum baierischen Militär hätte unter anderen Umständen solche verheerende Folgen gezeigt.
Ausschlaggebend war, dass die Tiroler unter Baiern keine Tiroler bleiben durften, sondern zu „Südbaiern“ gemacht wurden.
2 1809 - In Tirol kommt es zu Aufständen gegen die baierischen Landesherren
Tirol * In Tirol kommt es zu Aufständen gegen die baierischen Landesherren.
„Ungeliebte“ Maßnahmen der Münchner Regierung und ein vielfach landfremdes und unkluges Verhalten der baierischen Beamten provozieren Unmut und Widerstand gerade beim „Vierten Stand“, den Bauern, kleinen Handwerkern und Tagelöhnern.
Durch die Kriegsverhältnisse gelingt es nicht, in Tirol eine gewisse Zufriedenheit mit der baierischen Präsenz zu erzeugen.
9. 3 1809 - Adrian von Riedl verkauft die Neumühle an den Müller Schöttl
München-Englischer Garten * Adrian von Riedl verkauft die sich im Rohbau befindliche „Neumühle“ zu einem Schleuderpreis von 1.200 Gulden an den Münchner Bäcker und Müller Johann Jakob Schöttl. Auch der Mühlkanal ist bereits gegraben.
12. 3 1809 - Die baierischen Behörden wollen in Tirol Rekruten „ausheben“
Innsbruck * Die baierischen Behörden wollen in Axams bei Innsbruck erstmals in Tirol Rekruten „ausheben“. Weil sich die betroffenen Burschen in den Wäldern verstecken, schwärmen Patrouillen aus, um die Entlaufenen festzunehmen.
Als eine baierische Patrouille zwei bewaffnete junge Männer festnehmen will, werden sie in die Flucht geschlagen. Daraufhin wird das Militär in Alarmbereitschaft gesetzt. Jetzt greifen die Bauern zu den Waffen, nehmen baierische Soldaten gefangen, entwaffnen sie und schicken sie nach Innsbruck zurück.
18. 3 1809 - Adrian von Riedl stirbt
<p><strong><em>München</em></strong> * Adrian von Riedl stirbt neun Tage nach seinem Verkauf der Neumühle.</p>
24. 3 1809 - Bitte um Gründung einer Landwirtschaftlichen Gesellschaft
München * Sechzig „wirklich hochsinnige Maenner“, Aristokraten und geadelte Mitglieder der Baierischen Akademie der Wissenschaften sowie höhere Beamte, aber kein einziger aktiv praktizierender Landwirt, bitten König Max I. Joseph eine „Landwirthschaftliche Gesellschaft“ gründen zu dürfen. Sie beabsichtigen die „practische Beförderung der Landwirthschaft“ und des in „näherer Verbindung stehenden Gewerbes“.
24. 3 1809 - Religionsfreiheit und Gleichbehandlung der Konfessionen bestätigt
München-Kreuzviertel * Das Edikt über die äußeren Rechtsverhältnisse des Königreiches Baiern in Bezug auf Religion und kirchliche Gesellschaften bestätigt die Religionsfreiheit und verankert die Gleichbehandlung der Konfessionen.
9. 4 1809 - Erzherzog Johann erklärt Frankreich und seinen Verbündeten den Krieg
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Erzherzog Johann erklärt Frankreich und seinen Verbündeten den Krieg. Gemeinsam mit dem österreichischen General Johann Gabriel Marquis von Chasteler de Courcelles und 10.000 Mann der <em>„Italienarmee“</em> rücken sie in Tirol ein.</p>
9. 4 1809 - Der Krieg Österreichs gegen Frankreich beginnt
Österreich - Königreich Baiern * Mit dem Einmarsch der österreichischen Truppen in Baiern beginnt der Krieg Österreichs gegen Frankreich.
10. 4 1809 - Lohe, Falkenau und Birkenleiten kommen zur Vorstadt Au
<p><strong><em>Vorstadt Au - Untergiesing</em></strong> * Die Lohe, die Falkenau, die Birkenleiten und das alte Untergiesing - oder besser Nieder-Giesing - auf dem heutigen Nockherberg und an der Ruhestraße kommen zur Vorstadt Au. Die Bewohner der Lohe und der Oberen Falkenau wollen aber die Lasten der städtischen Verfassung nicht auf sich nehmen und protestieren lautstark gegen die Zwangseingemeindung.</p>
10. 4 1809 - Die Nachricht vom Kriegsbeginn verbreitet sich in ganz Tirol
Tirol * Die Nachricht vom Kriegsbeginn und der Vormarsch der österreichischen Truppen verbreitet sich in ganz Tirol wie ein Lauffeuer.
Auf Flugzetteln, die selbst in den hintersten Tälern kursieren, wird die Bevölkerung zu den Waffen gerufen.
Eine starke baierische Einheit greift das Dorf Axams zur Strafexpedition an.
Die Baiern stoßen dabei auf bewaffneten Widerstand.
Es fallen Schüsse, in denen der erste baierische Soldat stirbt.
Erzherzog Karl überschreitet in der Zwischenzeit mit der Hauptmacht der österreichischen Armee den Inn und marschiert in Richtung München.
12. 4 1809 - In und um Innsbruck toben heftige Kämpfe
<p><strong><em>Innsbruck</em></strong> * In und um Innsbruck toben heftige Kämpfe.</p> <ul> <li>Um 5 Uhr früh greifen 6.000 Bauern die baierischen Soldaten an. Innsbruck wird von den Tiroler <em>„Aufständischen“</em> erobert. Die baierischen Truppen werden gefangen genommen. </li> <li>Um 10 Uhr ist der Kampf beendet. Danach beginnen in der ganzen Stadt Plünderungen, die auch Judenfamilien einschließen, die kurz zuvor Kirchensilber ersteigert haben. Die Volkswut tobt.</li> </ul>
13. 4 1809 - Die Erste Befreiung Tirols
<p><strong><em>Innsbruck - Tirol</em></strong> * Der französische General Bisson rückt mit 2.000 Mann auf Innsbruck vor. Er kapituliert ohne Kampfhandlung. Damit haben die Tiroler <em>„Aufständischen“</em> die französisch-baierische Armee ohne österreichische Unterstützung geschlagen. Diese Tat geht als <em>„Erste Befreiung Tirols“</em> in die Geschichte ein.</p>
14. 4 1809 - Die von den Baiern gehaltene Festung Kufstein wird belagert
<p><strong><em>Kufstein</em></strong> * Die von den Baiern gehaltene Festung Kufstein wird belagert. Mehrere Aufforderungen zur Übergabe lehnt Major von Aicher ab.</p>
18. 4 1809 - Die Vertreibung der Baiern und Franzosen aus Tirol wird sanktioniert
Tirol * Im „Schärdinger Manifest“ wird von Kaiser Franz I. die Vertreibung der Baiern und Franzosen aus Tirol sanktioniert.
21. 4 1809 - General Chasteler bricht mit seinen Truppen nach Trient auf
Tirol * Nachdem es in Innsbruck nichts mehr zu tun gibt, bricht der in Lothringen geborene österreichische General Johann Gabriel Marquis von Chasteler de Courcelles mit seinen Truppen nach Trient auf, um dort die Franzosen zu vertreiben.
22. 4 1809 - Napoleon Bonaparte gewinnt die entscheidende Schlacht gegen Österreich
Eggmühl * Südlich von Eggmühl gewinnt Napoléon Bonaparte die entscheidende Schlacht gegen die Österreicher.
23. 4 1809 - Der österreichische General von Chasteler kann Trient besetzen
Trient - Tirol * Der österreichische General Johann Gabriel Marquis von Chasteler de Courcelles kann Trient besetzen.
Die Franzosen müssen daraufhin abziehen.
24. 4 1809 - Tirol wird von den Aufständischen - bis auf Kufstein - erobert
Tirol - Kufstein * Mit Ausnahme der Festung Kufstein wird Tirol von den Aufständischen erobert.
29. 4 1809 - Französische und baierische Truppen besetzen Salzburg
Salzburg * Französische und baierische Truppen unter Marschall François Joseph Lefébvre besetzen Salzburg, die Stadt und das Land.
Es folgen weitere Kämpfe, in deren Folge die Verbündeten das Salzburger Gebirgsland drei Mal erobern müssen.
Anfang 5 1809 - Napoleon Bonaparte befiehlt die erneute Unterwerfung Tirols
München - Wien - Tirol * Napoleon Bonaparte kann die anfangs durchaus erfolgreichen Österreicher aus Baiern herausdrängen und nach Wien vorrücken.
Gleichzeitig befiehlt er seinem Marschall Pierre François Joseph Lefèbvre mit zwei baierischen Divisionen unter den Generälen Philipp von Wrede und Bernhard Erasmus Graf von Deroy Tirol wieder zu unterwerfen.
Anfang 5 1809 - Die Tiroler unternehmen „Beutezüge“ nach Baiern
Tirol - Königreich Baiern * Auf Befehl von General Chasteler und unter der Führung eines Freiherrn von Taxis unternehmen rund 800 Tiroler „Beutezüge“ nach Baiern, um dort nach Belieben zu Brennen und zu plündern.
Schongau, Oberndorf, Kaufbeuren und Kempten werden überfallen.
Die Stimmung gegen Baiern wird durch das österreichische Militär mit einigen Propagandalügen noch aufgeheizt.
Der in Diensten Österreichs stehende Martin Teimer reist durch Tirol und erklärt, dass die Baiern beabsichtigen, in allen Orten die Kirchen zu schließen bis auf eine, alle Beichtstühle zu verbrennen bis auf einen, alle Altäre abzutragen bis auf einen und alle Kelche zu konfiszieren bis auf einen.
1. 5 1809 - Salzburg wird im Namen Napoleon Bonapartes verwaltet
Salzburg * Salzburg wird im Namen Napoleon Bonapartes verwaltet.
Der französische Marschall François Joseph Lefébvre bezieht die Residenz.
Kronprinz Ludwig I. von Baiern bewohnt das „Schloss Mirabell“.
11. 5 1809 - General Bernhard Erasmus von Deroy befreit Kiefersfelden
Rosenheim - Kiefersfelden * General Bernhard Erasmus von Deroy rückt von Rosenheim ab und wirft dabei die Tiroler Besatzer aus Kiefersfelden.
11. 5 1809 - Jetzt plündern, vergewaltigen und morden die baierischen Soldaten
Tirol * General Wrede marschiert über Lofer zum „Pass Strub“, wo es zu einem neunstündigen Kampf kommt.
Jetzt plündern, vergewaltigen und morden die baierischen Soldaten.
12. 5 1809 - „Wie tief sind Euere Gefühle von Menschlichkeit gesunken?“
Tirol * General Carl Philipp Joseph von Wrede hält vor seinen Soldaten eine Rede, in der er auf die Vorgänge des Vortags eingeht:
„Ich habe heute und gestern, an den Tagen, wo ich über so manche tapfere Tat der Division zufrieden zu sein Ursache hatte, Grausamkeiten, Mordtaten, Plünderungen, Mordbrennereien sehen müssen, die das Innerste meiner Seele angegriffen und mir jeden frohen Augenblick, den ich bisher über die Taten der Division hatte, verbittern.
Wahr ist es Soldaten! Wir haben heute und gestern gegen rebellische, durch das Haus Österreich und dessen kraftlose Versprechungen irre geführte Untertanen unseres allergeliebten Königs gekämpft, aber wer hat Euch das Recht eingeräumt, selbst die Unbewaffneten zu morden, die Häuser und Hütten zu plündern und Feuer in Häusern und Dörfern anzulegen.
Soldaten! Ich frage Euch, wie tief sind heute und gestern Euere Gefühle von Menschlichkeit gesunken?“.
12. 5 1809 - Die baierischen Truppen erobern Kufstein zurück
Kufstein * Die baierischen Truppen unter General Bernhard Erasmus von Deroy erobern Kufstein zurück.
12. 5 1809 - Napoleon Bonaparte erobert Wien
Wien * Napoleon Bonaparte erobert Wien.
Die Italienarmee des Erzherzogs Johann wird nun an der Donau gebaucht.
15. 5 1809 - Der Kampf um Schwaz dauert zwei Tage
Schwaz - Tirol * Zwei Tage dauert der Kampf um Schwaz, das im Verlauf in Flammen aufgeht. 420 der 425 Häuser brennen. Die Einwohnerzahl sinkt von 5.200 auf 3.000. Selbst in München scheint der Himmel über der Alpenkette zu glühen, aber „nicht vom Feuer der untergehenden Sonne, sondern vom Mordbrande“, schreibt Bettina von Arnim an Johann Wolfgang von Goethe.
19. 5 1809 - Die Divisionen Wrede und Deroy rücken kampflos in Innsbruck ein
Innsbruck - Tirol * Die Divisionen Wrede und Deroy rücken kampflos in Innsbruck ein. Napoleon Bonaparte gibt den Befehl, General Johann Gabriel Marquis von Chasteler de Courcelles „als Räuberanführer, als Urheber der an den gefangenen Franzosen und Baiern verübten Mordtaten und als Anstifter des Tiroler Aufstandes in die Acht erklärt, vor ein Kriegsgericht zu stellen und binnen 24 Stunden zu erschießen“.
Andreas Hofer verhandelt inzwischen am 19. in Mühlbach und am 20. in Bruneck mit General Chasteler und kann ihn zum Verbleib in Tirol überreden.
21. 5 1809 - Abzugsbefehl an alle in Tirol stationierten Truppen nach Österreich
Tirol * Angesichts der durch Napoleon Bonaparte erklärte „Acht“ ändert General Johann Gabriel Marquis von Chasteler de Courcelles seine Meinung und gibt den Abzugsbefehl an alle in Tirol stationierten Truppen nach Lienz und von dort weiter nach Österreich.
22. 5 1809 - Lefébvre und Wrede verlassen mit ihren Truppen Tirol
Tirol * Marschall François Joseph Lefébvre und General Carl Philipp Joseph von Wrede verlassen mit ihren Truppen Tirol. Sie sollen durch einen Angriff auf die Steiermark die in Wien stehende Grande Armee entlasten. In Tirol bleibt nur die Division Deroy zurück. Napoleon Bonaparte hat bei Aspern und Eßling eine Niederlage durch die österreichischen Truppen unter der Führung von Erzherzog Karl erfahren müssen.
Der Truppenabzug beflügelt Andreas Hofer und seine Verbündeten. Er überzeugt den österreichischen General Ignaz von Boul zum gemeinsamen Angriff auf den baierischen Feind. Boul hatte Chastelers Befehl zum Abzug aus Tirol nicht mehr erhalten und blieb nur deshalb im Land.
23. 5 1809 - General Deroy setzt seine Truppen in Alarmbereitschaft
Tirol * General Bernhard Erasmus von Deroy erkennt die von Andreas Hofer ausgehende Gefahr und setzt seine Truppe in Alarmbereitschaft.
25. 5 1809 - Die Erste Bergisel-Schlacht dauert nur wenige Stunden
Innsbruck * Rund 5.000 Tiroler Aufständische unter der Führung von Andreas Hofer greifen am Bergisel die Division Deroy an. Diese Erste Bergisel-Schlacht dauert nur wenige Stunden, da ein heftiger Gewitterregen und die einbrechende Nacht die Kämpfenden trennt.
29. 5 1809 - Es kommt zur Zweiten Bergisel-Schlacht
Innsbruck * Es kommt zur Zweiten Bergisel-Schlacht durch die Tiroler Aufständischen unter der Führung von Andreas Hofer. Über 15.000 Tiroler und österreichische Truppen kämpfen gegen 5.240 Baiern. Die Schlacht bringt die Zweite Befreiung Tirols.
Die siegreichen Tiroler Aufständischen bemerken nicht, dass sich die baierischen Truppen in der Nacht auf die Flucht begeben haben. Und vor lauter Jubel über den Sieg, vergessen sie die Verfolgung des Feindes.
6 1809 - Tirol wird seinem Schicksal überlassen
Tirol * Da Frankreich alle baierischen Truppen bei Wien braucht, überlässt man Tirol zunächst seinem Schicksal.
In Baiern werden Stimmen laut, die für eine friedliche Verständigung mit den Tirolern plädieren. Statt ein Volk mit Gewalt zu unterwerfen, solle man ihm lieber Zugeständnisse in wirtschaftlichen und religiösen Fragen machen.
Nach dem 2. 6 1809 - Major Martin Teimer nimmt seine Ausfälle nach Baiern wieder auf
Tirol - Königreich Baiern * Major Martin Teimer nimmt seine Ausfälle nach Baiern wieder auf. Obwohl viele Tiroler Schützenhauptleute eine Beteiligung an solchen Aktionen ablehnen, findet Teimer genügend Freiwillige. Zu ihnen gesellen sich noch österreichische Soldaten von General Ignaz von Boul. Die Freischärler überfallen Partenkirchen, Murnau, Weilheim, Kochel und Tegernsee.
27. 6 1809 - Joseph von Utzschneider verspricht zu viel
Tirol * Der Generalsalinenadministrator Joseph von Utzschneider kommt nach Tirol, um mit den Aufständischen zu verhandeln. In einem Aufruf an die Tiroler verspricht er
- eine Verringerung der Abgaben,
- eine allgemeine Amnestie und
- die Belassung der Klöster.
Das geht aber der baierischen Regierung zu weit, weshalb Utzschneider wieder abberufen wird.
5. 7 1809 - Napoleon Bonapartes Truppen schlagen die Österreicher entscheidend
Wagram * Napoleon Bonapartes Truppen schlagen am 5. und 6. Juli die Österreicher bei Wagram entscheidend.
12. 7 1809 - Die österreichischen Truppen müssen Tirol und Vorarlberg verlassen
Tirol * Erzherzog Karl muss bei Znaim einen Waffenstillstand unterzeichnen. Laut Artikel 4 müssen die österreichischen Truppen Tirol und Vorarlberg verlassen.
18. 7 1809 - Schlacht gegen die zu Beutezügen einfallenden Tiroler
Spatzenhausen * Zu einer regelrechten Schlacht gegen die zu Beutezügen einfallenden Tiroler „Insurgenten“, wie die Rebellen in Baiern bezeichnet werden, kommt es in Spatzenhausen bei Weilheim.
27. 7 1809 - Hinrichtung mit dem Schwert als alleinige Vollstreckungsart
München * Im Königreich Baiern wird die Hinrichtung mit dem Schwert als alleinige Vollstreckungsart angeordnet.
28. 7 1809 - General Boul erhält den Befehl zum Abzug seiner Truppen aus Tirol
Tirol * Der österreichische General Ignaz von Boul erhält den Befehl zum Abzug seiner Truppen aus Tirol.
30. 7 1809 - Marschall François Joseph Lefébvre zieht kampflos in Innsbruck ein
Innsbruck * Marschall François Joseph Lefébvre zieht kampflos in Innsbruck ein und nimmt in der Hofburg Quartier. Ihm ist klar, dass der Besitz der Tiroler Hauptstadt noch lange nicht die Eroberung Tirols bedeutet. Dazu muss der Kern des Landes von mehreren Seiten angegriffen werden, wozu man die 20.000 Mann in mehrere Korps aufteilt.
4. 8 1809 - General Boul verlässt mit seinen österreichischen Truppen Tirol
Tirol * General Ignaz von Boul verlässt mit seinen österreichischen Truppen Tirol.
4. 8 1809 - Die „französisch-rheinbündischen Truppen“ erleiden schwere Verluste
Tirol * Die „französisch-rheinbündischen Truppen“ erleiden schwere Verluste, nachdem sie südlich von Sterzing an der „Sachsenklemme“ in einen Hinterhalt geraten sind.
Die Tiroler haben über der Schlucht riesige Steinhaufen aufgeschichtet, die nun auf die marschierenden und reitenden französisch-baierischen Truppen niederschlagen.
Scharfschützen erledigen den Rest.
Der Zu Hilfe eilende Marschall François Joseph Lefébvre bleibt mit seinen 7.000 Soldaten hinter Sterzing stecken und wird in der Folge ebenfalls angegriffen.
8. 8 1809 - Verlustreiche Kämpfe an der Pontlatzer Brücke
Tirol * Bei den Kämpfen an der Pontlatzer Brücke werden Teile der Division Deroy aufgerieben.
10. 8 1809 - Großer Widerstand der Tiroler an der „Lienzer Klause“
Tirol * An der „Lienzer Klause“ ist der Widerstand der Tiroler so groß, dass der kommandierende General Rusca nach Kärnten ausweichen muss.
11. 8 1809 - Völlig demoralisierte Truppen sind in Innsbruck eingeschlossen
Innsbruck * Die völlig demoralisierten Truppen Marschall François Joseph Lefébvre sind in Innsbruck eingeschlossen.
13. 8 1809 - Die Dritte Bergisel-Schlacht beginnt
Tirol * Marschall François Joseph Lefébvre glaubt, dass die Tiroler die Sonntagsruhe einhalten und nie in eine Schlacht ziehen würden. Als sich aber die dienstfreie Garnison zum Gottesdienst in der Wiltener Kirche versammelt hat, kommt die Meldung, dass eine große Bauernschar auf der Brennerstraße vorrückt.
Die Dritte Bergisel-Schlacht hat begonnen und wird die Dritte Befreiung Tirols bringen. 17.000 Tiroler stehen einer etwa gleich großen baierischen Streitmacht gegenüber. Nach zwölf Stunden ist die Schlacht beendet. 100 tote Tiroler und mindestens 200 tote Baiern fordert der Kampf.
Bis 18. 8 1809 - Die baierisch-französischen Truppen haben Tirol geräumt
Tirol - Kufstein * Die baierisch-französischen Truppen haben Tirol - mit Ausnahme von Kufstein - geräumt.
4. 10 1809 - Andreas Hofer erhält österreichische Finanzhilfen
Wien - Tirol * Andreas Hofer erhält vom österreichischen Kaiser eine Ehrenkette, dazu eine beträchtliche Geldsumme und einen förmlichen Operationsplan von Erzherzog Johann.
9. 10 1809 - Die Statuten des Landwirtschaftlichen Vereins werden bestätigt
München * Die Statuten des Landwirthschaftlichen Vereins, Sitz München, werden vom König bestätigt. Laut seiner Satzung will der Landwirthschaftliche Verein in Baiern seine Zwecke erreichen,
- „durch mündliche und schriftliche Mittheilungen seiner Mitglieder;
- durch Ankauf und Vertheilung vorzüglicher Viehzuchtracen,
- nützlicher Sämereien und Gewächse,
- dann zweckmäßiger Geräthe; [...],
- Herausgabe einer Wochenschrift, [...];
- Vertheilung von Preisen für wichtige mit besonderem Fleiße und entsprechendem Erfolge ausgeführten Versuche und Abfassung wichtiger vom Verein veranlaßter Abhandlungen;
- endlich durch Unterstützung würdiger, unverschuldet verunglückter Arbeiter, Gewerbe- und Landleute.“
9. 10 1809 - Wieder wird die Seidenzucht in Baiern eingeführt
München * König Max I. Joseph bestätigt die Statuten der neu gegründeten Landwirthschaftlichen Gesellschaft, die umgehend eine Seidenzucht-Section einrichtet. Erneut führt man damit den Seidenbau in Baiern ein.
14. 10 1809 - Der Friede von Schönbrunn und Tirol
Schönbrunn - Tirol * Der Friede von Schönbrunn beendet die Erhebung Österreichs gegen Frankreich. Österreich muss Tirol wieder den Baiern überlassen. Das verbündete Tirol und ihre Anführer erhalten darüber jedoch keine Informationen.
17. 10 1809 - Der baierische Einmarsch in Tirol beginnt
Tirol * Der baierische Einmarsch in Tirol beginnt.
19. 10 1809 - Die Salzburger Gegenoffensive geht verloren
Salzburg * Die Salzburger Gegenoffensive geht verloren. Franzosen und Baiern nutzen die Stadt als Lazarett- und Etappenort.
21. 10 1809 - Der Erzherzog setzt den Tiroler Oberkommandanten Andreas Hofer ab
Tirol * Ein Kurier des Erzherzogs Johann informiert den Tiroler Oberkommandanten Andreas Hofer mündlich darüber, dass er abgesetzt sei. Der Grund dafür wird ihm nicht erklärt.
24. 10 1809 - Die baierischen Truppen ziehen in Innsbruck ein
Innsbruck * Die baierischen Truppen ziehen in Innsbruck ein. Der Bergisel ist nur notdürftig besetzt. Viele der besten Anführer und Kompanien der Tiroler wollen nicht mehr kämpfen. Die Baiern hätten die Tiroler Stellungen einfach überrennen können, doch Kronprinz Ludwig I. will ein unnötiges Blutvergießen vermeiden. Stattdessen soll eine Truppenparade die baierische Macht demonstrieren und jeden weiteren Widerstand als sinnlos erscheinen lassen.
25. 10 1809 - Der baierische Kronprinz Ludwig I. zieht in Innsbruck ein
Innsbruck * Der baierische Kronprinz Ludwig I. zieht in Innsbruck ein.
27. 10 1809 - Andreas Hofer erhält 18.000 Papiergulden für den Kampf gegen Frankreich
Tirol * Ein Bote aus Wien überbringt Andreas Hofer 18.000 Papiergulden zur Unterstützung des Kampfes gegen Frankreich und Baiern. Fast gleichzeitig trifft die gedruckte Friedensproklamation des italienischen Vizekönigs Eugéne Beauharnais ein. Das Schreiben enthält auch die Zusage, dass kein Tiroler „Rebell“ ein Strafe zu erwarten habe. Die Tiroler Aufständischen sehen in der Friedensproklamation aber nur eine Kriegslist des baierisch-französischen Feindes.
28. 10 1809 - Im Frieden von Schönbrunn wird Tirols Baiern überlassen
Tirol * Erzherzog Johann unterrichtet im Auftrag seines kaiserlichen Bruders die Tiroler Freunde über den Frieden von Schönbrunn und der Überlassung Tirols an Baiern. Der Tiroler Oberkommandant Andreas Hofer will daraufhin nach Innsbruck fahren und mit dem baierischen Kronprinzen Ludwig I. verhandeln.
Da erscheint der Kapuzinermönch Joachim Haspinger, genannt „Pater Rotbart“, der Hofer - mit seiner Redekunst, aber auch mit Lügen - umstimmen will. Und der der Geistlichkeit hörige Andreas Hofer lässt sich umstimmen. Erzherzog Johann informiert auch den Südtiroler Josef Giovanelli über den Frieden von Schönbrunn. Daraufhin machen sich viele Aufständische auf den Nachhauseweg.
1. 11 1809 - Es kommt zur vierten und letzten Schlacht am Bergisel
Innsbruck - Bergisel * Es kommt zur vierten und letzten Schlacht am Bergisel. 20.000 baierische Soldaten stehen etwa 8.500 Tirolern unter der Führung des Sandwirts Andreas Hofer gegenüber. Die Schlacht ist nach knapp drei Stunden entschieden. Die - von baierischer Seite „Rebellen“ oder „Insurgenten“ genannten - Aufständischen vernichtend geschlagen.
Der Aufstand der Tiroler und die zunächst vergeblichen Versuche, Tirol zurückzuerobern, sind in den Augen Napoleons eine militärische Schande, die seinen Ruf als unbesiegbaren Feldherrn beschädigt. Dies führt dazu, dass der Franzose eine Teilung für notwendig erachtet.
Die Südtiroler nehmen an den Kämpfen nicht mehr teil. Rund einhundert Abgeordnete versammeln sich in Bozen, beschließen die Niederlegung der Waffen und informieren Andreas Hofer darüber.
2. 11 1809 - Max Joseph von Montgelas wird in den Grafenstand erhoben
München * Freiherr Max Joseph von Montgelas wird in den Grafenstand erhoben.
2. 11 1809 - Die Tiroler beschließen ein Unterwerfungsschreiben
Tirol * Ein französischer Offizier mit wichtigen Schriftstücken wird von den Tiroler Rebellen gefangen genommen. Die Dokumente enthalten eindeutige Beweise über die Richtigkeit des Schönbrunner Friedens, die auch die hartnäckigsten Zweifler überzeugen.
Die Versammelten beschließen ein Unterwerfungsschreiben an Napoleons Adoptivsohn Eugéne Beauharnais, dem Vizekönig von Italien, der auch die den Tirolern zugestellte Friedensproklamation unterzeichnet hatte.
3. 11 1809 - Eine Abordnung der Tiroler reisen zu Eugéne Beauharnais
Tirol - Villach * Eine Abordnung der Tiroler Aufständischen, bestehend aus Jakob Sieberer und Josef Daney, macht sich auf den Weg nach Villach, wo Eugéne Beauharnais residiert.
4. 11 1809 - Andreas Hofer unterzeichnet das Unterwerfungsschreiben
Tirol - Pustertal - Innsbruck * Andreas Hofer unterzeichnet als „gewöster Oberkommandant“ ein „Unterwerfungsschreiben“ für das Pustertal an den in Innsbruck kommandierenden General Drouet.
Nahe der Trostburg in Südtirol wird eine 1.200 Mann starke französische Truppe angegriffen. Um ein Drittel dezimiert entkommt die Einheit nach Bozen.
5. 11 1809 - Bewaffnete Südtiroler Bauern greifen Bozen an
Tirol - Bozen * Bewaffnete Südtiroler Bauern greifen Bozen an. Unentschlossenheit und mangelnde Führung verhinderten einen Erfolg. Als sich dann von Süden her 2.000 französische Soldaten der Stadt nähern, lösen sich die Angreifer auf.
Andreas Hofer, der „gewöste Oberkommandant“, trifft am Brenner auf einige, nicht zum Frieden entschlossene Aufständische und ändert seine Einstellung erneut. Er ignoriert das Beratungsergebnis der von ihm selbst einberufenen Delegiertenversammlung und bricht sein gegebenes Wort gegenüber General Drouet. Erneut ruft er zum Kampf auf. Dass er damit dem Land jede Schonung verbaut, muss er wissen.
6. 11 1809 - Eine Abordnung der Tiroler Aufständischen wird empfangen
Tirol * Jakob Sieberer und Josef Daney, dIe Abordnung der Tiroler Aufständischen, werden vom italienischen Vizekönig empfangen. Eugéne Beauharnais bestätigt in einem Schreiben die wichtigsten Punkte der Friedensproklamation vom 25. Oktober. Darunter auch die Straffreiheit der Rebellen , obwohl die Tiroler die Waffen nicht niedergelegt haben.
8. 11 1809 - Andreas Hofer ändert ständig seine Meinung
Tirol * Jakob Sieberer und Josef Daney halten Andreas Hofer die „Ströme zwecklos jetzt noch zu vergießenden Menschenbluts, Städte und Dörfer in Asche“ vor und dass er das Land in Not und Elend, tausende Familien an den Bettelstab und seine treuen Anhänger an den Galgen bringen würde.
Wieder ändert Andreas Hofer seine Meinung, denn „unser lieber Herrgott und die Mutter Gottes werd'n wohl all's recht mach'n“. Daney und Sieberer verfassen einen Aufruf, der zur Niederlegung der Waffen aufruft. Andreas Hofer unterzeichnet das Schreiben, das daraufhin in Abschrift im ganzen Land verteilt wird.
An der Mühlbacher Klause überfallen Südtiroler Aufständische auf Hofers Aufruf vom 5. November hin französische Truppen. 500 Soldaten kommen dabei ums Leben.
10. 11 1809 - Tiroler Rebellen überfallen bei Imst baierische Truppen
Imst * Tiroler Rebellen überfallen bei Imst baierische Truppen. Sie kennen nur Hofers Kampfaufruf vom 5. November, nicht aber den Friedensaufruf vom 8. November.
11. 11 1809 - Andreas Hofer bricht sein gegebenes Wort
Tirol * Andreas Hofer hat sich inzwischen in das Sandwirtshaus in Sankt Leonhard zurückgezogen. Wieder ändert er seine Meinung und bricht sein gegebenes Wort, indem er einen weiteren Kampfaufruf unterschreibt. „Wenn Wir nachgeben ist Glaube, Religion, Volk und alles hin. Wer widerstrebt, ist ein Feind Gottes und des Vaterlands.“
12. 11 1809 - Italiens Vizekönig Eugéne Beauharnais erlässt eine Proklamation
Tirol * Italiens Vizekönig Eugéne Beauharnais erlässt eine Proklamation, derzufolge jeder erschossen wird, der noch zu den Waffen greift oder auch nur eine Waffe versteckt hält.
13. 11 1809 - General Rusca zieht mit 2.000 Mann nach Meran ein
Meran * General Rusca zieht mit 2.000 Mann nach Meran ein. Die Hälfte seiner Soldaten schickt er in das Tal hinein, um nach dem Rechten zu sehen. Drei Passeirer Kompanien erwarten die Franzosen und schlagen sie in die Flucht.
16. 11 1809 - Am Meraner Küchelberg kommt es zum Kampf
Meran - Tirol * Am Meraner Küchelberg kommt es zum Kampf zwischen den Franzosen und den Südtirolern. Es beginnt zu regnen, was das Schießen stark beeinträchtigt. Die Franzosen geraten in die Defensive und müssen sich in die Meraner Häuser zurückziehen. In der Nacht können sie fliehen, erleiden aber starke Verluste durch von den Tirolern aufgeschichteten und bewegten Steinlawinen.
18. 11 1809 - Eine französische Einheit wird zur Kapitulation gezwungen
Tirol * Eine französische Einheit kommt General Rusca zu Hilfe. Sie wird aber bei Sankt Leonhard eingekesselt und nach viertägigem Kampf am 22. November zur Kapitulation gezwungen.
Um den 19. 11 1809 - Andreas Hofer lässt Jakob Sieberer und Josef Daney gefangen nehmen
Passeiertal - Tirol * Andreas Hofer lässt Jakob Sieberer und Josef Daney als Gefangene ins Passeiertal bringen und als Landesverräter, Franzosen- und Baiernfreunde sowie Spione zum Tode verurteilen.
Mit den Worten: „Halt's Maul. Ich lass' dich und den Pfaffen totschießen für eure Lügen und alle, die den Frieden verkünden“, verweigert Hofer Jakob Sieberer auch einen Abschiedsbrief an seine Frau. Im Kerker entzieht man ihm sogar Wasser und Brot. Josef Daney wird in den gleichen Kerker geworfen.
Dass sie am Leben bleiben, verdanken sie einem 3.000 Mann starken französischem Korps, vor dem die Aufständischen fliehen.
24. 11 1809 - Im Paznauntal kommt es zu Kämpfen
Paznauntal * Im Paznauntal kommt es zu Kämpfen, die durch das Aufgebot von über 100 Bäuerinnen und Dirnen eine gewisse Berühmtheit erlangt haben.
Um den 27. 11 1809 - Das Ende der baierischen Herrschaft über Südtirol
Südtirol * Das Ende der baierischen Herrschaft über Südtirol zeichnet sich ab. Französische Truppen haben die Kontrolle über das Gebiet südlich des Brenners und des Reschenpasses übernommen.
29. 11 1809 - Maximilian Joseph von Montgelas erhält das Grafendiplom
München * In Anerkennung seiner Verdienste um den König, die königliche Familie und um Baiern erhält Freiherr Montgelas das Grafendiplom verliehen. Es ist vererbbar - und damit können seine ehelichen männlichen und weiblichen Nachkommen auch diesen Adelstitel führen.
Damit verbunden ist, als besonderer Gnadenerweis und Vertrauensbeweis des Königs, die Errichtung eines Majorats. Ein Majoratsbesitzer kann frei über sein Eigentum bestimmen und darf es im Erbfall sogar ungeteilt an den ältesten Sohn weitergeben. Neben Montgelas gelingt es in Altbaiern nur zwei Familien, ein Majorat zu bilden: Carl Philipp Fürst von Wrede und Johann Maximilian von Preysing-Hohenaschau.
Für Montgelas, der ursprünglich aus einer Familie ohne jeglichen Grundbesitz stammt, hat das Majorat zwischenzeitlich erhebliche Bedeutung gewonnen, denn er wird schon während seiner Amtszeit zu einem der reichsten Grundherren.
12 1809 - Tirol wäre besser bei Frankreich
Tirol * Die französische Militärverwaltung versucht den Tirolern karzumachen, dass sie bei Frankreich besser als bei Baiern aufgehoben wären.
1. 12 1809 - Bei der Lienzer Klause kommt es erneut zu Kämpfen
Tirol * Bei der Lienzer Klause kommt es erneut zu Kämpfen.
6. 12 1809 - Als Strafe für die Belagerung Brixens werden Dörfer abgebrannt
Brixen * Als Strafe für die Belagerung Brixens gehen die Dörfer Vahrn, Kranabit, Neustift, Elvas, Miland und die Fraktionen von Pfeifersberg mit 200 Höfen und 28 Ansitzen in Flammen auf.
8. 12 1809 - Letzter Waffengang zwischen Tiroler Aufständischen und Baiern
Tirol * Den letzten Waffengang liefern sich Tiroler Aufständische und baierisch-französische Truppen vor Ainet im Iseltal.
9. 12 1809 - Johann Wilhelm von Hompesch stirbt
Berg am Laim * Der Berg am Laimer Hofmarkbesitzer und Baierische Minister der Finanzen Johann Wilhelm von Hompesch stirbt. Sein Bruder Ferdinand übernimmt die Hofmark Berg am Laim. Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas besetzt den Posten des Finanzministers.
Nach dem 9. 12 1809 - Montgelas übernimmt zum zweiten Mal die Funktion des Finanzministers
München-Kreuzviertel * Nach dem Tod des Baierischen Ministers der Finanzen, Johann Wilhelm von Hompesch, übernimmt Maximilian Joseph Graf von Montgelas zum zweiten Mal die Funktion des Finanzministers. Damit konzentrieren sich die drei wichtigen Ministerien Außenministerium, Innenministerium und Finanzministerium in einer Person.
Montgelas hat im Verlauf seiner Tätigkeit in Bayern sehr viel Macht, Entscheidungsgewalt und Einfluss auf seine Person konzentriert. Er ist nicht nur mächtig, sondern sogar allmächtig. Ein Zustand, den er übrigens im Ansbacher Mémoire massiv kritisiert hat. Dies führt im Krankheitsfall des Ministers allerdings zum nahezu völligen Erliegen der Regierungstätigkeit.
20. 12 1809 - Kronprinz Ludwig entscheidet sich für Therese
Hildburghausen * Kronprinz Ludwig I. trifft in der kleinen Residenzstadt Hildburghausen ein. Er befürchtet nicht unbegründet, dass ihn Napoleon Bonaparte mit einer ihm genehmen Frau verheiraten will. Das will der junge Baier verhindern, weshalb sich selbst auf Freiersfüßen begibt und eine Ehefrau sucht.
Er muss sich entscheiden zwischen der großen, schlanken, 17-jährigen Therese und der eineinhalb Jahre jüngeren, aber „zweifellos hübscheren“ Luise. Er entscheidet sich für Therese.
Um 1810 - Joseph Sulzbeck und seine Kapelle
München * Drei weitere Musiker gesellen sich zu Joseph Sulzbeck hinzu.
Es sind dies der Flötist Straubinger, der Violinspieler und Sänger Huber, genannt „Canape“, und der Harfenzupfer Bacherl.
Ein Programm hat die erste „Münchner Volkssängergruppe“ nicht. Ihre Mitglieder spielen und singen, was ihnen gerade einfällt oder was gefordert wird.
Sie haben kein festes Engagement und leben alleine von den „Trinkgeldern“, die sie beim Einsammeln, beim „Schuberln“ oder „Abwackeln“ mit dem Teller, erhalten.
1810 - Das „Aumeisterjäger-Haus“ wird erbaut
München-Englischer Garten * Das alte „Aumeisterjäger-Haus“ wird an der Nordgrenze des „Englischen Gartens“ für die Heger und Jäger der „Hirschau“ erbaut.
1810 - Freiherr Adam von Aretin verkauft sein Grundstück an Raphael Kaula
München-Englischer Garten * Freiherr Adam von Aretin verkauft sein Grundstück am Ostrand des „Englischen Gartens“ an den „Großhändler und Bankier“ Raphael Kaula.
Seine im Jahr 1812 als jüngstes Kind geborene Tochter Nanette wächst zu einer so auffallenden Schönheit heran, dass sie unter dem Titel „Münchens schönste Jüdin“ weithin bekannt ist.
In der Folgezeit lässt Kaula kleinere Gebäude seines Vorbesitzers Aretin abreißen und durch das elegantere „Kaula-Schlössl“ ersetzen.
Nach seiner Erhebung in den Adelsstand heißt das „Kaula-Schlössl“ nun „Murat-Schlössl“.
1810 - Simon Westermaier kauft die „Giesinger Mühle“
Untergiesing * Der „Bayerische Staat“ verkauft die „Giesinger Mühle“ an den Müller Simon Westermaier.
1810 - Carl von Fischer baut im Park von „Schloss Biederstein“ einen „Belvedere“
Schwabing * Carl von Fischer baut im Park von „Schloss Biederstein“ einen „Belvedere“.
1810 - Die „Lehel-Kaserne“ muss vergrößert werden
München-Lehel * Um die Unterbringungskapazität der „Lehel-Kaserne“ zu vergrößern, realisiert man den Kasernenanbau an der Kirchen-Nordseite des ehemaligen „Hieronymiten-Klosters“.
5. 1 1810 - Franz Raffl verrät das Versteck von Andreas Hofer
Tirol * Franz Raffl verrät das Versteck von Andreas Hofer in der Pfandlerhütte an den zuständigen Richter Auer. Die Franzosen hatten ein Kopfgeld von 1.500 Gulden ausgesetzt. Richter Auer benachrichtigt General Huard.
6. 1 1810 - Andreas Hofer wird verhaftet
Mantua * Andreas Hofer wird verhaftet und nach Mantua gebracht.
12. 2 1810 - Kronprinz Ludwig I. und Prinzessin Therese verloben sich
Hildburghausen * Die Verlobung zwischen Kronprinz Ludwig I. von Baiern und Therese von Sachsen-Hildburghausen findet in Hildburghausen statt.
19. 2 1810 - Andreas Hofer wird zum Tode verurteilt
Mantua * Trotz Bitten der Stadtbevölkerung von Mantua und der Interventionen des Vizekönigs Eugéne Beauharnais sowie des baierischen Kronprinzen Ludwig I. wird Andreas Hofer auf persönliche Weisung Napoléon Bonapartes von einem französischem Kriegsgericht zum Tode verurteilt.
20. 2 1810 - Andreas Hofer wird hingerichtet
Mantua * Andreas Hofer wird in Mantua hingerichtet.
28. 2 1810 - Im Pariser Abkommen wird Tirol aufgeteilt
Tirol * Im Pariser Abkommen wird Tirol aufgeteilt. Der südliche Teil Tirols wird Italien zugeschlagen.
Napoléon Bonaparte wirft Baierns Verwaltung in Tirol Versagen vor. Salzburg, Regensburg und die Markgrafschaft Bayreuth sollen an das Königreich Baiern fallen.
9. 5 1810 - Regensburg wird französisch
Regensburg * Regensburg wird französisch.
22. 5 1810 - Regensburg wird an Baiern übergeben
Regensburg * Der französische General Jean Dominique de Compans übergibt - im Auftrag Napoléon Bonapartes - Regensburg an den baierischen Hofkommissar Joseph Maria Freiherr von Weichs.
7. 6 1810 - Bozen wird an Italien abgegeben
Tirol * Der Vertrag über die Abtretung des südlichen Tirol an Italien und Illyrien regelt weitere Details. Bozen wird an Italien abgegeben. Die von Freiherr Maximilan Joseph von Montgelas vorgeschlagenen baierischen Verbesserungen für ein neues Verwaltungskonzept kommen zu spät.
8. 7 1810 - Therese von Sachsen-Hildburghausen wird 18 Jahre alt
Hildburghausen * Durch Therese von Sachsen-Hildburghausen, die Verlobte des baierischen Kronprinzen Ludwig I., wird achtzehn Jahre alt und damit volljährig.
8 1810 - Das Königreich Baiern verliert „Südtirol“
Tirol * Der Aufstand der Tiroler und die zunächst vergeblichen Versuche Baierns, Tirol zurück zu erobern waren in den Augen Napoleon Bonapartes eine „militärische Schande“, die seinen Ruf als unbesiegbaren Feldherrn beschädigte.
Dies führt dazu, dass Baiern „Südtirol“ verliert, „Nordtirol“ bleibt dagegen weiterhin baierisch.
Dem Verlust von 300.000 Einwohnern steht aber ein Zugewinn von 700.000 gegenüber, weil Baiern zusätzlich die Herrschaft über Berchtesgaden, das Innviertel und Teile des Hausruckviertels sowie über Bayreuth und Regensburg erlangt.
8 1810 - Die neue Grenzziehung in Tirol ist abgeschlossen
Tirol * Die neue Grenzziehung in Tirol ist abgeschlossen.
Baiern behält Nordtirol, den Vinschgau sowie das obere Eisack- und das Pustertal.
Der südliche Teil geht an das Königreich Italien, Osttirol und Innichen werden zum Bestandteil der illyrischen Provinzen. Baierischen Berechnungen zufolge hatte „Gesamt-Tirol“ im Jahr 1807 exakt 618.857 Einwohner. Etwa 289.000 davon lebten in „Welschtirol“, dem italienisch sprechenden Süden.
Das Königreich Baiern muss also einen Bevölkerungsverlust von 300.000 Einwohnern verkraften.
Doch nahezu gleichzeitig kann das Baiernland einen Zugewinn von rund 700.000 Einwohnern verzeichnen, nachdem sie die Herrschaft über Berchtesgaden, das Innviertel und Teile des Hausruckviertels, aber auch über Bayreuth und Regensburg erlangt.
Um 8 1810 - Der Italiener Luigi Tambosi kommt nach München
München-Angerviertel * Der Italiener Luigi Tambosi kommt nach München und wohnt zunächst beim Weinwirt Johann Balthasar Michel in der Rosengasse.
16. 8 1810 - Salzburg soll dem Königreich Baiern eingegliedert werden
Salzburg * Erstmals wird in Salzburg die Entscheidung aus dem Pariser Abkommen publiziert, wonach das Land dem Königreich Baiern eingegliedert werden soll.
12. 9 1810 - Das ausgebeutete Salzburg kommt zum Königreich Baiern
Salzburg * Napoleon Bonapartes Frankreich tritt im Frankfurter Vertrag das ausgebeutete Salzburg an den baierischen König Max I. Joseph ab. Mit der Eingliederung in das baierische Königreich verliert Salzburg endgültig seine territoriale Selbstständigkeit. Das eh schon verarmte Land wird zunächst von den Franzosen ausgepresst und dann den Baiern wegen ihrer Bündnistreue überlassen.
28. 9 1810 - Der Lohnkutscher Franz Baumgartner schlägt ein Pferderennen vor
München * Der Münchner Lohnkutscher Franz Baumgartner, der in der Kavallerie-Division der Nationalgarde III. Klasse seine Wehrpflicht als Unteroffizier ableistet, schlägt - neben den vom Staat ausgerichteten und finanzierten Hochzeitsfeierlichkeiten - ein Pferderennen vor.
30. 9 1810 - Die Besitzergreifung Salzburgs durch Baiern
Salzburg * Die Besitzergreifung Salzburgs erfolgt durch die Abgesandten des baierischen Königs Max I. Joseph mit Carl Graf von Preysing als Hofkommissär an der Spitze. Die Salzburger erhoffen sich von den Baiern eine Linderung ihrer Not.
2. 10 1810 - Franz Baumgartner schlägt ein Pferderennen vor
München * Der Vorgesetzte von Franz Baumgartner, Major Andreas Michael Edler von Dall‘Armi, greift dessen Idee mit einem Pferderennen begeistert auf und trägt den Vorschlag König Max I. Joseph vor.
4. 10 1810 - Die Einladungen für das Pferderennen werden versandt
München-Theresienwiese * Die Einladungen und Ausschreibungen für das am 17. Oktober stattfindende Pferderennen werden versandt. Als Veranstaltungsort wird das weite, unbebaute Areal „vor dem Sendlinger Thore, seitwärts der Straße die nach Italien führt“ vorgeschlagen.
6. 10 1810 - Prinzessin Therese betritt in Bamberg baierischen Boden
Hildburghausen - Bamberg * Prinzessin Therese von Sachsen Hildburghausen macht sich gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester Louise auf den Weg in Richtung München, wo sie den baierischen Kronprinzen Ludwig I. heiraten wird. Ihre erste Station auf bayerischem Boden ist Bamberg. Dort wird sie von Herzog Wilhelm in Bayern begrüßt.
7. 10 1810 - Die nächste Station des Brautzuges ist Nürnberg
Bamberg - Nürnberg * Von Bamberg geht die Reise der Braut Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen und ihrem Anhang weiter nach Nürnberg, wo sie mit Kanonendonner begrüßt werden.
8. 10 1810 - Die Prinzessin auf der Steinernen Brücke
Nürnberg - Regensburg * Nachdem der Hochzeitszug mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen in Nürnberg übernachtet hat, geht der Weg weiter nach Regensburg, in das sie am Abend über Stadtamhof über die Steinerne Brücke einziehen.
9. 10 1810 - Die Hochzeitsgesellschaft übernachtet in der Landshuter Residenz
Regensburg - Landshut * Der Weg der Hochzeitsgesellschaft der Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen führt von Regensburg nach Landshut. Die herzogliche Familie übernachtet dort in der königlichen Residenz.
10. 10 1810 - Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen trifft in Freising ein
Landshut - Freising * Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen reist mit ihren Eltern und ihrer Schwester Louise von Landshut aus weiter nach Freising. Kronprinz Ludwig I. - und später sein Vater König Max I. Joseph - reisen den sechsstündigen Weg von München nach Freising inkognito zu einem kurzen Besuch und begrüßen die Teilnehmer des Hochzeitszugs.
11. 10 1810 - Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen trifft in München ein
Freising - München * Von Freising kommend trifft Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen - in einem wahren Triumphzug - in München ein.
12. 10 1810 - Die Kgl. priv. Hauptschützengesellschaft organisiert ein Festschießen
München * Die Königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft organisiert im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten ein mehrtägiges Festschießen in ihrer Schießstätte.
12. 10 1810 - Kronprinz Ludwig I. heiratet Therese von Sachsen-Hildburghausen
München-Graggenau * Am Abend findet in der Hofkapelle der Residenz die kirchliche Trauung von Kronprinz Ludwig von Baiern und Therese Charlotte Luise, Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen statt. „Den erhabenen Moment der Trauung verkündeten das Geläute aller Glocken und der Donner der Kanonen. [...] Auf dem Hauptplatz ertönten Musikchöre und fernhin klingende Trompeten erschallten von der Gallerie des Petersthurmes.“
12. 10 1810 - Namenstagsfeier von König Max I. Joseph in der Michaelskirche
München * Am Morgen trifft sich die königliche und die herzogliche Familie in der Münchner Michaelskirche, um den Namenstag von König Max I. Joseph mit einem Gottesdienst zu feiern.
13. 10 1810 - Neugierige wollen die Braut des Kronprinzen sehen
München * Am Morgen macht das Militär und die Beamtenschaft ihre Aufwartung. Die bayerische Haupt- und Residenzstadt ist festlich geschmückt; den Straßenrand säumen jubelnde, neugierige Menschen, die einfach sehen wollen, wie sich die Braut des Kronprinzen denn so geben würde.
13. 10 1810 - Ganz München erstrahlt im Lichterschmuck
München * Am Abend findet eine große Festbeleuchtung statt. Ganz München erstrahlt im Lichterschmuck. Mit den Aufbauten zur Illumination auf dem Max-Joseph-Platz ist bereits sechs Wochen zuvor begonnen worden. An den öffentlichen und privaten Gebäuden der Stadt leuchteten „transparente Gemälde und Inschriften“. So trägt die Fassade des Rathauses ein allegorisches, zur Vermählung passendes Bild mit den Wappen des Brautpaares.
Am Gebäude der Königlichen Akademie der Wissenschaften und Künste leuchtet „Hymens Fackel, und Ludwigs und Theresens Namenszüge von Blumen“ mit den Worten: „Der neuen Hoffnung des alten Hauses der Wittelsbacher huldigen Wissenschaft und Kunst.“ Soweit die staatlich verordnete Fürstenhuldigung.
Unter den Adelspalais erregt das des Freiherrn Maximilian Joseph von Montgelas besondere Aufmerksamkeit. „Letzteres war eigentlich hinter einem prächtigen dorischen Tempel verschwunden, der um dasselbe ausgeführt reichlich mit Grün und Blumengirlanden geschmückt, und durch die Lichtmassen wie in eine Feuerwohnung verwandelt war.“
Auch der Bankier Andreas von Dall’Armi hatte sein Haus am Rindermarkt festlich ausstaffiert. Die Fassade trägt „eine kolossale Bavaria mit einem ruhenden Löwen und […] mit der Inschrift, die den ganzen oberen Stock einnahm: Wittelsbachs Stamm blühe ewig!“
Auch die anderen privaten Gebäude sind, soweit es sich die Bewohner finanziell leisten können, aufwändig geschmückt und erleuchtet. Für Kaufleute, Gastwirte, Cafétiers, Weinhändler, Juweliere und Bierbrauer, kurz gesagt, für die besonders gut situierten Kreise der Münchner Bewohnerschaft, bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, miteinander mit prunkvollen Illuminationen zu Ehren des Königshauses sich gegenseitig zu übertreffen und nur das Beste vom Besten zu zeigen.
13. 10 1810 - Am Abend gibt es die bei Fürstenhochzeiten übliche Ausspeisung
München * An diesem Abend ist die bei Fürstenhochzeiten übliche Ausspeisung, die die Bevölkerung in großen Scharen herbeilockt. Es gibt dabei natürlich deutliche Unterschiede.
Denn während „die angesehenen Bürger, d.h. welche zur Nationalgarde gehörten, […] mit ihren Familien in vier großen Gasthäusern, bei 6.000 an der Zahl, auf königliche Kosten zum Tanz und Abendessen versammelt“ sind, hat man für „die herbeygeströmten Volkshaufen“ am Schrannenplatz, dem heutigen Marienplatz, am Promenadeplatz, in der Neuhauser Gasse und am Anger „Tische und Bänke hergerichtet, wo man ihnen zu essen und trinken bot“. Aktenbelegen zufolge werden an diesem Abend
- 32.065 Laibln Semmelbrod, 3.992 Pfund Schweizerkäse über 80 Zentner gebratenes Schaffleisch, 8.120 Cervelat-Würste und 13.300 Paar geselchte Würste ausgegeben.
- Brauknechte verzapften rund 232 Hektoliter Bier. Aus sieben Fässern werden knapp vier Hektoliter österreichischer Weißwein ausgeschenkt.
- 150 Musikanten sorgen für Stimmung und
- in zwei Volkstheatern wurden Vorstellungen zu freiem Eintritt gegeben.
- Sogar die Münchner Gefängnisinsassen erhalten eine - von der Israelitischen Gemeinde finanzierte - Ausspeisung.
13. 10 1810 - Das einfache Volk und die bessere Gesellschaft feiern
München * Nicht das einfache Volk benimmt sich während der Hochzeitsparty in der Innenstadt schlecht, sondern die bessere Gesellschaft. Das belegt ein Geheimprotokoll des damaligen Vizedirektors der Münchner Polizei, Markus von Stetten. Im einfachen Volk kommt es weder zu Ausschreitungen noch zu Raufereien oder grobem Unfug.
Er notiert lediglich: „[…] dem Bacchus und der Liebe wurde in der letzten Nacht treulich geopfert […]“ und berichtet weiter von Bierleichen, die im Polizeigebäude gestapelt werden und auch am Abend des nächsten Tages ihren Rausch noch nicht ausgeschlafen haben. Von Stetten: „Doch dies gehört zu dem Ganzen und ist ein wesentlicher Teil eines Volksfestes.“ Er stoppt den Ausschank von Bier und Wein, als er merkt, dass die Menge auf den Festplätzen der Stadt nur noch lallt und wankt.
Dann widmete sich der Polizeivize der Münchner Gesellschaft, die in der Hofoper feiert. Dort kommt es zu Schlachten am kalten Buffet, Herren in staatlichen Spitzenpositionen sitzen mit hochrotem Kopf inmitten von geleerten Flaschen. Ein Offizier schlägt eine Garderobenfrau nieder, ein Geheimer Rat gibt eine Portion Eis zurück, als er hört, dass er sie selbst bezahlen muss. Nach dem Fest wird ein Haufen Silber vermisst.
Mehrere Besucher schickt man volltrunken aus der Oper, eine Dame bleibt bewusstlos auf der Straße liegen. „Ein Fall, der sich unter Frauen bei einem Volksfeste nicht ereignete.“
13. 10 1810 - Zahnweh in der Hochzeitsnacht
München * Die Kronprinzessin ist durch die Aufregungen der letzten Tage erschöpft und will den Ball frühestmöglich verlassen. Das liegt aber nicht nur an den anstrengenden Festivitäten, sondern vor allem an ihren seit Tagen anhaltenden Zahnschmerzen, die ihr schon die Hochzeitsnacht verleidet hatten.
Therese verlässt den Hofball sehr zeitig. Ludwig begleitet seine Frau in die Residenz, kehrt aber alleine noch einmal zu den Tanzenden zurück. Seinem Tagebuch vertraut der Bayernprinz am Morgen danach seine entlarvenden und berechnenden Gedanken an, indem er schreibt: „Mir machte es wenig Vergnügen, aber ich tat es, um meine Freiheit zu zeigen und damit meine Frau nicht glaube, ich müsse, weil sie es getan, wegbleiben. […] So tue ich schon jetzt so viel möglich, bei Nacht schlafe ich in meinem Zimmer, nur zu Besuch zu meiner Frau kommend. […] Man muß sich gleich anfangs auf den Thron setzen, wie man ihn für die Folge will. So schicke ich mich in den Ehestand, fühle mich nicht unglücklich“.
Und seiner Lieblingsschwester Charlotte bekennt Ludwig: „Ausgezeichnet ist Therese durch ihr Herz, durch Vernunft, Schönheit, keine bessere Frau würde ich mir wünschen, aber leidenschaftslos verehelichte ich mich, es mag vorteilhafter sein für die Zukunft“.
Vertraute Kreise sehen die Zukunft der Ehe weniger rosig und trauen ihr - ganz im Gegenteil - nur sehr wenig Bestand zu.
14. 10 1810 - Kronprinz Ludwig wird Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises
München - Salzburg * König Max I. Joseph ernennt Kronprinz Ludwig I. zum Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises mit Sitz in Innsbruck. Er wird mit seiner Frau Therese im Schloss Mirabell in Salzburg wohnen.
Die Ernennung soll nicht zuletzt dazu dienen, den Kronprinzen mit den Verwaltungsgeschäften vertraut zu machen. Außerdem will ihn sein Vater in Distanz zur Regierungszentrale in München halten, um Auseinandersetzungen zwischen dem Kronprinzen und dem Außen-, Innen- und Finanzminister Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas, die sich beide nicht sonderlich mochten, zu vermeiden.
Der Super-Minister hat eine Menge Arbeit mit der Reorganisation des neuen Staates, um tiefgreifende Reformen und um die Schaffung eines einheitlichen Beamten- und Verwaltungsstaates. Gegen seine Aufgabe ist die Deutsche Wiedervereinigung ein Kinderspiel.
Eine wichtige Voraussetzung für die zentralistisch geführte Verwaltung war die Vereinheitlichung der Maße und Gewichte. So gibt es alleine 93 verschiedene Flüssigkeitseinheiten, die anno 1809 durch die Einführung der baierischen Maaß ersetzt werden. Das Baierische Maaß fasst 1.069 Kubikzentimeter und wird Mass ausgesprochen.
17. 10 1810 - Zum Andenken heißt der Platz der Feier Theresens Wiese
München * Am Abend gibt der Organisator der Volksbelustigung, Andreas von Dall’Armi, bekannt, dass König Max I. Joseph einverstanden ist, dass „die Wiese, worauf das erste baierische Nationalfest gefeiert worden, zum bleibenden Andenken Theresens Wiese“ genannt werden darf. Den Wunsch gewährt der König herzlich gerne, da es ihm ja nichts kostet.
17. 10 1810 - Gebete für die königliche Familie in der Bürgersaalkirche
München-Kreuzviertel * Andreas Michael von Dall’Armi hat in einer „Disposition des Festes“ den Ablauf der Veranstaltung peinlichst genau festgelegt. So wird früh um 9 Uhr eine Messe im Bürgersaal abgehalten, bei der „die National-Garden für die lange Erhaltung Ihrer Majestäten des Königs, und der Königin […] und der ganzen königl. Familie“ beten müssen.
17. 10 1810 - 40.000 Zuschauer nehmen an der Volksbelustigung teil
München * Im Anschluss an die Messe im Bürgersaal versammeln sich die Kavallerie-Divisionen am Hofgarten, um sich im Abstand von einer Stunde in zwei Zügen auf den Weg zum Rennplatz zu machen. Beide Züge des Bürgermilitärs durchqueren dabei die Stadt in Nord-Süd-Richtung.
Auf der Landstraße nach Sendling nehmen sie eine Abzweigung, um auf die Festwiese zu gelangen. Dort, am Fuße des Sendlinger Berges, befindet sich der Königliche Pavillon, bei dem Gardisten eine Ehrenwache halten. Der Pavillon ist das ursprünglich hellgrüne, circa 67 Meter lange Audienzzelt des türkischen Großwesirs, das Kurfürst Max Emanuel im Jahr 1683, bei der Befreiung Wiens, eroberte hat.
Der von türkischer Musik angeführte zweite Zug der Nationalgarde begleitet die Rennpferde und die Preisfahnen zur Rennwiese. Auf dem Sendlinger Berg, der Landsberger Straße und am Filserbräukeller sind Zelte und Bänke aufgestellt worden. Nach Andreas von Dall’Armi kommen rund 40.000 Zuschauer aus allen Volksschichten zum Sendlinger Berg, der späteren Schwanthaler Höhe, und säumen die unterhalb der Anhöhe bis nahe an die Stadtgrenze sich ausbreitende Festwiese.
17. 10 1810 - Kinder in Landestracht überbringen die Huldigungsgrüße des Volkes
München-Theresienwiese * Nachdem die königliche Familie endlich eingetroffen ist und im Königspavillon Platz genommen hat, gratuliert eine Gruppe von „Kindern im Nationalkostüme“ dem Kronprinzenpaar. Die Kinder, allesamt Töchter und Söhne von Angehörigen der k.b. Kavallerie Division, überbringen in verschiedenen Landestrachten gekleidet, stellvertretend für die baierische Nation, der Königsfamilie die Huldigungsgrüße des Volkes.
17. 10 1810 - Fahnen als Zeichen der Verbundenheit mit dem König
München * Beim Aufmarsch der National-Garde III. Klasse zum Oktoberfest-Pferderennen werden die Fahnen, die ihnen König Max I. Joseph am 12. Oktober 1808 überreicht hatte, als stolzes Zeichen der Verbundenheit mit dem Königshaus mitgetragen.
17. 10 1810 - Ein Siebenbürgener Apfelschimmel gewinn das 1. Oktoberfest-Pferderennen
München-Theresienwiese * Nachdem die hohen Herrschaften ein kleines Dejeuner eingenommen haben, kann das Pferderennen gestartet werden. Dreißig Pferde werden zur Startlinie geführt. Der dann folgende Startschuss gibt das Rennen über drei Runden frei. Diese drei Runden entsprechen ziemlich exakt einer Strecke von zehn Kilometern.
Die Pferde werden - ohne Sattel - von Rennbuben geritten. Diese sind in der Regel unter zwanzig Jahre. Der Jüngste bei diesem Wettkampf ist gerade einmal zehn Jahre alt. Allerdings werden die Rennknaben, die Jockeys, als derart nebensächlich betrachtet, dass sie teilweise nicht einmal in den Rennbüchern namentlich auftauchen.
Als Rennrichter fungieren Johann Schwangart, der Bierbrauer Cajetan Trappentreu und der Bäcker Anton Seidl. Gewonnen wird das erste Oktoberfest-Pferderennen von dem Münchner Lohnkutscher und Erfinder des Oktoberfest-Pferderennens, Franz Baumgartner, oder besser gesagt von seinem zwölfjährigen Rennbuben, der auf einem Siebenbürger Apfelschimmel nach 18 Minuten und 14 Sekunden als Erster durchs Ziel reitet. Franz Baumgartner erhält 20 von 98 Gulden. Mit der Preisverleihung endet das Fest.
30. 10 1810 - Luigi Tambosi pachtet das Kaffeehaus an der Hofgartenmauer
München-Graggenau * Die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine verpachtet das Kaffeehaus an der Hofgartenmauer vor der Reitschule für 1.400 Gulden jährlichen Pachtschilling an den Italiener Luigi Tambosi.
Der bisherige Kaffeehaus-Besitzer Johann Nepomuk Schuster konnte zuvor die Zinsen für das von der Kurfürstin-Witwe geliehene Geld nicht mehr bezahlen.
11 1810 - Vereinbarung für ein jährliches „Münchner Oktoberfest“
München * Zwischen den Gründern und Veranstaltern des ersten „Münchner Oktoberfestes“ und dem „Generalkomitee des landwirthschaftlichen Vereins“ wird eine Vereinbarung getroffen, „wonach die Volksfeier in der Maximilianswoche [12. Oktober] fortan jährlich als gemeinsames Fest begangen“ werden soll - unter Einbeziehung landwirtschaftsbezogener Aktivitäten.
Bis 1818 organisiert der „Landwirtschaftliche Verein“ das Gesamtfest: „Pferderennen“ und „Landwirtschaftliche Präsentation“.
3. 11 1810 - Eine Verordnung über die neuen Posttarife
München * Eine Verordnung über die neuen Posttarife bringt keine wesentlichen Fortschritte gegenüber dem alten System. Die Berechnung der Brieftaxe erfolgt nach dem Gewicht des Briefes und der Entfernung des Bestimmungsortes. Der billigste Brief kostet drei Kreuzer. Er darf nicht mehr wiegen als ein halbes baierisches Lot [8,75 Gramm] und der Bestimmungsort darf nicht weiter als sechs Meilen entfernt sein.
Für den Briefe schreibenden „Untertanen“ bedeutet die Übernahme der Posthoheit durch die souverän gewordenen Einzelstaaten einen Rückschritt gegenüber dem unter dem Schutz des Reiches entwickelten europäischen System der Thurn und Taxis, da es auf der Grundfläche des aufgelösten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nun nicht weniger als 43 verschiedene Postanstalten gibt.
Da auch auf dem Wiener Kongress nichts für die Wiederherstellung der Posteinheit und die Verbesserung der Postbedingungen unternommen worden war, muss jedes Land seine Postangelegenheiten in eigener Zuständigkeit ordnen. Den Vorschlag Bayerns, zumindest das Portosystem für das Gebiet des Deutschen Bundes zu vereinheitlichen und das Porto - nach baierischem Muster - zu verbilligen, lehnen die anderen Länder aber kategorisch ab.
Im Königreich Baiern, in dem zahlreiche fränkische und schwäbische ehemalige reichsunmittelbare Gebiete aufgegangen sind, kommt der Post eine wichtige Rolle bei der Aufgabe zu, die neubayerische Bevölkerung zu integrieren. Ein funktionierendes Post- und Verkehrswesen ist dabei ein wichtiges Mittel der bayerischen Regierungspolitik. Es sollen damit die Vorteile des neuen und größeren Wirtschaftsraumes demonstriert werden und den vom neuen Staatsverband eher weniger begeisterten Neubürgern das Königreich attraktiver machen.
27. 12 1810 - Montgelas lässt sein Stadt-Palais erweitern
München-Kreuzviertel * Freiherr Maximilian Joseph von Montgelas will den östlich an sein barockes Palais angrenzenden Salzstadel mit diesem vereinigen und zu einem großen Stadtpalast umgestalten.
Der erste Entwurf des Architekten Emanuel Joseph von Herigoyen gefällt dem Staats- und Konferenzminister noch nicht. Erst eine etwas abgeänderte Form wird anschließend ausgeführt und im Jahr 1813 vollendet.
Ab 1811 - Der „Militärholzgarten“ wird auf den „Gasteig“ verlegt.
München-Lehel - Haidhausen * Der „Militärholzgarten“ nördlich der „Isarbrücke“ wird auf den „Gasteig“ verlegt.
1811 - Städtische Mitfinanzierung der „Rumfordchaussee“ abgewehrt
München-Isarvorstadt * Der Staat verzichtet auf eine städtische Mitfinanzierung der „Ringstraße“.
Die „Rumfordchaussee“ war anno 1796 als militärische Straßenanlage gebaut worden, weshalb sich der Magistrat erfolgreich gegen jede finanzielle Beteiligung wehrte.
Auch als man die Straßenanlage als wesentlichen Beitrag zur Verschönerung Münchens ansah.
1811 - Joseph Anton von Maffei will Bildhauer werden
München - Italien * Joseph Anton Ritter und Edler von Maffei, Peter Paul von Maffei's Sohn, spielt während eines längeren Italienaufenthalts mit dem Gedanken Bildhauer zu werden.
Erst nach strengen väterlichen Ermahnungen widmet sich der feinsinnige und vielseitig interessierte Schöngeist der Tätigkeit im Familienunternehmen.
Dort erweist er sich bald als vorausschauender Geschäftsmann.
3. 3 1811 - Johann Weinmüllers Theater brennt ab
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Das provisorische Theater des Johann Weinmüller vor dem Isartor brennt ab. Der Hoftheater-Intendant Carl August Delamotte schlägt daraufhin dem Bayernkönig Max I. Joseph die Errichtung eines königlichen Nebentheaters vor. Aus diesem wird das <em>„Königliche Vorstadttheater am Isartor“</em> hervorgehen. </p>
20. 3 1811 - Die Weinmüller-Schauspieltruppe wird der Hoftheater-Intendanz unterstell
<p><em><strong>München</strong></em> * König Max I. Joseph lässt die arbeitslos gewordene Weinmüller-Schauspieltruppe der Hoftheater-Intendanz unterstellen. Die Hofmusik-Intendanz wird angewiesen, dem Vorstadt-Theater seine Schauspieler und Dekorationen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen muss sich finanziell selbst tragen und sich <em>„keines Zuschusses aus unserer Staatscassa zu erfreuen haben“</em>. </p> <ul> <li>Damit hat der König zwei Ziele erreicht. Er will einerseits ein etabliertes Theater für die mittleren Einkommensschichten schaffen</li> <li>und andererseits die bisher frei agierende Bühne unter die Kontrolle und Einflussnahme des Hofes zu stellen. </li> </ul>
15. 4 1811 - Weinmüllers Theaterbetrieb im Herzoggarten des Clemensschlössls
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Johann Weinmüller, inzwischen zum königlichen Regisseur befördert, kann seinen Theaterbetrieb im Herzoggarten des Clemensschlössls, auf dem Gelände des heutigen Justizpalastes, eröffnen. König Max I. Joseph hat dieses Weinmüller als Übergangslösung zur Verfügung gestellt. </p>
27. 5 1811 - Grundsteinlegung für die Neue Isarkaserne
München-Isarvorstadt * Grundsteinlegung für die Neue Isarkaserne an der Zweibrückenstraße. Auf dem Baugelände befinden sich noch die Obst- und Gemüsegärten des Stifts der Englischen Fräulein. In der Nachbarschaft liegen der Holzlagerplatz der Münchner Kistlerzunft und eine Werkstatt der Stadt, in der die hölzernen Wasserleitungsrohre gebohrt werden.
Der Flurname An den Schweineställen, in früherer Zeit auch Plärrer, kommt vom Verbot der Schweinehaltung in der inneren Stadt.
30. 8 1811 - Genehmigung zum Bau des Volkstheaters am Isartor
<p><em><strong>München</strong></em> * König Max I. Joseph genehmigt das Projekt eines Volkstheaters am Isartor und stellt dafür eine Summe vom 30.000 Gulden zur Verfügung. Dadurch kann er einerseits gerade den Zuschauern aus den unteren Einkommensschichten ihr privates Vergnügen erhalten und gleichzeitig in die Programmgestaltung steuernd und kontrollierend eingreifen. </p>
Um den 10 1811 - Die Nachbarschaft von Kaserne und „Anna-Kirche“ bietet Anlass zu Klagen
München-Lehel * Die unmittelbare Nachbarschaft von Kaserne und „Anna-Kirche“ bietet manchen Anlass zu Reibereien und Klagen.
Im Herbst 1811 wird das „Generalkommando München“ ermahnt, dafür zu sorgen, dass den Bewohnern des Lehels der Zutritt zu ihrer Pfarrkirche nicht durch Militärangehörige, insbesondere „Chevaulegers“, verwehrt wird.
Um den Kircheneingang zu sichern, grenzt man ihn beiderseits mit einem Zaun gegen den Kasernenbereich ab.
12. 10 1811 - Das 2. Münchner Oktoberfest beginnt
München-Theresienwiese * Das 2. Münchner Oktoberfest beginnt.
13. 10 1811 - Das 2. Oktober-Fest wird mit einem Pferderennen eröffnet
München-Theresienwiese * Das vom Landwirtschaftlichen Verein ausgerichtete Oktober-Fest wird mit einem Pferderennen eröffnet. „Eine zahllose Menge von Zuschauern“ verfolgt den Wettkampf der 60 teilnehmenden Pferde und ihrer Reiter.
14. 10 1811 - Die erste baierische Landwirtschaftsausstellung beginnt
München-Theresienwiese * Am zweiten Tag des Oktoberfestes, einem Montag, beginnt die erste baierische - und gleichzeitig deutsche - Landwirtschaftsausstellung. 23 Hengste, 29 Zuchtstuten, 31 Kühe, 27 Schafböcke und 3 Schweine werden präsentiert und ausgezeichnet. Mit einem Viehmarkt, bei dem 1.026 Stück Vieh zum Kauf angeboten werden, endet das erweiterte Oktoberfest des Jahres 1811.
26. 10 1811 - Grundsteinlegung für das Hof- und Nationaltheater
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Kronprinz Ludwig legte den Grundstein zum Hof- und Nationaltheater. </p>
28. 11 1811 - Kronprinz Max II. wird geboren
München * Kronprinz Max II. Joseph wird in München geboren.
9. 12 1811 - Die Musikalische Akademie wird gegründet
München * Mitglieder des Hoforchesters gründen in München die Musikalische Akademie.
13. 12 1811 - Maximilian Bernhard Graf von Arco-Zinneberg wird geboren
Stepperg * Maximilian Bernhard Graf von Arco-Zinneberg wird auf Schloss Stepperg geboren. Seine Mutter ist die Kurfürsten-Witwe Maria Leopoldine, sein Vater Ludwig Joseph Graf von Arco.
1812 - Die „Wiebekingsche Brücke“ bei Bogenhausen entsteht
Bogenhausen * Die zweite, die sogenannte „Wiebekingsche Brücke“ bei Bogenhausen entsteht.
Sie hält bis zum Hochwasser von 1826.
1812 - Kaspar Selmayr übernimmt den „Hanslmarterhof“ in Bogenhausen
Bogenhausen * Kaspar Selmayr übernimmt den „Hanslmarterhof“ in Bogenhausen.
1812 - Kronprinz Ludwig I. übernimmt offiziell die Planungen für den „Königsplatz“
München-Maxvorstadt * König Max I. Joseph überlässt seinem Sohn Ludwig I. offiziell die Planungen für den „Königsplatz“.
Dieser macht ihn zu seinem persönlichen „Kampfplatz gegen die französische Vorherrschaft in Europa“.
1812 - Der „Faber-Bräu“ wird mit der „Eberlbrauerei“ vereinigt
München * Der „Faber-Bräu“ wird mit der „Eberlbrauerei“ vereinigt.
1812 - Der Streit um die Zugehörigkeit der „Irrenanstalt“
Vorstadt Au - Untergiesing * Nach der Trennung der „Lohe“ und der „Falkenau“ von der „Vorstadt Au“ bleibt die „Irrenanstalt“ zunächst innerhalb der Auer Gemarkung.
Dagegen protestiert die Anstaltsverwaltung und erreicht die Zuordnung zur Gemeinde Giesing.
Da jedoch das königliche Landgericht München, „das wegen der verhaßten und gegen dessen Willen erwirkte allerhöchst genehmigten Trennung der Loh und Falkenau immer feindselig für die Gemeinde Giesing gestimmt war“, darüber keinerlei Aufzeichnungen führt, kommen die Auer - clevere Vorstädter mit viel Phantasie im Geldeintreiben - dreißig Jahre später auf die Idee, von den Giesingern die Rückvergütung von 1.515 Gulden für den „Malzaufschlag“ zu verlangen, die die Gemeinde Giesing - nach Auffassung der Auer - seit über zehn Jahren zu Unrecht erhalten hat.
Diese „Biersteuer“ muss - für das in der Anstalt ausgeschenkte Bier - an die zugehörige Gemeinde bezahlt werden.
Die Giesinger wehren sich dagegen.
1812 - Ein Gewächshaus für den „Alten Botanischen Garten“
München-Maxvorstadt * In den Jahren 1812/13 wird an der Nordseite des „Alten Botanischen Gartens“ ein Gewächshaus errichtet.
Die Eisen-Glas-Kostruktion ist etwa 135 Meter lang, besitzt sechs Kabinette, von denen die Hälfte als warme Abteilung, die andere als kalte Abteilung genutzt wird. Das Gewächshaus ist eingespannt zwischen zwei steinernen Eckbauten mit dorischem Fries und Giebel.
Der östliche Eckpavillon wird als „Direktorenwohnhaus“, der Westliche als Gärtnergebäude genutzt.
Um das Jahr 1812 - Jean Baptiste Métivier gestaltet das „Montgelas-Palais“ aus
München-Kreuzviertel * Für die Innendekoration des „Montgelas-Palais“ kann Graf von Montgelas den jungen, in Rennes in Frankreich geborenen und seit dem Jahr 1811 in München als „Inspektor der königlichen Baukommission“ tätigen Jean Baptiste Métivier gewinnen.
4. 1 1812 - Die Geburtsurkunde des Münchner Biergartenlebens
München * König Max I. Joseph genehmigt, „daß den hiesigen Bierbrauern gestattet sein soll,
- auf ihren eigenen Märzenkellern in den Monaten Juni, Juli, August und September ihr selbstgebrautes Märzenbier in Minuto zu verschleißen und
- ihre Gäste daselbst mit Bier und Brot zu bedienen.
- Das Abreichen von Speisen und anderen Getränken bleibt ihnen aber ausdrücklich verboten.“
Die Verordnung wird als die Geburtsurkunde des Münchner Biergartenlebens bezeichnet.
6. 2 1812 - Graf Anton Clemens von Toerring-Seefeld stirbt
Haidhausen * Graf Anton Clemens von Toerring-Seefeld, der Haidhauser Hofmarksherr, stirbt im Alter von 91 Jahren.
10. 3 1812 - Die Arbeiten am Theaterbau vor dem Isartor beginnen
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Die Arbeiten am Theaterbau vor dem Isartor nach Plänen von Emanuel Joseph d’Herigoyen und Ludwig von Sckell beginnen. </p>
Um 4 1812 - Ein „Dragoner-Regiment“ ist in der „Lehel-Kaserne“ stationiert
München-Lehel * Eine Abteilung des „Dragoner-Regiments“ bleibt bis zum Frühjahr 1812 in der „Lehel-Kaserne“ stationiert.
2. 4 1812 - Lohe und Obere Falkenau kommen nach Obergiesing
<p><strong><em>Untergiesing</em></strong> * Im Zuge ihrer Proteste erreichen die Bewohner der Lohe und der Oberen Falkenau - gegen den erklärten Willen des Landgerichts München - die formelle und zwei Jahre später, 1814, die politische Vereinigung mit Obergiesing, zu der sie kirchlich bereits seit 1809 gehören.</p> <p>Das alte Untergiesing - oder besser Nieder-Giesing - auf dem heutigen Nockherberg und an der Ruhestraße wird in die Au eingemeindet. Bis dahin ist Niedergiesing ein selbstständiger Weiler mit drei großen Bauernhöfen und Herbergen in der Falkenau und an der Nockherstraße, die in früher Zeit <em>„Bei den Jägerhäusln“</em> genannt wurden.</p>
24. 6 1812 - 30.249 bairische Soldaten beim Russlandfeldzug
Russland * Mit der Überschreitung der Memel durch die französische Armee beginnt - ohne Kriegserklärung - der Russlandfeldzug. Unter den 450.000 Soldaten der Großen Armee befinden sich 30.249 baierische Soldaten, die von den Generälen Carl Philipp Joseph von Wrede und Bernhard Erasmus von Deroy kommandiert werden.
30. 6 1812 - Pfarrer Johann Caspar Hallmayr kauft das Haidhauser Hofmarkschloss
Haidhausen * Pfarrer Johann Caspar Hallmayr kauft das Lustgebäud und einen Gartenanteil des Haidhauser Hofmarkschlosses zur Linderung der Schulraumnot. Der auch für Haidhausen zuständige Bogenhausener Pfarrer übt gleichzeitig das Amt des Lokalschulinspektors aus.
18. 8 1812 - Johann Peter von Langer erwirbt ein Grundstück in Haidhausen
Haidhausen * Johann Peter von Langer kauft vom Grafen Anton Clemens von Toerring-Seefeld - um 4.400 Gulden - ein Grundstück. Er lässt das an der Wiener Straße gelegene Salettl des ehemaligen Haidhauser Hofmarksitzes für seine Familiezu einer repräsentativen Künstlerresidenz umbauen.
Die Planungen erstellt der Professor für Architektur an der Münchner Kunstakademie, Carl von Fischer. Die Haidhauser bezeichnen das Anwesen als „Langerschlößl“.
23. 8 1812 - General Bernard Erasmus von Deroy stirbt in Russland
Polck * Bernard Erasmus von Deroy stirbt bei Polck in Russland.
10 1812 - Erstmals wird der Begriff „Central-Landwirthschaftsfest“ gebraucht
München-Theresienwiese * Das Volksfest auf der „Theresienwiese“ wird als „Central-Landwirthschafts- oder Oktoberfest“ bezeichnet.
Für die landwirtschaftlich ausgerichteten Programmpunkte des „Oktober-Festes“ wird erstmals der Begriff „Central-Landwirthschaftsfest“ gebraucht.
Es gibt ein „Pferderennen“ und einen „Nutzviehmarkt“.
Die preisgekrönten Tiere werden auf der Wiese vor dem „Königszelt“ im Beisein von König Max I. Joseph prämiert und ausgezeichnet.
10. 10 1812 -
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Das Königliche Theater am Isartor wird nach rekordverdächtiger Bauzeit eröffnet. Es fasst 1.200 Personen und verfügt über eine geräumige Bühne. Die Konzeption des Grundrisses des neuen Vorstadttheaters ging auf das Pariser Odeon zurück. </p> <p>Zur Theaterpremiere führt das Weinmüller-Ensemble ein historisch-musikalisches Drama auf, bei dem 105 Personen auf der Bühne stehen. Es wird zugunsten jener Familien aufgeführt, deren Angehörige beim Einsturz der Isarbrücke am 13. September 1813 verunglückten oder ums Leben kamen. </p>
11 1812 - Die Untergiesinger werden aus der „Nationalgarde“ entlassen
Untergiesing * Die männlichen Bewohner der „Lohe“ und der „Oberen Falkenau“ werden aus der „Nationalgarde“ entlassen, da die männlichen Bewohner der Städte den Militärdienst ableisten mussten.
11 1812 - Das Vorstadttheater am Isartor ist Königs Liebling
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Das neue <em>„Königliche Vorstadttheater am Isartor“</em> spielt mit noch größerem Erfolg als zuvor, und wird dadurch zum Schoßkind des Königpaares, die es als das <em>„lustigste, eigentümlichste Theater der Welt“</em> bezeichnet. Es zählt zu den ersten Theaterbauten Deutschlands, die losgelöst von höfischer Kultur für ein breites bürgerliches Publikum errichtet wurden. </p> <p>Die Schauspieler der Weinmüller-Truppe dürfen sogar im Cuvilliés-Theater aushelfen.</p>
13. 12 1812 - Von 30.249 sind nur noch 68 kampffähige baierische Soldaten übrig geblieben
München * Von den am Russland-Feldzug beteiligten 30.249 baierischen Soldaten sind nur noch 68 kampffähige Soldaten übrig geblieben. Lediglich 2.997 Soldaten werden unversehrt in ihre Heimatdörfer zurückkehren können.
14. 12 1812 - Aus dem Lehel wird die Sankt-Anna-Vorstadt
München-Lehel * Das Lehel, das bis dahin als Äußeres Graggenauer Viertel geführt wird, erhält die neue Bezeichnung Sankt-Anna-Vorstadt.
20. 12 1812 - Die erste Ausgabe von Grimms „Kinder- und Hausmärchen“
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Die Brüder Wilhelm und Jacob Grimm veröffentlichen die erste Ausgabe ihrer <em>„Kinder- und Hausmärchen“</em>. Sie waren noch wenig erfolgreich. </p>
Anno 1813 - Johann Peter von Langer erwirbt das Toerring-Seefeld‘sche „Salettl“
Haidhausen * Johann Peter von Langer, „Akademiedirektor“, erwirbt das Toerring-Seefeld‘sche „Salettl“ und baut es zum „Langer-Schlössl“ um.
1813 - Dr. Sieber wird neuer Besitzer des „Ridlerschlössls“
Haidhausen * Der „Landgerichts-Physikus“ Dr. Sieber wird neuer Besitzer des in Haidhausen gelegenen „Ridlerschlössls“.
1813 - In München gibt es acht von der Polizei anerkannte „Bordelle“
München * In München gibt es acht von der Polizei anerkannte „Bordelle“.
1813 - Aus dem „Lustigen Dörferl“ wird der „Prater“
München-Lehel * Nachdem Anton Gruber ein „Caroussel“ und eine Schaukel aufstellt, wird aus dem „Lustigen Dörferl“ der „Prater“.
Der Gastwirt ist ein Vollprofi in Sachen „Volksbelustigung“.
1813 - Erfolgsanreize für die Seidenzucht
München * Das Generalcomité der Landwirtschaftlichen Gesellschaft gründet eine Deputation für die Seidenzucht. Doch bis zum Jahr 1824 dümpeln die Aktivitäten dieser Abteilung vor sich hin, obwohl König Max I. Joseph die Unternehmung unterstützt und als Erfolgsanreiz sogar Preise ausgesetzt werden.
19. 2 1813 - Carl von Eichthal wird in München geboren
München * Carl von Eichthal, der spätere Kgl. Bay. Hofbankier und Mitbegründer der Bayerischen Vereinsbank, wird in München geboren.
18. 3 1813 - Schnurr- und Knebelbärte müssen entfernt werden
<p><strong><em>München</em></strong> * In einer von Minister Montgelas veranlassten Anweisung heißt es: <em>„Es ist Anzeige gemacht worden, daß mehrere Eleven der Akademie der bildenden Künste sich durch Schnurr- und Knebelbärte auszuzeichnen suchen. Die Akademie erhält den Auftrag, sie zur Ablegung derselben sofort anzuweisen und überhaupt über ein ruhiges und sittliches Betragen sorgfältig zu wachen.“ </em></p> <p>Besonders beunruhigend sind für die Regierung eine <em>„auffallende Haartracht oder Abzeichen auf Mützen und Hüten“</em>, die auf geheime Verbindungen hindeuten könnten.</p>
27. 3 1813 - Preußen erklärt Frankreich den Krieg
<p><strong><em>Berlin - Paris</em></strong> * Preußen erklärt Frankreich den Krieg. Damit beginnen die sogenannten Befreiungskriege. Nach dem gescheiterten Russlandfeldzug sind in ganz Europa - und damit natürlich auch in Baiern - Befreiungsbewegungen gegen Napoléon Bonaparte gewachsen. Es geht um die Beseitigung der französischen Vorherrschaft und Fremdherrschaft in Europa. </p>
30. 3 1813 - Georg Christian Friedrich Bürklein wird in Burk geboren
<p><strong><em>Burk</em></strong> * Georg Christian Friedrich Bürklein wird in Burk bei Ansbach in Mittelfranken geboren. Er ist der erste Sohn eines Lehrerehepaares. Den ersten Unterricht erhält der Friedrich genannte Knabe von seinem Vater. Ab dem Alter von dreizehn Jahren interessiert sich Friedrich für Architektur. Seine Wahl wird durch sein Zeichentalent unterstützt.</p>
7. 4 1813 - Preußen will Baiern in der „antifranzösischen Koalition“
Berlin - München * Preußen verlangt den sofortigen Anschluss Baierns an die „antifranzösische Koalition“.
3. 5 1813 - Ein Teil der „Neuen Isarkaserne“ ist bezugsfertig
München-Isarvorstadt * Ein Teil der „Neuen Isarkaserne“ an der Zweibrückenstraße, am Standort des heutigen „Marken- und Patentamtes“, ist mit Zimmern für 428 Mann und Stallungen für 104 Pferde bezugsfertig.
22. 5 1813 - Richard Wagner wird in Leipzig geboren
Leipzig * Wilhelm Richard Wagner wird als jüngstes von neun Kindern des Polizeiaktuars, einem Schriftführer im Polizeipräsidium, und Laienschauspielers Carl Friedrich Wilhelm Wagner und dessen Ehefrau Johanna Rosine in Leipzig geboren.
10. 6 1813 - Im Königreich Baiern tritt das Judenedikt in Kraft
München * Im Königreich Baiern tritt das Judenedikt in Kraft. Es legt detaillierte Rechte wie zahlreiche Beschränkungen für die Juden und die genaue Zahl der jüdischen Bevölkerung fest. Die letzte Auflage gilt bis 1861.
27. 7 1813 - Maria Ellenrieder, erste Münchner Kunststudentin an der Akademie
München-Kreuzviertel * Maria Ellenrieder schreibt sich als erste Münchner Kunststudentin an der Akademie ein. Bis 1841 weisen die Matrikelbücher insgesamt 47 Kunststudentinnen aus.
Nach dem 13. 9 1813 - Das Abbruchmaterial beim Neubau der Isarbrücke verwenden
München * Nach dem Einsturz der Isarbrücke untermauert Carl Friedrich von Wiebeking, der Leiter der staatlichen Straßen- und Wasserbaubehörde, seine Argumentation mit dem Hinweis, dass mit dem Abbruch des Isartores das anfallende Abbruchmaterial beim Neubau der Brücke verwendet werden könne. Wiebekings Vorschlag wird jedoch verworfen, die weiteren Planungen erst im Jahr 1816 wieder aufgenommen.
14. 9 1813 - Die Au hat jetzt einen Magistrat dritter Klasse
München Au * In der Vorstadt Au wird ein Municipalrat, ein Gemeinderat, gebildet. Die Au hat jetzt einen Magistrat dritter Klasse.
10 1813 - Das „Oktober-Fest“ fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Das „Oktober-Fest“ fällt kriegsbedingt aus.
1. 10 1813 - Das Allgemeine Strafgesetzbuch tritt in Kraft
München * Das von Anselm von Feuerbach verfasste Allgemeine Strafgesetzbuch tritt in Kraft. Das Gesetzeswerk gilt als fortschrittlich und wird zum Vorbild im In- und Ausland.
3. 10 1813 - Baiern tritt auf die Seite der Verbündeten Russland, Preußen und Österreich
Ried * Mit dem Vertrag von Ried tritt Baiern noch vor der Leipziger Völkerschlacht auf die Seite der Verbündeten Russland, Preußen und Österreich. Dem baierischen König sind darin der derzeitige Besitzstand und die volle Souveränität über alle seine Gebiete zugesichert worden.
4. 10 1813 - Eröffnung der Haidhauser Schule im ehemaligen Toerring-Schloss
Haidhausen * Lokalschulinspektor Hallmayr, der Bogenhausener Pfarrer, kann die Eröffnung der Haidhauser Schule im ehemaligen Schlossgebäude vermelden, muss aber darauf aufmerksam machen, dass noch die nötigen Bänke, Öfen und andere Dinge fehlen. Obwohl die Zahl der schulpflichtigen Kinder wesentlich höher lag, finden sich zur Winterschule lediglich 234 Schüler ein, zur Sommerschule sogar nur mehr 162 Kinder.
8. 10 1813 - Der Vertrag von Ried vollzieht den Bündniswechsel
Ried * Mit dem Vertrag von Ried vollzieht das Königreich Baiern den Bündniswechsel zur antinapoleonischen Koalition. Nach achtjährigem Bündnis mit Frankreich wechselt Baiern auf die Seite der Alliierten.
- Umgehend garantiert Österreich Baiern seine Souveränität und seinen Besitzstand im Umfang von 1812.
- Gleichzeitig erklärt Baiern den Austritt aus dem Rheinbund.
- Das zu stellende Truppenkontingent erhöht sich allerdings auf 36.000 Mann.
Das Oktoberfest fällt zum ersten Mal aus.
14. 10 1813 - Baiern erklärt Frankreich den Krieg
München - Paris * Das Königreich Baiern erklärt Frankreich den Krieg.
16. 10 1813 - Die Völkerschlacht bei Leipzig beginnt
Leipzig * Die Völkerschlacht bei Leipzig beginnt als Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege gegen Napoleon. Sie dauert bis zum vom 19. Oktober 1813. Dabei kämpfen die Truppen der Verbündeten Österreich, Preußen, Russland, Schweden und Baiern gegen die französischen Truppen.
Die Verbündeten bringen Napoleon Bonaparte die entscheidende Niederlage bei, die ihn zwingt, sich mit der verbliebenen Restarmee und ohne Verbündete aus Deutschland zurückzuziehen. In dieser wahrscheinlich größten Schlacht der Weltgeschichte werden von den rund 600.000 beteiligten Soldaten 92.000 getötet oder verwundet.
18. 10 1813 - Die entscheidende Schlacht bei Leipzig
Leipzig * Die entscheidende Schlacht der Völkerschlacht bei Leipzig wird geschlagen. Die französischen Truppen können der Übermacht der Verbündeten nicht mehr standhalten und müssen sich in die Stadt zurückziehen.
19. 10 1813 - Die französischen Truppen müssen Leipzig räumen
Leipzig • Die französischen Truppen unter Napoleon Bonaparte müssen Leipzig räumen. Die dreitägige Schlacht hatte schwere Verluste gefordert. Viele Franzosen kommen auch auf der Flucht ums Leben, andere müssen sich in Kriegsgefangenschaft begeben.
1. 12 1813 - Die Außenmauern am Nationaltheater stehen
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Beim Bau zum Hof- und Nationaltheater werden die Außenmauern fertiggestellt. </p>
22. 12 1813 - Die Haidhauser Schlossstraße entsteht
Haidhausen * Der Direktor der Akademie der Bildenden Künste, Johann Peter von Langer, kauft vom Haidhauser Hofmarkherrn Anton Clemens von Toerring-Seefeld noch weitere Grundstücke aus dem westlichen Teil des ehemaligen Schlossgartens als Bauplätze für Wohnhäuser an der neu angelegten Schlossstraße.
1814 - Die Wiederaufbauarbeiten für die Ludwigsbrücke beginnen
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Die Wiederaufbauarbeiten für die heutige Ludwigsbrücke beginnen. Sie werden aber nie beendet.
1814 - Franz Maria Schweiger stirbt
München-Maxvorstadt * Franz Maria Schweiger stirbt.
Seine Witwe Maria Agnes führt den Theaterbetrieb „vor dem neuen Maxthor“ so lange, bis ihr Sohn Josef das Theater und Ensemble des verstorbenen Lorenz Lorenzoni übernehmen kann.
Er ist nun der „Direktor des Theaters vor dem Karlstor“.
1814 - Die Polizei duldet sechs „Bordelle“ mit vier bis acht Luxusdirnen
München * Die Polizei duldet sechs „Bordelle“ mit vier bis acht Luxusdirnen, „obwohl sie gesetzlich nicht erlaubt“ sind.
Anno 1814 - Grundwasserverunreinigung durch die Pferde der „Lehel-Kaserne“
München-Lehel * Durch die jahrelange dichte Bewirtschaftung des Areals der „Lehel-Kaserne“ mit Pferdeställen treten ernsthafte Probleme mit dem Grundwasser auf.
Die Probleme, die zu zahlreichen Erkrankungen bei den Pferden durch schlechtes Wasser führt, wird übrigens erst ein Jahrzehnt später in Form einer zusätzlichen Wasserleitung beseitigt.
1. 1 1814 - Das Volljährigkeitsalter im Königreich Baiern wird auf 21 Jahre festgesetzt
Königreich Bayern * Das Volljährigkeitsalter im Königreich Baiern wird - ohne Unterschied des Standes oder Geschlechts - einheitlich auf 21 Jahre festgesetzt. Bisher waren die Regelungen in den einzelnen Reichsteilen Baierns unterschiedlich.
29. 1 1814 - Die Schlacht bei Brienne-le-Château sur Aube
Brienne-le-Château * Bei Brienne-le-Château sur Aube kämpft die Große Armee - mit Beteiligung Baierischer Truppen unter dem Befehl von General Carl Philipp Joseph von Wrede - gegen die Napoléonischen Streitkräfte. Die Schlacht endet mit einem Sieg Frankreichs unter Napoléon Bonaparte gegen die Russen, Preußen und Baiern unter Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher.
Der Name des Schlachtortes findet sich seit 1826 in der Brienner Straße wieder. Diese hieß zuvor Königsstraße beziehungsweise ab dem Königsplatz Kronprinzenstraße und ist aus dem ehemaligen Fürstenweg nach Nymphenburg entstanden.
2 1814 - Die „Heilig-Kreuz-Kapelle“ auf dem Mariahilfplatz wird abgerissen
Vorstadt Au * Die „Heilig-Kreuz-Kapelle“ auf dem Mariahilfplatz wird abgerissen.
1. 2 1814 - Die Schlacht bei La Rothière
La Rothière * Die Schlacht bei La Rothière findet im Tal der Aube südlich von Brienne statt. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Schlacht von Brienne-le-Château, die drei Tage zuvor mit einem Rückzug der Koalitionstruppen endete.
Das beherzte Eingreifen des baierisch-österreichischen Korps unter General Carl Philipp Joseph von Wrede hat dazu beigetragen, dass Napoléon Bonaparte um 21 Uhr den Befehl zum Rückzug gibt.
4. 2 1814 - Kronprinz Ludwig I. lässt ein Preisausschreiben veröffentlichen
München * Kronprinz Ludwig I. lässt ein Preisausschreiben zum Bau für ein Antikengebäude für Plastiken, der Glyptothek, sowie eine Ruhmeshalle für große Deutsche, die Walhalla, und für ein Invalidenhaus veröffentlichen. Der Einsendschluss für den Wettbewerb ist auf den 1. Januar 1815 festgelegt.
26. 2 1814 - Die Schlacht bei Bar-sur-Aube
Bar sur Aube * Die baierisch-österreichischen Truppen unter General Carl Philipp Joseph von Wrede kämpfen in Bar-sur-Aube gemeinsam mit Russen und Preußen gegen französisches Militär. Den Baiern gelingt es sogar ein Stadttor aufzubrechen und in das Stadtinnere vorzudringen. Doch sie werden schnell wieder vertrieben.
In der Nacht sitzen die Franzosen im Innern der Stadtmauern fest, während die Baiern das Gelände davor beherrschen.
26. 2 1814 - Kronprinz Ludwig I. trifft den Architekten Leopold Klenze
München * Graf Alois von Rechberg stellt Kronprinz Ludwig I. den Architekten Leopold Klenze vor. Es kommt noch zu keiner Anstellung. Erst im Januar 1816 wird Leo von Klenze nach München kommen.
27. 2 1814 - Die Kämpfe um Bar-sur-Aube gehen weiter
Bar sur Aube * Die Kämpfe um Bar-sur-Aube gehen weiter. Die Baiern greifen die Stadt entschlossen an, können eines der Stadttore erstürmen und aufbrechen und dringen in die Stadt ein. Ein heftiger Häuserkampf entbrennt, bei dem die Einwohner der Stadt auf der Seite ihrer Truppen mitkämpfen.
Als sich aber die französischen Truppen außerhalb der Stadt über die Aube zurückziehen, beginnt auch die französische Besatzung der Stadt ihren Rückzug über den Fluss. Die Baiern können nun Bar-sur-Aube im Sturm erobern und die in der Stadt festsitzenden französischen Soldaten gefangen nehmen.
Der Name dieses Schlachtortes findet sich seit 1826 in der Barer Straße wieder. Diese hieß zuvor Carolinenstraße beziehungsweise ab dem Carolinenplatz Wilhelminenstraße.
7. 3 1814 - General von Wrede wird zum Feldmarschall befördert
München * General Carl Philipp Joseph von Wrede wird wegen seiner besonderen militärischen Leistungen in den Befreiungskriegen zum Feldmarschall befördert.
11. 3 1814 - Der Alte Botanische Garten ist nahezu fertig gestellt
München-Maxvorstadt * Der Alte Botanische Garten ist nahezu fertig gestellt.
20. 3 1814 - Die Schlacht von Arcis-sur-Aube
<p><strong><em>Arcis-sur-Aube</em></strong> * Die Schlacht von Arcis-sur-Aube stellt sich für Napoleon Bonaparte nahezu aussichtslos dar, da er einen Mehrfrontenkrieg gegen Russland, Preußen, Großbritannien und Österreich führt. </p> <p>Bei Arcis-sur-Aube muss die französische Armee mit 28.000 Mann gegen eine fast dreifach überlegene österreichische Armee unter Generalfeldmarschall Karl Philipp zu Schwarzenberg mit 80.000 Mann kämpfen. Unter ihnen befinden sich auch baierische Truppen unter Feldmarschall Carl Philipp Joseph von Wrede. </p>
21. 3 1814 - Napoleon Bonaparte ordnet den sofortigen Abzug seiner Truppen an
Arcis-sur-Aube * Im weiteren Kampfverlauf in der Schlacht von Arcis-sur-Aube ordnet Napoleon Bonaparte um 12 Uhr mittags den sofortigen Abzug seiner sämtlichen Truppen an. Damit ist der Weg für die Verbündeten nach Paris frei.
Auch an diese Schlacht erinnert eine Straße in der Maxvorstadt, die Arcisstraße, die vor 1826 den Namen Ludwigstraße trug. Die spätere Meiserstraße und heutige Katharina-von-Bora-Straße hieß damals noch Amalienstraße.
31. 3 1814 - Die Verbündeten rücken in Paris ein
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Im Rahmen der Befreiungskriege marschieren die Verbündeten in Paris ein. </p>
6. 4 1814 - Napoleon Bonaparte dankt (erstmals) ab
<p><strong><em>Fontainebleau</em></strong> * Napoleon Bonaparte dankt in Fontainebleau (erstmals) ab. Der <em>„Rheinbund“</em> hat sich bereits aufgelöst.</p>
10. 4 1814 - Die Münchner feiern die Einnahme von Paris
<p><strong><em>München - Paris</em></strong> * In der Peterskirche, der Frauenkirche und der Michaelskirche wird ein <em>„Te deum“</em> gesungen. Draußen werden Kanonen abgefeuert. Damit feiern die Münchner das Einrücken der alliierten Truppen mit baierischer Beteiligung ins feindliche Paris. </p>
11. 4 1814 - Napoleon Bonaparte wird die Insel Elba als Fürstentum zugewiesen
<p><strong><em>Elba</em></strong> * Napoleon Bonaparte behält seinen Titel. Ihm wird die Insel Elba als Fürstentum zugewiesen. Mit Ludwig XVIII. wird in Frankreich das Königtum restauriert. </p>
18. 5 1814 - Errichtung einer Stahlfabrik am Eisbach in der Hirschau
München-Englischer Garten - Hirschau * Der Hofhammerschmied Lindauer erhält - gegen den erbitterten Widerstand des Hofgartenintendanten Friedrich Ludwig von Sckell - die Erlaubnis zur Errichtung einer Stahlfabrik am Eisbach in der Hirschau.
30. 5 1814 - Die Befreiungskriege sind beendet
Paris * Mit dem Ersten Frieden von Paris werden die napoleonischen Befreiungskriege beendet. Es ist ein Versöhnungsfrieden, der Frankreich als Großmacht in den Grenzen von 1792 bestehen lässt. Das Land erhält sogar besetzte Kolonien und Handelsniederlassungen zurück.
Der Erste Pariser Frieden legt in einer völkerrechtlich verbindlichen Formel fest: „Die Staaten Deutschlands werden unabhängig und durch ein föderatives Band vereinigt sein.“ Damit ist die Restauration der vorrevolutionären Verhältnisse des alten Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation ebenso ausgeschlossen, wie die Gründung eines deutschen Einheitsstaates.
Durch die von Napoleon initiierte große Flurbereinigung der deutschen Landkarte ist die Zahl der deutschen Staaten auf ein überschaubares Maß reduziert worden. Das hat jedoch an den zum Teil enormen Größenunterschieden nichts geändert. Durch die erheblich vergrößerten süddeutschen Mittelstaaten Baiern, Württemberg, Baden und anderer war ein neuer Machtfaktor entstanden.
Die Neuordnung erfolgt freilich unter den Eindrücken der bürgerlichen Reformprojekte der Französischen Revolution, die bereits zuvor in den deutschen Einzelstaaten Resonanz gefunden und dort manche Impulse zur Modernisierung der Staats- und der Gesellschaftsordnung ausgelöst hat.
3. 6 1814 - Die Grenzen des Königreichs Baiern werden neu festgelegt
Paris - München * Im baierisch-österreichischen Vertrag von Paris werden die Grenzen des Königreichs Baiern neu festgelegt. Für die Abtretung Tirols, Vorarlbergs sowie Salzburgs und einiger anderer österreichischer Gebiete erhält Baiern das Großherzogtum Würzburg, Aschaffenburg, die Pfalz und Berchtesgaden. Bayerns Staatsgebiet erreicht damit fast seine heutige Form.
9. 6 1814 - Carl Philipp Joseph von Wrede wird gefürstet
München - Ellingen * Generalfeldmarschall Carl Philipp Joseph von Wrede wird der Fürstentitel verliehen und ihm die fürstliche Herrschaft Ellingen überlassen.
26. 6 1814 - Österreich ergreift offiziell Besitz von Tirol
Innsbruck - Wien * Österreich ergreift offiziell Besitz von Tirol. Damit endet dort die baierische Herrschaft endgültig. Österreich übernimmt die meisten Errungenschaften der baierischen Verwaltung und hütet sich davor, zu den alten Strukturen zurückzukehren. Selbst die alte Ständeverfassung, deren Abschaffung eine der Hauptursachen des Aufstands von 1809 war, wird nur in sehr mild abgeänderter Form wiederbelebt.
7. 8 1814 - Papst Pius VII. stellt den Jesuitenorden wieder her
Rom-Vatikan * Papst Pius VII. stellt die Gesellschaft Jesu, den Jesuitenorden, wieder her.
22. 8 1814 - Reichsgraf Rumford stirbt
Auteuil * Sir Benjamin Thompson Reichsgraf von Rumford stirbt in Auteuil bei Paris.
26. 8 1814 - Tirol wird mit Österreich wieder vereinigt
Innsbruck - Wien * Tirol wird mit Österreich wieder vereinigt.
28. 8 1814 - Reichsgraf Rumford wird in Paris beerdigt
Auteuil * Sir Benjamin Thompson, Reichsgraf von Rumford, wird auf dem Friedhof von Auteuil, am Stadtrand von Paris, beerdigt.
18. 9 1814 - Der Wiener Kongress regelt die Neuordnung Europas
Wien * Der Wiener Kongress beginnt. Er tagt bis zum 9. Juni 1815. Im Mittelpunkt der vom österreichischen Staatskanzler Fürst Clemens Menzel von Metternich geleiteten und unter starkem Einfluss des Zaren Alexander I. und England stehenden Verhandlungen steht die Neuordnung Europas nach den Befreiungskriegen und dem Zusammenbruch des napoleonischen Herrschaftssystems.
Ein wesentlicher Punkt auf der Tagesordnung der europäischen Politik ist die Schaffung einer neuen Friedensordnung, die der Wiener Kongress vornehmlich dadurch umzusetzen versucht, indem er die Macht zwischen den Großmächten ins Gleichgewicht bringen will. Für die Königreiche, darunter Baiern, sowie die Großherzogtümer, Herzogtümer und Grafschaften des Rheinbundes ist vordringlich, dass nach ihrem Wechsel zur antinapoleonischen Allianz die Eigenstaatlichkeit und Souveränität ihrer bestehenden Staaten vertraglich festgeschrieben wird.
22. 9 1814 - Aron Elias Seligmann wird in den Adelsstand erhoben
München • Der mittlerweile zum Königlich Baierischen Hofbankier aufgestiegene Aron Elias Seligmann wird von König Max I. Joseph als erster Jude in Baiern in den erblichen Adelsstand erhoben, nobilitiert. Seither nennen sich er und seine zehn Kinder von Eichthal. Damit verbunden ist auch die Verleihung des Wappens der ausgestorbenen Familie von Thalmann in Augsburg.
12. 10 1814 - Ein Oktoberfest ohne Pferderennen
München-Theresienwiese * Aufgrund der Befreiungskriege findet das Oktoberfest nur in begrenztem Umfang statt. Das Pferderennen fällt aus. Nur das Landwirtschaftliche Zentralfest mit seinem Viehmarkt wird abgehalten. Von der königlichen Familie erscheint nur Prinzessin Auguste auf der Wiesn.
31. 10 1814 - Prostitution rund um die Isarinseln
München * Der Münchner Polizeidirektor von Stetten vermerkt in seinem Rapport:
„[...] Man mag ein Wirtshaus betretten, welches man wolle, so werden in demselben Husaren getroffen und in der Regel nicht alleine, sondern in der Gesellschaft ihrer Schönen, welche nicht neben, sondern auf ihnen sitzen. Gewöhnlich sind diese Damen aus der Vorstadt Au oder aus Haidhausen oder Dienstmägde.“
26. 12 1814 - Caroline Gräfin von Arco wird geboren
Schloss Stepperg * Caroline Gräfin von Arco wird als drittes Kind der Kurfürsten-Witwe Maria Leopoldine auf Schloss Stepperg geboren. Das Kind stirbt bereits am 18. Januar 1815 an Schleimfieber.
1815 - Ketzerei, Zauberei und Hexerei“ sind nicht mehr strafbare Tatbestände
München * Im „Strafrecht“ von Feuerbach sind „Ketzerei, Zauberei und Hexerei“ nicht mehr als strafbare Tatbestände zu finden.
1815 - Das Verständnis für die Belange des Militärs sinkt deutlich
München-Graggenau * Mit dem Eintreten der Friedenszeit sinkt auch das Verständnis der Anwohner des „Max-Joseph-Platzes“ für die Belange des Militärs deutlich.
3. 1 1815 - Österreich, England und Frankreich schließen ein Bündnis gegen Preußen
Wien * Österreich, England und Frankreich schließen während des Wiener Kongresses ein Bündnis gegen Preußen.
25. 1 1815 - 39 jüdische Männer gründen die Israelitische Kultusgemeinde
München * 39 jüdische Männer gründen in der Wohnung von Judith Wertheimer, der Witwe des kurfürstlichen Hoffaktors Abraham Wolf Wertheimer, die Israelitische Kultusgemeinde. Sie beschließen die Anlage eines jüdischen Friedhofs und für diesen Zweck den Kauf eines Grundstücks an der Thalkirchner Straße.
9. 3 1815 - Kronprinz Ludwigs liberale Verfassungsvorstellungen
München * Kronprinz Ludwig I. gibt in einer von seinem Vater Max I. Joseph angeforderten Stellungnahme zum Verfassungsentwurf eine sehr detaillierte und bemerkenswerte Denkschrift ab, in der der liberal auftretende Ludwig
- für eine Beschneidung der Kronrechte und
- für eine Volksrepräsentation mit weitreichenden Kompetenzen plädiert.
- In der Konzeption der Gewissens- und Pressefreiheit geht der Kronprinz sogar weit über den Entwurf der Kommission hinaus.
5. 4 1815 - Der Vulkan Tambora in Indonesien bricht aus
<p><strong>Indonesien</strong> * Am Abend des 5. April 1815 bricht im 12.000 Kilometer entfernten indonesischen Insel Sumbawa der Vulkan Tambora mit einer so apokalyptischen Gewalt aus, dass der ursprünglich 4.000 Meter hohe Vulkan 150 Megatonnen Gestein, Asche und Schwefelverbindungen in die Luft sprengt und nach dem Ausbruch 1.300 Meter niedriger ist. </p> <p>Die Verunreinigung der Atmosphäre führen zu einem Schleier, der den gesamten Erdball umfasst und das Weltklima abkühlen lässt. Der Temperaturrückgang hält bis 1819 an. Eine gigantische Aschewolke zieht über die nördliche Erdhalbkugel und bringt im Frühjahr 1816 mit Hunger und Tod das Elend über Baiern. </p>
Ab 6 1815 - Die Zeit des Biedermeier
Deutscher Bund * Die Zeitspanne vom Ende des Wiener Kongresses [1815] bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution [1848] in den Ländern des Deutschen Bundes wird als Biedermeier bezeichnet.
In dieser Zeit wird ein großer Teil der Bevölkerung daran gehindert, einen eigenen Hausstand zu gründen und zu heiraten. Als besonders streng gelten die Vorschriften im rechtsrheinischen Königreich Baiern. Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist die Eheschließung in Bayern an eine obrigkeitliche Genehmigung gebunden.
1. 6 1815 - Otto, der spätere König von Griechenland, wird geboren
Salzburg * Otto, der spätere König von Griechenland, wird als drittes Kind und zweiter Sohn des bayerischen Kronprinzen Ludwig I. und dessen Gemahlin Therese in Salzburg geboren.
8. 6 1815 - Auf dem Wiener Kongress wird der Deutsche Bund gegründet
Wien * Auf dem Wiener Kongress wird der Deutsche Bund gegründet. Der Zusammenschluss aller souveränen deutschen Fürsten und Freien Städte tritt an die Stelle des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
In der Bundesakte wird der Deutsche Bund als Staatenbund organisiert. Ohne Zentralgewalt, unter der Präsidialmacht Österreichs, ohne Gerichtshof und ohne gewähltes Parlament. Die Bundesversammlung, inoffiziell auch Bundestag genannt, ist eine Gesandtenversammlung. Darin ist sie dem alten Reichstag ähnlich, wie auch das alte Heilige Römische Reich Deutscher Nation ein Staatenbund war.
Der Artikel 13 der Deutschen Bundesakte bestimmt für alle Mitgliedsstaaten eine landständische Verfassung. Doch diesem Auftrag kommt das Königreich Baiern nur unvollständig nach, da die Verwirklichung eindeutig ein Rückschritt gegenüber der Konstitution gewesen wäre. Denn in einer landständischen Verfassung hätte sich die Landschaft wieder aus
- dem landständischen Adel,
- den landsässigen Prälaten und
- den Vertretern der Städte und Märkte
zusammengesetzt. Wieder hätte lediglich die Geburt, der Besitz und das Amt die Grundlage zur Beteiligung an der politischen Willensbildung gebildet.
Weder eine Wahl, noch eine Legislaturperiode ist vorgesehen. Dieses ist schlicht systemfremd.
9. 6 1815 - Der Wiener Kongress endet mit der Wiener Schlussakte
Wien * Der Wiener Kongress endet mit der Wiener Schlussakte.
28. 6 1815 - Andreas und Anna Schlutt sind Inhaber des Bachlbräu-Anwesens im Tal
München-Graggenau * Andreas und Anna Schlutt, die Eltern der Therese Feldmüller, sind zwischen 28. Juni 1815 und 20. Dezember 1836 Inhaber des Bachlbräu-Anwesens im Tal Mariae in München, das später wegen der geplanten Verbreiterung der Maderbräugasse verkauft und abgerissen wird.
Andreas Schlutt ist auch als Makler und Grundstücksspekulant tätig: So kauft er die Immobilie Priel 1, ein Ökonomieanwesen zwischen Bogenhausen und Oberföhring mit 76 Tagwerk.
Um 8 1815 - Eine nur geringe Getreideernte
Königreich Baiern * Die Getreideernte fällt in diesem Jahr nur sehr gering aus.
2. 8 1815 - Adolf Friedrich von Schack wird geboren
Schwerin * Adolf Friedrich von Schack wird in Schwerin, im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, geboren.
23. 9 1815 - Ein Haberfeldtreiben in Elbach
Elbach bei Miesbach • Vor dem Hause der Mayrin zu Elbach bei Miesbach wird Haberfeld getrieben.
10 1815 - Wieder ein „Oktoberfest“ mit den gewohnten Attraktionen
München-Theresienwiese * Das „Oktoberfest“ wird wieder mit den gewohnten Attraktionen (Pferderennen, Vieh-Prämierung und Viehmarkt) durchgeführt.
Lehrlinge und Feiertagsschüler, die sich durch herausragende Leistungen hervorgehoben haben, werden mit Preisen bedacht. Schüler zeigen gymnastische übungen und liefern sich Wettrennen.
Außerdem zeichnet man besonders fleißige und gehorsame Münchner Dienstboten aus, die mindestens 20 Jahre bei der gleichen Herrschaft „treu und fleißig gedient, sich allen Kleiderluxus enthalten und sich einer lobenswerten Sparsamkeit beflissen“ haben.
20. 11 1815 - Die Grenzen Frankreichs auf den Stand von 1789 festgesetzt
Paris * Im 2. Pariser Frieden werden die Grenzen Frankreichs - entgegen dem 1. Pariser Frieden vom 30. Mai 1814 - auf den Stand von 1789 festgesetzt.
1816 - Der entstehende „Königsplatz“ soll der „Platz der Könige“ werden
München-Maxvorstadt * „Kronprinz“ Ludwig I. fordert, dass der auf der grünen Wiese entstehende „Königsplatz“ auch der „Platz der Könige“ werden soll.
1816 - Joseph Anton von Maffei leitet die väterliche Tabakfabrik im Lehel
München-Lehel * Joseph Anton von Maffei leitet als Pächter die väterliche Tabakfabrik im Lehel.
1816 - Die „Konkordats-Verhandlungen“ werden wieder aufgenommen
München - Rom-Vatikan * Die „Konkordats-Verhandlungen“ zwischen dem Königreich Baiern und dem „Heiligen Stuhl“ werden wieder aufgenommen.
Bischof Johann Casimir Häffelin führt als baierischer Gesandter die Gespräche in Rom.
Und obwohl er als ein „Mann der katholischen Aufklärung“ gilt, kommt er der römischen Kurie so weit entgegen, sodass die Regierung in München mehrere „Konkordats-Entwürfe“ ablehnen muss.
1816 - Simon und Julie von Eichthal konvertieren zum katholischen Glauben
Berg am Laim * Simon von Eichthal und dessen Ehefrau Julie konvertieren in einer feierlichen Messe in der Berg am Laimer „Michaelskirche“ zum katholischen Glauben.
1816 - Zehn Jahre Aufenthalt zum Erwerb des Heimatrechts
München - Königreich Baiern * Die Regierung legt fest, dass der zehnjährige Aufenthalt in einem Ort zur Erwerbung des Heimatrechts ausreichend ist. Die Verjährung als Erwerbstitel wird ab dem Jahr 1818 dazu führen, dass viele Anwärter nach neun Jahren abgeschoben werden.
um 3 1816 - Eine Hungersnot bricht aus
<p><strong><em>Königreich Baiern</em></strong> * Nach dem gewaltigen Ausbruch des Vulkans Tambora zieht eine gigantische Aschewolke zieht über die nördliche Erdhalbkugel und bringt im Frühjahr 1816 mit Hunger und Tod das Elend über Baiern. Die Vorräte waren durch die Truppendurchzüge und Einquartierungen der letzten Jahre erschöpft worden. Das Land war schon von den Napoleonischen Kriegen ausgezehrt. Jetzt prägen Mangel und Not den Alltag.</p> <p>Die Aschewolke lässt kaum noch einen Sonnenstrahl durch. Mitten im August schneit es. Kälte und Frost vernichteten die Ernte. Es war ein europaweites Phänomen, aber Baiern traf es am härtesten. </p>
1. 4 1816 - Johann Georg Soldner erhält die provisorische Sternwarte
<p><em><strong>Berg am Laim</strong></em> * Die <em>„provisorische Sternwarte“</em> an der - damals noch zu Ramersdorf gehörenden - westlichen Ecke der Kreuzung an der heutigen Rosenheimer- und Friedenstraße wird offiziell an den Astronom und Vermessungsfachmann Johann Georg Soldner übergeben. </p> <p>Soldner stammt aus Mittelfranken und hat seine astronomische Ausbildung in Berlin erhalten. in der provisorischen Sternwarte entsteht auch seine erst über einhundert Jahre später in ihrer Bedeutung erkannte Arbeit <em>„Über die Ablenkung eines Lichtstrahls von seiner geradlinigen Bewegung, durch die Attraktion eines Weltkörpers, an welchem er nahe vorbeigeht“</em>. Die Arbeit lässt ihn zu einem Vorläufer Albert Einsteins werden. </p>
14. 4 1816 - Im „Münchner Vertrag“ erhält Baiern die linksrheinische Pfalz
<p><strong><em>München</em></strong> * Im <em>„Münchner Vertrag“</em> gibt Baiern Salzburg, das Hausruckviertel und Tirol an Österreich. </p> <ul> <li>In Bayern verbleiben Berchtesgaden und die Alt-Salzburger Gebiete rund um Tittmoning, Waging, Laufen, Teisendorf und Staufeneck. </li> <li>Im Umkehrschluss erhält Baiern die linksrheinische Pfalz sowie Hammelburg, Brückenau, Teile von Biberstein, Redwitz, Alzenau, Miltenberg, Amorbach und Heubach. </li> </ul>
18. 4 1816 - Baupläne zum Neubau einer Sternwarte in Bogenhausen
<p><em><strong>München - Bogenhausen</strong></em> * Nur wenige Tage nach der Ernennung Johann Georg Soldners zum Direktor der Sternwarte legt die Baierische Akademie der Wissenschaften König Max I. Joseph Baupläne zum Neubau einer Sternwarte in Bogenhausen vor. </p>
4. 6 1816 - Die Pläne zum Neubau einer Sternwarte in Bogenhausen sind genehmigt
München * König Max I. Joseph genehmigte die Pläne zum Neubau einer Sternwarte in Bogenhausen. Der endgültige und heutige Standort wird von Johann Georg Soldner sowie von Georg Friedrich von Reichenbach und wahrscheinlich Joseph von Fraunhofer festgelegt.
um 9 1816 - Es kommt zu einer fünffachen Brotverteuerung
<p><strong><em>Königreich Baiern</em></strong> * Es kommt aufgrund des Vulkanausbruchs in Indonesien und der damit verbundenen Klimaverschlechterung zu einer fünffachen Brotverteuerung. Und da siebzig Prozent der Ernährung aus Getreideproduktion besteht, kann der Bedarf an Grundnahrungsmittel für rund achtzig Prozent der Bevölkerung nicht mehr gedeckt werden.</p>
10 1816 - Erstmals ziehen die „Schützen“ auf die „Theresien-Wiese“
München-Theresienwiese * Erstmals ziehen die „Schützen“ auf „Theresens-Wiese“.
Die „Königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft“ organisiert mit einem „Vogel- und Scheibenschießen“.
Die damals einzige Schützengesellschaft bleibt fortan Träger des „Oktoberfest-Schießens“.
Als „Schützenkönig beim Vogelschießen“ hebt sich König Max I. Joseph hervor, für den ein „Kammerdiener“ das letzte Stück vom Holzadler herunterschießt.
Darüber hinaus werden langjährige landwirtschaftliche Dienstboten geehrt, die „mit dem Schweiße ihres Angesichtes, und bei den Schwielen ihrer Hände, und mit den Beulen an ihren Füßen, den Segen der natur bearbeiten und hereinbringen helfen“.
10 1816 - Eine „Gesellschaft für die Oktoberfeste“ wird neu gegründet
München-Theresienwiese * Die Finanzierung des „Pferderennens“ auf dem „Zentrallandwirtschafts- oder Oktoberfest“ überfordert den „Landwirtschaftlichen Verein in Baiern“.
Deshalb wird sie vorübergehend von der neu gegründeten „Gesellschaft für die Oktoberfeste“ übernommen.
Diese Lösung hält bis zum Jahr 1819.
10 1816 - Die „Oktoberfest-Gesellschaft“ richtet einen „Glückshafen“ ein
München-Theresienwiese * Die „Oktoberfest-Gesellschaft“ richtet einen „Glückshafen - Zum Besten der Armen“ ein, der in engem Zusammenhang mit den Missernten des Sommers steht.
Gleichzeitig wird ein absolutes Verbot anderer „Glücksspiele“ erlassen.
17. 11 1816 - Das Armenwesen wird grundsätzlich reformiert
München - Königreich Baiern * Das Armenwesen wird neu geregelt, durch eine Verordnung wieder dezentralisiert und zur Aufgabe der Heimatbezirke erklärt.
Die Kommunen bekommen mehr Mitbestimmung. Die Armenpflege wird jetzt durch kommunale Pflegschaftsräte und Pflegausschüsse, denen der Ortspfarrer, der Gemeindevorsteher und weitere gewählte Gemeindemitglieder angehören, geregelt. Sie entscheiden abschließend über den Anspruch und die Höhe der Unterstützung. Das Betteln wird grundsätzlich verboten.
Der Anspruch auf Armenpflege steht nur den „eingehörigen Armen“ zu. Die Gesetze über die Heimat legen den betroffenen Personenkreis fest.
28. 11 1816 - Bettelpolizeiliche Bestimmungen werden erlassen
München - Königreich Baiern * Bettelpolizeiliche Bestimmungen werden in einer Verordnung über Bettler und Landstreicher erlassen.
28. 11 1816 - Eine Verordnung über Zwangsarbeitshäuser
München - Königreich Baiern * Eine Verordnung über Zwangsarbeitshäuser regelt, dass in diese Einrichtungen nicht nur lästige Bettler und Landstreicher, sondern auch
- „Menschen von fortgesetztem schlechten Lebenswandel, die sich dem Müßiggange, der Unsittlichkeit und öffentlichen Ausschweifungen ergeben und dadurch,
- sowie durch Widerspenstigkeit und Ungehorsam gegen Eltern und Vorgesetzte Unordnung, Gefahr und Verderben in die Familie und Gemeinde bringen“ untergebracht werden können.
7. 12 1816 - Der päpstliche Konkordatsentwurf wird für unannehmbar erklärt
München * Der päpstliche Konkordatsentwurf wird für „unannehmbar“ erklärt.
Noch während der Regierungszeit des Grafen von Montgelas wurden Verhandlungen mit der päpstlichen Administration über die Neuordnung der Kirchenverhältnisse in die Wege geleitet. Anno 1807 stellte man die Gespräche ein, bis im Jahr 1816 der Bayerische Gesandte beim Heiligen Stuhl, Bischof Kasimir Freiherr von Häfflein, in neue Konkordats-Verhandlungen eintrat.
Da aber die Positionen der bayerischen Regierung und dem wieder erstarkten, selbstbewussten Papsttum nur schwer zu vereinbaren sind, schlägt Bayern als einzigen Gegenstand der Verhandlungen
- die Neufestsetzung der Diözesangrenzen und
- die Regelung zur Besetzung der Bischofsstühle vor.
Die Grenzen der Diözese stimmen nicht mit den Landesgrenzen überein, weshalb Bayern eine geschlossene territoriale Kirchenorganisation will und auf einen maximalen Einfluss bei der Besetzung der Bischofsstühle und damit indirekt auch auf die Pfarreien drängt. Eine Preisgabe der bisher ausgeübten staatlichen Kirchenhoheit kommt für die Regierung Montgelas nicht in Frage.
1817 - In der „Eisenfronfeste am Lilienberg“ sitzen 40 Häftlinge ein
Vorstadt Au * In der „Eisenfronfeste am Lilienberg“ sitzen 40 Häftlinge ein.
1817 - Die „Neue Isarkaserne“ in der Zweibrückenstraße wird bezogen
München-Isarvorstadt * Die „Kürassierkaserne“, „Schwere-Reiter-Kaserne“ oder „Neue Isarkaserne“ in der Zweibrückenstraße wird bezogen.
Bis 1885 dient die „Alte Isarkaserne“ nur noch als Behelfsunterkunft.
1817 - Das „Kaffeehaus an der Hofgartenmauer“ soll abgerissen werden
München-Graggenau * Luigi Tambosi und die Kurfürstinwitwe Maria Leopoldine sind sich handelseinig.
Er will ihr um 22.000 Gulden das „Kaffeehaus an der Hofgartenmauer vor der Reitschule“ abkaufen.
Dann erfahren sie, dass das „Kaffeehaus“ abgerissen und in den „Englischen Garten“ verlegt werden soll.
Die Niederlegung der Gebäude verzögert sich bis 1825.
So lange bleibt Maria Leopoldine Eigentümerin und Luigi Tambosi Pächter des „Kaffeehauses an der Hofgartenmauer vor der Reitschule“.
Im Jahr 1817 - Die „Lehel-Kaserne“ wird erneut erweitert
München-Lehel * Die „Lehel-Kaserne“ wird erneut erweitert.
Hierzu wird an der Nordspitze des Kasernengeländes bei der „Pferdstraße“, der heutigen Christophstraße, ein Teil der Stallungen durch den sogenannten „Neubau“ ersetzt.
1. 2 1817 - Kronprinz Ludwig fordert die Absetzung Montgelas
München * König Max I. Joseph kehrt von einem fast achtwöchigen Wien-Aufenthalt zurück. Er erhält von seinem Marschall Carl Philipp Fürst von Wrede anstatt des üblichen Rapports über das, was sich in der Abwesenheit des Königs zugetragen hat, einen Brief des Kronprinzen Ludwig überreicht.
In diesem fordert der „deutschtümelnde“ Prinz die Absetzung des Ministers Maximilian Joseph von Montgelas, weil dieser „alles Vertrauen im In- und Auslande“ verloren habe und der „täglich größer werdende Zerfall der Finanzen“ immer offensichtlicher werde. Aus Sicht Ludwigs, der Montgelas als den „eigentlichen Beherrscher Baierns“ empfindet, muss ein neuer Geist in die Ministerien einziehen. „Männer seines Systems“ dürfen nie wieder Minister werden.
Marschall Carl Philipp von Wrede hat die Aufgabe den König zu dieser Entscheidung zu überreden und ihn von der unabweislichen Amtsenthebung Montgelas zu überzeugen.
2. 2 1817 - Graf Maximilian Joseph von Montgelas erhält seine Entlassungsurkunde
München-Kreuzviertel * Mit den Worten: „Sonntag um elf Uhr werde ich mich bei Ihnen einfinden; adieu mon cher Montgelas. Ich hoffe, Sie in besserer Gesundheit anzutreffen, als ich Sie verlassen habe“, hat der baierische Herrscher sein Kommen für den 2. Februar 1817 angekündigt. Doch statt dem König fährt ein Bote mit der Entlassungsurkunde in der Tasche in das Palais am Promenadeplatz.
Der abgesetzte Minister erhält nicht einmal die Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das Kündigungsschreiben ist so formuliert, als hätte der Graf selbst aus gesundheitlichen Gründen gebeten, „ihn der ganzen Last der ihm bisher anvertrauten Staatsämter zu entheben“. Graf Maximilan Joseph von Montgelas schweigt nach der Überreichung des Schreibens erst einmal eine Viertelstunde und äußert sich dann nur über die - aus seiner Sicht - viel zu niedrige Höhe der Pension. 30.000 Gulden erhält der Neurentner, statt der 36.000 Gulden, die er als aktiver Minister erhalten hat.
Das ist also der Dank des Hauses Wittelsbach für den Mann, der ihnen in jahrzehntelanger Arbeit das Land vergrößerte, einen modernen Staat geschaffen und die Königskrone errungen hatte. Doch für Kronprinz Ludwig ist der Minister, der Baiern geformt, reformiert und modernisiert hat, einfach zu „unteutsch“.
In dieser Zeit kursieren zudem Schmähschriften, in denen Montgelas unterstellt wird, er sei nur ein „halber Baier“ und gehöre der alles unterjochenden französischen Nation an. Als Ernestine von Montgelas nach der Entlassung ihres Mannes als Minister die Gruppierung der Verschwörer an der Hoftafel beschimpft, erhält sie lebenslanges Hofverbot.
Kein Wunder, dass der ansonsten denkmalgeile König Ludwig I. dem Architekten des modernen Baiern kein Bronzestandbild setzen lässt, wohl aber seinem Mitverschwörer Fürst Carl Philipp von Wrede. Danach bewirkt eine deutsch-national gestimmte bayerische Geschichtsschreibung, dass Montgelas bei den Bayern in keinem guten Andenken bleibt.
Nach der Entlassung des Grafen Maximilian Joseph von Montgelas werden die Ministerien neu aufgeteilt. Das Portefeuille des Äußeren erhält Alois Graf von Rechberg, das des Inneren Friedrich Graf von Thürheim und das der Finanzen Maximilian Freiherr von Lerchenfeld.
2. 2 1817 - Die Konkordats-Verhandlungen nehmen einen völlig anderen Verlauf
München - Rom-Vatikan * Als Minister Maximilian Joseph von Montgelas gestürzt wird, nehmen die Konkordats-Verhandlungen einen völlig anderen Verlauf.
12. 2 1817 - Der Kampf ums Augustiner Christkindl
München-Kreuzviertel * Mitglieder der Marianischen Männerkongregation bitten Kronprinzen Ludwig I. in einem Brief, ihnen „den ehemaligen Gnadenschatz der hiesigen Augustinerkirche, nämlich das im Wachs wirklich schön und künstlich bousirte Jesukind“ zu überlassen. Als Entscheidungshilfe fügen sie hinzu, dass die Kongregation, sollte ihre Bitte Gehör finden, „dem hiesigen Armen-Fonde die baare Summe von Eintausend Gulden als Geschenk überreichen“ werde.
Gegen diese berechnende Wohltätigkeit der finanzkräftigen Marienverehrer können die sechs ehemaligen Elisabethinerinnen, in deren Besitz sich das Augustiner Christkindl befindet, nichts entgegensetzen. Obwohl sie in Bittschriften an König Max I. Joseph verbissen um das Kindl kämpfen, stehen sie bei diesem Angebot auf verlorenem Posten.
20. 2 1817 - Baiern wird in acht Kreise eingeteilt
Königreich Baiern * Baiern wird in acht Kreise eingeteilt, die in etwa den heutigen Regierungsbezirken entsprechen. Es sind dies
- der Isarkreis,
- der Unterdonaukreis,
- der Oberdonaukreis,
- der Regenkreis, der Rezartkreis,
- der Obermainkreis,
- der Untermainkreis und
- der Rheinkreis.
Um 3 1817 - Die Hungersnot setzt sich fort
Königreich Baiern * Die Hungersnot setzt sich fort. Ein Bericht informiert: „[…] man stach die ersten Graswurzeln im Frühjahr 1817 aus der Erde, um sich Gemüse daraus zu machen oder sammelte Brennnesseln zum gleichen Zweck, man kaufte sich Kleie […], um sie zu kochen und Kuchen aus ihr zu backen“.
Ab 3 1817 - Hungerkrawalle, Magazinplünderungen und Bauernaufstände
Königreich Baiern * Eine Teuerungshysterie beginnt. Man vermutet hinter den horrenden Getreidepreisen das Werk und die Machenschaften von Spekulanten und Wucherern.
Die Folge sind Hungerkrawalle, Magazinplünderungen und Bauernaufstände im Ausland und in Baiern.
um 3 1817 - Flechten, Moos und Baumrinde statt Brot
<p><strong><em>Königreich Baiern</em></strong> * Die Hungersnot erreicht ihren Höhepunkt. <em>„Statt des mangelnden Brotes aß man Flechten, Moose und Baumrinden, man stach die ersten Graswurzeln im Frühjahr 1817 aus der Erde, um sich Gemüse daraus zu machen oder sammelte Brennesseln zum gleichen Zweck, man kaufte sich Kleie, […] um sie zu kochen und Kuchen aus ihr zu backen.“</em></p> <p><em>„Achtzehnhundertunderfroren“</em> nennen die Menschen die Zeit dieses unerklärbaren Klimaschocks. Woher sollen sie auch wissen, dass ein Vulkanausbruch auf einer fernen unbekannten Insel ihr Elend ausgelöst hat. Sie vermuten vielmehr eine Strafe Gottes für die Säkularisation und das Verbot kirchlicher Traditionen. Klöster konnten geschleift werden - der Glaube nicht.</p>
16. 4 1817 - Eine Brandstiftung aus Hungersnot
München-Graggenau * Durch Brandstiftung brennt in der Nacht vom 16. April 1817 der seit zwei Jahren im Hof des Marstalls gelagerte Dachstuhl für das Hof- und Nationaltheater ab. An der Brandstelle findet man Zettel mit der Aufschrift „Brot oder Brand“.
Böse Zungen behaupten ernsthaft, der Dachstuhl „hat brennen müssen“, weil letzte Nachmessungen gezeigt hätten, dass die Querbalken zu kurz gewesen seien und dadurch die Unfähigkeit des Architekten Carl von Fischers ans Licht gekommen wäre.
Um den 17. 4 1817 - Über die Verlegung der Residenz nachgedacht
München-Graggenau * Nach der Brandstiftung am 16. April überlegt König Max I. Joseph die Verlegung der Residenz in eine andere Stadt. An seinen Sohn, Kronprinz Ludwig I., schreibt er: „Die Köpfe fangen an, sich zu erhitzen und unruhig zu werden, die anonymischen Briefe sind häufig.“
18. 4 1817 - Das „Augustiner Fatschenkindl“ wird in den Bürgersaal gebracht
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Die sechs ehemaligen Elisabethinerinnen müssen das <em>„Augustiner Fatschenkindl“</em> herausrücken. Das hochverehrte gefatschte <em>„Augustiner-Christkindl“</em> wird nun von der Elisabethkirche in den Bürgersaal gebracht, wo man es mit einer liturgischen Feier willkommen heißt. </p>
6. 5 1817 - Klatsch und Tratsch in Hof- und Diplomatenkreisen
Wien * Die Gräfin Ernestine Rupertina Walburga von Montgelas wird in den Sternkreuzorden aufgenommen und ist damit Mitglied des höchsten Damenordens der österreichischen Monarchie. Dennoch bietet die Gräfin breite Angriffsflächen für Klatsch und Tratsch in Hof- und Diplomatenkreisen. Und so flüsterte man in den Salons über ihre außerehelichen Amouren und unterstellt ihr Liebesbeziehungen zu verschiedenen Männern der baierischen Beamtenschaft, darunter auch zum Ministerkollegen ihres Mannes: Johann Wilhelm von Hompesch.
König Max I. Joseph befürchtet sogar, Montgelas Ehefrau Ernestine würde durch ihre Unbesonnenheit ihren Mann noch einmal ins Grab bringen. Im Jahr 1825 sagt er: „Wenn sie vor acht Jahren gestorben wäre, so wäre Montgelas noch heute Minister.“
10. 5 1817 - Die Regierung macht kleinere Zugeständnisse zum Konkordat
München-Kreuzviertel * Die baierische Regierung macht einige kleinere Zugeständnisse am Verhandlungsergebnis zum Konkordat.
5. 7 1817 - Bischof Häffelin unterschreibt - ohne Beauftragung - ein Konkordat
Rom-Vatikan - München * Obwohl er dazu nicht ermächtigt ist, unterschreibt Bischof Johann Casimir Häffelin ein zuvor von der baierischen Regierung in wesentlichen Teilen abgelehntes Konkordat.
Um 8 1817 - Die Hungersnot setzt sich fort
Königreich Baiern * Als Nachwirkung auf den Vulkanausbruch auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien vom April 1815 kommt es auch in diesem Jahr zu einer nur gering ausfallenden Getreideernte. Die Hungersnot setzt sich fort.
Um den 10. 9 1817 - Die Getreidepreise steigen erneut
Königreich Baiern * Trotz der Erhöhung des Ausfuhrzolls für Getreide und Ankäufe im Ausland steigen die Getreidepreise erneut. Kapitalkräftige Bauern, Bäcker und Getreidehändler machen in kürzester Zeit ein Vermögen.
13. 9 1817 - Eine Verordnung über den Getreidehandel und Notmagazine
München-Kreuzviertel * Die Regierung erlässt eine Verordnung über den Getreidehandel, in der alle Vorschriften zusammengefasst werden. Außerdem wird die Anlegung von Notmagazinen mit einem Sechstel des Jahresbedarfs für die Städte angeordnet.
10 1817 - Der Beginn der späteren „Landmaschinen-Ausstellungen“
München-Angerviertel - München-Theresienwiese * Der „Polytechnische Verein“ stellt Produkte der „vaterländischen Industrie durch alle Klassen der Fabrikation“ aus.
Diese Schau ist der Beginn der späteren „Landmaschinen-Ausstellungen“.
Die Objekte werden aber nicht auf der Theresienwiese, sondern in der Münchner Rosengasse ausgestellt.
11. 10 1817 - Grundsteinlegung für das Leuchtenberg-Palais
München-Maxvorstadt * Der Grundstein für das Leuchtenberg-Palais am Odeonsplatz wird gelegt.
24. 10 1817 - König Max I. Joseph unterzeichnet das Konkordat mit dem Vatikan
München * Die Regierung legt den Konkordatsentwurf König Max I. Joseph zur Unterschrift vor. Neben dem Verzicht auf Kontrollrechte über die Kirche wird der Staat zum Unterhalt der Bischöfe sowie der Domkapitel und zur Wiederherstellung einiger Klöster für Unterricht, Seelsorge und Krankenpflege verpflichtet.
Weil die religiöse Toleranz und Parität gefährdet scheint, das Konkordat die baierischen Protestanten eindeutig zurückgesetzt hat und gleichzeitig die herausgehobene Stellung der katholischen Kirche im Staat auf ein göttliches Gesetz beruft, ergeht für die neue Verfassung ein neues Religionsedikt, welches den Vertrag mit dem Heiligen Stuhl stark relativiert. Durch einen politisch-juristischen Kunstgriff erhält das Religionsedikt Verfassungsrang, während das Konkordat nur ein Staatsgesetz ist und sich somit unterordnen muss.
1818 - Von höchster Stelle wird eine „strenge Reinlichkeit“ verordnet
München * Wegen der auftretenden Hautkrankheiten wird von höchster Stelle eine „strenge Reinlichkeit“ verordnet.
Die Soldaten sollen künftig in den warmen Sommermonaten an „ausgewählten, schicklichen und gefahrlosen Stellen“ in fließendem Wasser öfter baden. Die Leibwäsche ist wöchentlich, die Bettwäsche monatlich zu wechseln.
Die Füllungen der Strohsäcke müssen fortan alle vier Monate ausgetauscht, die Bettdecken halbjährlich gereinigt werden. An der zweimännigen Bettenbelegung wird aber weiterhin festgehalten.
Lediglich das „rollierende Schlafen“, bei dem sich die vom Wach- oder Arbeitsdienst kommenden Soldaten in die Betten der Ablösung legt, ein Bett also von vier Soldaten benutzt wird und deshalb tagsüber gar nicht mehr auslüften kann, wird streng verboten.
1818 - Die „Tabakfabrik“ wird in ein Bad umgewandelt
München-Englischer Garten - Lehel * Die nahe dem „Diana-Tempel“ am östlichen Rand des „Englischen Gartens“ gelegene „Tabakfabrik“ wird in ein Bad umgewandelt.
Bald bürgert sich dafür der Name „Diana-Bad“ ein.
1818 - Erste Planungen zur Einrichtung einer „Erzgießerei“ in München
München-Maxvorstadt * Die Planungen zur Einrichtung einer „Erzgießerei“ in München stimmt Kronprinz Ludwig I. mit dem Architekten Leo von Klenze ab.
Ab 1818 - Graf von Montgelas wird „Erblicher Reichsrat“
München-Kreuzviertel * Maximilian Joseph Graf von Montgelas, der langjährige baierische „Premierminister“ und Erschaffer des modernen Bayern, gehört bis 1838 als „Erblicher Reichsrat“ der „Kammer der Reichsräte“ als „Vorsitzender des Finanzausschusses“ an.
1818 - Ein nicht immer spannungsfreies Zusammenleben
Ramersdorf - Haidhausen * Das Verhältnis zwischen den Bewohnern der „Ramersdorfer Lüften“ und der eher bäuerlich strukturierten Bevölkerung in Ramersdorf gestaltet sich nicht immer spannungsfrei.
Jedenfalls begehren die Haidhauser und später die Münchner dieses Gebiet, auch deshalb, weil die Grenzziehung zwischen den Gemeinden immer etwas verworren ist.
Diese Ungereimtheiten gehen auf die Bildung der bürgerlichen Gemeinde Ramersdorf zurück.
Damals nimmt man keine Rücksicht auf die Grenzen der bereits bestehenden „Steuerdistrikte“.
Deshalb kommen die „Ramersdorfer Lüften“ zum „Steuerdistrikt Haidhausen“.
Im Jahr 1818 - 390 Personen und 352 Pferde in der „Lehel-Kaserne“
München-Lehel * Die „Lehel-Kaserne“ besitzt eine Maximalkapazität von 390 Personen und 352 Pferdeständen.
Im ehemaligen „Konventbau der Hieronymitaner“, dem sogenannten „Altbau“, befinden sich vierzehn Mannschaftszimmer und fünf Küchen.
Der „Mittelbau“ nördlich der Kirche beherbergt acht Mannschaftszimmer und zwei Küchen.
Durch die anschließenden Stallungen getrennt befindet sich der „Neubau“.
Er enthält die Wache, das Verhör- und Rapportzimmer.
Darüber befinden sich weitere Büroräume, Magazine und Wohnungen.
1818 - Die Getreidepreise normalisieren sich wieder
Königreich Baiern * Die Getreidepreise normalisieren sich wieder.
Ende 4 1818 - Die „Neue Kavalleriekaserne an der Isar“ ist fertiggestellt
München-Isarvorstadt * Die „Neue Kavalleriekaserne an der Isar“, an der Zweibrückenstraße, ist insgesamt fertiggestellt.
Sie bietet jetzt Platz für 1.558 Soldaten und 359 Pferde.
Die Kapazität der Mannschaftszimmer schwankt zwischen 3 und 17 Bettladen für je zwei Personen. Die Standardzimmer haben entweder 8 oder 14 Bettladen.
5. 5 1818 - Karl Marx wird in Trier geboren
Trier * Karl Marx wird in Trier als drittes von neun Kindern geboren.
17. 5 1818 - Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden wieder hergestellt
München * Das Gemeindeedikt stellt die Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden wieder her. In seinem Konzept eines zentralisierten Staates hatte Maximilian Joseph von Montgelas die Selbstverwaltung der Städte, Märkte und Gemeinden abgeschafft. Nach Montgelas‘ Entlassung macht König Max I. Joseph - neun Tage vor dem Erlass einer neuen Verfassung - diese Maßnahme rückgängig.
17. 5 1818 - Die Gemeinde entscheidet über Ansässigmachung und Verehelichung
München - Königreich Baiern * Das Gemeindeedikt überweist die Bürgeraufnahme an die Gemeindebehörden. Die Gemeinden genehmigen damit alleine die Anträge auf Niederlassung und Verehelichung. Natürlich stehen dabei stets die Belange der Armenkasse und der Schutz des ortsansässigen Gewerbes vor möglicher Konkurrenz im Vordergrund.
Nach dem 18. 5 1818 - Gemeinden kaufen Land um Ansässigmachung zu verhindern
München - Königreich Baiern * Das Gemeindeedikt vom 17. Mai bewirkt, dass sich die Gemeinden nach Außen hin abschließen und sich insbesondere gegen kinderreiche Familien und Nachwuchs erwartende junge Paare wehren. Das selbst dann, wenn diese Bewerber über ein ausreichendes Einkommen verfügen. Zur Vermeidung von Ansässigmachungen kaufen Gemeinden sogar Land auf.
Bereits ansässigen Gemeindemitgliedern wird häufig die Wiederverheiratung versagt, wenn in der künftigen Ehe mit Kindern zu rechnen ist.
26. 5 1818 - Die Ständeversammlung hat über die Post mitzubestimmen
München * Seit der Verfassung vom 26. Mai 1818 sind im Königreich Baiern Fragen der Post nicht mehr alleine Angelegenheit des Landesherrn und seiner Regierung. Die Ständeversammlung hat das Recht über die Staatsausgaben und damit auch über die Post mitzubestimmen.
Zu den bevorzugt diskutierten Themen in der Ständeversammlung gehört unter anderem die Frage, ob die Post, als Öffentliche Anstalt die Bedürfnisse der Öffentlichkeit zu befriedigen hat oder ob sie vorwiegend Geld in die immer leeren Staatskassen bringen soll. Immer wieder prangern die Abgeordneten
- die katastrophalen Dienstleistungen der Post,
- die Grobheit der Postillione und
- den miserablen Zustand der baierischen Straßen an.
26. 5 1818 - Das Adelsedikt teilt den baierischen Adel in fünf Klassen ein
München * Das Adelsedikt teilt den baierischen Adel in fünf Klassen ein: Fürsten, Grafen, Freiherrn, Ritter (durch Verdienstorden) und einfache „von“.
26. 5 1818 - Das Königreich Baiern gibt sich eine konstitutionelle Verfassung
München * Das Königreich Baiern gibt sich eine konstitutionelle Verfassung. Baiern ist damit unter den großen deutschen Staaten der erste Verfassungsstaat. Baden erreicht diesen Status drei Monate und Württemberg ein Jahre später.
Der König vereinigt alle Rechte der Staatsgewalt in seiner Person, unterliegt aber in der Ausübung seiner Rechte einigen Beschränkungen.
Es gibt ein Zweikammersystem.
- Die Erste Kammer sind die Reichsräte,
- die Zweite Kammer setzt sich zusammen zu je einem Achtel aus adeligen Gutsbesitzern und Geistlichen, ein Viertel kommt von Städten und Märkten, die restliche Hälfte sind Landeigentümer ohne gutsherrliche Gerichtsbarkeit.
- Es gibt eine Legislaturperiode und
- außerdem werden die Mitglieder der Abgeordnetenkammer gewählt.
Dennoch ist der Weg zu demokratischen Strukturen noch sehr, sehr weit! - Die adeligen Gutsbesitzer stellen ein Achtel, die katholischen und evangelischen Geistlichen ebenfalls ein Achtel, die Städte, Märkte und Gemeinden ein Viertel und die übrigen Landeigentümer ohne gutsherrliche Gerichtsbarkeit die Hälfte.
- Dazu kommen zusätzlich drei Vertreter der Universitäten.
- Es gibt keinen Parlamentarismus,
- die Mehrheitsverhältnisse in der Abgeordnetenkammer haben keinen Einfluss auf die Arbeit des Ministerrats,
- die Abgeordneten haben kein Initiativrecht, dürfen also selbst keine Gesetzentwürfe einbringen und dürfen nicht über ihren Zusammentritt selbstständig entscheiden.
Im Vergleich zu den Vorgaben der Deutschen Bundesakte ist die Baierische Verfassung jedoch sehr modern ausgefallen. Sie legt das Fundament für das System einer konstitutionellen Monarchie.
Erneut ist das neue Staatsgrundgesetz aber keine Vertragskonstruktion zwischen dem Fürsten und dem Volk, sondern ein einseitiger verfassungsgebender Akt des Königs. Man nennt das auch eine oktroyierte Verfassung, die vom König in freier Selbstbeschränkung erlassen wird und somit nicht das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Fürst und Volksvertretung darstellt.
Im Gegenteil, der Baiernkönig begründet seine Herrschermacht mit der Verfassung nicht, sondern unterwirft sich vielmehr nur in bestimmten Punkten seinen selbst erlassenen Beschränkungen.
6 1818 - Das Eliteregiment „Garde du Corps“ setzt sich durch
München-Isarvorstadt * Das Eliteregiment „Garde du Corps“ erhebt erfolgreich Einspruch gegen die Absicht der Militärverwaltung, die Mannschaft in der „Neuen Isarkaserne“ sehr dicht zu kasernieren und einen Teil der Zimmer leer stehen zu lassen, um dadurch Brenn- und Beleuchtungsmaterial sparen zu können.
17. 6 1818 - König Max I. Joseph verkündet ein Religionsedikt
München * König Max I. Joseph verkündet ein Religionsedikt, durch das das Konkordat vom 24. Oktober 1817 stark relativiert wird. Während das Religionsedikt Verfassungsrang erhält, wird das Konkordat diesem als einfaches Staatsgesetz untergeordnet. Diese Maßnahme ist erforderlich geworden, weil das Konkordat für die katholische Kirche eine von Gott gegebene hervorgehobene Stellung proklamiert und damit die religiöse Toleranz und Gleichwertigkeit gefährdet hatte.
8 1818 - Die „Neue Isarkaserne“ wird dem Regiment „Garde du Corps“ übergeben
München-Isarvorstadt * Die „Neue Isarkaserne“ wird dem Regiment „Garde du Corps“ übergeben und auf 876 Mann Friedensbelegung bzw. 1.140 Mann in Ausnahmesituationen festgelegt.
10 1818 - Die Wirte stellen erstmals Bierbuden auf der Theresienwiese auf
München-Theresienwiese * Erstmals können die Münchner eine frische Mass Bier auf der „Wiesn“ trinken.
Denn die Wirte stellen Buden auf, in denen „Erfrischungen all Art verabreicht“ werden.
Die erste „Fischbraterei“ auf der Wiesn bietet „gebratenen Hering frischer Ernte“ an.
10 1818 - Anton Gruber betreibt sein Karussel auf der Theresienhöhe
München-Theresienwiese * Anton Gruber, der Wirt von der „Praterinsel“, erhält für fünf Jahre die Konzession für ein besonderes Publikumsvergnügen.
Auf der „Theresienhöhe“, also nicht auf dem „Festplatz“, betreibt er ein „Carussel“, eine „teutsche Schauckel“, wohl eine normale Schwingschaukel, eine „russische Schauckel“, ein Vorläufer des heutigen Riesenrads in bescheidener Größe, ein und eine „Taubenscheibe“, mit einer aufgehängten Holztaube als Zielwurfobjekt.
Zugleich darf er Speisen und Getränke anbieten.
17. 11 1818 - Beteiligung beim Erstellen der Heiratslizenz
München - Königreich Baiern * Bei Erteilung der Heiratslizenzen muss jetzt auch der Armenpflegschaftsrat der Heimatgemeinde gehört werden.
3. 12 1818 - Max von Pettenkofer wird geboren
Lichtenheim * Max Pettenkofer wird in Lichtenheim bei Neuburg an der Donau als Kind eines Einödbauern geboren.
21. 12 1818 - Prinzessin Amalie von Oldenburg wird geboren
Oldenburg * Prinzessin Amalie von Oldenburg, die spätere Königin von Griechenland, wird geboren.
1819 - Die Auer drängen auf die Eingemeindung
Vorstadt Au - München * Die Handwerker und die häufig arbeitslosen Tagelöhner der Au drängen auf die Eingemeindung.
In einem Gutachten des „Münchner Magistrats“ heißt es dazu:
„Der Gewerbemann der Vorstadt Au hat seine Kundschaft und seinen Markt nicht auf seinem Wohnplatz, sondern in München. Was sollen Schuhmacher und Schneider in einer Gemeinde mit 7.000 Köpfen, von denen zwei Drittel im Sommer mit bloßen Füßen gehen und sich in Lumpen kleiden“.
1819 - Die „Unheilbaren“ vom Schwabinger „Nicolai-Spital“ kommen zum Gasteig
Haidhausen * Nachdem das „Nicolai-Spital“ in Schwabing aufgelöst worden war, kommen die „Unheilbaren“ zum Gasteig.
Ab dem Zeitpunkt erhält das ehemalige „Leprosenhaus am Gasteig“ den Namen „Spital der Unheilbaren“.
1819 - Joseph Baader regt den Bau einer „eisernen Comerzstraße“ an
München * Joseph Baader, ein aus München stammender Ingenieur, regt den Bau einer „eisernen Comerzstraße“ zwischen Nürnberg und Fürth an.
Kronprinz Ludwig I. sieht jedoch noch in dem wirtschaftlichen Nutzen des Projekts Probleme.
1819 - Der „Holzmarkt“ wird am „Isartor“ eingerichtet
München-Lehel * Der „Holzmarkt“ wird am „Isartor“ eingerichtet.
1819 - Leonhard von Eichthal konvertiert zum katholischen Glauben
München * Leonhard von Eichthal hat Größeres vor.
Deshalb konvertiert er zum katholischen Glauben, da nun seine sieben Kinder in den bayerischen Adel einheiraten können.
- Er nutzt diese politischen Verbindungen, um sein Geld in den „Aufbau des bayerischen Eisenbahnnetzes“ zu investieren.
- Gleichzeitig bringt er große Grundstücke in seine Hand, die als potenzieller Baugrund gelten.
1819 - In München produzieren 62 Brauereien den beliebten Gerstensaft
München * In München produzieren 62 Brauereien den beliebten Gerstensaft.
1. 2 1819 - Die erste baierische Ständeversammlung tagt
München-Kreuzviertel * Die erste baierische Ständeversammlung tagt vom 1. Februar bis 25. Juli 1819.
4. 2 1819 - Der „Baierische Landtag“ wird feierlich eröffnet
München-Kreuzviertel * Die erste „Baierische Ständeversammlung“ wird von einem gut gelaunten König Max I. Joseph im „Ständehaus“ an der heutigen Prannerstraße feierlich eröffnet.
5. 2 1819 - Der Mittelbau der Lehel-Kaserne wird aufgestockt
München-Lehel * Da dem Fuhrwesen-Bataillon die Lehel-Kaserne immer noch zu klein ist, schlägt das Oberadministrativkollegium der Armee vor, den Mittelbau um eine Etage aufzustocken, um so sechs zusätzliche Zimmer für 102 Unteroffiziere und Mannschaften zu gewinnen. Der Plan wird an diesem Tag genehmigt und das Vorhaben bis zum Sommer ausgeführt.
5. 3 1819 - Ein Antrag gegen den jüdischen Hausiererhandel
München-Kreuzviertel * Joseph von Utzschneider bringt in seiner Funktion als Münchner Bürgermeister in der Ständeversammlung einen Antrag gegen den jüdischen Hausiererhandel ein. Der Handel der Juden soll demnach die „Quelle aller den inländischen Handel und das Gewerbe untergrabenden und vernichtenden Übel“ darstellen.
10. 7 1819 - Ein Maßnahmenkatalog zur Eingrenzung des jüdischen Hausiererhandels
München-Kreuzviertel * Die Ständeversammlung legt einen Maßnahmenkatalog zur Eingrenzung des jüdischen Hausiererhandels vor.
22. 7 1819 - Eingrenzung des jüdischen Hausiererhandels beschlossen
München-Kreuzviertel * König Max I. Joseph billigt den von der Ständeversammlung vorgelegten Maßnahmenkatalog zur Eingrenzung des jüdischen Hausiererhandels.
25. 7 1819 - Die erste Sitzungsperiode des Baierischen Landtags wird beendet
München-Kreuzviertel * Die erste Sitzungsperiode des Baierischen Landtags wird nach weniger als einem halben Jahr beendet.
8 1819 - Judenverfolgung inden fränkischen Landesteilen
Franken - Würzburg * Kurz nachdem König Max I. Joseph den Maßnahmenkatalog zur Eingrenzung des jüdischen Hausiererhandels genehmigt hat, kommt es in den fränkischen Landesteilen zu schweren Judenverfolgungen, „die vor allem in Würzburg das Maß des seit Jahrhunderten Dagewesenen überschritten. […] Arbeitslose, Handwerksburschen, verschuldete Bauern und Bürger stürmten die Häuser der Juden. Synagogen wurden in Brand gesteckt“.
Die Übergriffe auf die jüdischen Mitbürger dauern - mit Unterbrechungen - bis ins Jahr 1822 hinein an.
31. 8 1819 - Der österreichische Staatskanzler gegen die bayerische Verfassung
Karlsbad * Der österreichische Staatskanzler Clemens Menzel Fürst von Metternich will in den Karlsbader Verhandlungen vom 6. bis 31. August 1819 nicht nur
- die Souveränität des Königreichs Baiern, sondern auch
- die liberalen Errungenschaften der Baierischen Verfassung ernsthaft bedrohen.
Es ist hauptsächlich Kronprinz Ludwig, der mit vehementem Einsatz die Errungenschaften verteidigen und bewahren kann - auch gegenüber seinem Vater.
25. 9 1819 - Der Magistrat übernimmt die organisatorische Verantwortung für die Wiesn
München-Theresienwiese * Nachdem die Stadt München ein Jahr zuvor durch das Gemeinde-Edikt und die Verfassung des Königreichs Baiern erste kommunale Selbstverwaltungsrechte zurückerhalten und sich neu konstituiert hat, übernimmt der Magistrat der Stadt die alleinige organisatorische und finanzielle Verantwortung für den Unterhaltungsteil des Oktoberfestes, worunter das Pferderennen und das Vogelschießen gemeint ist. Für diesen Teil wird künftig der Name Oktoberfest gebraucht.
Die Ausrichtung des landwirtschaftlichen Teils (Vieh-Prämierung, Ausstellung und Viehmarkt) bleibt in der Verantwortung des Landwirtschaftlichen Vereins. Dieser Teil wird künftig als Landwirtschaftliches Centralfest bezeichnet werden.
Bis heute ist die Landeshauptstadt München der alleinige Veranstalter der Wiesn.
10 1819 - Die Stadtverwaltung kauft die Grundstücke der „Theresienwiese“ auf
München-Theresienwiese * Die Stadtverwaltung kauft die Grundstücke der „Theresienwiese“ auf, um den Betrieb des „Oktoberfestes“ sicher zu stellen.
Die Aufkäufe ziehen sich bis zur Mitte der 1880er Jahre hin.
3. 10 1819 - Die Stadt München übernimmt die Organisation des Oktoberfestes
München-Theresienwiese * Nachdem mit dem Gemeindeedikt vom 17. Mai 1818 die Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden wieder hergestellt worden war, übernimmt die Stadt München die Organisation und Finanzierung des Oktoberfestes.
Der Beginn des Oktoberfestes wird auf den ersten Oktober-Sonntag vorverlegt. Für das Ende wird der 12. Oktober, der Namenstag des Königs, festgelegt.
Eine städtische Tribüne wird direkt gegenüber dem Königszelt aufgebaut, um - sozusagen auf gleicher Augenhöhe mit dem Herrscherhaus - das Festgeschehen beobachten zu können.
12. 10 1819 - Das erste von der Stadt selbst organisierte Oktoberfest endet
München-Theresienwiese * Das erste von der Stadt München selbst organisierte und finanzierte Oktoberfest endet am Namenstag von König Max I. Joseph. Die Stadt gibt für das Oktoberfest 1.165 Gulden aus. Diesen stehen lediglich 346 Gulden Einnahmen gegenüber.
21. 10 1819 - Baron Aron Elias von Eichthal konvertiert zum katholischen Glauben
München-Au * Baron Aron Elias von Eichthal konvertiert - wie zuvor schon seine Söhne Simon, Bernhard und Arnold - zum Katholizismus. Er lässt sich in der Auer Carl-Borromäus-Kirche [?] taufen und nimmt zusätzlich den Namen Leonhard an. Seine Ehefrau Hindele/Henriette, eine geborene Levi, lässt sich hingegen nicht taufen. Ihre gemeinsamen Kinder können nun auch in den bayerischen Adel einheiraten.
19. 12 1819 - Getreidelieferung für die Münchner Schranne
München * 8.255 Schäffel (1 Scheffel = circa 222 Liter) Getreide kommen auf die Münchner Schranne. Rechnet man auf einen Wagen acht Scheffel, dann waren an diesem Tag 1.034 Bauernwagen mit 2.068 Pferden in der Stadt.
1820 - Im „Betz‘schen Wirtshaus“ wird als Attraktion ein Karussell aufgestellt
Bogenhausen * Im „Betz‘schen Wirtshaus“ in Bogenhausen wird als besondere Attraktion in einem Holzpavillon ein Karussell aufgestellt.
Die Figuren und Wagen kommen 1920 ins „Münchner Stadtmuseum“. Sie gelten als die weltweit ältesten erhaltenen Teile eines volkstümlichen Karussells.
Um 1820 - Josef Schweiger öffnet seine „Vorstadtbühne“ den Wiener Autoren
München-Maxvorstadt * Josef Schweiger öffnet seine „Vorstadtbühne“ den Wiener Autoren.
1820 - Die „Schauermayr‘sche Kapelle“ wird größer wieder aufgebaut
Haidhausen * Andreas Obermayr, der „Benefiziat der Nicolai-Kirche“ am Gasteig, lässt - ohne Erlaubnis - die „Schauermayr‘sche Kapelle“ abreißen und neu und größer wieder aufbauen.
1820 - Die Regierung hebt die Münchner „Bordelle“ wieder auf
München * Da trotz der tolerierten „Freudenhäuser“ die „Straßenhurerei“ nicht abnimmt, hebt die Regierung die Münchner „Bordelle“ wieder auf.
Um das Jahr 1820 - „Hier will das Volk gesehen, gefallen und bewundert werden“
München-Englischer Garten * Friedrich Ludwig von Sckell schreibt über den „Englischen Garten“:
„Hier will das Volk gesehen, gefallen und bewundert werden, alle Stände müssen sich also da versammeln und in langen bunten Reihen bewegen und die frohe Jugend unter ihnen hüpfen können“.
25. 1 1820 - Die Pfarrei Haidhausen wird selbstständig
Haidhausen * König Max I. Joseph verfügt die Erhebung des 3.100 Einwohner zählenden Benefiziums Haidhausen zur selbstständigen Pfarrei Haidhausen.
11. 2 1820 - Carl von Fischer stirbt im Alter von 37 Jahren
München * Der Architekt des Kgl. Hof- und Nationaltheaters, Carl von Fischer, stirbt im Alter von 37 Jahren. Kurz vor seinem Tod wird der Architekt - mit Duldung des Kronprinzen Ludwig I. - von Leo von Klenze verdrängt.
20. 3 1820 - Haidhausen ist selbstständige Pfarrei
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Haidhausen ist eine selbstständige Pfarrei.</p>
26. 3 1820 - König Max I. Joseph soll ein Denkmal bekommen
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Der Magistrat der Haupt- und Residenzstadt München beschließt, König Max I. Joseph ein Denkmal zu setzen. Anlass ist der bevorstehende zweite Jahrestag der Bayerischen Verfassung. Der König soll als <em>„Vater des Vaterlandes“</em> und als <em>„Friedensfürst“ </em>dargestellt werden.</p> <p>Zur Aufbringung der Kosten richtet man eine Subskription ein, eine für die damalige Zeit durchaus übliche Vorgehensweise. An vielen Orten in Deutschland und ganz Europa konstituieren sich im 19. Jahrhundert solche Kommissionen, deren Bestreben es ist, für eine zu ehrende Person - häufig sind es allerdings bürgerliche Größen der Geistes- und Kulturgeschichte - ein Denkmal zu errichten. Sie fungieren als unermüdliche Geldbeschaffer, Ausarbeiter eines Programms und Auftraggeber für einen Künstler.</p>
20. 5 1820 - Den baierischen Standpunkt durchgesetzt
Wien * In den Wiener Ministerkonferenzen, die zwischen dem 25. November 1819 und dem 20. Mai 1820 stattfinden, gelingt es, den baierischen Standpunkt durchzusetzen.
8. 6 1820 - Die Wiener Schlussakte sichert die Baierische Verfassung
München - Wien * Die Wiener Schlussakte tritt in Kraft. Damit ist die bereits erlassene Baierische Verfassung gesichert. Mit dieser Verfassung steht Baiern an der Spitze des deutschen Konstitutionalismus.
Immerhin können sich Österreich und Preußen erst unter dem Eindruck der Revolution von 1848/49 zu Verfassungen durchringen. Bis dahin werden die Konstitutionellen Monarchien argwöhnisch als revolutionäre Gebilde betrachtet.
16. 6 1820 - Kronprinz Ludwig: Wie viele Erzarbeiten habe ich nicht vor!
München * Kronprinz Ludwig I. schreibt an den Architekten Leo von Klenze: „Wie viele Erzarbeiten habe ich nicht vor!“ Und weiter: das geplante Denkmal für seinen Vater „möge das beste seyn, u. das wirksamste Mittel die Errichtung der Erzgießerei zu befördern.“
17. 6 1820 - Ernestine Rupertina Walburga Gräfin von Montgelas stirbt
Lucca * Ernestine Gräfin von Montgelas stirbt im Alter von 41 Jahren in Lucca. Ihr Mann Maximilian Joseph überlebt sie um 18 Jahre.
27. 8 1820 - Erstbesteigung der Zugspitze
<p><strong><em>Zugspitze</em></strong> • Josef Naus, ein bayerischer Offizier, gelingt die Erstbesteigung der Zugspitze. </p>
1. 10 1820 - Eine Ballonfahrt zum zehnjährigen Bestehen des Oktoberfestes
München-Theresienwiese * Zum zehnjährigen Hochzeitsjubiläum von Kronprinz Ludwig I. und Prinzessin Therese und damit zehnjährigen Bestehen des Oktoberfestes lässt man sich eine besondere Attraktion einfallen: eine Ballonfahrt. Die in einem altbaierischen Dirndl gekleidete und aus Dresden stammende Wilhelmine Reichard steigt mit ihrem aus gezwirnter Leinwand bestehenden Ballon in den Himmel. In der Nähe von Zornedig landet sie wohlbehalten.
31. 12 1820 - In Bayern leben 3.700.000 Menschen
Königreich Baiern * In Bayern leben 3.700.000 Menschen, wovon 3 Millionen oder 81 Prozent auf die landwirtschaftliche Bevölkerung entfallen, die auf 680.000 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe aufgeteilt sind.
31. 12 1820 - München hat 3.000 evangelische Bewohner
München * Die evangelische Gemeinde in München umfasst 3.000 Mitglieder.
1821 - Peter Paul Ritter von Maffei kauft das „Palais Seinsheim
München-Kreuzviertel * Peter Paul Ritter von Maffei kauft den „Seinsheim'schen Besitz“ am Promenadeplatz 8 zur Unterbringung seiner Bank.
1821 - Joseph Anton von Maffei gehört den „Gemeindebevollmächtigten“ an
München-Graggenau * Joseph Anton von Maffei gehört dem „Kollegium der Gemeindebevollmächtigten“, später dem „Magistrat“ an.
1821 - Johann Jakob Schöttl übergibt die „Neumühle“ an seinen Sohn
München-Englischer Garten - Tivoli * Johann Jakob Schöttl übergibt die „Neumühle“ an seinen gleichnamigen Sohn.
1821 - Beginn der Reparaturarbeiten an der Berg am Laimer „Michaelskirche“
Berg am Laim * Beginn der Reparaturarbeiten am Dachstuhl und den Gesimsen der Berg am Laimer „Michaelskirche“.
1821 - Halsband- und Maulkorb-Tragepflicht für Hunde
München * Wegen Überhandnehmens der herrenlosen Hunde führt man die Tragepflicht für ein Halsband und einen Maulkorb ein.
Die „Maulkorbverordnung“ verursacht einen drastischen Rückgang der Hunde in München.
17. 2 1821 - Lola Montez wird als Elizabeth Rosanna Gilbert in Irland geboren
Grange * Die „Spanische Tänzerin“ Lola Montez wird als Elizabeth Rosanna Gilbert in Grange, einem irischen Dorf im Nordwesten der Insel geboren. Ihre Mutter war das uneheliche Kind des angesehenen Landadeligen Charles Silver Olivier und seiner langjährigen Mätresse Mary Green. Edward Gilbert heiratet die Mutter der später als Lola Montez berühmt gewordenen Tänzerin.
Ab 3 1821 - Der „Griechische Freiheitskampf“ dauert von 1821 bis 1830
Griechenland * Der „Griechische Freiheitskampf“ dauert von 1821 bis 1830.
3 1821 - Der griechische „Unanhängigkeitskrieg“ beginnt
Griechenland * Unter dem Kommando des Fürsten Alexandros Ypsilantis beginnen die Griechen im offenen Aufstand für ihre Freiheit und Selbstständigkeit zu kämpfen.
Da aber die von Russland erwartete Unterstützung in diesem „Unanhängigkeitskrieg“ nicht erfolgt, wird die „Heilige Schar“ unter Alexandros Ypsilantis innerhalb von nur drei Monaten vollkommen aufgerieben.
Es kommt in der Folge zu grausamen Massakern unter der griechischen Bevölkerung.
Mit Beginn des „Unabhängigkeitskrieges“ gründen sich in ganz Westeuropa Vereinigungen von „Philhellenen“ (das bedeutet „Griechenfreunde“), die in der Öffentlichkeit für die griechische Sache werben, diese mit Geldspenden unterstützen und sich auch selbst in die Kampfhandlungen einmischen.
Zu diesen „Philhellenen“ zählt sich auch Ludwig I..
Der Bayernkönig unterstützt - leidenschaftlich und mit viel romantischem Pathos versehen - die griechischen Patrioten in ihrem „Freiheitskampf“.
Die Griechen kämpfen einen „Guerillakrieg“.
Die griechischen „Freiheitskämpfer“ werden von einem „Kapetánii“ angeführt und bezeichnen sich selbst als „Klephte“, was eigentlich Dieb oder Räuber bedeutet, oder als „Pallikare“, was junger Mann oder Held heißt.
In der Zeit des „Unabhängigkeitskrieges“ sind unter diesen Bezeichnungen aber immer „Freiheitskämpfer“ gemeint.
12. 3 1821 - Prinz Luitpold wird in Würzburg geboren
Würzburg * Prinz Luitpold, der spätere Prinzregent, wird in Würzburg geboren.
5. 5 1821 - Napoleon Bonaparte stirbt auf der britischen Insel Sankt Helena
St. Helena * Napoleon Bonaparte, der ehemalige französische Kaiser Napoleon I., stirbt in Langwood House auf der britischen Insel Sankt Helena im Südatlantik in der Verbannung.
15. 9 1821 - Die Tegernseer Erklärung beendet einen langwierigen Streit
Tegernsee * Mit der Tegernseer Erklärung wird ein langwieriger Streit zwischen der bayerischen Regierung und der katholischen Kirche ein Ende gesetzt. König Max I. Joseph erklärt darin, dass das Konkordat als Staatsgesetz angesehen und vollzogen werden wird.
12. 10 1821 - Die Fertigstellung der Glyptothek wird 9 Jahre verzögert
München-Maxvorstadt * Für diesen Tag ist die Schlüsselübergabe für die Glyptothek vom Architekten Leo von Klenze an Kronprinz Ludwig I. geplant. Diese Zeremonie kann erst am 5. Oktober 1830, fast neun Jahre später, nachgeholt werden.
1. 11 1821 - Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel wird zum Bischof geweiht
Tegernsee * Nachdem der Streit zwischen Staat und Kirche mit der Tegernseer Erklärung ausgeräumt werden konnte, kann Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel zum Bischof geweiht werden.
5. 11 1821 - Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel ergreift Besitz
München-Kreuzviertel - Freising * Bischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel ergreift feierlich Besitz
- von der Metropolitankirche Zu Unserer Lieben Frau,
- von seinem Erzbistum, aber auch
- von seiner Erzbischöflichen Residenz, dem Palais Holnstein.
1822 - Der Haidhauser Dorfteich, die „Große Lacke“, ist für Vieles nützlich
Haidhausen * Der Haidhauser Dorfteich, die „Große Lacke“, ist nützlich „bey Feuersgefahren, um Vieh und Wägen durchzuschwemmen, Gänse und Aenten darin herum schwimmen zu lassen, und bey trockner Zeit den Schlamm daraus zu sammeln“.
1822 - Ein aussichtsloser Kampf gegen die „Mayer'sche Lederfabrik“
Untergiesing * Die „bürgerliche Schuhmacherzunft Münchens und der Vorstadt Au“ entschließt sich, nachdem sie jahrelang dem Geschehen in der „Mayer'schen Lederfabrik“ tatenlos und voller Neid zugesehen hat, zu einem Protest bei „allerhöchster Stelle“ - vermutlich dem „Königlichen Ministerium des Inneren“ - gegen die „gewissenlosen Gewerbebeeinträchtigungen, welche wir von den hiesig- und umliegenden Lederfabrikanten und Israeliten durch die widerrechtliche Anmaßung der Selbstfabrikation ihrer in Accord übernommenen Militärlieferungen viele Jahre hindurch sehr empfindlich zu erdulden hatten“.
In der Folge fordert die Behörde den „Lederfabrikanten“ auf, künftige Militäraufträge bei den ansässigen Schuhmachermeistern fertigen zu lassen.
Doch die Freude der Schuster über ihren Sieg gegenüber dem Lederfabrikanten dauert nur kurz.
Dem geschäftstüchtigen Fabrikbesitzer Ignaz Mayer gelingt es nämlich, den Schwabinger Schumacher Hanrieder davon zu überzeugen, dass er seine Werkstatt mit „Sack und Pack“ sowie mit der Genehmigung der zuständigen Behörden in die „Untergiesinger Lederfabrik“ verlegt.
Der „Schuhmacher“ erhält dafür „eine wöchentliche Entschädigung [...], und [kann] sonach genüßlich sein Leben in Wohltätigkeit durchbringen“. Ignaz Mayer aber kann über den Trick der ausgeliehenen „Hanriederischen Konzession“ - sehr zur Empörung der „bürgerlichen Schuhmacherzunft Münchens und der Vorstadt Au“ - seine Militärlieferungen auch künftig weiter in eigener Regie herstellen lassen.
Der „Schuhmacherzunft“ bleibt nur mehr das Beschreiten des Protestwegs.
Ihr Protest gegen die „unerlaubte Transferierung einer Gewerbekonzession von einer Vorstadt in die andere“ findet beim „Königlichen Landgericht“ zunächst positives Gehör.
Doch die „Regierung des Isarkreises“ hebt das Verbot umgehend wieder auf.
Eine „königliche Anweisung“ zieht schließlich einen Schlussstrich unter die Affäre - und zwar zugunsten der industriellen Produktion in der „Lederfabrik“.
Es war das „Königliche Handelsministerium“, das sich in den Vorgang um die umstrittene Konzession einmischte und die Entscheidung zugunsten des „Hoflieferanten“ beeinflusste.
Wenn schon nicht das Einzelmitglied, so hätte doch die „Schuhmacherzunft“ den Einfluss ihres Kontrahenten und damit die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens erkennen müssen. Immerhin ist Ignaz Mayer nicht nur der Schwiegersohn des dem bayerischen Königs als millionenschweren Kreditgebers unentbehrlich gewordenen Leonhard von Eichthal, sondern seit dem Jahr 1809 auch der Schwiegervater von Simon Freiherr von Eichthal, der bei der Gründung der „Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank“ eine zentrale Rolle spielte.
Der „Hofbankier“ organisiert nicht nur die neue Kreditbank, sondern stellte auch dem späteren König Ludwig I. Mittel für seine Kunsteinkäufe zur Verfügung.
Ab dem Jahr 1822 - Der „Viehmarkt auf den Lüften“ wird jeden Donnerstag abgehalten
Vorstadt Au - Haidhausen * Der „Viehmarkt Auf den Lüften“ wird jeden Donnerstag abgehalten.
Ein Chronist schreibt über den Markt:
„Sehr merkwürdig ist es, wöchentlich am Donnerstag auf der Lüften zunächst München an der Rosenheimerstrasse den Viehmarkt zu sehen, auf welchem hiesige Metzger, und Köche für den Bedarf der Stadt bedeutend einkaufen.
Dieser Platz ist zu diesem Behufe um so mehr gut gelegen, weil alles Vieh, welches am rechten Isarhochufer im bayerischen Gebürgslande aufgezogen wird, sehr leicht dahin gebracht werden kann.
Da ist an der Landstrasse, und an der daranstoßenden Wiese alles mit Ochsen, Kühen, Kälbern, und Schweinen bedeckt, und die Luft ertönt von dem Gebläcke der Thiere, von dem Brummen der Kühe, denen man ihre Kälber nimmt, und von dem Bellen der Hunde.
Da geht es an ein Handeln, Einschlagen und Geldzählen, an ein Notiren und Aufschreiben zum Behufe des Aufschlages, und der Weg nach München ist an diesem Tage mit Vieh bedeckt, wobey die Treibbuben einen besonderen Verdienst haben”.
1822 - Bernbrunn bringt den Staberl auf die Bühne
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Der aus dem Weinmüller-Ensemble Schauspieler Carl Andreas von Bernbrunn, ein Darsteller aus Wien, übernimmt das Königliche Theater am Isartor. Der aus der österreichischen Hauptstadt kommende Akteur bringt den Wiener <em>„Staberl“ </em>auf die Bühne. </p> <p>Der <em>„Staberl“</em> ist in den Alt-Wiener Volkstheatern eine lustige Person, gekleidet mit einem roten Rock, grauem Hut, blaue Weste, Schnürstiefel á la Tyrolienne und mit einem dünnen, wegstehenden Zopf. Ursprünglich ist der <em>„Staberl“</em> ein Wiener Bürger des Mittelstands mit dem Beruf eines Parapluimachers [= Schirmmacher], der sich in fremdartigen Verhältnissen ungelenk benimmt, sich aber durch Mutterwitz immer zu helfen weiß. Er wird folgendermaßen beschrieben: Er sei ein <em>„lockerer Zeisig, der überall zu Hause ist und Dummheit mit Verschmitztheit vereint“</em>.</p> <p>Theaterstücke mit dieser Figur im Zentrum nannte man „<em>Staberliaden“. </em>Staberl ist auch mit den Darstellern Johann Nestroy und vor allem mit Carl Andreas von Bernbrunn, dem späteren Carl Carl verbunden, der schon in seiner Münchner Zeit Stücke für den <em>„Staberl“</em> schreibt. </p>
21. 1 1822 - Die zweite Ständeversammlung tagt
München-Kreuzviertel * Die zweite Ständeversammlung tagt vom 21. Januar bis zum 2. Juni 1822.
31. 12 1822 - 798 Familien bevölkern die Hofmark Haidhausen
Haidhausen * 798 Familien, das entspricht rund 4.000 Menschen, bevölkern die Hofmark Haidhausen.
31. 12 1822 - In München gibt es 62 Brauereien
München * In München gibt es 62 Brauereien.
1823 - Josef Schweiger muss sein „Theater vor dem Karlstor“ verschuldet schließen
München-Ludwigsvorstadt - München-Lehel * Josef Schweiger muss sein „Theater vor dem Karlstor“ verschuldet schließen.
Bis 1925 gibt er ein kurzes Intermezzo beim Wirt auf der „Praterinsel“.
Um 1823 - Nikolaus Freiherr von Maillot de la Treille lässt sich ein Schlösschen erbauen
München-Englischer Garten - Schwabing * Der baierische „Kriegsminister“ Nikolaus Freiherr von Maillot de la Treille lässt sich von dem Architekten Jean Baptiste Métivier am Westrand des „Englischen Gartens“ ein Schlösschen im Stil der italienischen Renaissance erstellen.
Es befindet sich an der Stelle des heutigen Verwaltungsgebäude der „Generaldirektion der Allianz-Versicherung“.
1823 - Die Familie Gilbert geht nach Indien
Indien * Die junge Familie Gilbert geht nach Indien, wo sich der im Dienst der britischen Besatzungsarmee stehende Vater ein finanziell abgesichertes Leben erhofft.
Er stirbt aber noch im gleichen Jahr an der Cholera.
1823 - Nauplia wird die Hauptstadt Griechenlands
Nauplia - Griechenland * Die provisorische Regierung Griechenlands erklärt Nauplia zur Hauptstadt.
1823 - 1.020 eheliche und 990 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.020 eheliche und 990 uneheliche Kinder geboren. Die Quote liegt weit über dem Landesdurchschnitt.
14. 1 1823 - Das Nationaltheater-Ensemble siedelt ins Isartor-Theater um
<p><em><strong>München-Graggenau - Angerviertel</strong></em> * Da das Königliche Hof- und Nationaltheater ein Opfer der Flammen wurde, siedelte das dortige Ensemble in das Theater am Isartor um, weshalb der Theaterdirektor Carl Andreas von Bernbrunn mit seiner Schauspielertruppe auf Tournee gehen musste. </p>
24. 2 1823 - Friedrich Ludwig von Sckell stirbt in München
München * Friedrich Ludwig von Sckell stirbt in München. Er wird auf dem Alten Südfriedhof beigesetzt. Sein Nachfolger als Hofgartenintendant wird sein Neffe Carl August Sckell.
10 1823 - Erstmals werden vier „Tanzplätze“ auf dem „Oktoberfest“ eingerichtet
München-Theresienwiese * Erstmals werden vier „Tanzplätze“ auf dem „Oktoberfest“ eingerichtet, was die Attraktivität bedeutend erhöht.
Ab 10 1823 - Ein erster Denkmalentwurf für das Max-Joseph-Denkmal entsteht
München-Graggenau * Ein großer Schritt in der Planung des Max-Joseph-Denkmals geschieht auf der Italienreise des Kronprinzen Ludwig mit Leo von Klenze vom Oktober 1823 bis Anfang des Jahres 1824. In Zusammenarbeit mit dem in Rom wohnenden Bildhauer Martin von Wagner, dem Kunsteinkäufer Ludwigs, der auch die berühmte Äginetengruppe für die Glyptothek erwerben konnte, entstand ein Denkmalentwurf. Er zeigt den König im Krönungsornat auf dem Löwenthron mit der zum Friedensgruß erhobenen rechten Hand.
„Als Grund für die sitzende Stellung führte ich an“, schreibt Leo von Klenze später, „daß der König als Nicht-Feldherr doch am besten in der Stellung dargestellt werden möchte, welche die Alten ihren Obergöttern und namentlich dem Zeus gaben“ und dass diese ruhige Haltung „dem Begriffe der gesetzlichen, sich ihrer Macht und Würde bewußten Herrschaft“ entspricht.
Doch König Max Joseph spricht sich prinzipiell gegen eine sitzende Stellung aus, und zwar in der ihm eigenen, sehr drastischen Ausdrucksweise: Er will nicht „auf dem Cacatojo sitzend“ dargestellt werden. Daraufhin macht Leo von Klenze einen neuen Entwurf, der den König stehend mit vier liegenden Löwen zeigt und die Zustimmung Max Josephs, schließlich auch des Kronprinzen und der Denkmalkommission findet.
23. 10 1823 - Die Franziskaner erhalten das Kloster im Lehel
München-Lehel * Noch bevor die Zentralklöster völlig aussterben, verhilft König Ludwig I. der bayerischen Franziskanerprovinz zum heiligen Antonius von Padua zu neuem Leben. Im Einvernehmen mit Erzbischof Anselm von Gebsattel erhalten die Franziskaner in München die Pfarr- und ehemalige Hieronymitenkloster-Kirche Sankt Anna im Lehel als neuen Sitz.
Über die massiven Bedenken, ob man die Bettelmönche überhaupt wieder in München ansiedeln soll, setzt sich der klösterrestaurierende Bayernherrscher - sehr zur Freude seiner konservativ eingestellten Untertanen - einfach hinweg. Als Begründung für seine Entscheidung zugunsten der Franziskaner gibt er an: „Eingedenk, daß Mitglieder dieses Hauses Unsern erhabenen Vorfahren Kaiser Ludwig den Bayern zu einer Zeit vertheidigt haben, in welcher dieses mit größter Gefahr verbunden war.“
Kurz und bündig gibt er an das Ministerium des Innern die Weisung: „Am Allerheiligentage sollen die Franciscaner von Ingolstadt in ihrem hiesigen Kloster eintreffen, daselbst Hochamt halten.“
1824 - Peter von Cornelius wird Direktor der „Kunst-Akademie“
München-Maxvorstadt * Peter von Cornelius wird Direktor der „Königlichen Akademie der Bildenden Künste“.
1824 - Bogenhausen erhält am Kirchplatz 3 eine eigene Schule
Bogenhausen * Bogenhausen erhält in einem alten Bauernhof am Kirchplatz 3 eine eigene Schule.
1824 - Der Haidhauser Dorfteich, die „Große Lacke“, wird aufgeschüttet
Haidhausen * Der Haidhauser Dorfteich, die „Große Lacke“, wird aufgeschüttet, in eine Wiese umgewandelt und mit Bäumen bepflanzt.
1824 - In den Kasernen sind nicht nur die Soldaten untergebracht
München * In den Kasernen sind aber nicht nur die Soldaten, sondern auch deren Ehefrauen untergebracht.
Diese müssen sich - gemeinsam mit ihren Männern und ihren Kindern - die Kasernenzimmer mit mehreren Soldaten teilen, sodass sich das ganze Ehe- und Familienleben „vor Publikum“ abspielt.
Ein Bericht beschreibt die Situation so: „[...] In Krankheit und Geburtsfällen müssen die Weiber in den nämlichen Zimmern, in denen sich auch die Mannschaft befindet, nur durch einen leichten Vorhang gedeckt, ihr Schicksal erleiden [...]
Wenn auch in Geburts Fällen im entscheidenden Augenblicke die Mannschaft aus dem betreffenden Zimmer entfernt, und für einige Zeit in ein anderes Zimmer gewiesen wird, so müssen zur Nachtzeit, wenn die leeren Bettstellen der im Dienst befindlichen Leute nicht hinreichen, drei Mann in einer Bettlade der Ruhe genießen“.
1824 - Die Stadt kauft Privatgrundstücke auf der „Theresienwiese“ auf
München-Theresienwiese * Die Stadt kauft Privatgrundstücke auf der „Theresienwiese“ auf, um das große Areal als „Festplatz“ erhalten zu können.
1824 - Ein Denkmal für Friedrich Ludwig von Sckell
München-Englischer Garten - Schwabing * König Max I. Joseph lässt am Südufer des „Kleinhesseloher Sees“ durch den Bildhauer Ernst von Bendel für Friedrich Ludwig von Sckell ein Denkmal errichten.
1824 - Franz Kester macht die Lederfabrik zu einer der modernsten in Deutschland
Untergiesing * Ignaz Mayer stirbt. Die „Untergiesinger Lederfabrik“ geht in den Besitz seines Schwagers Arnold von Eichthal über.
Die Leitung der „Großgerberei“ erhält damals Franz Kester, der die Lederfabrik zu einer der modernsten ihrer Art in ganz Deutschland und zur größten auf dem europäischen Festland machen wird.
1824 - Mit dem Bau der „Erzgießerei“ wird begonnen
München-Maxvorstadt * „An der Straße nach Nymphenburg“ wird mit dem Bau der „Erzgießerei“ begonnen.
1824 - Das „Artillerie-Regiment“ soll vom „Max-Joseph-Platz“ zu verbannt werden
München-Graggenau * Die „Kommission zum Wiederaufbau des Hof- und Nationaltheaters“ stellt den Antrag, nach der Eröffnung des neuen Theaters das „Artillerie-Regiment“ vom „Max-Joseph-Platz“ zu verbannen.
- Man verweist dabei auf die Belästigung der ganzen Nachbarschaft durch den täglichen Ausbildungsbetrieb.
- Außerdem würden in keiner „Haupt- und Residenzstadt“ außer in München, auf einem Stadtplatz ständig Militärübungen stattfinden.
- Vielmehr sucht sich überall sonst das Militär „Exerzierplätze“ außerhalb der Städte.
1824 - Leo von Klenze baut das neue „Schloss Biederstein“
Schwabing * Leo von Klenze baut im Park von „Schloss Biederstein“, anstelle des „Belvedere“ von Carl von Fischer, das neue „Schloss Biederstein“.
1824 - Die Einwohnerzahl Münchens beträgt 62.290
München * Die Einwohnerzahl Münchens beträgt 62.290. Das ist gegenüber dem Jahr 1801 eine Steigerung von 21.873 Bewohner. Das entspricht einem Zuwachs von 35 Prozent.
11. 1 1824 - Baron Leonhard von Eichthal stirbt in München
München * Baron Leonhard von Eichthal, der erste nobilitierte Jude, Hoffaktor und Finanzier des Bayerischen Staates, stirbt in München. Er wird auf dem Alten Südlichen Friedhof beigesetzt. Das Privatbankhaus in der Theatinerstraße führt der jüngste Sohn Simon weiter.
9. 6 1824 - Erzbischof Gebsattel veröffentlicht einen Hirtenbrief zur Sittlichkeit
München * Erzbischof Anselm von Gebsattel veröffentlicht einen „Hirtenbrief zur Sittlichkeit“ und erteilt den Geistlichen massive Anleitungen, um „gegen die große Zahl unehelicher Kinder und andere sittliche Verhaltensweisen“ aktiv zu werden. Das unterstützt die Haberer enorm und fordert die Geistlichen sogar auf, die Treiben zu fördern.
18. 6 1824 - Arnold Zenetti wird in Speyer geboren
Speyer * Arnold Zenetti wird in Speyer als Sohn des Regierungsrats Johann Baptist Zenetti geboren. Sein Bruder Julius wird Regierungspräsident von Mittelfranken, sein Bruder Wilhelm Abt von St. Bonifaz in München.
21. 7 1824 - Graf Toerring-Seefeld verkauft das Patrimonialgericht Haidhausen
Haidhausen * Graf Clemens Anton von Toerring-Seefeld verkauft das Patrimonialgericht Haidhausen um 70.000 Gulden an die Stadt München. Der Verkauf muss rückgängig gemacht werden, da er nicht die Billigung der Regierung findet.
26. 7 1824 - Grundsteinlegung für die jüdische Synagoge an der Westenriederstraße
München-Angerviertel * Der Grundstein für den Bau der jüdischen Synagoge an der Westenriederstraße wird gelegt.
6. 8 1824 - Die Zahl der auf dem Oktoberfest zugelassenen Bierwirte wird festgelegt
München-Theresienwiese * In einer gemeinsamen Bekanntmachung der Polizeidirektion, des Landgerichts und des Magistrats der Stadt München wird die Zahl der auf dem Oktoberfest zugelassenen einheimischen (hiesigen) Bierwirte und Brauer auf 18 festgelegt. Im Losverfahren werden in einem Jahr die ersten 18, im nächsten Jahr die zweiten 18 Bewerber berücksichtigt.
Zudem sind auch vier Wirte aus dem umliegenden Landgericht München zuglassen. Ihr Standort ist auf der Theresienhöhe.
6. 8 1824 - Johann Peter von Langer stirbt
Haidhausen * Johann Peter von Langer stirbt.
Noch kurz vor seinem Tod äußert er sich vor seinen Studenten folgendermaßen: „Meine Herren, es gibt nur drei wahrhaft große Künstler: Der Erste war Raffael, der Zweite ist mein Sohn und den Dritten verbietet mir die Bescheidenheit, Ihnen zu nennen!“
Kritik nahm er nicht mehr wahr. Den Bestrebungen, ihn als Akademiedirektor abzusetzen, muss er sich nicht mehr stellen, da er das Zeitliche segnet.
Robert von Langer erhält zwar das väterliche Adelsprädikat übertragen, doch für das Amt des Akademie-Direktors wird im gleichen Jahr Peter Cornelius berufen.
7. 9 1824 - König Max I. Joseph genehmigt die Neubefestigung Münchens
München * König Max I. Joseph genehmigt die Neubefestigung Münchens, das nach den Vorstellungen von Kronprinz Ludwig I. und Leo von Klenze mit Wall und Graben eingefasst werden soll. Klenze ist der Auffassung, dass sich München „nie über den Platz hinaus wo die Glyptothek steht, erstrecken kann“. Lediglich das Siegestor im Norden und die Propyläen im Westen werden realisiert.
10 1824 - König Max I. Joseph feiert sein 25jähriges Regierungsjubiläum
München - München-Theresienwiese * König Max I. Joseph feiert sein 25jähriges Regierungsjubiläum.
Auf dem „Oktoberfest“ rückt dadurch die Person des Monarchen stark in den Mittelpunkt.
Die dynastische Verbindung zwischen den Wittelsbachern und den Habsburgern wird durch die Verlobung der Königstochter Sophie mit dem österreichischen Erzherzog Franz Karl neu gefestigt.
Die Feierlichkeiten werden in das Geschehen des „Oktoberfestes“ mit einbezogen.
10 1824 - Am „Hauptrennen“ dürfen sich nur mehr inländische Pferde beteiligen
München-Theresienwiese * Am „Hauptrennen“ dürfen sich nur mehr inländische Pferde beteiligen.
Die Maßnahme dient der Förderung der „edlen Pferdezucht in Bayern“.
10 1824 - Innerhalb der „Pferderennbahn“ befindet sich der „Wirtsbudenring“
München-Theresienwiese * Innerhalb der „Pferderennbahn“ befindet sich der „Wirtsbudenring“.
Die sie betreibenden Bierwirte und Brauereien sorgen mit Kegelbahnen und Kletterbäumen für Unterhaltung und Volksbelustigung.
31. 12 1824 - Die Zahl der Seelen in der Anna-Pfarrei liegt bei 4.352
München-Lehel * Die Zahl der Seelen in der Anna-Pfarrei liegt bei 4.352.
1825 - Josef Schweiger öffnet sein „Theater vor dem Karlstor“ an alter Stelle wieder
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Josef Schweiger öffnet sein <em>„Theater vor dem Karlstor“</em> an alter Stelle wieder. So lange, bis der Neubau der protestantischen Matthäuskirche in der Sonnenstraße sein Budentheater verdrängt.</p>
1825 - Simon von Eichthal erwirbt den sumpfigen Heilig-Geist-Anger
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * Simon von Eichthal erwirbt den sumpfigen Heilig-Geist-Anger in der Absicht, ihn in möglichst viele kleine Grundstücke zu parzellieren und danach gewinnbringend zu verkaufen. Daraus wird später das Gärtnerplatz-Viertel.</p>
1825 - Rücklagen für den Bau einer protestantischen Kirche
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Bayerische Landtag ermächtigt das Finanzministerium, jährlich 20.000 Gulden für den Bau einer protestantischen Kirche anzusetzen. Dafür muss die Salvatorkirche unentgeltlich zurückgegeben werden. Erweiterungsplanungen werden damit hinfällig. </p>
1825 - Joseph Ritter von Hazzi übernimmt die Seidenzucht-Deputation
<p><em><strong>München</strong></em> * Erst als der Vorstand des Landwirtschaftlichen Vereins, der Staatsrat Joseph Ritter von Hazzi, den Vorsitz der Seidenzucht-Deputation übernimmt, geht es mit dem Vorhaben aufwärts. </p>
1825 - Bevölkerungsvermehrung und Gewerbeverfassung angestrebt
Königreich Baiern * Eine seit Jahren anhaltende Diskussion über die zu ergreifenden Maßnahmen
- zur Verbesserung der öffentlichen Finanzen und damit
- einer Abwehr eines Staatsbankrotts sowie
- die Anhebung des allgemeinen Wohlstands
führen zum Wunsch nach einer
- Vermehrung der Bevölkerungszahl und
- der Liberalisierung der Gewerbeverfassung.
1825 - Gründe für den Mangel an Bevölkerung
Königreich Baiern * Als Gründe für den Mangel an Bevölkerung sieht man in
- den Kriegsverlusten,
- der mangelnden Freizügigkeit,
- in dem zur Ehelosigkeit zwingenden Militärstand,
- in der großen Anzahl der Geistlichen,
- in den Eheverboten für untergeordnete öffentliche Bedienstete,
- in dem Luxusbedürfnis, das einer Eheschließung entgegen steht,
- in der Unteilbarkeit der Bauerngüter und
- in der Erschwerung der Ansässigmachung und Verehelichung.
1825 - Die Themen Ansässigmachung und Verehelichung im Landtag
München-Kreuzviertel - Königreich Baiern * Die Ständeversammlung befasst sich mit den Themen Ansässigmachung und Verehelichung. Man verweist auf England und Holland, wo der Wohlstand auf einer zahlreichen und gewerbefleißigen Bevölkerung basiert.
Dagegen hindern im Königreich Baiern die „Erschwerung der Heiraten und Ansässigmachungen […] ein unserem dürftigen Boden und seiner großen Oberfläche angemessenes Wachstum der Bevölkerung und beraubten uns dadurch gerade der Entwicklung jener kostbaren Kräfte, durch deren fruchtbare Produktion der innere Wohlstand am segensreichsten gedeiht und die Gewichtigkeit eines Staates am sichersten emporsteigt“.
Bedenken, dass die wachsende Bevölkerung nicht ernährt werden könne, zerstreut der Abgeordnete Jakobi mit Hunden in der Landeshauptstadt: „In München werden viele Tausend unnütze Hunde gehalten, die besser genährt und gefüttert werden oft als Tausende von Menschen“.
2. 1 1825 - Das Kgl. Hof- und Nationaltheater wird wiedereröffnet
München-Graggenau * Das vom Brand zerstörte Kgl. Hof- und Nationaltheater wird nach dem Wiederaufbau mit einem Prolog, einem baierischen Volkslied und dem Ballett „Aschenbrödel“ eröffnet. Die einzige bedeutende Veränderung am Theaterbau ist der Giebel, mit dem Leo von Klenze das Walmdach von Carl von Fischer ersetzt hat.
25. 2 1825 - Die dritte Ständeversammlung tagt
München-Kreuzviertel * Die dritte Ständeversammlung während der Regierungszeit von König Max I. Joseph tagt vom 25. Februar bis 12. September 1825.
1. 4 1825 - Auguste Friederike, Erzherzogin von Österreich, wird in Florenz geboren
Florenz * Auguste Friederike, Erzherzogin von Österreich und Prinzessin von Toskana, die spätere Ehefrau von Prinzregent Luitpold, wird in Florenz geboren.
Ab 8 1825 - Aus der ehemaligen Reitschule wird ein Bazar-Gebäude
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * An der Stelle der ehemaligen Reitschule entsteht das Bazar-Gebäude, ein für damalige Zeit hypermodernes Kaufhaus. Der Grundriss wird von Ulrich Himbsel entworfen. Für die Fassadengestaltung zeichnet Leo von Klenze verantwortlich.</p>
11. 9 1825 - Das Gesetz über das Gewerbewesen
München-Kreuzviertel - Königreich Baiern * Als drittes Gesetz wird zu den Bestimmungen über Heimat, Ansässigmachung und Verehelichung noch das Gesetz über das Gewerbewesen beschlossen, um „die Hindernisse des Kunstfleißes zu beseitigen“ und „die Ausbildung in den Gewerben zu befördern“. Während die Fabrikbesitzer die völlige Gewerbefreiheit fordern, wollen die Vertreter des Handwerks letztlich die bestehende Zunftverfassung behalten und sogar noch erweitern.
Die Ständeversammlung beschließt einen Kompromiss, in dem ein Konzessionssystem im Mittelpunkt steht. Danach ist die Ausübung eines Gewerbes von der Erteilung einer Gewerbekonzession abhängig. Diese wird von der staatlichen Polizeibehörde erstellt. Sie darf nicht versagt werden, wenn
- der Bewerber die erforderlichen Fähigkeiten besitzt und
- der Unterhalt der anderen Gewerbetreibenden durch die Erteilung der Konzession nicht gefährdet wird.
Die bestehenden Realrechte, worunter man die Verkäuflichkeit und Vererbbarkeit des Handwerks versteht, bleiben von dieser Reform ebenso wie die radizierten Gewerbe unberührt.
11. 9 1825 - Die Ständeversammlung verabschiedet drei Sozialgesetze
München-Kreuzviertel - Königreich Baiern * Die Ständeversammlung verabschiedet drei Gesetze, die als die ersten von einer bayerischen Volksvertretung verabschiedeten Sozialgesetze angesehen werden:
- Das Gesetz über die Heimat,
- das Gesetz über die Ansässigmachung und Verehelichung und
- das Gesetz über das Gewerbewesen.
11. 9 1825 - Jeder Staatsangehörige hat eine Heimat
München-Kreuzviertel - Königreich Baiern * Bedeutete bis dahin der Begriff „Heimat“ im wesentlichen Haus- und Grundbesitz, so wird jetzt das Recht auf Heimat, also Angehöriger einer Gemeinde zu sein, einklagbar.
Der Heimatberechtigte hat Anspruch auf Unterstützung durch seine Heimatgemeinde, wenn er sich selbst nicht mehr unterhalten kann. Das Gesetz besagt: „Jeder Staatsangehörige soll eine bestimmte Heimat haben.“ Jedermann besitzt entweder eine erworbene, eine ursprüngliche oder eine angewiesene Heimat. Durch das Heimatgesetz soll die „Heimatlosigkeit“ und damit die Zahl der Nichtsesshaften, der Vaganten und der „Gauner“ beseitigt werden.
Gleichzeitig entfällt der Erwerb des Heimatrechts nach einem Aufenthalt von zehn Jahren an einem Ort. Diese Vorgabe hat oftmals dazu geführt, dass Anwärter nach neun Jahren abgeschoben wurden. Ebenso wird die Geburt als Rechtstitel des Heimatrechts abgeschafft. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Schwangere abgeschoben wurden oder sogar kurz vor der Niederkunft aus dem Ort getrieben wurde.
11. 9 1825 - Das Gesetz über die Ansässigmachung und Verehelichung
München-Kreuzviertel - Königreich Baiern * Mit dem Gesetz über die Ansässigmachung und Verehelichung verfolgt der Staat vier Ziele:
- Vermehrung der Bevölkerung,
- Hebung des allgemeinen Wohlstands,
- Verbesserung der Sittlichkeit und
- Verringerung der Zahl der unehelichen Kinder.
Ansässigmachung ist ein Rechtsverhältnis, das zwischen einem (männlichen) Individuum und einer Gemeinde begründet wird. Voraussetzung für die Ansässigmachung ist
- der Besitz eines Grundvermögens,
- der Besitz eines realen, radizierten oder konzessionspflichtigen Gewerbes oder
- die definitive Einstellung in einem öffentlichen Amt des Staates, der Kirche oder einer Gemeinde oder
- ein anderweitig gesicherter Nahrungsstand.
- Die Erfüllung der Bestimmungen des Militärkonskriptsionsgesetzes,
- ein guter Leumund und
- den vorschriftsmäßigen Besuch des Schul- und Religionsunterrichts.
Der Ansässigmachungstitel beinhaltet die Erlaubnis zur Verehelichung. Bei Wiederverehelichung oder wenn zwischen Ansässigmachung und dem Heiratsgesuch ein längerer Zeitraum verstrichen ist, wird überprüft, ob die Voraussetzungen für die erteilte Ansässigmachung noch gegeben sind. So ist es möglich, auch einen Ansässigen Bewerber die Heiratserlaubnis zu verweigern.
12. 9 1825 - Graf Clemens Anton von Toerring-Seefeld will Haidhausen verkaufen
Haidhausen * Graf Clemens Anton von Toerring-Seefeld bietet dem Staatsministerium der Finanzen das Patrimonialgericht Haidhausen zum Kauf an.
27. 9 1825 - In der Erzgießerei wird ein Relief gegossen
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Leo von Klenze kann dem immer ungeduldiger werdenden Kronprinzen melden: <em>„Noch in dieser Woche wird das erste Stück, ein Basorelief, in der Erzgießerei gegoßen werden und ich hoffe, dass dann die Arbeit nicht mehr ausgehen wird“</em>.</p> <p>Bei diesem Relief handelt es sich um eine Grabplatte für die zwei Indianerkinder Juri und Mirhana, die die Naturforscher Johann Baptist von Spix und Karl Friedrich Philipp von Martius aus Brasilien mitbrachten, und die jeweils im Alter von 14 Jahren im Jahr 1822 kurz hintereinander starben.</p>
10 1825 - König Max I. Joseph nimmt letztmals am Oktoberfest teil
<p><strong><em>München-Theresienwiese</em></strong> * König Max I. Joseph, der <em>„Vater des Vaterlandes“</em>, nimmt letztmals am Oktoberfest teil. Er stirbt in der Nacht vom 12. zum 13. Oktober.</p>
10 1825 - Sanktionskaralog für Wiesnwirte
<p><strong><em>München-Theresienwiese</em></strong> * Nach einem Erlass der Polizeidirektion</p> <ul> <li>wird <em>„jeder Wirt, der als Folge einer polizeilichen Übertretung bestraft wird“</em>,</li> <li>zum Beispiel bei <em>„Nichteinhaltung der Polizeistunde, Unsauberkeit“ </em>oder <em>„nicht anständiger Bierpreis“</em></li> </ul> <p>mit dem Verlust der Ausübung seiner Wirtschaft auf der Theresienwiese bestraft.</p>
13. 10 1825 - König Ludwigs I. Lieblingsidee vom thronenden König
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Nach dem Tod König Max I. Josephs kehrt der neue Bayernregent Ludwig I. sofort wieder zu seiner Lieblingsidee des thronenden Königs auf dem Platz vor dem Hof- und Nationaltheater zurück. Auch in der Frage welcher Künstler das Monument ausführen soll, setze sich Ludwig durch. Der junge König hat bedeutende Künstler in seinem Blickfeld, die er zudem gerne an München binden will.</p>
15. 10 1825 - Prinzessin Marie Friederike von Preußen wird in Berlin geboren
Berlin * Prinzessin Marie Friederike von Preußen, die spätere Königin und Mutter Ludwigs II. wird in Berlin geboren.
20. 10 1825 - Bayern wird ab sofort mit einem „y“ geschrieben
München - Königreich Bayern * Nur zwei Tage nach seinem Regierungsantritt ordnet König Ludwig I. in einer Rechtschreibreform an, dass „Baiern“ in Zukunft „mit einem ‚y‘ statt mit einem ‚i‘ zu schreiben“ ist. Mit dem griechischen „y“ im Landesnamen will er seine Verehrung für den griechischen Befreiungskampf ausdrücken.
26. 10 1825 - König Ludwig I. favorisiert den Berliner Christian Daniel Rauch
München - Berlin * König Ludwig I. favorisiert den Berliner Christian Daniel Rauch, der als das Haupt der dortigen Bildhauerschule gilt. Gerade einmal 13 Tage nach dem Tod seines Vaters, Max I. Joseph, lässt er Klenze die Auftragserteilung für das Denkmal nach Berlin schicken.
31. 12 1825 - Der Englische Garten hat eine Größe von 231 Hektar
München-Englischer Garten * Der Englische Garten hat eine Größe von 231 Hektar.
1826 - Die Universität und das Georgianum werden nach München umverlagert
<p><strong><em>Landshut - München-Kreuzviertel</em> </strong>* Die Universität und das Georgianum werden von Landshut nach München umverlagert.</p>
1826 - Ein Hochwasser zerstört die „Wiebekingsche Brücke“
Bogenhausen * Ein Hochwasser zerstört die „Wiebekingsche Brücke“ bei Bogenhausen.
1826 - Der Schwabinger Wirt Johann Gradl kauft die „Neumühle“
München-Englischer Garten - Tivoli * Johann Jakob Schöttl junior verkauft die „Neumühle“ an den Schwabinger Wirt Johann Gradl.
1826 - Lola Montez kommt von Kalkutta ins südenglische Bath
Kalkutta - Bath * Die kleine Elizabeth Rosanna Gilbert, besser bekannt als Lola Montez, kommt von Kalkutta ins südenglische Bath, um im dortigen Internat eine standesgemäße Ausbildung zu erhalten.
1826 - Maulbeerbäume zur Züchtung der Seidenraupen werden angezogen
<p><em><strong>München</strong></em> * Auf Veranlassung von König Ludwig I. werden in den königlichen Hofgärten Maulbeerbäume zur Züchtung der Seidenraupen angezogen und später im ganzen Land verteilt. Bis zum Jahr 1836 sollen <em>„im Königreiche wenigstens vier Millionen Stück stehen“</em>.</p> <p>Die Verwaltung der Landeshauptstadt München beschließt daraufhin die Gründung der ersten städtischen Baumschulen im Garten der Landwirtschaftsschule an der Luisenstraße und auf der Kalkofeninsel, in denen rund zehntausend Maulbeerbäume aus Samen herangezogen werden, die drei bis vier Jahre später eine für die Raupenzucht geeignete Größe erreicht haben.</p>
1826 - Das Georgianum kommt in die Räume des ehemaligen Karmeliten-Klosters
<p><em><strong>Landshut - München-Kreuzviertel</strong></em> * Mit dem Umzug der Universität von Landshut nach München dienen die Räume des ehemaligen Karmeliten-Klosters zur vorläufigen Unterbringung des Georgianums, dem weltweit einzigen staatlichen Priesterseminar. Das Provisorium hält bis 1841.</p>
1826 - Ein kostengünstigerer Entwurf für die evangelische Matthäuskirche
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Oberbaurat Johann Nepomuk Pertsch erhält den Auftrag zur Erstellung eines kostengünstigeren Entwurfs für den Bau einer protestantischen Kirche in München. </p> <p>Als Standort für das evangelische Gotteshaus wird die Grünanlage in der Sonnenstraße festgesetzt. </p>
Im Jahr 1826 - Der Schlachtviehhandel „Auf den Lüften“ endet
<p><em><strong>München-Angerviertel - Au - Haidhausen</strong></em> * Ein neuer Viehmarkt wird zwischen Angertor und Einlaß eröffnet. Damit endet der Schlachtviehhandel <em>„Auf den Lüften“</em>.</p>
1826 - Das Haberfeldtreiben als einfältigen und tollen Spuk bezeichnet
<p><em><strong>Miesbach</strong></em> * Der Miesbacher Landrichter schreibt, dass es sich bei einem <em>Haberfeldtreiben</em> zwar um einen <em>„einfaltigen und tollen Spuk“</em> handle, den aber <em>„die Geistlichkeit als Strafe der Gefallenen gerne sieht“</em>.</p> <p>Es gibt sogar Geistliche, die sich gegen die eigene kirchliche Obrigkeit wenden und <em>„Schnaderhüpfel“</em> und so manchen Haberervers<em> </em>dichten. Diese sind in ihrer Ausdrucksweise schon nahe an der Pornographie. </p>
1826 - Die Geistlichkeit unterstützt die Haberfeldtreiber
<p><em><strong>Aibling</strong></em> * In einem Protokoll vom Aiblinger Landrichter heißt es über die Unterstützung des Pfarrers für das Haberfeldtreiben:</p> <p><em>„[…] wo schon mehrere denselben diesen Herrn als eine Sünde sollen gebeichtet haben, und aber der Pfarrer ihnen erklärt hätte, dass es keine Sünde sey, das Laster zu bestrafen; ja man behauptet sogar, dass die Geistlichen […] öffentlich in Wirtshäusern oder vielmehr in ihren eigenen pfarrlichen Zechstuben Lobreden auf dieses Haberfeldtreiben machen und, was leicht zu vermuten ist, jeden Meineid deswegen absolvieren“</em>. </p>
1826 - Joseph von Hazzi veröffentlicht sein Lehrbuch des Seidenbaus
<p><strong><em>München</em></strong> * Joseph Ritter von Hazzi veröffentlicht sein Lehrbuch des Seidenbaues. Im Vorwort heißt es: <em>„Es findet sich in dieser Schrift sowohl der kleinere als größere Seidenzieher den angemessenen Unterricht über alle Umstände des Seidenbaues, ja über alle, sogar tägliche nöthige Verrichtungen bey der ganzen Seidenzucht“</em>. </p>
7. 2 1826 - Grundsteinlegung für das Odeon an der Ludwigstraße
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Nachdem der Bankier Hirsch die notwendigen 256.644 Gulden vorfinanziert hat, kann der Grundstein für das Odeon, einem Konzertsaal<em> </em>an der Ludwigstraße, gelegt werden. </p>
3 1826 - Straßenbenennung nach den „Napoleonischen Befreiungskriegen“
München-Maxvorstadt * Die an die „Napoleonischen Befreiungskriege“ erinnernden Straßenumbenennungen erfolgen.
- Aus der Karolinenstraße bzw. Wilhelminenstraße wird die „Barer Straße“,
- aus der Ludwigstraße die „Arcisstraße“, die die heutige Katharina-von-Bora-Straße mit einschließt, die vor 1826 den Namen Amalienstraße trägt.
- Die Königsstraße, die ab dem „Königsplatz“ Kronprinzenstraße heißt und aus dem ehemaligen „Fürstenweg“ nach Nymphenburg entstanden sind, wird zur „Brienner Straße“.
Um 4 1826 - Wegen des neuen Königsbaues der Residenz entfällt die Exerzierstätte
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Der ganze Streit um die Belästigungen durch das Militär wird durch eine Anweisung König Ludwigs I. hinfällig, der wegen des neuen Königsbaues der Residenz der Artillerie den Max-Joseph-Platz als Exerzierstätte entzieht.</p>
7. 4 1826 - Der Grundstein für die Alte Pinakothek wird gelegt
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Der Grundstein für die Alte Pinakothek an der Barer Straße wird gelegt. </p>
25. 4 1826 - Christian Daniel Rauch gestaltet das Max-Joseph-Denkmal
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Christian Daniel Rauch übernimmt den Auftrag für das Max-Joseph-Denkmal, modelliert einen kleinen Bozzetto der Sitzfigur und kommt in der Zeit vom 25. April bis 13. Mai 1826 nach München.</p> <p>Da seine plastische Skizze von allen Seiten für gut befunden wird, beginnt man in München schon mal mit der Herstellung des Sockels.</p>
Um 8 1826 - Robert von Langer malt seine Haidhauser Villa mit Fresken aus
Haidhausen * In den Sommermonaten 1826 bis 1828 malt Robert von Langer, gemeinsam mit seinem Schüler August Riedel, den ansehnlichsten Raum seiner Haidhauser Villa an der heutigen Einsteinstraße mit Fresken aus.
Mit der Erschaffung des Freskenzyklus in seiner Künstlerresidenz will Robert von Langer wieder künstlerische Anerkennung erlangen und ein persönliches, weithin sichtbares Zeichen setzen.
27. 10 1826 - Der ledigen Wirtstochter von Thalham das Haberfeld getrieben
<p><em><strong>Thalham</strong></em> * In der Nacht vom 27. zum 28. Oktober 1826 wird der ledigen Wirtstochter von Thalham, der Theresia Kirchberger, das <em>„Haberfeld getrieben“</em>. Durch einen glücklichen Umstand wird dieses Treiben von einem Redakteur der Münchner Zeitung <em>„Der Bayerische Volksfreund“</em> mit verfolgt, sodass sich sogar einige Habererverse überliefert haben. </p>
15. 11 1826 - Die Universität wird von Landshut nach München verlegt
<p><em><strong>Landshut - München</strong></em> * Die Universität wird mit ihren rund achtzig Professoren und 1.500 Studenten von Landshut nach München verlegt. Der Akademiebetrieb wird im ehemaligen Jesuitenkolleg abgehalten. </p>
1827 - Die Fortsetzung der Ludwigstraße nach Norden angeordnet
München-Maxvorstadt - Schwabing * Die Fortsetzung der Ludwigstraße nach Norden bis zum Dorf Schwabing wird durch „Ministerialbeschließung“ angeordnet.
1827 - Aus dem „Schloss Neuberghausen“ wird eine Ausflugswirtschaft
Bogenhausen * Aus dem „Schloss Neuberghausen“ in Bogenhausen wird eine Ausflugswirtschaft, die die „Wirtin vom Tivoli“ betreibt.
1827 - Der „Kreuzlgießergarten“, der spätere „Salzburger Hof“ wird beschrieben
Haidhausen * Der „Kreuzlgießergarten“, der spätere „Salzburger Hof“ an der Ecke Gasteig und Rosenheimer Straße, wird folgendermaßen beschrieben:
„Das Wirtshaus ein Neubau, ebener Erde 2 Gastzimmer, ein Keller auf 40 Banzen Bier, ein geschlossener Hofraum, Stallungen für 20 Pferde, im ersten Stock ein geschmackvoller Tanz-Saal mit 3 Nebenzimmern“.
1827 - Reparaturarbeiten an der Berg am Laimer „Michaelskirche“ abgeschlossen
Berg am Laim * Die umfangreichen Reparaturarbeiten an den Türmen und Gesimsen sowie die neue Turmeindeckung mit Schindeln der „Michaelskirche“ in Berg am Laim werden abgeschlossen.
1827 - Herzog Max in Bayern sieht sich nach einem geeigneten Stadtpalast um
München-Graggenau * Offenbar will Graf Toerring das „Adelspalais“ an der heutigen Residenzstraße 2 bereits in den 1820er Jahren verkaufen.
Denn als sich Herzog Max in Bayern nach einem geeigneten Stadtpalast umsieht, wird ihm von Klenze das gegenüber der entstehenden „Königsresidenz“ gelegene „Palais“ schmackhaft gemacht.
Doch die Pläne des Herzogs zerschlagen sich.
1827 - Immanuel Kants Buch „Kritik der reinen Vernunft“ wird verboten
Rom-Vatikan * Immanuel Kants Buch „Kritik der reinen Vernunft“ wird wegen der darin enthaltenden Widerlegungen der Gottesbeweise vom Vatikan auf das „Verzeichnis verbotener Bücher“ gesetzt.
1827 - Seidenzucht und Seidenspinnerei als neuer Industriezweig in Bayern
Königreich Bayern * Die Seidenzucht und Seidenspinnerei lässt sich als neuer Industriezweig in Bayern nachweisen. Das dafür notwendige Fachwissen wird unter anderem durch Lehrbücher verbreitet, die auf dem Zentral-Landwirtschaftsfest erworben und gewonnen werden können.
1827 - Ein neues Futtermittel für Seidenraupen
Berg am Laim * In den Jahren von 1827 bis 1829 benutzt der Botaniker Alois Sterler in der ehemaligen Unterkunft des Franziskanzer-Hospiz neben der Berg am Laimer Michaelskirche einige Räume für seine „geheimnisumwitterten Experimente“.
Er soll ein neues Futtermittel für Seidenraupen entwickeln. Von den 300 Gulden, die er vom Fonds für Industrie als Unterstützung erhält, musste er jährlich 60 Gulden Miete an die Michael-Hofbruderschaft abführen.
1827 - Münchens Einwohnerschaft beträgt 76.117 Personen
München * Münchens Einwohnerschaft beträgt 76.117 Personen. Ein Zuwachs von 13.827 Menschen oder 22 Prozent in drei Jahren.
1827 - 1.227 eheliche und 1.028 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.227 eheliche und 1.028 uneheliche Kinder geboren.
1827 - In München gibt es drei öffentliche Aborte
<p><strong><em>München</em></strong> * In München gibt es drei öffentliche Aborte. Sie befinden sich an den Stadtbächen und sind einfache Bretterverschläge. Die Entsorgung der Ausscheidungen erfolgt in den nahegelegenen Bach, der später in die Isar mündet. </p>
4 1827 - Ioannis Antonios Graf Kapodistrias wird Griechenlands Präsident
Nauplia * Ioannis Antonios Graf Kapodistrias wird der erste Präsident Griechenlands.
Er gilt als Außenseiter, weshalb ihn die zerstrittenen Klans und Parteien als für ihre Interessen ungefährlich halten.
26. 4 1827 - Robert von Langer wird „Direktor der kgl. Sammlung“
München-Kreuzviertel * Robert von Langer wird „Direktor der kgl. Sammlung von Handzeichnungen, elfenbeinernen Schnitz-Werken, Miniatur-, Email- und Musiv- Arbeiten“.
Damit beendet er seine Tätigkeit an der „Akademie“.
26. 5 1827 - Die Haberer führen einen Doppelschlag aus
Steingraben bei Elbach - Großpienzenau * In der Nacht vom 26. zum 27. Mai 1827 führen die Haberer einen Doppelschlag aus.
- In Steingraben bei Elbach treibt man den beiden Bauerntöchtern Anna Kirchberger und Barbara Huber wegen ihres unsittlichen Lebenswandels und wegen ihrer unehelichen Kinder das Haberfeld.
- Kaum sind in Steingraben die letzten Schüsse verhallt, geht in dem drei Stunden entfernten Großpienzenau das Getöse los. Das „Treiben“ gilt hier der Bauerntochter Anna Taubenberger wegen „Umgangs mit mehreren Männern“. Neben der Anna werden noch „weitere Sünder ins Gebet genommen“.
Bei beiden „Treiben“ kann die Obrigkeit keine Spuren der Teilnehmer entdecken.
5. 8 1827 - Grundsteinlegung für die evangelische Matthäuskirche
München-Ludwigsvorstadt * Der Grundstein für die evangelische Matthäuskirche in der Sonnenstraße, der ersten protestantischen Kirche Münchens, wird gelegt.
20. 10 1827 - In der Seeschlacht von Navarino wird die türkische Flotte vernichtet
Navarino * In der Seeschlacht von Navarino versenkt die vereinigte britische, französische und russische Flotte sämtliche ägyptisch-türkischen Kriegsschiffe.
31. 10 1827 - Die Franziskaner treffen in Schwabing ein
Schwabing * Der Provinzial-Vikar der wiedererstandenen Franziskanerprovinz, Pater Johann Nepomuk Glöttner, trifft mit einigen Patres, Klerikern und Laienbrüdern von Ingolstadt kommend in Schwabing ein.
1. 11 1827 - Die Franziskaner kehren nach München zurück
München-Lehel * Mit der religiösen Restauration unter König Ludwig I. werden insgesamt 132 klösterliche Konvente in Bayern ins Leben gerufen. Jetzt kehren auch die Franziskaner nach München zurück. Gegen den Willen vieler Zeitgenossen und in völliger Verklärung der seinerzeitigen Ereignisse genehmigt König Ludwig I., „[...] eingedenk, dass Mitglieder dieses Ordens Unseren erhabenen Vorfahren Kaiser Ludwig den Bayer zu einer Zeit vertheidigt haben, in welcher dies mit größter Gefahr verbunden war“, die Niederlassung dieses Ordens im Lehel.
Am Allerheiligentag fahren die Franziskanermönche in sechs Wagen von Schwabing zur Sankt-Anna-Kirche im Lehel. „An der Brücke vor dem Kloster, wo bereits eine große Menschenmenge versammelt war, wurden sie vom Bürgermeister [...] und anderen Herren empfangen und unter Voraustretung der Laienbrüder [...] bis zur Türe der Pfarr- und nunmehr auch Klosterkirche geführt. Hier erwartete sie Stadtpfarrer Schuster und begleitete sie an den Choraltar. [...] Die ganze, sehr religiöse Feierlichkeit, wobei die Kirche bis zum Erdrücken angefüllt war, [...] wurde mit dem Te Deum beschlossen.“
Damit ist das Anna-Kloster im Lehel das Hauptkloster der wieder neu aufblühenden bayerischen Franziskanerprovinz. Seither befindet sich auch die Oberarm-Reliquie des heiligen Antonius in der Anna-Klosterkirche.
20. 12 1827 - Wieder keine Hinweise auf die Haberfeldtreiber
Großpienzenau * In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 1827 wird dann noch der 18-jährigen Tochter vom Seltenschmied, Ursula Menhofer, das Haberfeld getrieben. Da auch nach diesem Treiben die Bevölkerung verschwiegen bleibt, bringen die eingeleiteten Ermittlungen wieder keinerlei Hinweise auf die Täter.
In seiner Ohnmacht schlägt der Landrichter der Regierung von Oberbayern vor, künftig jede Gemeinde, „in welcher sich solche Ruhestörung ereignet, in eine ergiebige Geldstrafe nebst Bezahlung der Untersuchungskosten [zu] verurteilen“.
31. 12 1827 - In ganz Bayern gibt es etwas mehr als 350 Ziegeleien
Königreich Bayern * In ganz Bayern gibt es etwas mehr als 350 Ziegeleien.
1828 - Friedrich von Gärtner beginnt mit den Planungen zur „Ludwigskirche“
München-Maxvorstadt * Friedrich von Gärtner beginnt mit den Planungen zur „Ludwigskirche“.
1828 - Die „Notbrücke“ erhält den Namen „Ludwigsbrücke“
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Eine hölzerne, fünfbogige „Notbrücke“ über die Isar wird eingeweiht.
Sie erhält den Namen „Ludwigsbrücke“.
Sie ist bis dahin die einzige Isarüberführung zwischen Bogenhausen und Schäftlarn.
1828 - Der „Kreuzlgießergarten“ darf aufgestockt werden
Haidhausen * Dem Wirt des „Kreuzlgießergartens“ an der Rosenheimer Straße 1 wird die Aufstockung seines Gebäudes erlaubt.
1828 - Mit Adrian Dick kommt die erste protestantische Familie nach Giesing
Obergiesing * Mit Adrian Dick kommt die erste protestantische Familie nach Giesing.
Sie kommen aus der Rheinpfalz und schenken in seiner Gaststätte „Zum Weinbauern“ ihren Rebensaft aus.
1828 - Die „Erzgießerei“ muss erneut erweitert werden
München-Maxvorstadt * Die „Erzgießerei“ in der Sandstraße, nahe dem heutigen Stiglmaierplatz, muss für den Guss der „Max I. Joseph-Statue“ noch einmal erweitert werden.
1828 - Friedrich Bürklein studiert bei Friedrich von Gärtner
München-Maxvorstadt * Friedrich Bürklein studiert bei Friedrich von Gärtner an der „Akademie der Bildenden Künste“ in München.
Er wird nach Gottfried Semper der erfolgreichste und namhafteste Schüler dieses Architekturprofessors.
Da Bürklein völlig mittellos ist, muss er sich durch Stundengeben und Anfertigen von Bauzeichnungen sein Studium finanzieren.
1828 - 1.486 eheliche und 1.018 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.486 eheliche und 1.018 uneheliche Kinder geboren.
1828 - Militärisch Untaugliche wegen der Kinderarbeit
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * König Wilhelm III. beauftragt seinen Innenminister und seinen Kultusminister zur Erstellung eines Gesetzentwurfes zugunsten der Fabrikkinder. Allerdings geht es dem König vordergründig nicht um das Wohl der Kinder. Er hatte vielmehr festgestellt, dass die Soldaten in den Industriegebieten abnahmen und <em>„die Armeereserve nicht mehr vollständig zur Verfügung steht. Die Fabrik-, v.a. auch die Nacht- und Schichtarbeit im Kindesalter, haben einen Teil der Soldaten zu Schwächlingen und Krüppeln gemacht“</em>. </p> <p>Sowohl in England als auch in Preußen ist der Anteil für den Militärdienst Untauglicher in den industriellen Provinzen höher als in den ländlichen Bezirken. Dieser Unterschied ist sicher nicht nur durch die krankmachende Arbeit bedingt, sondern ebenso durch die schlechten Wohn- und Ernährungsverhältnisse. </p> <p>Die Arbeit an dem Gesetzentwurf zieht sich jahrelang hin, doch an der Situation der Kinder ändert sich nichts. </p>
6. 2 1828 - Geldstrafe und die Übernahme der Untersuchungskosten
München * Der gewünschte Regierungserlass, der jeder Gemeinde in der ein Haberfeldtreiben stattfindet eine Geldstrafe und die Übernahme der Untersuchungskosten auferlegt, wird erteilt.
10. 3 1828 - Das Odeon wird eröffnet
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Das von Leo von Klenze neu erbaute Odeon, ein Musiksaal mit hervorragender Akustik, wird eröffnet. Das Gebäude ist gegenüber dem Leuchtenberg-Palais entstanden und hatte sich diesem anzupassen, weshalb Leo von Klenze den Konzertsaal im Inneren des Neubaus versteckt. Es gibt deshalb kein natürliches Licht im 37 Meter langen Konzertraum. </p>
17. 4 1828 - Die Gemeinde Dettendorf wird für das Haberfeldtreiben verurteilt
Daxham bei Dettendorf * Die Gemeinde Dettendorf wird für das Haberfeldtreiben vom 17./18. April 1828 im zur Gemeinde gehörigen Daxham mit 50 Gulden verurteilt.
Der Rumor gilt der Dienstmagd Katharina Babel und dem Einödbauern Schnitzenbaumer, genannt Daxhammer, weil der verheiratete Bauer - trotz der Vorstellungen derGemeinde, des Pfarramts und des Landgerichts - nicht von der bei ihm in Diensten stehenden Magd abgelassen hatte. 14 Burschen veranstalten daraufhin das Haberfeldtreiben.
26. 4 1828 - Russland erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg
Petersburg - Konstantinopel * Russland erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg.
28. 4 1828 - Der Grundstein zum Herzog-Max-Palais wird gelegt
München-Maxvorstadt * Der Grundstein zum Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße wird gelegt.
16. 5 1828 - Der Magistrat der Vorstadt Au kauft den Mariahilfplatz
Vorstadt Au * Der Magistrat der Vorstadt Au kauft dem Staat den Mariahilfplatz ab.
8. 7 1828 - Graf Maximilian V. Franz Xaver von Preysing-Hohenaschau stirbt
München * Der 91-jährige Graf Maximilian V. Franz Xaver von Preysing-Hohenaschau stirbt.
1. 8 1828 - Den Franziskanern werden die pfarrherrlichen Aufgaben übertragen
München-Lehel * Den Franziskanern werden die pfarrherrlichen Rechte und Aufgaben im Lehel übertragen. Nun ist die Anna-Kirche zugleich Pfarr- und Klosterkirche der Franziskaner.
Nachdem ein Jahrhundert an dem Kloster und der Kirche genagt hatte, war eine Renovierung der Gebäude unumgänglich. Die dafür erforderlichen 34.319 Gulden sparen sich die über wenig Einkommen verfügenden Lechler vom Mund ab.
1. 9 1828 - Freiherr von Zentner muss zurücktreten
München-Kreuzviertel * Als Bauernopfer für die gescheiterte Stände-Versammlung muss der liberal gesinnte Freiherr von Zentner herhalten, der von dem als liberal geltenden Joseph Ludwig Graf von Armansperg, keine zwei Wochen nach dem Ende der Stände-Versammlung, ersetzt wird.
Armanspergs bisherige Aufgabe als Innenminister übernimmt der als konservativ geltende Eduard von Schenk. Er gilt König Ludjwig I. als wesentlich gefügiger als sein Amtsvorgänger, der die „Trennung von Religion und Staat“ vertritt.
9. 9 1828 - Herzog Max in Bayern heiratet die Königstochter Ludovica Wilhelmine
Tegernsee * Herzog Max in Bayern heiratet die Königstochter Ludovica Wilhelmine von Bayern in Tegernsee.
10. 11 1828 - Das Haidhauser Preysing-Schloss wird an Max Joseph Kaut verkauft
Haidhausen * Das Preysing-Schloss und der Garten in Haidhausen wird um 25.000 Gulden an den Handelsmann Max Joseph Kaut aus München verkauft.
10. 11 1828 - Das Haberfeldtreiben von Berbling bei Aibling
Berbling bei Aibling * Beim „Treiben von Berbling“ im Raum Aibling am 10. zum 11. November 1828 geht es um die Anna Mayr, die ledige Dorfschusters-Tochter, der man ein intimes Verhältnis mit einem verwitweten Bauern vorwirft, dem sie ein uneheliches Kind geboren hatte.
17. 11 1828 - König Ludwig I. vergeht die Lust am Liberalismus
München-Kreuzviertel * Die erste Stände-Versammlungen unter der Leitung von König Ludwig I. findet in der Zeit vom 17. November 1827 bis 18. August 1828 statt. Der bayerische Monarch ist gemeinsam mit seinem Leitenden Minister Georg Friedrich Freiherr von Zentner mit großen Erwartungen an dieses Zusammentreffen herangetreten. Die königlich angeordnete prunkvolle Eröffnung der Stände-Versammlung soll eine neue Ära einleiten.
Der Hinweis in Ludwigs Thronrede erweckt liberale Hoffnungen, auch wenn der König betont, dass ihm die Religion das Wichtigste sei. Das Einbringen von 39 Gesetzentwürfen in beide Kammern durch König Ludwig I. schürt die hohen Erwartungen zusätzlich.
Doch die Ernüchterung tritt auf beiden Seiten sehr schnell ein. Die Mandatsträger der beiden Kammer wollen sich nicht als bloße Erfüllungsgehilfen königlicher Politik verstanden wissen. Und der autokratische und ungeduldige Monarch zeigt sich enttäuscht von dem vielfältigen parlamentarischen Widerstand, den er nicht nach seinem Willen brechen kann. Deshalb vergeht ihm schlagartig die Lust am Liberalismus und an den Reformen.
Kaum hatte er die politische Verantwortung übernommen, soll sich bei ihm eine lebenslang anhaltende Entfremdung gegenüber der Verfassung einstellen.
31. 12 1828 - Seidenbau als Nebenverdienst
Königreich Bayern * Die Seiden-Deputation zählt bereits 82.844 Maulbeerbäume und 1,5 Millionen Sämlinge. In diesem Jahr bemühen sich „6 Lokalschulkommissionen, 4 Kultus-Kongresse, 4 Bezirks-Comites, 30 Landgerichte und 5.000 einzelne Individuen, die Seidenzucht einzuführen“.
Wie in anderen Ländern soll der Seidenbau ein einträglicher Nebenverdienst für das Gesinde, für Kinder sowie für „arme und alte Leute“ werden. Die Damen sollen sich die Seide für ihre Kleider und Möbel selbst herstellen können.
1829 - Der „Orden der Frauen vom guten Hirten“ wird in Angers gegründet
Angers * Der „Orden der Frauen vom guten Hirten“ wird in Angers, am Unterlauf der Loire, in Frankreich gegründet.
1829 - Für Unteroffiziere werden allmählich Einzelbetten eingeführt
München * Für Unteroffiziere werden allmählich Einzelbetten eingeführt.
1829 - In Wien entsteht die „Privilegierte Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“
Wien * Nachdem das „Osmanische Reich“ seine bisherige Kontrolle über die Donau verloren hat, entsteht in Wien die „Erste privilegierte Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“.
1829 - König Ludwig I. lässt Nanette Kaula für die „Schönheiten-Galerie“ malen
München * König Ludwig I. lässt Nanette Kaula als 17-jährige für die „Schönheiten-Galerie“ malen.
Sie trägt einen goldenen Pfeil in ihren dunklen Haaren.
Um 1829 - Der jüdische Mitbürger Raphael Kaula wird in den Adelsstand erhoben
München * Der jüdische Mitbürger Raphael Kaula wird er mit dem „Ritterkreuz des Ordens der Bayerischen Krone“ dekoriert und wird damit als „Baron de Murat“ in den Adelsstand erhoben.
1829 - Lorenz Schellerer übt das Amt des „Bayerischen Scharfrichters“ aus
München * Lorenz Schellerer, der ebenfalls in die Familie Reichhart eingeheiratet hat, übt das Amt des „Bayerischen Scharfrichters“ aus.
Er ist der Nachfolger von Jakob Keysser.
1829 - 1.548 eheliche und 1.128 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.548 eheliche und 1.128 uneheliche Kinder geboren.
22. 1 1829 - Therese Nockher verkauft das Nockher-Anwesen
Vorstadt Au * Therese Nockher verkauft das Nockher-Anwesen im Weiler Niedergiesing an ihren Nachbarn, den Krebsbauern Balthasar Peter um 12.000 Gulden.
15. 8 1829 - Grundsteinlegung für die Ludwigskirche
München-Maxvorstadt * Der Grundstein für die Ludwigskirche wird gelegt.
14. 9 1829 - Sultan Mahmud II. stimmt der Gründung des Staates Griechenlands zu
Adrianopel * Im Frieden von Adrianopel wird der türkisch-russische Krieg beendet. Sultan Mahmud II. stimmt der Gründung des autonomen Staates Griechenlands zu. Das Staatsgebiet Griechenlands ist allerdings nur etwa halb so groß wie heute.
10 1829 - Ein früherer „Wiesnbeginn“ wird vorgeschlagen - und abgelehnt
München-Theresienwiese * Wegen der oft ungünstigen Witterung im Oktober wird für den „Wiesnbeginn“ den 3. Sonntag im September vorgeschlagen.
Der Magistrat lehnt dieses Ansinnen mit der Begründung ab:
„Weil bey dem Oktober-Feste die umliegenden änger vieler Privater begangen und befahren werden, was den bestehenden Kulturverordnungen gemäß vor Michaeli um so weniger geschehen darf, da in hiesiger Gegend das Grumet vor Ende September nicht eingebracht wird“.
10 1829 - Die „Wiesn“ wird witterungsbedingt um acht Tage verlängert
München-Theresienwiese * Am Eröffnungstag des „Oktoberfestes“ regnet es so stark, „dass selbst der königliche Pavillon keinen Schutz mehr gewährte“.
Vier Tage später setzen starke Schneefälle ein. „Alle Buden waren geschlossen, die Theresienwiese verödet“.
Zum Ausgleich wird die „Wiesn“ um acht Tage verlängert.
Da aber das Wetter auch weiterhin kalt und nass ist, kommen nur wenige Besucher.
1830 - Die Biereinfuhr nach München beträgt 8.659 Hektoliter
München * Die Biereinfuhr nach München beträgt 8.659 Hektoliter.
Um 1830 - Das „Jodeln“ wird in den „Vorstadt-Theatern“ sozusagen „erfunden“
München - Wien * Das „Jodeln“ wird in den „Vorstadt-Theatern“ in Wien und München „erfunden“.
Freilich hat das „Jodeln“ eine alpenländische Tradition, deren Ursprünge auf vorhistorische Zeiten zurückreichen.
In allen gebirgigen und unwegsamen Regionen der Welt gibt es verschiedene Techniken, um mit Rufen weite Distanzen akustisch zu überbrücken.
Jodelnd verständigten sich Hirten und Sammler, Waldarbeiter und Köhler.
Nicht nur in den Alpen wurde von Alm zu Alm mit „Almschrei“ (Almschroa) oder „Juchzer“ (Juchetzer, Jugitzer, Juschroa) kommuniziert oder auch das Vieh mit einem „Jodler“ (Viehruf) angelockt.
Dennoch wird das „Jodeln“ erst als Unterhaltungseinlage in den „Vorstadttheatern“ und „Singspielhallen“ populär gemacht.
Erst von dort aus kommt es von gastierenden Künstlern aufs Land.
Um 1830 - Der Begriff „Industrielle Revolution“ wird erstmals verwendet
München * Der Begriff „Industrielle Revolution“ wird erstmals verwendet.
1830 - Die „Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ lässt ihr erstes Schiff vom Stapel
Wien * Die „Erste privilegierte Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ lässt ihr erstes Schiff vom Stapel.
1830 - In München leben 825 Juden
München * In München leben 825 Juden.
1830 - Der Schwabinger Wirt Georg Ferstl kauft das „Murat-Schlössl“
München-Englischer Garten - Tivoli * Der Schwabinger Wirt Georg Ferstl kauft das „Murat-Schlössl“ und eröffnet darin seine Gaststätte „Zum Tivoli“.
Dort gibt es auch eine einfache Badeanstalt.
Im Winter wird die Wiese durch Spritzen zur beliebten Eislaufbahn.
Außerdem gibt es einen „Kaffeepavillon“ und ein Kinderkarussell.
Damit wird Georg Ferstl „Tivoli“ ein beliebtes Ausflugslokal der Münchner.
Es besteht bis zum Jahr 1923.
Bald heißt auch die ganze Gegend ums Wirtshaus „Am Tivoli“.
1830 - Die „Cholera“ erreicht erstmals Europa
Indien - Europa * Die „Cholera“, die lange Zeit endemisch in Indien beheimatet war, erreicht - durch intensiven Handel, Reiseverkehr und Krieg - erstmals Europa.
Die Erkrankung beginnt mit sturzbachartigen Durchfällen und Dauererbrechen.
Der mit der „Cholera“ infizierte verliert am Tag bis zu 15 Liter Körperflüssigkeit, sodass die erkrankte Person innerhalb weniger Stunden zu einer „verrunzelten Karikatur ihres früheren Ichs zusammenschrumpft“.
Geplatzte Kapillargefäße verfärben die Haut schwarz und blau, der Kranke wird von Krämpfen geschüttelt, die Organe versagen, der Kreislauf bricht zusammen, das Herz stolpert und die Nieren arbeiten nicht mehr.
Die Temperatur kann bis auf 20 Grad absinken, weshalb die „Cholera“ auch „Kalte Pest“ genannt wird.
Der Tod tritt in drei bis fünf Tagen ein, oft aber schon nach wenigen Stunden.
Die Verbreitung der Krankheit erfolgt hauptsächlich über das Trinkwasser, das mit Exkrementen von „Cholera-Kranken“ verunreinigt ist.
Einen weiteren Übertragungsweg bilden Nahrungsmittel, die mit verseuchtem Wasser und ohne Erhitzung zubereitet werden.
Eine Ansteckung ist nur möglich, wenn der Erreger über den Mund in den menschlichen Verdauungstrakt gelangt.
Dabei reicht schon eine Berührung der Lippen mit infizierten Händen aus.
1830 - Friedrich Bürklein macht das Abitur nebenher
München-Maxvorstadt * Da eine neue Verordnung, den Eintritt in den „höheren Staatsdienst“ betreffend, die Absolvierung des Gymnasiums fordert, bereitet sich Friedrich Bürklein nebenher auch noch auf das Abitur vor, das er im Jahr 1830 mit Auszeichnung besteht.
Auf der „Akademie“ gehört er bald zu den besten Schülern Gärtners, vertritt den Professor häufig im Unterricht und wird von ihm auch zu Bauführungen herangezogen.
1830 - Die bayerische „Post“ erzielt einen hohen Gewinn
München * Die bayerische „Post“ erzielt alleine aus Briefportoeinnahmen 663.956 Gulden Gewinn.
Nur diese Zahlen faszinierten den König.
Da König Ludwig I. die „Post“ als Anstalt zur Erzielung von Einnahmen sieht, unterstellt er die „Generaldirektion der königlichen Posten“, samt seiner sieben „Postämter“, 22 „Postverwaltungen“, 175 „Postexpeditionen“, 16 „Posthaltereien“ und neun „Briefsammlungen“ dem „Staatsministerium der Finanzen“.
1830 - In München wohnen 6.000 Protestanten
München * Die evangelische Gemeinde in München ist auf 6.000 Mitglieder angewachsen.
1830 - München hat 77.802 Einwohner
München * München hat 77.802 Einwohner.
1830 - 1.503 eheliche und 1.070 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.503 eheliche und 1.070 uneheliche Kinder geboren.
1830 - München hat 77.802 Einwohner
München * München hat 77.802 Einwohner.
14. 2 1830 - König Ludwig I. gründet die „Oberste Baubehörde“
München * König Ludwig I. erlässt eine „Verordnung die Zusammenlegung des Gesamten Bauwesens betreffend“.
Er gründet damit die „Oberste Baubehörde“ und macht seinen „Hofbauintendanten“ Leo von Klenze zum Chef der Behörde.
Dieser nimmt als erstes Großprojekt die „Alte Pinakothek“ in Angriff.
1. 5 1830 - Das Schweiger-Theater hinterm „Gasthof zum Kaisergarten“
<p><strong><em>Vorstadt Au</em></strong> * Josef Schweiger tritt mit seinem Ensemble in seinem Theaterbau im Garten des <em>„Gasthauses zum Kaisergarten“</em> in der Vorstadt Au, in der heutigen Lilienstraße 42, auf.</p> <p>Die Spielzeiten des <em>„Schweigerischen Volkstheaters in der Vorstadt Au“</em> dauert von Ende April bis Ende September. Täglich finden zwei Aufführungen statt. Josef Schweigers <em>Holztheater</em> bietet Platz für bis zu 500 Zuschauer. Der billigste Platz kostet 6 Kreuzer, was dem Preis einer Maß dunklen Bieres entspricht. Dies können sich auch die weniger bemittelten Theaterbesucher leisten.</p> <p>Da man der <em>„Schweigerbühne“</em> eine <em>„Sitten zerrüttende Wirkung auf das Publikum“</em> nachsagt, lebt Josef Schweiger in ständigem Kampf um die Theaterkonzession. </p>
27. 5 1830 - Den Maurermeistern das Anfertigen von Bauplänen verboten
München * Die Privilegien der Münchner Maurermeister werden beschnitten. Jetzt wird ihnen durch eine Verordnung das Anfertigen von Bauplänen verboten.
27. 7 1830 - In Frankreich kommt es zur Juli-Revolution
Paris * Zwischen dem 27. und dem 29. Juli 1830 kommt es in Frankreich zur sogenannten „Julirevolution“, bei der der restaurative Bourbonenkönig Karl X. gestürzt und durch den liberalen Bürgerkönig Louis-Philippe ersetzt wird.
Da diese liberale Bewegung in ganz Europa Auftrieb erhält und es in mehreren Staaten des Deutschen Bundes wie dem Königreich Sachsen, dem Königreich Hannover, dem Großfürstentum Hessen-Kassel und dem Herzogtum Braunschweig zu Unruhen und neuen Verfassungen kommt, erhöht sich beim bayerischen König - völlig berechtigt - auch die Angst vor einem Umsturz, weshalb seine Politik - spätestens jetzt - extrem konservative Züge annimmt. In König Ludwigs I. Regierungszeit gibt es fast 1.000 politische Prozesse.
18. 8 1830 - Franz Joseph, der spätere Kaiser von Österreich-Ungarn wird geboren
Wien * Franz Joseph, der spätere Kaiser von Österreich-Ungarn wird in Wien geboren.
25. 8 1830 - Das Auer Rathaus am Mariahilfplatz wird eröffnet
Vorstadt Au * Das Auer Rathaus am äußeren Ende des Mariahilfplatzes wird eröffnet.
30. 9 1830 - Die Leihanstalt in städtischer Verwaltung
München * Die Leihanstalt wird dem Magistrat der Stadt München zur eigenen Verwaltung übergeben.
10 1830 - Die Ausgaben für das „Oktoberfest“ belaufen sich auf 6.500 Gulden
München-Theresienwiese * Die Ausgaben der Stadt für das „Oktoberfest“ belaufen sich auf 6.500 Gulden.
Das Geld wird gebraucht
- für zwei „Pferderennen“,
- das „Vogel-, Hirsch- und Scheibenschießen“,
- das „Ringelstechen“,
- für ein „Feuerwerk“ sowie
- den „Empfang des Königs“.
10 1830 - Erstmals wird auf dem „Oktoberfest“ ein „Ringelstechen“ veranstaltet
München-Theresienwiese * Erstmals wird auf dem „Oktoberfest“ ein „Ringelstechen“ veranstaltet.
26 Reiter treten gegeneinander an.
Sie müssen nach einer Anlaufdistanz mit einer Lanze einen Eisenring aufspießen.
22. 10 1830 - Aloys (Louis) Graf von Arco-Stepperg heiratet Irene Marchesa Pallavicini
Wien * Der 21-jährige Aloys (Louis) Graf von Arco-Stepperg heiratet in der Jesuitenkirche am Hof in Wien die 19-jährige Irene Marchesa Pallavicini.
Ab 24. 12 1830 - Nächtliche Ruhestörungen durch Studenten
München * Bis zum 29. Dezember kommt es in München zu nächtlichen Ruhestörungen durch Studenten. Gegen diese sogenannten „Dezember-Unruhen“ werden auf königlichen Befehl hin Landwehr und Linientruppen eingesetzt.
30. 12 1830 - Schließung der Universität wieder zurückgenommen
München-Kreuzviertel * König Ludwig I. muss die am Tag zuvor angeordnete Schließung der Universität auf Bitten der Bürgerschaft wieder zurücknehmen. Die Ausschreitungen waren vollkommen unpolitisch motiviert.
1831 - Die Eingemeindung der Au wird von der Staatsregierung abgelehnt
München - Vorstadt Au * Die bayerische Staatsregierung entscheidet abschlägig über die Eingemeindung der Au.
Es soll alles unverändert bleiben.
1831 - Der „Fischmarkt“ findet auf dem heutigen „Viktualienmarkt“ statt
München-Graggenau - München-Angerviertel * Der „Fischmarkt“, der bisher am „Fischbrunnen“ auf dem „Schrannenmarkt“ abgehalten wurde, findet auf dem heutigen „Viktualienmarkt“ statt.
1831 - Ein zweiter Flussübergang über die Isar
München-Isarvorstadt * Mit der hölzernen „Reichenbachbrücke“ kommt ein zweiter Flussübergang über die Isar hinzu.
Nach 1831 - Der Namensgeber Georg von Reichenbach
München-Isarvorstadt * Die Reichenbachstraße und Reichenbachbrücke wird nach Georg von Reichenbach benannt.
Die Büste des Mitglieds der „Baierischen Akademie der Wissenschaften“ wurde inzwischen in der „Ruhmeshalle“ aufgenommen.
1831 - Nur die Giesinger befugt, den „Malzaufschlag“ einzubeziehen
Vorstadt Au - Untergiesing * Nach einer Entschließung der königlichen Regierung sind nur die Giesinger befugt, den „Malzaufschlag“, eine Steuer für das in der „Irrenanstalt“ ausgeschenkte Bier, einzuziehen.
1831 - Über Russland und Polen gelangt die „Cholera“ nach Preußen
Preußen * Über Russland und Polen gelangt die „Cholera“ nach Preußen und von dort nach England.
Kuriose Vorschläge zur Bekämpfung der Seuche tauchen auf.
So schreibt die Freiin Caroline von Maiern in einer in Nürnberg erschienenen Flugschrift „Entdeckung des Geheimnisses der Cholera“ folgendes:
„Von Polizei wegen sollte Männern ein anderes Zeichen ihres Grußes bewilligt werden, als auf offener Straße ihre Hüte und Mützen abzuziehen, weil das Choleragift sehr leicht dem Haare sich mitteilt.
Und ferner sollte die Polizei das Tabakrauchen auf offener Straße erlauben, um das Miasma [„Choleradunst“] auch durch den Rauchtabak zu verscheuchen“.
Eine andere Schrift, die auch in München auftaucht, will Händler, „welche aus angesteckten Ländern kommen“, in eine vierzigtägige Quarantäne stecken.
Mitgeführte Papiere sollten geräuchert, Nahrungsmittel in Essig getaucht werden.
Auch Geld sollte nicht aus der fremden Hand genommen werden. Es sollte ebenfalls zuvor in Essig gelegt werden.
Die Schrift endet mit der Drohung: „Diejenigen, welche gegenwärtigen Vorschriften keinen Glauben schenken, werden sich der Gefahr aussetzen, ihren Unglauben mit dem Leben zu büßen“.
1831 - Ferdinand von Hompesch stirbt
Berg am Laim * Der Berg am Laimer „Hofmarkbesitzer“ Ferdinand von Hompesch stirbt.
Sein Nachfolger wird Wilhelm von Hompesch.
1831 - Luigi Tambosi kauft das bereits von ihm betriebene „Hofgarten-Café“
München-Graggenau * Das bereits von Luigi Tambosi betriebene „Hofgarten-Café“ geht um 30.000 Gulden von Simon von Eichthal und Ulrich Himpsel in dessen Eigentum über.
1831 - 1.511 eheliche und 1.182 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.511 eheliche und 1.182 uneheliche Kinder geboren.
1831 - Uneheliche Geburten im Königreich Bayern
Königreich Bayern * Die Quote der unehelich geborenen Kinder liegt im Königreich Bayern bei 21,5 Prozent.
28. 1 1831 - König Ludwig I. erlässt eine Pressezensur
München * König LudwigI. schränkt die Pressefreiheit durch starke Zensurbestimmungen für die innenpolitische Berichterstattung in der Tages- und Wochenpresse ein.
Zuvor hatte er drei aus dem Ausland stammende Publizisten des Landes verweisen lassen. Die Maßnahmen führen zu einer politischen Entrüstung der liberal eingestellten Bevölkerung, die in der Pressefreiheit ein extrem schützenswertes Gut sieht.
20. 2 1831 - Teilnahme an der Ständeversammlung verweigert
München-Kreuzviertel * Die zweite Ständeversammlung in Ludwigs I. Regierungszeit beginnt. Die Sitzungsperiode dauert bis zum 29. Dezember 1831.
Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer sind im Dezember des Vorjahres neu gewählt worden. Das Ergebnis brachte 62 Abgeordnete auf die christlich-konservative Regierungsseite und 66 Abgeordnete auf der fortschrittlich-liberale Bank der Opposition.
Weil der Monarch mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden ist, macht er von seinem ihm verfassungsgemäß zustehenden „Ausschließungsrecht“ bei fünf zur Opposition zählenden Abgeordneten Gebrauch und verweigert ihnen die Teilnahme an der Ständeversammlung.
22. 5 1831 - Innenminister Eduard von Schenk zum Rücktritt gezwungen
München-Kreuzviertel * Die schwäbischen und fränkischen Oppositionellen zwingen in der Frage der Pressefreiheit - sehr zum Ärger von König Ludwig I. - den Innenminister Eduard von Schenk zum Rücktritt. Dadurch muss König Ludwig I. die Zensurverordnung wieder zurücknehmen, was allerdings nichts an der Praxis der Zensur ändert.
12. 6 1831 - König Ludwig I. muss die von ihm eingeführte Zensur zurücknehmen
München * König Ludwig I. muss die von ihm am 28. Januar eingeführte Zensur für periodisch erscheinende Blätter auf dem Gebiet der Innenpolitik wieder zurücknehmen.
21. 6 1831 - Das Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße ist fertiggestellt
München-Maxvorstadt * Das Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße ist fertiggestellt.
7. 8 1831 - Das Bezirksamt links der Isar bezieht das ehemalige Kloster am Lilienberg
Vorstadt Au * Das ehemalige Kloster am Lilienberg wird zum Amtssitz des Bezirksamtes links der Isar.
7. 8 1831 - Das Landgericht Au wird nach Steuerdistrikten gebildet
München - Ramersdorf * Das Landgericht Au wird nicht nach bürgerlichen Gemeinden, sondern nach Steuerdistrikten gebildet. Nun überträgt man auch die Zuständigkeit des Gerichtsbezirks auf dieses Gebiet. Dadurch entstehen für Ramersdorf problematische Abläufe im Gemeindeleben, weshalb sich der Gemeindevorstand mehrfach beklagt - und Erfolg hat.
19. 8 1831 - Der Farbenfabrikant Michael Huber kauft das Schlossgutes Haidenberg
Haidhausen * Der aus Haidhausen stammende Farbenfabrikant Michael Huber kauft das Anwesen des Schlossgutes Haidenberg in Haidhausen für seine Fertigung von Farbprodukten.
13. 9 1831 - Überarbeitung des Ansässigkeitsgesetzes gefordert
München-Kreuzviertel * Eine überwältigende Mehrheit der Abgeordnetenkammer fordert, dass bei der Verleihung eines Gewerbes „nicht bloß der Nahrungsstand des Bewerbers, sondern auch jener der bereits Berechtigten berücksichtigt werde“.
17. 9 1831 - Die Abgeordneten des Bayerischen Landtags beraten über das Budget
München-Kreuzviertel * Die Abgeordneten des Bayerischen Landtags beraten über das Budget. Um die Abgeordneten zur Eile und damit zu nicht allzu gründlicher Beratung der Einzelposten zu zwingen, lässt König Ludwig I. - angesichts der herannahenden Cholera - verkünden, die Abgeordneten hätten so lange auszuharren, bis das Budget vereinbart ist.
- Die Abgeordneten kürzen den Gesamtetat von 28 auf 26,8 Millionen Gulden,
- die Zivilliste des Königs von 3,15 Millionen auf 2,5 Millionen Gulden
- und den Heeresetat von 6,7 auf 5 Millionen.
Innerhalb dieser Kürzungen beschließen sie zahllose Umverteilungen von Ausgabeposten sowie neue Ausgaben. Gekürzt wird bei den königlichen Prestigeobjekten Alte Pinakothek, Staatsbibliothek und Odeon sowie den Ausgaben für die zahlreichen wiedererrichteten Klöster. Mehr Geld soll dagegen in die Rechtspflege, die innere Verwaltung und das Bildungswesen fließen.
Für den König bedeutet dieses Verhalten „Anmaßung und Eingriff in die Exekutive“. Zum Glück gibt es noch die Erste Kammer, die Kammer der Reichsräte, die umgehend ihr Veto gegen die Kürzungen und Umverteilungen einlegt - und damit die Regierung rettet.
Unter dem Druck der Regierung, die sogar mit der Auflösung der Abgeordnetenkammer droht, knicken viele Abgeordnete ein. Dabei werden die Kürzungen der königlichen Zivilliste weitestgehend zurückgenommen. Die anderen Etatkürzungen fallen nicht so extrem aus, sodass immerhin noch 2 Millionen Gulden eingespart werden.
9. 10 1831 - Der erste griechische Präsident wird ermordet
Nauplia * Der erste griechische Präsident, Ioannis Antonios Graf Kapodistrias, wird in Nauplia auf dem Weg zur Kirche ermordet.
18. 10 1831 - Der Grundstein für die Walhalla wird gelegt
Donaustauf * Der Grundstein für die Walhalla bei Donaustauf wird gelegt.
Um den 1. 11 1831 - Prinz Carl lehnt die griechische Königskrone ab
München * Die Griechen und die griechischen Schutzmächte Großbritannien, Frankreich und Russland erhoffen sich durch einen über den Parteien stehenden, neutralen „christlichen erblichen Fürsten“ das Land stabilisieren zu können. Da England, Frankreich und Russland um die Einflussnahme in Griechenland konkurrieren, soll der künftige Herrscher jedoch einem politisch eher unbedeutendem Fürstenhaus entstammen.
Eine Wahl fällt auf den bayerischen Prinzen Carl, dem jüngeren Bruder König Ludwigs I.. Als ihm über die französische Regierung - vom Bruder nachhaltig unterstützt - die griechische Königskrone angetragen wird, macht dieser aber keinen Hehl daraus, dass ihm an Politik und Macht nichts liegt und er in Hinblick auf die Krone keinerlei Ehrgeiz entwickelt.
Prinz Carl widmet sich lieber seiner militärischen Karriere und seiner Familie. Ohne auch nur nachzudenken, lehnt er deshalb das Angebot umgehend ab. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Lage Griechenlands ist desolat. Das Land ist ausgeblutet und wirtschaftlich kaum entwickelt.
1832 - Gründung der „Armen-Industrie-Schule“ durch Pfarrer Hermann Rabl
Vorstadt Au * Gründung der „Armen-Industrie-Schule“ durch Pfarrer Hermann Rabl.
Ziel ist die „Erziehung der verwahrlosten Jugend zu aufrichtig frommen und wahrhaft tugendhaften Christen und zu rechtschaffenden, arbeitsamen, häuslichen und überhaupt wohlgesitteten Menschen“.
1832 - Erstmals kommt Natureis zur Kühlung der Bierkeller zur Anwendung
München * In der Brausaison 1832/33 kommt erstmals Natureis zur Kühlung der Bierkeller zur Anwendung. Bis dahin bewerkstelligte man die Kühlung lediglich durch Kaltluftzufuhr.
1832 - Ein künstlicher Hügel wird im „Englischen Garten“ aufgeschüttet
München-Englischer Garten - Lehel * Ein künstlicher Hügel wird im „Englischen Garten“ aufgeschüttet.
Ziegelfundamente in fast gleicher Höhe wie der „Monopteros“ selbst, geben dem Kunstberg den nötigen Halt.
Der Hügel besteht aus Ziegelsteinen, Resten der Stadtbefestigung und angefallenem Erdreich.
1832 - Neuverputzung der Westfassade der „Michaels-Kirche“ in Berg am Laim
Berg am Laim * Außenputzarbeiten und Neuverputzung der Westfassade der Kirche „Sankt Michael“ in Berg am Laim.
1832 - Die Post wird dem Ministerium des Königlichen Hauses unterstellt
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Post wird wieder dem Ministerium des Königlichen Hauses und des Äußeren unterstellt. Aus Angst vor einer Revolution - in Frankreich findet im Jahr 1830 die<em> „Julirevolution“</em> statt - will der Bayernherrscher die politische Kontrolle über die Post ausüben.</p> <p>Daran scheitert auch eine Privatisierung der Post, für die das Haus Thurn und Taxis ein entsprechend großzügiges Angebot offeriert hatte.</p>
1832 - Der Anstoß für die 1.664 Meter lange „Maximilianstraße“
München * Der 21-jährige bayerische Kronprinz Max II.
- hat die Idee einer „Akropole“ zur „Hebung des monarchischen nationalen Volksgeistes“
- und beabsichtigt, „auf der Isaranhöhe einen großen Nationalbau, einen Park, eventuell sogar einen neuen Stadtteil anzulegen”.
Das ist der Anstoß für die 1.664 Meter lange „Maximilianstraße“.
1832 - 1.456 eheliche und 1.206 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.456 eheliche und 1.206 uneheliche Kinder geboren.
1 1832 - Die „Cholera“ tritt in Frankreich auf
Frankreich * Die „Cholera“ tritt in Frankreich auf und verbreitet sich von da aus über die ganze Erde.
19. 1 1832 - Der Verein zur Abwehr von staatlichen Eingriffen in die Pressefreiheit
Bubenhausen * Auf Initiative von Johann Georg August Wirth gründet sich in Bubenhausen der „Preß- und Vaterlandsverein zur Abwehr von staatlichen Eingriffen in die Pressefreiheit“.
- Mit ihm will er die Arbeit der liberalen Journalisten unterstützen.
- Durch eine freie, unzensierte Presse sollte die öffentliche Meinungsbildung bis hin zur grundlegenden Staatsveränderungen geschaffen werden.
- Der Verein sollte den Journalisten und ihren Familien ein festes Einkommen sichern und Vertriebswege schützen.
13. 2 1832 - Die Großmächte bieten Kronprinz Otto die griechische Krone an
London - Petersburg - Paris - München * Nachdem Prinz Carl die griechische Krone ausgeschlagen hat, wählen die drei Schutzmächte England, Russland und Frankreich Carls Neffen Otto, den zweitgeborenen, erst 16-jährigen Sohn König Ludwigs I., zum griechischen König.
1. 3 1832 - Der Preß- und Vaterlandsverein wird verboten
München * Der „Preß- und Vaterlandsverein zur Abwehr von staatlichen Eingriffen in die Pressefreiheit“ wird verboten. Johann Georg August Wirth wird zwei Wochen später wegen Hochverrats verhaftet.
14. 4 1832 - Johann Georg Wirth von der Anklage des Hochverrats freigesprochen
<p><strong><em>Zweibrücken</em></strong> * Das Schwurgericht in Zweibrücken spricht Johann Georg August Wirth von der Anklage des Hochverrats wieder frei. </p>
18. 4 1832 - Einladung zur Verfassungsfeier
Hambach * In verschiedenen rheinbayerischen Zeitungen wird ein Aufruf veröffentlicht, der zu einer „Feier des Jahresgedächtnisses der Verkündigung der Verfassungsurkunde am 26. Mai 1818“ für den 26. Mai 1832 auf die als Ausflugsort genutzte Hambacher Schlossruine einlädt.
19. 4 1832 - Erste vorsorgliche Hinweise über die Cholera
<p><strong><em>München</em></strong> * Das Bayerische Innenministerium befasst sich mit der Cholera und gibt erste vorsorgliche Hinweise an die Bevölkerung.</p>
20. 4 1832 - Einladung für ein Volksfest auf dem Hambacher Schloss
<p><strong><em>Neustadt</em></strong> * 32 Neustadter Bürger laden zu einem Volksfest ein, das der <em>„politischen Diskussion über die Gestaltung eines demokratischen Nationalstaats und über die Mittel zu seiner Durchsetzung“</em> gewidmet ist. Der Kreis der Einladenden für das <em>„Volksfest auf dem Hambacher Schloss“</em> setzt sich überwiegend aus wohlhabenden Geschäftsleuten und Gutsbesitzern zusammen. </p> <p>Als äußeres Zeichen dafür, dass das Fest einem künftigen und nicht bereits erreichten politischen Ziel gilt, wird es vom bayerischen Verfassungstag am 26. auf den 27. Mai verschoben. Das ist zudem ein Sonntag und damit für die arbeitende Bevölkerung ein wesentlich günstigerer Termin. Ausdrücklich werden auch die Frauen zu dieser politischen Versammlung aufgerufen. </p>
29. 4 1832 - Zeitungsartikel und Flugblätter laden zum Hambacher Fest ein
Hambach * Der Festausschuss für das Volksfest auf dem Hambacher Schloss veröffentlicht Zeitungsartikel und Flugblätter für das Hambacher Fest am 27. Mai 1832.
7. 5 1832 - Die Bedingungen für König Otto auf dem griechischen Thron sind festgelegt
London * Im Londoner Vertrag werden die Bedingungen für die Einsetzung des bayerischen Kronprinzen Otto auf dem griechischen Thron detailliert festgelegt. Im Königreich Bayern wird die Berufung mit Stolz und Begeisterung aufgenommen.
8. 5 1832 - Die Rheinbayerische Kreisregierung verbietet das Hambacher Fest
Hambach * Die Rheinbayerische Kreisregierung unter der Leitung von Ferdinand Freyherr von Adrian-Werburg verbietet das „Hambacher Fest“. Begründet wird das Verbot mit
- der Ungesetzlichkeit des Versammlungszwecks,
- der politischen Diskussion und
- dem Bestreben der Auflösung der bestehenden Ordnung.
17. 5 1832 - Das Verbot des Hambacher Festes wird zurückgenommen
Pfalz * Ferdinand Freyherr von Adrian-Werburg und die Rheinbayerische Kreisregierung müssen das Verbot des „Hambacher Festes“ wieder zurücknehmen. Der Landrat, verschiedene Städte und einflussreiche, angesehene Bürger haben gegen das Verbot interveniert.
19. 5 1832 - Der Neustadter Stadtrat richtet eine uniformierte Sicherheitsgarde ein
Neustadt * Der Neustadter Stadtrat richtet - neben der Gendarmerie - eine aus Neustadter Bürgern zusammengesetzte, uniformierte Sicherheitsgarde ein. Das Tragen von Feuer- und sonstigen Waffen wird verboten.
27. 5 1832 - Kritische Töne auf dem Hambacher Fest gegen die Regierung
Hambach * Auf dem Hambacher Fest demonstrieren rund 30.000 Menschen aus Süddeutschland in den Farben Schwarz-Rot-Gold für die Einheit Deutschlands, für eine föderative deutsche Republik und für eine Allianz der demokratischen Bewegungen Europas. Offenbar sind viele Frauen dem Aufruf gefolgt, der sich ja auch ausdrücklich an die „deutschen Frauen und Jungfrauen“ gewendet hat, „deren politische Missachtung in der europäischen Ordnung ein Fehler [...] ist“.
Die Festteilnehmer tragen Fahnen mit politischen Aufschriften mit, die auf die Themen der Veranstaltung aufmerksam machen. In mehr als zwanzig Reden beschreibt man die augenblickliche politische Lage und beschreibt - in einer heute ungewohnt pathetischen Sprache - die künftige Gestaltung Deutschlands.
- Die Forderung nach Einheit meint die staatliche Einheit der deutschen Kulturnation, die auf der gemeinsamen Sprache und der gemeinsamen historischen Vergangenheit beruht.
- Die Forderung nach Freiheit meint die bürgerlichen Rechte wie Meinungs-, Rede- und Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Freizügigkeit sowie Handels- und Gewerbefreiheit.
- Die Forderung nach Gleichheit richtet sich gegen die mittelalterliche „Ständeordnung“, die die Menschen in Adel, Klerus und den dritten Stand, welcher über keinerlei politischen Rechte verfügt, einteilt. Gleichheit meint aber auch eine Gleichberechtigung aller Staatsbürger vor dem Gesetz ohne Bindung an den Geburtsstand.
- Gegen dieses absolutistische System setzen die Hambacher die Volkssouveränität als den obersten Wert der Staatsverfassung. Die Macht im Staate soll vom Volk ausgehen, gesetzlich festgelegt und kontrollierbar sein, damit Willkürakte verhindert werden und der Einzelne mit Hilfe der Gesetze in seinen Eigentums- und Freiheitsrechten geschützt ist.
- Anstelle der dem Fürsten verantwortlichen Heere fordern die Hambacher eine allgemeine Bürgerbewaffnung.
- Die Frau wird als gleichberechtigte Partnerin des Mannes gesehen. Sie ist „nicht mehr die dienstpflichtige Magd des herrschenden Mannes, sondern die freie Genossin des freien Bürgers“, deren Aufgabe es ist, frühzeitig ein politisches Verantwortungsbewusstsein in den Kindern zu wecken.
Überhaupt sehen die in Hambach Versammelten in der politischen Bildungsarbeit ein bedeutendes Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen. Das soll in einem öffentlichen Meinungsbildungsprozess in der Presse und auf Volksversammlungen gefördert werden, damit sich die Ziele der Einheit, der Freiheit, der Gleichheit und der Volkssouveränität in der Bevölkerung festsetzen und so allmählich gewaltlos verwirklicht werden können.
27. 5 1832 - Kritische Töne statt der Vivat-Rufe in Gaibach
Gaibach * Im fränkischen Gaibach wird auf dem Platz der Konstitutionssäule - ähnlich wie am gleichen Tag in Hambach - eine Verfassungsfeier abgehalten. Auch hier werden statt der Vivat-Rufe kritische Töne gegenüber der Regierung angeschlagen.
28. 5 1832 - Mehrere hundert Menschen treffen sich im Hambacher Schießhaus
Hambach * Mehrere hundert Menschen treffen sich zu einer Versammlung in dem neben dem Hambacher Schloss befindlichen Schießhaus. Man beschließt die Herausgabe einer Festbeschreibung und die Initiierung ähnlicher Feste in anderen deutschen Staaten. Die folgenden Erörterungen über das weitere Vorgehen enden mit dem Ergebnis, „jeder soll auf eigene Faust handeln“.
Heinrich Heine schreibt dazu spöttisch: „Ihr großen Königskinder, ich bitte Euch, öffnet die Kerkertüren der gefangenen Patrioten [...].Ihr habt nichts zu riskieren, die deutsche Revolution ist noch weit von Euch entfernt, gut Ding will Weile und die Frage der Kompetenz ist noch nicht entschieden. [...] O Schilda, mein Vaterland!“
1. 6 1832 - Das Hambacher Fest endet
Hambach * Das Hambacher Fest wird offiziell beendet.
Nach dem 1. 6 1832 - Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung in der Pfalz
München - Pfalz * Aus Sorge über die Entwicklung in der Pfalz und um hier die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, werden militärische Maßnahmen ergriffen.
2. 6 1832 - Erste öffentliche Stellungnahme der Regierung zum Hambacher Fest
München - Hambach * Das Bayerische Gesamtministerium gibt ihre erste öffentliche Stellungnahme zum Hambacher Fest heraus. Darin erklärt sie ihre „äußerste Missbilligung“ und ihre „Überzeugung von der Strafbarkeit“ der Hambacher Vorgänge. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich König Ludwig I. noch in Italien.
15. 6 1832 - Dr. Johann Georg August Wirth stellt sich in Homburg der Polizei
Homburg * Der Jurist und Publizist Dr. Johann Georg August Wirth, einer der Wortführer des Hambacher Festes, stellt sich in Homburg selbst der Polizei.
16. 6 1832 - Bayerische Truppen marschieren in Richtung Pfalz
Pfalz * Bayerische Truppen, bestehend aus 8.000 Soldaten, marschieren zur Besetzung in die Pfalz ab.
17. 6 1832 - Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer wird verhaftet
Haardt/Neustadt * Der Jurist Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer, ebenfalls ein Wortführer des Hambacher Festes, wird in seinem Haus in Haardt/Neustadt verhaftet.
22. 6 1832 - Diktatorische Vollmachten um die Unruhen im Rheinkreis zu „befrieden“
München - Hambach - Gaibach - Speyer * Auf ausdrücklichen Befehl des Königs Ludwig I. wird jetzt gegen die Aktivisten von Hambach und Gaibach mit harten Strafen vorgegangen. Feldmarschall Carl Philipp Joseph Fürst von Wrede wird vom Bayernkönig mit nahezu diktatorischen Vollmachten ausgestattet, um die Unruhen im Rheinkreis zu „befrieden“ und um gleichzeitig die Verwaltungsmissstände zu untersuchen.
Der Regierungspräsident des Rheinkreises, Ferdinand Freyherr von Adrian-Werburg, wird abberufen und durch den früheren Generalkommissär von Carl Albert Leopold Freiherr von Stengel ersetzt. Die bayerischen Truppenkontingente treffen in der Pfalz ein.
28. 6 1832 - Carl Philipp Joseph Fürst von Wrede unterdrückt die
Hambach * Feldmarschall Carl Philipp Joseph Fürst von Wrede verordnet in 16 Paragraphen detaillierte Maßnahmen, mit denen die oppositionelle Volksbewegung unterdrückt werden soll. Im Einzelnen verbietet er
- öffentliche Versammlungen, politische Vereine und Verbindungen sowie
- das Tragen von schwarz-rot-goldenen Abzeichen und Fahnen.
- Er befiehlt die Entfernung der Freiheitsbäume und
- kündigt die Bestrafung der Verfasser und Verbreiter unzensierter politischer Flugschriften an.
- Für den Fall, dass die angeordneten Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung unzureichend sein sollten, kündigt Wrede die Verhängung des Kriegszustandes an.
Im weiteren Verlauf kommt es zu 142 Gerichtsprozessen, in denen sogar sieben Todesstrafen ausgesprochen werden. Diese werden allerdings in lebenslange Haft umgewandelt.
1. 8 1832 - Carl Philipp Joseph Fürst von Wrede verlässt den Rheinkreis
Pfalz * Feldmarschall Carl Philipp Joseph Fürst von Wrede verlässt den Rheinkreis wieder. Die Ruhe in der Pfalz ist äußerlich wiederhergestellt, seine Anordnungen bleiben jedoch weiterhin in Kraft.
8. 8 1832 - Prinz Otto von Bayern wird als König von Griechenland akzeptiert
Nauplia * Die griechische Nationalversammlung akzeptiert Prinz Otto von Bayern als König von Griechenland. Ludwig I., der sich selbst gerne als „alten Philhellenen“ bezeichnet, fühlt sich mit der Ernennung seines zweitgeborenen Sohnes Otto zum griechischen König am Ziel seiner Träume.
15. 8 1832 - Schloss Haidenau wird zum Edelsitz
Haidhausen * Das vom Landgerichts-Physikus Dr. Sieber im Jahr 1813 erworbene Ridler-Schlössl wird Edelsitz und erhält den Namen Schloss Haidenau.
25. 8 1832 - Umbenennung des Haidhauser Ridlerschlößls in Schloss Haidenau
Haidhausen * Das Innenministerium genehmigt die Umbenennung des Haidhauser Ridlerschlößls in Schloss Haidenau.
9 1832 - Die Dettendorfer Strafe wird von der Staatskasse übernommen
Dettendorf - Miesbach - München * Die Gemeinde Dettendorf kämpft - unterstützt von den Pfarrherren von Elbach, Au und Irschenberg - mit den Miesbacher Behörden und die Regierung von Oberbayern gegen die 50-Gulden-Strafe und die Untersuchungskosten in Höhe von 244 Gulden und 42 Kreuzer.
Letztlich bringen aber nur verschiedene Gesuche an König Ludwig I. den Erlass der Strafe. Auch die Untersuchungskosten werden Ende September 1832 der Staatskasse auferlegt.
13. 10 1832 - Eine griechische Delegation huldigt dem künftigen König
München * Eine zwölfköpfige Delegation trifft in München ein, um dem künftigen König die Huldigung der Griechen darzubringen und ihn anschließend nach Griechenland zu begleiten.
14. 10 1832 - Das Oktoberfest wird für die griechische Delegation vertagt
München-Theresienwiese * Um den griechischen Abgesandten die Teilnahme am Oktoberfest zu ermöglichen, wird der Beginn der Wiesn vom 7. auf den 14. Oktober verschoben.
14. 10 1832 - „... die arbeitende, ärmere Klasse der Gesellschaft kann hier mitgenießen“
München-Theresienwiese * Auf dem Oktoberfest kann man beobachten, „dass die arbeitende, ärmere Klasse der Gesellschaft, die anderwärts nur draußen steht und neidisch und begehrlich zusieht, hier mitgenießen kann“.
20. 10 1832 - Das Haberfeldtreiben von Wilparting
Wildparting * In der Nacht vom 20. zum 21. Oktober 1832 findet in Wilparting ein Haberfeldtreiben statt.
30. 10 1832 - Ein Haberfeldtreiben in Irschenberg
Irschenberg * Vom 30. auf den 31. Oktober wird in Irschenberg ein Haberfeldtreiben abgehalten.
22. 11 1832 - Der Landrichter fordert Kugelschüsse gegen die Haberfeldtreiber
Litzldorf * In der Nacht vom 22. zum 23. November 1832 wird ein weiteres Haberfeldtreiben in Litzldorf abgehalten. Aus Sicht des Landrichters ist das die Folge der „oberbehördlichen Güte“. Konsequenterweise forderte er einen härteren Kurs gegen die Haberfeldtreiber und ihre Unterstützer.
Aus seiner Sicht wäre es gleich anders, wenn „rücksichtslos gegen diese Ruhestörer auf Leben und Tod fürgeschritten werden dürfte, wo vielleicht mit ein paar Kugelschüssen, Verwundeten oder einer Tötung diesem Mißstand auf lange Zeit, wenn nicht für immer, begegnet würde“.
6. 12 1832 - Prinz Otto macht sich auf den Weg nach Griechenland
Ottobrunn - Aibling * Der 17-jährige Bayernprinz Otto macht sich von der Münchner Residenz auf nach Griechenland, in sein neues Königreich. In Ottobrunn nimmt König Ludwig I. Abschied von seinem Sohn.
Königin Therese wird ihn noch bis nach Aibling begleiten. An der Brücke über die Mangfall wird sie sich - unter Tränen - von ihrem Sohn trennen.
7. 12 1832 - König Ottos bewusster Abschied von seiner bayerischen Heimat
Kufstein - Kiefersfelden * Weil Prinz Otto am 6. Dezember die bayerisch-österreichische Grenze schlafend überquert hat, kehrt er von Kufstein aus nochmal zurück nach Kiefersfelden, um den Abschied von seiner bayerischen Heimat bewusst zu vollziehen.
1833 - Das Brunnwerk am Neudeck kommt in den Besitz der Vorstadt Au
Vorstadt Au * Das Brunnwerk am Neudeck kommt für 100 Gulden in den Besitz der Vorstadt Au.
1833 - Es bestehen 49 Bierkeller in Haidhausen und der Au
Haidhausen - Au * Das Münchner Stadtadressbuch zählt
- in der Wiener Straße 20,
- in der Preysingstraße 3,
- in der Kellerstraße 5,
- auf der Nordseite der Rosenheimer Straße 7 und
- auf der Südseite der Rosenheimer Straße 13,
- also insgesamt 49 „Bierkeller“ auf.
Die Bierkeller liegen alle im Münchner Burgfrieden.
1833 - Der Besitz Haidenau liegt nicht nur „bey“, sondern „mitten“ in Haidhausen
Haidhausen * Da Dr. Sieber die Ansicht vertritt, dass sein Haidhauser Gut Haidenau sich „bey Haidhausen“ befindet, erklärt das Landgericht Au, dass der Besitz Haidenau nicht nur „bey“, sondern sogar „mitten“ in Haidhausen liegt und „durch den Starrsinn des Besitzers nicht in eine andere Gemeindegemarkung versetzt“ werden kann.
1833 - Das Hofbräuhaus ist als öffentliches Lokal zugänglich
München-Graggenau * Das Hofbräuhaus ist als öffentliches Lokal zugänglich. Hier spielt der Kapellmeister Sulzbeck mit seine „Bande“ auf. Von hier aus ertönt immer wieder der Landler „Huraxdax, packs bei der Hax“.
1833 - Schwanthaler erhält den Auftrag für zwölf Wittelsbacher-Bronzefiguren
München-Graggenau * Der Bildhauer Ludwig von Schwanthaler erhält den Auftrag, zwölf Bronzefiguren mit Ahnen der Wittelsbacher für den Thronsaal der Residenz zu erstellen.
1833 - 1.376 eheliche und 1.180 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.376 eheliche und 1.180 uneheliche Kinder geboren.
30. 1 1833 - König Otto von Griechenland trifft in Nauplia ein
Nauplia * König Otto von Griechenland trifft im Geleit von 33 Segelschiffen mit der britischen Fregatte Madagaskar in der damaligen griechischen Hauptstadt Nauplia ein. Mit Otto reisen 3.500 bayerische Soldaten, eine größere Zahl Wissenschaftler und Verwaltungsbeamte sowie ein dreiköpfiger Regentschaftsrat, bestehend aus dem ehemaligen bayerischen Finanzminister Joseph Ludwig Graf von Armansperg, dem Kgl. Staatsrat Georg Ludwig von Maurer und dem Generalmajor Karl Wilhelm von Heideck.
Der Regentschaftsrat soll bis zur Volljährigkeit Ottos - in zweieinhalb Jahren - die Regierungsgeschäfte führen.
6. 2 1833 - Otto von Griechenland zieht in die griechische Hauptstadt Nauplia ein
Nauplia * König Otto von Griechenland zieht in die griechische Hauptstadt Nauplia ein. Angeblich wird er von 50.000 jubelnden Landesbewohnern begrüßt und feierlich empfangen.
21. 3 1833 - König Ludwig I. steht dem Haberfeldtreiben positiv gegenüber
München * König Ludwig I. steht dem Haberfeldtreiben positiv gegenüber. Für ihn ist es kein Politikum, denn: „Bey dem alten Brauch des Haberfeldtreibens soll es gelassen, die dagegen gegebenen Verordnungen aufgehoben werden […]. Ohne meine Genehmigung soll keine Verordnung gegen einen alten Brauch gemacht werden“.
3. 6 1833 - Maximilian von Arco-Zinneberg heiratet Leopoldine von Waldburg-Zeil
München * Maximilian Bernhard Graf von Arco-Zinneberg heiratet Leopoldine Gräfin von Waldburg-Zeil-Trauchburg.
2. 7 1833 - Johann Valentin Fey wird in Darmstadt geboren
Darmstadt * Johann Valentin Fey, der Vater von Karl Valentin, wird in Darmstadt geboren.
11. 7 1833 - Athen wird zur neuen Hauptstadt Griechenlands erwählt
Athen * Athen wird - statt Nauplia - zur neuen Hauptstadt Griechenlands erwählt. Die Stadt hat stark unter dem Unabhängigkeitskrieg gelitten. Von 2.000 Häusern sind gerade mal sechzig noch bewohnbar.
19. 7 1833 - Die Bayern können aus dem Ausland demokratische Zeitungen beziehen
München * Die Beförderung der Post hat für Monarchen wie Ludwig I. einen sehr unerwünschten Effekt. Denn nun können die Bayern aus dem Ausland Zeitungen beziehen, die liberales und demokratisches Gedankengut transportieren.
Das wachsende Informationsbedürfnis der Untertanen steigt und stellt die Regierung vor immer neue Probleme, da die herkömmlichen Mittel der Zensur nicht mehr greifen. Wie schwierig die Situation für die reaktionäre bayerische Verwaltung ist, zeigt die Anweisung an die Postämter, wonach schweizerische und französische Zeitungen vor der Auslieferung an die Zensurbehörde zu geben sind.
29. 7 1833 - Prozess gegen die Wortführer des Hambacher Festes endet mit Freispruch
Landau/Pfalz * Der Prozess gegen die Wortführer des Hambacher Festes findet in Landau statt. Er dauert bis zum 16. August und endet mit dem Freispruch der Angeklagten.
König Ludwig I. versucht die Freilassung des Juristen und Publizisten Dr. Johann Georg August Wirth sowie des Juristen Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer zu verhindern, indem er aufgrund napoleonischer Gesetze eine „Präventivhaft“ anordnet. Aus seiner Sicht sind von den Beiden „staatsgefährdende Aktivitäten“ zu befürchten. Wegen kleinerer Vergehen (Beamtenbeleidigung) werden sie vor ein Zuchtpolizeigericht gestellt und zur Höchststrafe von zwei Jahren verurteilt.
Um 8 1833 - Die Raumprobleme des Münchner „Hauptpostamtes“
München-Graggenau * Wie gut, dass ausgerechnet jetzt die Raumprobleme des Münchner „Hauptpostamtes“ und die Umzugsabsichten der „Generalpostadministration“ bekannt werden.
- Bayernkönig Ludwig I. und sein Architekt Leo von Klenze sehen darin eine neue Chance für die abschließende Gestaltung des „Max-Joseph-Platzes“.
- Und das Allerbeste daran ist, dass man die entstehenden Kosten für den Erwerb des Gebäudes und den Umbau der „Postdirektion“ aufbürden kann.
1. 9 1833 - Leo von Klenze legt die Grundzüge seiner Planungen vor
München-Graggenau * Leo von Klenze legt dem König die Grundzüge seiner Planungen für den Platz vor der Oper in Form von zwei Baulinienalternativen vor.
- Die eine führt zu einer symmetrischen Platzgestalt, indem der Königsbau und die geplante neue Fassade der Hauptpost zwei gleich große Flächen beidseitig der Mittelachse begrenzen, die ihrerseits durch die Längsachse des Nationaltheaters und den geplanten Aufstellungsort des Max-Joseph-Denkmals festgelegt ist.
Diese Symmetrie ist allerdings nur um den Preis einer „ganz in die Karikatur fallende Breite“ des Postgebäudes von etwa vier Metern zu erreichen. - Der zweite Vorschlag rückt die Bauflucht weiter in den Platz, ausgerichtet auf die Südecke der Perusagasse, was erheblichen Gewinn an Raumtiefe für das Postgebäude bedeuten würde.
König Ludwig I. entscheidet sich für die erste Lösung, da im anderen Falle das Denkmal für seinen Vater aus der Platzmitte geraten würde.
Mit der Hauptpost soll ein markantes Beispiel für die hauptsächlich auf Stadtverschönerung ausgerichtete Baupolitik Ludwigs I. entstehen. Es ist aber zugleich ein Musterbeispiel dieser höchst fragwürdigen Baupolitik. Um seine Planungen verwirklichen zu können, braucht der König öffentliche und private Investoren, die seine gestalterischen Ideen unter Vernachlässigung von wirtschaftlichen und funktionalen Überlegungen akzeptieren. Private Bauherren lassen sich unter solchen Bedingungen kaum noch finden. Das haben nicht zuletzt die Erfahrungen in der Ludwigstraße gezeigt.
Doch auch die Veranlassung öffentlicher Bauaufträge gestaltet sich zunehmend schwierig. Die staatlichen Aufwendungen für königliche Luxusbauten geraten immer stärker in die Kritik. Insbesondere im Umgang mit der Ständeversammlung, die die Ausgaben bewilligen oder, wie bei der Hauptpost, im Hinblick auf weitere Bauaufgaben zumindest akzeptieren soll, findet Ludwig eigene Wege. Im Fall des Postgebäudes ist dies eine Mischung aus Täuschungsmanövern, neoabsolutistischer Herrscherwillkür sowie einer Instrumentalisierung von teils opportunistischen, teils ahnungslosen Beteiligten.
Denn letztlich werden bei den äußerst komplizierten und kaum durchschaubaren Vorgängen, bei denen man auch den Einsatz eines Strohmannes und die bewusste Verfälschung und Verschleierung wichtiger Tatsachen nicht scheut, nahezu alle mit den Plänen befassten Instanzen, von der Postadministration über das Ministerium des Königlichen Hauses, des Innen-, Außen- und Finanzministeriums und der Ständevertretung, in unterschiedlicher Form und in jeweils anderen Punkten getäuscht und ausgenutzt.
Um den 5. 9 1833 - Klenze legt einen Vorschlag für die Fassade der Residenzpost vor
München-Graggenau * Leo von Klenze legt - unaufgefordert und ohne „Anspruch auf diesen Bau zu begründen“ - einen Vorschlag für die Fassadengestaltung der Residenzpost vor, die er zur Kaschierung der 292 Fuß [90 Meter] langen und 70 bis 80 Fuß hohen Front auf dem nur 18 bis 19 Fuß tiefen bebaubaren Grundstück für geeignet hält. Dabei verfällt er „auf den Gedanken eines offenen Portikus - eines so schönen Gedankens der alten und neuen Zeiten, wozu hier der Bauplatz und seine Lage nach Norden und sein Verhältnis wie geschaffen scheint“.
Da das „Törringsche Palais in seiner ganzen Höhe bedeckt werden müßte, so schien es beßer, die Analogie einer Anlage aus dem Cinquecento als aus der Antike zu nehmen, und Florenz bietet dazu die schönsten Beispiele dar“. Beigefügt sind wieder zwei alternative Vorschläge. Sie sehen über einer in Anlehnung an Filippo Brunelleschis Findelhaus gestalteten Bogenhalle ein wahlweise in kleine Fenster oder Arkaden geöffnetes Obergeschoss vor.
Das florentinische Vorbild dürfte Klenze nicht allein im Hinblick auf Dimensionen und Proportionen gewählt haben. So wie er den Königsplatz als ein hellenisch-antikes Forum gestaltete, konnte mit dem an den Palazzo Pitti erinnernden Königsbau und die Angleichung des Toerring-Palais an das „Ospedale degli Innocenti“ ein Platz entstehen, der einen Eindruck der florentinischen Renaissance vermittelt.
Die Rückwand der Arkaden ist schmucklos: „Ich habe in diesen Skizzen den Grund der Arkaden ganz glatt und ungeziert gelaßen, jedoch würde sich eine paßliche, vom Königsbaue aus vorzüglich anzusehende Zierde [...] leicht finden laßen. [...]
Es scheint mir hier eine der seltenen Gelegenheiten die Großartigkeit und Einfachheit der Florentinischen Gebäude, welche ich soviel wie irgendjemand kenne und schätze, ohne Manier, Gewalt und Opfer dessen, was Vernunft und architectonische Consequenz erheischen anzuwenden und zu erreichen.“
Dem möglichen Wunsch des Königs nach einer dem Königsbau ähnlichen Fassade begegnete Klenze im Voraus mit dem Hinweis auf die völlig unterschiedlichen Größenverhältnisse. König Ludwig I. akzeptiert die Idee der Bogenhalle, gibt aber zu bedenken, wie ein Gebäudeteil finanziert werden könne, der „nur Zierde“ und deshalb der Postkasse kaum aufzubürden sei. Klenze wiegelt ab: „Da dieser Bau namentlich im oberen Stock nicht blos Zierde, sondern für den Nutzen der Post eingerichtet würde, so glaube ich nicht, daß ein Grund vorliegt, ihn nicht von dieser Administration bestreiten zu laßen“.
In den folgenden Monaten wird diese Frage zum zentralen Streitpunkt. König Ludwig I. verteidigt die Idee gegenüber dem Finanzminister Maximilian Emanuel Freiherr von Lerchenfeld und dem Minister des königlichen Hauses Gise. Die beiden Minister machen etatrechtliche Bedenken insbesondere im Hinblick auf die Ständeversammlung geltend, die ihrerseits bei der Entscheidungsfindung völlig übergangen worden ist.
20. 10 1833 - Der Steinmetzmeister Anton Ripfel beginnt die Ottosäule
Haidhausen - Ottobrunn * Der in Haidhausen niedergelassene Steinmetzmeister Anton Ripfel beginnt mit den Arbeiten an dem 8,75 Meter hohen Ehrendenkmal in Form einer griechisch-dorischen Säule am Ortsrand von Ottobrunn, dem damaligen Hehenkirchner Forst. Die sogenannte Ottosäule trägt die Inschrift: „3 ¼ Stunden von München entfernt, wo Ludwig I., König von Bayern, von seinem edlen Sohn, Otto I. von Griechenland, am 6. Dezember 1832 Abschied nahm.“
Die Aufstellung der Ottosäule geschieht in Abstimmung mit dem Regenten. Da der huldigende Aspekt des Denkmals schon von Anfang an feststeht, wünscht König Ludwig I. solche Initiativen nicht nur, sondern erwartet sie geradezu.
15. 11 1833 - Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer flüchtet aus dem Gefängnis
Landau/Pfalz * Der Jurist Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer, einer der Wortführer des Hambacher Festes, flüchtet aus seinem Gefängnisaufenthalt und reist in die Schweiz.
31. 12 1833 - Die gewerbliche Bevölkerung übertrifft die bäuerliche ums Neunfache
Haidhausen * Aus einem Bericht des Königlichen Landgerichts Au geht hervor, dass
- die rein landwirtschaftlich tätige Bevölkerung in Haidhausen - einschließlich der ansässigen und nichtansässigen Tagelöhner und Dienstboten - 445 Personen umfasst.
- Die rein gewerbliche Bevölkerung - mit Gesellen, Lehrlingen, Dienstboten und Taglöhnern - beträgt 4.053 Menschen, wovon 1.764 Personen in Haidhausen ansässige Tagelöhner sind.
Das bedeutet, dass die gewerbliche Bevölkerung zahlenmäßig die bäuerliche um das Neunfache übertrifft.
1834 - Eine direkte Schifffahrtsverbindung bis nach Griechenland
Donau * Nach der Sprengung der berüchtigten Katarakten des Eisernen Tores können Dampfschiffe bis ins Schwarze Meer fahren, wodurch die Donau-Dampfschifffahrt einen enormen Aufschwung erlebt. Nun ist eine direkte Schifffahrtsverbindung bis nach Griechenland möglich, wo seit 1832 mit König Otto ein Wittelsbacher regiert.
1834 - Die Königliche Civilliste beträgt jährlich 2,3 Millionen Gulden
München * Die Königliche Civilliste beträgt jährlich 2,3 Millionen Gulden, wovon dem König rund 300.000 Gulden zur freien Verfügung stehen.
1834 - München hat sich auf 88.905 Einwohner
München * Die Einwohnerzahl Münchens hat sich auf 88.905 erhöht.
1834 - 1.341 eheliche und 1.289 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.341 eheliche und 1.289 uneheliche Kinder geboren.
1834 - Wiedereinführung der Fornikationsstrafe gefordert
München * Die Wiedereinführung der Fornikationsstrafe [= Bestrafung der einfachen Unzucht] wird in der Ständeversammlung von katholischen und evangelischen Abgeordneten in einer gemeinsamen Eingabe gefordert. Es kommt zu keiner Verschärfung des Strafrechts, weil man eine Erhöhung der Abtreibungs- und Kindermorddelikte befürchtet.
19. 2 1834 - König Ludwig I. will weitere Eisenbahnen genehmigen
Nürnberg * König Ludwig I. gibt der von Geschäftsleuten gegründeten Nürnberg-Fürth-Ludwig-Eisenbahngesellschaft seine Zustimmung zum Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth. Er merkt dabei an, dass weitere Eisenbahnen genehmigt und sogar vom Staat gebaut werden könnten.
Um 3 1834 - Die Postverwaltung kauft das Toerring-Palais auf
München-Graggenau * Da das alte Postgebäude in der heutigen Theatinerstraße den Ansprüchen bei Weitem nicht mehr genügt, kauft die Postverwaltung das Palais des Grafen Maximilian August von Toerring-Gutenzell auf.
Das kommt König Ludwig I. und dessen Stararchitekt Leo von Klenze gerade recht. Immerhin soll der Max-Joseph-Platz zu einer städtebaulich herausragenden Freifläche werden, die durch repräsentative Randbauten und einem Denkmal ihre Wirkung erzielen soll.
4. 3 1834 - Die Beratungen sollen ein Erfolg für König Ludwig I. werden
München-Kreuzviertel * Das nächste Zusammentreffen der Stände-Versammlung wird für die Zeit vom 4. März bis 3. Juli 1834 einberufen. Innenminister Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein setzt alles daran, dass die Beratungen zu einem Erfolg für König Ludwig I. werden sollen. Und die vorausgegangenen, vom König veranlassten Einschüchterungen zeigen auch in der Abgeordnetenkammer ihre Wirkung.
19. 4 1834 - Das bis dahin teilnehmerstärkste Haberfeldtreiben in Maxhofen
<p><em><strong>Maxhofen bei Kirchdorf</strong></em> * Vom 19. zum 20. April 1834 findet das bis dahin teilnehmerstärkste Haberfeldtreiben statt. Bis zu 150 Burschen versammeln sich auf einem Hügel zwischen Maxhofen und Kirchdorf, um dem Lehrer Rothammer wegen <em>„Umgangs mit ledigen Mädchen“</em> und verschiedenen Bauern von Kirchdorf wegen <em>„ehelicher Untreue“</em> die Leviten zu lesen.</p> <p>Besonders gilt das Treiben aber dem Jäger des Grafen Arco, Friedrich Oberbichler, der die Gärtnermagd Katharina Wagner geschwängert hatte, ohne dass die Beiden aus dem Schloss verstoßen worden wären.</p> <p>Bei diesem Haberfeldtreiben wird dem Bauern Kaspar Schnitzenbaumer durch den Hut geschossen und eine Magd durch eine Schrotkugel verletzt. </p>
5 1834 - Die Kosten müssen reduziert werden
München-Graggenau * Leo von Klenze legt einen bewusst knapp kalkulierten Voranschlag über 95.000 Gulden vor. Der Betrag ist aus dem Verkauf des alten Postgebäudes zu kompensieren.
Der mit der Bauausführung beauftragte Joseph Daniel Ohlmüller legt einen Kostenvoranschlag über 123.992 Gulden vor, der auf Einspruch des Königs, der Veränderungen an der Fassade der Residenzgasse untersagt, auf 107.918 fl. korrigiert wird.
1. 5 1834 - Die Haidhauser Armen- und Krankenanstalt wird eröffnet
Haidhausen * Die Haidhauser Armen- und Krankenanstalt wird eröffnet. Sie ist auch für die Aufnahme der Auer Bevölkerung vorgesehen.
3. 5 1834 - Eine Konfrontation zwischen den Dorfbewohnern und den Haberern
Weyarn * Beim Haberfeldtreiben von Weyarn in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1834, das sich gegen die Wirtstochter Anna Kirchberger, die Hausmagd Maria Strohschneider, den Wirt Alois Kirchberger und andere Dorfbewohner richtet, kommt es zur direkten Konfrontation zwischen den Dorfbewohnern und den Haberern.
Der Wirt, sein Sohn und der Knecht gehen auf die Haberer los. Vater und Sohn Kirchberger werden nur leicht verletzt, der Knecht wird dagegen von fünf Schüssen schwer verwundet. Auch auf den herbeigeholten Pfarrer wird geschossen. Er kann den Verletzten nur im Schutze des Straßengrabens erreichen. Die heftigen verbalen Attacken richteten sich erneut gegen den Standesunterschied von Wirt und Dirn.
Durch die Vorgänge von Weyarn wird das Haberfeldtreiben endgültig kriminalisiert.
16. 5 1834 - Johann Nestroys „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ in der Au
Vorstadt Au * Johann Nestroys „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ erlebt im Schweiger‘schen Volkstheater in der Vorstadt Au seine Münchner Premiere. Erst knapp vier Wochen später wird das Bühnenstück im Königlichen Hof- und Nationaltheater gespielt.
6 1834 - Johann Nestroys „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ wird aufgeführt
München-Graggenau * Johann Nestroys „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ wird im Königlichen Hof- und Nationaltheater nachgespielt.
15. 6 1834 - Ein angeblicher Angriff der Haberer auf Schloss Maxlrain
Schloss Maxlrain * In der Nacht vom 15. zum 16. Juni 1834 verüben - angeblich - die Haberer einen „lebens- und eigentumsgefährlichen Angriff auf das Schloß Maxlrain“.
Doch bei der „Schlacht von Maxlrain“ sind vollkommen andere Gründe maßgeblich. Bestimmt werden Mord- und Branddrohungen ausgesprochen, denn die bewaffneten Burschen verdächtigen den Maxlrainer Jäger des Mordes an einem ihrer Freunde. Der Aufruhr läuft ziemlich unorganisiert ab und hat auch sonst nur wenig Ähnlichkeit mit einem Haberfeldtreiben.
7 1834 - Die Vermessungsarbeiten für die Eisenbahn Nürnberg - Fürth beginnen
Nürnberg - Fürth * Nachdem die Aktien schnell verkauft sind, kann der Königlich-Bayerische Bezirksingenieur Paul Denis mit den notwendigen Vermessungsarbeiten zur Errichtung der Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth beginnen. Aufgrund eines trockenen Sommers kommen die Schienenverlegungsarbeiten für die 6,05 Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth schnell voran.
1. 7 1834 - Die Ständeversammlung genehmigt den Ludwig-Main-Donau-Kanal
München-Kreuzviertel * Die bayerische Ständeversammlung genehmigt den Bau eines Kanals zwischen Main und Donau, den Ludwig-Main-Donau-Kanal.
1. 7 1834 - Ein neues Ansässigmachungs- und Verehelichungsgesetz
München-Kreuzviertel * Die Ständeversammlung beschließt ein Ansässigmachungs- und Verehelichungsgesetz, in dem den Gemeinden ein „absolut hindernder Widerspruch (Vetorecht)“ zugestanden wird. Das gilt in all den Fällen, wo das Gesuch auf Ansässigmachung lediglich auf dem Nachweis eines „anderweitig gesicherter Nahrungsstandes“ gestützt ist.
Damit liegt das Schicksal der Bewerber, für die kein Anspruch auf Ansässigmachung besteht, ausschließlich in der Hand der Gemeinde. Davon betroffen sind in erster Linie besitzlose Lohnabhängige, die dadurch auch von der Verehelichung ausgeschlossen werden.
1. 7 1834 - Gesetzesvorlagezur Begrenzung des Bevölkerungswachstums
München-Kreuzviertel * Innenminister Ludwig Fürst von Oettingen-Wallerstein bringt in die Ständeversammlung einen Gesetzentwurf zur Revision des Ansässigmachungs- und Verehelichungsgesetzes ein.
Ziel der Gesetzesvorlage ist die Begrenzung des Bevölkerungswachstums durch Verhinderung der Verehelichung und Familiengründung durch Besitzlose. Damit sollen gleichzeitig
- die Lasten der Armenkasse gesenkt sowie
- die Unzufriedenheit der sozialen Unterschichten und die damit verbundene Revolutionsbereitschaft unterbunden werden.
Der Innenminister kommt damit der überwältigenden Mehrheit der Abgeordnetenkammer entgegen, die bereits am 13. September 1831 derartige Schritte forderte. Fürst Ludwig von Oettingen-Wallenstein schafft mit diesem Deal auch die Zustimmung zu anderen Gesetzesvorlagen wie die Zivilliste, den Festungsbau in Ingolstadt und den Ludwig-Main-Donau-Kanal.
1. 7 1834 - Gemeindeeingeborene, sonstige Inländer und Ausländer
Königreich Bayern * Durch das neue Ansässigmachungs- und Verehelichungsgesetz unterscheidet man jetzt zwischen
- Gemeindeeingeborenen sowie
- sonstigen Inländern und
- Ausländern.
1. 7 1834 - Die Aufnahmegebühr wird erhöht
München * Die Ansässigmachung wird zusätzlich erschwert, da der Wert des Grundbesitzes von bisher etwa 600 Gulden auf 2.000 Gulden heraufgesetzt wird.
- Der Höchstsatz der Aufnahmegebühr liegt in München bei 100 Gulden, wenn das Vermögen 3.000 Gulden übersteigt.
- Die Aufnahmegebühr für besitzlose Lohnabhängige liegt in den größeren Städten zwischen 10 und 25 Gulden. Die Angehörigen dieses Personenkreises werden zu Bürger zweiter Klasse, zu „Beisassen“ oder „Insassen“.
1. 7 1834 - Eine städtische Klassengesellschaft
München * Durch die Novellierung des Gemeindeedikts von 1818 unterteilt man die Angehörigen eines Gemeindebezirks in Gemeindebürger und Nichtbürger ein.
- Gemeindebürger sind Personen, die im Gemeindegebiet ein Anwesen besitzen und eine Grundsteuer bezahlen oder
- ein besteuertes Gewerbe ausüben.
Zu diesen gesellen sich die „einem Gemeindebezirk angehörigen, aber mit Gemeindebürgerrecht nicht begabten Personen“, die in verschiedenen Klassen eingeteilt sind:
- Die erste Klasse der Nichtbürger bilden die Schutzverwandten oder Passivbürger, in den Städten auch Insassen genannt. Das sind Personen, die sich auf Lohnerwerb oder wegen definitiver Einstellung in einem öffentlichen Amt des Staates, der Kirche oder einer Gemeinde ansässig machen konnten. Dieser Personenkreis ist nicht wahlberechtigt.
- Die zweite Klasse der Nichtbürger besteht aus den ohne Ansässigmachung Heimatberechtigten.
- Die dritte Klasse der Nichtbürger aus den Heimatberechtigten anderer Gemeinden. Das ist der größte Teil der unverheirateten zugezogenen Arbeiter und Tagelöhner.
17. 7 1834 - Das Schloss Valley brennt ab
Valley * Das Schloss Valley brennt ab. Man vermutet, dass Haberer hinter dieser Brandschatzung stecken.
31. 7 1834 - König Ludwig I. ändert seine positive Haltung zum Haberfeldtreiben
München * König Ludwig I. gibt seine wohlwollende Haltung gegenüber dem Brauch des Haberfeldtreibens auf und erteilt den Befehl: „Seine Majestät der König haben zu genehmigen geruht, daß
- die alte Sitte des Haberfeldtreibens in jenen Gemeinden, in welchen selbes zur Verübung von Exzessen irgendeiner Art, d.h. als Spottung vor die Häuser der Mütter unehelicher Kinder mißbraucht wurde, oder künftig mißbraucht wird, verboten, und daß
- sodann die von einem solchen Verbote betroffenen Gemeinde für etwaige Zuwiderhandlungen in solidum [= ganzheitlich] verantwortlich erklärt und nach Lage der Sache durch die Kreisregierung selbst mit militärischer Exekution belegt werde.“
11. 8 1834 - Die Angst vor den Haberern wächst ins Unermessliche
Schloss Maxlrain * Auf den Maxlrainer Schlossherrn, Carl Theodor Graf von Lodron, wird ein Überfall versucht und am 11. August 1834 in einem Drohbrief ein Brandanschlag ankündigt. Jetzt wächst die Angst vor den Haberern ins Unermessliche. Auch, weil das Schloss Valley bereits am 17. Juli 1834 abgebrannt war.
21. 8 1834 - Ein Anschlag auf den Brauereiaufseher von Valley
Valley * Auf den Brauereiaufseher von Valley wird ein Anschlag verübt. Wieder verdächtigt man Haberer.
29. 8 1834 - Das Bischöfliche Ordinariat kämpft gegen das Haberfeldtreiben
München * Auf Bitten der Regierung von Oberbayern um Mithilfe bei der Bekämpfung des Haberfeldtreibens erlässt das Bischöfliche Ordinariat eine oberhirtliche Verfügung an die Dekanatsämter Miesbach, Aibling und Söllhuben.
Darin können diese entnehmen, dass sie „durch alle in ihrem seelsorgerischen Wirkungskreise ihnen zu Geboth stehenden Mittel, durch zweckmäßig eindringliche Belehrung in Kanzelvorträgen und Christenlehren sowohl, als vorzüglich im Beichtstuhle zur Ausrottung dieses so tief gewurzelten Übels mit aller Kraft und Klugheit einzuwirken, […] und besonders der männlichen Jugend die schwere Verantwortung, die sie sich vor dem weltlichen wie vor dem göttlichen Richterstuhle zuziehen würde, vorzustellen, wenn sie an diesen strafbaren nächtlichen Exzessen und unbefugten Rotten auf die eine oder andere Weise theilnehmen, und dieselben begünstigen würden“.
11. 9 1834 - Graf Toerring-Gutenzell senkt den Verkaufspreis
München-Graggenau * Nach einem ersten Verkaufsangebot über 250.000 Gulden senkt Graf Toerring-Gutenzell - auf Einspruch König Ludwigs I. - den Preis für seinen Besitz an der Stelle der späteren Residenzpost aus „patriotischer Gesinnung“ auf 185.000 Gulden, um dann einen um weitere 5.000 Gulden gedrückten Vertrag zu unterzeichnen.
11 1834 - Adolf Friedrich von Schack wechselt an die Universität in Heidelberg
Heidelberg * Adolf Friedrich von Schack wechselt an die Universität in Heidelberg. Dort beginnt er mit der Übersetzung des persischen Dichters „Firdausi“.
12 1834 - Die griechische Regierung zieht von Nauplia nach Athen um
Nauplia - Athen * Die griechische Regierung zieht von Nauplia nach Athen um.
1835 - Die Auer neigen zum Leichtsinn und zum Trinken
Vorstadt Au * In einem Bericht heißt es: „Die Auer neigen sich insbesondere zu zwei Hauptuntugenden hin, nämlich zu einem unbegränzten Leichtsinne und zum übermäßigen Trinken.“
1835 - Gründung einer Aktiengesellschaft zum Betrieb der Donaudampfschifffahrt
München * Gründung einer Aktiengesellschaft zum Betrieb der Dampfschifffahrt auf der Donau zwischen Ulm und Linz durch bayerische Bankiers und Unternehmer.
1835 - Joseph Anton von Maffei investiert in den Schiffs- und Lokomotivenbau
München-Englischer Garten - Hirschau * Joseph Anton von Maffei investiert in einen riskanten Zukunftsmarkt: dem Schiffs- und Lokomotivenbau. Um den Ausbau des bayerischen Eisenbahnnetzes zu forcieren, beteiligt er sich - als einer der Initiatoren und Hauptaktionäre von Münchner und Augsburger Bank- und Kaufleuten - an der Gründung einer Aktiengesellschaft zum Bau der Eisenbahn München - Augsburg.
1835 - Die Vision des Simon von Eichthal zum Eisenbahnbau
München * Die Vision von Simon von Eichthal, dem Bankier und Mitbegründer der Eisenbahngesellschaft München - Augsburg, zum Eisenbahnbau lautet:
„Die Großartigkeit des Unternehmens wird es dann auch möglich machen, im Inlande Anstalten ins Leben zu rufen, aus welchen Dampfwägen und alle diejenigen Gegenstände, welche zur Verfertigung und Befahrung der Eisenbahnen sonst aus England und den Niederlanden bezogen werden müssen, hervorgehen können“.
1835 - Die Zahl der Kaffeehäuser hat sich auf 41 erhöht
München * Die Zahl der Kaffeehäuser hat sich in München auf 41 erhöht.
1835 - 1.401 eheliche und 1.320 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.401 eheliche und 1.320 uneheliche Kinder geboren.
1835 - 23,8 Prozent der Geburten in Bayern sind unehelich
Königreich Bayern * Die Quote der unehelich geborenen Kinder liegt im Königreich Bayern bei 23,8 Prozent.
1835 - Im Landgericht Au 514 gibt es eheliche und 252 uneheliche Geburten
Landgericht Au * Im Landgericht Au, das die Vorstadt Au und die Gemeinden Haidhausen, Obergiesing, Bogenhausen, Oberföhring, Daglfing und Berg am Laim umfasst, werden 514 eheliche und 252 uneheliche Kinder geboren.
Um 3 1835 - Die Baukosten für die Hauptpost erhöhen sich
München-Graggenau * Vom Baubeginn bis zum Herbst 1836 haben sich die Baukosten für die Hauptpost infolge „höchst nöthiger und diensttauglicher Bauwendungen“ auf 186.229 Gulden erhöht. Ausschlaggebend sind Nachforderungen Lippes sowie Veränderungen an der Hauptfassade des Rokoko-Palais, die entgegen Ludwigs Weisung vorgenommen worden sind.
2. 3 1835 - Kaiser Franz I. Joseph Karl (Franz II.) von Österreich stirbt in Wien
Wien * Kaiser Franz I. Joseph Karl (Franz II.) von Österreich stirbt in Wien.
Ab dem 11. 4 1835 - Das Max-Joseph-Stift für höhere Töchter und das Georgianum entstehen
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Die Arbeiten für die von Friedrich von Gärtner im Stil des romantischen Historismus geplanten Bauten gegenüber der Universität beginnen. Sie dauern sechs Jahre an.</p> <ul> <li>Nördlich der heutigen Veterinärstraße entsteht das Max-Joseph-Stift für höhere Töchter, </li> <li>südlich davon das Georgianum für angehende Geistliche.</li> </ul>
1. 6 1835 - Das Theresienmonument wird eingeweiht
Aibling * Das Theresienmonument an der Brücke über die Mangfall, gleich hinter Aibling, wird eingeweiht. Das Denkmal erinnert an die tränenreiche Verabschiedung der Bayernkönigin Therese von ihrem 17-jährigen Sohn Otto, auf seinem Weg nach Griechenland. Das Theresienmonument ist eine neugotische „Fiale mit eingestellter Muttergottesfigur“, nach Plänen von Friedrich Ziebland.
1. 6 1835 - König Otto von Griechenland ist volljährig geworden
Nauplia * König Otto von Griechenland ist volljährig geworden und übernimmt damit vom dreiköpfigen Regentschaftsrat die Regierung. Obwohl die griechischen Schutzmächte England, Frankreich und Russland den Griechen bereits vor König Ottos Einsetzung eine Verfassung versprochen haben, regiert Otto zunächst als nahezu uneingeschränkter Herrscher.
Bestärkt wird der darin von seinem Vater, dem Bayernkönig Ludwig I., der ihm schreibt: „Nicht zu reiflich überdacht kann die Einführung einer Verfassung werden; es ist die Höhle des Löwen, aus der keine Fußstapfen gehen; sie hat Folgen, die man gar nicht voraussieht.“
18. 6 1835 - Ritter von Maffei steuert als Vorstandsmitglied die Geschicke der Hypo-Bank
München * Auf Betreiben des Hofbankiers Simon von Eichthal beteiligt sich Joseph Anton von Maffei - unterstützt von den Bankhäusern Rothschild in Frankfurt sowie Hirsch in Würzburg - mit 250.000 Gulden an der Gründung der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. In den kommenden fünf Jahren steuert Ritter von Maffei als Vorstandsmitglied die Geschicke der Bank aktiv mit.
23. 7 1835 - Grundsteinlegung für das Muffat-Brunnhaus auf der Kalkofeninsel
Haidhausen * Grundsteinlegung für das Muffat-Brunnhaus auf der Kalkofeninsel.
24. 9 1835 - Stimmen gegen Faulheit, Liederlichkeit und Sittenlosigkeit
München - Königreich Bayern * Da sich nach 1830 die wirtschaftliche Lage im Königreich Bayern verschlechtert hat, werden jetzt Stimmen laut, die die Faulheit, Liederlichkeit und Sittenlosigkeit der unteren Bevölkerungsgruppen anprangern.
Für die Behörden sind viele Arme und die meisten Bettler nur „Scheinarme“, die sich auf Kosten anderer ein schönes Leben machen wollen.
10 1835 - Gottfried Reichardt erhebt sich mit einem Ballon in die Lüfte
München-Theresienwiese * Gottfried Reichardt wird sich mit einem Ballon in die Lüfte erheben. Er erreicht Eggenfelden.
10 1835 - Zur „25. Jubiläums-Wiesn“ kommt Johann Strauß (Vater) aus Wien
München-Theresienwiese * Zur „25. Jubiläums-Wiesn“ kommt sogar Johann Strauß (Vater) aus Wien.
Er sorgt hier für die musikalische Unterhaltung und spielt zum Tanz auf.
„Die sämtlichen Produktionen dieses genialen Walzerkompositeurs ernteten enthusiastischen Beifall“.
10 1835 - Familienfest der Wittelsbacher und ihres Volkes
München-Theresienwiese * König Ludwig I. verbietet zwar alle öffentlichen Feiern aus Anlass seiner Silberhochzeit. Gleichzeitig „geruht“ er aber, „die Verherrlichung und Verjüngung der 25-jährigen Jubelfeier des Oktoberfestes zu gestatten“. Dabei lassen sich die beiden Anlässe nicht trennen, da sie in einem direkten Zusammenhang stehen. Dieses Oktoberfest wird deshalb auch als „Familienfest der erhabenen Wittelsbacher und ihres Volkes“ bezeichnet.
Der Festumzug umfasst 86 aufwändig geschmückte Wägen, die
- die Kreise Bayerns präsentieren,
- Epochen der bayerischen Geschichte,
- verschiedene Lebenswelten der Regionen,
- unterschiedliche Bevölkerungsschichten, Berufsgruppen und Erwerbszweige oder lokale Legenden darstellen.
- Die in Tracht gekleideten Festzugs-Teilnehmer verkörpern die bayerische Gesamtnation.
15. 10 1835 - Grundsteinlegung für das Max-Joseph-Stift an der Ludwigstraße
München-Maxvorstadt * Grundsteinlegung für das Max-Joseph-Stift an der Ludwigstraße.
11 1835 - Die beträchtliche Kostenüberschreitung führt zur Rüge - sonst nichts
München-Graggenau * Die Missachtung des königlichen Willens sowie die beträchtliche Kostenüberschreitung führen im November dazu, dass König Ludwig I. „das ernstliche Mißfallen“ gegenüber Klenze, Ohlmüller und „Postdirektor“ Lippe ausspricht.
Die Einsetzung einer „Untersuchungskommission“ unterbleibt jedoch in Hinblick auf den bereits sehr weit fortgeschrittenen Bau.
Doch unmittelbar danach ordnet Ludwig - unter Umgehung der Ministerien - in mündlichem Befehl an Klenze die von diesem vorgeschlagene „polychromatische Bemalung“ an.
12 1835 - Adolf Friedrich von Schack schreibt sich an der „Humboldt-Universität“ ein
Berlin * Adolf Friedrich von Schack schreibt sich an der Humboldt-Universität in Berlin ein.
12 1835 - Johann Georg August Wirth muss noch eine sechswöchige Strafe absitzen
Passau * Der Jurist und Publizist Dr. Johann Georg August Wirth, einer der Wortführer des „Hambacher Festes“, wird nach seiner Freilassung nach Passau gebracht, um dort noch eine sechswöchige „Kontumazstrafe“ (Verurteilung wegen Nichterscheinen vor Gericht) aus dem Jahr 1831 abzusitzen.
7. 12 1835 - Mit der Adler erstmals zwischen Nürnberg und Fürth
Nürnberg - Fürth * Der englische Lokomotivführer Wilson befährt auf seiner ebenfalls aus England stammenden 10-PS-Lokomotive Adler erstmals die Strecke zwischen Nürnberg und Fürth mit einer Geschwindigkeit von knapp zwanzig Stundenkilometern.
Der Lokomotiv-Führer verdient - mit einem Jahresgehalt von 2.571 Mark - mehr als der Eisenbahndirektor.
Um den 15. 12 1835 - Zustimmung zur Bahnlinie München - Augsburg
München - Augsburg * Nach dem Erfolg des „Adlers“ gibt König Ludwig I. die Zustimmung zum Bau der sechzig Kilometer langen Strecke zwischen München und Augsburg. Mit den Planungen der Neubaustrecke wird erneut Paul Denis beauftragt.
Noch während man in Nürnberg die Schienen nach Fürth verlegt, treffen sich in München und Augsburg vermögende Herren, um den Bau einer Eisenbahn zwischen den beiden Städten zu planen. Als Probleme mit verkaufsunwilligen Grundstückseigentümern auftreten, beschließt der Landtag ein Gesetz, das Enteignungen erlaubt.
1836 - In Bayern werden 1.125 Ziegelstadel,betrieben
Königreich Bayern • In Bayern werden 1.125 Ziegelstadel betrieben.
1836 - Der „Franziskaner-Keller“ kommt in den Besitz der Familie Deiglmayr
Vorstadt Au * Der „Franziskaner-Keller“ an der Hochstraße kommt in den Besitz der Familie Deiglmayr.
1836 - Peter Paul Ritter von Maffei hinterlässt ein Vermögen von 2,7 Millionen fl.
München * Bei seinem Tod hinterlässt Peter Paul Ritter von Maffei seinem Sohn ein Vermögen von 2,7 Millionen Gulden.
Joseph Anton von Maffei steht als Unternehmerpersönlichkeit seinem Vater in nichts nach und wird als eine „der bedeutendsten Industriepioniere Bayerns im 19. Jahrhundert“ beschrieben.
1836 - Satte 20 Prozent Dividende bei der „Nürnberg - Fürther Privateisenbahn“
Nürnberg - Fürth * Die „Nürnberg - Fürther Privateisenbahn“ erfüllt ihren Aktionären die Hoffnung auf's schnelle Geld.
Satte 20 Prozent Dividende werden ausgeschüttet und lassen die Aktien auf ein Vielfaches ihres Nennwerts steigen.
1836 - Die „Lederfabrik“ verfügt über die erste „Lederspaltmaschine“
Untergiesing * Die „Untergiesinger Lederfabrik“ verfügt - damals mit dreißig Beschäftigten - über die erste „Lederspaltmaschine“ auf dem Kontinent.
Franz Kester kauft die lange geheim gehaltene englische Erfindung - nicht ohne Schwierigkeiten - an und lässt sie nach Giesing transportieren.
Im gleichen Jahr wird in dem als „Sohlen- und Lederfabrik“ gegründetem Unternehmen mit der Herstellung von „lackiertem Leder“ begonnen.
Das ist eine absolute Novität.
1836 - Friedrich Bürklein legt die Prüfung für den „höheren Staatsdienst“ ab
München * Friedrich Bürklein legt die Prüfung für den „höheren Staatsdienst“ ab.
1836 - Leo von Klenze hat eine hervorragende städtebauliche Lösung gefunden
München-Graggenau * Leo von Klenze hat aus städtebaulicher Sicht eine hervorragende Lösung gefunden.
Durch die nach Art der altgriechischen „Polychromie“ [Vielfarbigkeit] gehaltenen Verzierungen in den Gesimsen und Gliedern hat Klenze einen Effekt erzeugt, der, „so fremdartig er sein mag (weil man buntverzierte Fassaden zu sehen noch nicht gewohnt ist), dennoch sehr harmonisch genannt werden muß“, lobt die „Allgemeine Bauzeitung“.
Der englische Architekt Charles Robert Cockerell, zeigte sich gleichfalls begeistert: „[...] im Postgebäude wird eine glückliche Wirkung erreicht, denn die auf dünnen Säulen aufruhenden Archivolten, die die Loggia bilden, werden durch die rote Farbe stark hervorgehoben und ebenso durch den Dekor auf der Stirnwand, der die Säulen wunderbar und mit einem warmen und angenehmen Effekt hervortreten läßt. Die Farbe ist es, die dem Bau so viel Gewicht gibt, daß er als Pendant zur Residenz bestehen konnte“.
Für die Belange der „Postadministration“ ist das Ergebnis dennoch mehr als enttäuschend.
1836 - Schwanthalers Gipsfiguren sollen im „Alten Rathaus“ aufgestellt werden
München-Graggenau * Der Stadtmagistrat bietet Ludwig von Schwanthaler die Aufstellung von acht vergoldeten Gipsfiguren der Wittelsbacher-Ahnen im „Festsaal des Alten Rathauses“ an, damit dieser eine „patriotische Ausschmückung“ erhält.
Bedingung ist die Renovierung des nicht mehr repräsentativen Zwecken genutzten und dementsprechend ramponierten „Rathaussaales“.
1836 - Haberer werden zu Arreststrafen und Rutenhiebe verurteilt
Miesbach * Es kommt zur Verhandlung zum „Maxhofener Haberfeldtreiben“ vom 19. zum 20. April 1834, bei der die „Tötungsabsicht“ an Kaspar Schnitzenbaumer im Mittelpunkt steht.
43 Personen werden zu „Arreststrafen“ und weitere 32 zu „Rutenhiebe“ verurteilt.
1836 - 1.325 eheliche und 1.301 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.325 eheliche und 1.301 uneheliche Kinder geboren.
Ab 1836 - Auswanderungen aus dem Königreich Bayern (I)
Königreich Bayern * Zwischen 1836 und 1845 wandern 60.980 Personen aus dem Königreich Bayern aus.
2 1836 - Johann Georg August Wirth gelingt die Flucht nach Weißenburg im Elsass
Hof - Weißenburg * Dr. Johann Georg August Wirth, einer der Wortführer des „Hambacher Festes“, begibt sich in seinen Heimatort Hof, wo er aber weiterhin unter Polizeiaufsicht steht.
Ihm gelingt jedoch die Flucht nach Weißenburg im Elsass.
6. 2 1836 - Der Grundstein für das Königliche Schloss in Athen wird gelegt
Athen * Der Grundstein für das Königliche Schloss in Athen wird in Anwesenheit des bayerischen Königs Ludwig I. gelegt.
Um 3 1836 - Die „Cholera“ grassiert erstmals in Süddeutschland
Süddeutschland * Die „Cholera“ grassiert erstmals in Süddeutschland.
Das Bürgertum fühlt sich zunehmend von den „armen“ Bevölkerungsschichten bedroht, weshalb das „Bayerische Staatsministerium des Innern“ eine Verordnung erlässt.
In dieser wird die Notwendigkeit der Unterstützung der Armen angesichts der herrschenden Epidemie eingefordert, da sie „zum Schutze der Gesamtheit nicht minder als zum Schirme der Dürftigen selbst“ notwendig sei, „da die in den Hütten sich steigernde Krankheit auch auf alle übrigen Klassen und den Gesundheits-Zustand ganzer Orte nicht ohne Rückwirkung bleibt“.
Um 5 1836 - König Otto von Griechenland begibt sich auf Brautschau
Athen - München * König Otto von Griechenland begibt sich auf Brautschau nach Deutschland.
16. 6 1836 - Die Bayerisch-württembergische Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft
München - Donau * König Ludwig I. erteilt der Bayerisch-württembergischen Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft ein auf vierzig Jahre befristetes Privileg zum Betrieb der Dampfschifffahrt auf der bayerischen Donau.
19. 6 1836 - Die neugotische Ottokapelle in Kiefersfelden wird eingeweiht
Kiefersfelden * Ein weiteres Denkmal der etappenweisen Verabschiedung des 17-jährigen Bayernprinzen Otto auf seinem Weg nach Griechenland findet sich in Kiefersfelden. Da Prinz Otto die dortige Grenze nach Österreich schlafend überquert hatte, kehrt er am nächstens Tag noch einmal zurück, um sich ganz bewusst „vom Boden seiner Heimat“ zu verabschieden. Diese aufsehenerregende Geste führt zur Errichtung der vom Bauinspektor Daniel Ohlmüller geplanten neugotischen Ottokapelle.
8 1836 - In München bricht die erste „Cholera-Epidemie“ aus
München - Vorstadt Au - Haidhausen * In München bricht die erste „Cholera-Epidemie“ aus.
Sie dauert bis Januar 1837.
143 von 4.700 Bewohner Haidhausens sterben daran, das sind rund 3 Prozent.
259 von rund 10.000 Bewohner der Au sterben daran, das sind rund 2,6 Prozent.
1.061 von rund 100.000 Bewohner Münchens sterben daran, das sind rund 1 Prozent.
Von Übergriffen auf Ärzten wegen der „Cholera“ wird berichtet:
„Im Jahre 1836 hielt man in der Vorstadt Haidhausen dafür, daß die Aerzte den Leuten die Cholera erst ins Haus brächten, und sie wollten von ärztlichen Nachforschungen im Hause nichts wissen.
Ja, es bestanden dort Vorurtheile, als ob die reichen Leute die Cholera machten, als leiser Nachklang der Brunnenvergiftungsfurcht durch die Juden im Mittelalter.
Es war daher das Aufsuchen und die Nachfrage in Haidhausen, ob im Hause keine Diarrhöen vorkämen, dem vorurtheilsvollen und ungebildeten Publikum gegenüber sogar mit persönlicher Gefahr verbunden“.
Bei den nächsten Epidemien spielten Vergiftungsvorstellungen keine Rolle mehr.
Doch nachvollziehbar sind solche Theorien schon.
So hält sich die Vorstellung, der „Aids-Virus“ sei in einem amerikanischen Labor geschaffen worden, um die „Schwarzen“ auszurotten, auch noch immer.
31. 8 1836 - Hugo Alois von Maffei wird geboren
München * Hugo Alois von Maffei wird geboren. Er wird später die Maffei-Werke von seinem Onkel erben und erfolgreich weiterführen.
10 1836 - Regensburg als Zentrum der bayerischen Seidenzucht
Regensburg - München-Theresienwiese * Regensburg hat sich zum Zentrum der bayerischen Seidenzucht entwickelt. Die Qualität der erzeugten Seide findet Anerkennung und die Regensburger Gesellschaft zur Beförderung der Seidenzucht bekommt auf dem Oktoberfest des Jahres 1836 eine Auszeichnung.
16. 10 1836 - Die Alte Pinakothek wird eröffnet
München-Maxvorstadt * Die Alte Pinakothek an der Barer Straße wird eröffnet. Aus dem überreichen Gemäldebestand können nur 1.300 Bilder gezeigt werden.
22. 11 1836 - König Otto von Griechenland heiratet die 18-jährige Prinzessin Amalie
Oldenburg * König Otto von Griechenland heiratet in Oldenburg die 18-jährige Prinzessin Amalie aus dem Großherzogtum Oldenburg.
12 1836 - Johann Georg August Wirth geht nach Nancy und Kreuzlingen/Schweiz
Nancy - Kreuzlingen * Der Jurist und Publizist Dr. Johann Georg August Wirth, einer der Wortführer des „Hambacher Festes“, kommt nach Nancy in Frankreich und 1839 nach Kreuzlingen im Thurgau in der Schweiz.
13. 12 1836 - Franz Lenbach kommt in Schrobenhausen zur Welt
Schrobenhausen * Franz Lenbach kommt in Schrobenhausen als 13. Kind seines Vaters, des Stadtbaumeisters Franz Joseph Lempach, und als drittes Kind seiner Mutter Josefa, eine geborene Herker, zur Welt.
Anfang 1837 - Das „Brunnhaus auf der Kalkofeninsel“ wird in Betrieb genommen
Haidhausen * Das „Brunnhaus auf der Kalkofeninsel“ wird in Betrieb genommen.
1837 - Eine Riesen-Defizit bei der „Haidhauser Armenpflege“
Haidhausen * Die Einnahmen der „Haidhauser Armenpflege“ liegen bei 4.872 Gulden, die Ausgaben bei 7.055 Gulden.
Das Defizit von 2.773 Gulden muss die Gemeindekasse übernehmen.
1837 - Erbärmliche Lebensumstände in den Herbersvierteln
Vorstadt Au - Haidhausen - Giesing * Der Auer „Armenarzt“ Anselm Martin schreibt:
„In den Herbergen sind nicht nur Menschen, sondern auch noch alle Gattungen Hausthiere Katzen, Kaninchen, Vögel, Mäuse und dergleichen, so wie alle nur erdenklichen Handwerksgeräthe, Hausutensilien, alte, bereits halb verfaulte, zusammengesammelte Leinwand, zerbrochenes Glas, neugewaschene zum Trocknen aufgehängte Wäsche und dergleichen in den kleinsten, mit zurückstoßender Luft angefüllten Gemächern anzutreffen.
Die Öfen sind gewöhnlich von Ziegel, selten von Eisen.
Die Feuerung geschieht mit Holz und zwar mit den schlechtesten und wohlfeilsten Holzgattungen, oft mit halbverfaulten, in der Isar aufgefangenen Gerten und Prügeln“.
Die „Höhe der Wohnräume“ liegt bei 180 bis 192 Zentimetern; die „Dachdeckungen“ aus Ziegel oder Blech lösen erst im 19. Jahrhundert die Schindel- oder Strohdeckung ab; ihre „Galerien und Träger“ verzieren die Bewohner mit Schnitzereien.
„Gemeinsamer Besitz“ aller Hausbewohner sind das „Grundstück“, die „Umfassungsmauern“ und das „Dach“.
Diese komplizierten Eigentumsverhältnisse führen häufig zu ausgiebigen Streitereien.
Wird das Dach undicht, so sind in erster Linie nur die Parteien des obersten Stockwerks vom Schaden betroffen, die Bewohner des Parterres dagegen haben nur sehr wenig Interesse an einer kostspieligen Reparatur.
Deshalb soll es vorgekommen sein, dass die „Oberen“ kübelweise Wasser auf den Fußboden schütteten, um die „Unteren“ drastisch an die gemeinsamen Verpflichtungen zu erinnern.
Nicht umsonst heißt es in den Akten des Landgerichts: „So viele Herbergsbesitzer sich in einem Hause befinden, ebensoviele Hauseigentümer gibt es im selben; keiner lässt sich vom andern etwas einsprechen, jeder tut in seiner Herberge, was er will“.
Auch die „hygienischen Zustände“ sind katastrophal.
Das „Trinkwasser“ muss von weit entfernten „Pumpbrunnen“ geholt werden.
Da eigene „Abtritte“ fehlen, benutzt man „Häfen und Leibstühle“.
Wegen der fehlenden Kanalisation werden „Abfälle und Abwässer“ jeglicher Herkunft in den „Auer Mühlbach“ geschüttet.
Eine „städtische Verordnung“ bestimmt deshalb, dass dies nur während der Nacht geschehen darf, da tagsüber die Frauen ihre Wäsche im „Auer Mühlbach“ waschen.
Das Fehlen der „Abfalltonnen“ bedingt viele unreinliche Wohnungen.
Dadurch sind die „Herbergsviertel“ in „Seuchenzeiten“ Brutstätten von Krankheiten.
Es ist also kein Wunder, dass viele Bewohner an den „Typhus- und Choleraepidemien“ sterben und die Einwohner oft hohen Blutzoll zu entrichten haben.
1837 - Ein Neubau der Haidhauser „Sankt-Johann-Baptist-Kirche“
Haidhausen * Erstmals ist von einem Neubau der Haidhauser „Sankt-Johann-Baptist-Kirche“ die Rede.
1837 - Die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten im Münchner Osten
Vorstadt Au - Haidhausen - Giesing * Anselm Martin, für den Münchner Osten zuständiger „Armenarzt“, schreibt in seiner „Topographie“ über die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten:
„Die Masse der Bevölkerung zieht [...] ihre Nahrungsquelle aus den Tages-Arbeiten in der benachbarten Stadt, den Fabriken des Bezirkes und namentlich den vielen nahen Ziegelöfen“.
1837 - Gut „Haidenau“ wird an den „Rittmeister“ Thelesphor von Streber verkauft
Haidhausen * Das Haidhauser Gut „Haidenau“ wird an den „Rittmeister“ Thelesphor von Streber verkauft.
Dieser tauscht es mit dem Münchner „Privatier“ Willibald Brodmann gegen dessen Besitz in Haching.
1837 - Josef Anton Ritter von Maffei kauft den „Lindauer'schen Hammer“
München-Englischer Garten - Hirschau * Der vielseitige Unternehmer Josef Anton Ritter von Maffei, einer der Mitbegründer der „Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank“ erwirbt in der „Hirschau“ für 57.000 Gulden den mit Wasserkraft betriebenen ehemaligen „Lindauer'schen Hammer“ mit einer kleinen Eisengießerei.
Er baut ihn zu einer der leistungsfähigsten Lokomotiven- und Maschinenfabriken Bayerns aus.
1837 - Freiherr Reinhard von Werneck erhält den „Civil-Verdienstorden“
München * Der inzwischen 80-jährige Freiherr Reinhard von Werneck erhält von König Ludwig I. das „Großkreuz des Civil-Verdienstordens der Bayerischen Krone“.
Ab 1837 - Joseph Anton von Maffei wird Mitglied in der „Kammer der Abgeordneten“
München-Kreuzviertel * Zwischen 1837 bis 1847 ist Joseph Anton von Maffei Mitglied in der „Kammer der Abgeordneten“.
1837 - Der Bankier Christian August Erich kauft Johann Gradl die „Neumühle“ ab
München-Englischer Garten - Tivoli * Der aus dem Hessischen stammende „Großhändler und Banquiers“ Christian August Erich kauft Johann Gradl die „Neumühle“ um 41.000 Gulden ab.
Erich war unter anderem Mitinhaber einer „Walzmühle“ in Frauenfeld im Schweizer Kanton Thurgau.
Herbst 1837 - Ein Statutenentwurf zur Errichtung einer „Walz-Getreidemühle“
München-Englischer Garten - Tivoli * Christian August Erich legt König Ludwig I. einen Statutenentwurf zur Errichtung einer „Walz-Getreidemühle“ vor, die von einer Aktiengesellschaft betrieben werden, an der sich vornehmlich die ansässigen Müller beteiligen sollten.
1837 - Emil Keßler und August Borsig gründen ihre Maschinenbauwerkstätten
Karlsruhe - Berlin * Die Ingenieure Emil Keßler in Karlsruhe und August Borsig in Berlin gründen ihre Maschinenbauwerkstätten.
Sie produzieren ihre ersten Lokomotiven - wie Joseph Anton von Maffei - im Jahr 1841.
1837 - Arnold von Eichthal erwirbt die „Schrafnagelmühle“
Untergiesing * Der Bankier und Besitzer der „Untergiesinger Lederfabrik“, Arnold von Eichthal, erwirbt das „Schrafnagelmühle“ [„Giesinger Mühle“] genannte Anwesen.
Um 1837 - Das unzweckmäßige „Postgebäude“ soll verkauft werden
München-Graggenau * Noch vor der offiziellen Eröffnung gibt es Verkaufsüberlegungen für das unzweckmäßige „Postgebäude“.
Der „Bayerische Gesandte“ in Hannover meldet, dass ein dortiger „Hotelier“, der zuvor „Schiffskapitän“ war, die umstrittene Immobilie zu einem in Deutschland einzigartigen „Gasthof der ersten Größe“ umgestalten will.
Die Verhandlungen scheitern aber letztlich am hohen Kaufpreis und an der Forderung, dass ohne königliche Genehmigung nichts an der Fassade geändert werden darf.
Bis um den 1837 - 2.300 von 3.500 bayerische Soldaten in Griechenland gestorben
Griechenland * Von den 3.500 Soldaten, die König Otto von Griechenland begleitet haben, sind 2.300 an den mangelhaften hygienischen Verhältnissen und den ständig kursierenden Epidemien gestorben.
1837 - 1.220 eheliche und 1.241 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.220 eheliche und 1.241 uneheliche Kinder geboren.
2. 2 1837 - Wahlergebnis im Sinne der Regierung beeinflusst
München-Kreuzviertel * Die nächste Zusammenkunft der Volksvertretung beginnt am 2. Februar und dauert bis zum 17. November 1837. Das Ergebnis der im Vorfeld durchgeführten Wahlen war von der Staatsregierung schon ganz in ihrem - konservativen - Sinne beeinflusst worden.
15. 2 1837 - König Otto von Griechenland und Amalie kehren nach Athen zurück
Athen * Nach neunmonatiger Abwesenheit kehrt König Otto von Griechenland mit seiner Gemahlin Amalie nach Athen zurück.
6. 3 1837 - Die Zugehörigkeit der Ramersdorfer Lüften zum Landgericht Au
Haidhausen - Ramersdorf * In der Auseinandersetzung um die Zugehörigkeit der Ramersdorfer Lüften zum Landgericht Au wird folgendes festgelegt:
„Zur Beseitigung der Nachteile, welche die gegenwärtig bestehende teilweise Unterordnung der Landgemeinde Ramersdorf unter die Landgerichte Au und München zur Folge hat, haben S.M. der König [...] zu beschließen geruht, daß der dem Steuerdistrikt Haidhausen und infolgedessen bisher dem Landgericht Au angehörige Teil der Landgemeinde Ramersdorf dem Landgericht München, welchem bereits der größere Teil dieser Gemeinde angehört, sowohl in Bezug auf Justizpflege als auch auf Administration zugewiesen und demnach der Landgemeinde Ramersdorf in ihrem ganzen Umfang und in jeder Beziehung des landgerichtlichen Geschäftskreises einem und demselben Landgericht untergeordnet werde.“
Das ist zwar sehr positiv formuliert, doch werden damit lediglich die Ramersdorfer Lüften in den Bezirk des Landgerichts München überstellt, nichts aber am Bestand der Gemeinde Ramersdorf und an der Zugehörigkeit zum Steuerdistrikt Haidhausen verändert.
Außerdem werden die „Lüftler“ - aufgrund der weiten Wege - nach Haidhausen eingepfarrt.
3. 7 1837 - Franz Xaver Zacherl kauft das Nockher-Anwesen
Vorstadt Au * Der Brauereibesitzer Franz Xaver Zacherl kauft das Nockher-Anwesen um 14.000 Gulden. Kein Wunder also, dass die Kinder später singen werden: „Des is da Nockher-Berg, der wo an Zacherl g'hört!“
23. 7 1837 - Joseph Anton von Maffei setzt die Visionen von Simon von Eichthal um
München * Der Münchner Unternehmer Joseph Anton von Maffei setzt die Visionen von Simon von Eichthal in die Tat um, in dem er sich intensiv um die Förderung des bayerischen Eisenbahnbaus kümmert.
Nachdem die München - Augsburger Eisenbahngesellschaft ihre endgültige Konzessionierung erhalten hat, wird Joseph Anton von Maffei auf der konstituierenden Verwaltungsratssitzung zunächst ins Direktorium und danach zum Vorsitzenden gewählt.
23. 7 1837 - Die 16-jährige Eliza Gilbert [= Lola Montez] heiratet Thomas James
Bath * Die 16-jährige Eliza Gilbert [= Lola Montez] heiratet in Irland den nur zwölf Jahre älteren Liebhaber ihrer Mutter, Thomas James. Beide fliehen aus dem südenglischen Bath, als Eliza mit dem siebzigjährigen Sir Lumley verheiraten werden soll.
8 1837 - Die „Bayerisch-württembergische Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“
Regensburg * Der erste Dampfer der „Bayerisch-württembergischen Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“, ein „Seitenraddampfer“, wird vom Stapel gelassen.
Er war in der Regensburger Werft von Maffei gebaut worden.
18. 9 1837 - König Ludwig I. legt sich mit der Stände-Versammlung an
München-Kreuzviertel * König Ludwig I. argumentiert vor der Stände-Versammlung so:
„Die Verfassungsurkunde räumt den Ständen keineswegs das Recht ein, die einzelnen Positionen der Einnahmen und Ausgaben unabänderlich mit verbindender Kraft für die Regierung festzustellen, nur zum Zwecke der Steuerbewilligung wird denselben das Budget vorgelegt; ein Finanzgesetz ist in der Verfassung nicht vorgeschrieben, sondern nur durch eine gezwungene Interpretation ist die bisherige Übung eingeführt worden. Zwingen lasse ich mich nicht, dafür meyne ich, sollte ich zu gut bekannt seyn. [...].“
Die Kammer der Abgeordneten wollte einen derartigen Angriff des Königs freilich nicht akzeptieren und selbst die Kammer der Reichsräte ist von den Argumenten des Innenministers Oettingen-Wallerstein überzeugt. Es kommt, was kommen musste: wer dem König nicht nach dem Mund spricht, hat mit Sanktionen zu rechnen, weshalb Ludwig I. seinen liberal geltenden Innenminister Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein am 4. November 1837 entlässt.
10 1837 - Die „Bayerisch-württembergische Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“
Regensburg - Linz * Der erste Dampfer der „Bayerisch-württembergischen Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“ fährt erstmals bis nach Linz.
Im folgenden Jahr wird der fahrplanmäßige Verkehr zwischen Regensburg und Linz aufgenommen.
4. 11 1837 - Karl August von Abel wird Innenminister
München * König Ludwig I. entlässt seinen als liberal geltenden Innenminister Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein. An seine Stelle rückt der erzkonservative Ministerialrat Karl August von Abel.
24. 12 1837 - Herzogin Elisabeth „Sisi“ in Bayern wird in München geboren
München-Maxvorstadt * Herzogin Elisabeth in Bayern, die als „Sisi“ bekannt gewordene spätere österreichische Kaiserin, wird in München geboren.
1838 - Die „Frauen vom guten Hirten“ wenden sich an König Ludwig I.
Angers - Haidhausen * Die „Generaloberin der Frauen vom guten Hirten“, Marie de St. Jean David, wendet sich an König Ludwig I., um „diesen frommen Orden auch in dieses Land zu verpflanzen“.
1838 - Der „Faber-Bräu“ und die „Eberlbrauerei“ wieder getrennt
Haidhausen * Der „Faber-Bräu“ und die „Eberlbrauerei“ gehen wieder getrennte Wege.
1838 - Die „Steinerne Bank“ wird statt des „Apollo-Tempels“ errichtet
München-Englischer Garten - Lehel * Der im „Hirschangerwald“ gelegene „Apollo-Tempel“ wird wegen Baufälligkeit entfernt.
Dafür entsteht an gleicher Stelle ein anderes Idyll: die „Steinerne Bank“, die Leo von Klenze nach Art einer griechischen „Exedra“ errichtet.
1838 - Joseph Anton Ritter von Maffei kauft die „Hofhammerschmiede
München-Englischer Garten - Hirschau * Der aus einem italienischen Adelsgeschlecht stammende Joseph Anton Ritter von Maffei kauft von der Witwe Lindauer die weit außerhalb der Stadtgrenze Münchens gelegene „Hofhammerschmiede“ in der „Hirschau“ ab.
1838 - Simon von Eichthal verkauft sein Palais an den „Konditor“ Carl Rottenhöfer
München-Graggenau * Simon von Eichthal verkauft sein Palais an der Residenzstraße 26 an den „Konditor“ Carl Rottenhöfer.
Dessen Geschäft floriert derart, dass es schon bald nach seiner Eröffnung zur „Königlich-Bayerischen Hofkonditorei“ ernannt wird.
Bis Mitte 2013 trägt es den Namen „Confiserie Rottenhöfer Café Hag“ und befand sich an der selben Adresse.
1838 - Eliza [= Lola Montez] und ihr Ehemann Thomas James reisen nach Indien
England - Indien - England * Eliza [= Lola Montez] und ihr Ehemann Thomas James brechen in Richtung Indien auf.
Kaum in Indien angekommen, verlässt Eliza ihren Mann und segelt nach England zurück, um dort einen Neuanfang zu versuchen.
Ihre Ehe wird anno 1842 aufgelöst.
1838 - 1.362 eheliche und 1.153 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.362 eheliche und 1.153 uneheliche Kinder geboren.
29. 1 1838 - Kaufvertrag für den Lindauer'schen Hammer ausgestellt
München-Englischer Garten - Hirschau * Obwohl der Kaufvertrag für den Lindauer'schen Hammer erst am 20. März unterschrieben wird, führt „von diesem Tage an [...] der Herr Käufer das Geschäft auf seine Rechnung und hat auch von diesem Tage an alle laufenden Kapitalzinsen, Staats-, Haus- und Kommunallasten zu tragen“.
20. 3 1838 - Der Kaufvertrag für den Lindauer'schen Hammer wird unterschrieben
<p><strong><em>München-Englischer Garten - Hirschau</em></strong> * Der Kaufvertrag für die Hofhammerschmiede, auch Lindauer'scher Hammer genannt, wird von Franziska Lindauer und Joseph Anton von Maffei unterschrieben. Das Unternehmen firmiert zunächst viele Jahre unter Eisenwerk Hirschau.</p> <p>Weil Maffei gegenüber seinen Konkurrenten Emil Keßler in Karlsruhe und August Borsig in Berlin nicht als Nachzügler erscheinen will, gibt er immer 1837 als Gründungsjahr seines Unternehmens an.</p>
Um 4 1838 - Adolf Friedrich von Schack legt sein „juristisches Staatsexamen“ ab
??? * Adolf Friedrich von Schack legt sein „juristisches Staatsexamen“ ab.
Nach einem dreiviertel Jahr „Referendarzeit“ erhält er - aus gesundheitlichen Gründen - Urlaub für ein Jahr, den er auch zur Vertiefung seines Sprach- und Literaturstudiums nutzt.
23. 4 1838 - König Ludwig I. lässt die „Zensur“ ausweiten
München * Der Gipfel der presse- und postfeindlichen Maßnahmen wird erreicht, als König Ludwig I. die „Zensur“ ausweitet und die Zulassung einer Zeitung so ändert, dass alle Zeitungen die unangenehm aufgefallen sind, nicht mehr von der „Post“ ausgeliefert werden dürfen.
Das heißt, ihnen das sogenannte „Postdebit“ zu verweigern oder nachträglich zu entziehen.
Durch den Gebrauch des „Postdebits“ als „Zensurmaßnahme“ macht sich Bayern in ganz Europa zum Gespött der Presse.
Die Furcht des Königs vor den Zeitungen ist freilich berechtigt.
Sein autokratisches Regiment ist ein beliebter Stoff für die deutsche und ausländische Presse.
14. 6 1838 - Graf Maximilian Joseph von Montgelas stirbt
München-Maxvorstadt * Graf Maximilian Joseph von Montgelas stirbt in seinem Haus am Karolinenplatz 2.
6. 7 1838 - Simon von Eichthal kauft die Giesinger Mühle
München - Untergiesing * Arnold von Eichthal stirbt. Sein Bruder, Simon von Eichthal, kauft die Giesinger Mühle den Erben um 57.000 Gulden ab.
14. 8 1838 - König Ludwig I. erlässt die die Kniebeugeverordnung
München * Als ein Beispiel der rückwärtsgewandten antikatholischen Maßnahmen kann die „Kniebeugeverordnung“ für die Bayerische Armee gelten.
Die Vorschrift über die Kniebeuge war vom damaligen Kurfürsten Max IV. Joseph im Jahr 1803 abgeschafft worden, nachdem Baiern kein ausgesprochen katholisches Land mehr war und Katholiken und Protestanten in der gleichen Armee dienten. Wenn also der Priester den Segen gab, knieten sich die Katholiken hin, während die Protestanten gemäß ihrer Glaubensauffassung stehen blieben. Nun befiehlt aber König Ludwig I., dass Alle niederzuknien haben.
24. 8 1838 - Das Kgl. General-Postamts-Bureau wird eröffnet
München-Graggenau * Nach vier Jahren Bauzeit kann das Kgl. General-Postamts-Bureau in der heutigen Residenzstraße 2 endlich für die Allgemeinheit geöffnet werden. Die Gesamtkosten sind in der Zwischenzeit auf 369.000 Gulden gestiegen. Kein Wunder also, dass in der Öffentlichkeit Beschwerden laut werden.
Da kann auch die damals hervorgehobene Funktion der Loggia, „welche den Abreisenden oder den Freunden der ankommenden Reisenden einen angenehmen Aufenthaltsort zum Abwarten darbietet“, die Kosten kaum rechtfertigen und die Mängel aufwiegen.
8. 10 1838 - König Ludwig I. genehmigt die Gründung einer Walz-Getreidemühle zu Tivoli
München-Englischer Garten - Tivoli * König Ludwig I. genehmigt die Gründung einer Walz-Getreidemühle zu Tivoli. Am Namen wird noch gefeilt und so wird aus der Neumühle die Königlich bayerische privilegierte Ludwigs-Walzmühle in München.
Von den damals 13 ansässigen Münchner Müllermeistern wird nur Anton Huber von der Hofpfistermühle Aktionär. Die übrigen bekämpften Christian August Erich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Argumenten.
21. 11 1838 - Die Rosseführer an der Hauptpost
München-Graggenau * Als letzter Schritt zur Fertigstellung der Hauptpost-Fassade zum Max-Joseph-Platz werden sechs Bilder mit „Rosseführern“ angeordnet, die von Johann Georg Hiltensperger auf den roten Grund der Hallenrückwand gemalt werden.
1839 - Die „Nicolai-Kirche“ am Gasteig wird grundlegend renoviert
Haidhausen * In einem zwei Jahre andauernden Zeitraum wird die „Nicolai-Kirche“ am Gasteig grundlegend renoviert.
1839 - Die „Maffei'sche Fabrik“ beschäftigt bereits 160 Arbeiter und Tagelöhner
München-Englischer Garten - Hirschau * Angeblich beschäftigt die „Maffei'sche Fabrik“ bereits 160 Arbeiter und Tagelöhner.
Doch diese Angabe scheint weit überzogen.
Das Münchner „Kunst- und Gewerbeblatt“ vom Juni 1852 beziffert die von Maffei im Jahr 1839 bezahlten Wochenlöhne auf 12.500 Gulden.
Davon kann er unmöglich 160 Arbeiter bezahlt haben.
Das wären lediglich 1½ Gulden in der Woche.
1839 - Joseph Hall wird Direktor im „Eisenwerk Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Joseph Anton von Maffei engagiert Joseph Hall, einen englischen Ingenieur, als Direktor für das „Eisenwerk Hirschau“.
Joseph Hall war zur Montage der sechs in England gefertigten Lokomotiven nach München gekommen.
Die Zugmaschinen sollen auf der Strecke München - Augsburg eingesetzt werden.
1839 - Auf königlichem Wunsch entsteht ein Übernachtungsbetrieb
München-Kreuzviertel * Der königliche Wunsch, „daß ein bedeutender Gasthof hieher komme“, trifft bei Joseph Anton Ritter von Maffei auf offene Ohren. Er erwirbt für 163.400 Gulden zwei Anwesen an der Prannergasse und vier ihm benachbarte Häuser an der ehemaligen Kreuzgasse, darunter den Gasthof Goldener Bär.
Anschließend lässt er das Hotel zum Bayerischen Hof projektieren und errichten. König Ludwig I. äußert für den Hotelbau einen ganz persönlichen Wunsch. Ausgerechnet der verantwortliche Bauherr der Ludwigstraße und der Ruhmeshalle, der Glyptothek und der Pinakotheken sowie zahlreicher anderer Bauwerke innerhalb und außerhalb Bayerns, hat in seiner Residenz kein adäquates Badezimmer, sodass er sich zwei Mal im Monat die Ehre gibt, im Hotel zum Bayerischen Hof sein Bad zu nehmen.
Schon aus diesem Grund besitzt die neue Nobelherberge das besondere Wohlwollen „Seiner Allerhöchsten Majestät“, die dem Hotelbetrieb deshalb sogar das Führen des Bayerischen Staatswappens mit Löwen, Rauten und Krone erlaubt. Mit dieser Nobelherberge schafft Anton Ritter und Edler von Maffei einen Übernachtungsbetrieb, der - bis zum heutigen Tag - als erste Adresse Münchens gilt.
1839 - Christian August Ernst kauft die Gaststätte „Zum Tivoli“
München-Englischer Garten - Tivoli * Christian August Ernst kauft die Gaststätte „Zum Tivoli“ und verpachtet sie an den bisherigen Besitzer.
1839 - Die Urbarmachung der Isar in Untergiesing beginnt
Untergiesing * Die Urbarmachung der Isar in Untergiesing beginnt.
Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Isar ein ungebändigter und wilder Gebirgsfluss, der im Süden der Stadt aus unzähligen, sich ständig verändernden Armen, Sümpfen und zum Teil bewachsenen Inseln besteht.
Eine Besiedlung der ufernahen Bereiche ist aufgrund der Überschwemmungsgefahren unmöglich.
Gleichzeitig entstehen hier die ersten „städtischen Grünanlagen“, nachdem „Baurat“ Franz Carl Muffat die Sümpfe und Wasserarme der weitverzweigten Isar mit Bauschutt, Haus- und Straßenabfällen auffüllen lässt, um so nutzbares Land für die „Anpflanzung von Maulbeerbäumen“ zu gewinnen.
Die bayerische Regierung verspricht sich von der Züchtung eigener Raupen die Unabhängigkeit von den teueren Seidenimporten.
Zur Ernährung der Raupen sind aber die Blätter der „Maulbeerbäume“ Grundvoraussetzung.
1839 - Simon Freiherr von Eichthal muss die „Lederfabrik“ mehrmals erweitern
Untergiesing * Die Nachfrage nach „lackiertem Leder“ ist - sowohl im Inland, wie auch im Ausland - so enorm hoch, dass der neue Besitzer, der „Hofbankier“ und „Großspekulant“ Simon Freiherr von Eichthal, die „Untergiesinger Lederfabrik“ in den Jahren von 1839 bis 1865 in mehreren Schritten erweitern lassen muss.
1839 - Der Standort des „Maximilianeums“ wird entwickelt
Haidhausen - München-Lehel - München-Graggenau * Der Standort des heutigen „Maximilianeums“ wird erst ins Auge gefasst, nachdem „Thronanwärter“ Max II. mit dem Gedanken einer vom „Max-Joseph-Platz“ ausgehenden und zur „Akropole“ führenden „Prachtstraße“ spielt.
Damals notiert er unter „Auszuführendes in München” den Plan einer „Verbindung der Stadt mit der Isar von der Neuen Residenz aus über das Lehel”.
Max‘ II. Vision wird später von Friedrich Bürklein folgendermaßen beschrieben:
„Die Anlage eines großen öffentlichen Gartens mit Vergnügungsplätzen, ausgestattet mit schönen Alleen zwischen Fahr- und Fußwegen, mit Blumenbosquetts, ist ein Bedürfniß.
In der Hauptform eines römischen Forums angelegt ein würdiger Bauplatz für öffentliche Bauten und Monumente, ein Corso, ein Sammelplatz der gebildeten Welt.
Gleich den Champs-Elysées in den entfernten Theilen zwischen Privatgebäuden: Conditoreien, Kaffee- und Speisehäuser, Säle für Musikfeste und Cirkus. Für die Anlage eines Objektes auf der Isaranhöhe wird ein Garten um so maßgebender, als durch diese Disposition genanntes Objekt gleichsam als Akropole für die Stadt erscheint”.
Der künftige König will eine - dem großstädtischen Charakter der Residenzstadt angemessene - Ausfallstraße nach Osten errichten lassen und befindet sich damit in vollkommener Übereinstimmung mit Münchens Stadtrat, der die Aufwertung dieses Stadtbereichs nach der ins Auge gefassten Eingemeindung der Vororte Haidhausen und Giesing sowie der Vorstadt Au schon seit längerer Zeit favorisiert.
Außerdem spielen militärische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle, da über die Straße die Armee zum Schutz der „Residenz“ und zur Verhinderung von Zusammenrottungen aufständischer Bürger schnellstens aufmarschieren kann.
1839 - Das Wirtshaus „Zum Hasenstall“ entsteht
München-Englischer Garten - Hirschau * Ein Wirt, dessen Namen nicht mehr feststellbar ist, erwirbt ein kleines Waldgrundstück in der „Hirschau“ und erstellt darauf ein einstöckiges Wirtshaus, das er „Zum Hasenstall“ nennt.
1839 - Preußen und andere Großmächte garantieren die belgische „Neutralität“
Brüssel * Preußen und andere Großmächte garantieren die belgische „Neutralität“.
1839 - Maulbeerpflanzungen in den Oberen Isaranlagen
Regensburg - München * König Ludwig I. besichtigt die Regensburger Plantage und zeigt sich zufrieden, weshalb im ganzen Land immer mehr Maulbeerbäume angepflanzt werden.
Da trifft es sich gut, dass die Münchner Stadtverwaltung die Kultivierung und Erschließung der brachliegenden Oberen Isaranlagen ausführen will, um dort für die Bewohner der südlichen Stadtquartiere eine Erholungszone zu erschließen, wie sie sich für die Bewohner der nördlichen Stadtviertel im Englischen Garten anbietet.
Auf der sogenannten Abdeckerinsel soll ein zwei Tagwerk großes Grundstück für die Anpflanzung von Maulbeer- und anderen Pflanzlingen vorbereitet werden.
1839 - 1.365 eheliche und 1.046 uneheliche Geburten
München * In München werden 1.365 eheliche und 1.046 uneheliche Kinder geboren.
4. 5 1839 - Aufenthaltsgenehmigung in München wegen Ehedifferenz
München * Therese Schlutt, verheiratet mit Anton Feldmüller, Gastwirt aus Kirchensur bei Amerang, ehemals Landgericht Wasserburg, beantragt eine Aufenthaltsgenehmigung in München wegen „Ehedifferenz“. Wahrscheinlich aber, um ihren väterlichen Erbteil anzutreten.
17. 5 1839 - Herzog Max in Bayern kauft das Anwesen Priel 1
Bogenhausen * Die Witwe Anna Schlutt und ihren Sohn Johann Baptist verkaufen die Immoblilie Priel 1 bei Bogenhausen an Herzog Max in Bayern („Zither-Maxl“). Dieser hat 1½ Jahre zuvor das Montgelas-Erbe in Bogenhausen erworben und erweitert jetzt durch Zukäufe seine Liegenschaft zum späteren Herzogpark.
25. 8 1839 - Die Eisenbahnstrecke München - Lochhausen wird erstmals befahren
München - Lochausen * Die Eisenbahnstrecke von München nach Lochhausen wird erstmals mit der Dampfkraft einer Lokomotive befahren.
1. 9 1839 - Feierliche Eröffnung der Eisenbahn-Teilstrecke München - Lochhausen
München - Lochhausen * Mit der feierlichen Eröffnung der Eisenbahn-Teilstrecke von München nach Lochhausen - wird der offizielle Betrieb der Privatbahn aufgenommen.
9. 9 1839 - Vorschriften für Kinderarbeit in Fabriken in Preußen
<p><strong><em>Berlin - Königreich Preußen</em></strong> * Das <em>„Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“</em> tritt in Kraft. </p> <ul> <li>Danach dürfen Kinder unter 17 Jahren erst dann arbeiten, wenn sie nachweisen können, dass sie eine dreijährige Schulbildung genossen haben. Unternehmer können diesen Punkt jedoch leicht umgehen, wenn sie eine Fabrikschule führen. Diese sind dann aber mehr Alibischulen. </li> <li>Kinder unter 17 dürfen nicht mehr als zehn Stunden täglich arbeiten. Die Ortspolizei kann jedoch die Arbeitszeit für maximal einen Monat erhöhen. </li> <li>Zwei Pausen von mindestens 15 Minuten und eine einstündige Mittagspause müssen eingeräumt werden. </li> <li>Sonntags- und Feiertagsarbeiten sowie die Nachtschicht ist für Kinder völlig verboten. </li> <li>Fabrikbesitzer müssen Buch über die Kinder in ihren Unternehmen zu führen. Nichteinhaltung der Vorschriften wurden mit Geldstrafen geahndet. </li> </ul> <p>Die Vorgaben gelten nicht für Arbeiterkinder in der Landwirtschaft. </p>
6. 11 1839 - Die Frauen vom guten Hirten können ihre Seelsorge aufnehmen
Haidhausen * König Ludwig I. erteilt in einer Kabinetts-Order den Auftrag, dass die Frauen vom guten Hirten ihre Seelsorge in den Räumen des ehemaligen Haidhauser Preysing-Schlosses aufnehmen sollen.
7. 12 1839 - Die Armen Schulschwestern kommen in die Au
Vorstadt Au * Die Armen Schulschwestern kommen in die Au.
10. 12 1839 - Das Gnadenbild wird in die neue Mariahilf-Pfarrkirche übertragen
Vorstadt Au * Das Gnadenbild wird feierlich in die neue Mariahilf-Pfarrkirche übertragen.
28. 12 1839 - Die Stände-Versammlung und die konservative Politik
München-Kreuzviertel * Die Stände-Versammlung dauert vom 28. Dezember 1839 bis 15. April 1840. Die Reichsräte und die Abgeordneten haben sich nun auch mit dem politischen Kurswechsel in der ludovizianischen Innenpolitik durch den konservativen Innenminister Karl August von Abel auseinanderzusetzen.
1840 - Die alte Mariahilf-Kirche wird abgebrochen
Vorstadt Au * Die alte Mariahilf-Kirche wird abgebrochen.
Die Mauern werden zum Bau des „Muffatwehres“ verwendet.
1840 - Pfarrer Rabl erwirbt für die „Armen-Industrie-Schule“ ein Grundstück
Vorstadt Au * Pfarrer Rabl erwirbt für die „Armen-Industrie-Schule“ ein Grundstück an der Hochstraße 11, auf dem „Knaben und Mädchen nützliche Kenntnisse in der Obstbaumzucht und Gartenkunde“ erlernen können.
1840 - Die „Frauen vom Guten Hirten“ kaufen das ehemalige „Preysing-Schloss“
Haidhausen * Die „Frauen vom Guten Hirten“ kaufen - unterstützt von König Ludwig I. - das ehemalige „Preysing-Schloss“.
Sie errichten auf dem Anwesen eine „Institution zum Zwecke der Besserung gefallener Mädchen, Frauen und Witwen, dann der Bewahrung der jungen schutzlosen weiblichen Unschuld vor Verführung“.
1840 - Die „Preysing-Allee“ wird der Gemeinde Haidhausen überlassen
Haidhausen * Die „Preysing-Allee“ wird der Gemeinde Haidhausen vom Grafen Max VI. Franz de Paula von Preysing-Hohenaschau kostenlos überlassen, nachdem ihm die Unterhaltskosten zu hoch geworden sind.
1840 - München ist für die Eingemeindung der drei östlichen Vororte
München * München ist für die Eingemeindung der drei östlichen Vororte Au, Haidhausen und Giesing.
??? 1840 - Simon von Eichthal erwirbt die „Hofmark Berg am Laim“
Berg am Laim * Simon von Eichthal erwirbt die „Hofmark Berg am Laim“ für 40.000 Gulden.
Ab 1840 - Die „Kolonie Birkenau“ entsteht inmitten von Feldern
Untergiesing * Wolfgang Wiensberger, der durch „Heurath“ in den Besitz des „Gutshofes Birkenleiten“ kommt, verkauft Teile seines unbebauten Wiesengrundes, den man damals „Birkenau Lohe“ oder „Bei den Pfaffenhäuser“ nannte, als Bauplatz.
Dadurch entsteht in der Zeit von 1840 bis 1845 die „Kolonie Birkenau“.
Sie ist in sich abgeschlossen und liegt weit außerhalb der Vorstadt Giesing - inmitten von Feldern.
Sie befindet sich zwischen dem Bahndamm, der Birkenau, der Sommer-, sowie Oberen- und Unteren Weidenstraße.
Die „Kolonie Birkenau“ stellt das Gegenstück zur „Feldmüller-Siedlung“ in Obergiesing dar.
1840 - Der durch die Isar-Regulierung gewonnene Landstreifen wird kultiviert
Untergiesing * Die Kultivierung des durch die Regulierung der Isar gewonnenen Landstreifens der rechten Isarseite beginnt mit der Pflanzung von Weiden.
Sie zieht sich aber lange Zeit hin, weil der Dammbau nur schleppend vorankommt.
Um 1840 - Die Giesinger „Narrenanstalt“ zu klein ist und genügt nicht den Ansprüchen
Vorstadt Au * In zeitgenössischen Beschreibungen Münchens findet Giesing eigentlich nur wegen seines „Narrenhauses“ Erwähnung:
„Untergiesing, ein Dörfchen am südlichen Ende der Vorstadt Au, hat eine Irrenanstalt, die jedoch wegen Mangel an Dotation den Anforderungen der Heilkunde nicht in dem Maß entsprechen kann, wie ähnliche Anstalten in anderen Hauptstädten“.
Noch Jahre später wird bemängelt, dass die Giesinger „Narrenanstalt“ zu klein ist und den Ansprüchen nicht genügt. Von Anfang an müssen statt der geplanten fünfundzwanzig Personen vierzig bis fünfzig Patienten versorgt werden.
In einer zeitgenössischen Beschreibung heißt es sarkastisch: Es ist für eine „so große Stadt wie München von günstigem Vorurtheil, ein so kleines Narrenhaus zu besitzen“.
1840 - Friedrich Bürklein beginnt den Bau des Rathauses in Fürth
Fürth * Friedrich Bürklein beginnt den Bau des Rathauses in Fürth, das nach dem Vorbild des „Palazzo Vecchio“ in Florenz ausgeführt wird.
1840 - Friedrich von Gärtner baut die Residenz des Königs Otto in Athen
Athen * Als Friedrich von Gärtner zum Bau der Residenz des Königs Otto nach Athen geht, begleitet ihn Friedrich Bürklein als „Bauüberwacher“.
1840 - In England wird eine „Postreform“ durchgeführt
Großbritannien * In England wird eine „Postreform“ durchgeführt, die ein einfaches und kundenfreundliches Tarifsystem beinhaltet.
Es basiert auf dem Grundsatz, dass die niedrig bemessene und nur nach Gewicht gestaffelte „Portogebühr“ ohne Rücksicht auf die Entfernung erhoben wird und hofft, dass durch die preiswerte Briefbeförderung die Zahl der versandten Briefe und damit auch die Einnahmen steigen werden.
Dazu werden „Briefmarken“ eingeführt.
1840 - Die Errichtung eines „Nationalbaus” nimmt eine hohe Priorität ein
Haidhausen * In den Überlegungen des „Kronprinzen“ Max II. nimmt die Errichtung des „Nationalbaus” eine hohe Priorität ein.
Doch eine mögliche Nutzung steht noch aus.
Sie findet sich erst mit dem Plan, dort ein „Erziehungsinstitut für künftige Staatsbeamte“ zu gründen.
Nun werden die Pläne für ein „Athenäum” bezeichnetes Bauwerk konkretisiert.
In den ersten Planungen wird es als „riesiger Kultur- und Sportcampus mit Kirchen, Sälen, einem Schwimmbad usw, mit insgesamt 23 Gebäuden” beschrieben.
1840 - Elisabeth Falk wird geboren
Vorstadt Au * Elisabeth Falk wird geboren.
15. 1 1840 - Eine Kinderschutzverordnung für Kinder unter 12 Jahren
München * Eine Kinderschutzverordnung legt fest, dass „Kinder unter 12 Jahren nicht regelmäßig in Fabriken, Berg-, Hütten- und Pochwerken“ beschäftigt werden dürfen.
15. 1 1840 - Theres Feldmüller lässt sich in Obergiesing nieder
Obergiesing * Die Theres Feldmüller meldet sich in München ab, um sich in Obergiesing niederzulassen und mit ihrem ererbten Vermögen ein Bauernanwesen zu kaufen. Die Ökonomie verpachtet sie weiter. Es sind vermutlich Teile des ehemaligen Sturmhofs, der bereits in der vorherigen Generation „zertrümmert“ worden war. Daneben betreibt sie am Färbergraben Nr. 4 in München eine Milchniederlage.
15. 1 1840 - Bayerns erste Verordnung zur Einschränkung der Kinderarbeit in Fabriken
<p><strong><em>München - Königreich Bayern</em></strong> * Die <em>„Königlich Allerhöchste Verordnung, die Verwendung der werktagsschulpflichtigen Jugend in Fabriken betreffend“</em> tritt im Königreich Bayern in Kraft. </p> <ul> <li>Nach dieser darf kein Kind vor dem zurückgelegten neunten Lebensjahr zu einer regelmäßigen Beschäftigung in Fabriken aufgenommen werden. </li> <li>Kinder mussten ein gerichtsärztliches Zeugnis über ihre gesundheitliche Tauglichkeit sowie ein Zeugnis der Lokalschulinspektion über vorgeschriebene Kenntnisse vorweisen. </li> <li>Die Arbeitszeit der Neun- bis Zwölfjährigen durfte nicht mehr als zehn Stunden am Tag betragen, nicht vor sechs Uhr morgens beginnen und nicht nach 20 Uhr abends enden. </li> <li>Die Erfüllung der Schulpflicht hatte durch die Teilnahme an mindestens zwei Unterrichtsstunden pro Tag zu erfolgen. </li> </ul> <p>Durch diese und weitere Bestimmungen bleibt die erste bayerische Fabrikkinder-Schutzverordnung hinter dem im Jahr zuvor erlassenen preußischen <em>„Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken“</em> zurück. Dieses hatte beispielsweise die Arbeitszeit nicht nur bis zum Alter von zwölf Jahren, sondern bis zum zurück-gelegten 16. Lebensjahr auf zehn Stunden pro Tag beschränkt. </p> <p> </p>
Um 3 1840 - Das Gasthaus „Zum Hasenstall“ in der „Hirschau“ wird eröffnet
München-Englischer Garten - Hirschau * Das Gasthaus „Zum Hasenstall“ in der „Hirschau“ wird eröffnet.
Es wird zur „Werkskantine“ der „Maffei‘schen Maschinenbauanstalt“.
Seine Gäste sind ausschließlich Arbeiter aus der „Maffei-Fabrik“.
Um 3 1840 - Theres Feldmüller erwirbt weitere Grundstücke in Obergiesing
Obergiesing * Theres Feldmüller erwirbt weitere Grundstücke in Obergiesing.
Sie lässt ihre Äcker und Wiesen parzellieren und verkauft - wann immer sie Geld braucht - ein Stück ihres Grundbesitzes als Bauplatz an zugewanderte Kleingewerbetreibende, Tagelöhner und Arbeiter des Baugewerbes zum Bau von „Eigenheimen“. Auch neu erbaute Häuser kauft und verkauft sie öfter.
Die „Feldmüller-Siedlung“ entsteht. Dieses „Arbeiterquartier“ aus der Zeit König Ludwig I. entwickelt sich gleichzeitig mit der mittelständisch-bürgerlichen „Maxvorstadt“.
Um ??? 4 1840 - Adolf Friedrich von Schack tritt in Mecklenburgische Dienste ein
Mecklenburg * Adolf Friedrich von Schack wird „Kammerjunker“ des Großherzogs Paul Friedrich von Mecklenburg und „Legationssekretär bei der Mecklenburgischen Bundestagsgesandtschaft“ in Frankfurt am Main.
23. 5 1840 - Errichtung einer Erziehungsanstalt im Berg am Laimer Jagdschlösschen
Berg am Laim * Nachdem König Ludwig I. die Errichtung einer Erziehungsanstalt im ehemaligen Berg am Laimer Jagdschlösschen der Wittelsbacher genehmigt hat, kaufen die Englischen Fräulein die Immobilie. Nach einjährigen Umbauarbeiten kann der Unterricht aufgenommen werden.
1. 7 1840 - Auswärtige Mütter entbinden in der Münchner Gebäranstalt
München * In München werden in der Zeit von 1826 bis 1840 insgesamt 19.222 eheliche und 16.015 uneheliche Kinder geboren. Fast die Hälfte der unehelichen Geburten geht auf das Konto der von auswärts kommenden Mütter, die in der Münchner Gebäranstalt entbinden.
24. 7 1840 - Die Birkenau ist sehr einheitlich erbaut
Untergiesing * Nach einem Regierungsbeschluss dürfen die neuen Eigentümer in der Birkenau jeweils nur zwei einstöckige Häuser mit drei Fenstern an der Straßenlinie zusammenbauen. Dadurch ist die Birkenau sehr einheitlich erbaut.
Zwischen den Häusern ist ein Abstand von 30 Fuß einzuhalten.Zu jedem Haus gehört ein Gartenteil. Außerdem sind die Besitzer zum Unterhalt der Straße verpflichtet, was natürlich zu Problemen führt.
10 1840 - Über die Geselligkeit auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese * „Ohne Unterschied des Standes und Geschlechtes lagerte man sich hier um die Tische, oder, wo es an Platz gebrach, gruppenweis auf die bloße Erde. [...]
Man that es mit jener Bonhomie, die keine Skrupel kennt, weil ihr der Genuß über alles geht“, heißt es 1840 über die Geselligkeit der Wiesn.
4. 10 1840 - Die Bahnlinie von München nach Augsburg geht in Betrieb
München - Augsburg * Die rund 60 Kilometer lange Eisenbahn-Gesamtstrecke von München nach Augsburg kann erstmals der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Auf der vorerst eingleisigen Strecke braucht der Reisende - trotz der acht Zwischenstationen - eine Fahrzeit von nur 2 Stunden 45 Minuten. Auf der Straße benötigt die Kutsche 17 Poststunden bis sie in der Banken- und Handelsmetropole am Lech ankommt.
In der Anfangszeit verkehren zwischen München und Augsburg täglich zwei Züge. Sie fahren um 8 Uhr und um 15 Uhr an ihren Endpunkten ab. Während der Sommermonate werden drei, gelegentlich vier Züge eingesetzt.
Neben dem Lokomotivbetrieb werden „Nacht-Fahrten mit Pferde-Kraft“ durchgeführt.
- Bei diesen Fahrten ziehen neben den Schienen herlaufende Pferde die Wagen.
- Die Reisenden brauchen - bei fünfmaligem Pferdewechsel - acht Stunden bis ans Ziel.
- Da dieses Fahrten nicht rentabel sind und der Bahndamm dabei Schaden nimmt, werden sie nach kurzer Zeit wieder eingestellt.
Um 12 1840 - Die Bauarbeiten für das „Max-Joseph-Stift“ sind abgeschlossen
München-Maxvorstadt * Die Bauarbeiten für das „Max-Joseph-Stift“, einem „Erziehungsinstitut für Töchter aus höheren Ständen“ sind abgeschlossen.
1841 - Der „Krebsbauernhof“ umfasst 98,6 Tagwerk Grund
Vorstadt Au * Der „Krebsbauernhof“ umfasst 98,6 Tagwerk Grund.
Davon liegen im Steuerdistrikt Obergiesing 65,6 Tagwerk, der Rest verteilt sich auf die Au, Haidhausen und Perlach.
1841 - Die Auer und die Giesinger streiten sich um die „Irrenanstalt“
Vorstadt Au - Giesing * Die Auer legen Beschwerde ein, da die „Irrenanstalt“ ja innerhalb ihrer Grenzen liegt.
Die Giesinger Gemeindeverwaltung argumentiert damit, dass sich die aus der Au seit 1812 weder um die „Irrenanstalt“, noch um die Straßen und Wege gekümmert haben. Außerdem beweist alleine schon der Name „Giesinger Irrenhaus“ deren gemeindliche Zugehörigkeit.
Schließlich haben die Giesinger damit Erfolg.
1841 - Lola Montez befasst sich mit den modernen spanischen Tänzen
London * Eliza oder Betty James [= Lola Montez] befasst sich mit den damals modernen spanischen Tänzen und besucht einige Ausbildungsstunden bei einer Tanzlehrerin in London.
Seit dieser Zeit gibt sie sich als spanische Adelige mit dem exotischen Namen „Maria de los Dolores Porrys y Montez” aus.
Bald stellten sich die ersten Verehrer aus den besten Londoner Kreisen ein und schon erscheint ihr Name in allen Zeitungen.
Damit beginnt der Karriere-Stern der „Donna Lola Montez vom Teatro Real, Sevilla” zu leuchten.
Das gebildete England begeistert sich seit den Dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts an Spanien und den von dort stammenden Tänzen.
5 1841 - Die „Frauen vom guten Hirten“ bauen eine Klosterkirche und Wohngebäude
Haidhausen * Eine Spende König Ludwigs I. in Höhe von 10.000 Gulden und weitere Schenkungen und Sammlungen ermöglichen den „Frauen vom guten Hirten“ in Haidhausen den Bau einer Klosterkirche und von zwei Wohngebäuden.
1. 5 1841 - Die „Frauen vom guten Hirten“ feiern in Haidhausen die erste „Maiandacht“
Haidhausen * Die Klosterinsassen des Ordens der „Frauen vom guten Hirten“ feiern - nach dem Vorbild ihres französischen Mutterhauses - in Haidhausen die erste - freilich noch nicht öffentliche „Maiandacht“.
12. 6 1841 - Die Deutsche Werktagsschule der Englischen Fräulein in Berg am Laim
Berg am Laim * Die Klosterfrauen der Englischen Fräulein eröffnen im ehemaligen Jagdschlösschen der Wittelsbacher - weit vor den Toren Münchens - mit dreizehn Zöglingen zwischen sechs und sechzehn Jahren die Deutsche Werktagsschule der Englischen Fräulein in Berg am Laim.
Im Gegensatz zum Nymphenburger Institut werden in Berg am Laim keine Töchter der höheren Stände erzogen. „Hier wird das Institut für bürgerliche Stände bestimmt, die Gränzen einer guten Elementarschule, nach dem Schulplan des Königreichs Bayern, nicht überschritten.
Nur ausnahmsweise wird theoretischer Musikunterricht, sowie Unterricht in der französischen Sprache [...] ertheilt. Dagegen werden die Zöglinge in allen Zweigen der weiblichen Hand-Arbeiten, und der Haushaltung, der Küche, der Wäsche, des Gartens usw. vorzugsweise eingeübt.“
Das angesprochene Bildungsziel für Mädchen unter König Ludwig I. lautet: „Es [das Weib] soll das von Männern gefundene bloß lernen, um es zu benützen, und nur lernen, was sich in seinem Wirkungskreis als künftige Magd oder Frau, Gattin, Mutter, Gesellschafterin anwenden lässt.“
Der Elementarunterricht findet täglich je zwei Stunden vormittags und nachmittags statt. Es bleibt also genügend Zeit für Hausfrauenarbeiten.
9. 9 1841 - Ritter Maffei bittet den König zur Namensgebung seiner Lokomotive
München * Joseph Anton von Maffei vertritt gegenüber König Ludwig I. die Auffassung, dass es notwendig ist, „alles Eisenbahnmaterial im eigenen Land herzustellen, um unabhängig vom Ausland zu werden“. Er habe zu diesem Zweck das Lindauer'sche Hammerwerk, eine Eisenschmiede mit kleinem Walzwerk, erworben und zu einer Maschinenfabrik mit Gießerei und Kesselschmiede umgestaltet. Dort, in der Hirschau, stünde seine erste, mit eigenen Mitteln erbaute Lokomotive vor der Vollendung. Und weil er die Maschine auch verkaufen will, bittet er den König - in einer peinlich unterwürfigen Sprache - zur Namengebung der Lokomotive:
„Euer Königliche Majestät wollen den in meiner Werkstätte erbauten ersten Bayerischen Dampfwagen den Namen Allergnädigst zu bestimmen geruhen.
Indem ich der Gewährung dieses allerunterthänigsten Gesuchs von Eurer Königlichen Majestät Huld und Gnade entgegenharre, erstrebe ich allertiefster Ehrfurcht Euer Königlichen Majestät
allerunterthänigst treugehorsamster Joseph Anton von Maffei“.
11. 9 1841 - Maffei's Lokomotive heißt „Der Münchner“
München - Berchtesdaden * Das von Joseph Anton von Maffei aufgesetzte Schreiben zur Namensgebung seiner in der Hirschau gefertigten Lokomotive erhält der Verfasser mit einem von König Ludwig I. ausgeführten handschriftlichen Vermerk aus Berchtesgaden zurück:
„Mit vielem Vergnügen erfuhr des Dampfwagens Erbauung aus München und dem ausgesprochenen Wunsche gemäß, daß ich ihm einen Namen geben möchte, soll er der „Münchner“ heißen“. Von einem Kaufangebot für die Lokomotive ist nichts zu lesen. Das wird bis noch 1845 dauern.
Überhaupt muss Joseph Anton von Maffei seine erste Lokomotive wie Sauerbier anbieten, denn „Der Münchner“ war keine Auftragsarbeit, sondern eher ein Gesellenstück, mit dem er die Leistungsfähigkeit seines Unternehmens unter Beweis stellen will. Räder, Treibachse, Kesselbleche und einige feinmechanische Teile mussten noch aus England bezogen werden. Und die München - Augsburger Eisenbahngesellschaft hat sich schon mit acht Lokomotiven eingedeckt und ist damit überversorgt.
25. 9 1841 - Ein Haberfeldtreiben gegen den Pfarrer
Wöllkauer Anhöhe bei Irschenberg * In der Nacht vom 25. zum 26. September 1841 zitieren etwa 100 Haberer auf der Wöllkauer Anhöhe bei Irschenberg den Pfarrer Ignaz Kalm zur mitternächtlichen Stunde heraus und lesen ihm beim Schein von Fackeln und Laternen aufgrund seines recht liederlichen Lebenswandels die Leviten.
Man wirft ihm unter anderem vor, dass „er sich mit Dirnen und Eheweibern abgebe, ja, daß er sich sogar soweit verfehlt habe, einer am Sterbebette befindlichen Weibsperson die Schamteile zu berühren“. Die Anschuldigungen führen dazu, dass der Pfarrer Ignaz Kalm „wegen seines äußerst unsittlichen und in der That höchst empörenden Wandels“ des Amtes enthoben wird.
Die geistlichen Herren rücken immer mehr in das Zentrum der Verfolgung, je mehr die Amtskirche mit der zunehmenden Kriminalisierung der Haberer eine kritische Position gegenüber den Treiben einnimmt.
7. 10 1841 - Die „Münchner“ wird zum Bahnhof auf dem Marsfeld gebracht
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Münchner“ genannte Lokomotive wird von „zehn Pferden gezogen und aufs Schönste mit Blumen und Girlanden geschmückt“ zum Bahnhof auf dem Marsfeld gebracht.
Denn in der Zwischenzeit hatte Joseph Anton von Maffei, der Vorsitzende der München-Augsburger-Eisenbahngesellschaft, im Maffeischen Eisenwerk in der Hirschau, mit dem Bau von Lokomotiven begonnen. Das erforderliche technische Know-how brachte der Engländer Joseph Hall in das Unternehmen ein.
13. 10 1841 - „Der Münchner“ erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 59 km/h
München-Englischer Garten - Hirschau * „Der Münchner“, die von dem englischen Ingenieur Joseph Hall in der Münchner Hirschau gefertigte Lokomotive absolviert erfolgreich ihre Probefahrt auf der Strecke München - Augsburg. Die Lokomotive ist noch vollständig einem englischen Vorbild nachgebaut.
Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 km/h auf der Horizontalen bei 161 Tonnen Anhängelast übertrifft sie jedoch die Leistung der englischen Vorbilder. „Der Münchner“ erreicht bei Probefahrten sogar eine Spitzengeschwindigkeit von 59 Stundenkilometern.
15. 10 1841 - Das Hotel Bayerischer Hof wird eröffnet
München-Kreuzviertel * Das Hotel Bayerischer Hof kann seine Eröffnung feierlich begehen. Zu den ersten Gästen gehört die Großherzogin Stephanie von Baden, die unter dem Namen einer Gräfin von Malberg aus Karlsruhe absteigt.
29. 10 1841 - Robert von Langer wird Direktor der Zentral-Gemälde-Galerie
München - Schleißheim * Robert von Langer wird Direktor der Zentral-Gemälde-Galerie. In dieser Funktion darf er die Alte Pinakothek einrichten und die Schleißheimer Galerie umordnen.
13. 11 1841 - Königin Caroline von Bayern stirbt
München - München-Kreuzviertel * Königin Caroline von Bayern stirbt. König Ludwig I. verbietet die Aufbahrung der Toten in der evangelischen Kirche. Sie wird stattdessen in die Herzog-Maxburg gebracht.
Schloss Biederstein erbt ihre jüngste Tochter, die Herzogin Ludovika in Bayern.
18. 11 1841 - Das Portal der Theatinerkirche bleibt geschlossen
München-Kreuzviertel * Der Sarg der evangelischen Königin Caroline wird in einem feierlichen Zug von der Herzog-Maxburg zur Theatinerkirche geleitet. Sechzehn evangelische Geistliche gehen vor dem Sarg, dahinter König Ludwig I. und weitere hohe monarchische Würdenträger. An der Theatinerkirche angekommen, bleibt das Kirchenportal geschlossen.
Trotz schlechten Wetters muss die Aussegnung vor der Kirche vorgenommen werden. Erst dann können die sterblichen Überreste der Königin an die Priester des Kollegiatsstifts von Sankt Cajetan übergeben werden.
Die katholischen Priester sind in gewöhnlicher Straßenkleidung erschienen, die Kirche ist dem Anlass entsprechend nicht ausgeschmückt, keine brennenden Kerzen, keine Orgelmusik, kein Gesang. Die evangelischen Geistlichen dürfen die Theatinerkirche nicht betreten. Der Sarg wird ohne Gebet und Segen in der Gruft abgestellt. Angeordnet hat diese Maßnahmen gegen die Häretikerin der Erzbischof von München-Freising, Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel.
1842 - Die beiden Braustätten des „Zengerbräu“ werden durch ein Feuer zerstört
München-Graggenau - Haidhausen * Die beiden Braustätten des „Zengerbräu“ in der Burgstraße werden durch ein Feuer zerstört.
Die Brauerei wird teilweise an die Kellerstraße verlegt.
1842 - Die Familie Deiglmayr kauft die „Franziskaner-Brauerei“
München-Graggenau - Vorstadt Au * Die Familie Deiglmayr kauft die „Franziskaner-Brauerei“ in der Residenzstraße und verlegt den Braubetrieb auf den „Gaisberg“, der zu dieser Zeit noch zur Au gehört.
1842 - Die „Zacherl-Brauerei“ betreibt Münchens erste „Dampfbrauerei“
Vorstadt Au * Die „Zacherl-Brauerei“ in der Vorstadt Au betreibt mit Anlagen der Firma Engelhardt aus Fürth Münchens erste „Dampfbrauerei“.
Das Maischen wird statt mit Menschenkraft durch Dampfkraft erledigt. Ach die Darre und der Braukessel werden mit Dampf erhitzt.
1842 - Joseph Anton von Maffei wird Chef der „Handelskammer für Oberbayern“
München-Maxvorstadt * Joseph Anton Ritter und Edler von Maffei steht der neu gegründeten „Handelskammer für Oberbayern“ vor.
Ab 1842 - Drei Wagner-Opern-Uraufführungen in Dresden
Dresden * Zwischen 1842 und 1845 bringt Richard Wagner in Dresden seine drei Opern „Rienzi, der Letzte der Tribünen“, „Der fliegende Holländer“ und „Thannhäuser“ zur Uraufführung.
1842 - Friedrich Bürklein erhält einen Ruf an die „Bauschule“ in Prag
München - Prag * Friedrich Bürklein erhält einen Ruf an die „Bauschule“ in Prag, den er jedoch ablehnt.
1842 - Die Brauerei „Zum Oberpollinger“ wird ein Gasthof
München-Kreuzviertel * Die Brauerei „Zum Oberpollinger“ in der Neuhauser Straße wird eingestellt, die Wirtschaft zum Gasthof umgewandelt.
1. 1 1842 - Die Rheinische Zeitung erscheint erstmals
Köln * Die von liberalen Bürgern in Köln gegründete Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe erscheint erstmals. Karl Marx wird ab 15. Oktober 1842 die Redaktion übernehmen.
14. 2 1842 - Königin Carolines Herz wird in der „Theatinerkirche“ beigesetzt
München-Kreuzviertel * Das Herz der ersten bayerischen Königin Caroline wird in einer goldenen Urne in der „Theatinerkirche“ beigesetzt.
Üblicherweise werden die Herzen der Wittelsbacher in der Altöttinger „Gnadenkapelle“ untergebracht.
Nicht aber die Herzen der evangelischen Familienmitglieder.
Bei diesem feierlichen Trauerakt sind die katholischen Geistlichen in liturgische Kleider gehüllt.
Den evangelischen Geistlichen wird aber erneut der Zutritt in die Kirche verweigert.
Dies geschieht allerdings mit dem ausdrücklichen Einverständnis von König Ludwig I..
6. 7 1842 - Kronprinz Max II. wird Vorstand des Landwirtschaftlichen Vereins
München * König Ludwig I. ernennt seinen ältesten Sohn, Kronprinz Max II., zum Vorstand des General-Comités des Landwirtschaftlichen Vereins in Bayern.
8 1842 - „Die Lokomotive Münchner [...] ist, selbst geschenkt, zu theuer“
München * In einem Expertengutachten kommt die für den Ankauf der Lokomotiven zuständige „Eisenbahnkommission“ zu folgendem Ergebnis:
„Es hat daher die Lokomotive Münchner [...] keinen Wert mehr, und ist, selbst geschenkt, zu theuer“.
5. 10 1842 - Prinzessin Marie Friederike von Preußen wird per procuram getraut
Berlin * Prinzessin Marie Friederike von Preußen wird in Abwesenheit ihres Bräutigams [per procuram] nach den Vorschriften der evangelischen Kirche getraut. Prinz Wilhelm, der spätere König Wilhelm I. von Preußen und Deutscher Kaiser vertritt den Bräutigam Kronprinz Max II. von Bayern.
7. 10 1842 - Die preußische Prinzessin Marie Friederike wird nach Bayreuth gebracht
Berlin - Bayreuth * Die preußische Prinzessin Marie Friederike wird mit der Eisenbahn von Berlin ins bayerische Bayreuth gebracht.
8. 10 1842 - Prinzessin Marie Friederike wird feierlich an ihren Bräutigam übergeben
Bayreuth * In Bayreuth wird die preußische Prinzessin Marie Friederike in einem protestantischen Gottesdienst feierlich an Bayern und ihren Bräutigam übergeben. Dieser ist allerdings nicht selbst anwesend, sondern wird von Finanzminister Carl Graf von Seinsheim vertreten.
10. 10 1842 - Prinzessin Marie Friederike trifft ihren Bräutigam
Bayreuth - Landshut * Mit der Kutsche reist Prinzessin Marie Friederike nach Landshut. Dort trifft sie auf ihren Bräutigam Kronprinz Max II., der aber noch am selben Tag zurück nach München aufbricht.
11. 10 1842 - Die preußische Prinzessin Marie Friederike trifft in München ein
München * Kronprinzessin Marie Friederike trifft in der bayerischen Haupt- und Residenzstadt ein.
12. 10 1842 - In der Allerheiligen-Hofkirche heiraten Max II. und Marie Friederike
München-Graggenau * In der Allerheiligen-Hofkirche findet die Hochzeit des Kronprinzen Max II. und Prinzessin Marie Friederike nach katholischem Ritus statt. Die Trauung ist auf den Hochzeitstag König Ludwigs I. gelegt worden. Der Tag war zugleich der Namenstag von König Max I. Joseph.
15. 10 1842 - Karl Marx übernimmt die Redaktion der Rheinischen Zeitung
Köln * Karl Marx übernimmt die Redaktion der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe, die seither einen noch radikaleren oppositionellen Standpunkt vertritt.
16. 10 1842 - Ein Festzug mit Brautpaaren bewegt sich auf die Theresienwiese
<p><strong><em>München - München-Theresienwiese</em></strong> * An diesem Sonntag versammeln sich 35 Brautpaare, die aus den acht Regierungsbezirken des Königreichs Bayern stammen, samt ihren Eltern oder deren Stellvertreter, mit den Trauzeugen und der sonst an jedem Ort üblichen Begleitung eines Brautzuges. Sie werden in der katholischen Michaelskirche beziehungsweise der evangelischen Matthäus-Kirche verehelicht. </p> <p>Nach einem gemeinsamen Mittagsmahl im Saal des Alten Rathauses bewegt sich der etwa 400 Personen umfassende und in den unterschiedlichen Trachten gekleidete <em>„Hochzeiter“</em>-Zug zur Theresienwiese, in die die 24 katholischen und elf protestantischen Brautpaaren in bayerischer Tracht einbezogen werden. </p> <p>Das Kronprinzenpaar eröffnet das Oktoberfest. Danach wohnen die Brautpaare gemeinsam mit der Herrscherfamilie dem Hauptpferderennen und der Preisverleihung des Landwirtschaftsfestes bei. </p>
17. 10 1842 - Die Walhalla wird eingeweiht
Donaustauf * Bei Donaustauf wird die Walhalla eingeweiht.
25. 10 1842 - Die Hausbesitzer in der Birkenau sind zum Straßenunterhalt verpflichtet
Untergiesing * Die Besitzer der Häuser in der Birkenau sind zum Unterhalt der Straßen verpflichtet. In einem Brief beschweren sich die Siedler, dass der „ehemalige Geh- und Fahrweg von Birkenau bis zur Loh“ schon „seit 1½ Jahren verwahrlost liegt, daß er bei Regen und Schnee nur einem Wassergraben gleicht, des Tags nur mit Vorsicht, des Nachts aber gar nicht zu passiren ist“.
Zudem bitten die Birkenauer die Giesinger, diese „nicht ganz und gar versinken zu lassen, zumal auch kleine Kinder bis zur Schule durch diesen Weg watten müssen“. Das zuständige Landgericht Au antwortet darauf, dass sie selbst für den fahrbaren Zustand ihrer Straßen zu sorgen hätten.
14. 11 1842 - Die Stände-Versammlung erhält ein Mitspracherecht
München-Kreuzviertel * Die nächste Stände-Versammlung dauert vom 14. November 1842 bis zum 30. August 1843. Sie ist zu Beginn überschattet vom Ausschluss mehrerer Abgeordneter, hauptsächlich aus der Pfalz.
Den Schwerpunkt der Verhandlungen bildet wiederholt die Frage der „Erübrigungen“, deren Summe seit dem Jahr 1837 auf fast 30 Millionen Gulden angewachsen ist, und die der König ohne Beteiligung der Volksvertretung für sich beanspruchen will.
Eingespart wurden diese Gelder zum größten Teil bei Infrastrukturmaßnahmen. Dabei war der Zustand der Straßen so katastrophal, dass man amüsiert feststellte, man könne bald nicht mehr zu den Prachtbauten Ludwigs gelangen. Doch der öffentliche Straßenbau interessierte den König nicht, da ihm sonst nicht genügend Geld für „seine Sachen“ bleibt.
Zudem wird bei der Verwaltung und den Bildungseinrichtungen gespart. Der Bildungsetat bleibt dreißig Jahre lang gleich und beträgt für ganz Bayern nur ein Viertel der Zivilliste für das Königshaus.
Das Ergebnis der Stände-Versammlung ist das sogenannte „Verfassungsverständnis“, in dem der König seinen Anspruch auf die alleinige Verfügungsmacht über die „Erübrigungen“ aufgeben muss. Das Parlament erhält bei der Verwendung der Gelder ein Mitspracherecht und geht aus dieser Auseinandersetzung gestärkt hervor.
31. 12 1842 - In München produzieren nur noch 38 Brauereien das beliebte Bier
München * In München produzieren nur noch 38 Brauereien den beliebten Gerstensaft.
1843 - Die Gebäude der „Frauen vom guten Hirten“ können bezogen werden
Haidhausen * Die Wohngebäude der „Frauen vom guten Hirten“ in Haidhausen können bezogen werden.
Die Klosterkirche wird eingeweiht.
Ende 1843 - Das alte „Preysing-Schloss“ in Haidhausen wird angerissen
Haidhausen * Das alte „Preysing-Schloss“ in Haidhausen wird angerissen.
Die Steine werden für die Gruft des neuen Klostergebäudes der „Frauen vom guten Hirten“ verwendet.
1843 - Grenzen zwischen künstlerischem und mehr unterhaltendem Theater
London * Der „Theatre Regulation Act“ definiert die Grenzen zwischen künstlerischem und mehr unterhaltendem Theater.
Es gibt daraufhin nur mehr zwei große Theater in London, die für dramatische Aufführungen zugelassen sind.
Die kleinen Bühnen dürfen keine vollständigen Dramen mehr anbieten und müssten dadurch auf die „Randgebiete der theatralischen Kommunikation“ zurückgreifen.
1843 - George Jon Ashton kommt an das „Eisenwerk Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Für das „Eisenwerk Hirschau“ von Joseph Anton von Maffei wird mit George Jon Ashton ein zweiter Engländer angeworben.
1843 - Auftrag über die Lieferung von acht Lokomotiven des Typs „Bavaria“
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Kgl. Bay. Staatsbahn“ erteilt dem „Eisenwerk Hirschau“ von Joseph Anton von Maffei einen Auftrag über die Lieferung von acht Lokomotiven des Typs „Bavaria“.
Sie sollen auf der Strecke Nürnberg - Bamberg eingesetzt werden.
Um den Auftrag zu erhalten, muss Maffei die väterliche „Tabakfabrik“ als Kaution einbringen.
Der Auftrag geht aber nicht nur an „Maffei“, sondern auch an „Kessler & Martiensen“ in Karlsruhe und „Meyer & Comp.“ im elsässischen Mühlhausen.
Sie müssen sich den Auftrag zu je acht Lokomotiven teilen.
Die wichtigste Auflage für die drei Firmen lautet: „Alle Teile an den 24 Lokomotiven müssen untereinander austauschbar sein“.
Seine erste Lokomotive, den „Münchner“, hat Maffei aber noch immer nicht verkauft.
1843 - Friedrich Bürklein wird „Baukondukteur“ bei der Eisenbahn in Nürnberg
Nürnberg * Friedrich Bürklein nimmt die Stelle eines „Baukondukteurs bei der Eisenbahnbaukommission“ in Nürnberg an.
1843 - Die bayerische „Post“ erzielt Gewinne
Königreich Bayern * Die bayerische „Post“ erzielt alleine aus Briefportoeinnahmen 868.220 Gulden Gewinn.
24. 1 1843 - Ludwig von Schwanthaler erhält 4 Moriskentänzer zum Geschenk
<p><strong><em>München</em></strong> * <em>„In Anerkennung der Mühe und Anordnungen, welche er für die würdige Ausschmückung des Rathaussaales“</em> aufgewendet hat, erhält Ludwig von Schwanthaler vier Moriskentänzer zum Geschenk, von denen zuvor allerdings Kopien angefertigt worden sind.<br /> Ludwig von Schwanthaler verkauft sie bald an einen italienischen Adeligen, den Conte Pallavicini-Barrocco, der sie auf seinen Stammsitz in Villa Rocca in Cremona bringt. </p>
1. 5 1843 - Die erste öffentliche „Maiandacht“ auf deutschem Boden
München-Hackenviertel * Die erste öffentliche „Maiandacht“ auf deutschem Boden findet in der Wallfahrtskirche der „Schmerzhaften Muttergottes“ in der „Herzogspital-Kirche“ statt.
1. 5 1843 - Die erste Maiandacht in der Herzogspitalkirche
München-Hackenviertel * Die erste Maiandacht auf Münchner Boden findet in der Herzogspitalkirche statt. Die Herzogspitalkirche ist aber keine Pfarrkirche.
9. 5 1843 - Die Frauen vom guten Hirten kaufen das Schlösschen Haidenau
Haidhausen * Die selbstständige Gemeinde Haidhausen schließt mit dem Münchner Privatier Willibald Brodmann einen provisorischen Kaufvertrag für das Schlösschen Haidenau., um dort ein Krankenhaus zu erbauen. 9.200 Gulden soll das Anwesen kosten.
Doch gegen diese Pläne wehren sich die Frauen vom guten Hirten. Sie werden von König Ludwig I. unterstützt. Deshalb tritt der Nonnenorden mit Willibald Brodmann in Verhandlungen und überbietet das Preisgebot der Gemeinde Haidhausen um 800 Gulden. Das Schloss Haidenau wird danach umgehend abgerissen.
Um 6 1843 - Das Königspaar bezieht den neuen den neuen Athener „Königspalast“
Athen * König Otto und Königin Amalie von Griechenland beziehen den neuen „Königspalast“ in Athen.
9. 6 1843 - Lobgesänge auf Lola Montez
London * Die Illustrated London News schreibt über die Tänzerin Lola Montez: „Jede Bewegung ist von einem Instinkt für Rhythmus und Bewegung begleitet. Ihre dunklen Augen leuchten, wenn sie spürt, dass man sie bewundert.”
12. 6 1843 - In der Morning Post manipuliert Lola Montez erstmals ihren Lebenslauf
London * In der Morning Post manipuliert Elizabeth Rosanna James alias Lola Montez erstmals ihren Lebenslauf, indem sie schreibt: „Ich stamme aus Sevilla und wurde im Jahr 1833, als ich zehn Jahre alt war, zu einer katholischen Lady nach Bath geschickt, wo ich sieben Monate blieb und dann zu meinen Eltern nach Spanien zurückgeschickt wurde.
Seit dieser Zeit bis zum letzten 14. April, als ich in London ankam, habe ich nie einen Fuß in dieses Land gesetzt und habe London auch nie zuvor in meinem Leben gesehen.”
Um den 20. 8 1843 - Lola Montez‘ rastloses Leben verlagert sich auf den Kontinent
Berlin * Lola Montez‘ rastloses Leben hat sich auf den Kontinent verlagert. Vom Fürstentum Reuß im Thüringischen Wald kommend, wo Prinz Heinrich LXXII. residiert, trifft die Künstlerin in Berlin ein, wo sie als Tänzerin auftritt. Bei dem nach Erotik und Exotik lechzenden Publikum hat sie so enormen Zuspruch, dass das Königliche Preußische Schauspielhaus ausverkauft ist.
3. 9 1843 - Auf dem Athener Schlossplatz kommt es zur Revolte
Athen * Auf dem Athener Schlossplatz kommt es zu einer unblutigen Revolte. König Otto von Griechenland muss seine absolutistische Herrschaft aufgeben und eine parlamentarische Verfassung mit königlicher Oberhoheit anerkennen. Außerdem werden alle bayerischen und fremdländischen Offiziere und Beamten entlassen.
7. 9 1843 - Lola Montez tanzt in Berlin vor König und Zar
Berlin * Lola Montez tanzt in einer Privatvorstellung unter anderem vor König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und Zar Nikolaus I. von Russland. Als sie auf einer Truppenparade zu Ehren des Zaren einem preußischen Gendarmen mit ihrer Reitpeitsche ins Gesicht schlägt, muss sie Berlin umgehend verlassen.
12. 10 1843 - Der Grundstein für das Siegestor wird gelegt
München-Maxvorstadt - Schwabing * Anlässlich des Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig wird der Grundstein für das Siegestor gelegt. König Ludwig I. verliest den Satz: „Bayerns tapferem Heere, das zu jeder Zeit, in allen Lagen seinem Landesfürsten unerschütterlich treu war, ihm widme ich das Siegesthor.“
25. 10 1843 - König Ludwig I. unterzeichnet das Eisenbahndotationsgesetz
München * König Ludwig I. unterzeichnet das Eisenbahndotationsgesetz, das die staatliche Finanzierung der ersten Hauptstrecken sichert.
1844 - Die „Ludwigskirche“ kann eingeweiht werden
München-Maxvorstadt * Nach einer Bauzeit von 15 Jahren kann die „Ludwigskirche“ eingeweiht werden.
Peter Cornelius, den König Ludwig I. extra von Düsseldorf nach München holt, schafft das größte Fresko der Welt. Wesentlich größer als Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der „Sixtinischen Kapelle“ in Rom.
1844 - Die Regierung lehnt die Eingemeindungswünsche Münchens ab
München * Die Regierung lehnt die Eingemeindungswünsche Münchens ab.
1844 - Die „Maffei'sche Fabrik“ liefert die ersten acht Lokomotiven aus
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Maffei'sche Fabrik“ liefert die ersten acht Lokomotiven an die „Bayerische Staatsbahn“ aus, die bald einen Großteil ihres Lokomotivenbedarfs bei Maffei deckt.
Die „Suevia“, eine technisch verbesserte Lokomotive, fährt die Strecke Augsburg - Donauwörth.
Daneben stellt Maffei auch Dampfschiffe, Dampfmaschinen, Walz- und Mühlwerke, Werkzeugmaschinen und sonstige Maschinen her.
1844 - Die „Maffei'sche Maschinenfabrik“ beschäftigt 150 Arbeiter
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Maffei'sche Maschinenfabrik“ in der Hirschau beschäftigt 150 Arbeiter.
1844 - Flucht vor den Schulden
Obergiesing * Der Pächter der Theres Feldmüller in Obergiesing setzt sich unter Hinterlassung von Schulden ab.
Vermutlich ist die Ökonomie wegen der fortdauernden Grundstücksverkäufe nicht mehr Gewinn bringend zu bewirtschaften. Die Strafanzeige erbringt nichts.
1844 - Ist nicht die Chemie der Stein der Weisen ?
xxx * Justus von Liebig, einer der „Gründungsväter der Chemie“, schrieb in seinen „Chemischen Briefen“ aus dem Jahr 1844: „Der Stein der Weisen, den die Alten im dunkeln unbestimmten Drange suchten, ist in seiner Vollkommenheit nichts anderes gewesen, als die Wissenschaft der Chemie. Ist sie nicht der Stein der Weisen, der uns verspricht, die Fruchtbarkeit unserer Felder zu erhöhen und das Gedeihen vieler Millionen Menschen zu sichern?
Ist nicht die Chemie der Stein der Weisen, welcher die Bestandtheile des Erdkörpers in nützliche Producte umformt, welche der Handel in Gold verwandelt; ist sie nicht der Stein der Weisen, der uns die Gesetze des Lebens zu erschliessen verspricht, der uns die Mittel liefern muss, die Krankheiten zu heilen und das Leben zu verlängern?“.
5. 2 1844 - Im ehemaligen Isartor-Theater wird ein zweites Pfandhaus eröffnet
München * Durch den rasanten Anstieg der Bevölkerung durch Zuzüge und Geburtenüberschüsse ist die Errichtung eines zweiten Pfandleihhauses notwendig geworden. Unter der Bezeichnung Leihhaus II wird dieses an der Westenriederstraße, im Gebäude des aufgelassenen ehemaligen Isartortheaters eröffnet.
29. 2 1844 - Lola Montez hat mit Franz Liszt in Dresden eine kurze Liaison
Dresden - Paris * Lola Montez taucht in Dresden auf, wo sie mit dem Klaviervirtuosen Franz Liszt, dem damals „umschwärmtesten Mann“, eine kurze Liaison hat. Nach einem Ohrfeigenduell mit einem italienischen Tenor ist Lola auf der Flucht nach Paris, wo die „Spanische Tänzerin” an der weltberühmten Oper durchfällt und erneut Zweifel an ihrer Herkunft hochkommen.
Ein Kritiker schreibt: „Mlle. Lola hat kleine Füße und schöne Beine. Aber wie sie sie nutzt, ist eine andere Angelegenheit. Es muss zugestanden werden, dass die Neugierde, die durch Lola Montez’ Pferdepeitschen-Unterhaltungen mit der preußischen Polizei erregt wurde, nicht befriedigt worden ist.”
15. 4 1844 - Prinz Luitpold heiratet Erzherzogin Auguste Friederike von Österreich
Florenz * Prinz Luitpold, der spätere Prinzregent, heiratet in Florenz Auguste Friederike, Erzherzogin von Österreich und Prinzessin von Toskana.
25. 8 1844 - Die Eisenbahnlinie von Nürnberg nach Bamberg wird eröffnet
Nürnberg - Bamberg * Die Eisenbahnlinie von Nürnberg nach Bamberg wird eröffnet. Dabei kommt erstmals eine bayerische Lokomotive - die Bavaria der Firma Maffei in der Hirschau - zum Einsatz.
9 1844 - Der Staat übernimmt die Eisenbahn zwischen München und Augsburg
München * Der bayerische Staat übernimmt die seit 1839 bestehende private Eisenbahnstrecke zwischen München und Augsburg.
Er kauft dem privaten Konsortium die Bahnstrecke um 4,4 Millionen Gulden ab.
8. 9 1844 - Die Ludwigskirche wird eingeweiht
München-Maxvorstadt * Die Ludwigskirche wird - nach 15-jähriger Bauzeit - durch Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel eingeweiht. Der ursprüngliche Weihetermin war für den 25. August 1844 vorgesehen, konnte aber nicht eingehalten werden, weshalb weder der sich inzwischen auf einer Badereise befindliche König Ludwig I., noch der Architekt Friedrich von Gärtner und der Innenminister Karl August von Abel daran teilnehmen können.
11. 9 1844 - Der Kopf der Bavaria wird gegossen
München-Maxvorstadt * Als erstes Stück der Bavaria wird ihr Kopf gegossen.
1845 - Adolf Friedrich von Schack bringt sein dreibändiges Werk heraus
??? * Adolf Friedrich von Schack bringt sein dreibändiges Werk „Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien“ heraus.
1845 - Josef Schweiger eröffnet sein „Isar-Vorstadt-Theater“
München-Isarvorstadt * Josef Schweiger zieht mit seinem Ensemble in das „Wirtshaus Drei Linden“ in der Müllerstraße, der heutigen Kolosseumstraße 4, wo er sein ganzjährig bespielbares „Isar-Vorstadt-Theater“ eröffnet.
1845 - Friedrich Engels: „Über die Lage der arbeitenden Klasse in England“
England * Friedrich Engels veröffentlicht sein Werk „Über die Lage der arbeitenden Klasse in England“, das ihn auch in Deutschland populär macht.
Darin schreibt er: „Die Teilung der Arbeit, die Benutzung der Wasser- und besonders der Dampfkraft und der Mechanismus der Maschinerie - das sind die drei großen Hebel, mit denen die Industrie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts daran arbeitete, die Welt aus ihren Fugen zu heben. [...]
Denn wie die neue Industrie erst dadurch bedeutend wurde, dass sie die Werkzeuge in Maschinen, die Werkstätten in Fabriken - und dadurch die arbeitende Mittelklasse in arbeitendes Proletariat, die bisherigen Großhändler in Fabrikanten verwandelte; wie also schon hier die kleine Mittelklasse verdrängt und die Bevölkerung auf den Gegensatz von Arbeitern und Kapitalisten reduziert wurde, so geschah dasselbe, außer auf dem Gebiet der Industrie im engeren Sinne, in den Handwerken und selbst im Handel. [...] Die wichtigste Frucht aber dieser industriellen Umwälzung ist das englische Proletariat“.
1845 - Der „Ludwig-Main-Donau-Kanal“ ist zu gering dimensioniert
Ludwig-Main-Donau-Kanal * Der „Ludwig-Main-Donau-Kanal“ kann durchgängig befahren werden, erfüllt aber wegen seiner zu geringen Dimension nicht die in ihn gesetzten Erwartungen.
1845 - Die „Königliche Bayerische Staatsbahn“ kauft den „Münchner“
München-Englischer Garten - Hirschau * Da Joseph Anton von Maffei seine erste, im „Eisenwerk Hirschau“ gefertigte Lokomotive immer noch nicht verkauft hat, greift er zur Feder und schreibt an König Ludwig I. folgende Zeilen:
„Es sind sechs Jahre, seitdem der „Münchner“ zu bauen angefangen wurde.
Die Durchschnittszahl der in dieser Fabrik allein seither Beschäftigten Arbeiter beläuft sich für ein Jahr auf 230.
Jeder derselben, gering gerechnet, gebraucht zur Stillung seines Durstes des Tages drei Maaß Bier, was in sechs Jahren 1.511.100 Maaß betrug.
Bekanntlich entrichtet die Maaß Bier beiläufig 1 Kreuzer ärarialischen Aufschlag, so entziffert sich an diesem einzigen Gefälle schon seither eine Staatseinnahme von ohngefähr 25.000 Gulden“.
Daraufhin kauft die „Königliche Bayerische Staatsbahn“ den „Münchner“ für 24.000 Gulden und reiht ihn unter der „Nummer 25“ in ihren Lokomotivenpark ein.
1845 - Friedrich Bürklein wird nach München versetzt
München * Friedrich Bürklein wird zur „Generalverwaltung der kgl. Eisenbahnen“ nach München versetzt und studiert - im Regierungsauftrag - Eisenbahnhochbauten in Deutschland, Österreich, Belgien, Holland, Frankreich und England.
Daher kommt es, dass viele bayerische Staatsbahnhöfe nach Bürkleins Plänen errichtet werden.
1845 - König Ludwig I. will eine Briefmarke
München - London * König Ludwig I. lässt an den königlichen Gesandten in London, Baron de Getto, einen langen Brief schreiben:
„Bekanntlich wird auf den englischen Posten das Porto für inländische Correspondenz nicht in der anderwärts üblichen Weise berechnet, sondern mittelst eigentümlicher Stempel erhoben“.
Mit diesem „Stempel“ meint Ludwig I. die „Briefmarke“ mit dem Konterfei der damals zwanzigjährigen Königin Viktoria.
1845 - Arnold Zenetti legt die „Examina im Hoch- und Tiefbau“ erfolgreich ab
München * Arnold Zenetti legt die „Examina im Hoch- und Tiefbau“ erfolgreich ab.
3. 1 1845 - Karl Valentins Mutter Johanna Maria Schatte wird geboren
Zittau * Johanna Maria Schatte, die spätere Mutter von Karl Valentin, wird in Zittau (Sachsen) geboren.
7. 1 1845 - Ludwig III. wird geboren
München * Prinz Ludwig III. wird als Sohn des späteren Prinzregenten Luitpold und dessen Frau Auguste geboren. Er ist damit der älteste Enkel des regierenden Königs Ludwig I. und rund achteinhalb Monate älter als der als Märchenkönig berühmt gewordene Ludwig II..
4. 4 1845 - Das Abhalten der Maiandacht in der Michaelskirche genehmigt
<p><em><strong>München</strong></em> * Das Ordinariat genehmigt der Pfarrkirche Sankt Ludwig das Abhalten der Maiandacht. </p>
1. 5 1845 - Erste Pfarrkirchen-Maiandacht Deutschlands in der Ludwigskirche
München-Maxvorstadt * In der Ludwigskirche wird die erste Maiandacht auf deutschem Boden in einer Pfarrkirche gehalten.
Bereits im Mai 1841 wurde die Maiandacht in der Hauskapelle der Frauen zum guten Hirten im damals noch nicht zu München gehörenden Haidhausen eingeführt.
Im Mai 1843 fand die erste Maiandacht auf Münchner Boden in der Herzogspitalkirche statt. Beide Gotteshäuser waren aber keine Pfarrkirchen.
8 1845 - Lolas gewagte Aktionen steigern ihre Bekanntheit
Bonn * Von Paris kommend trifft Lola Montez in Bonn auf Franz Liszt, der dort in Gegenwart königlicher Hoheiten eine Beethoven-Statue enthüllt.
In Anwesenheit französischer und deutscher Würdenträger stürmt Lola in den Festsaal, springt auf einen Tisch und „tanzte zwischen den Schüsseln“.
Zu einem weiteren Skandal kommt es in Baden-Baden, als Lola Montez im „Spielsalon“ für einen neben ihr sitzenden Herrn ihr Kleid bis zum Oberschenkel hochzieht, um ihm den im Strumpfband steckenden Dolch zu zeigen.
Doch solche höchst gewagten Aktionen tragen nur zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der jungen Frau bei.
15. 11 1845 - Ludwig (II.) erhält den neu eingeführten Titel Erbprinz
München * Ludwig (II.) erhält den neu eingeführten Titel Erbprinz für den ältesten Sohn des Kronprinzen Max II..
28. 11 1845 - Die Armen Schulschwestern beziehen ihr Kloster am Mariahilfplatz
München-Au * Die Armen Schulschwestern beziehen das heutige Gelände nahe dem Mariahilfplatz in der Au.
1. 12 1845 - Widerstand gegen die Konfessionspolitik des Innenministers Abel
München-Kreuzviertel * Die Stände-Versammlung wird für den 1. Dezember 1845 einberufen und tagt bis zum 24. Mai 1846. Die feierliche Eröffnung der Zusammenkunft der Volksvertreter findet, wie bereits beim vorhergegangen Treffen des Jahres 1842, in der Residenz statt. König Ludwig I. sucht das Ständehaus in der Prannerstraße nicht mehr offiziell auf.
Neun Abgeordnete werden ausgeschlossen, darunter acht Protestanten. Nun kocht der Widerstand gegen die Konfessionspolitik des Innenministers Karl August von Abel hoch. Die evangelischen Untertanen fühlen sich schon seit längerer Zeit zurückgesetzt und ungerecht behandelt.
12. 12 1845 - König Ludwig I. muss den Kniebeugeerlass zurücknehmen
München * König Ludwig I. muss den sogenannten Kniebeugeerlass vollständig zurücknehmen.
1846 - Auf den Bierkellern finden Unterhaltungs-Veranstaltungen statt
Haidhausen - Vorstadt Au * Aus einer Beschwerde geht hervor, dass auf den Bierkellern „Feuerwerk, großartige Beleuchtung, Harmonie-Musik, Dienées u. dergl.“ stattfinden.
1846 - Erweiterung der Bogenhausener Schule
Bogenhausen * Nachdem die Schülerzahl in Bogenhausen stark angestiegen war, kommt es zur Erweiterung der Schule.
1846 - Der „Lenzbauernhof“ wird zum Übernachtungsbetrieb umgebaut
Haidhausen * Den „Tafernwirtsleuten“ Johann und Maria Welsch gehört der „Lenzbauernhof“ in Haidhausen.
Er wird zum Übernachtungsbetrieb umgebaut.
Die Witwe Welsch heiratet Joseph Ellwanger. Seither heißt das Anwesen und die Wirtschaft „Zum Ellwanger“.
1846 - Giovanni Maria Mastai Ferreti wird als Pius IX. zum Papst gewählt
Rom-Vatikan * Giovanni Maria Mastai Ferreti wird zum Papst gewählt.
Er nimmt den namen Pius IX. an. Seine Regentschaft wird bis 1878 dauern und ist geprägt vom Kampf der römisch-katholischen Kirche um Macht und Einfluss im Verhältnis zu den Staaten und zur eigenen Anhängerschaft.
1846 - Die „Maffei'sche Maschinenbauanstalt“ beschäftigt 372 Arbeiter
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Maffei'sche Maschinenbauanstalt“ in der „Hirschau“ beschäftigt 372 Arbeiter.
Das ist eine für das damalige München „gewaltige“ Zahl.
1846 - Der bayerische Staat rettet die „Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“
München * Der bayerische Staat rettet die privatrechtlich organisierte „Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“ durch die Übernahme vor dem Konkurs.
Ab 1846 - Auswanderungen aus dem Königreich Bayern (II)
Königreich Bayern * Zwischen 1846 und 1856 wandern 141.638 Personen aus dem Königreich Bayern aus.
26. 2 1846 - „Buffalo Bill“ in Iowa geboren
Iowa * William Frederick Cody, besser bekannt unter seinem Pseudonym „Buffalo Bill“, wird in Iowa als Sohn eines Kutschers geboren.
26. 3 1846 - Eduard Theodor Grützner wird geboren
<p><strong><em>Großkarlowitz</em></strong> * Eduard Theodor Grützner kommt als siebtes Kind einer wenig begüterten Bauernfamilie im schlesischen Großkarlowitz zur Welt. Schon als Hüterbub zeichnet er auf alles, was ihm in die Hände fällt.</p>
26. 3 1846 - Theres Feldmüller verkauft ihr letztes Grundstück in Obergiesing
<p><strong><em>Obergiesing</em></strong> * Theres Feldmüller verkauft ihr letztes Grundstück in Obergiesing und verlässt danach den Ort. Sie hat innerhalb von sechs Jahren in der Entwicklung des Dorfes bleibende Spuren hinterlassen.</p>
23. 6 1846 - Theres Feldmüller meldet sich in München ab
München * Theres Feldmüller meldet sich in München ab.
5. 10 1846 - Lola Montez trifft in München ein
München * Die Spanische Tänzerin Lola Montez trifft im biedermeierlichen München ein. Die 25-jährige Künstlerin, die in ganz Europa für ihre zahlreichen Skandale und stürmischen Affären berühmt ist, steigt in Münchens erster Adresse - dem Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz - ab und bemüht sich umgehend um ein Engagement.
Vom Intendanten des Theaters wird ihr mitgeteilt, dass für ihre Tanzaufführungen das Hof- und Nationaltheater nicht infrage kommt, weil dafür ihr Können nicht ausreichend gut sei.
6. 10 1846 - Robert von Langer stirbt zutiefst verbittert in Haidhausen
Haidhausen * Robert von Langer stirbt zutiefst verbittert - im Alter von 63 Jahren - in seinem Besitztum in Haidhausen an Lungenlähmung. Der Künstler sah sich als Maler als gescheitert an. Robert von Langer wird von seinen Zeitgenossen als „konservativer Zopfmaler“ verspottet und diffamiert. Kein Wunder, dass nach seinem Tod übersehen wurde, dass das Haus eine kunsthistorische Attraktion ersten Ranges darstellte.
8. 10 1846 - Der König und die Skandalnudel Lola Montez
München * Die spanische Tänzerin Lola Montez hat einen Termin bei König Ludwig I.. Dieser fordert zur Audienz einen Bericht über das Vorleben der Tänzerin an, in dem er lesen kann:
„Dem allerhöchste Befehle vom 6. d.M. pflichtschuldige Folge leistend berichtet der treugehorsamst Unterzeichnete Euer Koeniglichen Majestät allerdevotest, wie die spanische Tänzerin Lola Montez dadurch öffentlich Anstoß erregte, dass sie, den Mitheilungen mehrerer Zeitungen zufolge, in einem Gasthofe zu Berlin einem ihr gegenüber sitzenden Offizier, der ihr mit übergroßer Freundlichkeit zu begegnen bemüht war, ein Champagnerglas an den Kopf warf, dass sie ferner, ebenfalls Nachrichten zufolge, einem bei der Revue in Berlin sie zurechtweisenden Polizeicommisär mit der Reitgerte übers Gesicht hieb, worauf sie mit 14-tägigem Arrest bestraft wurde, und dass sie endlich in Warschau dem Publikum, das ihren Kunstleistungen den gewünschten Beifall nicht zollte, von der Bühne herab mit begleitendem Gestikulieren den hinteren Theil ihres Körpers zuwandt".
Der König will sich von der Skandalnudel ein eigenes Bild machen. Bei dieser Audienz soll sich Lola Montez, „als der König einigen Zweifel über die Realität der ersichtlichen Wölbung ihres Busens andeutet", eine Schere genommen und sich damit „das Kleid vor der Brust aufgeschnitten“ haben. Der 60-jährige Bayernkönig ist augenblicklich Feuer und Flamme für die exotische Schönheit.
- Er engagiert die als erotisches Feuerwerk bekannte Tänzerin unverzüglich und
- erlässt eine Anweisung, dass die Tänzerin in den Zwischenaufzügen des Lustspiels „Der verschwundene Prinz" spanische Tänze in spanischer Tracht darbieten soll.
10. 10 1846 - Lola Montez' erster Auftritt im Hof- und Nationaltheater
München-Graggenau * Am 36. Hochzeitstag von König Ludwig I. und Königin Therese findet Lola Montez' erster Auftritt im Hof- und Nationaltheater statt. Die angebliche Spanierin tanzt einen Cachucca und in der zweiten Pause - zusammen mit einem Ensemble-Tänzer - einen Fandango genannten Tanz.
10. 10 1846 - Theres Feldmüller erwirbt in Neuötting ein Gastwirtsanwesen
Neuötting * Theres Feldmüller erwirbt in Neuötting ein Gastwirtsanwesen.
13. 10 1846 - Lola Montez zieht in den Gasthof Zum Goldenen Hirschen
München-Kreuzviertel * Die Spanische Tänzerin Lola Montez zieht vom Hotel Zum Bayerischen Hof in den näher an der Residenz gelegenen Gasthof Zum Goldenen Hirschen an der Theatinergasse um.
14. 10 1846 - Zweiter Auftritt der Lola Montez im Hof- und Nationaltheater
München-Graggenau * Die Solotänzerin Lola Montez tritt zum zweiten und gleichzeitig letzten Mal im Münchner Hof- und Nationaltheater auf. Luise von Kobell schreibt über den Auftritt: „Lola Montez stellte sich inmitten der Bühne, nicht im Trikot, mit dem üblich kurzen Ballettröckchen, sondern in spanischer Tracht, mit Seide und Spitzen angetan, da und dort schimmerte ein Diamant.
Sie blitzte mit ihren wunderbaren Augen und verbeugte sich wie eine Grazie vor dem König, der in seiner Loge saß. Dann tanzte sie Nationaltänze, wobei sie sich in den Hüften wiegte und bald diese, bald jene Haltung einnahm, voll unerreichter Schönheit. Solange sie tanzte, fesselte sie alle Zuschauer.“
Um den 25. 10 1846 - Hofmaler Joseph Stieler malte zwei Bilder der Lola Montez
München-Maxvorstadt * Schon bald nach ihren Auftritten im Hof- und Nationaltheater lässt der verliebte König Ludwig I. Lola Montez für den Saal der Schönheiten in der Residenz malen. Dazu beauftragt er den Hofmaler Joseph Stieler. Stieler malte zwei Bilder der Lola Montez. Die Señora Lola Montez ist eine international agierende, extravagante Persönlichkeit, die man ohne Zweifel mit heutigen Pop-Stars gleichsetzen kann.
Wie die Film-, Sport- und Pop-Idole unseres Jahrhunderts versucht auch die Señora durch den bewusst herbeigeführten Skandal im Gespräch - und damit interessant - zu bleiben. Und genau wie in heutigen Tagen werden die Skandale und Skandälchen interessiert vom Volk beobachtet und in allen Details besprochen.
22. 11 1846 - „Ich bin die Mätresse des Königs. Lola Montez“
München-Maxvorstadt * Auf einem Plakatanschlag an der Schönfeldstraße 25 ist zu Lesen:
„Ich bin nicht irgendein gnädiges Fräulein, ich bin die Mätresse des Königs.
Lola Montez“.
Seit 12 1846 - Lola Montez wird ausspioniert
München-Kreuzviertel * Der bayerische „Finanzminister“ Karl Graf von Seinsheim lässt die „Tänzerin“ Lola Montez im „Gasthof zum Goldenen Hirschen“ ausspionieren.
Er schleust dazu die Creszentia Ganser als „Haushälterin“ in den „Goldenen Hirschen“ ein.
Ihr Auftrag ist, ein minutiöses Tagebuch über das „ausschweifende Nachtleben“ ihrer Arbeitgeberin zuführen.
Mit ihren „schlüpfrigen Informationen“ soll genügend Beweismaterial gesammelt werden, um die „Tänzerin“ vor das Münchner „Stadtgericht“ zu zerren, um sie letztlich des Landes zu verweisen.
Geleitet wird die gesamte Aktion vom „Polizeidirektor“ Johann Nepomuk Freiherr von Pechmann.
Doch der Plan wandelt sich ins Gegenteil.
1. 12 1846 - Lola Montez kauft ein Palais an der Barer Straße
München-Maxvorstadt * „Maria de los Dolores Miontes, genannt Lola Montes“, kauft um 16.000 Gulden vom Steinbruchbesitzer Friedrich Adam Schwarz aus Solnhofen das Palais an der Barer Straße. Die Kaufurkunde weist aus, dass Lola Montez von Anfang an als Eigentümerin des Anwesens samt Hofraum, Hintergebäuden und Garten eingetragen ist.
Damit scheinen die Voraussetzungen für ihre Einbürgerung der „Spanischen Tänzerin“ gegeben.
2. 12 1846 - Lola Montez will eingebürgert werden
München * August Manostetter, der Anwalt der Lola Montez, stellt beim Magistrat der Stadt München den Antrag auf Erwerbung des bayerischen Indigenates durch Naturalisation. Im Bewusstsein um die Brisanz des Antrags, verschleppt der Magistrat die Angelegenheit.
Die Regierung von Oberbayern lehnt die Einbürgerung ab und begründet dies unter Berufung auf das Gesetz vom 1. Juli 1834 damit, dass „Frauenspersonen [...] nicht ansässig im Sinne des Gesetzes werden, wenn sie sich nicht gleichzeitig verehelichen oder wieder verehelichen“. Gleichzeitig stellt man klar, dass Lola Montez weder einen Pass hat, noch sonst imstande ist, sich auszuweisen.
6. 12 1846 - Lola Montez - so teuer wie die Feldherrnhalle
München-Maxvorstadt * Der Kauf des Palais an der Barer Straße durch Lola Montez wird ins Grundbuchverzeichnis eingetragen. Kauf, Umbau und Ausstattung verschlingen etwa 40.000 Gulden. Man kann also sagen, dass König Ludwig I., oder besser gesagt seinen bayerischen Untertanen, Lola Montez unterm Strich so viel gekostet hat wie die Feldherrnhalle.
7. 12 1846 - Eine Schmähschrift gegen den Fürsten
München * Eine Schmähschrift gegen König Ludwig I. schlägt vor: „Wenn Landeswappen [mit] ihren Emblemen immer den sittlichen Karakter des jeweiligen Fürsten darzustellen hätten, so müsste der bayerische Löwe bald einem gemeinen Schwein Platz machen.“
24. 12 1846 - Freiherr von Pechmann wird nach Landshut versetzt
München * Als der König zu Weihnachten 1846 von dem Komplott gegen Lola Montez erfährt [Auspioniererei durch die Creszentia Ganser], nimmt er Lola in Schutz und wendet sich gegen die selbsternannten Sonderermittler. An Freiherr von Pechmann wird daraufhin ein Exempel statuiert und dieser umgehend als Landrichter nach Landshut versetzt.
31. 12 1846 - München hat 85.555 Einwohner, Bayern 4.504.876
München * München hat 85.555 Einwohner, Bayern 4.504.876.
1847 - Ein Neubau für die „Frauen vom guten Hirten“
Haidhausen * Durch den Neubau der „Frauen vom guten Hirten“ kann der Platz von bisher 140 Zöglingen um weitere 40 erhöht werden.
Umfasste der Grund des Anwesens bisher 6 Tagwerk, so konnte er auf über 12 Tagwerk verdoppelt werden.
1847 - Max Schweiger erhält die Konzession für das „Isar-Vorstadt-Theater“
München-Isarvorstadt * Nach dem Tod von Josef Schweiger bemüht sich sein Bruder Johann um die übernahme des „Isar-Vorstadt-Theaters“.
Doch die Konzession erhält dessen Sohn Max.
1847 - Der „Tapezierer“ Karl Falk gründet die „Firma Karl Falk“
Vorstadt Au * Der „Tapezierer“ Karl Falk gründet die „Firma Karl Falk“.
1847 - Das „Kostümverbot“ wird in Frankreich eingeführt
Paris * Das „Kostümverbot“ wird in Frankreich eingeführt.
1847 - Die „Maffei'sche Fabrik in der Hirschau“ liefert ihre Lokomotive „Donau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Maffei'sche Fabrik in der Hirschau“ liefert ihre Lokomotive „Donau“ an die „Kgl. Bay. Staatsbahn“.
Sie ist bis 1895 im Einsatz.
1847 - Das „Schyrenbad“ wird als „städtisches Männerfreibad“ eröffnet
Untergiesing * Das „Schyrenbad“ wird als „städtisches Männerfreibad“ eröffnet.
Schwimmen dürfen hier in der Anfangszeit allerdings nur Männer, da Gleiches für Frauen als „unschicklich“ gilt.
Vorkämpfer für die Errichtung von „Badeanstalten“ sind die Anhänger der deutschen „Volksbadebewegung“.
Sie wollen durch eine „Verbesserung der Körperpflege“ die „sittliche Verwahrlosung und den sozialen Unfrieden in der Arbeiterbevölkerung“ abschaffen.
Die minderbemittelte Bewohnerschaft soll einen Teil ihrer Freizeit in einer „Badeanstalt“ verbringen können.
Die Gruppierung teilt sich in die Befürworter der „Regenerationsbäder“ und in jene, die den „Reinigungsbädern“ den Vorrang einräumen.
Das „städtische Männerfreibad“ wird damals vom „Aubach“ oder „Auerbach“ gespeist.
Er zweigt im heutigen „Tierpark Hellabrunn“ aus dem „Auer Mühlbach“ ab.
Nach dem Auslass unterhalb der „Thalkirchner Überfälle“ wechselt der Bach seinen Namen in „Freibadbächl“.
Da das Wasser direkt aus der Isar kommt und schon aufgrund seiner Temperatur nicht unbedingt für das Badevergnügen einladend ist, muss das Wasser erst in zwei großen, flachen „Aufwärmseen“ gesammelt und wird erst danach dem „Schyrenbad“ zugeführt.
Einer dieser „Aufwärmseen“ hat sich noch bis heute im „Rosengarten“ erhalten.
Kein Wunder also, dass selbst der „Münchner Magistrat“ das „Schyrenbad“ als „ein hervorragendes Bad“ bezeichnet.
Das Schwimmbad war etwa dreihundert Meter lang und rund zwanzig Meter breit.
Es verfügt über einen schönen Baumbestand und über ein „angenehmes Bachwasser“, das „stets mild bleibt“.
Das „Freibadbächl“ fließt heute unterirdisch durch das „Schyrenbad“ und mündet als „Freibad-Auslaufkanal“ zwischen der „Reichenbachbrücke“ und der „Corneliusbrücke“ in die „Kleine Isar“ zurück.
1847 - Gründung eines Frauenvereins zur Beförderung der Seidenzucht
München * König Ludwig I. genehmigt die Gründung eines Frauenvereins zur Beförderung der Seidenzucht. Mit der Aufgabe der Obersten Schutzfrau wird Königin Therese beauftragt.
Im Morgengrauen des 1 1847 - Eine Schmähschrift am Regensburger „Knorrkeller“
Regensburg * Am Regensburger „Knorrkeller“ findet die Polizei folgenden Reim:
„Montez du große Hur‘
Bald schlagen wird dein Uhr
Wo wir di außi hau‘n
Weil d‘Münchner sich nöt trau‘n.
Pfuy Teufl Königshaus
Mit unsrer Treu is aus
Bringst uns in Schand und Spott
Helf‘ uns der liebe Gott.
Ein Gebirgler“.
1. 1 1847 - Innenminister Abel wird ein wichtiges Ressort entzogen
München-Kreuzviertel * Dem Innenminister Karl August von Abel wird ein wichtiges Ressort entzogen, indem man ein eigenes Ministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten ins Leben ruft. Zum zuständigen Minister wird Karl Freiherr von Schreck ernannt.
5. 1 1847 - König Ludwig I. ordnet Personenschutz für Lola Montez an
München * Um seine Geliebte vor Übergriffen zu schützen, ordnete König Ludwig I. Personenschutz für Lola Montez an. Er befiehlt, die „Begleitung der Spanier in Lolla Montez durch einen Gendarmen nicht nur für das Theater, Konzerte u.d.gl. [...], sondern dass, auf so lange Allerhöchstdieselben nicht anders verfügen, ununterbrochen ein Gendarm bey derselben zu ihrem Schutze sich befinden soll“.
7. 2 1847 - König Ludwig I. legt den künftigen Bahnhof-Standort fest
München-Maxvorstadt * König Ludwig I. legt sich auf das Gelände der „Königlich Privilegierten Hauptschützengesellschaft“ als künftigen Bahnhof-Standort fest.
8. 2 1847 - Der Staatsrats ist gegen die Einbürgerung der Lola Montez
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Staatsrats befasst sich in seinen Sitzungen vom 8. und 9. Februar 1847 mit dem Gesuch auf <em>„Erwerbung des bayerischen Indigenates durch Naturalisation“</em> für Lola Montez - spricht sich aber einmütig dagegen aus. </p>
11. 2 1847 - Auch Innenminister Karl August von Abel verweigert die Unterschrift
München * Innenminister Karl August von Abel soll das Indigenat [= Einbürgerung, Staatsangehörigkeit, Heimatrecht] für Lola Montez gegenzeichnen. Doch dieser versicherte sich der Solidarität seiner Justiz-, Finanz- und Kriegsminister-Kollegen und bittet in einem von ihm verfassten und gemeinsam unterzeichneten Memorandum um die „Entfernung der Unruhestifterin“ oder um Amtsenthebung.
Der Inhalt des Memorandums, das Karl August von Abel in einem Akt mit der Aufschrift „Die unnennbare Weibsperson betr.“ aufbewahrt, wird in der Augsburger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.
16. 2 1847 - Verärgert entlässt König Ludwig I. das gesamte Kabinett
München * Die Veröffentlichung des Memorandums von Karl August von Abel in der Augsburger Allgemeinen Zeitung verärgert den starrsinnigen König derart, dass er in seiner Empörung die vier aufsässigen Minister entlässt. Für die Ultramontanen um Minister Karl August von Abel kommen jetzt liberale Männer in Amt und Würden. Man spricht jetzt vom „Ministerium der Morgenröte“.
Mit der Neubesetzung der Ministerien steht der Ernennung der Señora Lola Montez zur Gräfin Maria von Landsfeld nichts mehr im Weg. Immerhin ist es den deutschen Landesfürsten seit dem Jahr 1806 möglich, selbst Adelsbriefe auszustellen. Auch König Ludwig I. macht von dieser Regelung regen Gebrauch und adelte seine Künstler reihenweise - bezahlt sie dafür aber schlecht.
19. 2 1847 - Ludwig I. entzieht Professor Ernst von Lasaulx die Lehrerlaubnis
München-Maxvorstadt * Der Universitätsprofessor Ernst von Lasaulx fordert im Senat der Universität, dass man dem abgetretenen Innenminister Karl August von Abel für sein „mannhaftes Eintreten für die Sache des Rechts und der Moral“ eine Dankaufwartung machen sollte. Daraufhin wird ihm von König Ludwig I. die Lehrerlaubnis entzogen.
28. 2 1847 - Im Karlsruher Hoftheater bricht ein Feuer aus
Karlsruhe * Im Karlsruher Hoftheater bricht ein Feuer aus, das innerhalb von 28 Minuten gelöscht werden kann und deshalb „nur“ 63 Menschenleben fordert.
Um 3 1847 - Das „Palais für Königin Therese“ ist fertiggestellt
Schwabing * Das an der „Schwabinger Landstraße“ erbaute „Palais für Königin Therese“ ist fertiggestellt.
Der Architekt ist Friedrich von Gärtner.
13. 3 1847 - Lola Montez wohnt jetzt in der Theresienstraße 8
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Lola Montez wohnt jetzt in der Theresienstraße 8, beim <em>„Maurerpolier“</em> Lüglein, zur Miete. Die Solotänzerin hatte bei einem Hausball dem Geschäftsführer des Gasthofs <em>„Zum Goldenen Hirschen“</em> in aller Öffentlichkeit eine Watschen verpasst. Deshalb erhält sie - nach fünf Monaten - ein Hausverbot.</p> <p>Das Zimmer dient ursprünglich nur als Zwischenlösung, bis das am 1. Dezember 1846 vom König angekaufte, neu gestaltete und standesgemäße Palais an der Barer Straße 7 bezugsfertig ist. Doch kann sie dieses Haus erst am 28. April 1847 beziehen. </p>
Um 4 1847 - Der Widerstand gegen die bayerische Zensurpraxis wird immer größer
München * Der Widerstand gegen die von König Ludwig I. eingeführte bayerische Zensurpraxis wird immer größer.
4. 4 1847 - Der Münchner Bahnhof fällt einem Brandanschlag zum Opfer
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Einem Brandanschlag auf den <em>„Münchner Bahnhof“</em>, eine Holzkonstruktion etwa auf der Höhe der heutigen Hackerbrücke, fällt nicht nur das Gebäude, sondern auch sechs Waggons samt der darauf gelagerten 300 Scheffel Weizen zum Opfer.</p> <p>Vermutlich machen die unbekannt gebliebenen Täter die Eisenbahn für die seit mehreren Jahren anhaltende Teuerung des Getreides verantwortlich. Denn schon bald hieß es:<br /> <em>„Zu meinen Zeiten hast nix von Dampfwagen g'hört! Alles ist ruhig sein Weg gangen; aber desto mehr Dampfnudeln hat's geben; und je mehr Dampfwagen herkommen, desto rarer werden die Dampfnudeln! Die Zeit wird immer schlechter!“</em></p>
21. 4 1847 - Friedrich von Gärtner stirbt
<p><strong><em>München</em></strong> * Friedrich von Gärtner stirbt. Eduard Metzger übernimmt daraufhin die Bauleitung für die Arbeiten am Siegestor.</p>
3. 5 1847 - Das Gelände der „Schießstätte“ wird an die Eisenbahn verkauft
München-Ludwigsvorstadt - München-Maxvorstadt * Das Gelände der „Königlich Privilegierten Hauptschützengesellschaft“ wird an die staatliche „Generalverwaltung der Kgl. Eisenbahnen“ um 150.000 Gulden verkauft.
Weil aber viele Bürger die Notwendigkeit der Eisenbahn nicht anerkennen, beschweren sie sich in einer „Petition“ über den Verkauf der „Schießstätte“.
Für die Beschwerdeführer ist die Eisenbahn ein „unnützes Spielzeug finanzkräftiger und prestigesüchtiger Bürger“.
Außerdem, so die Kritiker, schadet das Reisen mit der Eisenbahn - durch die Rauchentwicklung, der die Passagiere schutzlos ausgeliefert sind - der Gesundheit.
Tatsächlich verfügt damals nur die erste Wagenklasse über verglaste Fenster;
die Wagen der 4. Klasse sind nicht einmal überdacht.
Und da die „München-Augsburger-Eisenbahngesellschaft“ statt der teuren Kohlen mit Torf und Holz heizt, regnet es nicht selten auch brennende Funken und Späne auf die Passagiere nieder.
Die Argumente änderten letztlich aber nichts am Verkauf der „Schießstätte“.
Doch zur Beruhigung der Situation lässt König Ludwig I. die zu fällenden Kastanien ausgraben und am „Wittelsbacher Palais“ wieder einpflanzen.
27. 5 1847 - Gründung der Generalverwaltung der Posten und der Eisenbahnen
München * Die Bayerische Eisenbahn und die Post werden in der Generalverwaltung der Posten und der Eisenbahnen zusammengefasst.
1. 6 1847 - Die Besitzungen Ramersdorfs im Steuerdistrikt Haidhausen
Haidhausen - Ramersdorf * Die Gemeinde Haidhausen gibt einen Bericht an die Königliche Steuerkatasterkommission, in dem die Besitzungen Ramersdorfs im Steuerdistrikt Haidhausen aufgezählt werden.
20. 6 1847 - Das Rauchverbot in den Straßen und auf den Plätzen wird aufgehoben
München * Das Verbot des Tabakrauchens in den Straßen und auf den Plätzen wird aufgehoben. Danach bleibt es nur in der Nähe der königlichen Residenzen und in den Arcaden des Hofgartens verboten. Die rauchende Lola Montez passt natürlich in das Bild der verruchten und selbstbewussten Frau. Denn das Rauchen ist eine männliche Domäne.
23. 7 1847 - Verkauf des Langer-Schlösschens
Haidhausen * Robert von Langers Cousine Josepha verkauft das Schlösschen an den Wirt Johann Baptist Riemer, der die Künstlervilla an der heutigen Einsteinstraße in eine Gastwirtschaft mit dem Namen Schlosswirtschaft oder Riemerwirt umwandelt.
Das Anwesen kommt nach mehreren Weiterverkäufen in den Besitz der Münchner-Kindl-Brauerei, die unter den Wandbildern durchreisende Handwerksburschen übernachten lässt.
26. 7 1847 - Dem Korps Alemannia werden alle Rechte garantiert
München * Dem Korps Alemannia werden alle Rechte garantiert, die auch die anderen Korps haben. Die neue Studentenverbindung Alemannia steht unter dem Schutz der Lola Montez - und versteht sich umgekehrt als ihre Garde. Angeblich sind ihre roten Mützen aus den Unterröcken der Tänzerin geschneidert.
Es wird nicht lange dauern, bis man die Alemannen als „Lolamannen“ diffamiert. Mehr wie achtzehn Mitglieder zählt die Verbindung nie. Wenn sie die Hörsäle betreten, ertönt ein gellendes Pfeifkonzert, weshalb sie sich bevorzugt im Kaffeehaus Rottmann treffen. Es befindet sich gegenüber dem Hofgartencafé von Luigi Tambosi, am anderen Ende des Bazargebäudes.
Der 23-jährige Jurastudent Elias [genannt Fritz] Peißner aus Vilseck in der Oberpfalz ist der leitende Senior der Verbindung. Er hat eine Art Büro im Palais Montez eingerichtet und ist verdächtigt, Lolas Liebhaber zu sein.
4. 8 1847 - Das „Adelsdiplom“ für Lola Montez
München * König Ludwig I. erteilt seinem „führenden Minister“ Georg Ludwig Freiherr von Maurer den Auftrag, das „Adelsdiplom“ für Lola Montez entsprechend dem üblichen Reglement gegenzuzeichnen.
Vorsorglich teilte ihm Ludwig mit:
„Es ist keine Verfassungsverletzung das Grafendiplom zu unterzeichnen, für Adelsverleihungen braucht der König niemand zu vernehmen“.
Sollte er sich jedoch sträuben, droht der Bayernmonarch „einen anderen Ministerverweser zu benennen“.
Gleichzeitig schreibt Ludwig I. seiner Geliebten:
„An meinem Geburtstag mache ich mir selbst das Geschenk, Dir die Gräfinnen-Würde zu verleihen“.
14. 8 1847 - Minister Maurer unterzeichnet das Adelsdiplom für Lola Montez
München * Minister Maurer unterzeichnet das Adelsdiplom, sodass es der Gräfin Maria von Landsfeld alias Lola Montez am 25. August 1847, dem Geburtstag König Ludwigs I., in der Hofkirche ausgehändigt werden kann.
25. 8 1847 - Aus Lola Montez wird die Gräfin Maria von Landsfeld
München-Graggenau * Lola Montez erhält an König Ludwigs I. 61. Geburtstag in der Hofkirche ihr Adelsdiplom, das sie zur Gräfin Maria von Landsfeld macht. Das Adelsdiplom hat den folgenden Wortlaut: „Wir Ludwig von Gottes Gnaden König von Bayern, Franken und in Schwaben urkunden und bekennen hiermit, dass Wir beschlossen haben, die aus Spanischem Adel geborene Maria von Porrys und Montez, Lola Montez, in den gräflichen Stand unter der Benennung einer Gräfin von Landsfeld allergnädigst zu erheben“.
Das gräfliche Wappen hat der König höchstpersönlich entworfen. Es ist, wie der Name selbst, ein Phantasiegebilde, denn eine Grafschaft Landsfeld gibt und gab es nie.
30. 8 1847 - Der Kunstmaler August Wilhelm von Kaulbach lästert über Lola Montez
München * Der Kunstmaler August Wilhelm von Kaulbach schreibt seiner Frau: „Die Lola Montez ist ja endlich Gräfin geworden!
Das ist ja herrlich, das freut mich sehr - da gehört sie hin, zum hohen Adel, der ist so trefflich, edel, keusch, wie sie selber ist, der Bürgerstand soll froh sein, dass er sie los ist, dem war sie zu gut für sie- also weg mit den H---; in Paris hat sie ihre adeligen Studien gemacht“.
2. 9 1847 - Das Geschäft mit dem Adelsdiplom für Lola Montez
München * Wenn Freiherr Georg Ludwig von Maurer schon das Adelsdiplom für Lola Montez unterzeichnen soll, will er wenigstens daraus ein Geschäft machen und retten, was zu retten ist. Er selbst will zum Reichsrat befördert werden und seinem Sohn Konrad will er durch den Ruf an die juristische Fakultät der Universität die Zukunft sichern.
Der Titel eines Reichsrats wird Minister Maurer zwar verwehrt, aber sein Sohn Konrad erhält an diesem 2. September 1847 eine außerordentliche Professur der Rechte.
6. 9 1847 - Jetzt gerät Königin Therese in Rage
München * Erst jetzt beauftragt König Ludwig I. seinen Staatsrat und Innenminister Franz von Berks mit der Veröffentlichung der Ernennung Lola Montez zur Gräfin Landsfeld im Regierungsblatt. Dadurch gerät jetzt allerdings die Königin Therese in Rage.
20. 9 1847 - In der „Stände-Versammlung“ werden weitreichende Forderungen erhoben
München-Kreuzviertel * Vom 20. September bis 30. November 1847 wird eine „Außerordentliche Stände-Versammlung“ einberufen, bei der es im Grunde nur um eine „Anleihe“ zur Finanzierung der Eisenbahn geht.
In beiden „Stände-Kammern“ werden lautstark liberale Forderungen wie die „Ausweitung der Pressefreiheit“ und weitere Reformen, die die „Märzforderungen“ des darauffolgenden Jahres vorwegnehmen, erhoben.
Um den 30. 9 1847 - Beschlüsse in der der Ständeversammlung gegen die Zensur
München-Kreuzviertel * Die willkürliche Verweigerung und Entziehung des Postdebits wird nun auch auf dem außerordentlichen Landtag vom September/November 1847 diskutiert. Die beiden Kammern der Ständeversammlung fassen dabei einen Beschluss, mit dem sie die Regierung auffordern, von der „Verweigerung bzw. Entziehung der Postbeförderung für Zeitungen“ Abstand zu nehmen.
2. 10 1847 - Paul von Hindenburg wird in Posen geboren
Posen * Paul Ludwig Anton von Beneckendorff und von Hindenburg wird in Posen geboren. Es ist der spätere Generalfeldmarschall und Reichspräsident Paul von Hindenburg.
15. 11 1847 - Der abgebrannte Bahnhof wird behelfsmäßig wiederhergestellt
München-Maxvorstadt * Zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs lässt man den alten, aus Holz erbauten und auf dem Marsfeld stehenden Bahnhof behelfsmäßig wiederherstellen und gleichzeitig die Gleise zur Schießstätte verlängern. Der Bahnhof war am 4. April 1847 einem Brandanschlag zum Opfer gefallenen.
Am neuen Standort werden die behelfsmäßigen Betriebs- und Empfangsräume eingerichtet, um den Bahnverkehr an diesem Tag dort aufzunehmen. Als Architekten für das neue Bahnhofsgebäude wird der Friedrich-von-Gärtner-Schüler, Friedrich Bürklein, beauftragt. Es sollte der spektakulärste Bahnhofsbau werden, den er von 1847 bis 1849 im Rundbogenstil ausführt. Die kühn konstruierte und wegen ihrer Zweckmäßigkeit von den Zeitgenossen bewunderte Bahnsteighalle darf mit Recht als eine der ersten Ingenieurbauten bezeichnet werden, das den Bedürfnissen der Zeit entspricht.
Auf dem Platz des neuen Bahnhofs haben die Münchner Armbrustschützen, später Feuerschützen, ihre Schießstatt. Die Schützengesellschaft lässt sich dafür auf der Theresienhöhe ein Neues Schießhaus von Bürklein errichten.
30. 11 1847 - König Ludwig I. bildet das Kabinett um
München-Kreuzviertel * Auch deshalb, weil sich die „Herren Minister“ weigern, die Gräfin von Landsfeld zu gesellschaftlichen Veranstaltungen einzuladen, bildet König Ludwig I. - gleich nach Beendigung der Stände-Versammlung - das Kabinett um.
Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein wird Minister des Königlichen Hauses und des Äußeren sowie Minister des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten.
16. 12 1847 - Die neue Regierung erreicht die Aufhebung der Zensur
München * Die neuernannte Regierung versucht umgehend innenpolitisch die Wogen zu glätten und erreicht die „Aufhebung der Zensur für die inneren Angelegenheiten“. Der Leitende Minister Ludwig zu Oettingen-Wallerstein sammelt inzwischen - natürlich ohne Wissen des Königs - Material für die „Entfernung der Lola Montez“.
Das bedeutet allerdings, dass satirische Zeitschriften nun vermehrt Karikaturen von Lola und Ludwig veröffentlichen. Auch Schmähschriften kursieren in großer Menge. In der politischen Presse offenbart sich, dass die Person des Königs nicht mehr unantastbar erscheint und Ludwig I. den Staat nicht mehr unangefochten repräsentiert.
31. 12 1847 - Die Zahl der Münchner Brauereien ist auf 32 geschrumpft
München * Die Zahl der Münchner Brauereien ist auf 32 geschrumpft.
1848 - Max Pettenkofer erforscht die Indische Cholera
München * Der Pharmazeut und Hygieniker Max Pettenkofer, von den Münchnern liebevoll-verachtend „Scheißhäusl-Apostel“ genannt, wird Mitglied der „Königlichen Kommission der Erforschung der indischen Cholera“.
1848 - Im Münchner „Löschwesen“ herrschen primitivste Verhältnisse
München * Während in Bayern bereits 173 gut ausgebildete „Feuerwehren“ vorhanden sind, herrschen in München die primitivsten Verhältnisse.
Das Münchner „Löschwesen“ besteht einerseits aus der „städtischen Feuerwache“, die durch städtische Arbeiter im Nebenamt gebildet wird, und andererseits aus den „kgl. Feuer-Piquetts“, die die königlichen und militärischen Liegenschaften schützen.
Der „Polizeidirektor“ ist gleichzeitig der „Kommandant der Löschmannschaft“.
Bis 1848 - Die Vor- und Nachteile der sogenannten „Bauernbefreiung“
München * Mit der sogenannten „Bauernbefreiung“ ist der Landwirt zwischen 1800 und 1848 zum „freien Eigner“ seines bisher in „grundherrlicher Leihe“ besessenes Anwesens, und somit „Grundherr“, geworden - mit allen Vorteilen, aber auch Risiken des „freien Marktes“.
In diesen „mobil“ geworden „befreiten Bauern“, die seither ihren Grundbesitz verkaufen, anderen Besitz ankaufen oder dem ländlichen Raum ganz den Rücken kehren konnten, sah der Adel und das Besitzbürgertum den „natürlichen Damm“ gegen die „revolutionär-kommunistischen [= demokratischen] Umtriebe“.
1848 - Das Bauerntum als staatstragende Schicht
<p><strong><em>München</em></strong> * Nach der Revolution von 1848 betrachten die politischen Führungskräfte das Bauerntum als staatstragende Schicht und unterstützen und fördern dieses, während sie den Auswirkungen des Fabrikwesens - Proletarisierung der Arbeiter und Niedergang alter Handwerksbetriebe - sehr widersprüchlich gegenüberstehen.</p> <p>Und tatsächlich bildet das traditionell wirtschaftende Bauerntum und die dörfliche Sozialverfassung eine starke Abwehrfront gegen alle Einflüsse der Industrialisierung.</p>
1848 - Joseph Anton von Maffei' Werk fertigt die Lokomotive „Behaim“
München-Englischer Garten - Hirschau * Die im „Eisenwerk Hirschau“ von Joseph Anton von Maffei gefertigte Lokomotive „Behaim“ wird auf der Steilrampe zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und Marktschorgast eingesetzt.
Die „Behaim“ ist die erste dreifach gekuppelte Lokomotive für die „Königlich Bayerische Staatsbahn“.
1848 - Arnold Zenetti legt die Prüfung für den Staatsdienst mit Erfolg ab
München * Arnold Zenetti legt die Prüfung für den Staatsdienst mit Erfolg ab.
1848 - 21 Prozent der Geburten in Bayern sind unehelich
Königreich Bayern * Die Quote der unehelich geborenen Kinder liegt im Königreich Bayern bei 20,9 Prozent.
1. 1 1848 - Revolutionäre Flugblätter kursieren
Hanau * In Hanau kursiert ein Flugblatt, das mit den Worten endete: „Ihr verfluchten Tyrannen,ihr Henker des Rechts, ihr schonungslosen Volksschinder, ihr Fürsten, Aristokraten, Pfaffen und Geldsäcke! Das Gericht komme über euch.“ In einem anderen steht zu lesen: „Gebt uns, was wir wollen, die Freiheit, oder wir werden sie uns nehmen!“
In dieser revolutionsbereiten Stimmung wird die Nachricht über die Revolution in Paris auch in München zum Signal des Aufbruchs.
Um den 6. 1 1848 - Die Stimmungslage wird für München positiv eingeschätzt
München * Zu Beginn des Jahres 1848 herrscht eine positive Lage in München. In Geheimberichten heißt es:
„Die Stimmung gegen die Frau Gräfin von Landsfeld ist gleichfalls von Seiten der Bürgerschaft gut zu nennen und wenn auch hie und da sich ein oder das andere bürgerliche Individuum beygehen lassen sollte, Resonements auszusprechen, so ist dies eine Folge von hochgestellten Personen, die in Gast- oder Kaffeehäusern Abends zusammen kommen und dort Gespräche führen, woraus sich Ressonements gegen die Frau Gräfin entnehmen lassen.“
24. 1 1848 - Der Goldrausch bricht aus
San Francisco * Am American River wird das erste Gold gefunden. Der Goldrausch bricht aus. Das Land wird von Metallgräbern und Glücksrittern, von Geschäftsleuten, Gaunern und Spielern überschwemmt.
3. 2 1848 - Ein öffentlicher Protest der katholisch-konservativen Partei
München * Die Beisetzungsfeierlichkeiten für den am 29. Januar 1848 verstorbenen Joseph von Görres führen an der Residenz vorbei. Es ist ein öffentlicher Protest der katholisch-konservativen Partei gegen die königliche Mätressenwirtschaft.
Wieder steht Ernst von Lasaulx, der Neffe von Joseph von Görres, im Mittelpunkt. Er will aus den Trauerfeierlichkeiten um den Verstorbenen eine Großdemonstration der Ultramontanen Partei inszenieren.
Die Polizeidirektion versucht solche Selbstdarstellungen zu verhindern und verbietet zunächst einen geplanten Fackelzug. Dies auch aus Angst vor Krawallen verfeindeter Studentenverbindungen, deren eine das neu gegründete Korps Alemannia ist.
9. 2 1848 - König Ludwig I. lässt die Universität schließen
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * König Ludwig I. lässt wegen der öffentlichen Proteste der katholisch-konservativen Partei gegen die königliche Mätressenwirtschaft die Universität schließen und verfügt, dass alle Studenten umgehend München zu verlassen haben. </p> <p>Als der der Burschenschaft Alemannia zugehörige Eduard Graf von Hirschberg am Odeonsplatz von anderen Burschenschaftlern bedrängt wird, zieht der Graf sein Messer und fuchtelt damit in der Luft herum. Dadurch eskaliert die Situation. Verletzt wird bei dieser Aktion jedenfalls niemand. </p> <p>Lola Montez mischt sich unter die Schaulustigen und sieht sich sofort einer bedrohlichen Verfolgungsjagd ausgesetzt. Sie kann gerade noch vor der aufgebrachten Menge in die Theatinerkirche flüchten, wo sie von ausgerückten Kürassieren in die Residenz eskortiert werden muss. </p> <p>König Ludwig I. tobt und lässt daraufhin umgehend die Universität bis zum Wintersemester schließen. <br /> Außerdem verfügt er, dass alle nicht aus München stammenden Studenten innerhalb von 48 Stunden die Stadt zu verlassen haben. </p> <p>In München sind etwa 1.500 Studenten immatrikuliert. Rund die Hälfte davon zieht vor das Haus des Rektors Friedrich Wilhelm von Thiersch, der die Betroffenen mit den Worten beruhigt: <em>„Sagen Sie überall, Sie seyen arme Studenten aus München, die man aus der Stadt gewiesen, aus Gründen, die Sie vor aller Welt aussprechen dürfen.“ </em></p>
10. 2 1848 - Ludwigs I. Liebesbeziehung wird zur Staatsangelegenheit
München * Der autokratische König Ludwig I. hält unbeirrt an seinem Vorhaben fest, der Tänzerin Lola Montez das bayerische Indigenat [= Einbürgerung, Staatsangehörigkeit, Heimatrecht] zu übertragen. Er ist der rechtlichen Auffassung, dass er mit der Anhörung des Staatsrats der Verfassung Genüge getan habe.
Daraufhin fertigt er das Indigenat höchstpersönlich aus, indem er dem Protokoll des Staatsrats vom Vortag hinzufügt: „Den Staatsrat vernommend habend, erteile ich der Senora Lola Montez (Maria de los Dolores Porrys y Montez) das bayerische Indigenat hiemit und das tax- und siegelfrei und mit Beibehaltung ihres dermaligen Indigenats.“
Um aber dem ganzen Vorgang Gesetzeskraft zu verleihen, muss der Minister des Königlichen Hauses und des Äußeren die Urkunde gegenzeichnen. Dieses Ansinnen lehnt Otto Graf von Bray-Steinburg ab und bittet gleichzeitig um seine Entlassung. Damit ist die ursprünglich rein private Beziehung des bayerischen Monarchen zu seiner Favoritin zu einer Staatsangelegenheit geworden.
10. 2 1848 - König Ludwig I. erkennt den Ernst der Lage nicht
München * König Ludwig I. erkennt den Ernst der Lage nicht. Am Abend des 10. Februar 1848 lässt er folgende Nachricht ins Rathaus bringen: „Jetzo, da die Bürger sich ruhig zurückbegeben haben, ist‘s mein Vorhaben, dass statt erst mit dem Wintersemester bereits mit dem Sommersemester die Universität wieder geöffnet werde, wenn bis dahin Münchens Einwohner sich zu meiner Zufriedenheit benehmen.“
Doch jetzt reicht es den Münchnern endgültig !
10. 2 1848 - Bürgerprotest bei König Ludwig I.
München * Doch jetzt werden die Münchner richtig sauer. Die Bürgerschaft sieht sich in ihrem „friedlichen Handel und Wandel“ bedroht und übernimmt die Forderungen der Studenten. Steine fliegen, Militär sichert das Palais der Montez. Tausend Bürger eilen zum Rathaus und von dort zur Residenz und fordern die Wiedereröffnung der Universität.
Bürgermeister Kaspar von Steinsdorf nimmt die Protestadresse der Münchner Bürger entgegen und setzt - begleitet von 2.000 angesehenen Münchner Bürgern - eine Audienz beim König durch. Eine Deputation, bestehend aus sieben Vertretern, will mit dem König sprechen, der jedoch einen Empfang der Abordnung kategorisch ablehnt und nur unter großem Einsatz seiner Familienmitglieder dazu überredet werden kann.
Bei den Verhandlungen lehnt König Ludwig I. jegliches Zugeständnis kategorisch ab und droht der Stadt im Umkehrschluss mit der Verlegung der Residenz an einen anderen Ort. Cholerisch verabschiedet er die Mitglieder der Deputation: „Es bleibt dabei, ich lasse mich nicht schrecken; man kann mir mein Leben nehmen, aber meinen Willen nicht. Meinen gefassten Entschluss werden Sie alsbald durch das Ministerium und schriftlich erhalten.“
11. 2 1848 - Die Wiederaufnahme des Universitätsbetriebs ist durchgesetzt
München * König Ludwig I. verfügt nach einer heftigen Diskussion mit seinen Ratgebern die Wiederaufnahme des Universitätsbetriebs. Die bayerische Monarchie hat eine ernsthafte Niederlage erlitten !
11. 2 1848 - Lola Montez muss vor den aufgebrachten Münchnern fliehen
München-Maxvorstadt - Schloss Blutenburg * Am Morgen belagert eine aufgebrachte Menge das Palais Montez in der Barer Straße. Die ersten Steine fliegen, ein Eingreifen des Militärs wird als aussichtslos angesehen. Der Bayerische Innenminister Franz von Berks meint sogar: „Die Position an der Barer Straße ist unhaltbar“ und befürchtet, „die Gräfin könne eine Stunde nach dem Angriff eine Leiche sein.“
Auch der Polizeidirektor will für Lolas Sicherheit nicht mehr garantieren und erklärt ihr, sie müsse innerhalb einer Stunde die Stadt verlassen. Da bleibt nur die Flucht. Lola Montez entkommt in einer Kutsche, die sie im Eiltempo aus der Stadt bringt. Das Palais der Gräfin von Landsfeld wird danach gestürmt - eine Verwüstung der Villa aber verhindert.
Lola Montez flieht - eskortiert und bewacht von einem Tross, den Graf von Arco-Steppberg anführt - über die Vorstadt Au nach Baiersbrunn. Dort verlassen sie ihre Bewacher. Nun begibt sie sich über Schleichwege über Großhesselohe nach Schloss Blutenburg. Der Wirt meldet das Versteck, weshalb die Polizei die sich auf der Flucht befindliche Gräfin von Landsfeld festnimmt, sie nach Pasing bringt und in den Zug nach Augsburg setzt.
13. 2 1848 - Lola Montez reist nach Lindau am Bodensee
<p><strong><em>Lindau</em></strong> * Lola Montez reist nach Lindau am Bodensee. Dort wartet sie auf ihre Habseligkeiten, Dienerschaft, Hunde und briefliche Antwort von Ludwig. </p>
18. 2 1848 - Lola Montez soll zum Genfer See weiterziehen
Lindau * König Ludwig I. schreibt seiner Lola, dass es besser wäre, „am Genfer See zu warten, wo die Luft milder“ sei. Er würde dann am 12. April nachkommen.
Um den 20. 2 1848 - Reichsrat Max von Arco-Valley spendet für die „Verjagung“ der Lola Montez
München - Altötting * Ein besonders berüchtigter Eiferer ist der Reichsrat Max Graf von Arco-Valley, der nach der „Verjagung“ der Lola Montez aus München eine Spende über 5.000 Gulden an die Armen der Stadt aushändigt. Das Geld hat er angeblich von den Redemptoristen aus Altötting erhalten.
21. 2 1848 - In Paris kommt es zu öffentlichen Protesten
Paris * Durch die sich in Frankreich verschärfenden sozialen Probleme kommt es ab dem 21. Februar 1848 in Paris zu öffentlichen Protesten, die rasch eine revolutionäre Entwicklung annehmen.
23. 2 1848 - Heftige Straßen- und Barrikadenkämpfe in Paris
Paris * Die Arbeiter vereinigen sich vorübergehend mit den Bürgern, so dass am 23. und 24. Februar in Paris heftige Straßen- und Barrikadenkämpfe zwischen den Aufständischen und den königlichen Truppen toben.
24. 2 1848 - Lola Montez flieht ins Schweizer Exil
Bodensee * Lola Montez befindet sich an Bord des Dampfschiffes „Ludwig“, um über den Bodensee ins Schweizer Exil zu schippern. In ihrem Gefolge befinden sich Elias Peißner und zwei weitere Alemannen.
24. 2 1848 - Frankreichs König Louis-Philippe dankt ab
Paris * König Louis-Philippe dankt ab und flieht nach England ins Exil.
25. 2 1848 - Frankreichs Zweite Republik ausgerufen
Paris * In Paris wird eine provisorische französische Regierung eingesetzt und die Zweite Republik ausgerufen. Diese Revolutionsregierung besteht aus einem elfköpfigen Ministerrat, in dem Vertreter der Linken, der Liberalen und Demokraten sowie der konservativen Rechten vertreten sind. Die gemäßigt reformorientierte Regierung beschließt einige wichtige Entscheidungen, darunter
- die Abschaffung der Sklaverei in den Kolonien,
- die Abschaffung der Todesstrafe für politische Delikte,
- die Einführung der Pressefreiheit und
- des allgemeinen Wahlrechts sowie
- die Anerkennung des Rechts auf Arbeit.
27. 2 1848 - Die Märzforderungen werden erstmals erstellt
Mannheim * Mit Bekanntwerden der Februarrevolution in Frankreich verstärken sich die politischen Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung am politischen Leben. Die Bevölkerung Mannheims reagiert als erste auf die Nachrichten aus Paris. An diesem Tag, einem Sonntag, kommen hier 2.500 Menschen zu einer Volksversammlung zusammen. Sie beratschlagen über eine Petition, die erstmals die vier Forderungen beinhalteten, die als Märzforderungen in alle künftigen Petitionen eingehen:
- Pressefreiheit,
- Volksbewaffnung,
- Schwurgerichte und
- ein nationales Parlament.
27. 2 1848 - Lola Montez und ihre Begleiter kommen in Bern an
Bern * Lola Montez und ihre Begleiter kommen in Bern an und nehmen zunächst Quartier bei dem britischen Diplomaten Robert Peel. Voller Ungeduld wartet sie auf König Ludwig I., doch der hat ganz andere Probleme zu lösen.
1. 3 1848 - Die Mannheimer Petition wird den badischen Abgeordneten überreicht
Mannheim * Die Mannheimer Petition, versehen mit vielen Unterschriften, wird den Abgeordneten im badischen Parlament überreicht. Eine mehrere tausend Menschen starke Demonstration begleitet die Delegation, um ihren Willen zur Änderung der politischen Verhältnisse zu unterstreichen. Das Großherzogtum Baden ist auch der erste Staat, der die Märzforderungen umsetzt.
Nach dem 1. 3 1848 - Das Ziel heißt: „Überwindung der Restaurationspolitik“
Deutschland * Innerhalb weniger Wochen greifen die revolutionären Vorgänge auch auf die übrigen Staaten des Deutschen Bundes über. Ein wesentliches Ziel der Märzrevolution ist die Überwindung der Restaurationspolitik, die die Zeit seit dem Wiener Kongress geprägt hat. Einer der bedeutendsten Verfechter der politischen Restauration ist der österreichische Staatskanzler Klemens Wenzel Fürst von Metternich.
Die Politik der Restauration wurde auf dem Wiener Kongress am 9. Juni 1815 von den meisten europäischen Staaten beschlossen. Sie sollte innenpolitisch und zwischenstaatlich die politischen Machtverhältnisse des Ancien Régime in Europa wiederherstellen, wie sie vor der Französischen Revolution von 1789 geherrscht hatten. Dies bedeutet die Vorherrschaft des Adels und die Wiederherstellung seiner Privilegien.
Weiterhin sollte die napoléonische Neuordnung Europas, die mit dem Code civil auch bürgerliche Rechte etabliert hatte, rückgängig gemacht werden. Innenpolitisch wurden im Zuge der Restauration Forderungen nach liberalen Reformen oder nach nationaler Einigung unterdrückt, Zensurmaßnahmen verschärft und die Pressefreiheit stark eingeschränkt. Vor allem die studentischen Burschenschaften sind zu dieser Zeit die Träger der Forderung nach nationaler Einigung und demokratischen Bürgerrechten.
In manchen Ländern des Deutschen Bundes lenken die Fürsten rasch ein. Dort kommt es bald zur Errichtung von liberalen „Märzministerien“, die den Forderungen der Revolutionäre nachkommen, durch Einrichtung von Schwurgerichten, der Abschaffung der Pressezensur, und der „Bauernbefreiung“. Oft bleibt es jedoch bei bloßen Versprechungen.
2. 3 1848 - In München beginnt die Märzrevolution
München * In München beginnt die „Märzrevolution“ mit dem Sturm auf das Haus des Ministers Franz von Berks, einem Vertrauten König Ludwigs I., der mit Unterstützung von Lola Montez in die Position des Innenminister-Verwesers gehievt worden war und deshalb von den Münchnern als „Lola-Minister“ oder „Huren-Minister“ bezeichnet wird.
3. 3 1848 - Die Münchner erstellen einen Forderungskatalog an den König
München * In einem Forderungskatalog verlangen die Münchner Untertanen vom König:
- Die Verabschiedung eines Gesetzes über Ministerverantwortlichkeit.
- Die Einführung voller Pressefreiheit und eines Pressegesetzes.
- Die Einführung öffentlicher Gerichtsverfahren.
- Die Unterstützung des Wunsches nach Schaffung einer Volksvertretung für den Frankfurter Bundestag.
- Die Vereidigung des Militärs auf die Verfassung.
- Die Verabschiedung eines neuen Polizeigesetzes.
- Die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes.
- Die Entlassung des Verwesers des Innenministeriums Berks.
Die Resolution liegt im Rathaus auf und „innerhalb von nur vier Stunden sollen bereits mehr als 10.000, bald gar 20.000 Unterschriften gesammelt worden sein“. Der Magistrat und zwei aus dem Bürgerstand ausgewählte Vertrauensmänner überreichen die Resolution.
Noch am Abend verkündet der Leitende Minister Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein, dass die Stände zur Prüfung der Resolution vorzeitig einberufen werden sollen. Als Termin wird der 31. Mai festgesetzt. König Ludwig I. kann und will die Forderungen der Bürger nicht akzeptieren, verspricht aber die Entlassung Berks. Außerdem soll die nächste Stände-Versammlung auf den 31. Mai 1848 vorverlegt werden.
Als die Münchner diese Forderungen aufstellen, hat Lola Montez das Königreich Bayern bereits seit drei Wochen in Richtung Schweiz verlassen. Es geht nicht mehr um die Affäre mit der Spanischen Tänzerin, es geht nur noch um das autokratische und neoabsolutistische Herrschaftssystem König Ludwigs I., das nicht mehr länger aufrechtzuerhalten ist.
3. 3 1848 - Staatskanzler Metternich flieht nach England
Budapest - Wien * Der Landtagsabgeordnete Lajos Kossuth hält im ungarischen Reichstag eine Rede, in der er mehr Souveränität für Ungarn fordert. Er greift in seinem Vortrag das Metternich-Regime scharf an und verlangt eine umfassende Reform der Habsburger Monarchie. Die Rede löst begeisterte Zustimmung in den Oppositionskreisen des österreichischen Kaiserreichs aus und gibt den Anstoß zur Wiener Märzrevolution.
Staatskanzler Klemens Wenzel Fürst von Metternich verliert daraufhin seinen Rückhalt am kaiserlichen Hof, sieht sich zum Rücktritt gezwungen und flieht nach England. Die Pressefreiheit wird eingeführt und eine Verfassung versprochen. Bis zum 15. März 1848 sind in Wien die zentralen Forderungen der Revolution durchgesetzt.
4. 3 1848 - Beratungen über die Forderungen des Volkes vom 3. März 1848
München * König Ludwig I., die Prinzen und die Minister beraten am 4. und 5. März 1848 über die Forderungen des Volkes vom 3. März und über das Ausmaß der zu gebenden Zugeständnisse.
5. 3 1848 - Reformen für ein nationales Parlament
Heidelberg * 51 führende Liberale und Demokraten, vorwiegend aus dem süddeutschen Raum, treffen sich im Heidelberger Schloss. Darunter befinden sich auch fünf bayerische Abgesandte, wovon vier aus der Pfalz und einer aus Franken stammt.
Sie beratschlagen Wege und Möglichkeiten der Umsetzung der Forderung der Reform des Deutschen Bundes, insbesondere zu einem deutschen Nationalparlament. Daraus resultiert das sogenannte Vorparlament.
Nach dem 6. 3 1848 - Das bayerische Zensursystem bricht zusammen
München * Das ganze bayerische Zensursystem und damit auch die Manipulation der Post zu Zensurzwecken bricht zusammen.
6. 3 1848 - Die Königliche Proklamation wird veröffentlicht
München * Die Königliche Proklamation wird als Antwort auf die Forderungen der Münchner Bürgerschaft vom 3. März veröffentlicht. Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein hat den Inhalt der Proklamation, in der der König seine weit reichenden Versprechungen zur Weiterentwicklung der Bayerischen Verfassung abgibt, redigiert. Sie beinhaltet:
- die verfassungsmäßige Ministerverantwortlichkeit,
- die vollständige Pressefreiheit,
- eine Verbesserung der Wahlordnung,
- die Einführung der Öffentlichkeit und Mündlichkeit in eine Rechtspflege mit Schwurgerichten,
- eine umfassende Fürsorge für Staatsdiener und ihre Angehörigen und Ausdehnung dieser Maßnahmen auf die übrigen Angestellten des Staates,
- eine Verbesserung der Verhältnisse der Israeliten,
- die Abfassung eines Polizeigesetzbuches,
- die Vereidigung des Heeres auf die Verfassung und
- eine Reform des Deutschen Bundes, insbesondere zu einem deutschen Nationalparlament.
Die Proklamation schließt mit den Worten: „Alles für mein Volk! Alles für Deutschland!“ und geht sogar über die Forderungen der Petition vom 3. März weit hinaus, beinhaltet aber alle Punkte und damit auch die Märzforderungen. Was aber mit keinem Wort erwähnt wird ist die „soziale Frage“, die Frage der „Bauernbefreiung“.
Nicht nur, dass mit der Proklamation vom 6. März 1848 die Märzforderungen in Bayern noch vor den anderen deutschen Staaten ihre Anerkennung finden, nein, es wird damit auch König Ludwigs I. autokratischer Regierungsanspruch mit einem Handstreich ausgehöhlt.
6. 3 1848 - Die Minister wollen eine Weiterentwicklung der Verfassung
München * König Ludwig I. kündigt in einer vom Leitenden Minister Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein verfassten Proklamation Verbesserungen in all den von den Bürgern geforderten Punkten an. Auch die Minister halten die Forderungen für berechtigt und plädieren für eine Weiterentwicklung der Verfassung - und damit für mehr Rechte des Parlaments.
Keiner tritt für die Beibehaltung der ludovizianischen Politik ein. Die weitreichenden Zugeständnisse des Königs kommen einer politischen Bankrotterklärung gleich.
9. 3 1848 - Das letzte Treffen von König Ludwig I. und Lola Montez
München-Graggenau * Lola Montez kommt in der Nacht zum 9. März 1848 - „wie ein Mann bekleidet“ - in Begleitung eines Baron Meller nach München und versteckt sich beim Tapezierer Krebs in der Wurzerstraße 12, der viele Arbeiten in Lola Montez‘ Palais ausgeführt hatte.
Doch Polizisten dringen in das Haus ein, finden „die Gräfin unter einem Sofa versteckt“ und bringen sie ins Polizeipräsidium in der Weinstraße. Dort verleben Ludwig I. und Lola Montez drei gemeinsame Stunden. Danach schleust man sie unter größter Geheimhaltung aus der Stadt. Das Treffen auf der Polizeiwache ist die letzte Zusammenkunft des Liebespaares. Danach wird Ludwig I. seine geliebte „Lolitta“ nie wieder sehen.
10. 3 1848 - Die Auer wollen eingemeindet werden
Vorstadt Au * In Revolutionsstimmung treffen sich die Auer beim „Radlwirt“ und verfassen eine Eingemeindungsforderung, die von 609 Auer Bürgern unterschrieben wird.
11. 3 1848 - König Ludwig I. entlässt seinen Minister Ludwig Fürst zu Wallerstein
München * In einem Anfall von Rachegelüsten entlässt König Ludwig I. seinen Leitenden Minister Ludwig Fürst zu Wallerstein.
13. 3 1848 - In Wien beginnen Straßenkämpfe
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Die Forderungen des Landtagsabgeordneten Lajos Kossuth werden in Wien mit Petitionen unterstützt und im Ständehaus beraten. Vor dem Gebäude demonstrieren Studenten, Bürger und Arbeiter, die den Rücktritt des verhassten Staatskanzler Klemens Wenzel von Metternich fordern. <br /> Metternich personifiziert für sie ein repressives, jegliche Freiheitsregung rücksichtslos verfolgendes System.</p> <p>Die Stimmung eskaliert, als am Nachmittag das Militär die Demonstranten plötzlich mit Waffengewalt angreifen. Es beginnen Straßenkämpfe in der Innenstadt und in den Vorstädten, die mehrere Dutzend Opfer fordern. </p>
15. 3 1848 - In Wien sind die zentralen Forderungen durchgesetzt
Wien * In Wien sind die zentralen Forderungen der Revolution durchgesetzt.
16. 3 1848 - Es kommt in München erneut zu Tumulten
<p><strong><em>München</em></strong> * Es kommt in München erneut zu Tumulten. Erstmals zieht König Ludwig I. die Abdankung in Erwägung. </p>
17. 3 1848 - Lola Montez verliert das bayerische „Indigenat“ und wird gesucht
<p><strong><em>München</em></strong> * Ludwig Fürst zu Öttingen-Wallersteins Posten geht an Gottlieb Freiherr von Thon-Dittmer, der mit seiner ersten Amtshandlung der Lola Montez das <em>„Bayerische Indigenat“</em> entzieht. König Ludwig I. muss öffentlich verkünden, dass Lola Montez das bayerische <em>„Indigenat“</em> nicht mehr besitzt, sie als <em>„Unruhestifterin“</em> mit Haftbefehl gesucht und nach ihrer Festnahme in die nächstgelegene Festung gebracht wird. </p>
18. 3 1848 - Die Stände-Versammlung soll im Ständehaus eröffnet werden
<p><strong><em>München</em></strong> * Die große Mehrheit der Vertreter der Abgeordnetenkammer will, dass die Eröffnung der Stände-Versammlung nicht mehr im Thronsaal der Residenz, sondern wieder im Ständehaus stattfinden soll. Anderenfalls sei <em>„ein förmlicher Bruch zwischen den Ständen und der Regierung“</em> zu erwarten. </p> <p>König Ludwig I. ist strikt gegen diese Aufforderung und vermerkt verärgert, er möchte von dieser Angelegenheit nichts weiter mehr hören. Wenige Stunden später streicht er eigenhändig die Sätze und schreibt kleinlaut darunter: <em>„Im Ständehaus soll dieses Mal die Eröffnung stattfinden.“ </em></p>
18. 3 1848 - In Berlin kommt es zu einem erbittert geführten Barrikadenkampf
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * In Berlin kommt es in der Nacht vom 18. auf den 19. März zu einem erbittert geführten Barrikadenkampf. Vor dem Berliner Stadtschloss hat sich eine große Menschenmenge versammelt, um auf die Antwort des Königs auf die Märzforderungen der Berliner Bürgerschaft zu warten. Als während der Verlesung eines Patents von König Friedrich Wilhelm IV. zu den Reformen in Preußen auf der anfangs friedlichen Versammlung revolutionäre Parolen laut wurden, fallen zwei - angeblich versehentlich ausgelöste - Schüsse. Das ist das Signal für einen Barrikadenkampf. </p> <p>Innerhalb von wenigen Stunden türmen sich im Zentrum von Berlin die Barrikaden auf. Das Militär geht mit großer Härte und Brutalität auch gegen Unbeteiligte in den Häusern vor. Dennoch kann sich das Militär nicht durchsetzen. Als Bedingung für einen Waffenstillstand muss der König am 19. März seine Truppen abziehen. </p>
19. 3 1848 - König Ludwig I. tritt zurück
München * König Ludwig I. tritt zurück.
19. 3 1848 - König Friedrich Wilhelm IV. muss seine Truppen abziehen
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * König Friedrich Wilhelm IV. muss seine Truppen abziehen. Nach Angaben der Behörden starben insgesamt 303 Menschen, darunter 288 Männer, elf Frauen und vier Kinder. König Friedrich Wilhelm IV. wird gezwungen zu Erscheinen und vor den im Schlosshof aufgebahrten <em>„Märzgefallenen“</em> den Hut zu ziehen. </p>
20. 3 1848 - Die Hoffnungen und Ängste des neu ernannten Königs Max II.
<p><strong><em>München</em></strong> * Nach 23-jähriger Regierungszeit dankt Ludwig I. ab und überträgt das Herrscheramt an seinen Sohn Max II..Sein Enkel Ludwig (II.) wird dadurch Kronprinz.</p> <p>Auch wenn sich Max II. nach Außen hin als Musterbild eines bürgernahen, konstitutionellen Staatsoberhauptes darstellt so plagt ihn zeitlebens die Furcht, dass ihm von seinem Volk ein ähnliches oder gar schlimmeres Schicksal bereitet werden könnte, wie seinem abgedankten Vater Ludwig I..</p> <p>Die revolutionären Begleitumstände, die König Max II. auf den Thron verhalfen und seinen Vater vom selben stießen, haben den neuernannten Bayernherrscher geradezu traumatisch geprägt. Er fühlt sich, nachdem auch das Militär auf die Verfassung vereidigt worden ist, <em>„schutzlos der Demokratie preisgegeben“</em>. Doch nachdem sich die revolutionäre Situation wieder beruhigt hat, kann König Max II. seine politischen Visionen endlich in die Tat umsetzen. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Förderung einer bayerisch-monarchischen Gesinnung. Greifbare Formen nehmen das <em>„Athenäum-Projekt”</em> und der Bau des Prachtboulevards an.</p>
20. 3 1848 - „Nicht Sklave zu werden, wurde Ich Freyherr“
<p><strong><em>München</em></strong> * König Ludwig I. stellt in einer Proklamation an das bayerische Volk die zentralen Momente seiner Herrschaft - aus seiner Sicht - dar: </p> <ul> <li><em>„Treu der Verfassung regierte Ich; dem Wohle des Volkes war Mein Leben geweiht; - als wenn ich eines Freistaats Beamter gewesen, so gewissenhaft ging Ich mit dem Staatsgute, mit dem Staatsgeldern um. [...]</em></li> <li><em><em>Auch vom Throne herabgestiegen, schlägt glühend Mein Herz für Bayern, für Teutschland.“</em> </em></li> </ul> <p>Den liberalen Forderungen der Märzrevolution kann und will der Autokrat Ludwig I. nicht entsprechen. <br /> <em>„Regieren konnte ich nicht mehr und einen Unterschreiber abgeben wollte Ich nicht. Nicht Sklave zu werden, wurde Ich Freyherr“</em>. </p>
21. 3 1848 - König Friedrich Wilhelm IV. für die Einheit und Freiheit Deutschlands
Berlin * König Friedrich Wilhelm IV. reitet mit einer schwarz-rot-goldenen Schärpe durch die Stadt und verkündet seinen Willen für die Einheit und Freiheit Deutschlands. Insgeheim aber schreibt er seinem Bruder, dem Prinzen Wilhelm: „Die Reichsfarben musste ich gestern freiwillig aufstecken, um Alles zu retten. Ist der Wurf gelungen […], so lege ich sie wieder ab!“
König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ist von Anfang an entschlossen, bei veränderten Kräfteverhältnissen der Revolution mit einer Gegenrevolution zu begegnen.
22. 3 1848 - Der sogenannte „Reform-Landtag“ beginnt
München-Kreuzviertel * Der sogenannte „Reform-Landtag“ beginnt.
Er wird bis zum bis 30. Mai 1848 dauern.
Diese „Stände-Versammlung“ leistet wichtige Arbeit, verabschiedet in nur zwei Monaten 14 Gesetze, die der bayerischen Verfassung liberalere Züge verleihen.
26. 3 1848 - Ludwig I. als „Großmeister des Georgs-Ritterordens“ entlassen
<p><strong><em>München</em></strong> * Mit der Abdankung König Ludwigs I. am 20. März muss er auch auf das Amt des <em>„Großmeisters des Georgs-Ritterordens“ </em>verzichten. Diese Funktion übernimmt der neue König Max II..</p>
31. 3 1848 - In Frankfurt am Main versammelt sich das sogenannte Vorparlament
<p><strong><em>Frankfurt am Main</em></strong> * In Frankfurt am Main versammelt sich das sogenannte Vorparlament, das aus 574 ehemaligen und gegenwärtigen Mitgliedern von Stände-Versammlungen sowie aus etlichen durch <em>„das Vertrauen des deutschen Volkes“</em> ausgezeichneten Männern besteht. Das sond allerdings noch keine gewählten Vertreter, die die verschiedenen Staaten des Deutschen Bundes deshalb nur sehr ungleichgewichtig repräsentierten. </p> <p>Sofort bricht der Konflikt zwischen den Demokraten, die eine republikanische Staatsform und soziale Reformen durchsetzen wollen, und den Liberalen aus, die der Konstitutionellen Monarchie den Vorzug geben. </p>
Um 4 1848 - König Max II. gibt den Auftrag zum Druck der Briefmarke
München * Die Anweisung zum Druck einer bayerischen Briefmarke kann Ludwig I. nicht mehr geben, da er zugunsten seines Sohnes Max II. abdanken muss.
Der neue Regent handelt dann unverzüglich. Wieder einmal sind in Deutschland die Bayern vorne.
Nach dem Bau der ersten Eisenbahn und der Erfindung der ersten „deutschen Kurzschrift“, des „Schreibtelegrafen“, der „Fotografie“ und der „elektrischen Uhr“ schauen insbesondere die Preußen abermals neidisch nach München.
3. 4 1848 - Das Vorparlament beendete seine Tätigkeit
Frankfurt am Main * Das Vorparlament in Frankfurt am Main beendete am Abend seine Tätigkeit mit dem Beschluss über die Durchführung „allgemeiner und gleicher Wahlen“.
7. 4 1848 - Das direkte Wahlverfahren wird lediglich empfohlen
<p><strong><em>Frankfurt am Main</em></strong> * Da sich das <em>„Vorparlament“</em> in Frankfurt am Main nicht auf einen gemeinsamen Wahlmodus einigen konnte, wird das direkte Wahlverfahren lediglich empfohlen. </p> <p>Bei der direkten Wahl werden die Kandidaten direkt vom Wähler gewählt, bei der indirekten Wahl werden die Kandidaten erst im zweiten Wahlgang durch die zuvor gewählten Wahlmänner gewählt. <br /> Im Königreich Bayern wird das indirekte Wahlverfahren angewandt werden. </p>
12. 4 1848 - Das Bayerische Wahlgesetz wird im Landtag verabschiedet
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Zwischen dem 12. und 15. April wird das Bayerische Wahlgesetz für das Frankfurter Paulskirchenparlament im Landtag verabschiedet und nach der Zustimmung der Kammer der Reichsräte und des Staatsrats verkündet. </p>
23. 4 1848 - Frankreichs Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung
Frankreich * In Frankreich findet die Wahl zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung statt. Bei dieser unterliegt die Linke, während die Konservativen und die gemäßigten Liberalen siegreich hervorgehen.
25. 4 1848 - In Bayern finden die „Urwahlen“ für das „Paulskirchenparlament“ statt
Königreich Bayern * In Bayern finden die „Urwahlen“, also die „Wahlen der Wahlmänner“ für das Frankfurter „Paulskirchenparlament“ statt.
6.901 Münchner beteiligen sich an den „Urwahlen“.
Sie wählen 125 [„München I“] beziehungsweise 59 „Wahlmänner“ [„München II“].
27. 4 1848 - Prinz Otto Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar wird geboren
München * Prinz Otto Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, der jüngere Bruder des „Kronprinzen“ Ludwig II., der spätere König Otto I. von Bayern, wird geboren.
28. 4 1848 - 70 bayerische Abgeordnete für das Paulskirchenparlament gewählt
München * Die Wahlmänner wählen die bayerischen Abgeordneten für das Frankfurter Paulskirchenparlament. Bayern hat siebzig Abgeordnete zu stellen. Die in München gewählten 125 und 59 Wahlmänner wählen in einer Honoratioren-Auslese aus der lokal bekannten Bürger- und Beamtenschaft zwei Abgeordnete.
12. 5 1848 - Die Schwurgerichte werden im Königreich Bayern eingeführt
München-Kreuzviertel * Das „Gesetz, einige Abänderungen des Strafgesetzbuches vom Jahre 1813 [...] betreffend“, wird veröffentlicht.
Darin führt Maximilian II. von Gottes Gnaden König von Bayern die Schwurgerichte zur Aburteilung von Verbrechen und Pressedelikten ein.
18. 5 1848 - Das Frankfurter Paulskirchenparlament tritt erstmals zusammen
Frankfurt am Main * Die 585 gewählten Abgeordneten treten erstmals in der Frankfurter Paulskirche zusammen und nehmen - nach einem triumphalen Einzug - auf den Kirchenbänken Platz. Es ist ein Akademiker-Parlament, dem alleine fünfzig Professoren angehören. Drei Viertel aller Abgeordneten haben eine akademische Ausbildung. Nach einem eher chaotischen Start entwickelt die Nationalversammlung in der Folge kontinuierlich alle Elemente eines funktionierenden parlamentarischen Verfahrens.
Die erste deutsche Nationalversammlung tagt vom 18. Mai 1848 bis zum 30. Mai 1849 an insgesamt 230 Sitzungstagen. An jedem Sitzungstag versammeln sich um 9 Uhr zwischen 400 und 450 Abgeordnete, die für einen nationalen Staat und für eine freiheitliche Verfassung streiten.
4. 6 1848 - Die ständischen Privilegien des Adels werden endgültig gebrochen
München-Kreuzviertel * Mit einem weiteren Reformgesetz werden auch die letzten Elemente der feudalen Grundherrschaft im Königreich Bayern beseitigt. Im I. Abschnitt des Gesetzes über die Aufhebung der standes- und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, dann die Aufhebung, Fixierung und Ablösung von Grundlasten hebt König Max II. die standes- und gutsherrliche Gerichtsbarkeit auf.
Das Gesetz entzieht den Gutsherren die Gerichtsbarkeit und die Polizeigewalt ohne Entschädigung und überträgt diese Befugnisse auf den Staat. Damit sind die letzten Reste des feudalen Staatsaufbaus abgeschafft worden. Dem Aufbau einer modernen einheitlichen Justizverwaltung steht nun nichts mehr im Weg.
4. 6 1848 - Eine Absichtserklärung zur Rechtspflege
München-Kreuzviertel * Im Artikel 1 des Grundlagengesetzes wird erklärt: „Die Rechtspflege soll von der Verwaltung, selbst in den untersten Behörden, gänzlich getrennt werden“. Es dauert jedoch bis zum 10. November 1861, bis der verkündete Grundsatz verwirklicht wird.
4. 6 1848 - Die Landtagsabgeordneten erhalten das Recht der Initiative
München-Kreuzviertel * Ein weiteres wichtiges Vorschriftenwerk ist das Gesetz über die ständische Initiative. Es gibt den Abgeordneten beider Kammern des Landtags das Recht der Initiative, also das Recht, Gesetzesentwürfe einzubringen.
Immerhin wird damit aus der Stände-Versammlung eine wirkliche Volksvertretung. Und aus dem Ständehaus wird das Landtagsgebäude.
4. 6 1848 - Das Gesetz über die Abschaffung der Pressezensur
München-Kreuzviertel * Außerdem tritt das Gesetz über die Abschaffung der Pressezensur in Kraft. In dem vom König erlassenen Edikt über die Freiheit der Presse und des Buchhandels ist festgelegt worden, dass das Erscheinen von Presseerzeugnissen nicht „von obrigkeitlicher Prüfung und Genehmigung des Inhalts oder überhaupt von irgend einer obrigkeitlichen Erlaubniß abhängig“ sei. „Die Strafgerichtsbarkeit [steht] nicht den Polizeibehörden, sondern den Gerichten zu.“
4. 6 1848 - Ein neues Wahlgesetz bringt entscheidende Verbesserungen
München-Kreuzviertel * Das Gesetz über die Wahl der Landtags-Abgeordneten bringt einige Neuerungen, die als „entscheidend“ bezeichnet werden müssen. Es beseitigt das ständische Element der Verfassungsurkunde von 1818. In diesem bestand die Kammer der Abgeordneten zu einem Achtel aus der Klasse der adeligen Großgrundbesitzer, ebenfalls ein Achtel aus der Geistlichkeit der christlichen Konfessionen, ein Viertel stellten die Vertreter der Städte und Märkte und die verbliebene Hälfte die Landeigentümer ohne gutsherrliche Gerichtsbarkeit.
- Im neuen Gesetz errechnet sich die Anzahl der Landtags-Abgeordneten nach dem Verhältnis von je Einem Abgeordneten auf 31.500 Seelen der Gesamtbevölkerung des Königreichs, die auf die „einzelnen Kreise vertheilt“ werden.
- Die Wahl ist indirekt. Das heißt, dass in einer Urwahl zunächst Wahlmänner gewählt werden, die dann in einem zweiten Wahlgang die Abgeordneten wählen.
- Zum Abgeordneten kann jeder gewählt werden, der das 30. Lebensjahr vollendet hat.
- Für das aktive Wahlrecht genügt die Zahlung einer direkten Steuer, und sei sie auch noch so klein.
- Weder das aktive noch das passive Wahlrecht ist an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis“gebunden. Damit kommt auch die staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Juden einen Schritt weiter.
- Und die nicht an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis gebundenen Angehörigen nichtchristlicher Konfessionen dürfen den Verfassungseid unter Weglassung des Bezugs auf das Evangelium schwören.
- Die Wahl der Landtags-Abgeordneten ist öffentlich, die Stimmzettel müssen jedoch noch vom Wähler unterschrieben werden. Die Geheime Wahl wird erst im Jahr 1881 eingeführt.
- Außerdem werden noch keine amtlichen Stimmzettel ausgegeben. Diese gibt es erst - mit dem Frauenwahlrecht - im Januar 1919.
- Das bisherige Ausschließungsrecht des Königs, mit dem er gewählten Abgeordneten den Urlaub für die Teilnahme am Landtag verweigern konnte, wird beseitigt.
Das Gesetz, das als Bestandteil der Verfassungs-Urkunde angesehen wird, tritt mit der nächsten Wahl in Wirksamkeit.
4. 6 1848 - Die Ministerverantwortlichkeit wird Gesetz
München-Kreuzviertel * Ein weiteres Reformgesetz von König Max II. ist das Gesetz, die Verantwortlichkeit der Minister betreffend. Kernpunkt dieses Verfassungsgesetzes ist, dass Regierungsanordnungen des Königs nur durch die Gegenzeichnung des verantwortlichen Ressortministers Geltung erhalten. Damit ist der Spätabsolutismus eines König Ludwigs I. mit einem Gesetz beseitigt.
Freilich verliert damit der König letztlich seine Verantwortlichkeit gegenüber der Bevölkerung, aber das Parlament hat immer jemanden, den es zur Verantwortung ziehen kann.
22. 6 1848 - Ein bewaffneter Aufstand in Paris fordert über 3.000 Tote
Paris * In den Straßen von Paris tobt zwischen dem 22. bis 26. Juni 1848 eine Schlacht, an der bis 50.000 Menschen kämpfen. Über 400 Barrikaden werden errichtet, über 3.000 Tote sind das Ergebnis. Kein anderes Ereignis in der Revolution von 1848/49 hat so viele Menschenleben gekostet.
Der Auslöser des Protests, der sich von anfänglichen Arbeiter-Demonstrationen schnell zum bewaffneten Aufstand ausweitet, ist die Beseitigung der Nationalwerkstätten. Diese waren im Februar 1848 unter dem Eindruck der hohen Arbeitslosigkeit eingerichtet worden. Damals war über die Hälfte der Pariser Arbeiter ohne Arbeit. Durch die Nationalwerkstätten konnten insgesamt 100.000 Menschen mit Erd- und Kanalisationsarbeiten beschäftigt und damit das Recht auf Arbeit verwirklicht werden.
23. 6 1848 - Maria Leopoldine Gräfin von Arco stirbt bei einem Verkehrsunfall
Wasserburg * Maria Leopoldine Gräfin von Arco, die ehemalige baierische Kurfürstin, stirbt bei Wasserburg bei einem Verkehrsunfall.
28. 6 1848 - In Frankfurt wird die vorläufige deutsche Regierung eingerichtet
Frankfurt am Main * Die vorläufige deutsche Regierung wird in Frankfurt eingerichtet.
29. 6 1848 - Erzherzog Johann zum Reichsverweser gewählt
Frankfurt am Main * Die Nationalversammlung wählt den österreichischen Erzherzog Johann zum Reichsverweser.
- Die Monarchisten stimmen zu, da er Fürst ist,
- die Großdeutschen, da er Österreicher ist,
- der Linken ist er genehm, weil er als volkstümlich gilt.
- Überhaupt ist Erzherzog Johann ein Gegner Metternichs gewesen.
Seine Popularität bei den Linken basiert auch auf seiner morganatischen Ehe mit einer bürgerlichen Postmeisterstochter. Am 18. Februar 1829 hatte er die aus Aussee stammende Anna Plochl geheiratet und hinnehmen müssen, dass er von der Thronfolge ausgeschlossen wurde.
11. 7 1848 - Erzherzog Johann zieht unter großem Jubel in Frankfurt ein
Frankfurt am Main * Erzherzog Johann zieht unter großem Jubel in Frankfurt ein. Als Reichsverweser ist er das provisorische Oberhaupt des Deutschen Reiches, eines Staates, der noch in der Entstehung ist. Aufgabe des Reichsverwesersmist es, die Reichsminister zu ernennen und zu entlassen. Außerdem unterschreibt er die Reichsgesetze.
Doch die Macht der Zentralregierung und der Nationalversammlung ist gering. Die Armeen der Großmächte Österreich und Preußen weigern sich, dem Reichsverweser zu huldigen und die Staaten England sowie Frankreich versagten ihm die völkerrechtliche Anerkennung. Und weil sie über keine eigenen Streitkräfte verfügt, muss die Zentralgewalt auf die ehemaligen Bundestruppen zurückgreifen, die aber letztlich ihre Befehle von den einzelstaatlichen Regierungen empfangen.
Diese intervenieren immer dann, wenn Ruhe und Ordnung durch linke Volksaufstände gefährdet sind. Wenn aber die Errungenschaften des März verteidigt werden sollen, ist mit den Bundestruppen nicht zu rechnen.
15. 7 1848 - Der Münchner Turnverein, der heutige TSV 1860 München, wird gegründet
München * Im Revolutionsjahr wird der Münchner Turnverein, der heutige TSV 1860 München, gegründet.
3. 8 1848 - Die Einführung der Schwurgerichte erweitert die Rechtspflege
München-Kreuzviertel * Mit dem Gesetz über die Einführung der Schwurgerichte wird die Reform der Rechtspflege erweitert.
13. 9 1848 - Preußens König Friedrich Wilhelm IV. provoziert das Parlament
Berlin * In Berlin überträgt König Friedrich Wilhelm IV. seinem General Friedrich Graf von Wrangel das „Commando über sämmtliche Truppen“. Auf diese Provokationen antwortete die Nationalversammlung, indem sie die Abschaffung von Adel, Titel und Orden sowie das „von Gottes Gnaden“ des preußischen Königs beschließt.
18. 9 1848 - Es kommt es zum sogenannten September-Aufstand
Frankfurt am Main * In Deutschland kommt es zum sogenannten September-Aufstand. Dieser beginnt, nachdem sich eine Demonstration in Frankfurt zu einem Barrikadenkampf zwischen revolutionären Arbeitern, Bauern und Handwerkern einerseits und dem preußischen und österreichischen Militär auf der anderen Seite, auswächst.
Der Aufstand wird sehr schnell unterdrückt, da die Handwerker, Tagelöhner und Gesellen spontan und planlos vorgehen. Sie haben zwar an rund vierzig Stellen in der Stadt Barrikaden errichtet, aber versäumt, wichtige militärische Zufahrtswege zu sperren und aus den Dörfern Unterstützung zu holen. Gegen Mitternacht ist der Aufstand niedergeschlagen. Bei den Kämpfen fallen dreißig Aufständische und zwölf Soldaten.
Doch mit diesem September-Aufstand sind die revolutionären Veränderungen von Staat und Gesellschaft gescheitert. Den Demokraten geht es nur mehr um die Wahrung der Märzerrungenschaften.
21. 9 1848 - König Max II. beklagt sich über seinen schweren Job
München - Berlin • In einem Brief an seinen Onkel, dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV., schreibt König Max II.: „Schwer ist unser Beruf, wir trugen, ich wenigstens trug bisher nur eine Dornenkrone.“
5. 10 1848 - Das Patrimonialgericht Berg am Laim wird aufgelöst
Berg am Laim * Das Patrimonialgericht Berg am Laim wird aufgelöst. Als Ergebnis der Märzunruhen des Jahres 1848 wird eine neue bayerische Verfassung verabschiedet, die unter anderem die Leibeigenschaft und die letzten ständischen Privilegien des Adels aufhebt. Damit sterben auch die Hofmarksgerichte. Die Bauern können nun den Grund und die von ihnen bewirtschafteten Bauernhöfe günstigst dem Staat abkaufen.
6. 10 1848 - Straßenschlachten verhindern den Einmarsch nach Ungarn
Wien * Der österreichische Kriegsminister Theodor Graf von Latour gibt den Befehl zum Einsatz deutscher Truppen gegen Ungarn. Der Befehl wird jedoch verweigert. Aus der Meuterei wird ein allgemeiner Aufstand. Blutige Straßenschlachten fordern mehr als 500 Tote und Schwerverletzte. Das Kriegsministerium wird gestürmt und der Kriegsminister an einer Laterne aufgehängt. Kaiser Ferdinand I. und seine Regierung müssen in das mährische Olmütz fliehen.
Der Abmarsch der Truppen nach Ungarn ist erfolgreich verhindert worden.
16. 10 1848 - Alfred Fürst zu Windischgrätz wird österreichischer Oberbefehlshaber
Wien * Der österreichische Kaiser Ferdinand I. ernennt Alfred Fürst zu Windischgrätz, den führenden Kopf der Gegenrevolution, zum Oberbefehlshaber aller österreichischen Truppen. Fürst Windischgrätz gilt in der Bevölkerung als Schreckensmann, mit dem man Kinder erschreckt, wenn sie nicht gehorchen.
20. 10 1848 - Alfred Fürst zu Windischgrätz verhängt das Standrecht über Wien
Wien * Alfred Fürst zu Windischgrätz hat die Stadt Wien umzingelt, verkündet nun den Belagerungszustand und verhängt das Standrecht über Wien. Fürst zu Windischgrätz stellt den Bewohnern der Hauptstadt Bedingungen und ein Ultimatum bis zum 25. Oktober 1848.
26. 10 1848 - Die Niederschlagung des Wiener Aufstands fordert über 2.000 Tote
Wien * Nach Ablauf des Ultimatums gibt der Oberbefehlshaber aller österreichischen Truppen, Alfred Fürst zu Windischgrätz, den Befehl zum Kampf. Innerhalb von fünf Tagen nehmen seine Truppen die Stadt ein. Die Bilanz: über 2.000 Tote.
Zwei Wochen nach der Niederschlagung des Wiener Aufstands werden 1.600 Personen verhaftet, davon 966 wieder entlassen. 24 Todesurteile kommen zur Vollstreckung. Das prominenteste Opfer ist der Nationalversammlungs-Abgeordnete Robert Blum, der - trotz seiner Immunität - am 9. November 1848 standrechtlich erschossen wird.
11 1848 - Adolf Friedrich von Schack tritt eine weitere Orientreise an
München-Maxvorstadt * Adolf Friedrich von Schack tritt eine weitere Orientreise an, von der er erst Mitte Juli 1849 wieder zurück kommt.
2. 11 1848 - Die Reaktion holt zum entscheidenden Schlag aus
Berlin * Mit Blick auf die Vorgänge in Wien holt jetzt auch die preußische Reaktion zum entscheidenden Schlag aus. König Friedrich Wilhelm IV. den reaktionären Grafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg mit der Regierungsbildung. Außerdem sollt er die Verfassungsfrage unter Ausschaltung der Nationalversammlung lösen und „die Märzrevolution entschieden und siegreich stürzen“.
4. 11 1848 - Charles Louis Napoleon Bonaparte wird französischer Staatspräsident
Paris * Von der Nationalversammlung in Paris wird eine Verfassung verabschiedet, in der auch die Wahl eines Staatspräsidenten vorgesehen ist. Charles Louis Napoleon Bonaparte, der Neffe des großen Napoleon Bonaparte, kandidiert als Staatspräsident. Er, der anno 1836 und 1840 gegen den Bürgerkönig Louis-Philippe vergeblich geputscht hatte, holt 75 Prozent der Stimmen und damit das Amt des französischen Staatspräsidenten.
9. 11 1848 - Robert Blum wird in Wien standrechtlich erschossen
Wien * Der populäre Nationalversammlungs-Abgeordnete Robert Blum wird - trotz seiner Immunität - in der Brigittenau bei Wien standrechtlich erschossen. Seine Hinrichtung ist ein „Akt der Willkür und Brutalität“.
9. 11 1848 - Die Preußische Nationalversammlung wird nach Brandenburg verlegt
Berlin * König Friedrich Wilhelm IV. lässt die Preußische Nationalversammlung in das altmärkische Städtchen Brandenburg verlegen.
12. 11 1848 - Belagerungszustand über Berlin verhängt
Berlin * General Friedrich von Wrangel verhängt den Belagerungszustand über Berlin.
27. 11 1848 - Lola Montez reist nach London ab
London * „Die treue Lolitta“ [Montez] teilt ihrem „geliebten Louis“ mit, dass sie nach London in England abreisen werde.
2. 12 1848 - Franz Joseph I. wird Kaiser von Östereich-Ungarn
Wien * Der 18-jährige Franz Joseph I. wird Kaiser von Östereich-Ungarn.
4. 12 1848 - Demonstration für den hingerichteten Demokraten Robert Blum
München * Rund 2.000 Fackelträger und Tausende Münchner ziehen durch die Straßen der Stadt. Sie wollen damit den am 9. November in Wien hingerichteten demokratischen Paulskirchen-Abgeordneten Robert Blum die letzte Ehre erweisen.
5. 12 1848 - Preußen erhält - 40 Jahre nach Bayern - eine Verfassung oktroyiert
Berlin * Die Preußische Nationalversammlung wird aufgelöst und eine neue Verfassung oktroyiert. Damit erhält das Königreich Preußen - vierzig Jahre nach Bayern - eine Verfassung.
Im Gegensatz zu Wien ist der Sieg der Gegenrevolution zwar unblutig errungen, aber dennoch unumkehrbar.
7. 12 1848 - „Diese schwere Last übernahm ich mit leidender Gesundheit“
München * Der eher zögerliche, häufig unentschlossene und kränkliche Bayernkönig Max II. schreibt an seinen Vater, Ludwig I., folgende Zeilen:
„Sie wissen, lieber Vater, unter welchen Umständen ich den Thron bestieg, welchen Zustand der Dinge ich gefunden; der Boden schwankte unter meinen Füßen, alle Bande der Ordnung waren gelockert. Diese schwere Last übernahm ich mit leidender Gesundheit. [...] Durch diese täglichen Körper- und Seelenleiden erscheint sie mir oft eine unerträgliche Bürde.“
27. 12 1848 - Grundrechte des deutschen Volkes verabschiedet
Frankfurt am Main * Die Nationalversammlung in Frankfurt am Main verabschiedet die Grundrechte des deutschen Volkes, die am 28. März 1849 in die Paulskirchen-Verfassung münden wird.
- Erbkaiser soll der König von Preußen werden.
- Anstatt eines Großdeutschland sollte es nur ein Kleindeutschland geben, da Österreich nicht bereit ist, seine nichtdeutschen Gebiete aufzugeben.
1849 - Eine „Turner-Feuerwehr“ wird gegründet
München * Eine „Turner-Feuerwehr“ wird gegründet.
Es ist der erste Versuch, in München ein organisiertes Löschwesen mit eingeübter Mannschaft ins Leben zu rufen.
1849 - Wagners antisemitisches Pamphlet „Das Judenthum in der Musik“
??? * Zwischen 1849 und 1851 entstehen viele musiktheoretischen Schriften von Richard Wagner, darunter das antisemitische Pamphlet „Das Judenthum in der Musik“.
1849 - Die „Paulskirchen-Verfassung“ will die „Abschaffung der Todesstrafe“
Frankfurt am Main * Im Paragraph 139 der „Paulskirchen-Verfassung“ ist die „Abschaffung der Todesstrafe“ vorgesehen.
Die anschließende „Reaktion“ führt sie jedoch wieder ein.
1849 - Die Zahl der „Seelen“ in der „Anna-Pfarrei“ liegt bei 6.897
München-Lehel * Die Zahl der „Seelen“ in der „Anna-Pfarrei“ liegt bei 6.897.
1849 - München hat 96.398 Einwohner
München * München hat 96.398 Einwohner.
15. 1 1849 - Eine linke Mehrheit
München-Kreuzviertel * Der neugewählte Landtag, es war der 13., tagt vom 15. Januar bis 7. März sowie vom 15. Mai bis 11. Juni 1849. Es ist der erste und bislang letzte Bayerische Landtag mit einer linken Mehrheit. Diese Mehrheit vertritt eine andere Auffassung als die Königliche Regierung.
69 Abgeordnete leisten ihren Verfassungseid nur mit dem Vorbehalt, dass sie durch diesen „an der Anerkennung der Gültigkeit der Reichsgesetze insbesondere der die Grundrechte betreffenden hiedurch nicht gehindert“ sein sollen.
Bei der ersten öffentlichen Sitzung der Abgeordnetenkammer erklärt sich Innenminister Hermann von Beisler bereit, „die Gesetzgebung Bayerns mit der des deutschen Reiches in Einklang zu setzen. In diesem Sinne werden Ihnen bezüglich der Grundrechte die entsprechenden Vorlagen gemacht werden.“
20. 1 1849 - Ein politisches Haberfeldtreiben gegen einen fortschrittlichen Lehrer
Holzolling * In der Nacht vom 20. zum 21. Januar 1849 wird auf einer Wiese außerhalb von Holzolling ein Haberfeldtreiben abgehalten. Die Treiben finden nun schon seit einiger Zeit aus Sicherheitsgründen außerhalb der dörflichen Siedlungen statt. Getrieben wird von 50 bis 60 Haberern. Es gilt mehreren Einwohnern des Dorfes, in der Hauptsache aber dem Lehrer Franz Xaver Bacherl.
Der Grund für das Haberfeldtreiben ist bei Franz Xaver Bacherl nicht in einer Leichtfertigkeit zu finden, sondern ist politischer Natur und zeigt damit eine völlig neue Tendenz weg vom Sittlichkeitstreiben. Der Lehrer Franz Xaver Bacherl
- begeisterte sich für ein großes, geeinigtes Deutschland,
- hatte einen Arbeiterverein, angelehnt an den Münchner Märzverein gegründet,
- organisierte Versammlungen und hielt politische Reden.
Als der Holzollinger Kooperator Haid gegen den Arbeiterverein von der Kanzel predigte, schrieb Bacherl über ihn einen Artikel in der revolutionsfreundlichen, radikal-demokratischen Zeitung „Gradaus mein deutsches Volk! * Volksblatt für uneingeschränkte Freiheit“.
Daraus ergibt sich einerseits, dass das Haberfeldtreiben gegen Franz Xaver Bacherl von einem geistlichen Herrn forciert worden war, und dass andererseits die Haberer wenig sorgfältig über ihr Opfer recherchierten und wie hilflos sie im Grunde den neuen sozialen und politischen Entwicklungen gegenüber standen. Die Haberer werfen dem Lehrer vor:
- seinen schändlichen Artikel im „Gradaus“ und
- unterstellen ihm, er hätte einen „Lumpenverein“ gegründet,
- den Opferstock ausgeraubt und
- die Vorhänge aus dem Beichtstuhl gestohlen, um sich daraus einen Frack schneidern zu lassen.
22. 1 1849 - Den Landtag beherrscht das Thema Reichsverfassung
München-Kreuzviertel * König Max II. eröffnet den Landtag im Landtagsgebäude an der Prannerstraße und kündigt eine ganze Serie von Gesetzesvorlagen an. Doch diese Zusammenkunft der Abgeordneten steht unter einem einzigen Thema: der Reichsverfassung, die die Frankfurter Nationalversammlung ausgearbeitet hat.
Es entsteht ein heftiger Meinungsstreit, weil das Frankfurter Staatsgrundgesetz von den konservativen Kräften als Eingriff in die Souveränität der Bundesstaaten betrachtet wird.
4. 3 1849 - Die Großmacht Österreich erhält eine Verfassung
Wien * Die Großmacht Österreich erhält eine Verfassung. Das ist immerhin über dreißig Jahre nach Bayern.
8. 3 1849 - König Max II löst - trotz Versprechungen - den Landtag auf
München-Kreuzviertel * Der Abgeordnetenkammer wird die Vorlage einer im Sinne der „Frankfurter Grundlage“ geänderten Bayerischen Verfassung versprochen. Doch noch am gleichen Tag vertagt König Max II. den Landtag und bildet die Regierung um.
28. 3 1849 - Die Nationalversammlung verabschiedet die Reichsverfassung
Frankfurt am Main * Die Frankfurter Nationalversammlung verabschiedet ihre Verfassung.
3. 4 1849 - Friedrich Wilhelm IV. will nicht Kaiser von Volkes Gnaden sein
Berlin - Frankfurt am Main * Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. lehnt die ihm von der Nationalversammlung angebotene Kaiserkrone ab. Die von Volksvertretern angebotene Krone besteht für Friedrich Wilhelm IV., der in seinem monarchischen Selbstbild vom traditionellen Gedanken des Gottesgnadentums ausgeht und die Idee der Volkssouveränität ablehnt, nur aus „Dreck und Letten“. Ein „Kaiser von Volkes Gnaden“ will er keinesfalls sein. Damit sind auch die Deutsche Einheit und die Reichsverfassung gescheitert.
Die Zurückweisung der Kaiserkrone durch den preußischen König liegt an dessen innerlichen Ablehnung der Frankfurter Reichsverfassung, weil diese von Demokraten und Liberalen beschlossen worden ist. Denn während der Revolutionszeit hat der Preußenkönig immer wieder seine Bereitschaft signalisiert, an die Spitze eines deutschen Bundesstaates zu treten. Er wünscht sich allerdings eine konservativere Verfassung und scheut sich vor dem Titel eines Kaisers.
Viel wichtiger ist ihm, die Zustimmung seiner Standesgenossen, der anderen deutschen Fürsten, zu erhalten. Bereits am 3. April 1849, als Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone des Frankfurter Parlaments ablehnt, lässt er die übrigen deutschen Staaten wissen, dass er an die Spitze eines deutschen Bundesstaates treten wolle, an dem diejenigen Staaten teilnehmen sollen, die dies wünschen.
23. 4 1849 - Das „Königreich Bayern“ lehnt die „Reichsverfassung“ ab
München * Das „Königreich Bayern“ lehnt die „Reichsverfassung“ ab.
Der „Landtag“ tagt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.
In der Folge kommt es zu einer breiten „Protestbewegung“, die sich in der Pfalz sogar zum „Aufstand“ auswächst.
„Es verstand sich bei den Pfälzern von selbst, wenn der König von Bayern nicht deutsch sein wollte, die Pfalz aufhören müsse, bayerisch zu sein“.
2. 5 1849 - Wahl eines „provisorischen Landesverteidigungs-Ausschusses“
Kaiserslautern * Die Vertreter der „demokratischen Vereine“ in der Pfalz wählen in Kaiserslautern einen „provisorischen Landesverteidigungsausschuss“, der von der bayerischen „Regierung“ die „Anerkennung der Reichsverfassung“ fordert und zur „Volksbewaffnung“ aufruft.
3. 5 1849 - Der „Dresdner Maiaufstand“ scheitert
Dresden * Die Ausrufung der „Sächsischen Republik“ scheitert im „Dresdner Maiaufstand“, der vom 3. bis 9. Mai 1849 andauert und von preußischen Truppen niedergeschlagen wird.
9. 5 1849 - Richard Wagner wird in Deutschland steckbrieflich gesucht
Dresden * Richard Wagner wird wegen seiner Beteiligung am Dresdner Mai-Aufstand in Deutschland steckbrieflich gesucht. Er ist beim Aufstand in Dresden als Schriftführer der Revolutionsregierung und als Beschaffer von [Semper'scher] Barrikadenarchitektur aufgefallen. Der Aufstand wird jedoch niedergeschlagen.
Zuvor sprach Richard Wagner in einem anonymen Artikel von der „Zerstörung der bestehenden Ordnung der Dinge“ durch die „erhabene Göttin Revolution“. Unterstützt von Franz Liszt flieht er über Weimar nach Zürich, wo er als Komponist und Musikschriftsteller arbeitet.
11. 5 1849 - Der „Badische Maiaufstand“ führt zur „Republik Baden“
Baden * Der beginnende „Badische Maiaufstand“ führt zur Flucht des Großherzogs Leopold von Baden am 13. Mai und zur Ausrufung der „Republik Baden“.
Doch preußische Truppen rückten gegen Baden vor.
16. 5 1849 - Der Bayerische Landtag tritt wieder zusammen
München-Kreuzviertel * Der Bayerische Landtag tritt wieder zusammen.
21. 5 1849 - Die Abgeordneten fordern die Anerkennung der Reichsverfassung
München-Kreuzviertel * Die Kammer der Abgeordneten fordert mit 72 gegen 62 Stimmen die Anerkennung der „Reichsverfassung, die insbesondere von der fränkischen, schwäbischen und rheinpfälzischen Bevölkerung laut und freudig begrüßt“ wird.
22. 5 1849 - Pfälzischen Abgeordneten wird die Sitzungsteilnahme verboten
München-Kreuzviertel * Die Regierung verweigert den pfälzischen Abgeordneten die Teilnahme am Landtag, woraufhin die Linke geschlossen das Parlament verlässt.
26. 5 1849 - Hubert Herkomer kommt in Waal bei Landsberg zur Welt
Waal bei Landsberg * Hubert Herkomer kommt in Waal bei Landsberg zur Welt.
27. 5 1849 - Bayern lehnt den Beitritt zur Erfurter Union ab
München - Berlin * Das Königreich Bayern lehnt den Beitritt der von Preußen gegründeten Erfurter Union ab.
1. 6 1849 - Die Regierung beschließt Entsendung von Truppen in die Pfalz
München-Kreuzviertel * Die Regierung beschließt die Entsendung von Truppen in die Pfalz. König Max II. setzt sich mit seinem Onkel Friedrich Wilhelm IV. von Preußen in Verbindung.
6. 6 1849 - Reste der Frankfurter Nationalversammlung tagen in Stuttgart
Stuttgart * Der verbliebene Rest der Frankfurter Nationalversammlung tagt in Stuttgart, wird dann aber von württembergischen Truppen aufgelöst.
10. 6 1849 - Der Kriegszustand wird über die Pfalz verhängt
München * Bevor das Militär in die Pfalz einmarschiert, macht der Bayernmonarch am 10. Juni 1849 erstmals vom Instrument der Auflösung des Landtags Gebrauch und veranlasst die nötigen Neuwahlen, die eine für die Regierung günstigere Zusammensetzung der Abgeordnetenkammer bewirken soll.
Gleichzeitig wird der Kriegszustand über die Pfalz verhängt.
Ab dem 13. 6 1849 - Der Aufstand in der Pfalz wird niedergeschlagen
Pfalz * Der Aufstand in der Pfalz wird ab dem 13. Juni mit preußischer Unterstützung niedergeschlagen. Nach den Unruhen in Schwaben und Franken, welche die Bürger aufgeschreckt und verunsichert haben, gewinnen die gemäßigten und konservativen Kräfte wieder die Oberhand.
24. 6 1849 - Der Steyrer Hans wird in Allach geboren
Allach * Hans Steyrer wird in Allach als Sohn der Metzger- und Wirtsleute Josef und Mathilde Steyrer geboren. Im Gegensatz zum gallischen Obelix ist der Bub aber nie in einen Zaubertrank gefallen, sondern besitzt seine außergewöhnliche Kraft bereits von Kindesbeinen an.
2. 7 1849 - Marie Therese wird in Brünn geboren
Brünn * Marie Therese, Erzherzogin von Österreich-Este und Prinzessin von Modena, die spätere Ehefrau von Prinzregent und König Ludwig III., wird in Brünn geboren.
14. 7 1849 - Die Landtagswahlen sollen andere Mehrheiten ermöglichen
Königreich Bayern * Die für diesen Tag angesetzten Landtagswahlen werden von der Staatsregierung sorgfältig vorbereitet. Sie setzt dabei vor allem auf den Einfluss der kirchlichen Oberhirten und Pfarrer sowie auf das Engagement der(höheren) Beamtenschaft. Der Regierung genehme Vereine werden gefördert; nach den Wahlen jedoch alle politischen Vereine wieder verboten.
Die Wahlkreise werden erstmals von der Regierung nach wahltaktischen Gesichtspunkten gebildet. Eine Praxis, die die Regierung von nun an bis zur Wahlrechtsreform von 1906 beibehalten wird. Mit den so gewonnenen neuen Mehrheitsverhältnissen kann König Max II. eine Politik der Reaktion verfolgen und versuchen, die Änderungen der Bayerischen Verfassung wieder rückgängig zu machen.
15. 7 1849 - Haidhausen will ein neues Gotteshaus
Haidhausen * Die Gemeinde Haidhausen beschließt den Neubau der Sankt-Johann-Baptist-Kirche am heutigen Johannisplatz.
19. 7 1849 - Lola Montez heiratet den 21-jährigen George Trafford Heald
London * Lola Montez heiratet den 21-jährigen George Trafford Heald. Der reiche Erbe war eine der besten Partien in London. Die Braut Lola Montez unterschreibt die Heiratsurkunde mit Maria de los Dolores de Landsfeld. Die Ehe hält nicht lange und wird annulliert. Während der Ehezeit tauschen Lola und Ludwig I. weiterhin Briefe aus. Außerdem erhält sie finanzielle Unterstützungen aus Bayern.
23. 7 1849 - Preußischen Truppen nehmen Rastatt ein
Rastatt * Preußischen Truppen nehmen Rastatt ein. Damit endete zumindest symbolisch die Deutsche Revolution von 1848/49.
16. 9 1849 - Der 77-jährige Franz Xaver Zacherl erhängt sich
Vorstadt Au * Der 77-jährige Franz Xaver Zacherl erhängt sich. Ludwig und Heinrich Schmederer erben die Zacherlbrauerei.
3. 10 1849 - Die letzten ungarischen Revolutionäre kapitulieren
Wien * Die letzten ungarischen Revolutionäre kapitulieren gegenüber den Österreichern.
30. 10 1849 - Zustimmung für die Eingemeindung der drei östlichen Vororte
München-Graggenau * Beide Münchner Gemeindekollegien stimmen der Vereinigung mit den drei östlichen Vororten zu.
1. 11 1849 - Der Schwarze Einser wird herausgegeben
München-Graggenau * Der königliche Postbeamte am Münchner Hauptpostamt gibt die erste deutsche Briefmarke, den „Schwarzen Einser“, heraus. Erst einen Tag nach der Ausgabe der ersten Bayern-Marke werden die Münchner über die Neuerung im Intelligenzblatt informiert. „Die Marken“, so kann man lesen, „sind jedesmal von dem Absender auf der Adreßseite des Briefes etc. im oberen Eck links durch Befeuchten des auf denselben befindlichen Klebstoffes gut zu befestigen“.
Geregelt werden in dem königlichen Erlass auch die Gebühren, Taxen genannt. Ein Brief innerhalb Münchens kostet einen Kreuzer [„Schwarzer Einser“]. Für Briefe, die nicht weiter als zwölf Meilen [knappe 20 Kilometer] verschickt werden, muss man drei Kreuzer berappen, sonst das Doppelte. Ein kleiner Preisvergleich: Für einen Kreuzer erhält man im Jahr 1849 ein Pfund Roggenbrot. Ein Pfund Schweinefleisch kostete zehn Mal soviel.
Die Herstellung des Spezialpapiers bereitet solche Probleme, dass die ersten bayerischen Briefmarken vier Wochen später als ursprünglich vorgesehen in die Postämter kommen. Peter Hasenay, der im Hauptberuf Geldscheine zeichnet, muss nur drei Werte entwerfen: „1 Kreuzer schwarz“, „3 Kreuzer blau“ und „6 Kreuzer braunrot“; erst im darauffolgenden Jahr kommt noch eine weitere Marke hinzu: die „9 Kreuzer grün“.
Zu dieser Zeit ist die erste Marke, der „Schwarze Einser“, schon wieder aus dem Handel gezogen. Der Schwärze wegen, denn sie macht die Stempel unleserlich. Die General-Verwaltung der königl. Posten und Eisenbahnen gibt eine neue, weniger schwarze Einser heraus. Von der ursprünglichen Marke werden rund 725.000 Stück verkauft.
9. 11 1849 - Das bayerische Nationalgefühl des Volkes heben und kräftigen
München * In einem Schreiben an seinen Innenminister Theodor von Zwehl kündigt König Max II. an: „Es ist von großer Wichtigkeit, auch in Bayern das Nationalgefühl des Volkes zu heben und zu kräftigen.“
Mit diesem Programm will er die Monarchie in Bayern sichern. Ihm ist klar, dass fast die Hälfte seines Staatsgebiets und seiner Bevölkerung nicht das Geringste mit Bayern zu tun hatte. Die revolutionären Ereignisse haben gezeigt, dass besonders von Franken, das keinerlei geschichtlichen Bezug zu Bayern hatte, der stärkste Widerstand gegen die Monarchie ausging.
Durch die Förderung von Tracht, Brauchtum und Geschichte, durch Geschichtszyklen und dynastische Feste, durch Denkmäler, Nationalhymne und den Ausgleich der Religionen sowie durch gezielte Unterstützung aller konservativen, monarchiefreundlichen Institutionen und Vereinigungen, soll die gesamtbayerische Identitätsstiftung gesteuert werden.
All diese Maßnahmen schlagen sich nicht zuletzt auch in Fragen der Architektur nieder. Denn zum Ziel zur Förderung einer bayerisch-monarchischen Gesinnung zählen auch die Bemühungen des Bayernregenten um einen neuen Baustil, bei dem programmatisch gotische und bäuerliche Architekturformen, also letztlich „deutsche“ und „bayerische“ Elemente verschmolzen werden sollen.
Darüber hinaus verfolgt Max II. mit einem neuen, in Bayern erfundenen Baustil außenpolitische Ziele.
- Er will damit für Bayern eine Vorrangstellung unter den deutschen Mittelstaaten erreichen und so das Land als dritte Kraft zwischen Preußen und Österreich etablieren und zumindest in der Architektur und im Städtebau eine führende Rolle einnehmen.
- Daneben hätte er mit der Erfindung eines neuen Baustils auch seinen Vater, den dominierenden Kunstkönig, in dessen ureigenstem Gebiet übertroffen.
12 1849 - 28 Länder haben sich der Erfurter Union angeschossen
Berlin * Im Deutschen Bund gibt es noch 36 deutsche Länder, von denen sich 28 der sogenannten Erfurter Union anschlossen. Acht Länder treten der Union nie bei. Außer Österreich sind dies: Bayern, Württemberg, Schleswig und Holnstein, Luxemburg-Limburg, Liechtenstein, Hessen-Homburg und Frankfurt.
1850 - Die Festlegung der „Brauperiode für untergäriges Bier“ wird aufgehoben
München * Die Festlegung der „Brauperiode für untergäriges Bier“ auf die Zeit vom 29. September (Michaeli) bis 23. April (Georgi) wird aufgehoben.
1850 - Bierkeller zählen zu den „Volksbelustigungsorten“
München * Die Münchner Bierkeller sind in bürgerlichen Kreisen so populär, dass man sie zu den „Volksbelustigungsorten“ zählt.
1850 - Das „Siegestor“ wird fertiggestellt
München-Maxvorstadt - Schwabing * Das „Siegestor“ wird zwei Jahre nach der Abdankung König Ludwig I. fertiggestellt.
Es soll an die siegreichen Feldzüge der Jahre 1813 bis 1815 gegen Napoleon erinnern.
Das „Siegestor“ ist 411.000 Gulden teuer.
1850 - Sebastian Kneipp entwickelt seine „Wasserkur“
München-Maxvorstadt * Während seines Aufenthalts im „Georgianum“ (bis 1852) entwickelt der spätere „Landpfarrer“ Sebastian Kneipp seine „Wasserkur“.
1850 - Der „Kreuzlgießergarten“ wird zur „Gastwirtschaft zum Salzburger Hof“
Haidhausen * Der „Kreuzlgießergarten“ an der Ecke Gasteig und Rosenheimer Straße wird zur „Gastwirtschaft zum Salzburger Hof“.
1850 - Lorenz Meiller kauft das Anwesen an der Lilienstraße
Vorstadt Au * Der „Schmied und Geschmeidemacher“ Lorenz Meiller kauft das Anwesen an der heutigen Lilienstraße 5.
1850 - Der Münchner Malzverbrauch liegt bei 284.582 Hektoliter
München * Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien liegt bei 284.582 Hektoliter.
Um 1850 - Die ersten „Stempeluhren“ werden installiert
Königreich Bayern * Die ersten „Stempeluhren“ werden installiert, wodurch die Erfassung der Arbeitszeit ständig präzisiert wird.
1850 - Maffei ist Hauptaktionär der „Eisenwerk-Gesellschaft-Maxhütte“
Burglengenfeld * Joseph Anton von Maffei ist Hauptaktionär und Vorstand der oberpfälzischen „Eisenwerk-Gesellschaft-Maxhütte“ bei Burglengenfeld.
Das Unternehmen hat sich vor allem auf die Herstellung von Eisenbahnschienen spezialisiert.
1850 - Die „Loretokapelle“ wird abgerissen
Berg am Laim * Die „Loretokapelle“ an der heutigen Berg-am-Laim-Straße wird abgerissen.
Bis zum Jahr 1850 - Die „Kolonie Birkenau“ ist durch die Hochwässer bedroht
Untergiesing * Die „Kolonie Birkenau“ ist, bis zur Aufschüttung der Dammanlagen der Isar - in den Jahren zwischen 1850 und 1860 - durch die jährlichen Frühjahrs- und Herbsthochwässer bedroht.
Vor der Bebauung sind die Giesinger Weidenflächen im Hochwassergebiet zwischen „Entenbach“ und „Kühbachl“ stellenweise eine mit Weiden und Birken bestandene Wiesenfläche.
Aus dem Wildwuchs des älteren Lohwaldes entsteht später - durch das Vieh und die Beweidung - eine Baumkultur.
1850 - Friedrich Bürklein wird „Professor an der Polytechnischen Schule“
München * König Max II. ernennt Friedrich Bürklein zum „Professor an der Polytechnischen Schule in München“ und befördert ihn zum „Baurath“ bei den „Generaldirektionen der kgl. Verkehrsanstalten“.
Den ersten Auftrag, den Bürklein vom König erhält, ist der „Stadtverschönerungsplan“.
Ab 1850 - Erstmals können großflächige Glasscheiben hergestellt werden
München * Erstmals können großflächige Glasscheiben ohne Sprossen hergestellt werden.
Ideal für die eleganten, neuen „Kaufhäuser“.
1850 - Braumeister Heiss kauft die Brauerei „Zum Oberpollinger“
München-Kreuzviertel * Ein Braumeister aus Kulmbach namens Heiss kauft die Brauerei „Zum Oberpollinger“.
1850 - Die „Anna-Kirche“ soll zwei Türme mit Glocken und Uhren erhalten
München-Lehel * Als sich das alte Chortürmchen der „Anna-Kirche“ als baufällig herausstellt, verwirklichen sich die Bewohner der „Anna-Vorstadt“ einen Traum.
Ihre Kirche soll zwei Türme mit Glocken und Uhren erhalten.
Die „Anna-Vorstädter“ gründen einen „Turmbau-Verein“ und beauftragen den Architekten August von Voigt mit der Planung einer dem Zeitgeschmack entsprechenden neuromanischen Außenfassade, die stilistisch von der nahegelegenen „Ludwigskirche“ beeinflusst ist.
Mit dem neuen Aussehen der Kirche soll das „Lehel“ einen besonderen städtebaulichen Akzent erhalten, damit es sich gegenüber „der an kostbaren Baudenkmälern so reichen Residenzstadt“ als würdig erweisen kann.
Die Türme waren im ursprünglichen Plan von Johann Michael Fischer bereits vorgesehen und hätten der Kirchenfassade in etwa das Aussehen der „Michaels-Kirche“ in Berg am Laim gegeben.
Es ging aber den „Lechlern“ nicht nur um Kirchentürme mit einem Geläute von fünf Glocken, sondern in der Hauptsache um die notwendige Vergrößerung des Kirchenraumes, da die Kirchengemeinde zwischenzeitlich erheblich angewachsen war.
1850 - Zu geringe Seiden-Ausbeute
München * Resigniert muss der Frauenverein zur Beförderung der Seidenzucht feststellen, dass zwar 150.000 Maulbeerbäume gepflanzt worden waren, aber daraus nur 389½ Pfund Seide gewonnen werden konnten.
26. 2 1850 - Der Vorläufer der Münchner Feuerwehr wird schon wieder aufgelöst
München * Da Turnvereine seit dem in diesem Jahr verabschiedeten Vereinsgesetz als politische Zusammenschlüsse gelten, wird der Vorläufer der Münchner Feuerwehr schon wieder aufgelöst. Ihr Vermögen, ihre Geräte und ihr gesamtes Inventar fallen der Stadt zu. Der alte Schlendrian geht weiter.
1. 5 1850 - J. Schweiger erhält eine Konzession für ein „Theater in der Vorstadt Au“
Vorstadt Au * Mit der Unterstützung Auer Bürger erhält Johann Schweiger - trotz des Widerstand der „Hoftheaterintendanz“ - die Konzession für ein eigenes „Theater in der Vorstadt Au“.
Es befindet sich im Garten der Wirtschaft „Kaisergarten“ in der Lilienstraße 2.
Jetzt haben die Münchner die Qual dar Wahl. Und schon bald heißt es: „Heut‘ geh‘ ich zum Schani, morgen zum Maxl“.
1. 5 1850 - Das „Schweiger Volkstheater“ in der Au erhält Gasbeleuchtung
Vorstadt Au * Das „Schweiger Volkstheater“ in der Au erhält Gasbeleuchtung.
Nach dem 1. 5 1850 - Die „Schweiger Volkstheater“ dürfen nur noch „Lokalpossen“ aufführen
Vorstadt Au - München-Isarvorstadt * Die „Schweiger Volkstheater“ dürfen auf Druck des „Königlichen Hoftheaters“ keine „Dramen“ und „Konversationsstücke“ mehr zur Aufführung bringen, sondern nur noch „Lokalpossen“ aufführen.
1. 5 1850 - Die „Maffei'sche Maschinenfabrik“ präsentiert ihr erstes Dampfschiff
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „Maffei'sche Maschinenfabrik“ präsentiert ihr erstes Dampfschiff.
Über dem zu den Werkstätten in der „Hirschau“ führenden Isarkanal fährt der Raddampfer „Stadt Donauwörth“ über die Isar bis zur „Praterinsel“.
Die Fabrikarbeiter haben den Dampfer, der eine Länge von etwa 40 Metern bei 3½ Meter Breite und einen sehr geringen Tiefgang besitzt, reich verziert und an der Landspitze nahe der „Praterinsel“ eine große, mit maschinentechnischen Emblemen geschmückte Pyramide aufgebaut.
Eine große Schar Neugieriger beobachtet die Fahrt des Schiffes, das mit einer Leistung von 43 Pferdestärken gegen den Strom der Isar hinauf fährt; später dann flussabwärts bis zur Donau.
1. 5 1850 - Arnold Zenetti wird als „Bauingenieur beim Stadtbauamt“ angestellt
München * Arnold Zenetti wird als „Bauingenieur beim Stadtbauamt“ angestellt.
Seine ersten Verdienste erwirbt sich der junge Zenetti beim Bau der „Maximilianstraße“ und der „Maximiliansbrücke“.
6. 7 1850 - Der Münchner Turnverein wird verboten und aufgelöst
München * Der Münchner Turnverein wird verboten und aufgelöst.
28. 8 1850 - Uraufführung der Wagner-Oper „Lohengrin“ in Weimar
Weimar * Die Richard-Wagner-Oper „Lohengrin“ wird unter der Leitung von Franz Liszt in Weimar zur Uraufführung gebracht.
3. 10 1850 - Enthüllung der Bavaria wegen Regen verschoben
München-Theresienwiese * Die Bavaria soll enthüllt werden, aber es regnet. Deshalb wird die Feier so lange verschoben, bis die Sonne scheint.
15. 10 1850 - Der preußisch-österreichische Konflikt spitzt sich zu
Berlin - Wien * Bis zum 15. Oktober 1850 reduzieren sich die Mitgliedsstaaten der Erfurter Union auf 21. Österreich kann die abgefallenen Staaten hinter sich bringen. Doch dadurch spitzte sich der preußisch-österreichische Konflikt immer mehr zu.
Um 11 1850 - Ein neuer Baustil soll erfunden werden
München * Um zu einem neuen Baustil zu gelangen, veranlasst König Max II. eine öffentliche Ausschreibung für das „Athenäum“-Projekt.
Die „Kgl. Akademie der Bildenden Künste“ verschickt dazu eine „Einladung zu einer Preisbewerbung die Anfertigung eines Bauplanes zu einer höheren Bildungs- und Unterrichtsanstalt betreffend“ an insgesamt einhundert Architekten in Deutschland, deren Beteiligung man gerne gesehen hätte. Zudem wird die Konkurrenz in Tageszeitungen und Fachzeitschriften angekündigt.
Das Wettbewerbsprogramm und die nachgereichten „Erläuternden Bemerkungen“ stellen die Bewerber jedoch vor eine komplexe Aufgabe.
So soll durch die „Verschmelzung der Elemente und Eigentümlichkeiten“ der Stilgattungen aller Epochen - unter Berücksichtigung der „altdeutschen“ gotischen Baukunst ein „bis dahin noch nicht dagewesener Baustil“ im Sinne eines „bayerischen Nationalstils“ geschaffen werden.
Der Wunsch nach Verwendung des „Formenprinzips der altdeutschen, sogenannten gotischen Architektur“ lassen aber den Architekturwettbewerb letztlich scheitern.
10. 11 1850 - Erneut ein Haberfeldtreiben gegen den Pfarrer
Wöllkauer Anhöhe bei Irschenberg * Dem Nachfolger von Ignaz Kalm, Pfarrer Zänger, wird in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1850, gemeinsam mit dem Kooperator Bartl, dem Schulmeister Strahler und noch ein paar anderen Dorfbewohnern das Haberfeld getrieben.
Der neue Pfarrer hatte zur Hebung des angekratzten Images von Kirche und Dorf einen katholischen Jungfernbund gegründet. Doch noch im gleichen Jahr hatten zwei junge Frauen „das theure Guth der Jungfrauenschaft“ verloren, ohne verheiratet zu sein. Die Haberer behaupten zudem, dass eine weitere Jungfer ein „Pfaffenkind“ ausgetragen hat.
Während beim ersten Treiben vom 20./21. Januar 1849 die Beteiligten ungeschoren davon kamen, werden im zweiten Verfahren alle dreißig Haberer verurteilt. Sie erhalten Zuchthausstrafen, die obligatorischen Rutenstreiche und müssen zudem fünf Gulden Strafe zahlen.
15. 11 1850 - Der Verein zur Ausbildung der Gewerke wird gegründet
München-Kreuzviertel * Der Verein zur Ausbildung der Gewerke wird gegründet. August von Voit übernimmt den Vorsitz und erklärt in seiner Rede, dass es zur Verpflichtung des Vereins gehört,
- die „deutsche Kunst wieder vollständig frei zu machen von Nachahmung“,
- worunter er die „schädliche Orientierung an der Kunstindustrie Frankreichs“ versteht.
Statt dessen wollen die Vereinsmitglieder
- „auf die reichen, schönen, lebendigen, entwicklungsfähigen Formen des romanischen und germanischen Styles in Deutschland“ zurückgreifen,
- um so „am größten und schwierigsten Bau der Gegenwart, an der Einheit des Vaterlandes“ mitzuwirken.
Um den 20. 11 1850 - Krieg zwischen Preußen und Österreich kann abgewendet werden
Berlin - Wien * Der drohende Krieg zwischen Preußen und Österreich kann gerade noch abgewendet werden, nachdem sich Russland auf die Seite Österreichs schlägt.
29. 11 1850 - Der Deutsche Bund soll wieder vollständig hergestellt werden
Olmütz * Österreich und Preußen verständigen sich in der Olmützer Punktation wieder auf eine Zusammenarbeit. Der Deutsche Bund soll wieder vollständig hergestellt werden. Preußen verzichtet auf seinen Führungsanspruch und muss seine Unionspolitik endgültig aufgeben.
Um 12 1850 - Friedrich Bürklein reicht einen „Stadtverschönerungsplan“ ein
München * Der Architekt Georg Christian Friedrich Bürklein reicht - im Auftrag des Königs - einen „Stadtverschönerungsplan“ ein.
Bürklein bringt auch den Gedanken des „Forums“ ein, indem er die Straße mit der vom König gewünschten Parkanlage verbindet.
Die Anlage wäre allerdings wesentlich größer und parkähnlicher ausgefallen, als dies heute der Fall ist. Da sich aber ein großer Park mit der Verkehrsstraße nur schwer vereinbaren lässt und außerdem die Vororte jenseits der Isar vom Stadtbezirk eher ferngehalten worden wären, nimmt man Abstand von diesen Plänen.
Was bleibt ist die Verbindung der Straße mit der Grünanlage, eben das heutige „Forum“, deren Platzmitte in den früheren Planungen mit vier Fontänen ausgestattet werden sollte.
Obwohl sich die Planungen für das Straßenprojekt noch über viele Jahre hinziehen, beginnt die praktische Umsetzung schon wesentlich früher.
Ab 1851 - Die „Brauerei zur Schwaige“ wird mehrfach erweitert
Haidhausen * Die „Brauerei zur Schwaige“ in Haidhausen wird mehrfach erweitert.
1851 - Eine Studie zur Neuorganisation des „Löschwesens“
München * König Max II. gibt eine Studie zur Neuorganisation des „Löschwesens“ in Auftrag.
1851 - Die „Woll- und Lodenfabrik Frey“ am „Dianabad“ wird gegründet
München-Englischer Garten - Hirschau * Am nordwestlichen Rand des „Englischen Gartens“ wird die „Woll- und Lodenfabrik Frey“ am „Dianabad“ gegründet.
1851 - Der bei „Maffei“ gebaute Dampfer „Maximilian“ läuft in Starnberg vom Stapel
München-Englischer Garten - Hirschau - Starnberg * Der bei „Maffei“ gebaute Raddampfer „Maximilian“ läuft in Starnberg vom Stapel.
Er hat eine genietete eiserne Schiffsschale mit Holzaufbauten.
1851 - Die „Bavaria“ ist die leistungsfähigste „Steilrampen-Lokomotive“
München-Englischer Garten - Hirschau * Maffei gewinnt mit seiner 72. Lokomotive, die ebenfalls auf den Namen „Bavaria“ hört, den ersten Preis beim „Semmering-Wettbewerb“ um die leistungsfähigste „Steilrampen-Lokomotive“.
1851 - Prozess um die „Verführung minderjähriger Mädchen“
München - Anif * Irene Gräfin von Arco-Stepperg, die Gattin von Aloys (Louis), wird von ihren Brüdern aus dem Hause Pallavicini gezwungen, sich zur „Wahrung der Familienehre“ von ihrem Ehemann zu trennen.
Die Ursache für diesen ungewöhnlichen Schritt liegt in einem Prozess begründet, den man Aloys (Louis) Graf von Arco-Stepperg in Anif macht.
Es geht dabei um die „Verführung minderjähriger Mädchen“.
19. 4 1851 - Der Zentralbahnhof wird mit 156 Lampen illuminiert
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Schwierigkeiten bereitet noch die Beleuchtung des Zentralbahnhofs. Doch dann kann die Einstiegs- und Empfangshalle mit 156 holzgasbetriebenen Lampen illuminiert werden. </p>
5 1851 - Franz von Pocci erhält König Ludwigs I. Liebesbriefe zurück
Rom * Franz von Pocci erhält die von König Ludwig I. an Lola Montez geschrieben Briefe zurück.
Mit der Übergabe der Liebesbriefe in Rom ist die spektakuläre Liebesbeziehung endgültig beendet.
21. 6 1851 - Vertrag für eine Bahnverbindung über Rosenheim nach Salzburg
München - Wien * Das Königreich Bayern schließt mit Österreich einen Vertrag zur Weiterführung einer Bahnverbindung über Rosenheim nach Salzburg auf österreichischem Territorium. Diese Planung hat eine europäische Dimension.
27. 7 1851 - Grundsteinlegung für die neue Loretokapelle
Berg am Laim * Für die neue Loretokapelle an der heutigen Josephsburgstraße wird der Grundstein gelegt.
31. 8 1851 - Der Architekturwettbewerb wird verlängert
München * Bis zum ersten Einsendetermin des Architekturwettbewerbs zu einem neuen Baustil liegen erst 17 Entwürfe vor. Man verlängert die Frist deshalb auf den 31. Dezember 1851 und versendet das Programm zusätzlich an eine Reihe inländischer und ausländischer Architekten.
Um den 15. 9 1851 - Lola Montez tritt in Frankreich auf
Frankreich * Lola Montez tritt in verschiedenen französischen Städten auf.
20. 11 1851 - Adolf Friedrich von Schack verlässt den Staatsdienst endgültig
Mecklenburg * Adolf Friedrich von Schack scheidet endgültig aus dem Staatsdienst aus.
20. 11 1851 - Lola Montez segelt nach New York
Le Havre * Lola Montez geht in Le Havre an Bord des Segelschiffes „Alexander von Humboldt“, um nach New York zu reisen.
2. 12 1851 - Staatspräsident Napoleon Bonaparte löst die Nationalversammlung auf
Paris * Kurz vor Ablauf seiner Amtszeit löst der französische Staatspräsident Charles Louis Napoleon Bonaparte die Nationalversammlung auf und lässt führende Oppositionspolitiker verhaften.
5. 12 1851 - Lola Montez trifft in New York ein
New York * Lola Montez erreicht nach einer 16-tägigen Schiffsreise New York.
5. 12 1851 - Charles Louis Napoleon Bonaparte siegt
Paris * Die nach der Auflösung der Nationalversammlung und Verhaftung führender Oppositionspolitiker folgenden blutigen Kämpfe kann Charles Louis Napoleon Bonaparte am 5. Dezember schließlich für sich entscheiden.
21. 12 1851 - Die Franzosen stimmen über eine neue Verfassung ab
Frankreich * Die Franzosen stimmen - für den Staatspräsidenten Charles Louis Napoleon Bonaparte erfolgreich - über eine neue Verfassung ab.
29. 12 1851 - Lola Montez spielt am Broadway Theatre in New York
New York * Lola Montez gibt ihr amerikanisches Debüt in „Betley, die Tirolerin“ am Broadway Theatre in New York. Sie ist der vor dreitausend Zuschauern umjubelte Star des Abends. Die Vorführungen müssen auf drei Wochen verlängert werden. Sie bricht damals in der ersten Woche erstmals den „Box Office Record“ der amerikanischen Theatergeschichte.
Der Finanz- und Publikumserfolg bleibt ihr in den nächsten Wochen und Monaten bei ihrer ausgedehnten Tournee an der amerikanischen Ostküste weiter treu.
31. 12 1851 - Unter den 100 Höchstbesteuerten Münchens befinden sich 26 Brauer
München * Unter den 100 Höchstbesteuerten Münchens befinden sich - trotz rückläufiger Brauereistätten - nun schon 26 Brauer.
1852 - Die Familie Herkomer wandert nach Cleveland, Ohio, aus
Cleveland/Ohio * Die Familie Herkomer wandert nach Cleveland, Ohio, aus.
1852 - Die „Rekognition für die Verlegung der Brücke“ abgelöst
München - Freising * Die Stadt München löst mit einer Einmalzahlung von 987 Gulden jährliche Zahlung für die „Rekognition für die Verlegung der Brücke“.
1852 - Lorenz Meiller wird die Ausübung seines Berufs verweigert
Vorstadt Au * Der „Magistrat der Vorstadt Au“ verweigert Lorenz Meiller die Ausübung seines Berufs als „Geschmeidemacher“, da „die Luxusartikel in der Au keinen genügenden Absatz finden“ können und zudem in München selbst genügend „Geschmeidemacher“ ansässig sind.
Die „Gerechtsame“ ist aber die Voraussetzung für die Ausübung eines Handwerks.
Zu dieser Zeit gibt es in Bayern noch keine „Gewerbefreiheit“.
1852 - Die „Augustiner-Brauerei“ stellt ihren Betrieb auf „Dampfkraft“ um
München-Ludwigsvostadt * Die „Augustiner-Brauerei“ stellt ihren Betrieb auf „Dampfkraft“ um.
1852 - Das erste „Varieté“ entsteht in London
London * Das erste „Varieté“ entsteht in London. Es wird „Music Hall“ genannt und befindet sich in der „Saint George's Tavern“.
Das „Varieté“ hat ihren Ursprung in den „Gauklern“ der Antike und des Mittelalters, die auf den Jahrmärkten herumzogen. In festen Häusern etabliert sich diese Kunstform im 19. Jahrhundert in England.
1852 - Turbulenzen bei der „Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft“
München-Englischer Garten - Tivoli * Es kommt zum Zerwürfnis zwischen Christian August Ernst und der „Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft“ wegen nicht ausbezahlter Dividenden.
Ab 1852 - Frauen werden nicht mehr an der „Kunst-Akademie“ zugelassen
München-Maxvorstadt * Bis zum Wintersemester 1920/21 werden Frauen nicht mehr zum Studium an der „Akademie der Bildenden Künste“ zugelassen.
1852 - Die schwierige Verwirklichung der „Isaranlagen“
München * Bürgermeister Dr. Jacob Bauer schreibt, dass die Verwirklichung der „Isaranlagen“ oftmals nur gegen den Widerstand einiger Ratsmitglieder zu erreichen ist:
„Es gibt Leute, welche keinen Baum sehen können und in deren Bepflanzung eine Geldverschwendung erkennen; nur solche Bäume, an denen statt Blätter Banknoten wachsen würden, wären für ihren Geschmack“.
1852 - Die bayerischen Briefmarken sind halt einfach schöner
Berlin * Die wegen dauernder Verletzung des Briefgeheimnisses arg ramponierte „Thurn- und Taxis-Post“, die in Preußen noch das Monopol hat, kann erst jetzt nachziehen.
Doch das Format und Design ihrer „Briefmarken“ sind nur ein Abklatsch des bayerischen Vorbildes.
Im Gegensatz zum „Schwarzen Einser“ stehen diese preußischen „Freimarken“ noch heute nicht besonders hoch im Kurs.
1852 - In New York fährt die weltweit erste Straßenbahn
New York * In New York fährt die weltweit erste Straßenbahn.
29. 3 1852 - Grundsteinlegung für die neue Haidhauser Johann-Baptist-Pfarrkirche
<p><strong><em>Haidhausen</em></strong> * Der Grundstein für die neue Johann-Baptist-Pfarrkirche in Haidhausen wird gelegt.</p>
7. 5 1852 - Finanzierung der Bahnverbindung nach Salzburg gesichert
Rosenheim - Salzburg * Der bayerische Staat finanziert und übernimmt die Ausführung der Bahnverbindung über Rosenheim nach Salzburg.
25. 5 1852 - Das Lola-Montez-Bühnenstück Lola Montez in Bavaria hat Premiere
New York * Das von Lola Montez selbst in Auftrag gegebene Stück „Lola Montez in Bavaria“ hat am Broadway Premiere. Im Mittelpunkt des Stückes steht ihre Affäre mit König Ludwig I.. Sie selbst spielt die Hauptrolle.
1. 6 1852 - Friedrich Bürklein reicht einen Stadtverschönerungsplan ein
München-Graggenau - München-Lehel * Der Architekt Georg Christian Friedrich Bürklein reicht - im Auftrag Königs Max II. - einen Stadtverschönerungsplan ein. Bürklein bringt auch den Gedanken des Forums in der heutigen Maximilanstraße ein, indem er die Straße mit der vom König gewünschten Parkanlage verbindet. Die Anlage wäre allerdings wesentlich größer und parkähnlicher ausgefallen, als dies heute der Fall ist.
Da sich aber ein großer Park mit der Verkehrsstraße nur schwer vereinbaren lässt und außerdem die Vororte jenseits der Isar vom Stadtbezirk eher ferngehalten worden wären, nimmt man Abstand von diesen Plänen. Was bleibt ist die Verbindung der Straße mit der Grünanlage, eben das heutige Forum, deren Platzmitte in den früheren Planungen mit vier Fontänen ausgestattet werden sollte.
Obwohl sich die Planungen für das Straßenprojekt noch über viele Jahre hinziehen, beginnt die praktische Umsetzung schon wesentlich früher.
9. 6 1852 - König Max II. schafft die Vereidigung der Armee auf die Verfassung ab
München * König Max II. lässt die Vereidigung der Armee auf die Verfassung abschaffen. Diese hatte sein Vater König Ludwig I. mit Ausrufung der Proklamation am 6. März 1848 eingeführt. Im neuen Eid ist von der Verfassung keine Rede mehr.
28. 6 1852 - Lola Montez spielt Lola Montez in Bavaria
New York * In dem Schauspiel „Lola Montez in Bavaria” tritt Lola Montez im New Yorker Bowery Theatre als Lola Montez auf.
Um 7 1852 - Aufträge zur Anfertigung von „Musterfassaden für die neue Straße“
München-Graggenau - München-Lehel * König Max II. gibt den Architekten Bürklein, Gottreu, Riedel, Voit und Ziebland Aufträge zur Anfertigung von „Musterfassaden für die neue Straße“.
Dass sich der König statt an einen, an mehrere Architekten wendet, ist vorbildlich. Doch er macht wieder den Fehler, den Architekten bindende, alle Einzelheiten festlegende Vorschriften vorzugeben und damit jede Bewegungsfreiheit und Kreativität der Fachleute einzuengen. Damit macht er eine unabhängige Lösung des Problems unmöglich.
Kein Wunder, dass die Ergebnisse ziemlich gleich sind und den Wünschen des Königs entsprechen. Bürkleins Vorschläge finden volles Lob und Anerkennung, weshalb er den Sieg davonträgt.
Um das Projekt zu beschleunigen und die Verhandlungen über die Grundstückskäufe in Gang zu bringen, stellt König Max II. den notwendigen Betrag zunächst aus seiner Privatkasse zur Verfügung, sodass die ersten Verhandlungen über die Grundstückskäufe aufgenommen werden können. Die Ankäufe gehen rasch und reibungslos vor sich. Auch deshalb, weil sich der König - entgegen seiner sonst üblichen Sparsamkeit - sehr großzügig zeigt. Er will eben den Bau seines „Prachtboulevards“ möglichst schnell umgesetzt sehen.
Freilich möchte der Bayernherrscher auch, dass auch die Stadt zur finanziellen Beteiligung herangezogen wird, da sie ja immerhin der Hauptnutznießer des Bauvorhabens ist. Bei der künstlerischen Ausgestaltung der „Prachtstraße“ soll die Obrigkeit der Stadtgemeinde allerdings keinerlei Mitspracherechte haben. Nur die Herstellung des Straßenkörpers will ihr der Regent überlassen.
25. 9 1852 - Johann Valentin Fey beginnt beim Auer Tapezierer Karl Falk zu arbeiten
Vorstadt Au * Johann Valentin Fey beginnt beim Auer Tapezierer Karl Falk in der Entenbachstraße 63 zu arbeiten.
Um 10 1852 - Die „Quadriga“ wird auf das „Siegestor“ gehievt
München-Maxvorstadt - Schwabing * Die von Ferdinand von Miller gegossene „Quadriga“, eine 6 Meter hohe Bavaria, die einen von vier Löwen gezogenen Wagen lenkt, wird auf das „Siegestor“ gehievt.
16. 10 1852 - Nach dem Aufsetzen der Quadriga wird das Siegestor feierlich eröffnet
München-Maxvorstadt - Schwabing * Nach dem Aufsetzen der Quadriga wird das Siegestor feierlich eröffnet.
21. 11 1852 - Frankreich für die Wiedereinführung des Kaisertums
Frankreich * Das französische Volk stimmt über ein vom Staatspräsidenten Charles Louis Napoleon Bonaparte vorgelegtes Plebiszit [= eine von oben angesetzte Volksbefragung] über die Wiedereinführung des Kaisertums ab.
2. 12 1852 - Napoleon III. lässt sich zum Kaiser der Franzosen ausrufen
Paris * Frankreichs Staatspräsident Charles Louis Napoleon Bonaparte lässt sich zum Kaiser der Franzosen ausrufen. Das war am ersten Jahrestag des Staatsstreichs und am selben Tag, als sich sein Onkel Napoleon Bonaparte im Jahr 1804 selbst zum erblichen Kaiser von Frankreich krönte.
Das bedeutet zusätzlich das Ende der im Jahr 1848 ausgerufenen Zweiten Republik und den Beginn des Zweiten Kaiserreichs. Fortan nennt er sich Napoleon III..
11. 12 1852 - König Max II. will die revolutionären Errungenschaften zurückdrehen
München * König Max II. schreibt an seinen Innenminister: „Ich will die gegenwärtige ruhige Zeit nicht ungenützt vorübergehen lassen, um [...] die Regierung der lähmenden und auf geradezu antimonarchische Grundlagen gebauten Gesetze zu entledigen, welche das Jahr 1848 förmlich oktoyiert hat.“
25. 12 1852 - Bayernkönig Max II. will eine neue Prachtstraße bauen lassen
München-Graggenau - München-Lehel * Der Bayernkönig Max II. teilt dem Ersten Bürgermeister der Stadt München, Dr. Jakob von Bauer, mit, er hat vor, „die Stadt mit der Sankt-Anna-Vorstadt mittels einer schönen Straße zu verbinden und hierdurch einem vielseitig gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen.
Die Vorbereitungen sind so weit gediehen, daß Ich Ihnen, Herr Bürgermeister, den Plan anbei mitteilen kann, damit Sie Mir berichten, ob sich die Überbrückung und Auffüllung der Kanäle und die Herstellung des Straßenkörpers aus städtischen Mitteln ins Werk setzen läßt, indem Ich in diesem Falle durch schenkungsweise Überlassung des auf Meine Kosten erworbenen Straßengrundes das Vorhaben zu verwirklichen gedenke.“
Bürgermeister Dr. Bauer setzt sich in der Folge vor dem Magistrat für den Bau der Straße ein, da mit ihr die kurz vor der Eingemeindung stehenden Orte des Ostends (Haidhausen, Au, Giesing) wesentlich besser erschlossen werden können.
Er räumt aber auch ein, dass der auf die Stadt zukommende Aufwand in Höhe von 260.000 Gulden nur dann zu finanzieren sei, wenn der König der Erhöhung des Pflasterzolls, der Weinsteuer oder des Malzzuschlags, einer Art Biersteuer, die der Stadt bis zum Jahr 1899 zu garantieren sei, zustimmen würde.
30. 12 1852 - Lola Montez erreicht mit ihrer Schauspieltruppe New Orleans
New Orleans * Lola Montez erreicht mit ihrer Schauspieltruppe das im Mississippi-Delta gelegene New Orleans.
1853 - Der „Baierwein“ wird auf einer Fläche von 180 Hektar angebaut
Niederbayern-Oberpfalz * Der „Baierwein“ wird auf einer Fläche von 180 Hektar angebaut.
1853 - Das „Gronimus-Anwesen“ in Haidhausen wird verkauft
Haidhausen * Das „Gronimus-Anwesen“ in Haidhausen kommt in den Besitz des Brauersohnes Georg Fenk aus Vilsbiburg.
Er verkauft den gesamten Grundbesitz in Einzelteilen.
Das Anwesen - ohne Ackerland - kauft der Haidhauser „Großwirt“ Franz Paul Wagner.
1853 - Das „Kloster der Frauen vom guten Hirten“ in Haidhausen
Haidhausen * Im „Kloster der Frauen vom guten Hirten“ in Haidhausen gibt es 25 „Chorschwestern“, 25 „Laienschwestern“ und 4 „Pförtnerinnen“.
1853 - Die „Singlspielerbrauerei“ geht als Aussteuer an den Brauer Mathias Wild
München-Angerviertel - Vorstadt-Au * Über Brathmanns Tochter Katharina gingt die „Singlspielerbrauerei“ als Aussteuer in die Ehe mit dem Grünwalder Wirtssohn und Brauer Mathias Wild ein.
Der neue „Bräu“ vervierfacht die Leistung des Betriebs innerhalb kürzester Zeit. Im Jahr 1853 erreicht er mit 3.481 versottenen Schäffel Malz seine Höchstleistung.
1853 - Die „Kohleninsel“ erhält ihren Namen
München-Isarvorstadt - Museumsinsel - München-Lehel * Die Insel zwischen den beiden Isarbrücken wird „Kohleninsel“ genannt.
1853 - Die „Ruhmeshalle“ auf der „Theresienhöhe“ wird eingeweiht
München-Theresienhöhe * Die „Ruhmeshalle“ hinter der „Bavaria“ auf der „Theresienhöhe“ wird eingeweiht.
1853 - Pepita de Olivia löst einen wahren „Pepita-Rummel“ aus
Deutschland * Die junge spanische Tänzerin Pepita de Olivia löst nach einigen Gastauftritten in Deutschland einen wahren „Pepita-Rummel“ aus.
1853 - „Aktiengesellschaft für die Dampfschiffahrt auf Inn und Donau“
München * Joseph Anton von Maffei übernimmt den Vorsitz der „Aktiengesellschaft für die Dampfschiffahrt auf Inn und Donau“.
1853 - Die Lokomotive „Die Pfalz“ erreicht bereits 120 km/h
München-Hirschau * Die im „Maffei-Werk Hirschau“ gebaute Lokomotive „Die Pfalz“ für die „Bayerische Pfalzbahn“ erreicht bereits 120 km/h.
1853 - Simon von Eichthal macht die „Giesinger Mühle“ zur „Kunstmühle“
Untergiesing * Simon von Eichthal erhält die Konzession zur Umwandlung der „Giesinger Mühle“ in eine „Kunstmühle“.
Als solche bezeichnet man in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen technisch voll automatisierten Mühlenbetrieb, bei dem der Transport des Getreides zu den „Reinigungsmaschinen“, den „Schälmaschinen“ und den „Spitzgängen“, von diesen zu den „Mahlgängen“, „Sortiermaschinen“ usw. durch mechanische Vorrichtungen in Gang gehalten wird und sämtliche Arbeiten vollautomatisch ablaufen.
1853 - König Max II. nimmt Friedrich Bürklein auf seine Romreise mit
München - Rom * König Max II. nimmt Friedrich Bürklein auf seine Romreise mit.
1853 - Eine Eisenbahnstrecke zum Starnberger See
München - Starnberg * Der weitere Ausbau des Eisenbahn-Streckennetzes wird angegangen.
Ulrich Himbsel, der ehemalige „Baudirektor der München-Augsburger-Eisenbahngesellschaft“, beginnt, trotz der anfänglich auftretenden Probleme mit der Finanzierung, mit dem Streckenbau zu dem „an Naturschönheiten so reichen Starnberger See“.
Die Linie zweigt hinter Pasing nach Süden ab und erfreut sich beim „gebirgssinnigen Münchner Publikum“ bald großer Beliebtheit.
1853 - Die Erweiterung der „Anna-Kirche“ ist vollendet
München-Lehel * Die Erweiterung der „Anna-Kirche“ ist vollendet, doch der expansive Bevölkerungszuwachs in der „Anna-Vorstadt“ macht einen Kirchenneubau unbedingt notwendig.
Dieser soll aber erst knapp fünfzig Jahre später in Form der „St.-Anna-Basilika“ entstehen.
In der Zwischenzeit müssen die „Lechler“ mit der maximal 700 Gläubigen Platz bietenden ehemaligen Klosterkirche vorlieb nehmen.
2 1853 - Lola Montez tritt in Cincinnati/Ohio auf
Cincinnati * Lola Montez tritt in Cincinnati/Ohio auf.
3 1853 - Der „Ziegelstadel Kirchstein“ wird gegründet
Haidhausen * Dem Haidhauser „Kirchenbau-Ausschuss“ wird die „Errichtung einer Ziegelei“ genehmigt.
Der „Ziegelstadel“ erhält den Namen „Kirchstein“.
11. 3 1853 - Anton Feldmüller stirbt in Kirchensur bei Amerang
Amerang * Anton Feldmüller stirbt in Kirchensur bei Amerang. Seine Ehefrau Theres tritt das Erbe an.
Um den 4 1853 - Meiller kauft die „Waffenschmied-Gerechtsame“ des Georg Buchwieser
Vorstadt Au * Lorenz Meiller kann der Witwe des Georg Buchwieser um 2.450 Gulden die „Waffenschmied-Gerechtsame“ abkaufen.
Nun stellt das Unternehmen zunächst Bauwerkzeuge wie Pickel, Schaufeln, Hauen und Hacken her.
1. 4 1853 - Theres Feldmüller pachtet ein Wirtshaus in Eggenfelden
Eggenfelden * Theres Feldmüller pachtet - gemeinsam mit ihrem Vetter Franz-Xaver Huber, Gastwirtssohn aus Zolling bei Freising, - die Wirtschaft beim „Freiherrlich von Closen‘schen“ Bräu- und Wirtsanwesen zu Eggenfelden und betreibt diese bis zum 1. Mai 1855.
1. 5 1853 - Lola Montez reist mit dem Schiff „Philadelphia“ nach Panama City
Cincinnati - Panama City * Lola Montez, die „pikante Abenteuerin“, reist mit dem Schiff „Philadelphia“ in Richtung Panama City ab.
5. 5 1853 - Lola Montez reist weiter nach San Francisco
Panama City - San Francisco * Lola Montez besteigt den Raddampfer „Northener“, um mit ihm nach San Francisco zu reisen.
21. 5 1853 - Ein Triumphzug für Lola Montez in San Francisco
San Francisco * Lola Montez trifft in der Bucht von San Francisco ein. „Die Stadt hatte geflaggt, zahlreiche Musikkapellen marschierten durch die Straßen, Kinder streuten Blumen, Salutschüsse wurden abgefeuert.“ Ein Triumphzug für Lola Montez.
12. 7 1853 - Lola Montez heiratet Patrick Hull
San Francisco * Lola Montez heiratet Patrick Hull, den Miteigentümer der Zeitschrift „San Francisco Whig“. Er ist irischer Abstammung. Die Ehe wird bereits im November wieder geschieden.
18. 7 1853 - Beginn der Bauarbeiten an der Maximilianstraße
München-Graggenau - München-Lehel * Nachdem das königliche Einverständnis zur Erhöhung des Pflasterzolls, der Weinsteuer und des Malzzuschlags vorliegt, beginnt die Stadt, unter Leitung des noch jungen Bauingenieurs beim Stadtbauamt, Arnold Zenetti, mit den Straßenbauarbeiten zur Maximilianstraße.
Die gewünschte Auffüllung der Bäche wird abgelehnt, da dies den wirtschaftlichen Ruin für den Münchner Osten bedeuten würde. Deshalb werden später viele Kellergeschosse aus den massiv gemauerten Bacheinfassungen hergestellt.
24. 7 1853 - Ein Sicherheitsbericht für München
München * Oberst Franz Freiherr von Hörmann zu Hörbach legt einen Sicherheitsbericht für München vor. Er trägt den Titel: „Erläuterungen zum Entwurfe der militärischen Dispositionen für die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit der Haupt- und Residenzstadt München behufs Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung.“ Es ist die Angst vor einer neuen Revolution, die König Max II. seine Armee auf einen Bürgerkrieg vorbereiten lässt. Um verbindliche Vorschläge auszuarbeiten, gründet er eine Special-Commissorium.
Inhaltlich geht Oberst Hörmann von einem Bedrohungsszenario aus, wonach „der inländische Pöbel - durch auswärtiges Proletariat verstärkt - bei Tag und Nacht ohne Hindernis in die Stadt eindringen kann, theils um die größten Schätze des Staates und des Landes zu plündern, theils um die heillosen Umtriebe der machtlosen Umsturzpartei in Vollzug zu setzen“. Freiherr von Hörmann fügt noch eine interessante Einteilung der Tumulte in vier Klassen bei.
- Als Erste und harmloseste Klasse bezeichnete er darin „Tumulte ohne insurreaktionäre politische Tendenz“, etwa die Studenten- und Handwerkertumulte oder die Münchner Bierkrawalle.
- Als nächste Kategorie folgen „Politische Tumulte durch demokratische Umtriebe der republikanisch gesinnten Umsturzpartei veranlaßt“. Als Beispiel führt er die Märzrevolution von 1848 an.
- Als dritte Klasse bezeichnet er „Tumulte mit kommunistischer Tendenz“. Der erzkonservative Oberst verschließt dabei aber keineswegs die Augen vor der bitteren Armut vieler Zeitgenossen und fordert zur Vorbeugung eine effektive staatliche Sozialpolitik.
- Die Letzte und zugleich gefährlichste Form der Unruhe klassifiziert der Militarist die „Tumulte durch Theuerung, Mißwachs und Hungersnoth veranlaßt“.
Sein konkreter Vorschlag beinhaltet die Erhöhung der Zahl der Kasernen in der Innenstadt und weitere flankierende Maßnahmen, um die Hauptverteidigungspunkte zu schützen. Dazu zählen unter anderem - neben der Residenz - das Nationaltheater, das Postgebäude, die Münze und der Alte Hof.
8 1853 - Lola Montez lässt sich in der „Goldgräbersiedlung“ Grass Valley nieder
Grass Valley * Lola Montez lässt sich in der „Goldgräbersiedlung“ Grass Valley nieder und kauft sich dort ein Haus.
16. 8 1853 - Kaisers Franz Joseph I. und seine Cousine Elisabeth „Sisi“
Bad Ischl * In Bad Ischl soll die Verlobung des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. mit der 19-jährigen Herzogin Helene in Bayern gefeiert werden. Doch es kommt anders. Dem 23-jährigen Regenten gefällt seine drei Jahre jüngere Cousine Elisabeth „Sisi“ ganz einfach viel besser.
18. 8 1853 - Kaiser Franz Joseph I. und Herzogin Elisabeth „Sisi“ verloben sich
Wien - München * An seinem 23. Geburtstag hält der österreichisch-ungarische Kaiser Franz Joseph I. um die Hand seiner Cousine Herzogin Elisabeth „Sisi“ in Bayern an. In der Überzeugung „einem Kaiser von Österreich gibt man keinen Korb“ stimmt das herzogliche Haus der Verlobung zu. Herzog Max in Bayern und die kaiserliche Administration einigen sich auf eine Mitgift in Höhe von 50.000 Gulden, dazu Kleider und Schmuck.
28. 11 1853 - König Max II. stiftet den Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst
München * An seinem 43. Geburtstag stiftet König Max II. den Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst. Der Bayernregent beruft bedeutende Gelehrte nach München, die von der Bevölkerung als „Nordlichter“ tituliert werden. Er will so die Hofgesellschaft mit den geistigen Koryphäen beleben.
Da diese Elite aber häufig nicht-adelig ist, erhalten sie keinen Zutritt zum Königlichen Hof. Mit der Verleihung des Maximiliansordens erwirbt man die dritte Rangklasse und damit den Hofzutritt.
1854 - „Die demokratisierende Macht des Bieres“
München * Paul Heyse schreibt: „Die demokratisierende Macht des Bieres hatte doch eine Annäherung bewirkt.
Der geringste Arbeiter war sich bewusst, dass der hochgeborene Fürst und Graf keinen besseren Trunk sich verschaffen konnte als er; die Gleichheit vor dem Nationalgetränk milderte den Druck der sozialen Gegensätze.
Und wenn im Frühling noch der Bock hinzukam, konnte man in manchen Wirtsgärten eine so gemischte Gesellschaft zwanglos beisammen finden, wie sie in Berlin nirgends anzutreffen war“.
1854 - Adolf Friedrich von Schack nach München berufen
München * Adolf Friedrich von Schack, ein sogenanntes „Nordlicht“, folgt dem Ruf König Max II. von Bayern und nimmt seinen Wohnsitz in München.
1854 - Die „Pschorr-Brauerei“ stellt ihren Betrieb auf „Dampfkraft“ um
München-Ludwigsvorstadt * Die „Pschorr-Brauerei“ stellt ihren Betrieb auf „Dampfkraft“ um.
1854 - Die „Giesinger Lederfabrik“ spezialisiert sich auf feines, lackiertes Leder
München-Untergiesing * Die „Untergiesinger Lederfabrik“ spezialisiert sich auf feines, lackiertes Leder, das für die Innenausstattung von Kutschen, später von Automobilen und für die Schuh- und Bekleidungsindustrie benötigt wird.
Die Giesinger Lederfabrik produziert nicht nur für den deutschen Markt, sondern exportiert ihre auf verschiedenen Weltausstellungen prämierten Produkte in fast alle Länder der Welt. Zumindestens dort hin, wo es die Zollbestimmungen ermöglichen.
1854 - Die Geländearbeiten für die Maximilianstraße sind abgeschlossen
München-Graggenau - München-Lehel * Die vorbereitenden Geländearbeiten für die Maximilianstraße sind abgeschlossen.
„Bauingenieur“ Arnold Zenetti baut in der ungleichförmigen Talsohle einen festen ebenen Damm auf.
Dazu muss an manchen Stellen das Gelände abgetragen, viel öfter aber aufgeschüttet werden. Sehr gut erkennt man die Höhenunterschiede am Marstallplatz, an der Wurzerstraße und am Kosttor.
Außerdem müssen mehrere alte Gebäude dem Erdboden gleichgemacht werden.
1854 - König Max II. verzettelt sich
München * Bis das „Preisgericht“ zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten erstmals zusammenkommt, vergehen nochmal eineinhalb Jahre. Diese erneute Verzögerung liegt ausschließlich in der Person des Königs begründet, weil dieser sich zunächst mit jedem einzelnen Entwurf selbst beschäftigt. Doch bei den anstehenden Staatsaufgaben und sonstigen Neigungen findet er für diese Tätigkeit nur gelegentlich Zeit und Muße.
Seine Einschätzung gibt er nicht preis, um dem „Schiedsspruch“ der Fachleute nicht vorzugreifen. Das ist zunächst eine weise Entscheidung, die jedoch sofort wieder relativiert wird, da ja die letzte Entscheidung doch wieder beim König liegt.
Das Protokoll der Sitzung des „Preisgerichts“ ist verschollen. Es ist nur bekannt, dass der Berliner „Oberbaurat“ Wilhelm Stier den ersten Preis in Höhe von 4.000 Gulden zuerkannt bekommt und dass ein zweiter und ein dritter Preis nicht vergeben wird. Es ist aber auch klar, dass die Planungen Wilhelm Stiers - „der ungeheueren Kosten wegen“ - nicht zur Ausführung kommen werden. Die übrigen Konkurrenzentwürfe verschwinden in der Versenkung.
Friedrich Bürklein wird - vollkommen unabhängig vom Konkurrenzergebnis - mit der Ausführung der Pläne für das „Maximilianeum“ und der Ausführung des umfangreichen Bauprogramms beauftragt. Über das „Preisgericht“ und die eingelaufenen Bewerbungen legt man den Mantel des Schweigens.
1854 - Die Eisenbahn wird bis zum „Königreich Württemberg“ weitergebaut
München - Augsburg - Württemberg * Die Eisenbahnstrecke München - Augsburg wird bis an die Grenze zum „Königreich Württemberg“ weitergebaut.
1854 - König Max II. lässt auf der Residenz einen „Wintergarten“ errichten
München-Graggenau * König Max II. lässt im ersten Obergeschoss zwischen dem „Königsbau“ der „Residenz“, dem „Cuvilliés-Theater“ und dem „Nationaltheater“ einen „Wintergarten“ errichten.
13. 1 1854 - Leonhard Romeis wird in Höchstadt an der Aisch geboren
Höchstadt an der Aisch * Leonhard Romeis, der spätere Haupt-Architekt der Richard-Wagner-Straße, wird in Höchstadt an der Aisch geboren.
2 1854 - Franz Lenbach kommt zum studieren nach München
München * Franz Lenbach kommt nach München und beginnt dort sein Studium in der „Zeichenklasse“ von Professor Hiltensperger an der „Akademie der Bildenden Künste“.
31. 3 1854 - Joseph Schülein kommt in Thalmässing zur Welt
<p><strong><em>Thalmässing</em></strong> * Joseph Schülein kommt in Thalmässing, einer Gemeinde in der Nähe von Roth bei Nürnberg, zur Welt. In diesem Ort leben traditionell zahlreiche jüdische Vieh-, Geld- und Hopfenhändler.</p>
6. 4 1854 - Grundsteinlegung für die Propyläen am Königsplatz
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Sechs Jahre nach der Abdankung König Ludwigs I. findet die Grundsteinlegung für die Propyläen am Königsplatz statt.</p>
20. 4 1854 - Herzogin Elisabeth „Sisi“ in Bayern verlässt München
<p><strong><em>München - Straubing</em></strong> * Herzogin Elisabeth <em>„Sisi“</em> in Bayern verlässt München in Richtung Straubing. Dort besteigt sie den Raddampfer <em>„Franz Joseph“</em>, der sie nach Wien-Nußdorf bringt. </p>
24. 4 1854 - Kaiser Franz Joseph und Herzogin Elisabeth „Sisi“ heiraten in Wien
Wien * Der 23-jährige österreichische Kaiser Franz Joseph heiratet in Wien die 16-jährige Herzogin Elisabeth „Sisi“ in Bayern.
5 1854 - Die letzte Hinrichtung mit dem „Handschwert“
München-Angerviertel * Der „Scharfrichter“ Lorenz Schellerer vollzieht auf dem „Heumarkt“, dem heutigen „Rindermarkt“, die letzte Hinrichtung mit dem „Handschwert“.
Die sich heftig wehrende „Gattenmörderin“ kann den Schlägen des Henkers mehrmals ausweichen. Er braucht sieben Hiebe, „bis sich ihr Kopf vom Rumpfe trennt“.
Die Menschenmenge ist aufgebracht und muss mit Gewalt zurückgedrängt werden.
Lorenz Schellerer bedient danach die ausschließlich zum Einsatz kommende „Guillotine“.
17. 5 1854 - Die Eingemeindung von Au, Haidhausen und Giesing ist genehmigt
Vorstadt Au - Giesing - Haidhausen * Fünf Jahre dauern die Überlegungen des Kgl. Bay. Staatsministeriums des Inneren, bis die 25 Paragraphen zur Eingemeindung ausgearbeitet sind. Nun ist die Vereinigung Münchens mit der Au, Haidhausen und Giesing genehmigt.
„Seine Majestät der König haben die nachgesuchte Vereinigung der Gemeinde Au, Giesing und Haidhausen mit der Reichshaupt- und Residenzstadt München in Eine Gemeinde unter Erhebung jener drei Gemeinden zu Vorstädten von München [...] allergnädigst zu genehmigen geruht.“
24. 6 1854 - Die Bahnstrecke ist bis „nach dem Belustigungsorte Hesselohe“ fertig
Großhesselohe * Der 10,7 Kilometer lange Streckenabschnitt der Bahnverbindung von München über Rosenheim nach Salzburg ist bis „nach dem Belustigungsorte Hesselohe“ fertiggestellt.
15. 7 1854 - Im Glaspalast wird die Industrie-Ausstellung von König Max II. eröffnet
München-Maxvorstadt * Die im Glaspalast stattfindende Industrie-Ausstellung wird von König Max II. feierlich eröffnet.
Nur wenige Tage später bricht die Cholera aus. Bei der Eröffnungsrede bricht ein Billeteur tot zusammen. Man glaubt an einen Schlaganfall, doch vermutlich handelt es sich um das erste Opfer der Cholera.
16. 7 1854 - Die Arbeitsbedingungen für Kinder in Fabriken wird verbessert
<p><em><strong>München - Königreich Bayern</strong></em> * Die <em>„Königlich Allerhöchste Verordnung, die sanitäts- und sittenpolizeiliche Fürsorge für jugendliche Arbeiter in den Fabriken betreffend“</em> wird erlassen. Diese zweite bayerische Kinderschutzverordnung erhöht immerhin </p> <ul> <li>das Mindestalter von Fabrikarbeitern auf zehn Jahre, </li> <li>gleichzeitig senkt sie die zulässige Höchstarbeitszeit von Kindern auf neun Stunden pro Tag. </li> <li>Nachtarbeit von schulpflichtigen Kindern ist nun ausdrücklich und uneingeschränkt verboten. </li> <li>Der den Kindern während der Arbeitszeit zu erteilende Schulunterricht wird auf drei Stunden am Tag erhöht. </li> </ul> <p>Die Verordnung erweitert somit den Kinderschutz in Bayern, bleibt aber erneut hinter den Bestimmungen eines ein Jahr zuvor in Preußen erlassenen Gesetzes zurück. </p>
18. 7 1854 - Ein neuer Fall von Cholera
München-Graggenau * Ein Theaterbesucher aus der Schweiz bricht während der Vorstellung zusammen und wird in die Klinik gebracht. Vermutlich ist auch er bereits vom Cholera-Erreger angesteckt.
27. 7 1854 - Das erste amtliche Opfer der Cholera-Epidemie
München * Der 39-jährige Tagelöhner Peter Stopfer ist das erste amtliche Opfer der Cholera-Epidemie.
29. 7 1854 - Der 39-jährige Tagelöhner Peter Stopfer stirbt an der Cholera
München * Der 39-jährige Tagelöhner Peter Stopfer stirbt. Mit ihm beginnt offiziell die Statistik der Cholera-Todesopfer.
2. 8 1854 - Ein Komitee kämpft gegen die epidemische Brechruhr
München * Das Bayerische Innenministerium beruft ein Komitee zur Beschließung von Maßnahmen gegen die epidemische Brechruhr, das sich bis Mitte Oktober wöchentlich zwei Mal treffen wird.
Beim ersten Zusammentreffen muss man seit dem 29. Juli weitere 22 Brechdurchfall-Erkrankungen zur Kenntnis nehmen, von denen zwölf mit dem Tod endeten. Aufgrund der Arztberichte bestätigt sich das Vorhandensein der Cholera.
Eine vorsichtige Information der Bevölkerung in der halbamtlichen Neuen Münchner Zeitung wird beauftragt. Mit den Warnungen vor bestimmten Lebensmitteln hofft das „Komitee“ auf keine weitere Verbreitung der Krankheit.
3. 8 1854 - Die Überladung des Magens mit Kartoffeln, Gurken und dergleichen
München * In der halbamtlichen Neuen Münchner Zeitung wird mitgeteilt, dass „in Folge der außergewöhnlichen, rasch eingetretenen Hitze, Durchfälle vorgekommen“ und dass „daran namentlich einige kleine Kinder, alte und kränkliche Personen gestorben“ sind. Als Ursache wird „die Überladung des Magens mit Kartoffeln, Gurken und dergleichen“ angegeben.
Die Cholera erreicht auch die Vorstädte Au, Haidhausen und Giesing. Bis zu deren Eingemeindung am 1. Oktober werden die Sterbestatistiken getrennt geführt.
5. 8 1854 - Maßnahmenkatalog gegen die epidemische Brechruhr
München - Vorstadt Au - Giesing - Haidhausen * Die Cholera-Erkrankungs- und Todesfälle haben weiter zugenommen, weshalb das „Komitee zur Beschließung von Maßnahmen gegen die epidemische Brechruhr“ einen Maßnahmenkatalog in Angriff nimmt.
Ärztliche Besuchsanstalten werden eingerichtet und dabei das Stadtgebiet und die Vorstädte Au, Haidhausen und Giesing in 13, später 15 Distrikte eingeteilt.
5. 8 1854 - Abschaffung des mittelalterlichen Richtschwerts
München * König Max II. verfügt die Abschaffung des mittelalterlichen Richtschwerts. Die Todesstrafe wird künftig ausschließlich mit der Guillotine vollstreckt.
Die bayerische Guillotine ist im Gegensatz zu dem aus Holz hergestellten französischen Original aus Eisen. Das Fallbeil braucht deshalb nur eine Fallhöhe von 1,50 Metern, statt den 5 Metern der Original-Guillotine.
6. 8 1854 - Die Cholera wird kleingeredet
München * Der Bayerische Landbote dementiert die über Mundpropaganda verbreitete Nachricht, „dass die Cholera wieder herrsche“.
7. 8 1854 - 44 Todesfälle seit Ausbruch der Cholera
München * Seit Ausbruch der Cholera sind alleine auf Münchner Stadtgebiet 44 Todesfälle aufgetreten.
8. 8 1854 - Erstmals die Gefahr einer Cholera-Epidemie zugegeben
München * In der Neuen Münchner Zeitung wird erstmals zugegeben, dass die Gefahr einer Cholera-Epidemie besteht.
13. 8 1854 - Die Zahl der Cholera-Toten ist auf 208 angestiegen
München * Die Ärztlichen Besuchsanstalten nehmen ihre Tätigkeit auf. Die Zahl der durch die Cholera verursachten Todesopfer ist auf 208 angestiegen.
20. 8 1854 - Ludwig Joseph Graf von Arco stirbt in München
München * Ludwig Joseph Graf von Arco, der Ehemann der Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine, stirbt in München.
Bis 22. 8 1854 - 138 Cholera-Tote in der Au, Haidhausen und Giesing
Vorstadt Au - Giesing - Haidhausen * In den Vorstädten Au, Haidhausen und Giesing zählt man insgesamt 138 Cholera-Tote.
23. 8 1854 - Der Epidemie-Höhepunkt ist in München erreicht
München * Der Epidemie-Höhepunkt ist in München erreicht. An diesem Tag sterben 82 Personen an der Cholera und erhöhen damit die Gesamtsterbezahl auf 803.
28. 8 1854 - Simon von Eichthal stirbt in Ebersberg
Ebersberg * Simon von Eichthal, der Mitbegründer der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, stirbt in Ebersberg.
30. 8 1854 - Der Epidemie-Höhepunkt ist in den Vorstädten erreicht
Vorstadt Au - Giesing - Haidhausen * Der Epidemie-Höhepunkt ist in den Vorstädten Au, Haidhausen und Giesing erreicht. An diesem Tag sterben 34 Personen an der Cholera und erhöhen damit die Gesamtsterbezahl auf insgesamt 355.
9 1854 - Wegen der „Cholera“ wird das „Oktoberfest“ abgesagt
München-Theresienwiese - München-Au - München-Maxvorstadt * Wegen der grassierenden „Cholera“ sagt die Regierung das „Oktoberfest“ ab, was zu zahllosen Klagen der Geschäftsleute führt.
Als auch noch die „Auer Herbstdult“ storniert werden soll, bitten die Geschäftsleute, „dem ohnedieß diesem Sommer schwerheimgesuchten Gewerbestand“ nicht auch noch dieses „Bißchen Brot“ zu entziehen.
Weder zur „Auer Herbstdult“ noch zu der seit 15. Juli stattfindenden „Industrie-Ausstellung“ im „Glaspalast“ finden sich viele Interessenten ein.
2. 9 1854 - 107 Cholera-Tote im Münchner Ostend alleine an diesem Tag
Vorstadt Au - Giesing - Haidhausen * Die Cholera-Sterbezahl in München und den Vorstädten Au, Haidhausen und Giesing beträgt an diesem Tag insgesamt 107.
3. 9 1854 - Die Cholera-Sterbefälle nehmen in München deutlich ab
München * Die täglichen Cholera-Sterbefälle nehmen in München deutlich ab. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind 1.468 Münchner verstorben.
9. 9 1854 - Die täglichen Cholera-Sterbefälle gehen deutlich zurück
Vorstadt Au - Giesing - Haidhausen * Die täglichen Cholera-Sterbefälle gehen jetzt auch in den Vorstädten Au, Haidhausen und Giesing deutlich nach unten. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind 564 Personen verstorben.
13. 9 1854 - In München werden die ersten Ärztlichen Besuchsanstalten aufgelöst
München * In München werden die ersten - wegen der Cholera-Epidemie eingerichteten - Ärztlichen Besuchsanstalten aufgelöst.
Ab 23. 9 1854 - Die Armenärzte übernehmen die Behandlung der Cholera-Kranken
München • Die Münchner Armenärzte übernehmen wieder die Behandlung der Cholera-Kranken.
30. 9 1854 - Die Cholera ist in München erloschen
München * Das Komitee zur Beschließung von Maßnahmen gegen die epidemische Brechruhr beschließt, das die Cholera in München erloschen ist. Nur drei Ärzte stimmen dagegen. Alle Ärztlichen Besuchsanstalten werden geschlossen, die Suppenanstalten wieder auf vier reduziert. Die ärztliche Versorgung in den Vorstädten wird eine Woche länger aufrecht erhalten.
2.143 von rund 114.000 Münchner Einwohnern fallen bis dahin der sogenannten Kalten Pest zum Opfer, das sind 1,9 Prozent. In den Vorstädten Au, Haidhausen und Giesing sterben 781 von 21.000 Bewohnern, das ist mit 3,7 Prozent eine fast doppelt so hohe Sterbequote.
Kinder, Frauen und ältere Menschen machen die Mehrzahl der Opfer aus. In München liegt der Anteil der Frauen bei 45,7 Prozent, der der Kinder unter zehn Jahren bei 19,7 %. In den Vorstädten liegt die Sterblichkeit bei den Frauen bei 39,5 und bei den Kindern bei 25,2 Prozent. An der Cholera sterben stets mehr Frauen als Männer. Das liegt daran, dass Frauen immer einer größeren Infektionsgefahr ausgesetzt sind, da sie die Kranken versorgen und die Wäsche waschen. Während der Anteil der über 60-jährigen Opfer in der Stadt München fast 27 Prozent beträgt, sind es in den Vorstädten „nur“ 17,7 Prozent. Das liegt aber an der sowieso wesentlich geringeren Lebenserwartung.
In Haidhausen wird fast kein Haus von der Cholera verschont. Hier liegt die Sterbequote bei 4,8 Prozent. Darunter sind 57 Mütter und 42 Väter, wodurch 102 Kinder einen Elternteil verlieren. Zwanzig Kinder werden zu Vollwaisen.
Von den in der Strafanstalt in der Au einsitzenden 541 Häftlingen sterben 63, gleich 11,6 Prozent.
1. 10 1854 - Au, Giesing und Haidhausen werden nach München eingemeindet
München-Au - München-Haidhausen - München-Giesing * Eingemeindung nach München
- der Vorstadt Au mit den Gemeindeteilen Niedergiesing und Nord-Falkenau,
- die selbstständige Gemeinde Haidhausen und
- die Gemeinde Giesing mit den Gemeindeteilen Obergiesing, Lohe, südliche Falkenau, Pilgersheim, Birkenleiten, Siebenbrunn, Hellabrunn, Harlaching, Soyerhof, Stadelheim und Menterschweige.
Dadurch erhöht sich die Bevölkerungszahl Münchens um 20.662 Einwohner. Davon kommen aus der Au 10.840, aus Haidhausen 6.273 und aus Giesing 3.549 Menschen. Damit wächst zusammen, was zusammen gehört, den die Bewohner der drei Vorstädte gehörten schon immer „funktional“ nach München.
Die Au ist zu diesem Zeitpunkt die zehntgrößte Stadt des Königreichs Bayern. Der Burgfrieden von München, der sich durch Korrekturen seit dem Jahr 1724 von 1.593 Hektar auf rund 1.700 Hektar erweitert hat, verdoppelt sich nahezu. Mit der Au [87 ha], Haidhausen [296 ha] und Giesing [1.287 ha] vergrößert sich das Stadtgebiet um weitere 1.670 Hektar. Wegen der noch grassierenden Cholera-Epidemie erfolgt der Eingemeindungsakt ohne großes Aufsehen.
1. 10 1854 - Das Stadtgericht München wird um einen zusätzlichen Bezirk erweitert
München * Das Stadtgericht München wird um einen zusätzlichen Bezirk erweitert. Es enthält den Namen Stadtgericht rechts der Isar und umfasst die neu eingemeindeten Stadtviertel Au, Giesing und Haidhausen. Zwischen 1854 und 1862 existieren in München also zwei Landgerichte und zwei Stadtgerichte.
1. 10 1854 - Die Innere Birkenau und die Äußere Birkenau
München-Au - München-Untergiesing * Mit der Eingemeindung von Haidhausen, Giesing und der Au unterscheidet man eine Innere Birkenau und eine Äußere Birkenau. Die letztgenannte reicht von der eigentlichen Siedlung bis zur Entenbachstraße.
1. 10 1854 - Die Ramersdorfer Lüften kommen zum Landgericht rechts der Isar
Ramersdorf * Im Zusammenhang mit der Eingemeindung Haidhausens nach München überlegte der Stadtrat ganz konkret, das gesamte Gemeindegebiet von Ramersdorf gleichzeitig in den Münchner Burgfrieden zu integrieren.
Diese Pläne zerschlagen sich zunächst. Dafür wird das Landgericht Au aufgehoben und die Ramersdorfer Lüften gemeinsam mit der Gemeinde Ramersdorf dem Landgericht rechts der Isar zugeteilt.
1. 10 1854 - Das Auer Leihhaus in der Lilienstraße kommt unter städtische Verwaltung
München-Au * Mit der Eingemeindung der Vorstädte Au, Giesing und Haidhausen kommt das Auer Leihhaus in der Lilienstraße 79 unter städtische Verwaltung.
2. 10 1854 - Die Cholera-Epidemie wird offiziell für erloschen erklärt
München * Die Cholera-Epidemie wird in der Neuen Münchener Zeitung offiziell für erloschen erklärt. An die Bevölkerung wird appelliert, auch weiterhin die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, da die Krankheit noch längere Zeit vereinzelt auftreten kann.
3. 10 1854 - Ein Dankgottesdienst für die Abwendung der Cholera
München-Graggenau * Aus Dankbarkeit für die Abwendung der Cholera versammeln sich „zahllos die Andächtigen jeden Standes, Geschlechts und Alters um die im schönsten Blumenschmuck prangende Mariensäule“ am Schrannenplatz. Ein „Verein hiesiger Bürger“ hatte dazu bereits am 29. September eingeladen, „um Gott den Herrn für die Errettung aus dieser großen Drangsal die innigsten Dankgebete darzubringen“.
14. 10 1854 - Letzte Sitzung zum Thema Cholera
München * Das Komitee zur Beschließung von Maßnahmen gegen die epidemische Brechruhr [= Cholera] hält seine letzte Sitzung ab.
26. 10 1854 - Die Königinmutter Therese stirbt an der Cholera
München-Graggenau * Die Königinmutter Therese stirbt an der Cholera. Ihre Grabstätte befindet sich heute in der Basilika Sankt Bonifaz in München.
28. 10 1854 - Bestattung ohne den Ex-König Ludwig I.
München - Darmstadt * Der Ex-König Ludwig I. reist in Begleitung seiner Tochter, der Großherzogin Mathilde von Hessen, und seinem Sohn Adalbert mit dem Eilzug nach Darmstadt. Er will scheinbar bei der Bestattung seiner evangelischen Frau Therese in der Theatinerkirche einen möglichen Eklat ausweichen, wie er sich 1841 bei Königin Caroline ereignet hat.
31. 10 1854 - Die Ex-Königin Therese wird in der Theatinerkirche beigesetzt
München-Kreuzviertel * Die evangelische Ex-Königin Therese wird vorübergehend in der Gruft der Theatinerkirche beigesetzt.
11 1854 - Die „Armen-Industrie-Schule“ wird aufgelöst
München-Au * Mit der Eingemeindung der Au nach München wird die „Armen-Industrie-Schule“ aufgelöst.
In dem frei gewordenen Gebäude an der Gebsattelstraße wird später eine Knabenschule untergebracht.
28. 11 1854 - Adolf Friedrich von Schack wird Mitglied des Maximiliansordens
München * Adolf Friedrich von Schack wird Mitglied des neu gestifteten Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst.
8. 12 1854 - Papst Pius IX. verkündet das dritte Marianische Dogma
Vatikan * Papst Pius IX. verkündet das dritte Marianische Dogma, das besagt: „Maria hat unbefleckt empfangen.“ Es geht darum, dass bereits Maria ohne Erbsünde geboren worden ist.
Damit entscheidet das Oberhaupt der katholischen Kirche einen Jahrhunderte alten theologischen Streit. Doch nicht nur der Inhalt des Dogmas erregt Aufsehen, sondern auch die Tatsache, dass der Papst diese Entscheidung ohne ein Konzil und damit völlig eigenmächtig getroffen hat. Dogmen gelten in der katholischen Kirche als geoffenbarte Glaubenswahrheit und sind deshalb für alle Katholiken verbindliche und unumstößliche Glaubenssätze.
Ignaz von Döllinger und viele deutsche Theologen sind entsetzt über dieses Dogma. Döllinger kann aber weder in der Heiligen Schrift noch in der Überlieferung der alten Kirche etwas auffinden, das diesen Glaubenssatz gerechtfertigten würde. Die Münchner theologische Fakultät rät dem Papst jedenfalls in einem Gutachten von diesem Schritt eindringlich ab. Ignaz von Döllinger hält sich dabei noch zurück.
1855 - Die ersten Gehsteige für Fußgänger werden angelegt
München * Die ersten Gehsteige für Fußgänger werden in München angelegt.
1855 - Schwerreiche Bauern und halbe Existenzen
Berg am Laim * Der Berg am Laimer Pfarrer Anton Joseph Geyer schreibt an die „Königliche Regierung“ über das Spekulantentum:
„Eine kleine Anzahl schwerreicher Bauern steht einer großen Menge halber Existenzen gegenüber“.
1855 - Mathias Wilds Sohn Joseph übernimmt den „Singlspielerbräu“
München-Angerviertel - München-Au * Mathias Wilds Sohn Joseph übernimmt den „Singlspielerbräu“ und passt das Unternehmen den Bedingungen des 19. Jahrhunderts an.
1855 - Das neue „Franziskaner-Bräuhaus“ entsteht an der Hochstraße
München-Au * Da die „Vorstadt Au“ inzwischen nach München eingemeindet ist, entsteht das neue „Franziskaner-Bräuhaus“ auf Münchner Stadtgebiet.
1855 - Die Isaranlagen werden kultiviert
München-Untergiesing - München-Harlaching * Die der Stadt gehörenden Flächen an der Isar zwischen Giesing und Harlaching werden teilweise gerodet, die unzähligen Sümpfe mit Schutt aufgefüllt und die darauf hergestellten Nutzflächen anschließend verpachtet.
1855 - Die Eckbauten des „Bazargebäudes“ werden aufgestockt
München-Maxvorstadt * Der nördliche und der südliche Eckbau des „Bazargebäudes“ wird um ein Stockwerk erhöht.
Zuvor war nur der Mittelbau dreigeschossig.
Bis 4 1855 - Die „Cholera“ kostet in München 3.082 Menschen das Leben
München * Die „Cholera“ tritt in München sporadisch immer wieder auf.
Bis zu ihrem endgültigen Verschwinden kostet sie 3.082 Menschen das Leben.
Nach 5 1855 - Theres Feldmüller verkauft ihr Anwesen in Neuötting
Neuötting * Theres Feldmüller verkauft ihr Anwesen in Neuötting, erwirbt ein Haus in Schwabing und beantragt dort zusammen mit Franz-Xaver Huber die Ansässigmachung und Eheschließung.
Beides wird wegen „schlechten Leumunds“ (Überschuldung und Urkundenfälschung) abgelehnt.
7. 5 1855 - Oskar von Miller wird in der Nymphenburger Straße geboren
München-Maxvorstadt * Oskar von Miller wird in der Nymphenburger Straße geboren.
1. 7 1855 - Die Zeichnungs- und Modellierschule nimmt ihre Tätigkeit auf
München * Unter der Leitung des Malers Hermann Dyck nimmt die kunstvereinseigene Zeichnungs- und Modellierschule ihre Tätigkeit auf. Sie wird als Einrichtung des Kunstgewerbevereins gegründet und von der bayerischen Staatsregierung lediglich mit 1.600 Gulden unterstützt.
20. 7 1855 - Regierung erlaubt einer privaten Bahngesellschaft den Streckenausbau
München * Die jahrelang hohen Belastungen des Staatshaushaltes durch die Bayerische Staatsbahn führen zu einer ständig wachsenden kritischen Stimmung. Deshalb legt der Bayerische Staat nur noch den Gesetzesentwurf zum Bau und Betrieb der Bahnstrecke Lichtenfels - Coburg vor und betrachtet im Anschluss daran seine aktive Beteiligung am Eisenbahnwesen als abgeschlossen. Allerdings verbindet das Staatsbahnnetz zu diesem Zeitpunkt lediglich Oberbayern mit Schwaben sowie Franken und schließt damit die altbaierischen Gebiete Oberpfalz und Niederbayern vollkommen aus.
Die Königliche Eisenbahn-Commission hat aber für die vier wichtigsten Strecken nach Ostbayern bereits Vorbereitungen getroffen, weshalb die Bayerische Staatsregierung den Bau und den Betrieb der Eisenbahnstrecken nach Ostbayern einer privaten Bahngesellschaft erlauben will. Die notwendigen Voraussetzungen werden an diesem Tag mit Allerhöchster Verordnung geschaffen.
12. 8 1855 - Premiere der Wagner-Oper Thannhäuser in München
München-Graggenau * Die Richard-Wagner-Oper Thannhäuser wird im Münchner Hof- und Nationaltheater aufgeführt.
27. 9 1855 - Heinrich Frauendorfer wird in Höll geboren
Höll * Heinrich Frauendorfer wird in Höll geboren.
1856 - Joseph Selmayr sen. ist Bauer auf dem „Hanslmarterhof“
Bogenhausen * Joseph Selmayr sen. ist Bauer auf dem Bogenhausener „Hanslmarterhof“.
1856 - Die „Stadtgerichte“ werden zu „Bezirksgerichte“
München * Das „Stadtgericht München“ und das „Stadtgericht rechts der Isar“ werden in „Bezirksgerichte“ umbenannt.
1856 - Die „Gemeinstraß nach Loretto“ heißt jetzt offiziell „Bergerstraße“
München-Haidhausen * Früher endete die Kirchenstraße bei der alten Haidhauser „Sankt-Johann-Baptist-Kirche“.
Der sich östlich anschließende Feldweg hatte den amtlichen Namen „auf dem Laimb“. Umgangssprachlich hieß er „Loretto-Steig“ oder „Gemeinstraß nach Loretto“.
Nun heißt die Straße offiziell „Bergerstraße“.
1856 - Der Berliner Baumeister Friedrich Hoffmann erfindet den Ringofen
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Der Berliner Baumeister Friedrich Hoffmann erfindet den Ringofen. Damit kann die Ziegelherstellung wesentlich kostengünstiger und energiesparender erfolgen.</p>
1856 - Die Standorte der Bezirks- und Landgerichte
München-Kreuzviertel - München-Au - München-Haidhausen * Das „Bezirksgericht links der Isar“ residiert in der Weitegasse, der heutigen Ettstraße.
Der Sitz des „Bezirksgerichts rechts der Isar“ befindet sich in der Ohlmüllerstraße 8 am Mariahilfplatz.
Der Amtssitz des „Landgerichts links der Isar“ ist auf dem „Lilienberg“, der des „Landgerichts rechts der Isar“ in der Kirchenstraße 6.
1856 - Die „Schweiger-Theater“ als lästige Konkurrenz des „Hoftheaters“
München-Au - München-Isarvorstadt * Wegen des großen Erfolgs der „Schweiger-Theater“ bei allen Bevölkerungsgruppen bittet „Hoftheaterintendant“ Franz Dinglstedt das „Innenministerium“, das „Interesse seines Hoftheaters“ gegen die lästige Konkurrenz aus der Vorstadt zu schützen.
So kommt es zum „Aufführungsverbot klassischer Dramen“.
1856 - Ex-König Ludwig I. bestimmt die „Sankt-Bonifaz-Kirche“ zur „Grabkirche
München-Maxvorstadt * Der Ex-König Ludwig I. bestimmt die „Sankt-Bonifaz-Kirche“ zur „Grabkirche“.
Ab 1856 - Das Forum bekommt vier Bronzedenkmäler
München-Lehel * Als einziger plastischer Schmuck verbleiben auf dem „Forum“ die vier - von 1856 bis zum Jahr 1868 aufgestellten - Bronzedenkmäler vor dem „Regierungsgebäude“ und dem (alten) „Nationalmuseum“:
- des „Armeeführers“ Deroy,
- des „Philanthropen“ Graf Rumford,
- des „Optikers“ Fraunhofer und
- des „Philosophen“ Schelling.
Die ursprünglich geplanten vier Fontänen werden zunächst auf zwei verringert und fallen dann den weiteren Planungen ganz zum Opfer.
1856 - Das „Café Probst“ entsteht auf dem Areal des Gasthofs „Zum Oberpollinger“
München-Kreuzviertel * Das „Café Probst“ gilt als erstes Münchner „Prachtcafé“.
Es entsteht auf dem Areal des Gasthofs „Zum Oberpollinger“.
3. 1 1856 - Café Probst - Münchens erstes großes Kaffeehaus
München-Kreuzviertel * Das unbestreitbar erste große Kaffeehaus Münchens mit einer aufwändigen Ausstattung ist das Café Probst an der Neuhauser Straße. Es befindet sich von 1856 bis 1903 an der Stelle des heutigen Kaufhauses Oberpollinger. Zur Eröffnung vermerkt der Münchner Stadtchronist: „[...] viel bewundert wurden [...] die Schnitzereien des Buffetts und die Oelgemälde im Billardsaale, die Szenen aus dem Caféhaus-Leben darstellten.“
Gewölbte und glasgedeckte Raumkompartimente, getrennt durch Säulen und Karyatiden, wechseln sich ab; Stuckornamente überziehen die Wände. König Ludwig I. soll bei der Besichtigung geäußert haben: „Was, was! Stuck! So viel Stuck! Was bleibt mir dann noch für meine Kirchen!“
Der Vergleich zu den kargen Kaffeestuben macht das Aufsehen, welches das Café Probst erregt, nachvollziehbar. Dabei hat König Ludwig I. angeblich bezweifelt, „dass ein so nobles Kaffeehaus sich halten kann“.
12. 4 1856 - Der Generalplan für die Maximilianstraße
<p><strong><em>München-Graggenau - München-Lehel</em></strong> * Mit dem <em>„Generalplan über die Maximilianstraße“</em> ist die endgültige Lösung der Straßenführung gefunden.</p>
12. 4 1856 - Die Ostbahn-Aktiengesellschaft erhält die Baumaßnahme übertragen
<p><strong><em>München</em></strong> * Der <em>„Kgl. privilegierten Aktiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen“</em> wird die Durchführung der <em>„längst allgemein als dringendes Bedürfnis erachteten“</em> Baumaßnahme übertragen.</p> <ul> <li>Die Ostbahn-Aktiengesellschaft besitzt ein Kapital von 60 Millionen Gulden. Beteiligt sind unter anderem die Bankhäuser Rothschild, Eichthal, Hirsch und Bischofsheim, die Fabrikbesitzer Cramer und Klett, die Kgl. Bank in Nürnberg sowie Maximilian von Thurn und Taxis. </li> <li>Als Direktor der Gesellschaft, dem der gesamte Bau und die Betriebsführung anvertraut wird, kann Paul Camille von Denis gewonnen werden, der schon beim Bau der Strecke Nürnberg - Fürth und München - Augsburg tätig war. </li> </ul>
7 1856 - Christian August Ernst muss zurücktreten
München-Tivoli * Christian August Ernst wird von der „Generalversammlung der Aktionäre“ gezwungen, von der Leitung der „Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft“ zurückzutreten und die Mühle verhältnismäßig günstig an die „Gemeinschaft der Aktionäre“ zu verkaufen.
Für die Mühle und und das Ausflugslokal „Tivoli“ erhält er 59.000 Gulden. Die Aktionäre wollen keinesfalls auf das „Tivoli“ verzichten.
5. 8 1856 - Adolf Friedrich von Schack kauft ein Haus in der Brienner Straße
München-Maxvorstadt * Adolf Friedrich von Schack kauft ein Haus in der Brienner Straße 22, später 19. Es ist das „Pallavicini‘sche Haus, [...] ein artiges Gebäude mit großen Spiegelscheiben, aber jenseits der Propyläen“.
16. 8 1856 - Lola Montez in Sydney
Sydney * Lola Montez kommt mit ihrem Ensemble in Sydney an.
23. 8 1856 - „Lola Montez in Bavaria“ im überfüllten Victoria Theatre in Sydney
Sydney * Lola Montez tritt mit „Lola Montez in Bavaria“ im überfüllten Victoria Theatre in Sydney auf. Diese höchst erfolgreiche Sensationsstory führt die Señora zu weiteren großen Erfolgen in den Weiten des australischen Kontinents.
10 1856 - Die Maximilianstraße ist nach über dreijährigen Bauarbeiten fertiggestellt
München-Graggenau - München-Lehel * Die Maximilianstraße ist nach über dreijährigen Bauarbeiten fertiggestellt.
Die Länge vom Max-Joseph-Platz bis zur Isar beträgt 1.664 Meter, breit ist die Straße dreiundzwanzig Meter. Das „Forum“ ist 82 Meter breit und 379 Meter lang.
Abschließend werden die Grünflächen im „Forum“ hergestellt und mit „Rosskastanien“ bepflanzt.
Entlang der Straße pflanzt man „Platanen“. Diese vertragen allerdings das Münchner Klima nicht und sterben ab, weshalb sie durch „Bergahorn“ ersetzt werden.
1857 - Die „Frauen vom guten Hirten“ stellen eine Madonna in ihrem Garten auf
München-Haidhausen * Aus Dankbarkeit von der „Cholera“ verschont worden zu sein, lassen die „Frauen vom guten Hirten“ in Haidhausen eine aus Stein gehauene Madonna in ihrem Garten aufstellen.
1857 - Adolf Friedrich von Schack will junge Künstler fördern
München-Maxvorstadt * Adolf Friedrich von Schack erwirbt von dem „Historienmaler“ Bonaventura Genelli das erste Gemälde seiner Sammlung.
Er wendet sich den unbekannten oder verkannten Malern seiner Zeit zu. „Junge Kräfte zu entdecken oder auch solche zu beschäftigen, welche, der Gunst des großen Publikums entbehrend, brach lagen“, erscheint ihm lohnender, als Bilder von jenen Künstlern besitzen zu wollen, die den Ruhm des Tages für sich haben.
„Ich dachte“, so äußerte er sich später, „meine Galerie würde so einen eigentümlichen Charakter erhalten, während sie sonst nur Bilder von Malern aufgewiesen hätte, von denen man schon überall welche sehen konnte“.
1857 - Die „Preußische Gesandtschaft“ befindet sich im „Palais Dürckheim“
München-Maxvorstadt * Die „Preußische Gesandtschaft“ befindet sich im „Palais Dürckheim“ in der Türkenstraße 4.
1857 - Joseph Wild verlegt den „Singlspielerbräu“ an die Rosenheimer-/Hochstraße
München-Angerviertel - München-Au * Zwischen 1857 und 1859 verlegt Joseph Wild den „Singlspielerbräu“ an die Ecke Rosenheimer- und Hochstraße.
Er schafft damit die Voraussetzungen für den weiteren Aufstieg der Brauerei.
1857 - „Spatenbräu“ steht mit dem Malz-Verbrauch an der Spitze
München * Im Braujahr 1856/57 steht „Spatenbräu“ mit einem Verbrauch von 18.417 Scheffel Malz an der Spitze in München.
Die zwölf erfolgreichsten Münchner Brauereien haben einen Malzverbrauch von zusammen 102.748 Scheffel.
Das sind 228.100 Hektoliter.
1857 - Max Schweiger engagiert „Fräulein Dellson“ als „Pepita“
München-Isarvorstadt * Max Schweiger engagiert die Wiener Soubrette „Fräulein Dellson“ als „Pepita“ an sein Theater.
Verschiedene Possen mit „Pepita“ im Namen werden in diesem Jahr im „Isar-Vorstadt-Theater“ in der Müllerstraße aufgeführt.
1857 - Joseph Hall verlässt das „Eisenwerk Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Joseph Hall verlässt das „Eisenwerk Hirschau“ von Joseph Anton von Maffei.
Sein Nachfolger wird George Jon Ashton.
1857 - Aus der Unteren Isargasse wird die Entenbachstraße
München-Au * Aus der Unteren Isargasse wird die Entenbachstraße.
4. 4 1857 - König Max II. lässt die Maximiliansanlagen anlegen
<p><strong><em>München-Haidhausen - Bogenhausen</em></strong> * König Max II. lässt die Maximiliansanlagen durch den 26-jährigen Hofgärtner Carl Effner anlegen. Die Arbeiten für den Landschaftspark dauern bis 1866.</p>
9. 4 1857 - Ex-Königs Ludwig I. Sarkophag wird in der Bonifaz-Kirche aufgestellt
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Der Sarkophag des Ex-Königs Ludwig I. wird noch zu seinen Lebzeiten in der Sankt-Bonifaz-Kirche aufgestellt.</p>
14. 7 1857 - Friedrich Wilhelm IV. von Preußen erleidet mehrere Schlaganfälle
Berlin * König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen erleidet mehrere Schlaganfälle, wodurch auch sein Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen wird. Er wird von seinem Bruder Prinz Wilhelm vertreten.
26. 7 1857 - Lola Montez ist wieder in San Francisco
San Francisco * Lola Montez ist wieder in San Francisco. Von dort reiste sie nach New York weiter, wo sie sich auf ihre nächste Karriere als Vortragsreisende vorbereitet.
18. 8 1857 - Hans von Bülow heiratet Cosima, die Tochter von Franz Liszt
Berlin * Der Pianist und Dirigent Hans von Bülow heiratet in Berlin Cosima, die Tochter von Franz Liszt.
9 1857 - Lola Montez tritt in der „Goldgräbersiedlung“ Sacramento auf
Sacramento * Lola Montez tritt in der „Goldgräbersiedlung“ Sacramento auf.
Sie fühlt sich in der Gesellschaft der „rauen Gesellen“ wohl, die sich gerne in der Rolle der „Beschützer“ sehen.
15. 9 1857 - Explosion führt zur Zerstörung des Hauptturms des Karlstores
<p><strong><em>München-Kreuzviertel - Hackenviertel</em></strong> * Gegen 22:30 Uhr explodiert das rechts am Haupttorturm des Karlstores anschließende Haus des Eisenhändlers Rosenlehner. Auf dem Anwesen war Schwarzpulver gelagert, das detoniert. Bei diesem Unglück kommen fünf Menschen ums Leben, das Haus wird völlig zerstört und der Turm in seinen Grundfesten so stark erschüttert, dass er anschließend abgetragen werden muss. </p>
22. 9 1857 - Anita Augspurg wird in Verden an der Aller (Niedersachsen) geboren
Verden/Aller • Anita Theodora Johanna Sophie Augspurg wird in Verden an der Aller (Niedersachsen) geboren.
24. 9 1857 - Carl Gabriel wird in Bernstadt in der Nähe von Breslau geboren
Breslau * Carl Gabriel wird in Bernstadt in der Nähe von Breslau als Sohn eines Menageriebesitzers geboren.
17. 10 1857 - Lola Montez steht letztmals in Kalifornien auf der Bühne
Sacramento - Grass Valley * Lola Montez steht letztmals in Kalifornien auf der Bühne.
31. 10 1857 - Die Eisenbahn-Strecke bis Rosenheim ist fertiggestellt
München-Großhesselohe * Der 62,9 Kilometer lange Eisenbahn-Streckenabschnitt von dem Belustigungsorte Hesselohe bis Rosenheim ist fertiggestellt.
Ab 11 1857 - Professor Karl von Piloty unterrichtet Franz Lenbach
München * Der neu berufene Professor Karl von Piloty unterrichtet Franz Lenbach.
11 1857 - Lola Montez fährt nach New York zurück
New York * Lola Montez fährt mit dem Dampfschiff „Orizaba“ nach New York zurück.
1858 - Aus dem „Palais der Königin Therese“ wird eine „Kriegsschule“
Schwabing * Das „Palais der Königin Therese“ wird um 20.000 Gulden - über einen Strohmann - vom Militär gekauft und nach dem Umbau als „Kriegsschule“ verwendet.
1858 - Der „Kenotaph“ für Kaiser Ludwig dem Baiern wird versetzt
München-Kreuzviertel * Der „Kenotaph“ für Kaiser Ludwig dem Baiern wird aus der Mitte des „Chores“ der „Frauenkirche“ in das Kirchenschiff versetzt.
1858 - Die Familie Herkomer lässt sich in Southampton nieder
Southhampton * Die Familie Herkomer lässt sich in Southampton in England nieder.
1858 - Die „Dr. Steinbachs Naturheilanstalt“ im „Brunnthal“
Bogenhausen * Die „Leipziger Illustrirten“ loben die „Dr. Steinbachs Naturheilanstalt“ im „Brunnthal“ von Bogenhausen, die sich einen international bekannten Namen gemacht hat.
Ab 1858 - Die „welschen Hauben“ sollen durch „gotische Spitzhelme“ ersetzt werden
München-Kreuzviertel * In der Zeit der „Purifizierung der Frauenkirche“ wird alles entfernt, verkauft oder zerschlagen, was nicht gotisch ist.
Sogar die „welschen Hauben“ sollen durch „gotische Spitzhelme“ ausgetauscht werden.
Von diesem Plan wird jedoch Abstand genommen.
1858 - Die Dampfschifffahrt auf dem Main wird eingestellt
Main * Die Dampfschifffahrt auf dem Main wird bis 1886 eingestellt.
1858 - Die Spuren der Theres Feldmüller verlieren sich
München-Obergiesing * Nachdem die Beziehung zu ihrem Vetter Franz-Xaver Huber in die Brüche geht, verlieren sich die Spuren der Theres Feldmüller.
Ihr Sterbedatum ist unbekannt.
Man sagt ihr ein „wechselhaftes Leben“ nach, weshalb sie noch heute einen „schlechten Ruf“ besitzt.
1858 - Geplante Maßnahmen gegen Rebellen und gegen Aufruhr
München-Graggenau - München-Kreuzviertel * Eine von „Kriegsminister“ von Manz vorgelegte „Denkschrift“ will die Bürgerhäuser am „Max-Joseph-Platz“, zwischen der „Perusagasse ab nach Norden bis auf die Höhe des ludovicianischen Königsbaues abzureißen“, um den „Rebellen“ keinen Unterschlupf und ein „freies Schußfeld“ zu ermöglichen.
Zwischen der „Prannergasse“ [heutige Kardinal-Faulhaber-Straße] und der „Theatinerstraße“ will er in den geschlossen bebauten Häuserblock eine Bresche schlagen, den gesamten Häuserblock zwischen der „Perusagasse“ und der „Schrammergasse“ demolieren und auf der dadurch freiwerdenden Fläche eine „Defensivkaserne“ errichten.
Zum Glück haben sich all diese Planungen aus verschiedenen Gründen nicht realisieren lassen.
11. 2 1858 - Marienerscheinung in einer Felsengrotte bei Lourdes
Lourdes - Rom-Vatikan * In den Auseinandersetzungen um das Dogma der unbefleckten Empfängnis erscheint dem Bauernmädchen Bernadette Soubirous in einer Felsengrotte bei Lourdes eine „schöne weiße Dame“, die sich als „die unbefleckte Empfängnis“ betitelt.
Aus der Sicht von Papst Pius IX. gerade im richtigen Moment. Umgehend wird der Ort der Erscheinung zum Wallfahrtsort erhoben.
28. 2 1858 - Uraufführung der Oper „Lohengrin“ in München
München * Die Richard-Wagner-Oper „Lohengrin“ wird in München aufgeführt.
8 1858 - Richard Wagner trennt sich von seiner Frau Minna
Zürich - Venedig - Paris - Karlsruhe * Richard Wagner trennt sich von seiner Frau Minna, verlässt Zürich und übersiedelt nach Venedig.
Danach folgen Paris und Karlsruhe.
5. 8 1858 - Die Eisenbahnstrecke von Rosenheim bis Kufstein ist fertig
Rosenheim - Kufstein * Die 31,9 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Rosenheim bis zur Grenze bei Kufstein ist fertiggestellt.
7. 10 1858 - Wilhelm I. wird preußischer Prinzregent
Berlin * Nachdem die Stellvertretung des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. durch seinen Bruder Prinz Wilhelm von Preußen dreimal verlängert worden ist, unterzeichnete der kranke König die Regentschaftsurkunde für Wilhelm I., der damit die Funktion des Prinzregenten übernimmt.
22. 10 1858 - Auguste Viktoria, die spätere Kaiserin, wird in Dolzig geboren
Dolzig * Auguste Viktoria Friederike Luise Feodora Jenny von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, die spätere Ehefrau von Kaiser Wilhelm II., wird in Dolzig in der Niederlausitz geboren.
26. 10 1858 - Es kommt zu einer Grenzbereinigung bei der Ramersdorfer Lüften
München-Haidhausen - Ramersdorf * Es kommt zu einer Grenzbereinigung, bei der die Anwesen Nummer 1 bis 37 der Ramersdorfer Lüften sowie die Anwesen Nummer 1 bis 5 am Ramersdorfer Feldweg von der Gemeinde Ramersdorf abgetrennt, danach wird aber der Vorzustand wieder hergestellt.
3. 11 1858 - Die Maximilianstraße, Münchens teuerster Boulevard
München-Graggenau - München-Lehel * Der neue Boulevard erhält die offizielle Bezeichnung Maximilianstraße. Es ist eine großartige Straßenachse entstanden, die in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts keinen Vergleich zu scheuen braucht. Die Münchner sind allerdings weniger mit den neugotischen Fassadenvorstellungen Friedrich Bürkleins einverstanden und so hagelt es durchwegs vernichtende Kritik am neuen Baustil.
Leo von Klenze schreibt unter anderem: „Der Einfluß des Hofsekretärs Hofmann für seinen Freund Bürklein [...] bewirkte nun, daß der König sich der Illusion hingab, ein gewisses architektonisches Ragout, ein Mixtum compositum, welches ihm der Baurath Bürklein servierte, für einen wirklich neuen Baustyl anerkennen zu dürfen, dasselbe den maximilianischen Styl taufte und seine Anwendung bei allen nur aufzufindenden Gelegenheiten durch eigene Verordnung befahl.”
Noch erbarmungsloser fällt die Kritik des Ex-Königs aus: „Was man da gebaut hat”, sagt Ludwig I. zu Leo von Klenze, „ist das Abscheulichste, das ich kenne” und weigert sich strikt, die Konkurrenz seiner Prachtstraße zu besichtigen.
Doch in der Maximilianstraße, immerhin „Münchens teuerstem Boulevard“, pulsiert das großstädtische Leben - im Gegensatz zur menschenleeren, sterilen, verkehrsreichen und autobahnählichen Ludwigstraße. Dass es zu der teilweise vernichtenden Kritik am Maximilianischen Stil kommt, liegt zu einem erheblichen Teil an dem ewig zaudernden und unsicheren Bayernkönig Max II., indem er mitten im Bau der Maximilianstraße die Konzeption abändert. So lässt er das fast fertiggestellte Taubstummeninstitut wieder abreißen, um eine einheitliche Bebauung am Forum zu erhalten.
Und kurz vor seinem Tod ordnet er noch an, dass am Maximilianeum die gotisierenden Spitzbögen in Rundbögen abgeändert werden müssen, wodurch der Bau im Gegensatz zum ganzen Straßenzug einen Renaissance-Charakter erhält. Diese Stiländerung nimmt der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt in seiner Kritik auf. Er schreibt zum Maximilianeum: „[...] Ich habe nur deshalb Dankbarkeit für das Gebäude empfunden, weil es wenigstens äußerlich in die Formen der Renaissance hinüberleitet und den Geist von dem jämmerlichen Gotisch der Maximilianstraße befreit.”
3. 11 1858 - Die Landshuter Eisenbahn-Linie kann eröffnet werden
München - Landshut * Auf den Vorarbeiten der staatlichen Eisenbahn-Commission aufbauend, kann die Landshuter Linie eröffnet werden. Die Landshuter Allee erinnert noch heute an die ursprüngliche Trassenführung.
5. 12 1858 - Das Marionettentheater wird eröffnet
<p><em><strong>München-Isarvorstadt</strong></em> * Das Münchner Marionettentheater wird als erste feste Bühne für Marionetten in Deutschland eröffnet. </p>
31. 12 1858 - In München wohnen 121.234 Einwohner in 6.083 Häusern
München * In München wohnen 121.234 Einwohner in 6.083 Häusern.
1859 - Das alte „Brunnhaus auf dem Isarberg“ wird abgerissen
München-Haidhausen * Das alte „Brunnhaus auf dem Isarberg“ wird abgerissen.
1859 - Die „Gastwirtschaft zum Roten Turm“
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Im nördlichen Anbau des ehemaligen „Roten Turms“ wird die „Gastwirtschaft zum Roten Turm“ eingerichtet.
Sie erhält die „Taferngerechtsame des Heiliggeistspitals“.
Die Gäste dieses Lokals sind hauptsächlich Soldaten der nahen „Schwere-Reiter-Kaserne“.
1859 - In der „Tuchfabrik“ Roeckenschutz an der Wurzerstraße bricht ein Feuer aus
München-Graggenau * In der „Tuchfabrik“ des Johann Nepomuk Roeckenschutz an der Wurzerstraße bricht ein Feuer aus, „bei dem sich die Münchner Löschverhältnisse in aller Jämmerlichkeit“ zeigen.
1859 - Johann Georg Landes gründet die „Landes Maschinen- und Kesselfabrik“
München-Haidhausen * Johann Georg Landes gründet die „J. G. Landes Maschinen- und Kesselfabrik, Eisen- und Metallgießerei“.
Die Firma stellt Erzeugnisse des Maschinenbaues her und spezialisiert sich später auf Wasserturbinen, Schleusen- und Wehranlagen. Das Unternehmen ist bis zum Zweiten Weltkrieg tätig.
Johann Georg Landes richtete „aus Fürsorge um das Wohl ihrer Arbeiter“ eine firmeneigene „Betriebskrankenkasse“ ein. Die Höhe der Unterstützungsleistung richtet sich nach der Lohngruppe. Um das Leistungsrisiko zu vermindern, knüpfen die Kassen oft die Auszahlung von „Krankengeld“ an gewisse Bedingungen.
In der Satzung des „Krankenvereins der Maschinenfabrik J. G. Landes“ heißt es: „Auf Unterstützung hat aber kein Mitglied Anspruch, so lange dasselbe wirklich Arbeit verrichtet, nur Medizin gebraucht, oder sich Krankheit und Arbeitsunfähigkeit durch Exzeß, Rauferei oder unordentlichen Lebenswandel [durch übermäßiges Trinken oder syphilitische Krankheiten] zugezogen hat“.
1859 - In Wien wird die „Gewerbefreiheit“ eingeführt
Wien * In Wien wird die „Gewerbefreiheit“ eingeführt.
Seit dem Jahr 1859 - Johann Valentin Fey arbeitet bei Karl Falk als Geschäftsführer
München-Au * Johann Valentin Fey übt beim Auer „Tapezierer“ Karl Falk in der Entenbachstraße 63 die Tätigkeiten eines Geschäftsführers und Vorarbeiters aus.
1859 - Bis zu 17.000 Arbeiterinnen und Arbeiter bauen an der „Ostbahn“
Geiselhöring - Passau - Regensburg * Ab dem „Verkehrsknotenpunkt Geiselhöring“ wird auf zwei Strecken die „Ostbahn“ weitergebaut.
Die eine Strecke führte nach Passau, die andere nach Regensburg, Amberg und Nürnberg.
Mit einem Aufgebot von bis zu 17.000 Arbeiterinnen und Arbeitern wird das 453 Kilometer umfassende Grundnetz der „Bayerischen Ostbahnen“ fertiggestellt werden.
Paul Camille von Denis schafft das in einer fünfeinhalbjährigen Bauzeit.
Der „Direktor der Ostbahngesellschaft“ unterschreitet damit nicht nur die zeitliche Vorgabe der staatlichen „Eisenbahn-Commission“, die dafür eine Bauzeit von sieben Jahren vorgesehen hatte, sondern auch die Baukosten gegenüber dem Voranschlag von 46,5 Millionen Gulden um 12,8 Millionen Gulden.
Das sind nahezu dreißig Prozent.
Damit ist Paul Camille von Denis, dem „Altmeister des Eisenbahnbaus“, die allgemeine Anerkennung sicher.
In Zeitungsartikeln halten sich die Zeitgenossen mit ihrer Bewunderung für diese Leistung nicht zurück:
„Der Erfahrungssatz, der leider bei uns in Deutschland viel zu wenig bekannt oder anerkannt scheint - ‚Zeit ist Geld‘ -, spricht sich in allen Anordnungen der Ostbahn-Direction aus“.
1859 - Aufhebung der „Maulkorbverordnung“ für Hunde
München * Nach der Aufhebung der „Maulkorbverordnung“ steigt die Zahl der Hunde wieder stark an.
Im Laufe des Jahres 1859 - König Max II. gibt resigniert auf
München * König Max II. beendet seine sämtlichen Versuche, die „Verfassung“ zu verschlechtern.
Sie scheitern an der hohen Hürde der „Dreiviertelmehrheit“, die in „Titel X Artikel 7 der Verfassungsurkunde des Jahres 1818“ festgelegt worden war.
Der angebliche Leitspruch Königs Max II.: „Ich will Frieden haben mit meinem Volk!“ trat damit tatsächlich ein.
Der König erkennt die Unmöglichkeit der „Verfassungsänderung“ gegen den Willen der bayerischen Bevölkerung.
1859 - Lola Montez hält sich in London auf
London * Lola Montez hält sich in London auf.
27. 1 1859 - Prinz Wilhelm II. von Preußen, der spätere Kaiser, wird in Berlin geboren
Berlin * Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm II., wird in Berlin geboren.
2. 8 1859 - Die Jakobi-Dult wird an den Haidhauser Johannisplatz verlegt
München-Haidhausen * Die Jakobi-Dult wird provisorisch auf den Haidhauser Johannisplatz verlegt.
12. 9 1859 - Reinhold Hirschberg eröffnet eine Ziegelei in Steinhausen
Bogenhausen * Der Unternehmer Reinhold Hirschberg gründet eine oHG (= offene Handelsgesellschaft) und eröffnet eine Ziegelei mit dem Namen Fabrik Steinhausen.
31. 10 1859 - Das Irrenhaus Giesing wird in die Hochau verlegt
München-Au * Das Irrenhaus Giesing wird in die Hochau verlegt, wo die Kreisirrenanstalt eröffnet hat. Sie steht später auch unter der Leitung des Obermedizinalrats Dr. Bernhard von Gudden, dem Gutachter König Ludwig II., und gilt über eine lange Zeit als Musteranstalt.
Mit der Eröffnung der Kreisirrenanstalt nutzt man die Gebäude am Kolumbusplatz für das St.-Nikolai-Spital für Unheilbare, das vorher am Gasteig stand. König Max II. hatte zuvor das Leprosenhaus am Gasteig erworben, das mittlerweile den Namen Spital der Unheilbaren erhalten hat, um es in den Maximiliansanlagen aufgehen zu lassen. Der Magistrat der Stadt muss daraufhin die aufgelassene Irrenanstalt in Untergiesing - zur Unterbringung der Unheilbaren - kaufen.
21. 11 1859 - Die Kreisirrenanstalt in der Hochau wird eröffnet.
München-Au * Die Kreisirrenanstalt für Oberbayern wird eröffnet. Das neue Nervenkrankenhauses liegt bei ihrer Errichtung in einem völlig unbebauten Gebiet zwischen der Rosenheimer- und der Auerfeldstraße. Unter der Leitung des Obermedizinalrats Dr. Bernhard von Gudden gilt die Einrichtung als Musteranstalt.
- Der quadratische Gebäudekomplex hat vier Höfe.
- Die Länge der Flügelbauten betragen hundert Meter.
- Im Südflügel sind die Verwaltungsräume, in der Mittelachse die Küche,
- die Anstaltskapelle mit Werkstätten ist im Erdgeschoss,
- ebenso eine Turnhalle mit dem zentralen Bad und den Beschäftigungsräumen.
In den beiden südlichen, nur auf drei Seiten geschlossenen Höfen sind die „ruhigen Irren“, in den beiden nördlichen geschlossenen Höfen die „unruhigen Kranken“ untergebracht. Die Zimmer der „ruhigen“ Patienten liegen außen. Die Räume der „unruhigen“ Kranken sind genau umgekehrt angeordnet.
Nur die Fenster und Türen im Erdgeschoss haben Gitter und da sie die Form der rundbogigen Fenster aufnehmen, bleiben sie relativ unauffällig. Die Anlage um die vier Höfe entspricht den zeitgemäßen Forderungen nach Trennung der Patienten nach Geschlechtern und der Schwere ihrer Erkrankung. Eine Trennung nach Klassen ist nicht vorgesehen.
Die Beschäftigten der Kreisirrenanstalt finden allerdings keine mustergültigen Arbeitsbedingungen vor. Das Pflegepersonal untersteht der Gesindeordnung. Es gibt weder eine Pflegequote, noch Urlaubsregelungen oder eine Altersversorgung für die Pflegekräfte. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt einhundert Stunden und mehr. Der Dienst beginnt um 5:00 Uhr und endet um 21:00 Uhr. Selbst verheiratete Pfleger müssen in der Anstalt schlafen und dürfen nur einen Nachmittag pro Woche bei ihren Familien verbringen.
Durch das rapide Bevölkerungswachstum der Stadt - München wächst vom Jahr 1854 von 100.000 Einwohnern auf fast 500.000 im Jahr 1900 - kommt es in der Kreis-Irrenanstalt zu einer über fünfzigprozentigen Überbelegung und wird unter diesen Umständen den Bedürfnissen nicht mehr gerecht.
1860 - Die Münchner „Ziegeleibesitzer“ schließen sich zusammen
München * Die Münchner „Ziegeleibesitzer“ schließen sich im „Verein Münchner Ziegeleien“ zusammen und verpflichten sich in ihren Statuten, jährlich nur eine festgelegte Anzahl von Steinen zu brennen.
Gleichzeitig vereinbaren sie einen Mindestpreis.
1860 - Das „Auer Tor“ wird abgerissen
München-Haidhausen - München-Au * Das „Auer Tor“ an der Zusammenführung des „Gasteigs“ und der Rosenheimer Straße wird abgerissen.
1860 - Das Sommersud-Verbot wird aufgehoben
München * Das Sommersud-Verbot wird aufgehoben und damit das ganzjährige Brauen erlaubt. Es dauert aber noch weitere zwanzig Jahre, bis die Münchner Brauer die Möglichkeit auch nutzen.
1860 - Jeder Münchner - vom Säugling bis zum Greis - trinkt 535 Liter Bier
München * Die 18 „Braun- und Weißbierbrauereien Münchens“ erzeugen 802.389 Hektoliter Bier.
Davon werden 6.775 Hektoliter exportiert.
Bei einer Einwohnerzahl von rund 140.000 ergibt sich für dieses Jahr ein Pro-Kopf-Verbrauch von 535 Liter. Dieses durchschnittliche Quantum, das „jeder Münchner“ zu sich nimmt [vom Säugling bis zum bettlägerigen Kranken], reduziert sich im Laufe der folgenden Jahre.
1860 - Die Grundungsversuche für eine Münchner Feuerwehr scheitern
München * Der neu gegründete „Münchner Männerturnverein“ versucht die Gründung einer „Freiwilligen Feuerwehr“.
Gleichzeitig befasst sich der Magistrat mit der Gründung einer „bezahlten und kasernierten Feuerwehr“.
Beide Projekte werden abgelehnt.
1860 - König Max II. lässt das „Spital der Unheilbaren“ aufkaufen
München-Haidhausen * König Max II. lässt das „Spital der Unheilbaren“ und das gesamte Anwesen aufkaufen, um es in seine „Maximiliansanlagen“ einbeziehen zu können.
Um 1860 - Die Münchner nutzen das Wirtshaus „Zum Hasenstall“ als Ausflugslokal
München-Englischer Garten - Hirschau * Immer mehr Münchner nutzen das in der „Hirschau“ gelegene Wirtshaus „Zum Hasenstall“ als Ausflugslokal.
In Stadtführern taucht deshalb auch der Name „Hirschauer Ausflugslokal“ auf.
Die Bezeichnung „Zum Hasenstall“ gerät immer mehr in Vergessenheit.
1860 - Zu jedem Haus in der „Birkenau“ gehört ein Gartenanteil
München-Untergiesing * Zu jedem Haus in der „Birkenau“ gehört ein Gartenanteil, der bei einigen Häusern bereits mit Stallungen und sonstigen Gebäuden bebaut ist.
Der Gartenanteil wird von den meisten Bewohnern für gewerbliche Zwecke genutzt, denn sie sind fast ausschließlich „Gänsemäster, Geflügel- und Federnhändler“ sowie „Fiaker“, also Pferdefuhrunternehmer.
Daneben siedeln sich in der „Birkenau“ auch Tagelöhner an und es gibt hier eine Bierwirtschaft, nämlich das „Gasthaus zum Fiakerheim“.
1860 - Die Bautätigkeit für das „Gärtnerplatz-Viertel“ beginnen
München-Isarvorstadt * Die Bautätigkeit für das „Gärtnerplatz-Viertel“ - als ein planmäßig angelegtes typisches Mietshaus-Quartier - beginnen.
1860 - Durch die private „Ostbahn“ muss der „Centralbahnhof“ erweitert werden
München-Maxvorstadt * Der ständige Ausbau des Schienennetzes zieht für den „Centralbahnhof“ Erweiterungen und Umbaumaßnahmen nach sich.
Durch die Aktivitäten der privaten „Ostbahn-Aktiengesellschaft“ droht der „Centralbahnhof“ zusätzlich aus allen Nähten zu platzen.
Deshalb erbaut man nördlich des Bahnhofgebäudes eine eigene Einsteighalle für die „Ostbahn“.
Sie überspannt vier Gleise, hat eine Länge von rund 145 und eine Breite von 24 Metern.
Um das einheitliche Bild des „Centralbahnhofs“ zu erhalten, blendet Friedrich Bürklein der „Ostbahnhalle“ einen dreigeschossigen Pavillon als Kopfbau vor.
Zur Symmetrie erhält der Bahnhof am südlichen Ende einen von der Post genutzten Erweiterungsbau.
7. 5 1860 - Die Eisenbahnstrecke von Rosenheim nach Traunstein ist fertig
Rosenheim - Traunstein * Die 53,3 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Rosenheim bis nach Traunstein ist fertiggestellt.
16. 5 1860 - Der Verein zur körperlichen Ausbildung wird gegründet
München * Der Münchner Turnverein wird als Verein zur körperlichen Ausbildung wieder gegründet.
30. 6 1860 - Lola Montez erleidet einen Schlaganfall
New York * Lola Montez erleidet einen Schlaganfall, ist linksseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen.
15. 7 1860 - Richard Wagner wird nur noch in Sachsen verfolgt
Deutschland ohne Sachsen * Richard Wagner erreicht seine Teil-Amnestierung für Deutschland - mit Ausnahme von Sachsen.
1. 8 1860 - Die Eisenbahnstrecke von Traunstein bis Salzburg ist fertiggestellt
Traunstein - Salzburg * Die 29,5 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Traunstein bis zur Grenze bei Salzburg ist fertiggestellt.
12. 8 1860 - Die Eisenbahn-Strecke München - Salzburg wird erstmals befahren
München - Salzburg * Die in fünf Teilabschnitten erbaute und insgesamt 188 Kilometer lange Eisenbahn-Strecke von München nach Salzburg kann erstmals befahren werden. Ab Salzburg führt die Bahnlinie weiter nach Wien.
Kaiser Franz Joseph I. von Österreich trifft aus Wien mit der k.k. privilegierten Kaiserin-Elisabeth-Bahn ein, König Max II. von Bayern in Salzburg in seinem Hofzug an. Der bayerische Zug wird von zwei Maffei-Lokomotiven gezogen.
Mit dieser Zugverbindung liegt München genau zwischen den zwei großen europäischen Metropolen Wien und Paris.
9 1860 - „Menschenunwürdige Zustände“ im „Nicolai-Spital der Unheilbaren“
München-Haidhausen - München-Au * Die Insassen des „St.-Nicolai-Spitals der Unheilbaren“ ziehen in die Räume des aufgelassenen „Irrenhauses Giesing“ an den heutigen Kolumbusplatz um.
Waren die Raumverhältnisse und die Unterbringung der „Pfründner“ am Gasteig schon misslich, so gestalten sich die Verhältnisse im „neuen Nicolaispital“ noch ungünstiger und werden sogar als „menschenunwürdig“ bezeichnet, was für diese „elendgewohnte Zeit“ eine starke Aussage bedeutet.
Trotzdem ist das Spital siebzehn Jahre in Betrieb.
3. 9 1860 - Der eiserne Dachstuhl für die Befreiungshalle
München-Englischer Garten - Hirschau * Das Eisenwerk Hirschau von Joseph Anton von Maffei liefert den von ihr gefertigten eisernen Dachstuhl für die Befreiungshalle bei Kehlheim und beginnt vor Ort mit den Arbeiten. Innerhalb von 14 Tagen ist die Bedachung des kolossalen Gebäudes vollendet.
19. 9 1860 - Coletta Möritz kommt in Ebenried bei Pöttmes zur Welt
Ebenried * Coletta Möritz kommt in Ebenried bei Pöttmes im Landkreis Aichach als zweites lediges Kind ihrer Mutter zur Welt.
1. 10 1860 - Franz Lenbach wird Lehrer der historischen Malerei in Weimar
Weimar * Franz Lenbach wird als Lehrer der historischen Malerei an der neuen Kunstschule in Weimar angestellt.
15. 12 1860 - Erstmals erklingt die „Bayernhymne“
München * Erstmals erklingt die „Bayernhymne“, intoniert von den Mitgliedern der Münchner Bürger-Sänger-Zunft. Die Melodie in G-Dur geht angenehm ins Ohr und hat deshalb großen Anteil an der Popularität der „Bayernhymne“.
- Komponiert hat die Melodie Konrad Max Kunz, der Chordirigent der Königlichen Hofoper.
- Den Text der „Bayernhymne“ verfasste der wegen kritischer Artikel im Visier der Obrigkeit stehende Lehrer Michael Öchsner.
Bis 31. 12 1860 - Im Eisenwerk Hirschau sind 465 Lokomotiven entstanden
München-Englischer Garten - Hirschau * Im Eisenwerk Hirschau von Joseph Anton von Maffei sind 465 Lokomotiven entstanden. Davon fanden 129 einen Käufer im Ausland.
1861 - Der „Salvator“ wird erstmals im neu erbauten „Zacherlkeller“ ausgeschenkt
München-Au * Der „Salvator“ wird erstmals im neu erbauten „Zacherlkeller“ ausgeschenkt.
1861 - Die Wirtschaft „Neuberghausen“ wird eröffnet
Bogenhausen * Auf dem Grundstück des „Rappelhofes“ in der Neuberghausener Straße, der mit rund 100 Tagwerk Wirtschaftsfläche zweitgrößte Bauernhof Bogenhausens, wird die Wirtschaft „Neuberghausen“ eröffnet.
1861 - Das ehemalige „Schloss Neuberghausen“ wird abgerissen
Bogenhausen * Das ehemalige „Schloss Neuberghausen“ wird abgerissen.
Die „Gastwirtsgerechtsame“ des Ausfluglokals geht auf den „Rappelhof“ - neben der Bogenhausener Georgs-Kirche - über.
1861 - Der „Vorstadt-Krämer“ Eugen Allwein erwirbt den „Kotterhof“
München-Haidhausen * Der „Vorstadt-Krämer“ Eugen Allwein erwirbt das „Kotterhof“-Anwesen in Haidhausen.
1861 - Josef Sedlmayer erwirbt den „Franziskaner-Keller“ an der Hochstraße
München-Au * Josef Sedlmayer erwirbt den „Franziskaner-Keller“ an der Hochstraße und lässt ein auf neuester Technik basierendes Brauereigebäude errichten.
Er verlegt auch seinen „Leistbräu“ hieher.
Das Unternehmen heißt jetzt „Josef Sedlmayer - Brauerei zum Franziskaner (Leistbräu)“.
1861 - Die „Unheilbaren“ kommen nach Untergiesing
München-Haidhausen - München-Au * Die „Unheilbaren“ vom Spital am Gasteig werden in den Räumen der ehemaligen „Irrenanstalt“ in Untergiesing untergebracht.
1861 - König Max II. bekräftigt das „Reinheitsgebot“ für Bier
München * König Max II. verordnet mit Gesetzeskraft: „Die Verwendung anderer Stoffe oder Surrogate für Gerstenmalz und Hopfen zur Bereitung von Braunbier bleibt verboten“.
1861 - Der sogenannte „Matrikelzwang“ wird aufgehoben
München * Der sogenannte „Matrikelzwang“ wird aufgehoben.
Den jüdischen Mitbürgern ist damit die Ansiedelung in München ohne Beschränkung möglich.
1861 - Das „Hotel Oberpollinger“ entsteht
München-Kreuzviertel * Die Häuser Nr. 41 - 44 in der Neuhauser Straße werden zum „Hotel Oberpollinger“ umgebaut.
1861 - Der bayerische Staat kauft die Eisenbahn-Strecke zum Starnberger See
München - Starnberger See * Der bayerische Staat erwirbt die Eisenbahn-Strecke zum Starnberger See von Ulrich Himbsel.
1861 - Philipp Reis erfindet das „Telephon“
Friedrichsdorf * Philipp Reis erfindet das „Telephon“.
1861 - Im „Kriechbaumhaus“ gibt es zwölf Herbergs-Eigentümer
München-Haidhausen * Das „Verzeichnis der Hauseigentümer und Herbergsbesitzer“ verzeichnet in den vier Häusern des „Kriechbaumhauses“ insgesamt zwölf Eigentümer von Herbergen.
1. 1 1861 - Ida Baer (Schülein) wird in Oberdorf geboren
Oberdorf * Ida Baer, die spätere Ehefrau des Bierbrauers und Besitzers der Union-Brauerei, Joseph Schülein, wird in Oberdorf geboren.
2. 1 1861 - Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. strbt im Schloss Sanssouci
Berlin * Ein letzter Schlaganfall setzt den Leiden des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. im Schloss Sanssouci ein Ende.
17. 1 1861 - Lola Montez stirbt einen Monat vor ihrem 40. Geburtstag
New York * Einen Monat vor ihrem 40. Geburtstag stirbt Lola Montez. Ein kurzes, aber ereignisreiches Leben ist damit zu Ende.
2. 2 1861 - Kronprinz Ludwig besucht die Münchner „Lohengrin“-Aufführung
München-Graggenau * Der 15-jährige bayerische Kronprinz Ludwig erlebt die Münchner „Lohengrin“-Aufführung. Damit wird der Grundstein für seine schwärmerische Begeisterung für Richard Wagner und dessen Musikwelt gelegt. Es heißt, dieser Abend sei Ludwigs „wahrer Geburtstag“ gewesen.
4. 3 1861 - Die Ramersdorfer Lüften sollen mit Haidhausen vereinigt werden
München-Haidhausen - Ramersdorf * Mit einer Entschließung des Staatsministerium des Inneren und des Justizministeriums soll das Gebiet Auf der Ramersdorfer Lüften und jenes am Kuisl künftig
- von der Gemeinde Ramersdorf abgetrennt,
- mit der Vorstadt Haidhausen vereinigt und
- in den Münchner Burgfrieden aufgenommen werden.
Ab 4 1861 - Wagners „Tristan und Isolde“ wegen „Unspielbarkeit“ abgesagt
Wien * Am Wiener „Hofoperntheater“ soll Richard Wagners „Tristan und Isolde“ aufgeführt werden.
Nach 77 Proben wird das Stück Ende 1863 wegen „Unspielbarkeit“ abgesagt.
27. 4 1861 - Der 13-jährige Prinz Otto wird zum „Unteroffizier“ ernannt
München * Prinz Otto wird an seinem 13. Geburtstag von seinem Vater zum „Unteroffizier“ ernannt.
6. 6 1861 - Die Gesellschaft zur Beförderung der Seidenzucht löst sich auf
München * Die Gesellschaft zur Beförderung der Seidenzucht in Bayern löst sich auf.
16. 6 1861 - Ludwig Schnorr von Carolsfeld in der Titelrolle des Lohengrin
München-Graggenau * Kronprinz Ludwig II. erlebt Ludwig Schnorr von Carolsfeld in der Titelrolle des Lohengrin.
16. 6 1861 - Der Lohnkutscher Michael Zechmeister betreibt einen Stadtomnibus
München * Der bürgerliche Lohnkutscher Michael Zechmeister will „einem längst gefühlten Bedürfnisse unserer Residenzstadt“ abhelfen und richtet einen privaten „fahrplanmäßigen Stellwagenverkehr“ ein. Seine drei Groschenwagen fahren fünfmal täglich die Strecke Centralbahnhof - Marienplatz - Tal - Lilienstraße - Mariahilfplatz.
Doch auch wenn Michael Zechmeister mit seinem Stadtomnibus erstmals die innerstädtische Beförderung einer größeren Menschenmenge ermöglicht, so ist die Nachfrage nach dieser Dienstleistung noch sehr gering. Das liegt auch an der Durchschnittsgeschwindigkeit der Pferde-Omnibus-Linie, die nur wenig über der eines Fußgängers liegt und deshalb mehr der Bequemlichkeit und weniger dem schnelleren Vorwärtskommen dient.
Hinzu kommen die hohen Fahrpreise, die sich nur gut situierte Fahrgäste leisten können. Sie liegen bei sechs Kreuzern und sind damit doppelt so teuer wie ein Brot. Damit scheidet die Unterschicht als Kundschaft aus. Die zahlungskräftige Oberschicht lässt sich aber von Fiakern oder in eigenen Equipagen kutschieren.
12. 8 1861 - Der Lohnkutscher Michael Zechmeister eröffnete seine dritte Linie
München * Der Lohnkutscher Michael Zechmeister eröffnet seine dritte Linie.
Sie führt vom Bahnhof über den Promenadeplatz, über die Theatiner- zur Maximilianstraße und endet an der Praterinsel. Von hier aus muss der Fahrgast den Weg nach Haidhausen zu Fuß zurücklegen.
Um 9 1861 - Anfrage wegen einer „Konzession für eine Pferdebahn“
München - New York * Der aus New York stammende „Zivil-Ingenieur“ S. A. Beer sucht in München um eine „Konzession für eine Pferdebahn“ nach.
Doch der Münchner „Magistrat“ lässt den Amerikaner abblitzen, weil die Sache für ihn zu wenig erprobt und er München schlichtweg für zu klein hält.
Tatsächlich besteht München damals lediglich aus der Innenstadt, der zum ehemaligen „Burgfrieden“ gehörenden „Anna-Vorstadt“, der „Maxvorstadt“, der „Ludwigsvorstadt“, der „Isarvorstadt“ und den seit dem 1. Oktober 1854 eingemeindeten Vorstädten „Haidhausen“, „Au“ und „Giesing“.
Durch die Eingemeindung hat sich das Stadtgebiet Münchens zwar verdoppelt.
Doch dieses Stadtgebiet entspricht mit seinen rund 3.200 Hektar gerade einmal zehn Prozent der heutigen Stadtfläche, die damals von 130.222 Menschen bewohnt wird.
Außerdem, so lautet ein weiteres Argument des „Stadt-Magistrats“, hat ja der „bürgerliche Lohnkutscher“ Michael Zechmeister gerade einen privaten „Stellwagenverkehr“ eingerichtet, der seine drei „Groschenwagen“ fünfmal täglich die Strecke „Centralbahnhof - Marienplatz - Tal - Lilienstraße - Mariahilfplatz“ anfahren lässt.
18. 10 1861 - Wilhelm I. wird zum preußischen König gekrönt
Königsberg * Prinzregent Wilhelm I. von Preußen krönt sich im Königsberger Schloss zum König von Preußen.
10. 11 1861 - Die Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung ist verwirklicht
München * Der bereits am 4. Juni 1848 im Grundlagengesetz verkündete Grundsatz der Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung wird nun endlich verwirklicht.
22. 12 1861 - Kronprinz Ludwig II. genießt die Wagner-Oper „Tannhäuser“
München * Kronprinz Ludwig II. wohnt der Aufführung der Wagner-Oper „Tannhäuser“ bei.
31. 12 1861 - München hat 130.222 Einwohner
München * München hat 130.222 Einwohner, 4.251 Familien, 6.210 Häuser.
31. 12 1861 - 166 Herbergen-Häuser in Haidhausen
München-Haidhausen * Der Physikatsbericht gibt Auskunft über die Aufteilung der Häuser in Herbergseigentum in Haidhausen:
- Demnach sind von den 491 Haidhauser Häuser 166 für Herbergen bestimmt.
- Das sind 33,8 Prozent. 626 Gemächer oder 3,8 Wohnungen je Haus waren darin untergebracht.
31. 12 1861 - Zu den Wohnverhältnissen in den Herbergsvierteln
München - München-Au - München-Haidhausen - München-Giesing * Im Physikatsbericht des Bezirks der Stadt München finden sich über die Wohnverhältnisse in den Herbergsvierteln folgende Ausführungen:
„München besteht gegenwärtig aus 2 Theilen, durch den Isarfluß voneinander getrennt. München links der Isar ist der größte Theil, und das ursprüngliche, eigentliche, alte München. München rechts der Isar enthält die erst seit 1854 zu München gezählten 3 Vorstädte Au, Haidhausen und Giesing.
In diesen 3 Vorstädten sind natürlich die Wohnungsverhältnisse ganz anders, wie auch die Population eine ganz andere ist, als wie in München links der Isar. In den genannten 3 Vorstädten, in welchen größtentheils Taglöhner, überhaupt Arbeiterbevölkerung wohnt, ist das Herbergswesen vorherrschend. [...]
In diesen Herbergen ist die Bewohnung dichter, sind die Wohnungen überhaupt schlechter, den hygienischen Anforderungen nicht entsprechend, ja sie sind, wie dies namentlich in den Jägerhäuseln, in der Lohstraße, Quellenstraße, in der Grube zu Haidhausen der Fall ist, sogar im hohen Grade feucht in Folge ihrer tiefen Lage an dem Bergabhang und an den Canälen und dergleichen, sie sind finster, oft dumpf usw., und wunderbar dennoch ist, wie ich in einer speciellen Bearbeitung der Wohnungsfrage in München im Allgemeinen im vorigen Jahre nachgewiesen habe, die Mortalität in diesen Straßen und Häusern nicht im Geringsten eine größere, und sind die Erkrankungen, namentlich an Typhen etc. nicht einmal so häufig hier, als wie in den luftigsten und schönsten Quartieren der Stadt.
Ich weiß dieses nur dadurch zu erklären, daß diese Bevölkerung eine abgehärtetere und obgleich arm, doch gut genährte, und größtentheils im Freien lebende ist.“
31. 12 1861 - 269 Herbergen-Häuser in der Au
München-Au * Der Physikatsbericht gibt Auskunft über die Aufteilung der Häuser in Herbergseigentum in der Au:
- Demnach sind von den 744 Auer Häuser 269 für Herbergen bestimmt.
- Das sind 36,2 Prozent. 1.167 Gemächer oder 4,3 Wohnungen je Haus sind darin untergebracht.
31. 12 1861 - 89 Herbergen-Häuser in Giesing
München-Giesing * Der Physikatsbericht gibt Auskunft über die Aufteilung der Häuser in Herbergseigentum in Giesing:
- Demnach sind von den 467 Giesinger Häuser 89 für Herbergen bestimmt.
- Das sind 19,1 Prozent. 294 Gemächer oder 3,3 Wohnungen je Haus waren darin untergebracht.
31. 12 1861 - 25 Herbergen-Häuser im Lehel
München-Lehel * Der Physikatsbericht gibt Auskunft über die Aufteilung der Häuser in Herbergseigentum im Lehel:
- Demnach sind von den 435 Häuser im Lehel 25 für Herbergen bestimmt. Das sind nur 5,6 Prozent.
31. 12 1861 - Fünf Herbergen-Häuser in der Isarvorstadt
München-Isarvorstadt - München-Ludwigsvorstadt * Der Physikatsbericht gibt Auskunft über die Aufteilung der Häuser in Herbergseigentum in derIsarvorstadt:
- Demnach sind von den 806 Häuser der Isarvorstadt und Ludwigsvorstadt lediglich 5 für Herbergen bestimmt.
- Das sind 0,6 Prozent. 20 Gemächer oder 4,0 Wohnungen je Haus waren darin untergebracht.
Ab 1862 - Der „Fischbrunnen“ wird erneuert
München-Graggenau * Der Bildhauer Konrad Knoll beginnt mit der Erneuerung des „Fischbrunnens“.
Die Arbeiten dauern bis 1865 an.
1862 - Die „Eisenfronfeste am Lilienberg“ wird zum „Bezirksgefängnis“
München-Au * Die „Eisenfronfeste am Lilienberg“ wird in „Bezirksgefängnis“ umbenannt.
1862 - Das „Gerichtswesen“ wird von der Verwaltung getrennt
München * Das „Gerichtswesen“ wird von der Verwaltung getrennt und in diesem Zusammenhang das „Landgericht links der Isar“ mit dem „Landgericht Starnberg“ vereinigt.
Dadurch entsteht das „Bezirksamt links der Isar“.
Das „Bezirksamt rechts der Isar“ bildet sich aus der Zusammenlegung des „Landgerichts Wolfratshausen“ mit dem „Landgericht rechts der Isar“.
1862 - Die Wirtsleute Wagner verkaufen die Tafernwirtschaft „Zum Salzburger Hof“
München-Haidhausen - München-Au * Die Wirtsleute Johann und Susanne Wagner verkaufen die Tafernwirtschaft „Zum Salzburger Hof“ und übernehmen dafür die Braustätte mitsamt der Bäcker- und Metzgergerechtsame in der Lilienstraße in der Au.
Aus ihr wird später die „Wagner-Brauerei“.
1862 - In München gibt es 3.891 Gewerbebetriebe
München * In München gibt es 3.891 Gewerbebetriebe.
1862 - Die Wiener „Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“ übernimmt
München - Wien * Der bayerische Staat gibt seinen gesamten Schifffahrtsbesitz an der Donau an die Wiener „Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft“ ab.
1862 - Ein „Zoologischer Garten“ am „Englischen Garten“
München-Maxvorstadt * Der zur Münchner Oberschicht zählende „Großhandelsaufmann“ Benedikt Benedikt erwirbt ein Gelände am Westrand des „Englischen Gartens“, wo er einen „Zoologischen Garten“ anlegen möchte.
Zuvor war seine Initiative zur Gründung einer Aktiengesellschaft für diesen Zweck gescheitert, da die Mehrheit der von ihm Eingeladenen nicht an die Rentabilität eines solchen Unternehmens glauben wollten.
1862 - Richard Wagner will ein eigenes Theater
München * Richard Wagner spricht im Vorwort zu „Der Ring des Nibelungen“ den Wunsch nach einem eigenen Theater konkret an.
Er will „ein provisorisches Theater, so einfach wie möglich, vielleicht bloß aus Holz“.
1862 - Der „Münchner Turnverein“
München * Der „Verein zur körperlichen Ausbildung“ wird wieder in „Münchner Turnverein“ umbenannt.
Ab 1862 - Der „Westernheld“ William Frederick Cody alias „Buffalo Bill“
Nordamerika - Kanada * Der „Westernheld“ William Frederick Cody, besser bekannt unter seinem Pseudonym „Buffalo Bill“, ist ein ehemaliger Offizier der amerikanischen Nordstaaten, der als „Militärkundschafter und Fährtensucher“ im Rang eines „Colonels“ steht.
Seinen Namen macht er sich in den „Indianerkriegen“ der Jahre 1862 bis 1872, wo er als gefürchteter Kämpfer seine Opfern - nach Indianer-Vorbild - sogar eigenhändig skalpiert. Zusätzlich ist der „exzentrische Abenteurer“ und „Glücksritter“ auch als „Expreß-Pony-Reiter“ unterwegs und verdient sein Geld mit der „Büffeljagd“ in Nordamerika und Kanada.
Für ein Gehalt von monatlich 500 Dollar dezimiert der hoch verschuldete „Buffalo Bill“ im Auftrag der amerikanischen Eisenbahngesellschaften in kürzester Zeit ganze Büffelherden. Aus übelster Profitgier ist der „Offizier“ zum brutalen Massenschlächter geworden, der innerhalb von eineinhalb Jahren 4.280 Büffel zur Strecke bringt.
1862 - Die systematische „Kanalisierung“ Münchens wird in Angriff genommen
München * Die Stadtverwaltung nimmt die systematische „Kanalisierung“ Münchens in Angriff.
Das unterirdische Röhrensystem wächst bis zur Jahrhundertwende auf eine Länge von 225 Kilometern an.
1862 - In München gibt es 2.298 Rinder und rund 4.500 Hunde
München * In München gibt es noch 2.298 Rinder und rund 4.500 Hunde.
1862 - Das Sexualleben auf dem oberbayerischen Land
München * Carl Kern beschreibt in seinem Buch „Oberbayerisches Sittenbild: Die Haberfeldtreiber“ das Sexualleben auf dem Land als „durchaus nicht nach den Ansprüchen einer sittlichen Warte geartet“.
Anders gesagt: „Wer eine hohe Idee von Sitteneinfalt und Sittenreinheit nach dem Oberlande mitbrächte, würde sich getäuscht finden. Die Geschlechter genießen einer zügellosen Freiheit im gegenseitigen Umgang, und das Kammerfenstern hat sich zur bedauerlichen Berechtigung verholfen.
Dass ein Brautpaar eine Familie von vier und fünf Kindern mit an den Traualtar bringt, ist weder eine Seltenheit, noch eine Schande. Sind die Leute aber verheiratet, dann tritt Ordnung und Mäßigung an ihren Sinn auf das Erwerben“.
Und weiter: „Weit häufiger als in den Städten sieht man auf dem Lande die ungleichartigsten Paare zusammengekoppelt, den 60-jährigen Greis mit dem 20-jährigen Weibe, oder die 50-jährige Frau mit dem 25-jährigen Manne, ohne dass diese Ehen zu solchen schauderhaften Experimenten werden, wie in den Städten“.
Ab 3 1862 - Franz Lenbach fertigt Kopien von Kunstwerken
München * Wieder zurück in München fertigt Franz Lenbach für den „Kunstsammler“ Adolf von Schack Kopien an.
Es folgen längere Reisen nach Italien, Basel, Paris und Madrid.
28. 3 1862 - Richard Wagner auch in Sachsen amnestiert
Sachsen * Richard Wagner wird auch in Sachsen amnestiert. Damit ist er kein politischer Flüchtling mehr.
1. 7 1862 - Die Ramersdorfer Lüften und der Kuisl wird von Ramersdorf abgetrennt
München-Haidhausen - Ramersdorf * Trotz der Gegenwehr der Ramersdorfer Gemeindeverwaltung wird das Gebiet Auf der Ramersdorfer Lüften und jenes am Kuisl endgültig von der Gemeinde Ramersdorf abgetrennt und Haidhausen zugeschlagen.
8 1862 - König Max II. beabsichtigt seine provisorische Ruhestätte einzurichten
Bogenhausen * König Max II. beabsichtigt, im Garten von „Schloss Neuberghausen“ für sich ein „Mausoleum“ und in der „Georgskirche“ seine provisorische Ruhestätte einzurichten.
Der Pfarrer von Bogenhausen argumentiert gegen diese Planungen, weshalb der König Abstand von dem Vorhaben nimmt.
18. 8 1862 - Ex-König Ludwig I. übereignet die Propyläen der Stadt München
München-Maxvorstadt * Ex-König Ludwig I. übereignet die Propyläen am Königsplatz - ein „Denkmal erhabener Nutzlosigkeit“ - der Stadt München „zur Pflege und Bewahrung“.
22. 8 1862 - Kronprinz Ludwig II. wird Hubertusritter
Königssee - Sankt Bartholomä * An seinem 17. Geburtstag wird Kronprinz Ludwig II. in der Kirche Sankt Bartholomä am Königssee in den Hubertusritterorden aufgenommen.
26. 8 1862 - Das Reiter-Standbild wird durch die Propyläen gezogen
München-Maxvorstadt * Das Reiter-Standbild, das Geschenk der Haupt- und Residenzstadt zum 70. Geburtstag des Ex-Königs Ludwig I., das sich heute am Odeonsplatz befindet, wird durch die Propyläen zu seinem Standort gezogen.
20. 9 1862 - Das Marienstift für verwaiste Töchter von Staatsdiener aller Klassen
Bogenhausen * Der Privat-Fidei-Kommiß König Max II. kauft das Anwesen des ehemaligen Schlosses Neuberghausen mit 14 Tagwerk Grund um 60.000 Gulden von Franz und Anna Wagenpfeil. Auf dem Areal soll das Marienstift für verwaiste Töchter von Staatsdiener aller Klassen errichtet werden, die sogenannte Beamten-Relikten-Anstalt.
24. 9 1862 - Otto von Bismarck wird Preußischer Ministerpräsident
Berlin * Der Preußische Gesandte in Paris, Otto von Bismarck, wird zum Preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Bismarck ist als hochkonservativ und als „personifizierte Konterrevolution“ gefürchtet.
Er verspricht König Wilhelm I. die Stabilisierung der königlichen Macht und die Niederwerfung der liberalen Parlamentsherrschaft. Ihm geht es aber um mehr. Bismarck versteht seine Ministerpräsidentschaft nur als Mittel zur Erreichung eines höheren Zieles. Er will die Oberherrschaft [= Hegemonie] Preußens in Deutschland - auf Kosten Österreichs.
22. 10 1862 - Griechenlands König Otto wird für abgesetzt erklärt
Athen * Während das griechische Königspaar durch Griechenland reist, wird das Athener Schloss von Aufständischen gestürmt und König Otto für abgesetzt erklärt.
23. 10 1862 - König Otto von Griechenland muss auf den griechischen Thron verzichten
Athen * König Otto von Griechenland muss auf den griechischen Thron verzichten und nach Bayern zurückkehren.
30. 10 1862 - Die Propyläen am Königsplatz werden dem Publikumsverkehr übergeben
München-Maxvorstadt * Die Propyläen am Königsplatz werden für den Publikumsverkehr freigegeben. Das ist exakt eine Woche, nachdem König Otto von Griechenland abdanken musste.
2. 11 1862 - Das abgesetzte griechische Königspaar trifft in München ein
München-Graggenau * Der abgesetzte König Otto von Griechenland trifft mit seiner Gemahlin Amalie in München ein. Sie wohnen hier zunächst in der Residenz.
29. 11 1862 - Gustav von Kahr wird in Weißenburg geboren
Weißenburg * Gustav von Kahr wird in Weißenburg geboren.
6. 12 1862 - Das Gasteig-Spital wird eingeweiht
München-Haidhausen * Das neuerbaute Gasteig-Spital - an der Stelle des ehemaligen Armenversorgungshauses - wird eingeweiht.
1863 - Die Kirchturmkuppel der „Johann-Baptist-Dorfkirche“ wird erneuert
München-Haidhausen * Die Kirchturmkuppel der Haidhauser „Sankt-Johann-Baptist-Kirche“ muss erneuert werden.
Trotz der 1.000 Gulden höheren Kosten entscheidet sich der Münchner Magistrat für die schlanke, bis heute bestehende „Spitzpyramide“.
1863 - Der „Münchner Männerturnverein“ will eine „Freiwillige Feuerwehr“ gründen
München * Der „Münchner Männerturnverein“ betreibt die Gründung einer „Freiwilligen Feuerwehr“.
Doch die bürgerlichen Entscheidungsträger lassen das Projekt erneut scheitern.
Bis zum Jahr 1863 - Die Gebäude des ehemaligen „Leprosenhauses“ werden abgerissen
München-Haidhausen * Nachdem die „Unheilbaren vom Spital am Gasteig“ nach Untergiesing gebracht worden waren, werden die Gebäude des ehemaligen „Leprosenhauses“ abgerissen.
Nur die Anstaltskirche „sancti Nycolai ad Lepros“ und die „Altöttinger Kapelle“ bleiben bestehen.
1863 - Joseph Anton von Maffei wird „lebenslänglicher Reichsrat
München * Die Ernennung zum „Adeligen lebenslänglichen Reichsrat der ersten Kammer des Landtags“ durch König Max II. ist der Höhepunkt der politischen Karriere von Joseph Anton von Maffei.
Damit gehört er dem höchsten bayerischen Gremium an und sitzt an der Spitze der Entscheidungsträger.
Dieses politische Engagement verschafft dem Geschäftsmann und dem gesamten „Geldadel“ seiner Zeit einen massiven Informationsvorsprung.
Mit diesem Insider-Wissen ist es vergleichsweise einfach, sein Geld in gewinnbringende Projekte und Immobiliengeschäfte zu investieren.
Von der „Karmelitenbrauerei“ in Regensburg über das „Gut Weichs“ bei Ohlstadt zu einer „Villa in Feldafing“ und einem weiteren Großanwesen in der Nähe von Iffeldorf, das „Gut Staltach“.
1863 - Der „Turnverein München“ eröffnet seine erste „Turnhalle“
München-Isarvorstadt * Aus dem „Münchner Turnverein“ wird der „Turnverein München“.
Die Vereinsmitglieder können der Eröffnung ihrer ersten „Turnhalle“ beiwohnen.
Sie befindet sich an der Jahnstraße in der „Isarvorstadt“.
1863 - Die Familie des Steyrer Hans zieht nach München
München - München-Maxvorstadt * Die Familie des Steyrer Hans nach München, wo sie die Gastwirtschaft „Wilhelm Tell“ führt.
Standesgemäß erlernt der Hans das „Metzgerhandwerk“ in einem Laden am Maximiliansplatz.
Zwischendurch holt er sich Ochsenviertel vom Haken und stemmt sie zur Ertüchtigung.
1863 - Im „Franzosenviertel“ ist der geschlossen bebaute Häuserblock bestimmend
München-Haidhausen * Eine neue „Münchner Bauordnung“ regelt das Bausystem derart, dass im „Ostbahnhofviertel“ der geschlossen bebaute Häuserblock bestimmend ist.
Das kommt den Bauspekulanten recht, da diese ohnehin kein Interesse an einer „offenen Bauweise“ haben.
Bis 1863 - Michael Zechmeisters schienenunabhängiges Verkehrsmittels ist am Ende
München - München-Au * Die erste Betriebszeit des von Michael Zechmeister eingerichteten, schienenunabhängigen Verkehrsmittels dauert lediglich von 1861 bis 1863.
Während dieser Zeit werden drei Linien eingerichtet.
Dabei erreicht die „klassische Strecke“ den Mariahilfplatz und damit das Herz der Au.
Giesing und Haidhausen - aber auch die anderen „Vorstädte“ - werden nicht angefahren.
1863 - Die evangelische Familie Kraemer aus Cannstadt kommt nach Giesing
München-Untergiesing - Cannstadt * Die evangelische Familie des Carl Kraemer aus Cannstadt in Württemberg kommt in das Giesinger Geviert, wo sie und ihre Nachkommen die „Kraemer‘sche Kunstmühle“ betreiben.
1863 - Die Seidenraupe ist in Bayern fast verschwunden
München * Die Seidenraupe ist in Bayern nahezu verschwunden.
1 1863 - Zukäufe für den „Zoologischen Garten“
München-Englischer Garten - Schwabing * Der „Großhandelsaufmann“ Benedikt Benedikt vergrößert durch Zukäufe sein für einen „Zoologischen Garten“ vorgesehenes Grundstück am Westrand des „Englischen Gartens".
Es hat jetzt die Größe von sechs Fußballfeldern und ist damit etwa ein Zehntel des heutigen „Tierparks Hellabrunn“.
Die landschaftliche Anlage des „Zoologischen Gartens“ übernimmt der königliche „Hofgärtner“ August Klein.
Die Bauten erstellt der Münchner Architekt Carl Schönhammer.
Als nächstes werden Tiere angeschafft, die das Münchner Klima vertragen müssten.
23. 2 1863 - Franz Stuck wird in Tettenweis geboren
Tettenweis * Franz Stuck wird in Tettenweis in Niederbayern geboren. Sein Vater ist der Müller Franz Stuck, seine Mutter Anna ist eine geborene Schuhwerk.
20. 3 1863 - Georgios I. wird neuer griechischer König
<p><strong><em>Athen</em></strong> * Die griechische Nationalversammlung wählt auf Empfehlung Englands den 17-jährigen Prinzen Wilhelm Georg von Dänemark zum neuen König. Er wird als Georgios I. gekrönt. </p>
23. 5 1863 - Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein - ADAV wird gegründet
Leipzig * In Leipzig wird der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein - ADAV gegründet und Ferdinand Lassalle zum Präsidenten gewählt.
6. 6 1863 - Das abgesetzte griechische Königspaar wohnt in Bamberg
Bamberg * Die ehemalige fürstbischöfliche Residenz in Bamberg wird der neue Wohnsitz für das abgesetzte griechische Königspaar Otto und Amalie.
13. 7 1863 - Die Hauptstreitmacht der Osmanen steht vor Wien
Wien * Die Hauptstreitmacht der Osmanen steht vor Wien.
25. 8 1863 - Kronprinz Ludwig II. wird volljährig
Schloss Hohenschwangau * Seinen 18. Geburtstag und damit seine Volljährigkeit feiert Kronprinz Ludwig II. auf Schloss Hohenschwangau.
9 1863 - Eduard Theodor Grützner kann ein Kunststudium in München beginnen
München * Mit Professor Karl von Pilotys Befürwortung kann Eduard Theodor Grützner ein Kunststudium in München beginnen.
9 1863 - Kronprinz Ludwig [II.] bezieht die „Kronprinzen-Appartements“
München-Graggenau * Kronprinz Ludwig [II.] bezieht mit seinen Erziehern die „Kronprinzen-Appartements“ im „Festsaalbau“ der „Residenz“.
20. 9 1863 - Kronprinz Ludwig II. leistet den Eid auf die Bayerische Verfassung
Berchtesgaden * Kronprinz Ludwig II. leistet in Berchtesgaden den Eid auf die Bayerische Verfassung.
Um den 10. 10 1863 - Eisenbahnstrecke über Mühldorf nach Österreich genehmigt
München-Kreuzviertel * Der Bayerische Landtag genehmigt die für die Stadtviertel des Münchner Ostens so wichtig werdende Eisenbahnstrecke über Mühldorf zur österreichischen Landesgrenze. Zeitgleich bewilligt er 15,4 Millionen Gulden für den Bau der Linie. Die genaue Streckenführung ist zu diesem Zeitpunkt allerdings an mindestens zwei Stellen noch offen.
- Einmal, weil auf österreichischer Seite die rund fünfzig Kilometer lange Teilstrecke von der Grenze in Richtung Linz nicht von der Eisenbahnverwaltung, sondern von einem privaten Konsortium aus Großgrundbesitzern, Unternehmern und Bankiers finanziert wird und
- sich als Alternativen der Grenzübergang bei Braunau oder das vierzig Kilometer innabwärts gelegene Schärding anbieten.
- Von einem dieser Grenzübergänge soll die Eisenbahn das oberösterreichische Neumarkt und darüber hinaus Linz erreichen.
- Die zweite ungeklärte Streckenführung war gleich am Beginn der Bahnlinie.
Die Generaldirektion der Kgl. Bayerischen Staatseisenbahnen - als zuständige Planungsbehörde - will jedenfalls die Strecke unmittelbar nach der Großhesseloher Brücke - der seit dem Jahr 1858 bestehenden Hauptverkehrsstrecke München - Holzkirchen - Rosenheim - Salzburg - abzweigen lassen. In einem weiten Bogen soll die Bahntrasse dann durch den Perlacher Forst, weiter über das Obergiesinger Feld, südlich an Haidhausen vorbeiführend das Stadtgebiet in östlicher Richtung verlassen. So jedenfalls sieht die grobe Planung lange Zeit aus.
Nun ist aber in Obergiesing, östlich der Tegernseer Landstraße, ein großes Neubaugebiet geplant. Und um zu verhindern, dass die Bahnverwaltung baureife oder möglicherweise schon bebaute Grundstücke teuer erwerben muss, verweigert das Ministerium des Inneren, das bei allen Bauvorhaben in der Haupt- und Residenzstadt ein Planungs- und Einspruchsrecht besitzt, ihre Zustimmung zum Wohnungsbau so lange, bis eine detaillierte Bahnplanung vorliegt. Erst danach will das Innenministerium den künftigen Baulinien zustimmen.
10. 11 1863 - Ein Hirtenbrief fordert die Haberer zum Aufgeben auf
München * Mit einem Hirtenbrief forderte Erzbischof Gregorius von Scherr die immer radikaler agierenden Haberer auf, „von einem Thun und Treiben abzulassen, das gegen die Grundsätze der Religion, der bürgerlichen Ordnung und aller Sittlichkeit verstößt“.
28. 11 1863 - Cosima und Richard werden ein Liebespaar
Berlin * Cosima von Bülow und der 24 Jahre ältere Richard Wagner werden ein Liebespaar. Bei einer gemeinsamen Spazierfahrt durch Berlin gestehen sie sich ihre Zuneigung. Cosima schreibt: „Unter Tränen und Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig gegenseitig anzugehören.“
28. 12 1863 - Kronprinz Ludwig II. macht einen Rückzieher
München * Kronprinz Ludwig II. will an Richard Wagner schreiben, setzt seinen Entschluss aber erst vier Monate später in die Tat um.
1864 - Haidhauser Bauerndynastie Rottenhuber stirbt aus
München-Haidhausen * Die Haidhauser Bauerndynastie der Familie Rottenhuber auf dem „Zeugnerhof“ stirbt aus.
Die Grundstücke werden Zug um Zug verkauft.
1864 - „Kostümverbot“ in Frankreich zum „Schutz der Theater“
Paris * Das „Kostümverbot“ in Frankreich wird zum „Schutz der Theater“ polizeilich überwacht.
1864 - Joseph Gungl übersiedelt von Wien nach München
Wien - München * Joseph Gungl übersiedelt von Wien nach München und gibt mit seinem „Orchesterverein Wilde Gungl“ bis 1876 regelmäßig Konzerte und Bälle „á la Gungl“.
1864 - Die 500. Lokomotive aus der „Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Die 500. Lokomotive mit dem Namen „Hirschau“ (?) verlässt die „Maffei'sche Lokomotiven-Fabrik“.
1864 - Das Haus in der Reichenbachstraße 13 wird gebaut
München-Isarvorstadt * Das Haus in der Reichenbachstraße 13, in dem sich heute die „Deutsche Eiche“ befindet, wird erbaut.
1864 - Papst Pius IX. erlässt eine „Enzyklika“ aller „zeitgenössischen Irrlehren“
Rom-Vatikan * Papst Pius IX. erlässt - wieder ohne Konzil - die „Enzyklika Quanta Cura“, den sogenannten „Syllabus“, der eine Aufstellung von 80 „zeitgemäßen Irrlehren“ enthält.
Dazu gehören nicht nur der „Pantheismus“, Naturalismus“ und „Rationalismus“, sondern vor allem der „Sozialismus“, Kommunismus“ sowie „irrige Anschauungen“ über die „Natur der Ehe“ und das „Verhältnis von Staat und Kirche“.
Verurteilt wird auch der „ungezügelte Fortschrittsglaube“ und der „Liberalismus“, der die „Trennung von Staat und Religion“ vorsieht.
Die „Kurie“ sieht ihren Feind in der „modernen Welt“.
Deshalb ist sie gegen die Glaubensfreiheit, Gewissens-, Kult-, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit sowie die Demokratie.
Im Gegensatz dazu verlangt der Papst im „Syllabus“ die Oberhoheit der Kirche über die staatliche Gewalt.
Auf Kritik an der „römisch-katholischen Kirche“ und auf „Individualismus“ antwortet sie mit dem Anspruch, dass nur sie selbst auf Erden die Sache Gottes „ausschließlich, alleinig und entscheidend“ vertreten könne.
Wer zu dieser Kirche nicht gehören will, der muss sie eben verlassen.
Besonders in Deutschland entbrennt daraufhin eine Auseinandersetzung, in deren Folge es zum sogenannten „Kulturkampf“ kommt.
Um 1864 - Neubau der Giesinger Heilig- Kreuz-Kirche
München-Obergiesing * Die neue Heilig- Kreuz-Kirche wird nach Plänen von Georg von Dollmann gebaut. Den entscheidenden Einfluss auf die architektonische Gestaltung des Kirchenneubaus übt jedoch der Ex-König Ludwig I. aus, der achtzehn Jahre zuvor seiner Ämter enthoben worden ist.
Er ist nicht nur während der Planungsphase und des ersten Bauabschnitts der potenteste Finanzier, sondern bestimmt auch den Architekten: den königlich bayerischen Hofbaurat und Schwiegersohn von Leo von Klenze, Georg von Dollmann. Dieser hatte für den pensionierten König den Ausbau der assyrischen Abteilung in der Glyptothek und einen großen Teil der Befreiungshalle ausgeführt. Dollmann ist Betriebsingenieur der kgl. bay. Staatsbahn und wirkt als Baumeister König Ludwigs II. bei der Projektierung seiner Schlösser mit.
1. 1 1864 - Die selbstständige Gemeinde Ramersdorf wird eingemeindet
München-Ramersdorf * Durch die Abtrennung der Ramersdorfer Lüften und das Gebiet am Kuisl wird Ramersdorf als selbstständige Gemeinde zu klein. Die 600 Bewohner der bislang selbstständigen Gemeinde Ramersdorf werden deshalb samt einer Fläche von 121 Hektar nach München eingemeindet.
27. 1 1864 - Leo von Klenze stirbt in München
München * Leo von Klenze stirbt in München.
3 1864 - Die Geschichte der „Sozialdemokratie“ beginnt nun auch in Bayern
Augsburg * Eine Gruppe Augsburger Arbeiter tritt dem 1863 in Leipzig gegründeten „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein - ADAV“ bei.
Damit beginnt in Bayern die Geschichte der „Sozialdemokratie“, denn der „ADAV“ ist die erste selbstständige deutsche Arbeiterpartei.
1. 3 1864 - Prinz Otto wird ins Kadettenkorps eingeführt
München * Prinz Otto wird zur militärischen Ausbildung ins Kadettenkorps eingeführt.
10. 3 1864 - König Max II. stirbt nach kurzer Krankheit
<p><strong><em>München - München-Kreuzviertel</em></strong> * König Max II. stirbt nach kurzer Krankheit. Seine Grabstätte befindet sich in der Fürstengruft der Theatinerkirche in München.</p> <p>Ihm folgt sein 18-jähriger Sohn Ludwig II. auf dem Thron. Er wird noch am gleichen Tag zum König proklamiert.</p>
11. 3 1864 - Ludwig II. leistet seinen Eid als König
München * Nach dem Tod seines Vaters, König Max II., wird Kronprinz Ludwig II. zum König der Bayern. Um 10 Uhr vormittags leistet er seinen Eid auf die Verfassung.
14. 3 1864 - König Max II. wird bestattet
<p><strong><em>München-Kreuzviertel - München</em></strong> * Der verstorbene König Max II. wird bestattet. König Ludwig II. tritt erstmals in der Öffentlichkeit auf.</p>
28. 3 1864 - Neuausstattung der Königswohnung und des Wintergartens
München-Graggenau * König Ludwig II. beauftragt die Neuausstattung der Königswohnung in der Residenz. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um die Anschaffung neuer Möbel und um Tapeziererarbeiten. Gleichzeitig werden die Planungen für einen neuen Wintergarten in die Wege geleitet.
Um 4 1864 - Das „Maillot-Schlösschen“ wird zum „Zoo-Restaurant“
München-Englischer Garten - Schwabing * Das „Maillot-Schlösschen“ wird umgebaut und als „Restaurant“ für den „Zoologischen Garten“ am Westrand des „Englischen Gartens“ genutzt.
8. 4 1864 - Richard Wagner: „Ein Licht muss sich zeigen, sonst ist's aus!“
<p><strong><em>Stuttgart</em></strong> * Der geniale Musiker Richard Wagner schreibt an seinen Freund Peter Cornelius: <em>„Ein Licht muss sich zeigen: Ein Mensch muss mir erstehen, der jetzt energisch hilft. Ein gutes, wahrhaft hilfreiches Wunder muss mir jetzt begegnen; sonst ist's aus!“</em></p>
14. 4 1864 - Kabinettssekretär Pfistermeister muss Richard Wagner ausfindig machen
<p><strong><em>München</em></strong> * Eine der ersten Taten des jungen Bayernskönigs Ludwig II. ist die Berufung Richard Wagners nach München. Kabinettssekretär Franz Seraph von Pfistermeister muss sich - nur einen Monat nach Ludwigs Thronbesteigung - mit dem schwierigen Auftrag aus München abreisen, den verehrten Musiker ausfindig zu machen und ihn zum König zu bringen.</p> <p>Der hoch verschuldete Komponist ist - wieder einmal pleite - mit unbekanntem Ziel abgereist, denn in Wien und der Schweiz verfolgen ihn die Gläubiger so sehr, dass er sich kaum mehr auf die Straße traut. Nach über zwei Wochen gelingt es Pfistermeister, den europaweit gesuchten Schöpfer wichtiger Musikwerke in Stuttgart aufzuspüren.</p>
21. 4 1864 - Max Weber, der spätere Soziologe, wird in Erfurt geboren.
Erfurt * Max Weber, der spätere Soziologe, Ökonom, Jurist, Historiker und politische Analyst, wird - in großbürgerlichen Verhältnissen - in Erfurt geboren.
26. 4 1864 - Auguste Ferdinande stirbt
München - München-Kreuzviertel * Auguste Ferdinande, die Ehefrau des späteren Prinzregenten Luitpold, eine geborene Erzherzogin von Österreich und Prinzessin von Toskana, stirbt in München.
Sie wird in der „Gruft der Theatinerkirche" beigesetzt.
5 1864 - Richard Wagner ist ohne Hoffnung
Stuttgart * Richard Wagner ist ohne Hoffnung und spricht in einem Brief an Mathilde Maier sogar von Selbstmord: „Ich fürchte, nun ist's mit Allem aus. [...] So tief zerstreut und lebensmüde war ich noch nie“.
3. 5 1864 - „Kabinettssekretär“ Pfistermeister trifft in Stuttgart auf Richard Wagner
Stuttgart * „Kabinettssekretär“ Franz Seraph von Pfistermeister trifft in Stuttgart auf Richard Wagner.
Er überreicht ihm Brief, Bild und Ring des bayerischen Königs Ludwig II..
Gemeinsam reisen sie noch am gleichen Tag nach München.
4. 5 1864 - „Ich will Sie für vergangenes Leid entschädigen“
München * Am Nachmittag treffen der Komponist Richard Wagner und der fast dreißig Jahre jüngere Bayernkönig Ludwig II. das erste Mal zusammen. Mit der Anstellung am bayerischen Hof endet für Wagner die Zeit der Schulden und seine schier ausweglose finanzielle Notlage.
König Ludwig II. verspricht Richard Wagner in einem Brief: „Seien Sie überzeugt, ich will alles tun, was irgend in meinen Kräften steht, um Sie für vergangenes Leid zu entschädigen, die niedrigen Sorgen des Alltagslebens will ich von Ihrem Haupte auf immer verscheuchen, die ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten, damit Sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können!“
Die Großzügigkeit des Wittelsbachers gegenüber den von ihm vergötterten Komponisten kennt keine Grenzen:
- Der Musiker erhält ein Jahresgehalt von 4.000 Gulden, was dem Gehalt eines „Ministerialrats“ nach achtzehn Dienstjahren entspricht.
- Als „öffentlichen Beweis der königlichen Freundschaft“ erhält Richard Wagner vom bayerischen Regenten die Gartenvilla an der Brienner Straße 18 (heute Haus Nr. 37) mietfrei gestellt.
- Und er bekommt darüber hinaus 16.000 Gulden, womit er seine in Wien hinterlassenen Schulden begleichen kann.
- Und weil das immer noch nicht reicht, verlangt der Neu-Münchner einen Vorschuss von 30.000 Gulden für die Fertigstellung des „Rings der Nibelungen“, obwohl er die „Partituren“ bereits anderweitig verkauft hat.
- Er bekommt den Vorschuss, wenn auch nur in Raten.
- Daneben eröffnet der König dem Musiker die Aussicht, für sein „unvergleichliches Werk“ - wie es der König nennt - eine eigene Spielstätte errichten zu können.
10. 5 1864 - Ein Jahresgehalt von 4.000 Gulden für Richard Wagner
München * König Ludwig II. weist sein Hofsekretariat an, Richard Wagner ein Jahresgehalt von 4.000 Gulden zu bezahlen. Um keine „Neiddiskussion“ hochkommen zu lassen, wird gegenüber der Öffentlichkeit nur ein Jahresgehalt von 1.200 Gulden angegeben. Zusätzlich erhält der Musiker ein ganzes Jahresgehalt „zur Bestreitung der Übersiedelung zur Verfügung“ gestellt.
14. 5 1864 - Richard Wagner bezieht ein Landhaus in Kempfenhausen
Kempfenhausen * Richard Wagner bezieht das Landhaus des Gastwirts Pellet in Kempfenhausen am Starnberger See, das Ludwig II. für ihn gemietet hat. Fast drei Wochen lang trifft er täglich mit dem König auf Schloss Berg zusammen. Der Aufenthalt dauert bis zum 27. September.
22. 5 1864 - Ein Königsporträt für Richard Wagner
München * König Ludwig II. schenkt Richard Wagner zu dessen 51. Geburtstag sein von Friedrich Dürck gemaltes Porträt in Generalsuniform.
25. 5 1864 - Richard Wagner bleibt am Starnberger See
Starnberger See * Als König Ludwig II. nach München zurückkehrt, bleibt Richard Wagner bis Oktober am Starnberger See, fährt aber öfter zu Audienzen nach München.
26. 5 1864 - Prinz Otto wird zum Oberleutnant befördert
München * Prinz Otto wird von seinem Bruder - König Ludwig II. - zum Oberleutnant befördert.
3. 6 1864 - Der Nibelungen-Gang in der Residenz entsteht
München-Graggenau * König Ludwig II. gibt den Auftrag für einen repräsentativeren offiziellen Zugang zu seiner Wohnung im nordwestlichen Pavillon des Festsaalbaues. Dazu müssen Bedienstetenwohnungen entfernt werden. Der dadurch entstehende 31 Meter lange Gang [= Nibelungen-Gang] mit 14 Fenstern zur Theatinerstraße wird ausgebaut.
6. 6 1864 - Besprechung zur Gründung eines Konsumvereins
München-Hackenviertel * Im Kreuzbräu an der Brunnstraße findet eine Besprechung zur Gründung eines Konsumvereins, also eines Vereins zur möglichst billigen Beschaffung von Lebensmitteln, statt. Man diskutiert dort die Erfahrungen aus anderen Städten und schlägt die Schaffung eines Gründungskomitees vor.
10. 6 1864 - Richard Wagner bezahlt seine Schulden
München - Wien * Richard Wagner fährt nach Wien, um dort seine Schulden zu begleichen. Dazu werden ihm aus der Kabinettskasse 16.000 Gulden zur Verfügung gestellt. Mit einem Schlag ist der Musiker von seinen Geldsorgen befreit.
11. 6 1864 - Richard Strauss wird in München geboren
München-Hackenviertel * Der Komponist Richard Strauss wird in München geboren.
11. 6 1864 - Über den Nutzen der Einrichtung Konsumverein
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten schreiben über den Nutzen der Einrichtung Konsumverein: „Er hat die ganz dieselbe Wirkung für den Arbeiter, Handwerker, Beamten usw. wie eine Lohnerhöhung. Diesen wichtigen Moment können wir unseren Lesern nicht eindringlich genug ans Herz legen.“
29. 6 1864 - Cosima von Bülow trifft bei Richard Wagner ein
Kempfenhausen am Starnberger See * Cosima von Bülow trifft mit ihren beiden Töchtern Daniela und Blandine bei Richard Wagner zur Sommerfrische im Landhaus Pellet in Kempfenhausen am Starnberger See ein.
7. 7 1864 - Familienzusammenführung am Starnberger See
Starnberger See * Hans von Bülow, Cosimas Ehemann, trifft ebenfalls am Starnberger See ein.
8. 7 1864 - Johann Valentin Fey wird als Bürger und Tapezierer aufgenommen
München - München-Au * Durch Beschluss des Magistrats wird Johann Valentin Fey, der spätere Vater von Karl Valentin, „als Bürger und Tapezierer dahier aufgenommen“. Das kostet dem Neubürger 75 Gulden Bürgeraufnahmsgebühren.
11. 7 1864 - Einer der ersten Konsum-Organisationen Deutschlands
München * Die I. Ordentliche Generalversammlung des Konsumvereins von 1864 findet statt. Er ist einer der ersten Konsum-Organisationen Deutschlands. Der Mitgliedsbeitrag wird auf 4 Gulden festgesetzt. Das erste Lager eröffnen die Gründungsmitglieder am Frauenplatz.
22. 7 1864 - Hochschnellende Mitgliederzahlen im Konsumverein
München * Nur elf Tage nach der Geschäftseröffnung des Konsumvereins von 1864 ist die Zahl der Mitglieder auf 400 gestiegen.
„Sie [die Konsumvereine] sind daher geradeso für die Reichen wie für die Unbemittelten. Jene ziehen aus ihnen, weil sie am meisten verbrauchen, verhältnismäßig den größten Gewinn, während wieder die Unbemittelten dadurch, daß sie einem Verein mit großen Warenumsatz angehören, die Waren für den möglichst billigen Preis bekommen, also auch bei kleinen und kleinstem Bedarf die höchst möglichen Ersparnisse bei bester Qualität der Waren machen“.
25. 7 1864 - Wagner besucht König Ludwig II. auf Schloss Hohenschwangau
Schloss Hohenschwangau * Richard Wagner besucht König Ludwig II. an dessen 19. Geburtstag auf Schloss Hohenschwangau“
25. 8 1864 - Grundsteinlegung für das spätere Gärtnerplatz-Theater
München-Isarvorstadt * Der Grundstein für das Münchner Volkstheater, dem späteren Gärtnerplatz-Theater wird gelegt.
1. 10 1864 - Beträchtliche Gehaltserhöhung für Richard Wagner
München * Richard Wagners Gehalt erhöht sich stufenweise auf 8.000 Gulden.
2. 10 1864 - König Ludwig II. besucht das Münchner Oktoberfest
München-Theresienwiese * König Ludwig II. besucht in Begleitung seines Bruders Prinz Otto das Münchner Oktoberfest.
Ab 3. 10 1864 - Richard Wagner wohnt im Hotel Bayerischer Hof
München-Maxvorstadt - München-Kreuzviertel * Während sein Haus in der Brienner Straße 21 entsprechend seinen Wünschen und Vorstellungen eingerichtet wird, wohnt Richard Wagner im Hotel Bayerischer Hof.
5. 10 1864 - Wagners Huldigungsmarsch für den Märchenkönig
München-Graggenau * Unter den Fenstern der königlichen Wohnung in der Münchner Residenz wird der von Richard Wagner komponierte „Huldigungsmarsch“ zur Aufführung gebracht. Die Uraufführung dieses Werkes war ursprünglich am 25. August 1864, dem 19. Geburtstag des Märchenkönigs in Schloss Hohenschwangau geplant, musste dann aber aus verschiedenen Gründen vertagt werden.
7. 10 1864 - Vollendung des „Ring des Nibelungen“ innerhalb von drei Jahren
München * König Ludwig II. vereinbart mit Richard Wagner die Vollendung und Aufführung des „Ring des Nibelungen“ innerhalb der nächsten drei Jahre.
12. 10 1864 - Richard Wagner bezieht seine Villa in der Brienner Straße
München-Maxvorstadt * Der Komponist Richard Wagner schlägt sein Domizil in der von König Ludwig II. gemieteten Villa in der Brienner Straße 21 (heute 37) auf. Der bislang total verschuldete Komponist richtet sich in dem prachtvollen Haus wie ein „orientalischer Grandsigneur“ ein. Er bleibt dort bis zum 10. Dezember 1865.
18. 10 1864 - Wagners „Ring der Nibelungen“ wird Eigentum des Bayernkönigs
München * Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ geht in das Eigentum des Bayernkönigs über.
Ab 11 1864 - Michael Echter malt den „Nibelungen-Gang“ aus
München-Graggenau * Der „Nibelungen-Gang“ bezeichnete neue Zugang zu den „Königsappartements“ König Ludwigs II. in der „Residenz“ wird von dem Maler und Graphiker Michael Echter mit dreißig Fresken aus dem Richard-Wagner-Zyklus „Der Ring der Nibelungen“ ausgemalt.
Die Arbeiten dauern bis 1866 an.
1. 11 1864 - 5.000 Gulden Jahresgehalt für Richard Wagner
München * Richard Wagners Jahresgehalt beträgt aktuell 5.000 Gulden.
26. 11 1864 - En großes steinernes Theater für Wagners Werke
München-Haidhausen * Dem Bayernkönig Ludwig II. schwebt ein monumentales Bauwerk für ein Festspielhaus vor. Deshalb schreibt der Monarch an Wagner, er habe „den Entschluß gefaßt, ein großes steinernes Theater erbauen zu lassen, damit die Aufführung des Ringes der Nibelungen eine vollkommene wäre“.
König Ludwigs Vorstellungen eines Richard-Wagner-Festspielhauses in München werden jedoch von seiner unmittelbaren Umgebung und von einem großen Teil der Bevölkerung mit Skepsis beobachtet, da der prachtvolle Monumentalbau nur an wenigen Festspieltagen benutzt worden wäre. Das Interesse der Zeitzeugen am weiteren Verlauf von Gottfried Sempers Planungen ist deshalb ebenso groß wie widersprüchlich.
4. 12 1864 - Uraufführung von „Der Fliegende Holländer“
München * „Der fliegende Holländer“ kommt, von Richard Wagner selbst dirigiert, in München erstmals zur Aufführung.
Mit diesem Werk und der gezeigten Inszenierung gelingt es Wagner, sich beim Münchner Publikum mit großem Erfolg einzuführen. Außerdem ist diese „Holländer“-Aufführung das einzige große und damit herausragende Ereignis des Münchner Opernspielplans in diesem Jahr.
13. 12 1864 - Gottfried Semper plant ein Theater für Wagners Musikdramen
München - Dresden * Durch einen Brief Richard Wagners erfährt der Architekt Gottfried Semper von der Aussicht, „ein großes Theater im edelsten Stile“ für Wagners Musikdramen in der bayerischen Haupt- und Residenzstadt ausführen zu können.
Drei Tage später zeichnet dieser eine erste Skizze und reist danach umgehend nach München, um die genaueren Bedingungen zu erfahren. Doch dort sind die Vorstellungen noch nicht sehr weit gediehen, nicht einmal ein Bauplatz ist im Gespräch.
29. 12 1864 - Mündlicher Planungsauftrag für Gottfried Semper
München-Graggenau * König Ludwig II. empfängt den Architekten Gottfried Semper und gibt ihm einen mündlichen Planungsauftrag für ein neues Opern- und Festspielhaus. Man fasst ein Terrain südlich des seit dem Jahr 1857 im Bau begriffenen Maximilianeums ins Auge.
Da Richard Wagner aber keine sechs Jahre bis zur Fertigstellung des neuen Theaters warten will, überredet er den König, für die Zwischenzeit noch ein provisorisches, hölzernes Theater im Glaspalast zu errichten, um - so die Begründung - nach Abschluss des „Nibelungen Rings“ im Sommer 1867 sofort mit den Aufführungen beginnen zu können.
Doch damit wäre die Nutzung des Glaspalastes als Ausstellungsort massiv eingeschränkt worden, weshalb nun zusätzliche Gegner des Projekts auf den Plan treten.
31. 12 1864 - 42.333 Gulden und 20 Kreuzer für Richard Wagner
München * Ohne Berücksichtigung der Kosten für die Sachgeschenke von Ludwig II. an Wagner betragen die im Jahr 1864 getätigten baren Zahlungen aus der königlichen Kabinettskasse an Richard Wagner insgesamt 42.333 Gulden und 20 Kreuzer.
Dem König stehen etwa 300.000 Gulden zur freien Verfügung.
31. 12 1864 - Der Konsumverein München von 1864 hat 1.140 Mitglieder
München * Der Konsumverein München von 1864 kann bereits 1.140 Mitglieder verzeichnen.
31. 12 1864 - Im Lehel leben 11.500 Einwohner
München-Lehel * Im Lehel leben 11.500 Einwohner.
1865 - Johann Valentin Fey heiratet Elisabeth Sigl, geb. Falk
München-Au * Der aus Darmstadt kommende „Tapeziermeister“ Johann Valentin Fey heiratet die 25-jährige, kinderlose Hausbesitzerstochter und „Tapeziererswitwe“ Elisabeth Sigl, geborene Falk.
Das ermöglicht ihm, bei seinem Schwiegervater als „Compagnon der Firma Falk & Fey“ einzusteigen.
1865 - Hubert Herkomer besucht die „Akademie der Bildenden Künste“
München-Kreuzviertel * Hubert Herkomer besucht die „Akademie der Bildenden Künste“ in München.
1865 - Die Gemeinde Bogenhausen will eingemeindet werden
Bogenhausen * Die Gemeinde Bogenhausen stellt erstmals den Antrag auf Eingemeindung nach München.
1865 - Die „Beamten-Relikten-Anstalt“ wird zunächst als „Militärspital“ benutzt
Bogenhausen * Nach der Fertigstellung des „Beamten-Relikten-Anstalt“ in Bogenhausen wird es wegen der stattfindenden Kriege zunächst als „Militärspital“ benutzt.
1865 - Der „Brauer“ Bathasar Füger erwirbt die „Brauerei zur Schwaige“
München-Haidhausen * Der „Brauer“ Bathasar Füger erwirbt die „Brauerei zur Schwaige“ in Haidhausen.
Sie wird seither auch „Fügerbräu“ genannt.
1865 - Die „Maximiliansstiftung für kunstgewerbliche Ausbildung“ wird gegründet
München * Die „Maximiliansstiftung für kunstgewerbliche Ausbildung“ wird gegründet.
Sie vergibt sowohl Schul- als auch Reisestipendien.
1865 - Ein zweiter „Galeriebau“ für Adolf Friedrich von Schack
München-Maxvorstadt * Nachdem das neue „Galeriegebäude“ im Garten von Adolf Friedrich von Schack an der Brienner Straße 19 schon wieder zu klein geworden war, lässt er sich von Heinrich von Hügel einen zweiten „Galeriebau“ erstellen.
1865 - Bitte um Verkürzung der täglichen Arbeitszeit
<p><em><strong>Augsburg</strong></em> * Arbeiter einer Augsburger Textilfabrik wenden sich an König Max II. mit der Bitte um Verkürzung der täglichen Arbeitszeit um eine Stunde. Begründet wird die Bitte damit, dass zahlreiche Arbeiter in den umliegenden Dörfern wohnen. </p> <p><em>„Um nun rechtzeitig an ihrer Arbeit einzutreffen, sind diese Arbeiter genötigt, morgens um drei Uhr aufzustehen. Um fünf Uhr morgens beginnt diese Arbeit und dauert bis abends sieben Uhr. Bis die Arbeiter nach Hause kommen, wird es neun Uhr und bis sie zur Nacht gegessen und die Ruhestätte aufsuchen können, wird es zehn Uhr. So bleibt diesen Arbeitern, wovon die Hälfte nKinder und Weibspersonen sind, nur fünf Stunden zur nötigen Ruhe.“</em></p>
Seit 1865 - „Lehrstühle für Hygiene“ an den bayerischen „Hochschulen“
München * An den bayerischen „Hochschulen“ werden „Lehrstühle für Hygiene“ eingerichtet.
1865 - Das „Montgelas-Palais“ erhält ein weiteres Stockwerk aufgesetzt
München-Kreuzviertel * Zwischen 1865 und 1870 wird dem „Montgelas-Palais“ ein weiteres Stockwerk aufgesetzt.
2 1865 - Bayerische Zeitungen feinden Richard Wagner an
München * Die Anfeindungen einiger bayerischer Zeitungen gegenüber Richard Wagner und seiner „Verschwendungssucht“ werden immer massiver.
3 1865 - Richard Wagners Auswanderungspläne nach Italien
München - Augsburg * Richard Wagner ist in München Anfeindungen ausgesetzt, die in ihm Abwanderungspläne in Richtung Italien reifen lassen.
Die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ veröffentlicht einen Artikel von Oskar Redwitz, der in einer Pressekampagne gipfeln sollte. Unter dem Titel „Richard Wagner und die öffentliche Meinung“ wird schon damals die Verschwendungssucht des Komponisten und Dichters angeprangert.
5. 3 1865 - Hans von Bülow dirigiert die „Tannhäuser“-Aufführung
München * Die „Tannhäuser“-Aufführung wird von Hans von Bülow dirigiert. Damit wird der Münchner Generalmusikdirektor Franz Lachner ausgebootet.
23. 3 1865 - Richard Wagner erstellt ein Konzept für eine „Deutsche Musikschule“
München * Richard Wagner erstellt ein Konzept für eine „Deutsche Musikschule“ in der er
- die Ausbildung dramatischer Sänger für die Aufführung theatralischer Werke,
- einen neuen Gesangsstil,
- dazu opernreformatorische Aspekte und
- verschiedene darauf aufbauende Ausbildungsinhalte
in den Mittelpunkt der Wissensvermittlung stellt.
5. 4 1865 - Ludwig und Malvina Schnorr von Carolsfeld treffen in München ein
München * Ludwig und Malvina Schnorr von Carolsfeld treffen zu Proben von „Tristan und Isolde“ in München ein.
10. 4 1865 - Cosima von Bülow und Richard Wagners Tochter Isolde wird geboren
Kempfenhausen am Starnberger See * Im Landhaus Pellet in Kempfenhausen am Starnberger See wird Isolde, die Tochter von Cosima von Bülow und Richard Wagner geboren.
2. 5 1865 - Es kommt zur „Schweinehunde-Affäre“
München * Es kommt zur „Schweinehunde-Affäre“, nachdem Hans von Bülow bei einer der letzten Proben zu „Tristan und Isolde“ äußert: „Nun ja, was liegt denn daran, ob dreißig Schweinehunde mehr oder weniger hereingehen!“.
Bülow will eigentlich nur durch die Entfernung von Sperrsitzen eine Vergrößerung des Orchesterraumes erzielen.
Doch er vergreift sich derart im Ton, dass ihn sogar König Ludwig II. in einem persönlichem Brief rügt.
Auch die bayerische Presse ist empört und kocht die Emotionen hoch.
9. 5 1865 - Hans von Bülow veröffentlicht eine Gegendarstellung
München * Hans von Bülow veröffentlicht eine Gegendarstellung. In dieser stellt er klar, dass es sich bei dem von ihm im Ärger geäußerten Satz keinesfalls um eine „Gesammt-Verunglimpfung des gebildeten Münchner Publikums“ handelt, sondern er damit jene Theaterbesucher meint, „welche verdächtig sind, an den in Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister [Richard Wagner] gesponnenen Verleumdungen und Intrigen Teil genommen zu haben“.
Doch trotz aller Entschuldigungen bleibt die „Schweinehunde-Affäre“ an Hans von Bülow haften. Der Neue Bayerische Courier bezieht am schärfsten Stellung gegen Hans von Bülow und wiederholt am 9., 11., 12. und 13. Mai: „Hans v. Bülow ist noch hier“.
11. 5 1865 - „Generalprobe“ der Richard-Wagner-Oper „Tristan und Isolde“
München-Graggenau * Mit 600 geladenen Gästen findet im „Hof- und Nationaltheater“ die „Generalprobe“ der Richard-Wagner-Oper „Tristan und Isolde“ statt.
Sie wird von den Beteiligten als inoffizielle „Uraufführung“ gewertet.
15. 5 1865 - Die Premiere von Tristan und Isolde muss abgesagt werden
München * Die ursprünglich für den 15. Mai 1865 angesetzte Premiere von Tristan und Isolde muss wegen „plötzlich eingetretener Heiserkeit“ von Frau Malvina Schnorr von Carolsfeld abgesagt werden.
Wieder schlägt die Stimmung um, was in Josephine Kaulbachs Brief deutlich zum Ausdruck kommt: „Was soll ich Ihnen noch erzählen? von unseren Freunden? oder von der Zukunftsmusik, oder von den Schweinehunden des Herrn von Bülow?
Die letztere Geschichte hat eine größere Bedeutung gewonnen, wie man sich's erwartete; seit der Lola-Geschichte waren die Münchner nicht mehr so in Wuth. (...) Ich sage Ihnen, es ist toll, wie das hier getrieben wird, für und gegen Wagner. - Die Fama wächst zu einem hundertköpfigen Ungeheuer, der Wagner-Cultus wird zu einem Ekel; der junge König an der Spitze tauft alles, was ihn umgibt, in Tristan und Isolde um“.
8. 6 1865 - Im Isar-Vorstadt-Theater wird „Triftanderl und Süßholde“ aufgeführt
München-Isarvorstadt * Im Isar-Vorstadt-Theater wird eine Parodie auf Tristan und Isolde unter dem Titel „Triftanderl und Süßholde“ aufgeführt. Die Titelfigur Triftanderl ist ein Floßknecht von Ammerland, Süßholde eine reiche Bäckerstochter aus Wolfratshausen. Schwerpunkte bei diesem Stück sind:
„Dramatische Verslein mit Worten ohne Melodie, gegenwärtige Parodie von einer Zukunfts-Oper in 3 Aufzügen, wo darüber viel losgezogen wird, und einem Vorspiel des Vorspielers, von Richard, Wagnermeister und Stückschreiber, sowie musikalischen Dramatisirer.“
10. 6 1865 - Richard Wagners Tristan und Isolde feiert Premiere
München-Graggenau * Im Hof- und Nationaltheater wird Richard Wagners „Tristan und Isolde“ uraufgeführt. Auch hier führt Hans von Bülow den Dirigentenstab. Die Oper ist ein weiterer Höhepunkt im Leben des Komponisten.
Die Frankfurter Rundschau schreibt darüber:„Das schönste und erhabenste Werk, welches die Welt besitzt“. Dagegen meint Der Volksbote, eine bayerische Provinzzeitung: „Musik ein Tollsinn, Text ein Unsinn, das Ganze ein Irrsinn“. Doch der Märchenkönig ist wieder einmal begeistert.
Wegen der „Schweinehunde-Affäre“ und den deshalb befürchteten Ausschreitungen befindet sich die Polizei im Zuschauerraum.
13. 6 1865 - Die zweite Aufführung von „Tristan und Isolde“
München-Graggenau * Die zweite Aufführung von „Tristan und Isolde“ im Hof- und Nationaltheater.
19. 6 1865 - „Tristan und Isolde“ wird zum dritten Mal aufgeführt
München-Graggenau * „Tristan und Isolde“ wird im Hof- und Nationaltheater zum dritten Mal aufgeführt. König Ludwig II. wohnt der Aufführung nicht bei, da er die Anwesenheit seines Onkels und Taufpaten Otto, des entthronten Königs von Griechenland, und seines Onkels Luitpold, dem späteren Prinzregenten, in seiner Loge als störend empfindet.
1. 7 1865 - König Ludwig II. ordnet einen 4. Aufführungstermin an
München-Graggenau * Da König Ludwig II. die Aufführung von „Tristan und Isolde“ am 19. Juni nicht miterleben wollte, ordnet er einen vierten Termin an. Er hatte die Anwesenheit seines Onkels und Taufpaten Otto, des entthronten Königs von Griechenland, und seines Onkels Luitpold, dem späteren Prinzregenten, in seiner Loge als störend empfunden.
Für die Zusatzaufführung muss Ludwig II. extra beim sächsischen König eine Verlängerung des Urlaubs für das Ehepaar Schnorr von Carolsfeld erwirken.
9. 7 1865 - „Der fliegende Holländer“ mit Ludwig Schnorr von Carolsfeld
München * Die Richard-Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ mit Ludwig Schnorr von Carolsfeld als Erik wird in München aufgeführt. König Ludwig II. fährt zu jeder Aufführung im Sonderzug von Starnberg nach München und wieder zurück.
21. 7 1865 - Ludwig Schnorr von Carolsfeld stirbt plötzlich und unerwartet
Dresden * Ludwig Schnorr von Carolsfeld stirbt plötzlich und unerwartet in Dresden. Lange hält sich das - auch von Malvine Schnorr von Carolsfeld verbreitete - Gerücht, dass der Sänger „infolge der Anstrengung des Tristan, namentlich der 4ten Aufführung, sein Leben lassen musste“.
31. 7 1865 - Richard Wagners geplante Deutsche Musikschule
München * König Ludwig II. befiehlt die Schließung des Münchner Konservatoriums als Vorbedingung für die von Richard Wagner geplante Deutsche Musikschule.
1. 8 1865 - Richard Wagner erhält zusätzliche 1.200 Gulden
München * Richard Wagner erhält zusätzliche 1.200 Gulden für die Haltung einer Equipage.
2. 8 1865 - Münchens erste öffentliche Toilette wird eröffnet
München * Münchens erste öffentliche Toilette wird von der ersten städtisch bestallten Abortwärterin eröffnet. Zu ihren Aufgaben gehört es: „streng die angeordnete Scheidung der Geschlechter bei Benutzung der Abtritte zu überwachen und allen den Abtritt benützenden Personen mit Höflichkeit entgegenzukommen“.
2. 8 1865 - Richard Wagner will Tristan und Isolde nie mehr aufführen
München * Nach dem unerwarteten Tod von Ludwig Schnorr von Carolsfeld will Richard Wagner die Oper „Tristan und Isolde“ nie mehr aufführen. Doch König Ludwig II. besteht auf eine Wiederaufnahme der Oper.
9. 8 1865 - Richard Wagner besucht König Ludwig II. auf der „Hochkopfhütte“
Walchensee * Richard Wagner besucht König Ludwig II. auf der „Hochkopfhütte“ über dem Walchensee.
25. 8 1865 - Zum 20. Geburtstag von König Ludwig II. gibt's die Wagner-Oper Lohengrin
Alpsee * Zum 20. Geburtstag von König Ludwig II. wird am Alpsee eine Szene aus der Wagner-Oper Lohengrin - und zwar die Ankunft der Gralsritter am Ufer der Schelde - inszeniert.
27. 8 1865 - Richard Wagner vollendet den Entwurf zu „Parsifal“
München * Richard Wagner vollendet den Entwurf zu „Parsifal“.
9 1865 - Richard Wagner mischt sich in die bayerische Politik ein
München * Richard Wagner mischt sich immer mehr in die bayerische Politik ein.
Für König Ludwig II. verfasst er ein Pamphlet mit dem Titel „Was ist deutsch?“. In diesem fordert er die Gründung einer neuen politischen Zeitschrift und den Aufbau einer bayerischen „Volksmiliz“.
15. 9 1865 - Die Schweiger-Theater müssen schließen
München-Isarvorstadt - München-Au * Am Ende bringt die politisch stärkere Konkurrenz die Schweiger-Theater zur Strecke. Als das Aktien-Volkstheater am Gärtnerplatz eröffnet wird, müssen die Schweiger-Theater schließen.
Um 10 1865 - Die Streckenerschließung soll nicht länger verzögert werden
München - München-Obergiesing * Nachdem noch immer keine endgültige Bahntrassenführung durch Obergiesing feststeht, teilt das „Innenministerium“ dem für den Eisenbahnbau zuständigen „Handelsministerium“ mit, dass sich die Erschließung und Bebauung des „Neubaugebiets“ nicht länger verzögern lässt.
1. 10 1865 - König Ludwig II. besucht das Münchner Oktoberfest
München-Theresienwiese * König Ludwig II. besucht das Münchner Oktoberfest in Begleitung seines Bruders Prinz Otto.
11. 10 1865 - Es kommt zum Zerwürfnis zwischen Wagner und Pfistermeister
München * Nachdem bei Kabinettssekretär Franz Seraph von Pfistermeister die Ausführungsanordnung König Ludwigs II. für Richard Wagners „Was ist deutsch?“ auf Widerstand stößt, kommt es zum Zerwürfnis der Beiden.
16. 10 1865 - Richard Wagner fordert von König Ludwig II. 200.000 Gulden
München * Richard Wagner fordert von König Ludwig II. 200.000 Gulden. Davon 40.000 sofort und 160.000 Gulden als Anlage auf Lebenszeit bei einer jährlichen Verzinsung von fünf Prozent.
Um den 20. 10 1865 - Ludwig II. bewilligtRichard Wagner die geforderten 40.000 Gulden
München * Der Bayernkönig Ludwig II. bewilligt dem Komponisten Richard Wagner die geforderten 40.000 Gulden und darüber hinaus ein Jahresgehalt von 8.000 Gulden. Diese Summe entspricht exakt der fünfprozentigen Verzinsung, ist aber kündbar.
Da für die 40.000 Gulden angeblich keine Scheine verfügbar sind, wird das Geld in Silbermünzen ausbezahlt. Cosima von Bülow lässt daraufhin das Münzgeld mit zwei Kutschen in die Brienner Straße 21 bringen.
4. 11 1865 - Das Gärtnerplatz-Theater wird eröffnet
München-Isarvorstadt * Das Gärtnerplatz-Theater wird nach einer Bauzeit von gerade einmal eineinviertel Jahren eröffnet.
7. 11 1865 - Wettbewerb für den Bau des Neuen Rathauses ausgeschrieben
München * Ein Wettbewerb für den Bau des Neuen Rathauses wird ausgeschrieben. 27 Architekten beteiligen sich.
Um den 10. 11 1865 - Ein neuer Streckenverlauf wird festgelegt
München-Untergiesing * Nur wenige Monate vor dem Ende des dreijährigen österreichischen Verhandlungsmarathons, legt sich die Generaldirektion der Kgl. Bayerischen Staatseisenbahnen auf einen anderen Streckenverlauf fest.
Nach diesem sollte, um den Umweg über die Großhesseloher Brücke zu umgehen, bereits in Friedenheim eine Trasse von der Hauptstrecke München - Augsburg abzweigen und über Untersendling und einer neu zu erbauenden Isarbrücke nach Untergiesing und von dort weiter nach Haidhausen führen.
Diese Streckenführung ist gar nicht so revolutionär, da schon bei der Projektierung der Strecke München - Salzburg in der 1850er-Jahren dieser Verlauf zum Teil angedacht worden war. Allerdings würde die neue Bahntrasse doppelt so teuer wie die ursprüngliche sein.
Die Planer können aber darstellen, dass die Bahnstrecke zehn Kilometer kürzer ist und außerdem weniger Steigungen überwinden muss. Dadurch entsteht nicht nur eine enorme Zeitersparnis, sondern gleichzeitig ein beträchtlich verringerter Energieverbrauch. Den Mehraufwand für die neue Brücke von 800.000 Gulden kann man in Kauf nehmen, da sich die erhöhten Baukosten bereits innerhalb weniger Jahre wieder amortisieren.
11. 11 1865 - Wagner will, dass König Ludwig II. ein neues Kabinett bildet
Schloss Hohenschwangau * Zwischen dem 11. und dem 18. November hält sich Richard Wagner bei Ludwig II. in Schloss Hohenschwangau auf. Während diesen ausdauernden Gesprächen fordert Wagner die Entlassung seiner Widersacher, des Königlichen Kabinettssekretärs Franz Seraph von Pfistermeister und des bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig von der Pfordten. Respektlos spricht der Komponist von „Pfi“ und „Pfo“. Wagner will, dass König Ludwig II. ein neues Kabinett bildet.
18. 11 1865 - Richard Wagner schickt sein Gedicht „Abschiedsthränen“ an Ludwig II.
München * Wieder in München zurück, schickt Richard Wagner sein Gedicht „Abschiedsthränen“ an Ludwig II..
26. 11 1865 - Richard Wagner hat den Bogen endgültig überspannt
München * In einem Brief schlägt Richard Wagner dem König vor, den Kabinettssekretärs Franz Seraph von Pfistermeister durch Max von Neumayr und den bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig von der Pfordten durch Ludwig von Edelsheim zu ersetzen.
Der König wird die Entlassungen erst im Oktober 1866 umsetzen. Nun kommt es zum Eklat.
Denn durch sein massives Einmischen in die bayerischen Staatsangelegenheiten hat Richard Wagner den Bogen endgültig überspannt. Der Komponist, der wie kaum ein anderer Zugang zum König hat, wird von der Regierung sowieso mit großem Misstrauen beobachtet. Nun stellt der Ministerrat dem König ein Ultimatum. Ludwig II. habe zu wählen „zwischen der Liebe und Verehrung Ihres treuen Volkes und der Freundschaft Richard Wagners“.
Eine breite öffentliche Opposition gegen den Komponisten hat sich gebildet. Sie wirft Richard Wagner vor, er halte den König von den Regierungsgeschäften ab und beanspruche die Kabinettskasse übermäßig. Bald darauf übergeben Münchner Bürger 810 Unterschriften mit der Forderung der Landesverweisung des Komponisten Richard Wagner an den Kabinettssekretär Franz Seraph von Pfistermeister.
6. 12 1865 - Richard Wagner soll München für einige Monate verlassen
München-Maxvorstadt * Oberappellationsrat Johann Freiherr von Lutz wird vom Kabinettssekretär Franz Seraph von Pfistermeister zu Richard Wagner geschickt, um ihn zu bitten, München für einige Monate zu verlassen.
8. 12 1865 - Ludwig II. muss Richard Wagner einen Abschiedsbrief schreiben
München * Nachdem 810 Münchner Bürger schriftlich die Landesverweisung des Komponisten forderten, muss König Ludwig II. Richard Wagner einen Abschiedsbrief schreiben. Die Abreise Wagners aus München sollte nur ein Abschied auf Zeit sein. Wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hätten, könnte er ja wieder nach München zurückkehren.
Aus diesem Grund erhält der Komponist auch weiterhin sein Jahresgehalt von 8.000 Gulden, was dem Doppelten einer Ministerpension entspricht.
10. 12 1865 - Fluchtartig verlässt Richard Wagner München
München-Maxvorstadt - Triebschen * Richard Wagner verlässt fluchtartig seine Villa in der Brienner Straße 21 (heute 37) und flieht nach Triebschen in der Schweiz. Die Münchner Gemeindebevollmächtigten sprechen sich in ihrer Sitzung für die Übersendung einer „Danksagung der Stadt München für die Entfernung Richard Wagners aus Bayern“ an den König aus. Diese Aktion wird allerdings nach einem Einspruch des Magistrats unterbleiben.
Zwischen Mai 1864 und Dezember 1865 hat Richard Wagner von der Kabinettskasse 99.400 Gulden erhalten. In dieser Summe sind weder die Zuschüsse an Wagner nahestehende Personen, noch die Zuwendungen für die „Tristan und Isolde“-Aufführung in Höhe von 57.500 Gulden. Das entspricht etwa einem Drittel der jährlich rund 300.000 Gulden aus der Kabinettskasse, über die der König ein freies Verfügungsrecht besitzt.
10. 12 1865 - König Ludwig II. will erstmals zugunsten seines Bruders Otto abdanken
München * König Ludwig II. will erstmals zugunsten seines Bruders abdanken und sich zu Richard Wagner in die Schweiz begeben.
Um den 20. 12 1865 - Die Unruhe- und Angstzustände des 17-jährigen Bayernprinzen Otto
München * Die Unruhe- und Angstzustände des 17-jährigen Bayernprinzen Otto bleiben in der königlichen Familie nicht unbemerkt. Die Königinmutter wird aber von den Ärzten beruhigt, da es sich lediglich um ein „Jugendirresein“ handle, das von selbst wieder vergeht.
24. 12 1865 - Der amerikanische Ku-Klux-Klan wird gegründet
USA * Der amerikanische „Ku-Klux-Klan“ wird gegründet. Sein Ziel ist vor allem die Unterdrückung der Schwarzen. Es handelt sich um einen paramilitärischen Geheimbund im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika, der seine politischen Ziele mit rücksichtslosem Terror durchsetzen will.
Seine Gewalttaten richten sich zunächst gegen Schwarze und deren Beschützer sowie gegen die zahlreichen ehemaligen Nordstaatler, die vom Wiederaufbau des Südens profitieren wollen.
1866 - Die Georgskirche wird dem Zeitgeschmack entsprechend renoviert
Bogenhausen * Die Georgskirche in Bogenhausen wird dem Zeitgeschmack entsprechend renoviert. Dabei versieht man die Ignaz-Günther-Kanzel mit einem braun-mamorierten Anstrich.
1866 - Aus der Firma Hirschberg & Co wird die Actien-Ziegelei München
München * Aus der Firma Hirschberg & Co geht die Actien-Ziegelei München hervor. 1.080 Aktien zum Preis von 250 Florin werden ausgegeben. Sie bringen ein Kapital von 270.000 Gulden.
1866 - Joseph Wild erhöht die Leistung seiner Singlspielerbrauerei
München-Hackenviertel * Joseph Wild kann die Leistung seiner Singlspielerbrauerei auf 9.000 Scheffel Malz erhöhen. Er erreicht dabei aber auch die Grenzen seiner finanziellen Leistungskraft.
1866 - Ein zweites Lager des Konsumvereins von 1864 in der Karlstraße
München-Maxvorstadt * Ein zweites Lager des Konsumvereins von 1864 wird in der Karlstraße eröffnet.
1866 - Der Turnverein München wird zum Turnverein München von 1860
München-Isarvorstadt * Der Turnverein München wird in Turnverein München von 1860 umbenannt.
5. 1 1866 - Ludwig II. ernennt Malvina Schnorr von Carolsfeld zur Kammersängerin
München * König Ludwig II. ernennt Malvina Schnorr von Carolsfeld zur Kammersängerin mit einem Jahresgehalt von 2.000 Gulden „ohne ausdrückliche Verpflichtung ihrerseits für irgend eine Gegenleistung".
25. 1 1866 - Richard Wagners Ehefrau Minna stirbt
Dresden * Richard Wagners Ehefrau Minna stirbt in Dresden.
30. 1 1866 - Finanzielle Unterstützung für den Bau einer größeren Synagoge
München * Weil das anno 1826 fertigestellte jüdische Gotteshaus an der Westenriederstraße - mit seinen 160 Männer- und 160 Frauen- Betplätzen - bald aus allen Nähten zu platzen droht, bittet der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde den Münchner Stadtmagistrat um finanzielle Unterstützung für den Bau einer größeren Synagoge.
Ab 2 1866 - König Ludwig II. lässt die Unteren Hofgartenzimmer reich ausstatten
München-Graggenau * König Ludwig II. lässt nach seiner Verlobung mit Herzogin Sophie Charlotte in Bayern die Unteren Hofgartenzimmer in der Residenz für die künftige Königin reicher ausgestalten. Zusätzlich dazu lässt er eine Wendeltreppe, die von seinem Arbeitszimmer direkt in das künftige Königinnen-Appartement führt, anlegen.
16. 2 1866 - Erzbischof Gregorius von Scherr droht den Haberern mit Kirchenbann
München * In einem Hirtenbrief droht Erzbischof Gregorius von Scherr den immer radikaler agierenden Haberern den Kirchenbann an. Die Herausgabe der Hirtenbriefe wird von den Regierungsstellen einhellig begrüßt.
3 1866 - Das Projekt einer Spielstätte im Glaspalast wird endgültig verworfen
München-Maxvorstadt * Das Projekt einer vorübergehenden Spielstätte im Glaspalast für die Werke Richard Wagners wird endgültig zu den Akten gelegt.
Um den 3 1866 - Einigung auf den Eisenbahn-Übergangspunkt bei Braunau am Inn
Wien - Braunau * Das österreichische Eisenbahn-Konsortium einigt sich auf den Übergangspunkt bei Braunau am Inn.
13. 4 1866 - Johannes Timm wird in Schashagen geboren
Schashagen * Johannes Timm wird in Schashagen geboren.
27. 4 1866 - Prinz Otto erreicht seine Volljährigkeit
München * Prinz Otto erreicht seine Volljährigkeit mit Vollendung seines 18. Lebensjahres. Damit steht ihm ein eigener Hofstaat, eine Apanagenvon 80.000 Gulden und eine Beförderung zum Hauptmann im Infanterie-Leib-Regiment zu.
1. 5 1866 - Prinz Otto tritt in den aktiven Militärdienst ein
München * Prinz Otto tritt in den aktiven Militärdienst ein.
9. 5 1866 - Der bayerische Ministerrat beantragt die Mobilmachung
München * Der bayerische Ministerrat beantragt beim König die Mobilmachung. Ludwig II. will daraufhin zugunsten seines Bruders Otto abdanken.
10. 5 1866 - König Ludwig II. befiehlt die Mobilmachung
München - Königreich Bayern * Die Mobilmachung der bayerischen Armee wird ausgerufen. Da das bayerische Heer nicht für den Krieg vorbereitet ist, dauert es bis zum 22. Juni, bis die Truppen in die vorgesehenen Standorte eingerückt sind. Inzwischen sind die Preußen bereits in Böhmen eimarschiert.
22. 5 1866 - König Ludwig II. und Richard Wagner treffen sich in Triebschen/Schweiz
Triebschen * König Ludwig II. und Richard Wagner treffen zu dessen Geburtstag erstmals nach seinem Weggang aus München in Triebschen in der Schweiz wieder aufeinander. Die Begegnung dauert bis zum 24. Mai.
27. 5 1866 - König Ludwig II. eröffnete den 22. Landtag
München-Graggenau * König Ludwig II. eröffnete den 22. Landtag im Thronsaal der Residenz. Er will zur Eröffnung des Landtags eine Rede zu halten, in der er
- Bayerns Eintreten für ein frei gewähltes Parlament befürwortet,
- die Volksbewaffnung anstelle eines stehenden Heeres empfiehlt und
- die Militärgerichtsbarkeit abschaffen will.
Der Bayerische Ministerrat kann gerade noch rechtzeitig die eindeutig auf Richard Wagner zurückgehenden radikaldemokratischen Vorschläge aus der Thronrede streichen.
13. 6 1866 - Die Pläne für ein Richard-Wagner-Festspielhaus
Dresden - München * Der Architekt Gottfried Semper stellt eine Anfrage an das Kabinett des bayerischen Königs, ob er die Pläne für das Richard-Wagner-Festspielhaus, die „seit mehreren Monaten zur Vorlage fertig“ wären, schicken soll.
14. 6 1866 - Bayern unterstützt die Bundesexekution gegen Preußen
Wien - München - Berlin * Nachdem Preußen Holnstein wiederbesetzt und damit den Bundesfrieden bricht, unterstützt das Königreich Bayern den Antrag Österreichs auf Bundesexekution gegen Preußen.
16. 6 1866 - Der Deutsche Bund beschließt den Krieg gegen Preußen
Wien - München - Berlin • Der Deutsche Bund beschließt den Krieg gegen Preußen.
Um den 16. 6 1866 - König Ludwig II. zerstreut sich auf der Roseninsel
Roseninsel • König Ludwig II. verbringt diese für Bayern schwierigen Tage mit seinem Adjudanten Paul Fürst von Thurn und Taxis auf der Roseninsel im Starnberger See, wo er „zu seiner Zerstreuung Feuerwerke abbrennen ließ und bei künstlichem Mondschein Vergessen suchte“.
22. 6 1866 - Mobilmachung der bayerischen Truppen gegen Preußen
München * Mobilmachung der bayerischen Truppen gegen Preußen.
23. 6 1866 - Mit dem Einmarsch der Preußen in Böhmen beginnt der Deutsche Krieg
Berlin - Prag * Mit dem Einmarsch der Preußen in das habsburgische Königreich Böhmen beginnt der Deutsche Krieg. Preußen hat bereits vor Kriegsbeginn den Bundesvertrag des Deutschen Bundes für nichtig erklärt und schert aus der anno 1815 in Wien beschlossenen Friedensordnung aus.
Preußen führt also keinen Krieg gegen Österreich, sondern gegen ganz Deutschland. Die auf österreichischer Seite stehenden süddeutschen Bundestruppen tragen deshalb auch schwarz-rot-goldene Armbinden, als sie gegen die in Schwarz-Weiß antretenden Preußen kämpfen.
24. 6 1866 - König Ludwig II. besucht die bayerischen Truppen in Bamberg
Bamberg * König Ludwig II. besucht die bayerischen Truppen in Bamberg.
30. 6 1866 - Für die Polytechnische Schule wird der Grundstein gelegt
München * Für die Polytechnische Schule wird der Grundstein gelegt.
7 1866 - Das ehemalige Palais der Königin Therese als Militärkrankenhaus
Schwabing * Im stattfindenden Krieg wird das ehemalige Palais der Königin Therese als Filialspital des Münchner Militärkrankenhauses verwendet.
7 1866 - Franz Lenbach mietet in der Augustenstraße 10 ein Atelier
München-Maxvorstadt * Franz Lenbach mietet in der Augustenstraße 10 ein Atelier.
3. 7 1866 - Preußen siegt über Österreich bei Königgrätz
Königsgrätz * Der preußischen Militärführung gelingt es, ihre getrennt anmarschierende Armee bei Königgrätz zu einem vereinten Schlag zusammenzuführen und den Österreichern sowie den an ihrer Seite kämpfenden Sachsen eine schwere und letztlich entscheidende Niederlage zuzufügen.
18. 7 1866 - König Ludwig II. will zurücktreten
München • König Ludwig II. will unter dem Eindruck des verlorenen Krieges erneut zurücktreten. Bereits am 9. Mai, als er vom Ministerrat zur Mobilmachung aufgefordert worden war, äußerte er erstmals Rücktrittsabsichten.
1. 8 1866 - Die preußische Armee besetzt Nürnberg
Nürnberg * Die preußische Armee besetzt Nürnberg.
2. 8 1866 - Waffenstillstand zwischen Preußen und Bayern
??? * Der Waffenstillstand zwischen dem Königreich Preußen und dem Königreich Bayern wird geschlossen.
16. 8 1866 - Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in München
München * Die Freiwillige Feuerwehr München wird gegründet. 180 Münchner lassen sich als Mitglieder einschreiben. Arnold Zenetti umgehend zum ersten Vorsitzenden bestimmt. Viele Neuerungen im gesamten Löschwesen lassen sich von da an auf ihn zurückführen. Darunter fällt beispielsweise die Installierung der damals hochmodernen telegraphischen Feuermeldestationen.
18. 8 1866 - Der durch Preußen beherrschte Norddeutsche Bund wird gegründet
Berlin * Der Deutsche Krieg führt zur Auflösung des Deutschen Bundes. Gleichzeitig wird der durch Preußen beherrschte Norddeutsche Bund gegründet, um Preußens Hegemonie [= Vorherrschaft] zu festigen und zu legitimieren.
Unabhängig bleiben vorerst die süddeutschen Staaten:
- das Königreich Bayern,
- das Königreich Württemberg,
- das Großherzogtum Baden und
- das Großherzogtum Hessen, das dank russischer Fürsprache mit einigen kleinen Gebietsabtretungen davonkommt.
21. 8 1866 - Der Zoo des Kaufmanns Benedikt Benedikt ist bankrott
München-Englischer Garten * Der Zoo des Kaufmanns Benedikt Benedikt am Westrand des Englischen Gartens ist nach drei Jahren schon wieder bankrott. Die Versteigerung des auf 118.000 Gulden geschätzten Geländes wird anberaumt, doch es findet sich kein Käufer. Das Gelände übernimmt die Stadt, die Wirtschaftsgebäude werden für den Betrieb eines Kaffeehauses verpachtet.
22. 8 1866 - Bayern macht seinen Frieden mit Preußen
??? * Bayern macht seinen Frieden mit Preußen. Das Königreich Bayern muss 30 Millionen Gulden zahlen, verliert Land und verpflichtet sich in einem Geheimvertrag, in einem künftigen Kriegsfall mit seinen Truppen an Preußens Seite zu kämpfen.
23. 8 1866 - Mit dem Frieden von Prag ist Österreich aus Deutschland hinausgedrängt
Prag - Wien - Berlin - München * Mit dem Frieden von Prag drängt Preußen Österreich aus Deutschland. Außerdem annektiert Preußen die umstrittenen Elbherzogtümer Holstein und Lauenburg, das Königreich Hannover, das Herzogtum Nassau und das Kurfürstentum Hessen-Kassel sowie die Freie Stadt Frankfurt am Main.
Geblieben ist ein Bundesstaat mit 15 Klein- und Mittelstaaten nördlich der Mainlinie, der politisch, wirtschaftlich und militärisch im Norddeutschen Bund von Preußen dominiert wird. Eine sonderbare staatsrechtliche Konstruktion, die keinen langen Bestand haben wird.
Der Norddeutsche Bund erhält ein eigenes Parlament. Seine Verfassung nimmt bereits die des 1870/71 begründeten Deutschen Reiches vorweg.
31. 8 1866 - König Ludwig II. legt dem Landtag den Friedensvertrag vor
München-Kreuzviertel * Obwohl ihn die Verfassung dazu nicht zwingt, legt König Ludwig II. den Friedensvertrag dem Landtag vor. Nach einer teilweise hitzigen Debatte wird der bayerisch-preußische Friedensvertrag schließlich von beiden Kammern gebilligt.
An diesem Tag werden sowohl der Friedensvertrag als auch das geheime Schutz- und Trutzbündnis unterzeichnet, das Bayern verpflichtet, Preußen im Fall des Angriffs einer auswärtigen Macht durch die Unterstellung der bayerischen Armee unter preußischem Oberbefehl zu unterstützen.
9 1866 - Die Vermessungsarbeiten für die Eisenbahn nach Braunau beginnen
München * Die Vermessungsarbeiten, um den genauen Verlauf der Bahnstrecke nach Braunau am Inn festzulegen, beginnen. Die angedachte Trasse soll südlich von Untergiesing durch die Isarauen verlaufen, dann die Hangkante auf der Höhe des späteren Stadions an der Grünwalder Straße durchschneiden und östlich von Obergiesing durch die Hochau nach Haidhausen führen. Damit wären die drei Stadtviertel des Münchner Ostens direkt an die Eisenbahn angebunden.
Als nächste Entscheidung steht die Standortwahl für den nach dem Zentralbahnhof zweiten großen Staatsbahnhof auf der Tagesordnung. Für das betroffene Stadtviertel hätte das weitreichende Folgen auf die wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Entwicklungen, denn es geht bei dieser Entscheidung immerhin um die Drehscheibe für den künftigen Güter- und Personenverkehr im Münchner Osten.
9. 9 1866 - Grundsteinlegung für die neue Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing
München-Obergiesing * Die Grundsteinlegung für die neue Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing findet statt. Der Bau entsteht auf einem Gebiet, das landwirtschaftlich nicht genutzt werden kann, nachdem hier die Toten der Pest des Jahres 1636 begraben worden sind.
Geldgeber Ex-König Ludwig I. verlangt von vom Architekten Dollmann, dass die Kirche „noch schöner werde, als die Auer Kirche“. Die Stadtbaukommission besteht auf die Erhöhung des Kirchturms von achtzig auf 95 Meter. Damit ist die Heilig-Kreuz-Kirche - bis zum Bau des Fernsehturms - der höchste Punkt Münchens.
Niemand fragt zum Entstehungszeitpunkt der Kirche, ob der Bau in die Gegend passt oder ob er von der armen Vorstadtgemeinde überhaupt finanziert werden kann. „Wieder wurde hier ein Denkmal gesetzt, für das die Nutzung nur Anlass und zweitrangige Funktion war“, schrieb G. Schickel im Jahr 1987.
10 1866 - Das Oktoberfest fällt trotz des Prager Friedens aus
München-Theresienwiese * Das Oktoberfest fällt trotz des Prager Friedens vom 23. August aus.
10 1866 - Ludwig II. entlässt den Kabinettssekretär und den Ministerpräsidenten
München * König Ludwig II. entlässt seinen Kabinettssekretär Franz Seraph von Pfistermeister und den Ministerpräsidenten Ludwig von der Pfordten. Richard Wagner nannte die Beiden respektlos „Pfi“ und „Pfo“. Nun hatte er seine späte Rache.
Um 10 1866 - Das Haidhauser Komitee ist für einen Bahnhof in Haidhausen
München-Haidhausen - München-Giesing - München-Au * Nachdem Einzelheiten über den Streckenverlauf und den Bahnhofsstandort der Eisenbahnstrecke nach Braunau am Inn durchgesickert sind, gründen sechs Haidhauser Unternehmer und Geschäftsleute ein Komitee. Nach den Planungen der Eisenbahn-Generaldirektion soll der künftige Ostbahnhof an der heutigen Regerstraße, auf damals Giesinger Gebiet, entstehen. Dieser Standort gilt als ideal, da er
- von den Zentren der drei Stadtviertel Au, Giesing und Haidhausen nahezu gleich weit entfernt ist und
- einer möglichen Erweiterung des Bahnhofs sowie der Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben nichts im Wege steht.
Das Haidhauser Komitee spricht sich gegen den Bahnhofsstandort in Giesing und für einen solchen in Haidhausen - nahe dem heutigen Rosenheimer Platz - aus. Der Vorsitzende des Haidhauser Komitees ist der Besitzer der Franziskaner-Leistbrauerei, Joseph Sedlmayr. Nach Auffassung der Haidhauser Unternehmer spricht für den Standort Haidhausen, dass
- der Hauptpersonen- und Hauptgüterverkehr schon immer über diesen Ort lief und demzufolge
- alle verkehrstechnischen Infrastruktureinrichtungen vorhanden sind.
- Die „gefährliche Verkehrsanbindung“ über den steilen und nicht regulierten Giesinger Berg und dem gleich abschüssigen Nockherberg sprechen gegen Giesing.
- Hinzu kommen die fehlenden Brückenverbindungen für die Pferdefuhrwerke.
Der Münchner Magistrat und das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten schließen sich umgehend den Forderungen der Haidhauser an. Doch das für den Eisenbahnbau in Bayern zuständige Handelsministerium steht den Vorschlägen völlig konträr gegenüber, da nach seiner Auffassung der zweite Bahnhof höchstens ein kleiner Nebenbahnhof werden soll, an dem nur wenige Züge halten.
1. 10 1866 - Die Deutsche Musikschule wird eröffnet
München * Die von Richard Wagner konzipierte Deutsche Musikschule wird eröffnet. Rund 75 Schülerinnen und Schüler werden unter der Leitung von Karl von Perfall, dem späteren Intendanten des Hof- und Nationaltheaters, Hans von Bülow als Künstlerischem Direktor, sowie Peter Cornelius als Lehrer für Harmonie und Rhetorik ausgebildet.
Anfang 12 1866 - Georg Hauberrisser erhält den Auftrag für den Bau des Neuen Rathauses
München-Graggenau * Der erst 26-jährige, aus Graz stammende Architekt Georg Hauberrisser erhält den Auftrag für den Bau des Neuen Rathauses.
15. 12 1866 - Wagner fordert die Ausweisung von Malvina Schnorr von Carolsfeld
München * Richard Wagner fordert von König Ludwig II. die Ausweisung der Kammersängerin Malvina Schnorr von Carolsfeld. Sie hat das eheähnliche Zusammenleben von Wagner und Cosima von Bülow kritisiert.
31. 12 1866 - Prinz Otto fordert eine dritte Person zum Duell
München-Graggenau * Prinz Otto fühlt sich bei einer Teegesellschaft seiner Mutter grundlos provoziert und fordert eine dritte Person zum Duell. König Ludwig II. schließt eine eventuelle Thronfolge seines Bruders aus.
1867 - Das Ende der Holz-Wasserrohre
München-Angerviertel * Die letzten Holzwasserrohre werden am Oberanger gegen Metallrohre ausgetauscht.
1867 - Die „Actien-Ziegelei München“ richtet die „Fabrik Bogenhausen“ ein
Bogenhausen * Die „Actien-Ziegelei München“ richtet an der Denninger Straße, beim heutigen Herkomerplatz, die „Fabrik Bogenhausen“ ein.
Nach dem Jahr 1867 - Die „Actien-Ziegelei München“ betreibt eine Ziegelei in Zamdorf
Bogenhausen - Zamdorf * Die „Actien-Ziegelei München“ betreibt eine Ziegelei in Zamdorf.
Eine weitere, die sogenannte „Ziegelei IV“ entsteht am Prinzregentenplatz.
Sie muss vor 1901 dem „Prinzregententheater“ Platz machen.
1867 - Michael Schottenhamel kommt nach München
Schwabing - München-Theresienwiese * Der aus der Oberpfalz stammende Schreiner Michael Schottenhamel
- kommt nach München,
- heiratet hier eine Wirtshausköchin,
- eröffnet mit ihr das Gasthaus „Zu den drei Mohren“ in der Luitpoldstraße 13 und
- nimmt noch eine „Oktoberfest-Bierbude“ dazu.
Sie steht hinter dem „Königszelt“ und bietet 50 Personen Platz.
1867 - München hat nur mehr 17 Brauereien
München * München hat nur mehr 17 Brauereien.
1867 - Friedrich Brugger erschafft das „Leo-von-Klenze-Denkmal“
München-Isarvorstadt * Friedrich Brugger erschafft das „Leo-von-Klenze-Denkmal“ am Gärtnerplatz.
1867 - Eduard von Grützners Abschlussarbeit an der Kunstakademie
München-Maxvorstadt * Als Abschlussarbeit verlangt Karl von Piloty von seinen Schülern einen „großen historischen Unglücksfall“.
Als Thema für Eduard Grützner schlägt er vor: „Heinrich II. von England lässt sich 1174 am Sarkophage des Erzbischofs Thomas Becket geißeln“. Da der Student der Thematik nur wenig Sympathie abgewinnen kann, malt er eine ganz andere Unglücksgeschichte.
Es wird ein humoristisches Kellerbild mit Mönchen, auf dem ein behäbiger, zum Weinholen geschickter Klosterbruder abgebildet ist. Er hat zu tief und zu lange ins Glas geschaut und ist deshalb angetrunken - an einem Weinfass stehend - eingeschlafen. Von einem anderen Pater denunziert, wird der Mönch nun vom Prior kritisch beobachtet.
Piloty sieht sich das Bild lange an und sagt schließlich: „Bravo, gratuliere!“ Eduard Grützners nächstes Werk hat eine ähnliche Thematik: Ein von Zahnweh geplagtes Pfäfflein steigt in den Weinkeller, um dort Linderung für seine Pein zu suchen. Dieses Bild kauft der „Kunstverein“ an und versteigert es für dreihundert Gulden. Der Käufer veräußert es umgehend für beinahe das Dreifache.
1867 - Der erste Münchner Fahrrad-Besitzer
München * Als erster Münchner kauft sich der Maschinenmechaniker Conrad Gautsch ein - damals „Velociped“ genanntes - Fahrrad.
Um 1867 - Heben von Steinblöcken mit nur einem Finger
Lenggries * Als „Metzgergeselle“ in der „Alten Wirtschaft“ in Lenggries beginnt der Steyrer Hans mit dem Heben von Steinblöcken unter erschwerten Bedingungen, nämlich mit nur einem Finger.
1867 - Der „Topographischen Atlas“ ersetzt Philipp Apians Baiernkarte
München-Lehel * Erst mit dem „Topographischen Atlas“ liegt ein Nachfolgewerk von Philipp Apians Baiernkarte aus dem Jahr 1563 vor.
1867 - Gerüchte über eine Geisteskrankheit des bayerischen Prinzen Otto
München - Berlin * Der preußische „Gesandte“ Freiherr von Werther berichtet an „Reichskanzler“ Otto von Bismarck über umlaufende Gerüchten einer Geisteskrankheit des bayerischen Prinzen Otto.
Es gibt Überlegungen, ihn von der Thronfolge auszuschließen.
Angeblich leidet er „an einem kalten Fieber“.
1867 - Der „Irrenweg“ erhält seinen Namen
München-Au - München-Haidhausen * Der an der „Kreisirrenanstalt” vorbeiführende Verkehrsweg erhält die Bezeichnung „Irrenweg“.
1867 - Arnold Zenetti übernimmt als „Baurat“ die Leitung des „Stadtbauamts“
München * Der inzwischen zum „Oberingenieur“ ernannte Arnold Zenetti übernimmt als „Baurat“ die Leitung des „Stadtbauamts“.
Nun besteht für ihn die Möglichkeit, einmal gefasste Ideen und Bauvorhaben in die Tat umzusetzen.
Max von Pettenkofers leidenschaftliche Forderungen und Vorschläge, München endlich zur colera- und typhusfreien Stadt zu machen, fallen bei Arnold Zenetti auf fruchtbaren Boden und finden in ihm einen energischen Unterstützer.
Es beginnt eine fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Männer, zu denen sich ab dem Jahr 1870 noch der „Erste Bürgermeister von München“, Alois von Erhardt, hinzugesellt.
Die gewaltigen Aufgaben, denen sich die Drei stellten, sind
- die Errichtung einer neuzeitlichen „Kanalisation“,
- verbunden mit einer einwandfreien zentralen „Wasserversorgung“ sowie
- der Errichtung eines „städtischen Vieh- und Schlachthofs“.
Dadurch können die mehr als achthundert Schlachtstätten der Metzgereien, die in denkbar unhygienischer Art und Weise arbeiten, geschlossen werden.
1867 - König Ludwig II. lässt die „Nibelungensäle“ in der Residenz fertigstellen
München-Graggenau * König Ludwig II. lässt die „Nibelungensäle“ im „Königsbau“ der Residenz fertigstellen.
Im „Saal der Klage“ fehlen noch zwei Bilder, die jetzt - 40 Jahre nach Beginn der Malerarbeiten - von dem Maler und Graphiker Michael Echter ergänzt werden.
Auf dem Bild gegenüber dem Eingang gibt der Maler dem lorbeerbekränzten Dicchter des „Nibelungenliedes“ die Gesichtszüge Ludwigs I..
Dem daneben stehenden jungen Sänger im roten Mantel gibt er das Aussehen König Ludwigs II..
5. 1 1867 - Malvina Schnorr von Carolsfeld soll umgehend ausreisen
München * Malvina Schnorr von Carolsfeld erhält von König Ludwig II. eine Aufforderung zur umgehenden Ausreise aus Bayern. Falls sie dieser Anordnung nicht innerhalb von zwei Wochen nachkommt, soll ihr der „verliehene Jahresbezug von 2.000 fl. sofort sistirt“ werden.
11. 1 1867 - Gottfried Semper zeigt dem König das Modell des Festspielhauses
<p><strong>München</strong> * Gottfried Semper zeigt König Ludwig II. das Modell des Festspielhauses. Der Monarch ist derart angetan, dass er dem Architekten per Handschlag nicht nur den Auftrag zum Bau erteilt, sondern ihn auch einlädt, nach München zu übersiedeln und Oberbaurat sowie Hoftheater-Intendant zu werden.</p> <p>Da Semper den Platz auf dem rechten Isarhochufer favorisiert, steht freilich sofort die Anlage einer neuen Straße zur Debatte. Gottfried Semper schlägt dafür eine Nord- und eine Südvariante vor.</p> <ul> <li>Erstere verlängert in leicht geknickter Form die Galeriestraße.</li> <li>Der südliche Straßenzug, dem auch der König den Vorzug gibt, ist die Verlängerung der Brienner- und Hofgartenstraße.</li> </ul> <p>Obwohl das Bauterrain vom König nie erworben wird, fertigt Semper dafür bis Dezember 1867 die Planunterlagen an.</p>
21. 1 1867 - Ludwig Thoma wird in Oberammergau geboren
Oberammergau * Ludwig Thoma wird in Oberammergau geboren.
22. 1 1867 - König Ludwig II. verlobt sich mit Sophie in Bayern
München * König Ludwig II. verlobt sich mit Sophie, der Tochter von Herzog Max in Bayern.
30. 1 1867 - Das offizielle Verlobungsfoto entsteht
München * Das offizielle Verlobungsfoto von König Ludwig II. und seiner Großcousine Sophie Charlotte, Herzogin in Bayern entsteht im Atelier des Hofphotographen Josef Albert.
Um 2 1867 - Eine weitere Interessengruppe meldet sich zu Wort
München-Haidhausen * Eine weitere Interessengruppe meldet sich zur Standortfrage des „Ostbahnhofs“ zu Wort.
Diese Gruppierung hat für den Bahnhof ebenfalls einen Standort in Haidhausen vorgesehen.
Dieser liegt aber etwa einen Kilometer östlicher, bei einem „Kuisl“ genannten alleinstehenden landwirtschaftlichen Anwesen, das dem Perlacher Gärtnereibetreiber Peter Ballauf gehört.
Das ist der Platz, auf dem sich heute der „Ostbahnhof“ befindet.
Der genannten Interessengemeinschaft gehören - neben Peter Ballauf - ausschließlich Personen an, die in der Nachbarschaft des „Kuisl-Anwesens“ ausgedehnte Grundstücke besitzen.
Sprecher und Vorsitzender dieses „Konsortiums“ ist der „Hofbankier“ Carl von Eichthal, der kurz zuvor ein riesiges und unbebautes, „Auf der Ramersdorfer Lüften“ bezeichnetes Gelände erworben hat.
2 1867 - Noch eine Interessengemeinschaft zur „Ostbahnhof“-Standortfrage
München-Au - München-Giesing - München-Haidhausen * Noch eine Interessengemeinschaft zur Standortfrage des „Ostbahnhofs“ tritt auf.
Ihr gehören „Handels- und Gewerbetreibende“ aus der Au, Giesing, Haidhausen und „südlicher Stadtteile“ an.
Sie wollen einen „Südbahnhof“ in Untergiesing, südlich des im Jahr 1847 als „Männerfreibad“ eröffneten „Schyrenbades“ installiert sehen.
Der Bahnhof soll die Anlage eines ausgedehnten Industrieviertels in den Isarauen ermöglichen.
Ein Vorschlag, der heute möglicherweise Erstaunen hervorruft.
Aber am „Auer Mühlbach“ war von „Hellabrunn“ bis hinauf zur „Bäckerkunstmühle“ sogar ein Gebiet für schwerindustrielle Güter im Entstehen.
Mit den genannten Vorschlägen liegen vier Standorte für einen Bahnhof und zwei alternative Streckenführungen zur Auswahl:
- eine „innere“, unmittelbar am Haidhauser Zentrum, und
- eine „äußere“, am östlicher gelegenen „Kuisl-Anwesen“ vorbeiführende Linie.
10. 3 1867 - Richard Wagner und König Ludwig II. begegnen sich in München
München * Während seines München-Aufenthalts zwischen dem 9. und 18. März begegnen sich Richard Wagner und König Ludwig II..
16. 4 1867 - Die II. Compagnie der Freiwilligen Feuerwehr München wird gegründet
München * Die II. Compagnie der Freiwilligen Feuerwehr München kann gegründet werden.
Um 5 1867 - Eichthal unterbreitet dem „Innenministerium“ ein lukratives Angebot
München-Haidhausen * Carl von Eichthal unterbreitet dem „Innenministerium“ ein lukratives Angebot:
Wenn die „Braunauer Eisenbahnlinie“ am „Kuisl“ vorbei geführt wird, tritt die Interessengemeinschaft - „der guten Sache halber und im Interesse der Vorstadt Haidhausen und zum allgemeinen besten“ - dem Staat „schenkungsweise“ einen Tagwerk Grund ab.
Gleichzeitig bietet er an, die zusätzlich für die Anlage des Bahnhofs und der Bahnstrecke benötigten Flächen zu einem Preis von lediglich 2.000 Gulden pro Tagwerk zur Verfügung zu stellen.
Natürlich liegt dem „Konsortium“ an der Wertsteigerung ihrer noch unerschlossenen Grundstücke.
Das vorgelegte Angebot liegt zwar weit unter dem Verkehrswert, doch durch die geänderte Streckenführung würde sich das „Entgegenkommen“ durch die in die Höhe schnellenden Baulandpreise schnellstens wieder ausbezahlen.
14. 5 1867 - Kurt Eisner wird in Berlin geboren
Berlin * Kurt Eisner, der spätere Revolutionär und Bayerische Ministerpräsident, wird in Berlin geboren.
28. 5 1867 - Pläne für die Neugestaltung der Appartements und des Wintergartens
München-Graggenau * Der Hofbauinspektor Eduard von Riedel legt Pläne für die Neugestaltung der Appartements Ludwigs II. vor. Der König ist mit den Planungen nicht zufrieden und gibt die Aufgabe an Franz Seitz weiter.
Riedel legt auch seine Pläne für die Herstellung eines Dachpavillons auf dem Dach des Festsaalbaus vor. Der Dachgarten ist nur ein kleines, zimmergroßes Häuschen aus Eisen und Glas mit einem rechteckigen Grundriss.
30. 5 1867 - Richard Wagner bezieht das Haus Prestell am Starnberger See
Starnberger See * Richard Wagner bezieht das von König Ludwig II. für ihn gemietete Haus Prestell am Starnberger See.
1. 6 1867 - Die Arbeiten am Neuen Rathaus beginnen
München-Graggenau * Die Arbeiten am Neuen Rathaus beginnen. Der erste Bauabschnitt ist bis 1874 fertig gestellt.
3. 7 1867 - Johannes Hoffmann wird in Ilbesheim bei Landau/Pfalz geboren
Ilbesheim * Johannes Hoffmann, der spätere bayerische Ministerpräsident, wird in Ilbesheim bei Landau in der Pfalz geboren.
26. 7 1867 - König Otto von Griechenland stirbt in Bamberg
Bamberg - München-Kreuzviertel * Otto, der ehemalige König von Griechenland, stirbt in Bamberg. Er wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche beigesetzt.
Prinz Ludwig, der spätere König Ludwig III. von Bayern, verzichtet auf den griechischen Thron.
8 1867 - Es kommt zur Entscheidung in der Standortwahl des „Ostbahnhofs“
München-Haidhausen * Es kommt zur Entscheidung in der Standortwahl des „Ostbahnhofs“.
In verschiedenen Gutachten werden eindeutig die Bahnhofs-Standorte in Haidhausen bevorzugt.
Dabei fällt die Wahl zunächst eindeutig auf die „Sedlmayr‘sche Streckenführung“ mit dem Bahnhof nahe dem heutigen Rosenheimer Platz.
9 1867 - Der Ostbahnhof-Standort wird neu festgelegt
München-Haidhausen * Nur wenige Wochen nach der vorhergehenden Entscheidung, stell die „Generaldirektion der kgl. Staatseisenbahnen“ fest, dass sie wegen bautechnischer Schwierigkeiten auf den Bau der „Sedlmayr‘schen“ Alternative zugunsten der „Eichthal‘schen“ verzichten muss.
Und diese Entscheidung steht felsenfest.
Da bewirkten selbst die Proteste des Besitzer der „Franziskaner-Leistbrauerei“, Joseph Sedlmayr, der die getroffene Entscheidung lauthals als „Resultat gelungener Agitation und Privatspekulation“ bezeichnet, nichts mehr.
Als eindeutiger Gewinner geht aus diesem monatelangen Tauziehen Carl von Eichthal hervor.
Der „Hofbankier“ hat anno 1856 zusammen mit den bedeutendsten deutschen Großunternehmern und Bankchefs die „Ostbahn-Aktiengesellschaft“ ins Leben gerufen.
Carl von Eichthal gehört unter anderem dem „Kollegium der Gemeindebevollmächtigten“ sowie der „Abgeordnetenkammer“ an und verfügt damit über einen massiven Informationsvorsprung, der seine Eisenbahngeschäfte mit der Bodenspekulation verschmelzen lässt.
Bei der Entscheidungsfindung für die „äußere“ Bahnlinie und dem Bahnhofsstandort am „Kuisl“ war es zumindest nicht hinderlich, dass Gustav von Schlör vor seiner Ernennung zum „Handelsminister“ lange Jahre Direktor bei der „Ostbahngesellschaft“ war.
Eichthal und Schlör kennen sich persönlich gut und dem entsprechend gut sind die geschäftlichen Verbindungen zwischen dem „Bankier“ und dem „Minister“.
Darüber, ob es interne Absprachen zwischen den beiden Akteuren gab oder dass der einflussreiche „Bankenchef“ Druck auf den „Staatsminister“ ausübte, lässt sich nur spekulieren.
7. 10 1867 - König Ludwig II. löst die Verlobung mit Herzogin Sophie Charlotte
München * König Ludwig II. löst in einem Schreiben die Verlobung mit seiner Großcousine Sophie Charlotte, Herzogin in Bayern. Er schreibt in sein Tagebuch: „Sophie ist abgeschrieben. Das düstere Bild verweht; nach Freiheit verlangt mich, nach Freiheit dürstet mich, nach Aufleben von qualvollem Alp.“ Das ist ein fast wortgleiches Zitat aus Richard Wagners „Thannhäuser“.
10. 10 1867 - Die Auflösung der Verlobung wird bekannt
München * Die Auflösung der Verlobung zwischen König Ludwig II. und Sophie in Bayern vom 7. Oktober 1867 wird in München bekannt.
12 1867 - Der „Wintergarten“ für König Ludwig II. ist fertiggestellt
München-Graggenau * Der „Wintergarten“ auf dem Dach des „Festsaalbaus“ für König Ludwig II. ist fertiggestellt.
Der Monarch plant umgehend die Erweiterung des „Dachgartens“ um 33 Fuß.
1868 - Bierverbrauch in München so hoch wie in ganz Russland
München - Russland * Die Münchner Bierbrauer stellen triumphierend fest, dass der Bierverbrauch allein in München ebenso hoch liegt wie in ganz Russland.
1868 - Elisabeth Fey stirbt im Alter von 28 Jahren
München-Au * Elisabeth Fey stirbt im Alter von 28 Jahren.
1868 - Die „Königliche Kunstgewerbeschule“ wird staatlich
München * Die „Zeichnungs- und Modellierschule“ wird als „Königliche Staatliche Kunstgewerbeschule“ in eine staatliche Institution umgewandelt.
1868 - Das Stammhaus der „Singlspielerbrauerei“ wird versteigert
Angerviertel - Au * Das Stammhaus der „Singlspielerbrauerei“ in der Sendlinger Straße wird versteigert.
Den Braubetrieb an der Rosenheimer- Ecke Hochstraße erwerben die „Braugrafen“ Butler-Haimhausen und machen ihn mit hohem Kapitaleinsatz wieder flott.
1868 - Ignaz von Döllinger wird „lebenslänglicher Reichsrat der Krone Bayerns“
München * König Ludwig II. beruft Ignaz von Döllinger zum „lebenslänglichen Reichsrat der Krone Bayerns“.
Ab 1868 -
München-Untergiesing * Zur optimalen Straßenführung legt die Bahnverwaltung „einen Eisenbahndamm von der Brücke angefangen bis zum Berge von Giesing, und durch diesen einen aufsteigenden tiefen Einschnitt“ an. Damit wird Untergiesing in zwei Hälften zerschnitten.
Proteste der Untergiesinger stellen heraus, dass mit dem plumpen und unansehnlichen Bahndamm die Vorstadt in ihrer baulichen Entwicklung beeinträchtigt, dass zumindest die in der Nähe des Damms liegenden Grundstücke entwertet und der Bevölkerung eine „unästhetische und unerträgliche Last aufgebürdet“ wird.
Der Stadtrat befürchtet bei einem Bruch des Hochwasserdammes der Isar können die hereinströmenden Wassermassen große Teile Untergiesings überschwemmen. Statt des festen Bahndammes fordert man deshalb die Herstellung der Bahntrasse auf Pfeilern. Die Bahnverwaltung hält aber die vorgetragenen Hochwasserängste für stark übertrieben, da genügend Öffnungen für Straßen und Bäche vorgesehen sind. Gleichzeitig stellt sie die - berechtigte - Frage, ob eine leichtere Bauweise etwas an der Lautstärke und der Ästhetik ändern würde.
Zum Bau des Bahndamms wird auf der gesamten Strecke zwischen dem Bergeinschnitt und der „Braunauer Brücke“ ein sieben Meter hohes Holzgerüst aufgebaut. Diese Konstruktion trägt eine Rollbahn, mit der die Erdmassen aus dem Hangeinschnitt abtransportiert und anschließend auf beide Seiten der Holzkonstruktion herabgekippt werden. Das Holzgerüst verschwand nach und nach im aufgeschütteten Eisenbahndamm.
Zehn Monate sind dafür vorgesehen, um die 60.000 Kubikmeter Erdreich, die beim Aushub des Einschnitts zwischen dem Giesinger Berg und dem Ostbahnhof anfallen, auf den Bahndamm zu verteilen. Voraussetzung ist aber, dass die Bauarbeiter pro Tag rund 750 Waggons der Rollbahn mit Erdreich be- und entladen. Auf dem Streckenabschnitt sind drei Rollbahnzüge mit jeweils siebzehn Waggons ständig im Einsatz. Zu erheblichen Problemen führen nach der Inbetriebnahme der Bahnstrecke die Lärmentwicklung an der Eisenbahnbrücke am Kolumbusplatz und dem gesamten Weg des Damms. Der Lärmpegel war noch höher wie heute, da die Schienen ohne jede Geräuschdämmung direkt auf die eisernen Brückenläufe montiert worden waren.
1868 - Die Kirchenschiffe der neuen „Heilig-Kreuz-Kirche“ sind 13 Meter hoch
Obergiesing * Die Kirchenschiffe der neuen „Heilig-Kreuz-Kirche“ sind bereits dreizehn Meter hoch, aber auch alles Geld verbaut.
Ab 1868 - Georg von Dollmann und die Planungen für „Schloss Linderhof“
Schloss Linderhof * Georg von Dollmann wirkt bei den Planungen für „Schloss Linderhof“ mit.
Anno 1868 - Die Gleisverlegungsarbeiten und der Bau des „Ostbahnhofs“ beginnen
Haidhausen - Rosenheim - Simbach/Braunau * Die Gleisverlegungsarbeiten an den Bahnlinien nach Simbach/Braunau am Inn und der neuen Streckenführung nach Rosenheim beginnen.
Von Rosenheim aus sollte noch eine weitere, insgesamt kürzere Strecke nach Salzburg abzweigen.
Im selben Jahr wird auch der Bau für den „Haidhauser Bahnhof“ begonnen, der zu dieser Zeit noch „mitten auf der grünen Wiese“ entsteht.
1868 - Die Überplanung des „Franzosenviertels“ ist unumgänglich geworden
Haidhausen * Gleichzeitig mit der Verlegung der Bahngleise und der Errichtung des „Ostbahnhofs“, ist die Überplanung des Geländes zwischen der künftigen Bahnlinie und der „Vorstadt Haidhausen“ unumgänglich geworden.
Diese Aufgabe übernimmt der städtische „Oberbaurat“ Arnold Zenetti.
1868 - Die „Kiauschou-Bucht“ als „Marine- und Handelsstützpunkt“ vorgeschlagen
Kiautschou-Bucht - China * Der „Geograph“ und „Geologe“ Ferdinand von Richthofen durchquert in den Jahren zwischen 1668 und 1872 als „Forschungsreisender“ dreizehn der achtzehn chinesischen Provinzen und schlägt die „Kiauschou-Bucht“ für einen deutschen „Marine- und Handelsstützpunkt“ vor.
Die sich in den 1890er-Jahren ändernde „Kolonialpolitik“ bringt auch eine aktive Unterstützung der Tätigkeit der „Missionare“.
Diese kümmern sich weder um die Gefühle der Bewohner und sehen in „Konfuzius“ lediglich ein „eingebildetes Symbol“, das dem katholischen Glauben „zu weichen“ hat.
30. 1 1868 - Bayern führt - als letztes deutsches Land - die Gewerbefreiheit ein
München * Das Königreich Bayern führt - als letztes deutsches Land - die Gewerbefreiheit ein. In dem Gesetz heißt es:
„Alle Staatsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts und des Glaubensbekenntnisses sind zum Betriebe von Gewerben im ganzen Umfange des Königsreichs berechtigt.
In dieser Berechtigung liegt insbesondere die Befugnis, verschiedenartige Geschäfte gleichzeitig an mehreren Orten und in mehreren Lokalitäten desselben Ortes zu betreiben, von einem Gewerbe zum andern überzugehen, ein Geschäft auf den Bereich anderer Gewerbe auszudehnen und Hilfspersonen aus verschiedenartigen Gewerbszweigen in beliebiger Anzahl in und außer dem Hause zu beschäftigen.“
Das bedeutet, dass jeder, ob Mann oder Frau, ob Christ oder Jude, beliebig viele Gewerbeunternehmungen an beliebig vielen Orten in Bayern betreiben kann. Nur für Apotheken und Gastwirtschaften bleibt auch weiterhin ein Konzessionssystem erhalten.
20. 2 1868 - Ludwig III. heiratet Marie Therese Erzherzogin von Österreich-Este
Wien * Prinz Ludwig III., der spätere Prinzregent und König, heiratet Marie Therese, Erzherzogin von Österreich-Este und Prinzessin von Modena, in Wien.
29. 2 1868 - Der Ex-König Ludwig I. stirbt in Nizza
Nizza * Der Ex-König Ludwig I. stirbt in Nizza. Seine Grabstätte befindet sich in der Basilika Sankt Bonifaz in München.
15. 3 1868 - Lida Gustava Heymann wird in Hamburg geboren
Hamburg * Lida Gustava Heymann wird in Hamburg geboren.
27. 3 1868 - Richard Wagner erhält von König Ludwig II. ein Darlehen
München * Richard Wagner erhält vom Bayernkönig Ludwig II. ein Darlehen unbekannter Höhe.
29. 4 1868 - Prinz Otto wird in den Georgs-Ritterorden aufgenommen
München * Prinz Otto wird durch seinen Bruder König Ludwig II. in den Ritterorden vom Heiligen Georg, dem Hausorden der Wittelsbacher, aufgenommen.
13. 5 1868 - Ludwig II. will ein Schloss in Hinterhohenschwangau bauen lassen
Schloss Neuschwanstein * König Ludwig II. teilt Richard Wagner in einem Brief seinen Entschluss mit, dass er die alte Burgruine Hinterhohenschwangau bei der Pöllatschlucht neu aufbauen lassen will. Es ist das spätere Schloss Neuschwanstein.
6 1868 - Franz Lenbach kehrt wieder nach München zurück
München * Franz Lenbach kehrt wieder nach München zurück.
Später schreibt er: „Ich machte von da an die Bildnismalerei zu meinem eigentlichen Berufe“.
21. 6 1868 - Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ werden uraufgeführt
Graggenau * Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ werden im Hof- und Nationaltheater für München uraufgeführt.
7 1868 - Der Bauplatz für „Schloss Neuschwanstein“ wird vorbereitet
Schloss Neuschwanstein * Für das „Neue Schloss Hohenschwangau“ an der Stelle der „Burgruine Hinterhohenschwangau“, dem späteren „Schloss Neuschwanstein“, beginnen mit Sprengungen und Erdarbeiten die Vorbereitungen für den Bauplatz.
9 1868 - Auf der Wiesn wird ein Tanzverbot eingeführt
München-Theresienwiese * Auf der Wiesn wird ein Tanzverbot eingeführt.
Um 10 1868 - König Ludwig II. gibt einen „Maurischen Kiosk“ in Auftrag
Graggenau * König Ludwig II. gibt einen „Maurischen Kiosk“ für seinen „Wintergarten“ in der Residenz in Auftrag.
Er soll ähnlich dem sein, den Karl von Diebitsch für die „Pariser Weltausstellung 1867“ geliefert hatte.
Um den 12 1868 - Helmuth von Moltke plant den Deutsch-Französischen Krieg
Berlin • Helmuth von Moltke, der Chef des preußischen Generalstabs, beginnt bereits im Winter 1868/69 mit den konkreten und detaillierten Planungen für die kriegerische Auseinandersetzung mit Frankreich. Wichtig ist ihm dabei, dass der Krieg nicht lange dauern darf. Schnelligkeit zählen neben zahlenmäßiger Überlegenheit und guter Bewaffnung zu den wichtigsten Voraussetzungen eines modernen Krieges.
19. 12 1868 - Die Polytechnische Schule wird eingeweiht
Maxvorstadt * Die Polytechnische Schule an der Arcisstraße wird eingeweiht.
Ab 1869 - Die zweischläfrigen Mannschaftsbetten werden abgeschafft
München * Die zweischläfrigen Mannschaftsbetten werden abgeschafft.
Es dauert aber noch etliche Jahre, bis in allen Kasernen tatsächlich Einzelbetten für alle Soldaten vorhanden sind. Bis dahin müssen sich zwei ausgewachsene Männer ein Bett teilen, das eine Länge von 1,79 Metern und eine Breite von 1,30 Metern nicht überschreiten darf.
Als Schlafunterlage dient ein gemeinsamer Strohsack, über den ein Leintuch gespannt ist. Darüber liegt eine große Decke.
1869 - Die „Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft“ bittet um eine staatliche Finanzhilfe
München-Englischer Garten - Tivoli * Wegen Misswirtschaft und sinkenden Umsätzen muss die „Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft“ um eine staatliche Finanzhilfe bitten.
Diese wird nicht gewährt.
1869 - Einführung einer neuen „Gemeindeordnung“
München * Mit der Einführung der neuen „Gemeindeordnung“ wird auch Bayerns Hauptstadt aus der Vormundschaft des Staates entlassen und die Stadt mit allen erforderlichen organisatorischen und finanziellen Kompetenzen ausgestattet.
Ab 1869 - Georg von Dollmann und die Planungen für „Schloss Neuschwanstein“
Schloss Neuschwanstein * Georg von Dollmann wirkt bei den Planungen für „Schloss Neuschwanstein“ mit.
1869 - Der „Konsumverein von 1864“ eröffnet zwei weitere Filialen
München * Der „Konsumverein von 1864“ eröffnet zwei zusätzliche Filialen in München.
1 1869 - Interessenten für den „Zoologische Garten“
München-Englischer Garten - Schwabing * Die Unternehmer eines kleinen, aber populären zoologischen Museums in München, Leven & Sohn, beantragen bei der Stadt, den ehemaligen „Benedikt-Tierpark“ zu pachten.
Der „Zoologische Garten“ am Westrand des „Englischen Gartens“ soll wieder mit lebenden Tieren bevölkert und ein „Seewasseraquarium“ eingerichtet werden.
Bei Erfolg wollen sie das Anwesen kaufen.
Um den 1 1869 - Der erweiterte „Wintergarten“ Ludwigs II. ist fertig
München-Graggenau * Der erweiterte „Wintergarten“ Ludwigs II. auf dem Dach des „Festsaalbaus“ ist fertiggestellt.
Der König ist noch immer nicht zufrieden.
Er will einen „Maurischen Kiosk“ in seinem „Dachgarten“ integriert wissen, der bereits im Herbst 1868 beauftragt wurde.
2. 1 1869 - Der Lohnkutscher Michael Zechmeister startet einen neuen Versuch
München * Der Lohnkutscher Michael Zechmeister startet einen neuen Versuch und schickt seine schienenunabhängigen, pferdebetriebenen, auf eisenbereiften Holzrädern laufenden Pferdewagen auf die Straßen der bayerischen Haupt- und Residenzstadt.
Das Stadtomnibusnetz besteht jetzt aus fünf Linien mit Umsteigebetrieb, wobei auf die weitere Anbindung der Au verzichtet wird. Auch Haidhausen und Giesing sind noch nicht in das Verkehrsnetz einbezogen worden.
23. 2 1869 - Das Königshäuschen im Graswangtal wird modernisiert
Schloss Linderhof * Das „Königshäuschen“ im Graswangtal wird modernisiert.
1. 3 1869 - Der Münchner Ableger des ADV wird in der Nordendhalle gegründet
München * Der Münchner Ableger des seit 1863 bestehenden Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins - ADV wird in der Nordendhalle gegründet. Angekündigt ist eine Veranstaltung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt: „Besprechung der Arbeiterfrage“.
Tatsächlich ist es eine Gründungsversammlung. Siebzig Personen treten dem Vorgängerverein der SPD an diesem Tag bei. Der Verein wird aber ziemlich schnell wieder verboten, weil der Obrigkeit die politischen Debatten in Vereinen einfach suspekt sind.
2. 3 1869 - König Ludwig II. gewährt Richard Wagner ein 10.000-Gulden-Darlehen
München * König Ludwig II. gewährt Richard Wagner ein Darlehen in Höhe von 10.000 Gulden. Dieses und jenes vom 27. März 1868 wird in jährlichen Raten in Höhe von 166 Gulden und 40 Kreuzer zurückgefordert.
5. 3 1869 - Michael Faulhaber wird geboren
Klosterheidenfeld * Michael Faulhaber, der spätere Erzbischof von München und Freising, kommt als Sohn eines Bäckers in Klosterheidenfeld im Bezirksamt Schweinfurt zur Welt.
27. 4 1869 - Prinz Otto wird in die „Kammer der Reichsräte“ eingeführt
München-Kreuzviertel * Prinz Otto wird in die „Kammer der Reichsräte“ eingeführt.
29. 4 1869 - Meter und Kilogramm werden eingeführt
München * Meter und Kilogramm werden als einheitliche Maße eingeführt.
5 1869 - Der „Münchner Veloziped-Club“ wird gegründet
München * Der „Münchner Veloziped-Club“ wird gegründet.
9. 5 1869 - Der Deutsche Alpenverein wird gegründet
München * Im Gasthof Zur blauen Traube gründen 36 Männer, 34 davon aus München, dazu ein Kurat aus Vent im Ötztal und ein Prager Kaufmann, einen „bildungsbürgerlichen Bergsteigerverein“. Das ist die Geburtsstunde des Deutschen Alpen Vereins. Im Paragraph 1 der Vereinsstatuten ist als Ziel festgeschrieben: „[…] die Kenntniss der deutschen Alpen zu verbreiten und die Bereisung Derselben zu erleichtern.“
18. 5 1869 - Herzog Rupprecht wird in München geboren
München * Herzog Rupprecht, der letzte bayerische Kronprinz, wird in München, im Wittelsbacher Palais, als Sohn von Prinz Ludwig III. und Prinzessin Maria Theresia geboren.
25. 5 1869 - Conrad Gautsch gründet den Münchner Veloziped-Club
München * Der Maschinentechniker Conrad Gautsch gründet den Münchner Veloziped-Club als einen der ersten Fahrradclubs der Welt.
6 1869 - Die erste Münchner Gruppe des „ADAV“ gegründet
München-Maxvorstadt * Die erste Münchner Gruppe des „Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins - ADAV“ gründen die „Schriftsetzer“ Leonhard Tauscher und Robert Neff in der „Nordendhalle“ in der Schellingstraße.
15. 6 1869 - Kostenvoranschlag für einen Byzantinischen Palast im Graswangtal
Schloss Linderhof * Georg Dollmann legt König Ludwig II. einen Kostenvoranschlag für einen Byzantinischen Palast im Graswangtal vor.
20. 6 1869 - Hans von Bülow bringt „Tristan und Isolde“ erneut zur Aufführung
München-Graggenau * Vor seinem endgültigen Weggang aus München bringt Hofkapellmeister Hans von Bülow „Tristan und Isolde“ am 20. und 22. Juni im Nationaltheater erneut zur Aufführung.
21. 6 1869 - Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund wird erlassen
Berlin * Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund wird erlassen.
1. 7 1869 - Die Bayerische Vereinsbank wird eröffnet
München * Die Bayerische Vereinsbank öffnet erstmals ihre Schalterhalle. Die ersten Geschäfte werden noch in Bayerischen Gulden abgewickelt.
3. 7 1869 - Adolf Friedrich von Schacks Mutter stirbt
München-Maxvorstadt * Adolf Friedrich von Schacks Mutter stirbt. Mit einem Teil des Geldes aus der Erbschaft kauft der Kunstmäzen die Grundstücke an der Brienner Straße 21 und 22.
13. 7 1869 - Ein Gesuch um Ausfertigung eines Verehelichungszeugnisses
München - München-Au * Johann Valentin Fey stellt ein „Gesuch um Ausfertigung eines Verehelichungszeugnisses“. Der verwitwete Tapezierer möchte Johanna Maria Schatte heiraten.
27. 7 1869 - Amos Tyler erhält das erste Kaugummi-Patent
USA * Amos Tyler aus Ohio erhält das erste Kaugummi-Patent zugesprochen.
Um den 8 1869 - Die „Königlichen Appartements“ Ludwigs II. sind bewohnbar
München-Graggenau * Die „Königlichen Appartements“ König Ludwig II. im Pavillon des „Hofgartentrakts“ der „Residenz“ sind fertiggestellt und werden von dem Bayernmonarchen bewohnt.
1. 8 1869 - Die erste sozialdemokratische Zeitung erscheint in Bayern
München * Die erste sozialdemokratische Zeitung „Der Proletarier - Sozialdemokratisches Arbeiterwochenblatt“ in Bayern erscheint.
27. 8 1869 - Grundsteinlegung für das Königshaus am Schachen
Schachen * Grundsteinlegung für das von Ludwig II. beauftragte Königshaus am Schachen.
29. 8 1869 - Johann Valentin Fey heiratet Johanna Maria Schatte
München-Au - Herwigsdorf * Der 36-jährige Tapezierer Johann Valentin Fey heiratet die 24-jährige Köchin Johanna Maria Schatte aus Zittau in Herwigsdorf in Sachsen nach evangelischem Ritus. Sie möchten ganz bewusst der selben Zeremonie im erzkatholischen München entgehen.
9 1869 - Leonhard Romeis kommt an die „Königliche Gewerbeschule“
München * Der 15-jährige Leonhard Romeis kommt an die „Königliche Gewerbeschule“ nach München.
21. 9 1869 - Das Dresdner Hoftheater wird ein Raub der Flammen
Dresden • Das Dresdner Hoftheater wird ein Raub der Flammen.
22. 9 1869 - Ludwig II. lässt das Rheingold im Hof- und Nationaltheater uraufführen
München-Graggenau • Gegen den erklärten Willen von Richard Wagner lässt König Ludwig II. die Oper „Das Rheingold“ im Hof- und Nationaltheater uraufführen.
10 1869 - Michael August Schichtl eröffnet sein Zaubertheater
München-Theresienwiese * Michael August Schichtl eröffnet gemeinsam mit seinen zwei Brüdern erstmals auf dem Oktoberfest sein „Zaubertheater“.
3. 10 1869 - König Ludwig II. besucht das Münchner Oktoberfest
München-Theresienwiese * König Ludwig II. besucht das Münchner Oktoberfest.
5. 10 1869 - König Ludwig II. gibt erneuten Auftrag für einen Wintergarten
München-Graggenau * König Ludwig II. gibt Carl von Effner den Auftrag für einen neuen königlichen Wintergarten auf dem Dach des Festsaalbaus der Residenz, mit den Ausmaßen 69,50 x 17,20 x 9,50 Metern. Um der Längenausdehnung entgegen zu wirken, wird der Dachgarten im Süden durch einen Quertrakt erweitert. Dazu wird im Kaiserhof ein dreiachsiger Unterbau errichtet.
Der für den neuen Wintergarten angefertigte Maurische Pavillon [Beauftragt im Herbst 1868] findet keine Verwendung. Er wird stattdessen im Park von Schloss Berg am Starnberger See aufgestellt.
12 1869 - Der „Zoologische Garten“ wird gepachtet
München-Englischer Garten - Schwabing * Die Unternehmer Leven & Sohn werden als Pächter des „Zoologischen Gartens“ am Westrand des „Englischen Gartens“ erwähnt.
8. 12 1869 - Papst Pius IX. lädt zum Ersten Vatikanischen Konzil ein
Rom-Vatikan * Für diesen Tag lädt Papst Pius IX. zum Ersten Vatikanischen Konzil, ohne dass er in der Einladung die zu beratenden Punkte angibt.
9. 12 1869 - Die Königlichen Appartements Ludwigs II. werden fotografiert
München-Graggenau * Die Königlichen Appartements Ludwigs II. im Pavillon des Hofgartentrakts der Residenz werden fotografiert.
1870 - Die Hauptwache bezieht ihr neues Wachlokal im Neuen Rathaus
München-Graggenau * Die von der Münchner Garnison gestellte Hauptwache bezieht ihr neues Wachlokal in der Erdgeschosszone des Neuen Rathauses.
Um 1870 - Jährlich kommen etwa 15.000 Saisonarbeiter aus der Gegend von Udine
Königreich Bayern * Die bayerischen Ziegeleibarone holen jährlich etwa 15.000 Saisonarbeiter aus der Gegend von Udine und dem Friaul ins Land, da sie - so die offizielle Begründung - als „streng katholisch“ sowie „genügsam und anspruchsvoll“ gelten. Auch würden sie „am Montag früh stets vollständig zur Arbeit erscheinen, eine Eigenschaft, auf die man bei den einheimischen Arbeitern nicht bestimmt rechnen kann“.
Wesentlich interessanter war für die „Loambarone“ allerdings, dass die italienischen Arbeitskräfte gegenüber ihren deutschen Kollegen erheblich billiger waren und dass sie das in Italien traditionelle Akkordanten-System von jeglicher sozialer Verantwortung gegenüber den Ziegeleiarbeitern entband. Die Anwerbung der Ziegelarbeiter, den Fornaciai, übernahmen die Akkordanten oder Capuzats. Das waren Friulaner, die mit den hiesigen Verhältnissen bestens vertraut und sprachkundig waren und so als Bindeglied zwischen den Ziegeleibesitzern und den Arbeitern fungierten.
1870 - Der Bildhauer Anton Heß baut neben seinem Vaterhaus ein Atelier
München-Maxvorstadt * Der Bildhauer Anton Heß, Sohn des Historienmalers Heinrich Maria, baut neben seinem Vaterhaus in der Luisenstraße 17 (heute HsNr. 37) ein Atelier.
1870 - Arnold Zenetti wird Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
München * Stadtbaurat Arnold Zenetti wird Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr München.
Um 1870 - In München entstehen die ersten Singspielhallen
München * In München entstehen - als Ableger der Varietés - die ersten Singspielhallen.
Um 1870 - Die Sonntags- und Feiertagsarbeit nimmt ständig zu
München * Die Sonntags- und Feiertagsarbeit nimmt ständig zu.
Um 1870 - Das Gebäude des Spitals der Unheilbaren muss abgebrochen werden
München-Au * Mit dem Bau der Eisenbahnlinie muss sich der Magistrat gegenüber der Eisenbahn-Gesellschaft verpflichten, das Gebäude des neuen St.-Nicolai-Spitals der Unheilbaren am heutigen Kolumbusplatz abzubrechen.
1870 - Die Altkatholiken spalten sich von der römisch-katholischen Kirche ab
Rom-Vatikan - München * Das Erste Vatikanische Konzil beschäftigt sich mit der Lehrgewalt des Papstes, bei der die Mehrzahl der Bischöfe die „Unfehlbarkeit des Papstes“ in Glaubensfragen bejaht. Daraufhin spalten sich - unter Führung von Ignaz Döllinger - die Altkatholiken von der römisch-katholischen Kirche ab, da sie die Konzilsentscheidung nicht anerkennen wollen.
1870 - Der Papst verliert seine weltlichen Machtbefugnisse über den Vatikan
Rom-Vatikan * Der Papst verliert seine weltlichen Machtbefugnisse über den Vatikan.
1870 - Das Zeitalter der Schaufenster beginnt
München * 20 Jahre nach der Erfindung der großflächigen Glasscheiben beginnt das Zeitalter der Schaufenster.
1870 - Das Zechmeister‘sche Streckennetz wird ständig erweitert
München * Die klassische Strecke des Stadtomnibusnetzes geht jetzt vom Zentralbahnhof zur Ludwigsbrücke. Sie wird in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.30 Uhr im 20-Minuten-Takt befahren.
Auf Drängen der Polizei müssen die Linien beschildert und nummeriert werden, bei Dunkelheit farbige Lampen die Richtung anzeigen. Der Tarif beträgt nur mehr drei Kreuzer. Es gibt bunte Fahrscheine, die sogar schon mit einem Reklameaufdruck versehen sind. Da die Nachfrage inzwischen angestiegen ist, kann das Unternehmen auch auf einen wirtschaftlichen Erfolg hoffen.
Das Zechmeister‘sche Streckennetz wird in der Folgezeit ständig erweitert. Bei Unrentabilität werden Streckenabschnitte aber auch wieder eingestellt oder nur mehr zu besonderen Anlässen angefahren. So verkehren bestimmte Sonderwagen nur während des Oktoberfestes oder fahren nach Nymphenburg.
1870 - Der amerikanische Ku-Klux-Klan wird aufgelöst
USA * Der amerikanische Ku-Klux-Klan wird aufgelöst.
Ab dem 1. 1 1870 - Enormer Anstieg des Bierkonsums in den deutschsprachigen Länder
Deutschland - Österreich - Schweiz * In den deutschsprachigen Ländern verzeichnet man einen enormen Anstieg des Bierkonsums, sodass sich der Pro-Kopf-Verbrauch bis zum Ersten Weltkrieg verdreifacht.
31. 3 1870 - Arnold Zenetti fertigt die Pläne fürs Franzosenviertel
München-Haidhausen * Der Plan für die Straßenzüge zum Braunauer Bahnhof in der Vorstadt Haidhausen wird vom Stadtbaurat Arnold Zenetti fertiggestellt und den zuständigen Gremien zur Genehmigung zugeleitet.
7. 4 1870 - Gustav Landauer wird in Karlsruhe geboren
Karlsruhe * Gustav Landauer wird in Karlsruhe geboren.
11. 4 1870 - Behördliche Nachforschungen zur Eheschließung
München-Au * Scheinbar haben die Eheleute Johann Valentin und Johanna Maria Fey ihre in Sachsen vollzogene Eheschließung nicht bei der Königl. Polizeidirektion München gemeldet, weshalb die Behörde Nachforschungen anstellt.
11. 6 1870 - Das erste deutsche Urheberrecht wird verabschiedet
Berlin * Das erste deutsche Reichsgesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen und musikalischen Kompositionen wird verabschiedet. Es hat aber bis zur Gründung der Anstalt für musikalisches Aufteilungsrecht im Jahr 1902 nur wenig Bedeutung.
13. 7 1870 - Der Preußenkanzler Otto von Bismarcks brüskiert Frankreich
Berlin * Der Preußische Kanzler Otto von Bismarck weis, dass die Deutsche Einigung nur durch den Druck von Außen vollendet werden kann. Diesen Druck von Außen liefert ihm der französische Kaiser Napoleon III., nachdem das spanische Parlament den vakanten Thron einem Mitglied des Haus Hohenzollern-Sigmaringen anbietet. In Frankreich kommen daraufhin Einkreisungsängste hoch, die sich in der scharfen Ablehnung des spanischen Vorhabens durch Kaiser Napoleon III. niederschlagen.
Preußens König Wilhelm I. erklärt sich daraufhin öffentlich bereit, den französischen Wünschen nachzukommen und den Thron einem nicht-deutschen Kandidaten zu überlassen. Doch das ist für die französische Öffentlichkeit zu wenig. Sie fordert die Garantie, dass auch zukünftig die Kandidatur hohenzollerischer Prinzen ausgeschlossen wird. Mit dieser Forderung reist der französische Botschafter Benedetti nach Bad Ems, wo sich der Preußenkönig zur Kur aufhält.
Wilhelm I. und Bismarck erkennen die isolierte Position der Franzosen, da weder England noch Russland Interesse an dem Vorgang zeigen. Schon deshalb lehnt König Wilhelm I. die Forderung ab und informiert darüber seinen Kanzler in einer sachlich gehaltenen Depesche.
Bismarck überarbeitet den Inhalt der Emser Depesche in scharfer Form und gibt den veränderten Text noch am selben Tag an die Presse weiter. Durch den brüsken Ton der Depesche fühle sich Frankreich tief gedemütigt. Damit geht Otto von Bismarcks Rechnung auf.
14. 7 1870 - Frankreich beschließt die Mobilmachung gegen Preußen
Paris * In der französischen Zeitung Soir erscheint Otto von Bismarcks Pressemitteilung zur Emser Depesche am französischen Nationalfeiertag, abends um 18:30 Uhr. Durch den brüsken Ton der Depesche fühle sich Frankreich tief gedemütigt.
Der Ministerrat beschließt am Abend die Mobilmachung. Das bedeutet Krieg.
15. 7 1870 - Der Preußenkönig Wilhelm I. erlässt die Mobilmachungsorder
Ems - Berlin * Der Preußenkönig Wilhelm I. beendet seinen Kururlaub in Ems und reist über Potsdam nach Berlin. Er wird von einer jubelnden Bevölkerung empfangen. Der König erlässt die Mobilmachungsorder für Preußen.
15. 7 1870 - Mobilmachung im Großherzogtum Baden gegen Frankreich
Karlsruhe * In Karlsruhe, der Hauptstadt des Großherzogtums Baden, ergeht der Befehl zur Mobilmachung.
16. 7 1870 - König Ludwig II. befiehlt die Mobilmachung
München - Berlin * Da für die bayerische Regierung der Bündnisfall gegenüber Preußen eingetreten ist, befiehlt König Ludwig II. die Mobilmachung.
16. 7 1870 - Die erste Ansichtskarte wird verschickt
??? • Die erste Ansichtskarte wird verschickt. Eine Seite der Karte trägt eine Holzschnittvignette, ein Artilleriebildchen. Die Ansichtsseite ist nicht vollständig bedruckt. Den bis dahin kursierenden „Correspondenzkarten“ zur rein schriftlichen Kommunikation ist damit ein entscheidendes Motiv hinzugefügt worden.
16. 7 1870 - Die Truppentransporte beginnen
Norddeutscher Bund • Einen Tag nach der Mobilmachung beginnen die Truppentransporte. Dazu werden die Bahnstrecken für den zivilen Verkehr gesperrt.
16. 7 1870 - Die englischen Sympathien gehören Preußen
London * In der Londoner Times kann gelesen werden: „Über das eine kann gegenwärtig kein Zweifel herrschen, dass aller Welt Sympathien sich jetzt dem angegriffenen Preußen zuwenden. Napoleon hat. sich zu einer unpolitischen und verbrecherischen Tat hinreißen lassen, die Gedanken des ersten Kaiserreichs scheinen der Fluch des zweiten zu werden. […] Wehe dem Kaiser, wenn seine Soldaten eine Schlappe oder gar eine Niederlage erleiden sollten.“
18. 7 1870 - Die Unfehlbarkeit des Papstes wird beschlossen
Rom-Vatikan * Die Konzilsmehrheit beschließt auf dem Ersten Vatikanischen Konzil die „Unfehlbarkeit des Papstes“ in Fragen des Glaubens und des Lebens der Christen sowie seine oberste und alleinige Rechtsgewalt in der Kirche. Ignaz von Döllinger sieht durch das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit die apostolische Tradition verraten.
Doch die Reaktion der römischen Kurie folgt umgehend. Alle Katholiken, die aus Gewissensgründen die neuen Glaubenssätze nicht annehmen und ihnen öffentlich widersprechen, werden exkommuniziert, also aus der sakramentalen Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen.
18. 7 1870 - Cosima von Bülow wird von ihrem Mann Hans von Bülow geschieden
Luzern ? * Cosima von Bülow wird von ihrem Mann Hans von Bülow geschieden.
18. 7 1870 - Unfehlbarkeit des Papstes verkündet
<p><em><strong>Rom-Vatikan</strong></em> • Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil wird die Unfehlbarkeit des Papstes verkündet. Von dem umstrittenen Dogma wird nur einmal Gebrauch gemacht. </p>
19. 7 1870 - Frankreichs Kaiser Napoleon III. erklärt Preußen den Krieg
Paris - Berlin • Die französische Kriegserklärung trifft in Berlin ein. Kaiser Napoleon III. tritt die Flucht nach vorne an und erklärt - überstürzt und ohne außenpolitische Rückendeckung - Preußen den Krieg. „Nach Berlin!“ heißt der Schlachtruf und Marschall Leboeuf erklärt: „Frankreich ist bereit. Die preußische Armee existiert nicht. Ich kenne sie nicht!“
Da nun aber Preußen der angegriffene Staat ist, werden - für Frankreich völlig unerwartet - die süddeutschen Länder Bayern, Baden und Württemberg als Verbündete Preußens mit in den Krieg ziehen.
19. 7 1870 - Erste Scharmützel im Grenzgebiet
Rhein - Saar - Mosel * Im Grenzgebiet an Rhein, Saar und Mosel kommt es zu ersten Scharmützeln zwischen vorgeschobenen Kavallerie-Patrouillen.
20. 7 1870 - „Mit Begeisterung werden Meine Truppen (...) den Kampf aufnehmen“
München - Berlin * König Ludwig II. telegrafiert seinem Vetter, dem Preußenkönig Wilhelm I.: „Mit Begeisterung werden Meine Truppen an der Seite ihres ruhmreichen Bundesgenossen für deutsches Recht und deutsche Ehre den Kampf aufnehmen.“
23. 7 1870 - Die Truppentransporte treffen in der Pfalz ein
Pfalz • Die Züge mit den Truppentransporten rollen in die Pfalz und an den Rhein.
25. 7 1870 - Die ersten Gefallenen im Deutsch-Französischen Krieg
Frœschwiller • In Schirlenhof, in der Nähe von Frœschwiller im Elsass, gab es auf beiden Seiten die ersten Gefallenen im Deutsch-Französischen Krieg.
30. 7 1870 - Bayerns Soldaten: Schwerfällig und auffällige Beleibtheit
Pfalz * Der preußische Kronprinz Friedrich vertraut seinem Kriegstagebuch seine Eindrücke über die bayerischen Truppen an: „Das preußische Auge freilich muss man ablegen, weil hier eben alles anders ist als bei uns, auch Schwerfälligkeit und auffällige Beleibtheit bereits unter den jüngeren Altersklassen vorwalten.“
8 1870 - Die Gemeindeverwaltung Bogenhausen will keinen ledigen Lehrer
Bogenhausen * Die Gemeindeverwaltung Bogenhausen wendet sich an die Lokalschulinspektion mit der Bitte: „Keinen ledigen Schullehrer hierher zu versetzen, der Verlockungen durch die nahe Stadt wegen“.
1. 8 1870 - Die Eisenbahn zum Transport der Truppen und der Geschütze
Deutschland - Frankreich * Die Deutschen können den etwa 265.000 französischen Soldaten etwa 500.000 Mann gegenüberstellen. Zielstrebig setzen die Deutschen die Eisenbahn zum Transport der Truppen und der Geschütze ein.
1. 8 1870 - Der Bayer rettet den preußischen Husaren
Stürzelbronn * In der Nähe der elsässischen Ortschaft Stürzelbronn stößt deutsche Kavallerie überraschend auf französische Truppen. Die Deutschen müssen sich unter heftigem Feuer zurückziehen. Herrmann Weihnacht vom bayerischen 5. Chevaulegersregiment nimmt dabei einen preußischen Husaren, der sein Pferd verloren hat, mit auf das seine und bewahrt ihn so vor Gefangenschaft.
2. 8 1870 - Saarbrücken wird von Franzosen kurzfristig besetzt
Saarbrücken * Frankreichs Armee greift mit drei Divisionen Saarbrücken an und kann dieses kurzfristig besetzen. Doch dann ziehen sich die französischen Truppen wieder zurück.
3. 8 1870 - 460.000 deutsche Soldaten in der Pfalz und im Saarland
Pfalz - Saarland • 460.000 Mann stehen in ihren Aufmarschplätzen in der Pfalz und im Saarland bereit.
4. 8 1870 - Die Kampfhandlungen beginnen in Weißenburg
Weißenburg • Die ersten Kampfhandlungen zwischen deutschen und französischen Truppen beginnen bei der elsässischen Grenzstadt Weißenburg. Erstmals tritt hier ein gesamtdeutsches Heer auf. Nach der Einnahme Weißenburgs wenden sich die Deutschen den französischen Stellungen auf dem Geisberg zu, auf dem sich auf halber Höhe das Schloss Geisberg befand, in welchem der französische General Abel Douay sein Hauptquartier eingerichtet hatte, sowie oben auf dem Berg ein Gehöft mit dem Namen Schafbusch.
Die französischen Truppen sind zwischen den beiden Gebäuden verteilt. Der Großteil der deutschen Truppen wird auf das Schloss Geisberg konzentriert. Die Franzosen sind im Schloss und in den Gebäuden allerdings gut verschanzt. Dadurch muss die Erstürmung des Geisbergs mit vielen Opfern bezahlt werden. Den Sieg in der Schlacht haben die Deutschen ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit zu verdanken. Scheinbar ist der französische General Douay auf die Schlacht nicht ausreichend vorbereitet. Die Verluste sind auf beiden Seiten erheblich. So gibt es auf deutscher Seite 700 Tote, Verwundete und Gefangene, auf französischer Seite waren es über Tausend, darunter General Abel Douay.
5. 8 1870 - Bayerns Selbstständigkeit und Integrität wird geachtet
Berlin - München * Der Preußenkönig Wilhelm I. versichert dem Märchenkönig Ludwig II., Bayerns Selbstständigkeit und Integrität zu achten.
6. 8 1870 - Kämpfe bei den Spicheren Höhen
Spichern * Die Spicheren Höhen bei Saarbrücken sind umkämpft. Die Schlacht wird nach ihrem Schauplatz, dem Dorf Spichern bei Forbach, nahe Saarbrücken, benannt. Ein Grund für den preußischen Sieg ist das zögerliche Verhalten der französischen Führung. Der Sieg der Preußen ist unvorhergesehen. Es war ein Risiko, einen Feind von unbekannter Truppenstärke und in starken Stellungen anzugreifen; der Angriff hätte in einer Niederlage enden können.
6. 8 1870 - Kämpfe auch bei Wörth
Wörth * Auch in Wörth prallen die deutschen und die französischen Soldaten aufeinander.
Bei Karl Graf von Rambaldi liest sich das so: „Zur Erinnerung an die Schlacht bei Wörth […], an welcher beide bayerischen Armeekorps […] mit Auszeichnung Anteil nahmen. […] Heiß war der Kampf; die die Weinberge dicht besetzt haltenden Turkos und Zuaven wehrten sich grimmig; aber unaufhaltsam war das Vordringen der Deutschen und zuletzt zerstob die französische Armee in wilder Flucht. […] Der Sieg war mit einem eigenen Verlust von 489 Offizieren und 10.153 Mann erkauft.”
9. 8 1870 - Die Eisenbahn hat die entscheidende Rolle für den Kriegsverlauf
Pfalz - Saarland • Deutschen Eisenbahnen befördern mit insgesamt 1.500 Zügen bis zum 9. August 640.000 Soldaten und 170.000 Pferde an die Aufmarschplätze. Anders ist dies in Frankreich, das im Jahr 1870 über das wohl modernste Eisenbahnnetz Europas verfügt. Doch was die Organisation der Truppentransporte betrifft, befindet sich das Land auf dem Stand von 1859. Bleibt festzustellen, dass von Mitte Juli bis Anfang August 1870 die Eisenbahn die entscheidende Rolle für den Kriegsverlauf hatte und der preußische Fahrplan besser war.
12. 8 1870 - Die ersten deutschen Truppenteile erreichen Straßburg
Straßburg * Die ersten deutschen Truppenteile erreichen die Umgebung von Straßburg. Sie schneiden die Stadt von der Außenwelt ab, indem sie die Eisenbahn- und Telegrafenverbindungen kappen. Die Verteidiger Straßburgs ziehen sich in die Festung zurück.
14. 8 1870 - Kämpfe bei den Dörfern Colombey und Nouilly
Colombey-Nouilly - Courcelles * Östlich von Metz, in der Nähe der zwei lothringischen Dörfer tobt die Schlacht bei Colombey-Nouilly. Der Kampf endet letztlich mit einem Sieg der Deutschen, wobei auf deutscher Seite 1.189, auf französischer Seite 377 Tote zu verzeichnen sind. Die Franzosen ziehen sich unter den Schutz der Forts von Metz zurück.
15. 8 1870 - Franz Xaver und Ludwig Schmederer erben den Nockhergarten
München-Au * Durch den Tod seiner Mutter kommt Franz Xaver Schmederer gemeinsam mit seinem Onkel Ludwig in den Besitz des Nockhergartens und des dort befindlichen Angers.
15. 8 1870 - Deutsche Truppen beginnen mit der Belagerung von Straßburg
Straßburg * An Napoleon Bonapartes Geburtstag beginnen die deutschen Truppen mit der Belagerung von Straßburg. Sie wird bis zum 27. September andauern.
16. 8 1870 - Siegreiche Kämpfe auch in Mars-la-Tour
Vionville - Mars-la-Tour * Eine weitere Schlacht des Deutsch-Französischen Krieges wird bei Mars-la-Tour, im Nordosten Frankreichs, etwa zwanzig Kilometer westlich von Metz, geschlagen. Zwei preußische Korps besiegen die zahlenmäßig deutlich überlegene komplette Französische Rheinarmee und zwingt diese zum Rückzug in die Festung Metz.
Die Schlacht ist ein großer strategischer Sieg für die Preußen. Frankreichs Truppen können nicht mehr nach Verdun flüchten, sondern müssen den Rückzug in die Festung Metz antreten. Gründe hierfür sind neben den hohen Menschen-Verlusten auch der Mangel an Munition.
16. 8 1870 - Die Einnahme der Festung Toul scheitert
Toul * Die Einnahme der Festung Toul durch scheitert am Widerstand der Besatzung.
18. 8 1870 - In Lothringen kommt es zur Schlacht von Gravelotte
Gravelotte - Saint Privat - Metz • In Lothringen kommt es zur Schlacht von Gravelotte, die auch Schlacht bei Saint Privat genannt wird. Es ist zugleich die letzte Schlacht um die Einkesselung der Festung Metz.
Beide Armeen büßen ein Achtel ihres Bestandes ein. Anders als in den meisten Schlachten zuvor fordert es in Gravelotte und Saint Privat einen erheblichen preußischen Blutzoll. Die Deutschen haben seit der Völkerschlacht bei Leipzig keinen verlustreicheren Kampf mehr geführt. Die geschlagene französische Rheinarmee zieht sich nach Metz zurück.
19. 8 1870 - Die Franzosen beschießen die deutsche Stadt Kehl
Straßburg - Kehl * Die Franzosen beschießen von Straßburg aus die deutsche Stadt Kehl auf dem rechten Rheinufer.
20. 8 1870 - Die Belagerung von Metz beginnt
Metz * Die Belagerung von Metz beginnt. Mehrere Ausbruchsversuche scheitern. Sie dauert bis zum 27. Oktober 1870 und endet mit einer vernichtenden Niederlage für die Franzosen.
23. 8 1870 - Straßburg wird beschossen
Straßburg * Die deutschen Geschütze eröffnen das Feuer auf die Stadt Straßburg und verursachen starke Schäden, auch am Straßburger Münster. Der Bischof von Straßburg bittet vergeblich um Einstellung des Feuers. Die Zivilbevölkerung schlägt vor, jeden Tag 100.000 Franc zu bezahlen, an dem die Stadt nicht bombardiert würde.
Der Beschuss hört allerdings erst auf, als man sich bewusst wird, dass ein fortgesetztes Bombardement zu viel Munition verbrauchen und schwerste Schäden in der Stadt anrichten würde. Man will jedoch die Stadt erobern und nicht zerstören.
24. 8 1870 - Straßburg im Bombardement
Straßburg * Während der Belagerung Straßburgs wird das Museum der Schönen Künste durch einen Brand und die Stadtbibliothek mit ihrer einzigartigen Sammlung mittelalterlicher Manuskripte, seltener Bücher aus der Zeit der Renaissance und römischer Artefakte vernichtet.
25. 8 1870 - Richard Wagner und Cosima von Bülow heiraten in Luzern
Luzern * Richard Wagner und Cosima von Bülow heiraten in Luzern.
1. 9 1870 - Joseph Anton Ritter von Maffei stirbt im Alter von 80 Jahren
München * Joseph Anton Ritter von Maffei stirbt im Alter von 80 Jahren. Sein Neffe Hugo Alois von Maffei führt die Firma weiter.
1. 9 1870 - Die vorentscheidende Schlacht von Sedan beginnt
Sedan • Die für den Deutsch-Französischen Krieg vorentscheidende Schlacht findet in Sedan, einer Stadt am Ufer der Maas, in der Nähe der belgischen Grenze statt.
1. 9 1870 - Kriegerische Auseinandersetzungen in Balan
Balan * Auch in Balan kämpfen französische Truppen wenig erfolgreich gegen die Deutschen. Da sich die französischen Offiziere nach dem Gefecht von Balan weigern, ihrem Befehlshaber weiter zu folgen, ziehen sie auf Weisung von Kaiser Napoleon III. den Rückzug in die Festung Sedan an.
1. 9 1870 - Kaiser Napoleon III. ergibt sich
Sedan * Am Abend hissen französische Soldaten, die den Kampf beendet sehen wollen, auf einem Turm der Festung von Sedan eine weiße Fahne.
Zur gleichen Zeit übergibt ein französischer General auf einer Anhöhe oberhalb der Stadt dem preußischen König Wilhelm I. einen Brief von Kaiser Napoleon III., in dem dieser schreibt: „Nachdem es mir nicht vergönnt war, in der Mitte meiner Truppen zu sterben, bleibt mir nichts übrig, als meinen Degen in die Hände Eurer Majestät zu legen.“
1. 9 1870 - Massaker in Bazeilles
Bazeilles * Bayerische Truppenteile greifen Bazeilles an. Der Kampf endet mit der völligen Vernichtung des Ortes. Ein Teil der Einwohner war bereits am Vorabend der Kämpfe geflohen. Dem in Bazeilles gebliebenen Teil der Bevölkerung wird die Beteiligung an Schießereien gegen die Bayern vorgeworfen. Zwar wird keiner der Zivilisten mit Waffen angetroffen, dennoch ermorden bayerische Soldaten noch am 1. September vierzig Frauen und Männer aus dem Ort, weitere 150 in den folgenden Tagen. Zudem werden 363 Häuser in Bazeilles niedergebrannt.
Der Kampf um Bazeilles ist für die Bayerische Armee besonders verlustreich und gilt in der deutschen Öffentlichkeit als „Ein blutiger Beitrag zur Bayerischen Waffenehre, ein ehrenvoller Kitt für die Deutsche Einigkeit“.
2. 9 1870 - Kaiser Napoleon III. begibt sich in preußische Gefangenschaft
Sedan * Nachdem über der Festung Sedan eine weiße Flagge gehisst worden ist, schweigen die Waffen. Preußenkönig Wilhelm I. schickt daraufhin zwei deutsche Parlamentäre zur Festung, um die Übergabe zu fordern. Sie werden direkt zu Kaiser Napoléon III. geführt, von dessen Anwesenheit die Deutschen bisher nichts gewusst haben.
Gegen 19 Uhr wird das Kapitulationsangebot an König Wilhelm von Preußen übergeben.
Der französische Kaiser Napoleon III. begibt sich in preußische Gefangenschaft und mit ihm 83.000 Offiziere und Soldaten. Zusätzlich waren schon während der Kampfhandlungen 21.000 Mann gefangen genommen worden. Frankreich hat damit keine handlungsfähige Armee mehr im Felde, weil die anderen 180.000 Mann nach wie vor in Metz eingeschlossen sind. Nur ein Korps hat sich der Einkesselung bei Sedan entziehen können und ist damit der letzte einsatzfähige Rest des französischen Feldheeres.
3. 9 1870 - Napoleon III. flieht nach Kassel
Sedan - Kassel * Als ab dem 3. September 1870 rund 104.000 französische Soldaten, darunter 4.000 bis 5.000 Offiziere, in die Kriegsgefangenschaft gehen, ist Kaiser Napoleon III. schon auf dem Weg nach Wilhelmshöhe bei Kassel, wo er den Friedensschluss abwarten soll.
Der französische Noch-Kaiser will schnellstens durch Belgien nach Kassel reisen. Seinem eigenen Volk misstraut er. Und seinen Soldaten tritt er nicht mehr gegenüber, so groß ist die Schmach der Niederlage.
3. 9 1870 - Die Siegesbotschaft aus Sedan trifft in Berlin ein
Berlin * Am Vormittag trifft die Siegesbotschaft aus Sedan in Berlin ein. In den Kirchen der deutschen Länder werden Dankgottesdienste gefeiert und „Nun danket alle Gott!“ gesungen. Beseelt von der Überzeugung, dass der Krieg nun bald beendet sein würde, umarmen sich unbekannte Menschen in den Straßen.
3. 9 1870 - Schlechte Nachrichten für Paris
Sedan - Paris * Am Nachmittag des 3. September dringt die Kunde von der Niederlage und der Gefangennahme durch ein Telegramm des Kaisers an die Kaiserin Eugénie nach Paris. Auf französischer Seite hat die Kapitulation der französischen Truppen das Ende des Zweiten Kaiserreichs und die Ausrufung der Dritten Republik zur Folge.
4. 9 1870 - Die Französische Republik wird ausgerufen
Paris * Volksmassen stürmen die Deputiertenkammer, kurz danach wird die Absetzung des Kaisers verkündet und die „provisorische“ Französische Republik ausgerufen, die den Krieg gegen die Deutschen fortsetzt. Die französischen Volksheere können zunächst die deutschen Angriffe zurückdrängen, zu keiner Zeit aber den deutschen Sieg ernsthaft gefährden.
4. 9 1870 - Die französische Kaiserin Eugénie flieht nach England
Paris * Die französische Kaiserin Eugénie verlässt am Nachmittag Paris und flieht nach England, nachdem die Demonstranten vor den Tuilerien unverhohlen ihren Kopf fordern und alles, was an Napoleon III. erinnert zerstören.
11. 9 1870 - Eine Delegation des Roten Kreuzes betritt Straßburg
Straßburg * Eine Delegation des Roten Kreuzes kann Straßburg betreten, um Alte und Kranke zu evakuieren. Nun erst erfahren die Straßburger von der Niederlage bei Sedan. Ihnen wurde bis dahin vom Stadtkommandanten Jean-Jacques Uhrich erzählt, dass ein 100.000 Mann starkes Entsatzheer auf dem Weg wäre. Jetzt verlässt viel Straßburger die Zuversicht.
12. 9 1870 - Die deutsche Belagerung von Toul beginnt
Toul * Die deutsche Belagerung von Toul beginnt. Sie dauert bis zum 23. September 1870.
12. 9 1870 - Bayern will Verhandlungen mit dem Norddeutschen Bund
München - Berlin * Der Ministerrat erbittet von König Ludwig II. die Ermächtigung, mit dem Norddeutschen Bund über eine verfassungsrechtliche Verbindung zu verhandeln. Dabei lehnt das Königreich Bayern einen Beitritt zum Norddeutschen Bund ab, stellt aber einen offiziellen Antrag auf Verhandlungen, um im Falle einer Reichsgründung möglichst viele Sonderrechte [= Reservatsrechte] zu erringen. Zudem fordert Bayern von Preußen
- die Rückzahlung der Kriegsentschädigung von 1866,
- den vollständigen Ersatz aller im gegenwärtigen Krieg anfallenden Kosten,
- den Verzicht auf die Düsseldorfer Galerie, auf die Preußen im Jahr 1866 Anspruch erhoben hatte, und
- einen Gebietszuwachs im Anschluss an die Pfalz.
13. 9 1870 - Ein Programm zum raschen Beitritt Bayerns
Berlin - München * Rudolph von Delbrück, der Präsident des Bundeskanzleramtes und Bismarcks Beauftragter für die Verhandlungen mit Württemberg und Bayern, legt ein Programm zum raschen Beitritt Bayerns vor. Das Deutsche Reich soll ein föderaler Staatenbund auf Grundlage des Norddeutschen Bundes werden, dem die Süddeutschen beitreten, ohne ihre Eigenständigkeit zu verlieren.
Daraufhin gibt König Ludwig II. dem Kanzler des Norddeutschen Bundes und preußischen Ministerpräsidenten, Otto von Bismarck, seine Bereitschaft zu einem Verfassungsbündnis bekannt.
15. 9 1870 - Karl Valentins älteste Schwester Elisabeth wird geboren
München-Au * Karl Valentins älteste Schwester Elisabeth wird geboren. Sie stirbt kurz nach der Geburt.
17. 9 1870 - Versailles wird von den deutschen Truppen besetzt
Versailles * Versailles wird von den deutschen Truppen besetzt.
ab 19. 9 1870 - Der Belagerungsring um Paris ist geschlossen
Paris * Der Belagerungsring um Paris ist geschlossen. Paris gilt zu diesem Zeitpunkt als „die am stärksten befestigte Stadt der Welt“. Die Stadt ist von einer zehn Meter hohen und sechs Meter breiten Mauer umgeben, die unter dem Bürgerkönig Louis Philipp nach 1830 erneuert worden war. Aber noch viel wichtiger als die Mauern sind die 16 Forts, die mit ihren Artilleriestellungen einen Schutzring von 53 Kilometern Länge um die Stadt bilden. Für die belagernde Armee bedeutete das, dass sie einen Einschließungsring von mindestens achtzig Kilometer bilden muss.
Nun kappen die Belagerer die Telegraphenleitungen nach Paris, sodass die Kommunikation mit dem restlichen Land nur mit Brieftauben aufrecht erhalten werden kann. Es kommen keine Vorräte mehr in die Stadt, in der sich über zwei Millionen Menschen befinden.
Die deutsche Heeresführung geht davon aus, dass die Versorgung der Stadt sechs Wochen hält, danach muss Paris kapitulieren. Die Belagerung mit preußischen und süddeutschen Truppen wird bis zum 28. Januar 1871 dauern.
19. 9 1870 - Scharmützel bei Sceaux
Sceaux * Eine deutsche Vorhut und die Truppen der Verteidiger von Paris treffen aufeinander. Obwohl die französischen Truppen zahlenmäßig weit überlegen sind, verlieren sie die Schlacht.
19. 9 1870 - Erste Friedensverhandlungen in Ferrières-en-Brie
Ferrières-en-Brie • Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck und Jules Favre, Außenminister und Repräsentant der französischen republikanischen Regierung, verhandeln im deutschen Hauptquartier in Ferrières-en-Brie über einen möglichen Friedensschluss.
- Bismarck bietet Favre einen 14-tägigen Waffenstillstand an. In dieser Zeit könnten die Wahlen zu einer neuen Nationalversammlung stattfinden. Er erhofft sich damit ein Wahlergebnis, das eine monarchisch orientierte Mehrheit hervorbringt und ihm die Verhandlungen erleichtert.
- Favre lehnt jedwede Abtretung französischen Territoriums ab,
- Bismarck besteht darauf, dass Straßburg und das Elsass deutsch werden muss.
20. 9 1870 - Die weltliche Herrschaft der Päpste beendet
Rom • Die weltliche Herrschaft der Päpste endet mit dem Einzug der italienischen Truppen in Rom. Der Kirchenstaat mit Latinum wird dem Königreich einverleibt.
Ab dem 22. 9 1870 - Bayern und Württemberg verhandeln auf der Münchner Konferenz
München • In der sogenannten Münchner Konferenz, die vom 22. bis zum 26. September 1870 in München stattfindet, besprechen die Vertreter Bayerns und Württembergs den von Rudolph von Delbrück vorgelegten Beitritts-Vorschlag zum Deutschen Reich.
23. 9 1870 - Die Friedensverhandlungen werden ergebnislos beendet
Ferrières-en-Brie • Die Verhandlungen über einen Friedensschluss zwischen Otto von Bismarck und Jules Favre werden ergebnislos abgebrochen.
23. 9 1870 - Toul hisst die Weiße Fahne
Toul • Die deutschen Belagerer beginnen Toul zu beschießen. Schon kurz darauf hisst die Besatzung die weiße Fahne.
23. 9 1870 - Ein Heißluftballon verlässt Paris
Paris • Von Montmartre aus bringt man Post mit einem Heißluftballon aus der besetzten französischen Hauptstadt Paris.
26. 9 1870 - Eine Einigung mit Preußen liegt in der Luft
München * Die Münchner Konferenz, bestehend aus Vertretern Württembergs und Bayerns, erkennen die Bedingungen der Norddeutschen Bundesverfassung über Bundesoberhaupt, Bundesrat und Reichsrat als annehmbar an. Eine Einigung mit Preußen liegt in der Luft.
27. 9 1870 - Straßburg kapituliert
Straßburg • Straßburg fällt. Nach deutschen Angaben feuerten 241 Geschütze 193.722 Geschosse in die Stadt. 500 Häuser werden vollständig zerstört. Am Straßburger Münster wurde der Dachstuhl beschädigt und eines der kunstvollen Fenster zerstört.
Karl von Rambaldi: „Leider gingen hiebei gegen 400 Häuser, darunter die berühmte Bibliothek mit wertvollen Büchern, zugrunde und wurden aus der Bürgerschaft Straßburgs 1.700 Personen teils getötet, teils verwundet.“
30. 9 1870 - Beginn der Planungen für Schloss Linderhof
Schloss Linderhof * König Ludwig II. beauftragt einen Anbau an das Königshäuschen im Graswangtal. Das ist der Beginn der Planungen für Schloss Linderhof.
10 1870 - Das Oktoberfest fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Der Deutsch-Französische Krieg zwingt zur Absage des Oktoberfestes.
Um 10 1870 - Der bayerische Herkules will seine Kunst jetzt auch öffentlich zeigen
München - Frankreich * Als Rekrut zieht der Steyrer Hans in den Deutsch-Französischen Krieg. Dort findet er neue Übungsgegenstände, wie ausrangierte Zugräder und Kanonenrohre. Angesichts des kargen Solds entschließt er sich, alle Kraft aufs Geldverdienen zu verwenden. Der „bayerische Herkules“ ist fest entschlossen, seine Kunst jetzt auch öffentlich zu zeigen.
11. 10 1870 - Orleans wird von deutschen Truppenverbänden eingenommen
Orleans * Orleans wird von deutschen Truppenverbänden eingenommen und später wieder aufgegeben.
Ab dem 3. 11 1870 - Belfort ist eingeschlossen
Belfort * Belfort ist eingeschlossen und erhält während der Belagerung mehr als 500.000 Artillerietreffer.
17. 11 1870 - Bismarck wird über König Ludwigs II. Geldprobleme informiert
München * Der Preußische Gesandte Georg Freiherr von Werthern informiert den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck über die Geldprobleme König Ludwigs II.:
„Der König von Bayern ist durch Bauten und Theater in große Geldverlegenheiten geraten. Sechs Millionen würden ihm sehr angenehm sein, vorausgesetzt, dass die Minister es nicht erfahren. Für diese Summe würde er sich auch zur Kaiser-Proclamation und Reise nach Versailles entschließen."
19. 11 1870 - Preußen wird über Prinz Ottos Gesundheitszustand informiert
München * Der Bismarck‘sche Presseagent Moritz Busch schreibt nach Berlin:
„Aus München meldet man, dass sich Prinz Ottos Gesundheitszustand fortwährend verschlimmert, dass man infolgedessen an seiner Sukzessionsfähigkeit zweifelt, und dass deshalb der König Ludwig sich der Familie Luitpold wieder nähert und ihr schon zweimal abends Besuche gemacht hat, was sonst nicht seine Gewohnheit ist.“
23. 11 1870 - Das Bündnis mit dem Norddeutschen Bund verbessert die Regelungen für Kinderarbeit
<p><strong><em>Berlin - München</em></strong> * Eine Verbesserung der Kinder-Schutzvorgaben in Bayern bringt der Bündnisvertrag des Königreichs mit dem Norddeutschen Bund vom 23. November 1870. Mit der Ausrufung des Deutschen Reichs werden deren Gesetze und Verordnungen auch in Bayern maßgeblich. Für die regelmäßig beschäftigten Fabrikarbeiter gilt nun </p> <ul> <li>ein Mindestalter von zwölf Jahren, </li> <li>für unter 14-jährige Beschäftigte eine maximale Arbeitszeit von sechs Stunden am Tag. </li> <li>die Arbeit an Sonn- und Feiertagen war verboten.</li> <li>Der Schulunterricht, der den Kindern zu erteilen war, die in Fabriken arbeiteten, sollte mindestens drei Stunden am Tag betragen. </li> </ul> <p>Das ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber der bisher in Bayern geltenden Verordnung. </p>
23. 11 1870 - Das Königreich Bayern kann sich mehrere Reservatrechte sichern
München - Berlin * In den sogenannten Novemberverträgen kann sich das Königreich Bayern mehrere Reservatrechte sichern. Sie betreffen vor allem
- das Militär,
- die Eisenbahn,
- das Post- und Telegrafenwesen,
- die Branntwein- und Biersteuer sowie
- die allgemeine Staatsverwaltung.
Die Reservatrechte sind von der Aufsicht und Gesetzgebung des Deutschen Reichs befreit. Eisenbahn, Post und Biersteuer stellen wichtige Einnahmequellen dar.
Das Bayerische Heer bildet - in Friedenszeiten - einen geschlossenen Bestandteil innerhalb der Streitkräfte des Deutschen Reichs. Es steht mit eigener Verwaltung unter der Hoheit des bayerischen Königs. Doch mit dem Beginn der Mobilmachung - und damit dem Eintritt des Kriegsfalles - untersteht das bayerische Militär direkt dem Kaiser.
28. 11 1870 - Prinz Otto warnt seinen Bruder eindringlich
München * Als König Ludwig II. als Regent des zweitgrößten Königreichs dem preußischen König Wilhelm I. die Kaiserkrone antragen soll, fleht ihn Prinz Otto an:
„Höre noch einmal meine Stimme; ich beschwöre Dich, das Schreckliche nicht zu tun!
Wie kann es denn für einen Herrn und König eine zwingende Gewalt geben, seine Selbstständigkeit dahinzugeben und außer Gott noch einen Höheren über sich anerkennen zu müssen! [...]
Mögen wir auch für den jetzigen Augenblick Vorteile und Zugeständnisse erlangen, die vielleicht von großem Umfang sind, so wiegen Sie doch gewiss nicht den hundertsten Teil von jenem Nachteil auf, den wir durch Dahingebung der Selbstständigkeit erleiden.“
Ganz schön weitblickend!
30. 11 1870 - Ludwig II. schreibt den Kaiserbrief an König Wilhelm I. von Preußen
München * Bayernkönig Ludwig II. schreibt den sogenannten Kaiserbrief an König Wilhelm I. von Preußen. Darin regt er die „Wiederherstellung der deutschen Kaiserwürde“ und eines Deutschen Reiches an. Im Namen aller Bundesfürsten trägt er dem Preußenkönig die Kaiserkrone, die höchste deutsche Würde, an.
Oberststallmeister Max Graf von Holnstein hat gemeinsam mit Bismarck den Brief entworfen, den der mit Zahnschmerzen im Bett liegende Bayernkönig nur ab- und unterschreiben muss. Noch am selben Tag reist Graf Holnstein nach Frankreich und überreicht dort den entscheidenden Brief an Prinz Luitpold.
Für diesen bayerischen Ausverkauf wird König Ludwig II. allerdings persönlich mit rund fünf Millionen Mark aus Bismarcks Welfenfond entschädigt. Jedenfalls wird dem König lange Zeit unterstellt, dass der Kaiserbrief der noble Preis für diese Rentenzahlung gewesen ist. Max Graf von Holnstein, der Überbringer des Geldes und Mitbegründer der Bayerischen Vereinsbank, ist mit zehn Prozent an diesem Deal beteiligt.
Um 12 1870 - Franz Lenbach bezieht drei Räume im ersten Stock des „Ateliergebäudes“
München-Maxvorstadt * Franz Lenbach bezieht drei Räume im ersten Stock des neuen „Ateliergebäudes“, das sich der „Bildhauer“ Anton Heß in der Luisenstraße 17 (heute HsNr. 37) hat erbauen lassen.
3. 12 1870 - Prinz Luitpold von Bayern übergibt den Kaiserbrief
Versailles * Prinz Luitpold von Bayern übergibt den „Kaiserbrief“ im Hauptquartier von Versailles an den preußischen König Wilhelm I..
- Der bayerische Märchenkönig Ludwig II. verhält sich also gegenüber Preußen sehr loyal, muss aber - statt belohnt zu werden - bayerische Rechte an das von Preußen geführte Reich abtreten.
- Nichts ist es mit der erhofften Vergrößerung des Bayernlandes,
- nichts mit der gewünschten alternierenden Kaiserkrone, derzufolge dem preußischen Kaiser einer aus dem bayerischen Herrscherhaus folgen soll.
Ein paar Reservatrechte, das Heer, die Post und die Eisenbahn betreffend, bleiben den süddeutschen Verbündeten. Ansonsten hat sie sich Bismarcks großpreußischem Staatengebilde unterzuordnen.
4. 12 1870 - Die Stadt Orleans gelangt erneut in deutsche Hand
Orleans * Die Stadt Orleans gelangt erneut in deutsche Hand. In den belagerten und beschossenen Städten leiden die Menschen nicht nur unter den direkten Kriegseinwirkungen, sondern auch unter Hunger und Krankheiten.
5. 12 1870 - Die Auflösung der Ludwigs-Walzmühle am Tivoli beschlossen
München-Englischer Garten - Tivoli * Weil im Gebäude der Ludwigs-Walzmühle am Tivoli inzwischen weder Tische noch Stühle vorhanden sind, findet die Generalversammlung der Königlich bayerischen Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft im Nebenzimmer des Gasthauses Zum Tivoli statt. Diese beschließt die Auflösung der Gesellschaft.
8. 12 1870 - Josef wird zum Patron der katholischen Kirche ernannt
Rom-Vatikan * Josef, der Nährvater Jesu, wird von Papst Pius IX. zum Patron der katholischen Kirche ernannt.
19. 12 1870 - Kanzler Otto von Bismarck leitet eine Verfassungsänderung in die Wege
Berlin * Nach König Ludwigs II. Kaiserbrief vom 30. November 1870 reagiert Kanzler Otto von Bismarck und leitet eine Verfassungsänderung in die Wege, durch welche die Bezeichnung „Deutscher Bund“ in „Deutsches Reich“ und „Deutscher Kaiser“ eingeführt wird.
Dies geschieht auch im Einvernehmen mit der bayerischen Regierung. Spätestens jetzt ist es mit der Souveränität Bayerns vorbei.
Ab 27. 12 1870 - Paris wird mit Granaten beschossen.
Paris * Paris wird mit Granaten beschossen.
30. 12 1870 - Die Kammer der Reichsräte beschließt den Beitritt zum Reich
München-Kreuzviertel * Zur Annahme der Versailler Verträge vom 23. November 1870 und dem damit verbundenen Reichsbeitritt ist im Bayerischen Landtag eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit notwendig.
Diese Verträge regeln die Modalitäten, unter denen die süddeutschen Staaten dem Deutschen Kaiserreich beitreten sollen. Dabei ist zu entscheiden, ob das Königreich Bayern selbstständig bleiben oder ein Teil des Deutschen Reiches werden soll.
Die Kammer der Reichsräte, der Vertretung des Hochadels, der Hochfinanz und der hohen Geistlichkeit, hat den Verträgen, die am 1. Januar 1871 in Kraft treten sollen, bereits an diesem 30. Dezember 1870 mit großer Mehrheit zugestimmt. Um die Souveränität des bayerischen Volkes preiszugeben, haben die erklärten „Sachwalter bayerischer Interessen“ genau einen Vormittag gebraucht.
31. 12 1870 - Der Export Münchner Bieres liegt bei 150.903 Hektoliter
München * Der Export Münchner Bieres liegt bei 150.903 Hektoliter.
31. 12 1870 - Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien liegt bei 592.618 Hektoliter
München * Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien liegt bei 592.618 Hektoliter.
1871 - Hubert und Lorenz Herkomer leben für sechs Monate bei Bauern in Garmisch
Garmisch * Hubert und sein Vater Lorenz Herkomer leben für sechs Monate bei Bauern in Garmisch.
1871 - Die Beamten-Relikten-Anstalt bietet Platz für rund 100 Frauen
Bogenhausen * Die Beamten-Relikten-Anstalt wird seinem Zweck zugeführt. Die von der Bevölkerung „Drachenburg“ genannte Einrichtung bietet Platz für rund 100 Frauen.
1871 - In Wien dürfen erst jetzt Frauen auf Kleinkunstbühnen auftreten
Wien * Im Gegensatz zu München dürfen in Wien erst jetzt Frauen auf Kleinkunstbühnen auftreten.
Ab 1871 - Sempers Opernpläne werden für das neue Dresdner Hoftheater verwendet
Dresden * Die Theater-Pläne von Gottfried Semper werden - mit geringfügigen Änderungen - für das neue Dresdner Hoftheater verwendet. Gottfried Sempers Sohn Manfred führt den Bau in den Jahren 1871 bis 1873 aus. Und so entsteht der heute weltberühmte Opernbau - an anderer Stelle - doch noch.
1871 - Die Lederfabrik ist eines der bedeutendsten Unternehmen Münchens
München-Untergiesing * Die Untergiesinger Lederfabrik ist zu einem der bedeutendsten Unternehmen Münchens aufgestiegen.
1871 - Die Todesstrafe nur mehr bei Mord und schweren Militärstraftaten im Krieg
Deutsches Reich * Die für das gesamte Deutsche Reich geltende Verfassung sieht die Todesstrafe nur mehr bei Mord und schweren Militärstraftaten im Krieg vor. Nur für Letztere wird die Vollstreckung durch Erschießen eingeführt.
1871 - Der Wintergarten auf dem Festsaalbau der Münchner Residenz ist fertig
München-Graggenau * Der Königliche Wintergarten auf dem Festsaalbau der Münchner Residenz ist fertiggestellt.
1871 - München hat 169.693 Einwohner
München * München hat 169.693 Einwohner.
1 1871 - Dreißig Handwerksmeister gründen den Meisterverein in München e.G.
München * 30 Handwerksmeister, die alle aus dem Katholischen Gesellenverein hervorgingen, gründen im Januar 1871 einen Verein unter dem Namen Meisterverein in München e.G..
- Als Ziele schreiben sie die „gegenseitige Unterstützung mit Rat und Tat im gewerblichen Leben“ in ihre Satzung.
- Außerdem wollen sie in monatlichen Zusammenkünften „Vorträge hören“ und „Erfahrungen austauschen“ sowie „sachgemäße Kassen“ gründen.
2. 1 1871 - Der Verein Münchener Brauereien e.V. wird gegründet
München * Der Verein Münchener Brauereien e.V., der sich bis heute als Hüter des Münchner Bieres versteht, wird gegründet, um die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den staatlichen Behörden besser durchsetzen zu können. Gleichzeitig fungiert er als Arbeitgebervereinigung der Münchner Braubetriebe.
Vor dem 16. 1 1871 - Alles eine Frage der richtigen Anrede
Versailles * Die Frage der richtigen Anrede des künftigen Kaisers sollte noch zu viel Ärger führen. Im „Kaiserbrief“ von König Ludwig II. benannte dieser den höchsten Repräsentanten mit „deutscher Kaiser“. Doch der Preußenkönig Wilhelm I. wollte den Titel „Kaiser von Deutschland“ und damit weitreichende Machtbefugnisse.
Der Titel „deutscher Kaiser“ strahlt für ihn keine Macht aus. Abfällig äußert er sich dazu: „Was soll mir der Charaktermajor?“ Gemeint damit ist zu dieser Zeit ein unbesoldeter Ehrentitel, mit dem man meist beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst geehrt wird. Dieser hat zwar alle äußerlichen Anzeichen einer Beförderung wie Uniform, Titel etc., jedoch keinerlei wirklichen Befugnisse. Also, ein Titel ohne jeden Wert. Dennoch hat der Norddeutsche Bund zuvor den Titel „deutscher Kaiser“ beschlossen.
17. 1 1871 - König Ludwig II. eröffnet den 24. Landtag
München-Graggenau • König Ludwig II. eröffnet den 24. Landtag, der sich mit dem Reichsbeitritt befassen muss, im Thronsaal der Residenz mit einer Thronrede. Es wird Ludwigs letzte Landtags-Eröffnung gewesen sein.
17. 1 1871 - Der angehende Kaiser flippt aus
Versailles • Dass der Norddeutsche Bund den Titel „deutscher Kaiser“ beschlossen hat, verärgerte den Preußenkönig Wilhelm I. derart, dass er noch bei den Schlussberatungen einen Tag vor der Proklamierung erklärt, „er wolle Kaiser von Deutschland oder gar nicht Kaiser sein“.
Weder Bismarck noch Wilhelms Sohn können ihn überzeugen. Im Gegenteil: „Im höchsten Zorn sprang der König schließlich auf, brach die Verhandlungen ab und erklärte, von der morgen angesetzten Feier nichts mehr hören zu wollen.“
18. 1 1871 - Prinz Otto empfindet die Kaiserproklamation als bedrückend
Versailles * Als König Wilhelm von Preußen in der Spiegelgalerie von Schloss Versailles zum Deutschen Kaiser ausgerufen wird, lässt sich der Bayernkönig Ludwig II. von Prinz Otto und seinem Onkel Luitpold vertreten. Otto empfindet die Kaiserproklamation als bedrückend. Seinem Bruder klagt er: „Der deutsche Kaiser, das deutsche Reich, Bismarck, die laute preußische Begeisterung, die vielen Stiefel, das alles macht mich sehr traurig“.
Ein böses Gerücht macht die Runde, in dem Otto nachgesagt wird, er hätte während der Proklamation zu Versailles „infolge einer plötzlichen Diarrhöe ein degoutantes Malheur gehabt“. Das heißt, er hat - aus ohnmächtiger Enttäuschung und Widerwillen, vielleicht aber auch schon als Folge seiner geistigen Zerrüttung - in die Hose gemacht. In Bayern geht der Satz um: „Otto hat auf Preußens Kaiserkrone geschissen!“
18. 1 1871 - Der Tag der Kaiserproklamation
Versailles • Als Tag der Kaiserproklamation hat man den 18. Januar 1871 auserkoren. Es ist der Tag, als Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg im Jahr 1701 zum ersten preußischen König Friedrich I. gekrönt und damit zugleich das Königreich Preußen gegründet worden ist. Mit der Terminwahl will das Haus Hohenzollern an seinen Aufstieg innerhalb von 170 Jahren von Kurfürsten zu mächtigen Monarchen Europas erinnern.
18. 1 1871 - Die Frage der richtigen Anrede geht weiter
Versailles • Da sich auch am frühen Tag der Proklamation noch nicht abzeichnete, wie die unwillige Hauptperson, König Wilhelm I. reagieren würde, nimmt Bismarck mit dem ranghöchsten anwesenden Fürsten, der den Kaiser proklamieren soll, Kontakt auf. Es ist dies Friedrich I., der Großherzog von Baden. Auf die Frage, wie er gedenke, Wilhelm auszurufen, schockiert dieser Bismarck mit den Worten: „Kaiser von Deutschland, auf Befehl Seiner Majestät.“
Bismarck bittet den Großherzog inständig, Wilhelm I. von der Unmöglichkeit dieser Titulatur zu überzeugen, da dies die süddeutschen Monarchen kaum akzeptieren würden. Außerdem lautet der verfassungsmäßige Titel seit dem 1. Januar bereits „Deutscher Kaiser“.
18. 1 1871 - Otto von Bismarck fällt ein Stein vom Herzen
Versailles • Um 12 Uhr beginnt die Zeremonie der Kaiserproklamierung im prachtvollen Schloss des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV.. Nach einer kurzen Rede Wilhelms I., in der er die Kaiserwürde annimmt, verliest Reichskanzler Otto von Bismarck die Proklamation. Dann wird es spannend. Der Großherzog von Baden tritt nach vorne und ruft: „Seine Kaiserliche und Königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch! Hoch! Hoch!“ Eine elegante Lösung. Otto von Bismarck fällt ein Stein vom Herzen.
Gleichzeitig wird auch das Zweite Kaiserreich gebildet und ausgerufen.
19. 1 1871 - Der letzte Durchbruchversuch der Verteidiger von Paris
Paris • Die Verteidiger der französischen Hauptstadt Paris unternehmen einen letzten Durchbruchsversuch, der aber von den Belagerern mühelos zurückgeschlagen werden kann.
20. 1 1871 - Ein geplanter Ausbruch unterbleibt
Paris • Ein für den 20. Januar geplanter Ausbruch unterbleibt, nachdem bekannt worden war, dass die Loirearmee geschlagen ist. Am Nachmittag berät die Regierung zusammen mit zwanzig Arrondissements-Bürgermeistern die Lage.
21. 1 1871 - Auch die Abgeordnetenkammer stimmt dem Beitritt zum Kaiserreich zu
München-Kreuzviertel * Nach einer zehnstündigen Redeschlacht stimmen 102 Abgeordnete für den Beitritt Bayerns zum Deutschen Kaiserreich und nur noch 48 dagegen. Damit ist die Zweidrittelmehrheit - wenn auch knapp - erreicht.
Das im Jahr 1871 gegründete Deutsche Reich ist nach der Präambel seiner Verfassung ein „ewiger Bund zum Schutz des deutschen Bundesgebietes und des innerhalb dieses gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes“.
Diesen Bund schließen die 22 Repräsentanten
- der vier Königreiche Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen;
- der sechs Großherzogtümer Baden, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Hessen-Darmstadt, Oldenburg und Sachsen-Weimar;
- der fünf Herzogtümer Braunschweig, Anhalt, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Altenburg;
- der sieben Fürstentümer Schwarzburg-Sonderhausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss ältere Linie, Reuss jüngere Linie, Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe, des mitregierten Reichslandes Elsass-Lothringen sowie
- der Regierenden Bürgermeister der drei Freien Städte Hamburg, Bremen und Lübeck.
Dieser Bundesstaat wird durch zwei Institutionen - Bundesrat und Reichstag - repräsentiert. Verfassungsrechtlich ist der Bundesrat das höchste Reichsorgan, in dem Preußen aufgrund seiner Größe und seiner hegemonialen Stellung dominiert.
In diesem Gremium sind die einzelnen Länder entsprechend ihrer Größe mit unterschiedlichen Stimmenzahlen ausgestattet vertreten:
- Preußen 17,
- Bayern 6,
- Sachsen und Württemberg je 4,
- Baden und Hessen je 3,
- die kleineren je 2 oder 1 -
- insgesamt 58 Stimmen.
28. 1 1871 - Paris ergibt sich den Deutschen Truppen
Paris * Paris ergibt sich den Deutschen Truppen. Das führt auch zur Niederlage der neubegründeten Dritten Republik Frankreichs und zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs.
28. 1 1871 - Der Waffenstillstand mit Frankreich tritt in Kraft
Berlin - Paris * Der Waffenstillstand mit Frankreich tritt in Kraft.
30. 1 1871 - König Ludwig II. unterzeichnet die Beitritts-Verträge
München * König Ludwig II. setzt mit seiner Unterschrift die Beitritts-Verträge rückwirkend zum 1. Januar 1871 in Kraft. Doch trotz aller Zugeständnisse bedeutete die Reichsgründung für Bayern und seinen König
- eine deutliche Einschränkung der Souveränität,
- den Verlust der staatsrechtlichen Unabhängigkeit und
- eine Unterstellung der Monarchie der Wittelsbacher unter die Vorherrschaft der Hohenzollern.
12. 2 1871 - In Bordeaux trifft sich die verfassungsgebende Versammlung
Bordeaux * In Bordeaux trifft die verfassungsgebende Versammlung zusammen. In ihr sind mehr als doppelt so viele Monarchisten als Republikaner vertreten. Dagegen sind die städtischen Gemeinderäte in ihrer Mehrheit entschlossen republikanisch.
15. 2 1871 - Weitreichende deutsche Forderungen
Bordeaux - Versailles • Die deutschen und die französischen Verhandlungsführer einigen sich auf eine Verlängerung des Waffenstillstands bis zum 26. Februar und weiten ihn auf ganz Frankreich aus.
Das Deutsche Reich forderte von Frankreich
- das Elsass und Teile von Lothringen,
- dazu eine Entschädigung von sechs Milliarden Goldfranc
- sowie eine Parade der deutschen Truppen in Paris.
- Die Besetzung der Stadt sollte bis zur Unterzeichnung eines vorläufigen Friedensvertrages anhalten.
- Bis zur Abwicklung der vollständigen Zahlung - vorgesehen ist der 2. März 1874 - sollen deutsche Truppen stationiert bleiben und Teile des Landes besetzen.
16. 2 1871 - Die Festung Belfort kapituliert
Belfort • Die Festung Belfort kapituliert auf Weisung der französischen Regierung, ohne militärisch besiegt zu sein. Die Übergabe war zur Bedingung für die Verlängerung des Waffenstillstandes gemacht worden. Die Garnison erhält freien Abzug unter Mitnahme ihrer Waffen und Feldgeschütze.
16. 2 1871 - Paraphierung des Vorfriedens von Versailles
Versailles • Paraphierung des Vorfriedens von Versailles zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich.
17. 2 1871 - Adolphe Thiers wird Chef der Regierung der nationalen Verteidigung
Bordeaux • Die neugewählte verfassungsgebende Versammlung wählt Adolphe Thiers zum Chef der „Regierung der nationalen Verteidigung“.
1. 3 1871 - 20.000 deutsche Soldaten paradieren in Paris
Paris * 20.000 deutsche Soldaten, darunter 1.000 bayerische, marschieren in Paris ein und paradierten auf dem Longchamps vor dem Deutschen Kaiser Wilhelm I.. Die Parade ist der der Abmachung vom 15. Februar 1871.
1. 3 1871 - Der Versailler Vorfriede wird unterzeichnet
Bordeaux • Der Versailler Vorfriede wird in Bordeaux von der französischen Regierung unterschrieben.
2. 3 1871 - Der unterschriebene Vorfriede wird ausgetauscht
Bordeaux • Der von der französischen Regierung unterschriebene Vorfriede wird mit der deutschen Delegation ausgetauscht.
3. 3 1871 - Die Nationalversammlung stimmt dem vorläufigen Friedensschluss zu
Bordeaux * Die in Bordeaux zusammengetretene französische Nationalversammlung stimmt dem vorläufigen Friedensschluss mit 552 gegen 107 Stimmen zu.
3. 3 1871 - Die deutschen Truppen müssen Paris wieder verlassen
Paris • Die deutschen Truppen müssen zwei Tage nach ihrem triumphalen Einmarsch in Paris die französische Hauptstadt schon wieder verlassen.
5. 3 1871 - Rosalie Luxemburg wird in Zamosc geboren
Zamosc * Rosalie Luxemburg wird in Zamosc in Russisch-Polen als Tochter des Holzhändlers Eliasz Luxemburg und dessen Frau Line geboren.
10. 3 1871 - Versailles zum Sitz von Regierung und Parlament bestimmt
Paris • Die französische Nationalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Ministerpräsidenten Adolphe Thiers nicht Paris, sondern Versailles zum vorläufigen Sitz von Regierung und Parlament. Versailles war inzwischen von den deutschen Truppen geräumt worden.
15. 3 1871 - Der Ostbahnhofs und die Bahnlinie werden eingeweiht
München-Haidhausen * Das Empfangsgebäude des Braunauer Bahnhofs wird eröffnet. Spätestens jetzt bricht für das Ostend das Eisenbahnzeitalter an. Allerdings verlassen zunächst nur drei Personen- und wenige Güterzüge den Hauptbahnhof über die neue Isarbrücke durch Untergiesing zum Braunauer Bahnhof und weiter in Richtung Rosenheim und nach Simbach/Braunau am Inn.
15. 3 1871 - Gründung der Kunstmühle Tivoli von K. Kurlaender & Comp.
München-Englischer Garten - Tivoli * Frühere Aktionäre der Königlich bayerischen Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft gründen unter dem Namen Kunstmühle Tivoli von K. Kurlaender & Comp. - Commanditgesellschaft in Tivoli bei München eine neue Gesellschaft.
15. 3 1871 - Auch für Giesing bricht das Eisenbahnzeitalter an
München-Untergiesing * Für Giesing bricht das Eisenbahnzeitalter an. Doch zunächst verlassen nur drei Personen- und wenige Güterzüge den Hauptbahnhof über die neue Isarbrücke durch Untergiesing in Richtung Rosenheim und weiter nach Braunau.
15. 3 1871 - Die Baulinie für das Eichthal‘sche Areal ist bereits genehmigt
München-Haidhausen * Bis zur Eröffnung des Empfangsgebäudes des von Friedrich Bürklein entworfenen Braunauer Bahnhofs haben die Münchner Gemeindebevollmächtigten die Baulinie für das angrenzende Eichthal‘sche Areal bereits genehmigt.
18. 3 1871 - In Paris kommt es zum Kommune-Aufstand
Paris * In der französischen Hauptstadt kommt es zum Kommune-Aufstand, in deren Verlauf Paris den Versuch macht, eine demokratische und soziale Republik zu gründen. Die Pariser Commune will die Auflösung Frankreichs in eine Föderation von autonomen kleinen Gemeindeverwaltungen
- mit eigener Rechtsprechung,
- eigenem Militär und
- eigenem Unterrichtswesen,
- der Verstaatlichung der Produktion
- und so fort.
- Die rote Fahne und
- der Revolutionskalender werden eingeführt,
- ein Wohlfahrtsausschuss und
- ein Revolutionstribunal eingesetzt,
- Geiseln ausgehoben sowie
- Kirchen und Klöster geschlossen.
Doch Paris bleibt alleine, nachdem sich die Gemeinderäte der großen Provinzstädte versagen. Alleine muss Paris nun den Kampf gegen die konservative Republik ausfechten, die ihren Sitz nach Versailles verlegt hat. Dort befindet sich auch das deutsche Hauptquartier.
Die Auseinandersetzungen finden unter den Augen der deutschen Militärs statt. Den Petroleumbrennern der Communards fallen zahlreiche öffentliche Gebäude zum Opfer, darunter die Tuilerien; über siebzig bürgerliche Geiseln werden erschossen, darunter der Erzbischof von Paris.
18. 3 1871 - Die französische Regierung flieht nach Versailles
Versailles • Die französische Regierung flieht nach Versailles.
19. 3 1871 - Ex-Kaiser Napoleon III. verlässt die Wilhelmshöhe
Kassel • Der französische Ex-Kaiser Napoleon III. verlässt die Wilhelmshöhe in Kassel, von wo aus er mehrfach versucht hat, sein gescheitertes Regime wiederherzustellen. Doch das französische Volk hatte von ihrem bisherigen Staatsoberhaupt einfach genug. Er geht ins Exil nach Großbritannien.
21. 3 1871 - Napoleon III. trifft in seinem Exil in Chislehurst ein
Chislehurst • Der französische Ex-Kaiser Napoleon III. trifft in seinem Exil in Chislehurst, im heutigen Stadtbezirk London Borough of Bromley, ein.
28. 3 1871 - Das Grazer Landstädtische Theater brennt ab
Graz * Das Grazer Landstädtische Theater brennt ab.
16. 4 1871 - Die Reichsverfassung wird rechtskräftig
Deutsches Reich - Königreich Bayern * Die Reichsverfassung wird rechtskräftig.
Das Zweite Deutsche Kaiserreich ist ein Bundesstaat, dem - unter preußischer Hegemonie - 25 Einzelstaaten angehören. Der preußische Ministerpräsident ist gleichzeitig Reichskanzler.
Das Deutsche Reich ist nach der Präambel seiner Verfassung ein „ewiger Bund zum Schutze des deutschen Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes“.
Diesen Bund schließen die 22 Repräsentanten:
- der vier Königreiche Preußen, Bayern, Württemberg und Sachsen;
- der sechs Großherzogtümer Baden, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Hessen-Darmstadt, Oldenburg und Sachsen-Weimar;
- der fünf Herzogtümer Braunschweig, Anhalt, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Altenburg;
- der sieben Fürstentümer Schwarzburg-Sonderhausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss ältere Linie, Reuss jüngere Linie, Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe,
- des mitregierten Reichslandes Elsass-Lothringen sowie
- der Regierenden Bürgermeister der drei Freien Städte Hamburg, Bremen und Lübeck.
Dieser Bundesstaat wird durch zwei Institutionen - Bundesrat und Reichstag - repräsentiert. Verfassungsrechtlich ist der Bundesrat das höchste Reichsorgan, in dem Preußen aufgrund seiner Größe und seiner hegemonialen Stellung dominiert.
In diesem Gremium sind die einzelnen Länder entsprechend ihrer Größe mit unterschiedlichen Stimmenzahlen ausgestattet vertreten: Preußen 17, Bayern 6, Sachsen und Württemberg je 4, Baden und Hessen je 3, die kleineren je 2 oder 1 - insgesamt 58 Stimmen.
Bis im Rahmen der Reichsgründung auch in Bayern das metrische Maß eingeführt wird, fasst die Bayerische Mass 1.069 Kubikzentimeter. Durch die Preußische Maß- und Gewichtsordnung wird das Bayerische Maaß abgeschafft. Als gesamtdeutsche Maßeinheit gilt nun der Liter. Und dieser ist auf 1.000 Kubikzentimeter festgelegt worden.
17. 4 1871 - Ignaz von Döllinger wird in aller Form exkommuniziert
München * Ignaz von Döllinger wird vom Erzbischof von München und Freising, Gregor von Scherr, in aller Form exkommuniziert. Er bleibt es bis an sein Lebensende. In der Karwoche 1871 liest er in der Hofkapelle zum letzten Mal die Messe.
Daraufhin beschließen die Ratskollegien der Stadt, Magistrat und Kollegium der Gemeindebevollmächtigten, ihm „wegen seiner mutigen Haltung gegen Rom“ das Ehrenbürgerrecht der Stadt München zu verleihen. Doch das lehnt Ignaz von Döllinger ab.
5 1871 - Die Münchner Pfingsterklärung wird verfasst und unterschrieben
München * In einer Zusammenkunft bei Ignaz von Döllinger unterschreiben dreißig Gegner der neuen Dogmen der römisch-katholischen Kirche die „Münchner Pfingsterklärung“, in der sie die gegen sie verhängten Maßregelungen als ungültig und unverbindlich erklären.
10. 5 1871 - Die Provinzen Elsaß und Lothringen fallen an Deutschland
Berlin * Der Frankfurter Friedensschluss kostet Frankreich im Wesentlichen die Provinzen Elsass und Lothringen sowie eine Kriegsentschädigung von fünf Milliarden Gold-Franc.
Der deutsch-französische Krieg von 1870/71 war ein Krieg der modernen Technik und der Massenheere, der zu den Schrecken des ungebändigten totalen Kriegs des 20. Jahrhunderts führen wird. Bismarcks wichtigstes Kriegsziel, die „dauerhafte Beseitigung der Kriegsgefahr an der deutschen Westgrenze“, ist schon beim Friedensschluss bedroht, weshalb zwei grausame Weltkriege mit Millionen Toten folgen werden.
Eine betont kriegerische und verherrlichende Geschichtsschreibung verstellt auf beiden Seiten den Blick auf das Kriegselend. „Das erste Preußengrab für Deutschlands Einheit - Der Schwur auf die Fahne führte sie alle zum Heldentod fürs Vaterland - Gott verleihe den Helden droben die Siegespalmen - für Deutschlands Ehre weiht jedes deutsche Frauenherz Gatten, Sohn und Bruder gern dem Heldentod“. Diese Worte werden in ein Denkmal auf dem Gaisberg, nahe Weißenburg, geschlagen.
10. 5 1871 - Prinz Otto, König Ludwigs II. Bruder, steht unter ärztlicher Überwachung
München * Prinz Otto, König Ludwigs II. Bruder, steht unter ärztlicher Überwachung. Sein Krankheitsbild wird bald darauf von Syphilis in Paranoia abgeändert.
18. 5 1871 - Franziska Gräfin zu Reventlow wird geboren
Husum * Franziska „Fanny“ Gräfin zu Reventlow, die später als „Skandalgräfin“ oder „Schwabinger Gräfin“ der Münchner Bohème und als Autorin des Schlüsselromans „Herrn Dames Aufzeichnungen“ bekannt werden wird, kommt in Husum zur Welt.
21. 5 1871 - Die Truppen der Versailler Regierung beginnen mit dem Sturm auf Paris
Paris * Die Truppen der Versailler Regierung beginnen mit dem Sturm auf Paris. Die „Blutige Woche“ beginnt.
28. 5 1871 - Die „Blutige Woche“ endet
Paris * Die „Blutige Woche“, in deren Verlauf grausame Rache an den aufständischen Frauen und Männer aus Paris geübt wird, endet auf dem Friedhof von Père-Lachaise. Rund 30.000 Tote, mindestens 50.000 Verschwundene, fast 40.000 Verhaftete sind die Opfer. Die Mehrzahl der 13.000 Verurteilten werden nach Neukaledonien deportiert.
So etwas, darüber sind sich die konservativen Politiker und Militärs - in Hinblick auf die deutsche Sozialdemokratie - einig, darf in Deutschland nie passieren. Die in Paris gemachten Erfahrungen münden später in das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen“, kurz gesagt, das „Sozialistengesetz“ vom 21. Oktober 1878.
1. 6 1871 - Die Ruhe und der Beschaulichkeit in Untergiesing ist dahin
München - Braunau - Linz - Wien * Die über Mühldorf nach Simbach/Braunau am Inn führende Hauptverkehrsstrecke der Eisenbahn wird eröffnet. Sie führt weiter über Linz nach Wien. Spätestens ab jetzt ist es mit der Ruhe und der Beschaulichkeit in Untergiesing vorbei.
Während die neue Streckenführung für den Güter- und Personenverkehr einen erheblichen Zeitgewinn bedeutet und reiche Spekulanten noch reicher macht, ist die Bahnlinie für Untergiesing mit erheblichen Nachteilen verbunden und bringt für die ansässigen Bewohner neben einer Lärmbelästigung noch zusätzlichen Gestank und einen sieben Meter hohen, die ganze Ortsflur durchtrennenden Bahndamm.
Der gewünschte Bahnhof, verbunden mit der Möglichkeit der Ansiedelung von Industrieanlagen, bleibt den Untergiesingern ebenfalls versagt. War zu Beginn noch von einer Station mit Güterhalle die Rede, so verwarf die Generaldirektion auch diese Pläne, da Bodenuntersuchungen die Untergiesinger Isarauen als denkbar ungünstiges Areal für einen Bahnhof bezeichneten.
Das bedeutet für die Stadt München, dass sie nach einen neuen Standort für den Städtischen Schlacht- und Viehhof suchen muss, der ursprünglich zwischen Schyrenbad und Stadtgartendirektion geplant war.
18. 6 1871 - „Der Proletarier“ stellt sein Erscheinen ein
München * Die sozialdemokratische Zeitung „Der Proletarier“ stellt sein Erscheinen ein, nachdem die Redakteure Robert Neff und Jacob Franz wegen Beleidigung der Staatsregierung zu drei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden sind.
30. 6 1871 - Die SAP hat etwa 500 Mitglieder in ganz Bayern
Königreich Bayern - München * Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei - SAP hat etwa 500 Mitglieder in ganz Bayern, in München 43.
9. 7 1871 - Bürgermeister Alois von Erhardt stellt das Franzosenviertel-Konzept vor
München-Haidhausen * Das Einverständnisschreiben des Innenministeriums für die „Straßenzüge zum Braunauer Bahnhof in der Vorstadt Haidhausen“ enthält gegenüber der Ursprungsplanung nur geringfügige Änderungen. Daraufhin kann Bürgermeister Alois von Erhardt noch im gleichen Monat das Konzept der Öffentlichkeit vorstellen.
Das Franzosenviertel ist von dem Münchner Stadtbaurat Arnold Zenetti streng geometrisch als Dreistrahlanlage geplant worden. Das Konzept umschließt das künftige Straßennetz zwischen dem Bahngelände, der Stein-, Rosenheimer-, Wolfgang- und der Äußeren-Wiener-Straße und sieht den Ostbahnhof und das ihn umgebende Rondell des Orleansplatzes als Mittelpunkt des Viertels vor. „Diese Zentrierung auf den Ostbahnhof nimmt sich wie die Persiflage eines residenzstädtischen Grundrisses aus, im dem - dem Arbeiterviertel entsprechend - der Platz des Herrscherhauses von dem Pendlerbahnhof eingenommen wird“.
Damit die neue Wohnsiedlung an die Vorstadt Haidhausen und an das Gasteig-Gelände angebunden werden kann, sind in Zenettis Planungskonzepten Straßendurchbrüche von der Wörth- zur Preysingstraße und Verbreiterungen der Rosenheimer-, Stein- und Milchstraße vorgesehen. Im Gegensatz zu der am Beginn des 19. Jahrhunderts angelegten Maxvorstadt und zu dem ab dem Jahr 1860 erbauten Gärtnerplatz-Viertel haben die Straßen und Plätze des Franzosenviertels erstmals unterschiedliche Breiten. Dafür sind - neben verkehrstechnischen - vor allem ästhetische Gesichtspunkte ausschlaggebend.
Vom 530 Fuß messenden, halbkreisförmigen Orleansplatz ausgehend, bildet die 100 Fuß breite Wörthstraße die Mittelachse der symmetrischen Dreistrahlanlage. Ihre Aufweitung - der früher als Forum bezeichnete heutige Bordeauxplatz - bildet den prunkvollen Mittelpunkt innerhalb des Franzosenviertels. An seiner Stelle beträgt die Straßenbreite 200 Fuß. Ein ebenfalls 100 Fuß breites Straßenprofil verzeichnen die Rosenheimer- und die Orleansstraße. Die Weißenburger- und die Belfortstraße verlassen das Rondell am Orleansplatz als Diagonalachsen. Diese Verkehrswege messen, ebenso wie die sie kreuzende Pariser- und Breisacher Straße 60 Fuß in der Breite. Die restlichen Straßen haben eine Breite von 50 Fuß.
An den beiden diagonal verlaufenden Straßenzügen sind Platzanlagen geplant. So folgt an der Weißenburger Straße dem 220 Fuß messenden, rechteckigen Pariser Platz der im Durchmesser 300 Fuß umfassende, kreisrunde Weißenburger Platz. Spiegelbildlich zum Pariser Platz soll an der Belfortstraße ebenfalls eine quadratische Platzanlage, der Straßburger Platz, angelegt werden. Die Planung, die mit ihrer symmetrischen Straßenführung an eine barocke Bauweise erinnert, kann aber nur dort verwirklicht werden, wo sich der Grund in der Hand eines Besitzers befindet.
Im Gegensatz zu dem Baugebiet das sich überwiegend im Besitz Carl von Eichthals befindet und das etwa bis zur Wörthstraße reicht, scheitert nördlich davon der weitere Ausbau am Kloster der Frauen zum guten Hirten, das das Gelände des ehemaligen Preysing-Schlosses seit 1840 besitzt. Die Klosterverwaltung lehnt jeden Verkauf der notwendigen Grundstücke zur Fertigstellung des Franzosenviertels ab und tritt nicht einmal einen Quadratmeter Grund für die Straßenanlagen ab.
Ein Opfer dieser unnachgiebigen Haltung wird der Straßburger Platz den der Königlich-bayerische Major a.D., Karl Graf von Rambaldi, im Jahr 1894 in seiner Zusammenstellung der Münchner Straßennamen wie folgt beschreibt: „Straßburgerplatz. Liegt in Haidhausen zwischen der Elsaß-, Pariser- und Belfortstraße, nördlich vom Ostbahnhofe“. Doch ohne ein Entgegenkommen der Klosternonnen kamen die weiteren Planungsarbeiten für dieses Gebiet ins Stocken. Dies auch,
- weil einerseits keine aussichtsreichen Enteignungsmöglichkeiten bestehen,
- andererseits, weil sich in den Zeiten der geometrischen Stadtplanung kein Verantwortlicher zu einer Planänderung entschließen kann.
Erst mit dem Amtsantritt Theodor Fischers, dem Vorstand des Münchner Stadterweiterungsbüros, werden die Planungen wieder aufgenommen.
29. 7 1871 - Die Universität wählt Ignaz von Döllinger zu ihrem Rektor
München-Maxvorstadt * Die Universität wählt Ignaz von Döllinger zu ihrem Rektor.
1. 8 1871 - Der erste tödliche Unfall nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie
München-Untergiesing * Schon wenige Monate nach Eröffnung der Eisenbahnlinie über den Ostbahnhof nach Braunau kommt es zum ersten tödlichen Unfall. Die Frau des Gemeindebevollmächtigten Wilhelm Kanzler, der in Obergiesing die bekannte Gastwirtschaft Zum Giesinger Weinbauern betreibt, stirbt.
Mutter Kanzler ist mit ihrem Sohn in der Kutsche über den Giesinger Berg in Richtung Innenstadt gefahren. Bei der Eisenbahnbrücke erschreckt ein heraneilender Zug das Pferd so sehr, dass es scheut, die Kutsche umwirft und beide Insassen unter sich begräbt. Während der Sohn mit leichten Blessuren davonkommt, stirbt die Mutter an ihren Verletzungen.
Es kommt fast täglich zu solchen Unfällen, „weil die Bauernpferde aus den außergelegenen Dörfern noch keinen Kurs bezüglich der Vorsichtsmaßregeln genommen und jetzt wie früher scheuen und durchgehen“.
3. 8 1871 - Vorlesungsverbot für Münchner Theologiestudenten
München * Das Münchner Ordinariat untersagt den Theologiestudenten den Besuch der Vorlesungen von Ignaz von Döllinger.
9 1871 - Auf Anregung Döllingers tagt in München der erste Altkatholikenkongress
München * Auf Anregung Ignaz von Döllingers tagt in München der erste Altkatholikenkongress. Der Gelehrte hat das Stichwort von der „alten katholischen Kirche“ geprägt und meint damit „alt“ im Sinne von „ursprünglich“. Döllinger warnt zwar eindringlich vor der sich anbahnenden Kirchenspaltung, doch ist die Gründung der Altkatholischen Kirche unumgänglich.
Nach 9 1871 - Bier nach Wiener Art wird das erfolgreiche Wiesn-Märzenbier
München-Au - München-Theresienwiese * Gabriel Sedlmayr junior vom Leistbräu entwickelt ein neues, stärker eingebrautes untergäriges Bier nach Wiener Art. Es wird sich zum erfolgreich auf der Wiesn angeschenkten Märzenbier entwickeln. Erstmals wird es im Jahr 1872 im Schottenhamel-Festzelt ausgeschenkt.
25. 9 1871 - Separatvorstellung des Oberammergauer Passionsspieles für Ludwig II.
Oberammergau * Separatvorstellung des Oberammergauer Passionsspieles für König Ludwig II..
Bis zum 1. 10 1871 - Die Bewohner von Elsaß und Lothringen können das Land verlassen
Elsass - Lothringen * Die Bewohner der Provinzen Elsaß und Lothringen können bis zum 1. Oktober das Land um den Preis des Heimatverlustes verlassen. Das Angebot nehmen vorwiegend Staatsbedienstete, junge Leute und Industrielle an.
11. 11 1871 - Die Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern wird gegründet
München * Die Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern wird als Lehranstalt für weltliche Lehrerinnen durch einen Beschluss des Bayerischen Landtags gegründet. Damals werden Schulen nur von klösterlichen Lehrerinnen geleitet. Für interessierte und begabte Frauen ist es jedoch nur über Einrichtungen dieser Art möglich, eine beruflich gehobene Qualifikation zu erreichen und damit zu gesellschaftlichem Ansehen zu kommen.
Da die Universitäten „frauenfrei“ gehalten werden, ist der Beruf der Volksschullehrerin eine der wenigen, möglichen Alternativen.
15. 11 1871 - Prinz Ottos Geisteskrankheit wird an Bismarck gemeldet
München - Berlin * Prinz Ottos Geisteskrankheit wird an Reichskanzler Otto von Bismarck gemeldet.
12 1871 - Richard Wagner sitzt bei Franz Lenbach für ein Porträt Modell
München-Maxvorstadt * Richard Wagner sitzt bei Franz Lenbach für ein Porträt Modell.
8. 12 1871 - Ein Großfeuer zerstört das Wiener Ringtheater
Wien * Ein Großfeuer zerstört das Wiener Ringtheater. Es kommen 384 Menschen zu Tode.
25. 12 1871 - Prinz Otto soll keinesfalls in eine Heilanstalt eingewiesen werden
München * König Ludwig II. und seine Mutter wollen Prinz Otto keinesfalls in eine Heilanstalt einweisen lassen, sondern ihn auf Gütern der Familie vor der Öffentlichkeit fernhalten.
27. 12 1871 - Lorenz Gedon erhält den Auftrag für eine Galerie
München-Maxvorstadt * Adolf Friedrich von Schack schließt mit dem jungen Architekten Lorenz Gedon einen Bauvertrag für die Vergrößerung seiner Galerie an der Brienner Straße.
1872 - Das „Palais der Königin Therese“ wird von Prinz Leopold gekauft
Schwabing * Das „Palais der Königin Therese“ wird von deren Enkel Prinz Leopold gekauft.
Seither trägt es den Namen „Palais Leopold“.
1872 - Die „Zeichnungs- und Modellierschule“ wird für Frauen erweitert
München * Die „Zeichnungs- und Modellierschule“ wird um eine „Abteilung für Mädchen“ erweitert.
Vor 1872 - „Ein Paar Frauenzimmer zweideutigen Rufes“ werden angetroffen
München-Englischer Garten - Schwabing * Scheinbar haben sich die Unternehmer Leven & Sohn etwas zu Schulden kommen lassen, denn seither bezahlt ein Joseph Hermann die Pacht.
Ob aber das Antreffen von „ein Paar Frauenzimmer zweideutigen Rufes“ zur Kündigung des Pachtvertrages geführt haben, ist unklar.
Jedenfalls lässt sich Joseph Hermann „die Hebung des Unternehmens sehr angelegen sein.
Er richtete im ehemaligen Schlössl eine feudale Restauration ein und suchte dem Publikum möglichst viel zu bieten.
Da war ein Raubtierhaus, auf einem Hügel ein Bärenzwinger, ein Affenhaus, Singvögelhäuser, ein wildverwachsner Wasserfall
[...]. Die Münchner kamen gern heraus und ließen sich's wohl sein.
[...] Auch für artistische Darbietungen sorgte der Pächter und ließ Seiltänzer wie Blondin und Miss Victoria auftreten.
Und besonders schön und beliebt war's an Sommerabenden, wenn im Zoologischen ein wenig getanzt wurde“.
1872 - Michael Rosipal kauft das „Maillot-Schlösschen“
München-Englischer Garten - Schwabing * Der „Zoo“ am Westrand des „Englischen Gartens“ schließt endgültig seine Pforten.
Der Münchner „Textilgroßkaufmann“ und „Königlich Spanische Konsul“ Michael Rosipal kauft das „Maillot-Schlösschen“ um 70.000 Gulden und macht es zur „Villa Rosipal“.
Er nutzt es rein für private Zwecke und übergibt es seinen Sohn Carl Rosipal.
Nach 1872 - Richard Wagners Musik wird konsumierbar gemacht
München * Das neu erwachte „Deutschland-über-alles-Selbstwertgefühl“ nach dem gewonnenen Krieg von 1870/71 sowie die „Reichsgründung“ haben in München schon zu Wagners Lebzeiten Vereine gründen lassen, die dieses Gefühl pflegen und hochhalten.
Und damit stehen Richard Wagners Kompositionen im Mittelpunkt des öffentlichen Musikinteresses.
Seine Musik wird konsumierbar gemacht; von der „Spieldose“ bis zum „mechanischen Klavier“. Neben „Volksliedern“, „patriotischen Hymnen“ und „Gassenhauern“ spielen „Kirmes-Orgeln“ auch „Wagner-Potpourris“.
Und selbst in den regelmäßig stattfindenden „Bierkonzerten“ erfreut sich ein „mehrere tausend Köpfe starkes Publikum“ an den von vierzig bis fünfzig Mann starken „Militärkapellen“ vorgetragenen Werken von Richard Wagner. Das „Vorspiel zu Parsifal“ oder Szenen aus „Rheingold“ beziehungsweise der „Walküre“ werden dargebracht und von den zechenden Besuchern mitgesungen.
Richard Wagner ist einfach zum „Popstar“ geworden.
1872 - Umbenennung in „Königliches Hoftheater am Gärtnerplatz“
München-Isarvorstadt * Umbenennung des „Gärtnerplatz-Theaters“ in „Königliches Hoftheater am Gärtnerplatz“.
1872 - „Buffalo Bill“ gründet seine „Wander- und Wildwestschau“
USA * Als auch mit der „Büffeljagd“ nichts mehr zu verdienen war, gründet „Buffalo Bill“ seine „Wander- und Wildwestschau“, mit der er - gemeinsam mit seiner „Artisten- und Schaustellertruppe“ - rund dreißig Jahre die verschiedensten Länder der „Alten und Neuen Welt“ bereist und dort die Zuschauer fasziniert.
1872 - Die dritte Welle der „Cholera“ kündigt sich an
München * Die dritte Welle der „Cholera“ kündigt sich an.
In München sterben 17 Menschen an der Seuche.
Nach 1872 - Obergiesinger Kleinhausbesitzer lassen ihre Häuser aufstocken
München-Obergiesing * In den 1870er Jahren, als das Baugewerbe in München nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich einen allgemeinen Aufschwung erlebt, lässt ein Teil der Obergiesinger Kleinhausbesitzer seine Häuser aufstocken, sodass in der „Feldmüller-Siedlung“ das zweigeschossige Vorstadthaus prägend wird.
Die Gebäude sind dennoch äußerst einfach und schlicht.
1872 - Eine der frühesten rein stadtteilbezogenen Grünanlagen Münchens
München-Haidhausen * Der streng geometrisch angelegte „Bordeauxplatz“ gilt als eine der frühesten rein stadtteilbezogenen Grünanlagen Münchens, der zusammen mit dem Orleans-, dem Weißenburger- und dem Pariser Platz das dreistrahlige, vom „Ostbahnhof“ ausgehende Straßensystem im „Franzosenviertel“ gliedert.
1 1872 - Ein ärztliches Gutachten über Prinz Otto von Bayern
München * Prinz Otto von Bayern wird von mehreren Ärzten untersucht und ein ärztliches Gutachten erstellt.
Die Ärzte prognostizieren, dass eine Heilung möglich wäre, wenn der Patient von München entfernt und einer konsequenten Behandlung zugeführt werden würde.
Man vermutet allerdings „Syphilis“ und keine „Schizophrenie“.
Außerdem gibt man dem Prinzen nur noch eine Lebenserwarten von einem halben bis maximal zwei Jahren.
1. 1 1872 - Das Gesetz, die Maß- und Gewichtsordnung betreffend tritt in Kraft
München * Das Gesetz, die Maß- und Gewichtsordnung betreffend tritt in Kraft. Damit wird das metrische System mit seinen dezimalen Teilungen und Vielfachen im Königreich Bayern eingeführt. Eine Ausnahme bildet das Pfund, das gesetzlich auf ein halbes Kilogramm festgelegt wird.
Um den 15. 1 1872 - Prinz Otto wird von mehreren Ärzten untersucht
München * Prinz Otto wird von mehreren Ärzten untersucht. Die Mediziner sehen eine Heilung im Bereich des Möglichen, wenn der Patient von München entfernt und einer konsequenten Behandlung unterzogen werden würde. Ottos Leibarzt Dr. Gietl vermutet sogar, dass der Prinz innerhalb eines halben Jahres sterben wird, wenn er sich nicht einer strengen Kur unterzieht.
Man attestiert ihm aber nicht Schizophrenie, sondern Syphilis. Erst als Ottos Tod partout nicht eintreten will, ändert man das Krankheitsbild auf Paranoia um.
21. 2 1872 - Ein Großbrand vernichtet die Kunstmühle von K. Kurlaender & Comp.
München-Englischer Garten - Tivoli * Ein Großbrand vernichtet die Kunstmühle Tivoli von K. Kurlaender & Comp.. Da die Gesellschaft gut versichert war, ist man eher „aufgebrannt“ statt abgebrannt.
7. 4 1872 - Hildegard Menzi wird in Schöneck geboren
Schöneck * Hildegard Menzi wird in Schöneck geboren.
8. 4 1872 - Die Kreislehrerinnenbildungsanstalt kommt ins Schulhaus im Rosenthal
München-Angerviertel * Zunächst wird die Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern im Schulhaus im Rosenthal untergebracht.
22. 4 1872 - Der Grundstein für das „Festspielhaus auf dem Grünen Hügel“ wird gelegt
Bayreuth * Was in München nicht gelingt, glückt in Bayreuth.
Der Grundstein für das „Festspielhaus auf dem Grünen Hügel“ wird gelegt.
Doch schnell steht das Projekt vor dem Ruin.
Da schreibt König Ludwig II.: „Nein! Nein und wieder nein! So soll es nicht enden; es muß geholfen werden“ und schickt 100.000 Mark nach Bayreuth.
Wagner bedankt sich bei seinem königlichen Gönner mit den Worten: „Oh, mein huldvoller König! Blicken Sie nur auf alle deutschen Fürsten, so erkennen Sie, daß nur Sie es sind, auf welchen der deutsche Geist noch hoffend blickt!“
Nachdem die ersten Festspiele mit Schulden in Höhe von 148.000 Mark enden, greift der König wiederholt in die Tasche und unterstützt den Musiker, obwohl er dem „Meister“ schon zuvor 25.000 Mark zur Fertigstellung seiner „Villa Wahnfried“ überlassen hat.
Die Großzügigkeit Ludwigs II. gegenüber dem von ihm vergötterten Musiker ist grenzenlos.
Mit insgesamt 562.914 Mark greift Ludwig II. dem Komponisten unter die Arme, um die Vollendung des „Rings des Nibelungen“, der „Meistersinger“ und des „Parsifal“ zu sichern und ihm auch weiterhin einen luxuriösen Lebensstil zu ermöglichen.
Aus Ludwigs Sicht ist das Geld gut investiert, denn: „Die Töne Ihrer Werke sind meine Lebensluft, ich kann sie nicht entbehren“ schreibt der Monarch an den „Meister“.
26. 4 1872 - Josef Hofmiller wird in Kranzegg im Allgäu geboren
Kranzegg im Allgäu * Josef Hofmiller wird in Kranzegg im Allgäu geboren.
6. 5 1872 - Die erste offizielle Separatvorstellung für König Ludwig II.
München-Graggenau * Im Residenztheater wird mit dem Lustspiel „Die Gräfin du Barry“ die erste offizielle Separatvorstellung für König Ludwig II. aufgeführt. Weitere 208 werden folgen. Zwischen dem 6. Mai 1872 und dem 12. Mai 1885 hat das Residenztheater, vom Oktober 1873 an auch das Hof- und Nationaltheater, exklusiv für den Märchenkönig 154 Schauspielvorführungen, 44 Opern- und elf Ballettaufführungen angesetzt. Dabei entgehen den genannten Schauspielhäusern etwa 200.000 Mark an Einnahmen.
Der König erklärt dem Intendanten Ernst Possart zur Begründung: „Ich kann keine Illusion im Theater haben, solange die Leute mich unausgesetzt anstarren und mit ihren Operngläsern jede meiner Minen verfolgen. Ich will selbst schauen, aber kein Schauobjekt für die Menge sein.“
12. 6 1872 - Die Gewerbeordnung gilt über ein Reichsgesetz auch für Bayern
München * Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund wird mit einem Reichsgesetz auch auf Bayern übertragen.
Diese allgemeine Gewerbefreiheit ermöglicht es Unterhaltungskünstlern, ihre Darbietungen im ganzen Kaiserreich anzubieten, Singspielgesellschaften zu gründen und Bühnen oder Schauspielbetriebe zu eröffnen. Damit blühen viele Theaterbetriebe, besonders aber deren Mischformen wie Varieté, Revue, Tingeltangel und Singspielhalle auf.
Da das Reichsgesetz die Restaurationsbetriebe mit Unterhaltungsdarbietungen zwar wie Theater unter die Gewerbeordnung stellt, schränkt sie deren Tätigkeit jedoch umgehend wieder ein, denn die Betreiber sind weiterhin in erster Linie Gastronomen und keine Theaterdirektoren.
4. 7 1872 - Das Jesuitengesetz erklärt die Gesellschaft Jesu zu Reichsfeinden
Berlin * Reichskanzler Otto von Bismarcks Jesuitengesetz erklärt die Mitglieder der Gesellschaft Jesu zu Reichsfeinden.
29. 9 1872 - Der Wiesnbeginn wird erstmals in den September verlegt
München-Theresienwiese * Wegen der vergangenen Schlechtwetterperioden im Oktober wird der Wiesnbeginn erstmals in den September verlegt.
29. 9 1872 - Erstmals wird auf der Wiesn das sogenannte Märzenbier ausgeschenkt
München-Theresienwiese - München-Au * Bis 1872 wird auf der Wiesn das sogenannte Sommerbier ausgeschenkt. Nachdem der Sommer dieses Jahres sehr heiß gewesen ist, gingen dem Leistbräu die Vorräte an Lagerbier aus. Michael Schottenhamel will auf dem Oktoberfest jedoch kein Winterbier ausschenken, weshalb er Sedlmayr‘s Märzenbier zum Ausschank bringt.
Der Bierpreis liegt mit 12 Kreuzern 3 Kreuzer über dem üblichen Preis, was den Polizeipräsidenten wegen zu erwartender Bierkrawalle schlecht schlafen lässt. Michael Schottenhamel meint dazu nur: „Wann d‘Münchner was richtig‘s kriag‘n, na schaug‘n sie‘s Geld net o!“ Und tatsächlich, das neue Münchner Bier findet einen derartigen positiven Anklang, dass bald alle Brauereien ein Märzenbier entwickeln.
29. 9 1872 - Erste Enthauptung im Schichtl-Theater
München-Theresienwiese * Michael August Schichtl und seine Brüder bringen aus Frankreich einen neuen Trick mit: „Die Enthauptung einer lebenden Person auf hell erleuchteter Bühne.“
1. 10 1872 - Der Magistrat beschließt die Namensgebung für das Franzosenviertel
München * Der Magistrat beschließt die Namensgebung für das Franzosenviertel.
14. 10 1872 - Die Kreislehrerinnenbildungsanstalt zieht in die Ludwigstraße
München-Maxvorstadt * Die Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern hat im Gebäude des Damenstifts an der Ludwigstraße ihre neue Unterkunft gefunden. Die Lehramtsaspirantinnen müssen eine höhere Erziehungs- und Unterrichtsanstalt besuchen und anschließend eine zweijährige Fachausbildung durchlaufen, werden aber nicht in den gleichen Fächern ausgebildet wie die Männer.
Behörden und Lehrer sehen die Frau in der Schule - zwar als einen hübschen, aber dennoch - als Ärgernis erregenden Fremdkörper an. Kritiker betonen, dass der Körper der Lehrerinnen „den Anstrengungen des Schulberufs weniger gewachsen ist als der der Männer. Wir Deutsche aber, die dem konzentrischen Drucke aller Völker Europas ausgesetzt sind, können die Verweiblichung am allerwenigsten brauchen. Wir können uns in unserer Stellung nur halten aufgrund jener harten Männertugenden, die das schönste Erbteil des deutschen Volkes sind.“
- Die Lehrerinnen werden von ihrem männlichen Kollegen verteufelt, obwohl ihr Lohn sowieso schon geringer als der ihrer männlichen Kollegen ist.
- Außerdem haben die meisten weiblichen Lehrkräfte keine feste Anstellung und kommen über die untersten Stufen der Hierarchie nicht hinaus.
- Hinzu kommt noch ein strenges Zölibat, ein Heiratsverbot.
- Das verordnete Eheverbot für die Lehrerinnen ist ein wirksames Mittel, die Quote der weiblichen Lehrkräfte niedrig zu halten.
Die Unvereinbarkeit zwischen Ehe und Lehrberuf wird begründet und verteidigt. So kommt der Bayerische Landtag zur Erkenntnis, dass das Eheverbot „einem dem Interesse der Schule schädlichen Widerstreit zwischen den Pflichten einer Frau als Lehrerin und als Ehefrau“ zuvorkomme.
11 1872 - Arnold Zenetti prüft die „Pferdestraßenbahnen“ anderer Städte
Dresden - Hamburg - Wien * Der „Magistrat“ schickt seinen „Stadtbaurat“ Arnold Zenetti nach Dresden, Elberfeld, Hamburg, Berlin und Wien zur Besichtigung und Prüfung der dort verkehrenden „Pferdestraßenbahnen“.
In seinem Gutachten befürwortet Zenetti den Bau einer zweigleisigen „Münchner Pferdetrambahn“, die auch die Altstadt durchziehen soll.
Allerdings nur dort, wo die Straßen eine Mindestbreite von fünf Metern aufweisen.
12 1872 - Richard Wagner sitzt bei Franz Lenbach für ein Porträt Modell
München-Maxvorstadt * Richard Wagner sitzt bei Franz Lenbach für ein Porträt Modell.
4. 12 1872 - Friedrich Bürklein stirbt in der Heilanstalt Werneck
Werneck * Friedrich Bürklein stirbt - gebrochen durch den Tod seines ältesten Sohns vor Sedan - in der Heilanstalt Werneck in Unterfranken.
1873 - Hubert Herkomers Bild „Nach des Tages Arbeit“ entsteht
England * Hubert Herkomers Bild „Nach des Tages Arbeit“ entsteht.
Es zeigt bayerische Bauern, die von der Feldarbeit nach Hause kommen.
Ab 1873 - Hygienische Maßnahmen der Stadtsanierung werden durchgeführt
München * Dritte „Cholera-Epidemie“ bricht in München aus.
Sie führt zur Umsetzung der von Professor Max von Pettenkofer vorgeschlagenen hygienischen Maßnahmen der Stadtsanierung:
- den Bau der „Schwemmkanalisation“,
- einer „zentralen Wasserversorgung“ und
- dem zentralen „Schlacht- und Viehhof“.
Damit wird München, als eine der schmutzigsten Städte die „sauberste Stadt Europas“.
1873 - Der 19-jährige Jungunternehmer Joseph Schülein kommt nach München
München * Der 19-jährige geschäftstüchtige Jungunternehmer Joseph Schülein kommt nach München und wird Teilhaber der Firma „Julius Schülein & Söhne“.
1873 - Die Künstlervereinigung „Allotria“ wird gegründet
München * Die Künstlervereinigung „Allotria“ wird gegründet.
1873 - Ignaz von Döllinger wird „Präsident der Akademie der Wissenschaften“
München * König Ludwig II. ernennt Ignaz von Döllinger zum „Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften“.
Die „Universitäten“ Oxford, Edinburgh, Wien und Marburg verliehen ihm die „Ehrendoktorwürde“.
1873 - Adele Spitzeders will die „Westendhalle“ kaufen und umgestalten
München-Ludwigsvorstadt * Adele Spitzeders Plan, die „Westendhalle“ zu kaufen und in ein glitzerndes „Vandevillet-Theater“ umzuwandeln, scheitert.
1873 - Umbenennung in „Kunstmühle Tivoli Aktiengesellschaft“
München-Englischer Garten - Tivoli * Die „Königlich Bayerische privilegierte Ludwigs-Walzmühl-Gesellschaft“ wird in „Kunstmühle Tivoli Aktiengesellschaft“ umbenannt.
Damit hat sich der Name des „Ausflugslokals Tivoli“ endgültig auf die ehemalige „Neumühle“ übertragen.
1873 - König Ludwig II. spielt mit dem Gedanken der Abdankung
München * König Ludwig II. spielt mit dem Gedanken der Abdankung und will sich auf die „Kanarischen Inseln“ zurückziehen.
Um 1873 - Der Steyrer Hans tritt zuerst in der „Westendhalle“ in der Sonnenstraße auf
München-Ludwigsvorstadt * In München tritt der Steyrer Hans zuerst in der „Westendhalle“ in der Sonnenstraße auf.
Mit dem Mittelfinger kann er bereits einen 375 Pfund schweren Steinbrocken heben.
Um einen weiteren Anreiz fürs Publikum zu schaffen, setzt er eine hohe Belohnung für denjenigen aus, der es ihm nachmacht. Das bringt mehr Spannung und sorgt für reihenweise ruinierte Bandscheiben.
Hans Steyrer reichert seine Vorstellungen mit immer effektvolleren Vorführungen zu einer kompletten „Kraftshow“ an. Dabei zerbricht er unter anderem zwischen seinen gewaltigen „Pratzen“ Hufeisen.
Schnell sprach sich sein besonderes Talent herum und erregt dadurch überall Aufsehen, wird bald einem breiteren Publikum bekannt und erhält in der Folge Engagements in Wien, Berlin und Hamburg.
Bis 1873 - Ludwig Thoma lebt bei seinen Eltern im „Forsthaus“ in Vorderriß
Vorderriß * Ludwig Thoma lebt bei seinen Eltern im „Forsthaus“ in Vorderriß bei Lenggries.
1 1873 - Der „Magistrat“ genehmigt den Bau einer „Pferdeeisenbahn“
München * Der wirtschaftliche Erfolg von Michael Zechmeisters „Pferde-Omnibus-Linie“ überzeugt den „Magistrat“, weshalb er sich für den Aufbau einer „schienengebundenen Pferdestraßenbahn“ ausspricht.
Und das, obwohl sich der gleiche „Magistrat“ noch anno 1868 gegen die Zulassung einer „Pferdetrambahn“ durch die Altstadt ausgesprochen hatte.
Lediglich eine „Zirkelbahn“ - vom Hauptbahnhof über den Sendlinger-Tor-Platz zur Isar und zwei Stichlinien nach Nymphenburg und Schwabing - genehmigen die „Stadtväter“.
Die Bedingung ist aber die Hinterlegung von 100.000 Gulden, „da man mit Aktiengesellschaften bisher schlechte Erfahrungen gemacht habe“.
Doch dann dauert es bis zum Februar 1874, bis sich die „Kgl. Polizeidirektion“ als genehmigende Aufsichtsbehörde äußert.
21. 2 1873 - Die Kunstmühle Tivoli A.G. wird ins Handelsregister eingetragen
München-Englischer Garten - Tivoli * Die Kunstmühle Tivoli A.G. wird mit ihrer Rechtsnachfolgerin Tivoli Handels- und Grundstücks-Aktiengesellschaft, München ins Handelsregister eingetragen. Dieses Datum gilt als Geburtstag der Kunstmühle Tivoli.
Um den 15. 8 1873 - Ludwig II. äußert sich über Ottos Gesundheitszustand
München * König Ludwig II. äußert sich über Ottos Gesundheitszustand: „Mein Bruder kann nie regieren“.
9 1873 - Das „Oktoberfest“ wird wegen der drohenden „Cholera-Epidemie“ abgesagt
München-Theresienwiese * Das „Oktoberfest“ wird wegen der heraufziehenden „Cholera-Epidemie“ abgesagt.
Seit 1810 fällt das Volksfest damit zum fünften Mal aus.
2. 9 1873 - Der „Sedantag“ wird als patriotischer Feiertag begangen
Deutsches Reich * Im Deutschen Kaiserreich wird am 2. September der „Sedantag“ als patriotischer Feiertag an Stelle eines noch nicht existierenden Nationalfeiertages gefeiert. Es ist vor allem ein Feiertag des kaisertreuen Bürgertums, des Adels sowie des Militärs, der preußischen Beamtenschaft und der ländlichen Bevölkerung gewesen, nicht oder nur kaum einer der Arbeiterschaft.
17. 9 1873 - Der letzte Weißbiersud im Königlichen Hofbräuhaus
München-Graggenau * Der letzte Weißbiersud wird im Königlichen Hofbräuhaus eingebraut.
25. 9 1873 - Bismarcks erste Zahlung aus dem Welfenfonds trifft in München ein
Berlin - München * Die erste Zahlung Bismarcks aus dem sogenannten Welfenfonds trifft in München ein.
Um 10 1873 - Die erste „Velociped-Wettfahrt“ in der Landeshauptstadt München
München * An einem nebeligen Herbsttag treten dreizehn Mitglieder des „Münchner Velociped-Klubs“ zur ersten „Velociped-Wettfahrt“ der Landeshauptstadt an.
Die Herren mussen schon hart gegen sich selbst sein, denn sehr leicht und bequem lassen sich die Maschinen aus Holz mit ihren eisenbeschlagenen Rädern nicht fortbewegen.
Die Strecke beträgt circa neun Kilometer und beginnt am Sendlingertorplatz. Der Sieger benötigt 42 Minuten.
Er hatte Glück, da sein wichtigster Konkurrent unterwegs durch „eine unfreiwillig wichtige Besprechung mit einem Gensdarm“ an der Weiterfahrt gehindert wurde.
22. 10 1873 - In Wien das Dreikaiserabkommen geschlossen
Paris - Berlin - Wien - Petersburg * Zur Isolierung Frankreichs wird in Wien das Dreikaiserabkommen zwischen Deutschland, Österreich und Russland abgeschlossen.
11 1873 - Carl von Lindes erste „Kompressions-Kältemaschine“ kommt zum Einsatz
München-Maxvorstadt * Carl von Lindes erste „Kompressions-Kältemaschine“ kommt in der „Spatenbrauerei“ an der Marssstraße zum Einsatz.
Die 4 Tonnen schwere Eis-Maschine wird mit „Methyläther“ betrieben.
Spätestens als eines nachts die Pumpe explodiert, war die ungünstige Wahl des Kältemittels bewiesen.
Ab 9. 11 1873 - Die dritte Cholera-Epidemie bricht in München aus
München * Die dritte Cholera-Epidemie bricht zwischen 9. und 15. November in München aus. Sie wütet am Schlimmsten bis April 1874 und wird bis 1875 andauern. Obwohl die Seuche diesmal vergleichsweise glimpflich abläuft, werden dennoch etwa 1.400 Münchner an der Cholera sterben.
Sie führt zur Umsetzung der von Professor Max von Pettenkofer vorgeschlagenen hygienischen Maßnahmen der Stadtsanierung:
- den Bau der Schwemmkanalisation,
- einer zentralen Wasserversorgung und
- dem zentralen Schlacht- und Viehhof.
Damit wird München, als eine der schmutzigsten Städte die „sauberste Stadt Europas“.
10. 11 1873 - Grundsteinlegung für die evangelische Markuskirche
München-Maxvorstadt * Der Grundstein für die evangelische Markuskirche an der Gabelsbergerstraße in der Maxvorstadt wird gelegt.
25. 12 1873 - Karl Fey, der älteste Bruder von Karl Valentin, kommt zur Welt
München-Au * Karl Fey, der älteste Bruder von Valentin Ludwig (Karl Valentin), kommt zur Welt.
1874 - Carl von Linde's „Kältemaschine“ erfüllt alle Erwartungen
München * Carl von Linde baut bei der Münchner „Spatenbrauerei“ die zweite, mit „Ammoniak“ betriebene „Kältemaschine“, die alle Erwartungen erfüllt.
Damit wird der Brauprozess berechenbarer und die Kosten kalkulierbarer.
1874 - Das neue Bogenhausener Schulhaus wird fertig gestellt
Bogenhausen - München-Haidhausen * Das neue Bogenhausener Schulhaus für rund 200 Schüler wird fertig gestellt.
Es ist bald zu klein, weshalb die älteren Kinder in die Haidhauser „Kirchenschule“ ausweichen müssen.
1874 - Die „Stadtverwaltung“ bezieht das „Neue Rathaus“
München-Graggenau * Die „Stadtverwaltung“ bezieht das „Neue Rathaus“.
1874 - Die neue „Kirchenschule“ wird seiner Bestimmung übergeben
München-Haidhausen * Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres wird das neue „Schulhaus an der Kirchenstraße“ seiner Bestimmung übergeben.
1874 - Die „Bergerstraße“ wird in „Berg-am-Laim-Straße“ umbenannt
München-Haidhausen - Berg am Laim * Die „Bergerstraße“ wird in „Berg-am-Laim-Straße“ umbenannt.
1874 - Joseph Behringer betreibt im Münchner Osten den ersten Ringofen
<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Der Berg am Laimer Maurermeister Joseph Behringer betreibt im Münchner Osten den ersten Ringofen.</p>
1874 - Leonhard Romeis tritt einen 15-monatigen Studienaufenthalt in Italien
Italien * Leonhard Romeis schließt nach seiner Ausbildung an der „Kunstgewerbeschule“ einen 15-monatigen Studienaufenthalt in Italien an.
Finanziert wird die Reise von der „Maximiliansstiftung für kunstgewerbliche Ausbildung“.
1874 - Die Arbeiten an der „Baron Schack‘schen Gallerie“ sind abgeschlossen
München-Maxvorstadt * Die Arbeiten an der „Baron Schack‘schen Gallerie“ sind abgeschlossen.
Die „Münchner Stadtchronik“ schildert die nahe Vollendung des Gebäudes so: „Er verspricht eine der bemerkenswertesten Zierden Neu-Münchens zu werden. Die Facade dieses Baues ist im Spätrenaissance-Styl gehalten, die ursprünglich einen zwar überaus reichen und eigentümlichen, aber etwas unruhigen Eindruck machte, hat in letzter Zeit an Einheit und Harmonie wesentlich gewonnen“.
Und tatsächlich ist es Lorenz Gedon gelungen, mit dem Gebäudekomplex den ersten privaten Neo-Renaissance-Bau in München zu erstellen. Weil er damit einen Stil schafft, den es in München bisher so nicht gibt, kommen Besucher aus ganz Deutschland und aus Wien, um sich zu informieren, den Bau zu bewundern oder einen Auftrag in Gedons Stil zu vergeben.
Lorenz Gedons Werk wird - trotz der zum Teil erheblichen Kritik besonders aus den Reihen der Architekten - die Fassadengestaltung vieler nachfolgender Bauten nachhaltig beeinflussen.
1874 - Adolf Friedrich von Schacks Sammlung soll der deutsche Kaiser erben
München-Maxvorstadt * In seinem Testament legt Adolf Friedrich von Schack fest, dass seine Sammlung nach seinem Tod in das Eigentum des deutschen Kaisers übergehen, aber auf Dauer in München und für die öffentlichkeit zugänglich sein soll.
1874 - Die „Kunstmühle Tivoli“ wird neu erbaut
München-Englischer Garten - Tivoli * Die „Kunstmühle Tivoli“ wird neu erbaut und im Jahr darauf bereits erweitert.
1874 - Die „Fingergasse“ wird zur „Maffeistraße
München-Kreuzviertel * Zum Andenken an Joseph Anton Ritter von Maffei nennt der Magistrat die „Fingergasse“ auf den Namen dieser außergewöhnlichen bayerischen Unternehmerpersönlichkeit um.
1874 - Eduard Theodor Grützner heiratet Barbara Link
München * Eduard Theodor Grützner heiratet die um sieben Jahre jüngere Barbara Link.
Sie bringt zwei Jahre später die gemeinsame Tochter Barbara zur Welt, die in verschiedenen Akten auch mit dem Kosenamen „Babette“ eingetragen wird.
Ab 1874 - Die Planungen für eine „zentrale Wasserversorgung“ beginnen
München * Die Planungen für eine „zentrale Wasserversorgung“ beginnen.
1874 - Die Ärzte attestieren dem Bayernprinzen Otto „Paranoia“
München * Nachdem Prinz Otto von Bayern partout nicht sterben will, attestieren ihm die Ärzte „Paranoia“.
Darunter versteht man zu dieser Zeit „Geistesstörungen mit Sinnestäuschungen, Wahnvorstellungen und Beziehungsideen, Verfolgungs- und Größenideen“.
1874 - Gründung von „Krieger- und Veteranenvereinen“
München * Nach dem erfolgreichen Verlauf des „Siebzigerkrieges“ und der „Reichsgründung“ kommt es zur Hinwendung des Bürgertums und der Arbeiterschaft zur Armee; und selbst sozialdemokratisch geprägte Arbeiter sind stolz auf ihre „aktive“ Dienstzeit.
In der Folge kommt es zur Gründung von militärischen Vereinen, wie der „Münchner Gesellschaft der Offiziere des Beurlaubtenstandes“ von 1879, aber auch einer Reihe von „Krieger- und Veteranenvereinen“.
Den Dachverband für den überwiegenden Teil dieser Vereine bildet der im Jahr 1874 gegründete „Bayerische Veteranen-, Krieger- und Kampfgenossenbund“, der bis zum Jahr 1899 im gesamten „Königreich Bayern“ 2.573 Einzelvereine mit knapp 190.000 Mitgliedern umfasst.
Die „Kriegervereine“ werden bei ihrer Gründung auch als ein „Bollwerk gegen die sozialdemokratischen Umtriebe“ verstanden.
Vollkommen unnötig. Denn so mancher „Fürstenfeind“, der beizeiten durchaus lautstark und öffentlich den „Umsturz“ verkündete, schmettert zur rechten Zeit „ein bayerisches Soldatenlied voller martialischer Treue zum angestammten Herrscherhaus“.
Im Jahr 1874 - Der „Sozialdemokratische Verein“ wird aufgelöst
München * Auf Betreiben des Münchner „Polizeidirektors“ Max Freiherr von Feilitzsch wird der „Sozialdemokratische Verein“ aufgelöst.
Von 1875 bis 1878 werden 568 Verfahren wegen „geheimer Verbindung und verbotener Affiliation“ eingeleitet.
Ab 1874 - Ludwig Thoma wohnt bei seinem Onkel in der Rheinpfalz
Rheinpfalz * Ludwig Thoma wohnt bis 1876 bei seinem Onkel in der Rheinpfalz.
1 1874 - Emil Weinberger gründet das „Volkstheater in der Leopoldstadt“
München-Maxvorstadt * „Theaterdirektor“ Emil Weinberger gründet das „Volkstheater in der Leopoldstadt“ in der Senefelderstraße.
1 1874 - Georg Dollmann übernimmt die Aufgaben des „Hofbaudirektors“
München * Georg Dollmann übernimmt die Aufgaben des „Hofbaudirektors“ Eduard von Riedel.
21. 1 1874 - Das Königshäuschen im Graswangtal wird abgerissen
Schloss Linderhof * König Ludwig II. ordnet den Abbruch des Königshäuschen im Graswangtal an. Das Schloss Linderhof entsteht damit in seiner endgültigen Form.
23. 1 1874 - Ziviltrauung auch in Preußen eingeführt
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Der Preußische Landtag beschließt die Einführung der Zivilehe.<br /> Die erste Münchner Ziviltrauung fand dagegen bereits am 3. Januar 1806 statt - 68 Jahre früher. </p>
2 1874 - Die „Polizeidirektion“ lehnt die „Pferdeeisenbahnlinie“ ab
München * Die „Kgl. Polizeidirektion“ als genehmigende Aufsichtsbehörde lehnt die „Pferdeeisenbahnlinie“ aus „verkehrstechnischen Gründen“ ab,
- da sich in der Innenstadt „eine große Zahl von Industriellen niedergelassen habe, denen Tag für Tag große Quantitäten Waren auf umfangreichen Transportmitteln zugeführt werden,
- da ferner die Straßenkörper noch zu speziellen Verrichtungen, wie Holzmachen, Entleerung von Abortgruben, Beladen von Möbelwagen, ununterbrochen in Anspruch genommen werden müssen“.
Doch die Idee für eine „Münchner Pferdeeisenbahnlinie“ war dennoch nicht mehr auszulöschen.
13. 3 1874 - Fest zur Feier der Pariser Commune
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Die Münchner Sozialdemokraten organisieren ein stark besuchtes <em>„Arbeiter-Massenfest zur Feier der Pariser Commune“</em> in den Räumlichkeiten der Centralsäle.</p>
22. 3 1874 - Das Augsburger „Stadttheater“ wird vom Feuer zerstört
Augsburg * Das Augsburger „Stadttheater“ wird vom Feuer zerstört.
22. 5 1874 - Erhard Auer wird in Dommelstadl bei Passau geboren
Dommelstadt * Erhard Auer wird in Dommelstadl bei Passau geboren.
Um 8 1874 - Die Gemeinde Bogenhausen finanziert den Bau einer Eisenbrücke
Bogenhausen * Durch das Fehlen der Isarbrücke bei Bogenhausen geht die Zahl der Münchner Ausflügler stark zurück.
Die Gemeinde Bogenhausen finanziert deshalb den Bau einer Eisenbrücke selbst.
9 1874 - König Ludwig II. lässt sich letztmals auf dem „Oktoberfest“ blicken
München-Theresienwiese * König Ludwig II. lässt sich letztmals auf dem „Oktoberfest“ blicken.
Bis zu seinem Tod am 13. Juni 1886 meidet er die „Wiesn“.
7. 9 1874 - Der Münchner Stadtmagistrat tagt erstmals im Neuen Rathaus
München-Graggenau * Erstmals tagt der Münchner Stadtmagistrat in einem provisorisch ausgestatteten Saal im 3. Stock des Neuen Rathauses.
1. 10 1874 - Die 1.000. Lokomotive verlässt das Maffei-Werk
München-Englischer Garten - Hirschau * Die 1.000. Lokomotive verlässt das Maffei-Werk in der Hirschau.
12. 10 1874 - Königin-Mutter Marie konvertiert zum römisch-katholischen Glauben
Waltenhofen * Die Königin-Mutter Marie tritt in Waltenhofen zum römisch-katholischen Glauben über.
1. 11 1874 - Der Wiener Zentralfriedhof wird eingeweiht
Wien * Der 300.000 Gräber und 240 Hektar umfassende Wiener Zentralfriedhof, und damit Europas größter Totenacker, wird eingeweiht.
Um 1875 - Hubert Herkomer malt sozialkritische Themen
England * Hubert Herkomer ist für seine ausdrucksvollen Darstellungen der Armen der Stadt und sozialer Probleme bekannt.
Er malt Bilder mit dem Titel „Harte Zeiten“ oder „Im Streik“.
1875 - Die Münchner Trinkwasserversorgung
München * Die „städtischen Brunnwerke“ speisen 60 öffentliche Brunnen und 2.203 Häuser.
Auf die „Hofbrunnwerke“ fallen neun öffentliche Brunnen und 960 Häuser.
Das Rohrsystem ist 120 Kilometer lang. Davon entfallen 80 Kilometer auf die Stadt und 40 Kilometer auf den „Hof“.
Von den 7.382 Anwesen der Stadt sind 4,219, also 57 Prozent, ohne laufendes Wasser.
1875 - Das „Neue Rathaus“ wird in absehbarer Zeit zu klein
München-Graggenau * Aufgrund des enormen Wachstums der Stadt und ihrer Aufgaben ist das „Neue Rathaus“ absehbar bald zu klein, weshalb man sich zur Vergrößerung des Gebäudes entschließt.
Um 1875 - Coletta Möritz arbeitet beim „Sterneckerbräu“ im Tal
München-Angerviertel * Coletta Möritz arbeitet als „Wassermadl“ und „Krüglputzerin“, später als „Kellnerin“ beim „Sterneckerbräu“ im Tal.
1875 - Gabriel Sedlmayer übernimmt die „Brauerei zum Franziskaner (Leistbräu)“
München-Au * Josef Sedlmayer übergibt die „Brauerei zum Franziskaner (Leistbräu)“ an seinen Sohn, den „Commerzienrat“ Gabriel Sedlmayer.
1875 - Drei Mass Bier für stillende Mütter und Ammen sind zuviel
München * Das „Gesundheitsamt“ spricht sich dagegen aus, „daß stillende Mütter und Ammen täglich drei bis vier Liter Bier trinken, um ausreichend ‚Kraftnahrung‘ für den säugenden Nachwuchs zu sich zu nehmen.
Ein Liter täglich ist genug“.
1875 - Der Rechtsverkehr wird eingeführt
München * Wichtige Verkehrsregeln treten in Kraft.
- Das Rechtsfahren von Pferdefuhrwerken wird eingeführt;
- das Zerkleinern von Brennholz in weniger als vier Meter breiten Straßen wird verboten.
1875 - Das Rad fahren im Münchner Burgfrieden wird verboten
München * Das fahren mit dem „Veloziped“ innerhalb des Münchner Burgfriedens ist „gänzlich untersagt“.
1875 - Ein Probesud beim „Spatenbräu“ mit dem neuen Wasser vom Taubenberg
München-Ludwigsvorstadt * 100 Hektoliter Wasser werden vom „Taubenberg“ nach München gebracht und beim „Spatenbräu“ ein Probesud angesetzt.
Das gebraute Bier entspricht den Vorstellungen und den Qualitätsanforderungen der Brauer und der Verbraucher.
Ab 1875 - Fünf Lotterien zum Weiterbau der neuen „Heilig-Kreuz-Kirche“
München-Obergiesing * Durch fünf Lotterien wurde die Baukasse soweit aufgefüllt, dass die neue „Heilig-Kreuz-Kirche“ weitergebaut werden kann.
Ab dem 1875 - Der „Vieh- und Schlachthof“ entsteht im Münchner Süden
München-Isarvorstadt * In den Jahren von 1875 bis 1878 entsteht der „Vieh- und Schlachthof“ für eine Summe von fünf Millionen Mark auf einem 101.000 Quadratmeter großen Gelände im Münchner Süden.
Die Stadt zählt damals zwar erst 215.000 Einwohner, dennoch ist die Planung von Arnold Zenettis schon auf eine Großstadt mit erheblich mehr Einwohnern ausgerichtet.
Zahlreich - in enger Zusammenarbeit mit Max von Pettenkofer und Bürgermeister Alois von Erhardt - sind Arnold Zenettis Anstrengungen, durch Verordnungen, die in die Praxis umgesetzt werden, die Gesundheit und Reinlichkeit im Sinne der allgemeinen Hygiene zu heben.
9. 2 1875 - Dr. Bernhard von Gudden fertigt ein Gutachten über Prinz Otto
München * Dr. Bernhard von Gudden fertigt ein Gutachten über Prinz Otto und dessen geistig-seelischen Zustand.
22. 2 1875 - Im Gasthaus Zum Ewigen Licht wird die Weißwurst erfunden
München-Angerviertel * Im Gasthaus Zum Ewigen Licht am Marienplatz wird die Weißwurst erfunden - erzählt man!
23. 2 1875 - Karl Gandorfer wird in Pfaffenberg bei Straubing geboren
Pfaffenberg * Karl Gandorfer wird in Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen geboren.
3. 5 1875 - Münchens Gassen werden zu Straßen
München * Die „Polizeidirektion“ erlässt eine neue „Bezirks- und Distriktseinteilung“, mit der Aufzählung sämtlicher Straßen, die zu dem jeweiligen Bezirk gehören.
Alle bisherigen „Gassen“ heißen seitdem „Straße“.
Nur die „Preysinggasse“ wird vergessen und dafür im Jahr darauf zur Straße.
Inzwischen ist aus der „Preysingstraße“ die „Viscardigasse“ geworden.
Andere „Straßen“ nennt man später wieder in „Gasse“ um.
Es sind dies die „Dürnbräugasse“, die „Albertgasse“ und die „Filserbräugasse“.
10. 5 1875 - Königin Amalie von Griechenland stirbt in Bamberg
Bamberg - München-Kreuzviertel * Amalie, die ehemalige Königin von Griechenland, stirbt in Bamberg. Sie wird in der Fürstengruft der Theatinerkirche beigesetzt.
27. 5 1875 - Prinz Otto I. entkommt seinen Bewachern
Schloss Nymphenburg - München-Kreuzviertel * Prinz Otto ist seinen Bewachern auf Schloss Nymphenburg entkommen. Er durcheilt die Frauenkirche bis zum Altar, wirft sich auf die Knie und bittet laut schreiend um Vergebung seiner Sünden.
7. 6 1875 - Prinz Otto will eine Reise in die Beneluxländer unternehmen
München * Prinz Otto will eine Reise in die Beneluxländer, Skandinavien und Russland unternehmen.
9. 6 1875 - Prinz Otto muss seine Reise wegen starker Wahnideen abbrechen
Würzburg - München * Prinz Otto muss seine Reise in die Beneluxländer, Skandinavien und Russland wegen auftretender starker Wahnideen abbrechen. Zwei Tage nach Reiseantritt trifft er schon wieder in München ein.
14. 6 1875 - Leonhard Romeis arbeitet im Architekturbüro seines Lehrers
München * Leonhard Romeis arbeitet im Architekturbüro seines ehemaligen Lehrers Emil von Lange.
Um 7 1875 - „Musteraufführungen“ der Werke Richard Wagners in München
München * Bereits im Sommer 1875, also ein Jahr vor der Eröffnung des „Bayreuther Festspielhauses“, zeigt man in München - auf Betreiben des „Generalintendanten“ Carl Freiherr von Perfall - eine Reihe von sogenannten „Musteraufführungen“ vor allem der Werke Richard Wagners.
Selbst der Plan eines „Festspielhauses“ in München findet keine Ruhe und wird weiterentwickelt.
1. 7 1875 - Das Gasteig-Gebiet kommt zu Haidhausen und der Au
München-Haidhausen - München-Au * Das nördlich der Rosenheimer Straße gelegene Gasteig-Gebiet wird von der Anna-Vorstadt [= Lehel] abgetrennt und Haidhausen zugeteilt.
Gleiches gilt für das südlich der Rosenheimer Straße gelegene Gasteig-Gebiet, das von der Isar-Vorstadt abgetrennt und der Au zugeschlagen wird.
16. 7 1875 - Karl Falks Ausbauarbeiten werden von der Baupolizei abgenommen
München-Au * Der Anbau für das Wohnhaus des bürgerlichen Tapezierermeisters Karl Falk an der Entenbachstraße 63 wird von der Baupolizei abschließend besichtigt. Mit der Umbaumaßnahme ergibt sich ein Raumgewinn von zwei größeren Zimmern pro Etage, die als Wohnungen vermietet werden. Der Eingang ist auf die Rückseite verlegt worden. Das Dach ist zur Hofseite hin abgewalmt.
22. 8 1875 - Prinz Ottos letzter öffentlicher Auftritt
München * Bayernprinz Ottos letzter öffentlicher Auftritt gemeinsam mit seinem Bruder König Ludwig II. bei der Königsparade auf dem Münchner Marsfeld.
28. 8 1875 - Zamdorf wird der Gemeinde Berg am Laim zugeschlagen
Zamdorf - Berg am Laim * Zamdorf wird auf eigenen Wunsch der Gemeinde Berg am Laim zugeschlagen. Zu Zamdorf gehört auch Steinhausen.
9 1875 - Josef Knabl formt die „Madonna della Saluta“ für Avilla di Buia
München-Haidhausen - Avilla du Buia * Der Münchner Akademieprofessor Josef Knabl, „Lehrer für christliche Plastik“, formt die „Madonna della Saluta“.
Anschließend wird sie in einem Ofen des Haidhauser „Ziegeleibesitzers“ Anton Graßl gebrannt, danach mit einem Pferdefuhrwerk nach Avilla di Buia bei Udine gebracht, farbig gefasst und auf dem dortigen Hochaltar aufgestellt.
9 1875 - Nach der Währungsumstellung kostet die Mass „Wiesnbier“ 32 Pfennige
München-Theresienwiese * Nachdem in der Zwischenzeit die Währung von Gulden auf Mark umgestellt worden war, kostet jetzt die Mass „Wiesnbier“ 32 Pfennige.
Die Wirte kaufen sie pro Mass um 22 Pfennige ein.
20. 9 1875 - Matthias Erzberger wird in Buttenhausen geboren
Buttenhausen * Matthias Erzberger wird in Buttenhausen im Königreich Württemberg geboren.
9. 11 1875 - Adam Alfred Rudolf Glauer wird in Hoyerswerda geboren
Hoyerswerda * Rudolf von Sebottendorff, eigentlich Adam Alfred Rudolf Glauer, wird in Hoyerswerda geboren.
25. 11 1875 - Das Theater in Barmen wird ein Raub der Flammen
Barmen * Das Theater in Barmen wird ein Raub der Flammen.
1876 - Adolph Brougier wird Teilhaber der Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“
München-Graggenau * Adolph Brougier steigt in das Unternehmen seines Freundes Emil Wilhelm mit ein.
Die Firma heißt jetzt „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“.
1876 - Ein Bericht über die Münchner „Prostituierten“
München * Über die Münchner „Prostituierten“ liest man:
„München zählt [...] nahezu 1.000 konskribierte öffentliche Phrynen [Dirnen], deren Kleiderkunst und übertünchte Gesichter sich in den schönen Teilen der Stadt zeigen“.
Weiter beklagt der Bericht die überhand nehmende Straßenprostitution und plädierte für die Errichtung eigener „Freudenhäuser“.
1876 - „Papa“ Jakob Geis tritt mehrmals in der Woche im „Oberpollinger“ auf
München-Kreuzviertel * Zwischen 1876 und 1899 tritt „Papa“ Jakob Geis, der bekannte Münchner Komiker und Direktor einer Singspielgesellschaft, tritt - mehrmals in der Woche - im „Oberpollinger“ auf.
1876 - Das Übungsgelände des „Münchner Veloziped-Clubs“
München-Untergiesing * Auf dem „Schyrenplatz“ befindet sich ein Übungsgelände des „Münchner Veloziped-Clubs“.
Aus ihr wird später die erste „Profi-Radrennbahn der Welt“.
Ab 1876 - Der „Zentrale Schlacht- und Viehhof“ entsteht
Sendling - München-Angerviertel * Zwischen 1876 und 1878 entsteht auf dem „Sendlinger Unterfeld“ der „Zentrale Schlacht- und Viehhof“.
Damit können die „Untere Metzg' am Füße des Petersbergls“ und die „Obere Metzg' am Färbergraben“ aufgehoben werden.
1876 - „Bruderschaft zur Verehrung der hl. fünf Wunden Jesu Christi“
München-Kreuzviertel * Die „Bruderschaft zur Verehrung der hl. fünf Wunden unseres Herrn Jesu Christi“ wird in die „Bürgersaalkirche“ verlegt.
1876 - Errichtung der „Hundinghütte“ bei „Schloss Linderhof“
Schloss Linderhof * Errichtung der „Hundinghütte“ im „Ammerwald“ bei „Schloss Linderhof“.
1876 - Errichtung einer neugotischen Kapelle bei Berg
Starnberger See - Berg * Errichtung einer neugotischen Kapelle bei Berg.
1876 - Der „Centralbahnhof“ muss ständig umgebaut werden
München-Maxvorstadt * Durch das ständig steigende Verkehrsaufkommen wird der „Centralbahnhof“ umgebaut.
1876 - In Italien wird das erste „Krematorium“ gebaut
Italien * In Italien wird das erste „Krematorium“ gebaut.
1876 - Franz Lenbach wird Ehrenmitglied der Künstlervereinigung „Allotria“
München * Die Künstlervereinigung „Allotria“ trägt dem aufstrebenden Maler Franz Lenbach die „Ehrenmitgliedschaft“ an.
5. 1 1876 - Konrad Adenauer wird in Köln geboren
Köln * Konrad Adenauer, der spätere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und CDU-Vorsitzende, wird in Köln geboren.
23. 1 1876 - Rupert Emil Mayer wird in Stuttgart geboren
Stuttgart * Rupert Emil Mayer, der spätere Jesuitenpater, wird in Stuttgart geboren.
14. 2 1876 - Graham Bell entwickelt ein elektromagnetisches Telefon
Edinburgh * Graham Bell meldet sein elektromagnetisches Telefon zum Patent an.
2. 3 1876 - Eugenio Pacelli wird in Rom geboren
Rom * Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII. und langjährige Nuntius in München, wird in Rom geboren.
26. 3 1876 - Ein Vorvertrag für die Pferdestraßenbahn wird geschlossen
<p><strong><em>München - Brüssel</em></strong><em> * </em>Bürgermeister Alois von Erhardt schließt mit dem aus Brüssel stammenden Industriellen Edouard Otlet - vorbehaltlich der Genehmigung durch die beiden Ratskollegien - einen Vorvertrag ab. Dieser sieht eine Konzession auf dreißig Jahre vor. </p> <p>Edouard Otlet, der bereits zuvor in Prag und Wiesbaden erfolgreich Pferdebahnen aufgebaut hat, verpflichtet sich, auch in München ein weit gespanntes Linienkreuz zu errichten. </p> <ul> <li>Die West-Ost-Achse soll vom Nymphenburger Schlosspark über Neuhausen zum Stachus führen und sich dort verzweigen.</li> <li>Ein Nebenast soll über den Lenbachplatz zum Promenadeplatz und den dort gelegenen Hotels und Geschäften führen.</li> <li>Der Hauptast soll - die Altstadt umfahrend - über die Sonnenstraße den Sendlinger-Tor-Platz erreichen und von dort über den Gärtnerplatz zur Isarbrücke, weiter durch die Rosenheimer- und Weißenburger Straße und am damals noch Haidhauser Bahnhof genannten Ostbahnhof enden.</li> <li>Der Verlauf der Nord-Süd-Linie beginnt am Großen Wirt in Schwabing und führt weiter über die heutige Leopoldstraße zum Odeonsplatz, von dort über die Brienner Straße zum Stachus, weiter zum Bahnhofsplatz und endet am Fuße der Theresienhöhe. </li> </ul> <p>Mit dieser Linienführung können die engen Altstadtstraßen geschickt umfahren werden. Außerdem soll die Pferdetram in einem zehnminütigen Abstand verkehren und Otlets Gesellschaft - für die Benutzung des städtischen Straßengrundes ein Prozent der Bruttoeinnahmen an die Stadtgemeinde abführen. </p>
5 1876 - Ludwig II. kauft den „Maurischen Kiosk“ für „Schloss Linderhof“
Schloss Linderhof * König Ludwig II. kauft den „Maurischen Kiosk“ für den „Schlosspark in Linderhof“.
7. 5 1876 - Franz von Pocci stirbt in München
München * Franz von Pocci stirbt in München.
16. 6 1876 - Baron von Schack will Preußen seine Sammlung vermachen
München-Maxvorstadt - Berlin * Baron Adolf Friedrich von Schack informiert den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, den späteren Kaiser Wilhelm II., von seiner Absicht, ihm seine Sammlung zu vermachen.
23. 6 1876 - Der endgültige Vertrag zum Betrieb einer Pferdetrambahn
München * Die Stadt und Edouard Otlet unterzeichnen den endgültigen Vertrag zum Betrieb einer Pferdetrambahn.
7 1876 - Die Gleisbauarbeiten für die „Pferdetrambahnlinie“ beginnen
München-Kreuzviertel - München-Maxvorstadt * Die Gleisbauarbeiten für die erste Versuchsteilstrecke für Münchens erste „schienengebundene Pferdetrambahnlinie“ - vom „Promenadeplatz“ über den Stachus zur Nymphenburger Straße - beginnen.
Sie endet an der „Burgfriedensgrenze“ an der „Maillingerstraße“.
6. 8 1876 - Ludwig II besucht die Proben zum Ring des Nibelungen
Bayreuth * König Ludwig II. und Richard Wagner treffen sich in Bayreuth. Der Bayernkönig wohnt den Generalproben zum Ring des Nibelungen bei. Ludwigs II. Aufenthalt dauert bis zum 9. August.
7. 8 1876 - Margaretha Geertruida Zelle, die spätere Mata Hari, kommt zur Welt
Leeuwarden * Margaretha Geertruida Zelle, die spätere Mata Hari, kommt im westfriesischen Leeuwarden als Tochter eines Hutmachers zur Welt.
13. 8 1876 - Richard Wagner eröffnet sein Festspielhaus in Bayreuth
Bayreuth * Richard Wagner eröffnet - im Beisein des deutschen sowie des brasilianischen Kaisers und des württembergischen Königs - sein Festspielhaus in Bayreuth. Bayerns König Ludwig II. befindet sich nicht unter den Gästen, obwohl er zuvor dem Komponisten beim Bau des Theaters großzügigst unter die Arme gegriffen hatte.
21. 8 1876 - Max Fey, der zweitälteste Bruder von Valentin Ludwig, wird geboren
München-Au * Max Fey, der zweitälteste Bruder von Valentin Ludwig, wird geboren.
22. 8 1876 - Adolf Friedrich von Schack wird zum Grafen erhoben
Berlin * Adolf Friedrich von Schack erhält die erbliche preußische Grafenwürde übertragen.
27. 8 1876 - König Ludwig II. besucht den „Ring“-Zyklus der Bayreuther Festspiele
Bayreuth * Zwischen dem 27. und dem 31. August besucht König Ludwig II. den dritten und letzten „Ring“-Zyklus der ersten Bayreuther Festspiele.
9 1876 - Die erste, noch sehr bescheidene „Völkerschau“ auf dem „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Die erste, noch sehr bescheidene „Völkerschau“ wird auf dem „Oktoberfest“ gezeigt.
Gezeigt werden: „Die Lappländer Polarmenschen, bestehend aus 2 Männlichen und 2 Weiblichen, produzieren sich hier während des Oktoberfestes auf der Festwiese, und zwar mit ihren 4 Renntieren, Eishunden (Bärenfänger), Hütten, Fahrzeugen und vielen Originalgerätschaften in einem eigens zu diesem Zwecke elegant hergerichteten Theater“.
9 1876 - Michael August Schichtl‘s „Hinrichtung einer lebenden Person“
München-Theresienwiese * Michael August Schichtl‘s „Hinrichtung einer lebenden Person“ zieht die Menschen an.
21. 10 1876 - Münchens erste schienengebundene Pferdetrambahnlinie wird eröffnet
München * Münchens erste schienengebundene Pferdetrambahnlinie kann eröffnet werden. Schon am ersten Tag wird die Münchner Tramway Ed. Otlet von 5.092 Fahrgäste genutzt. Das sind weit mehr Straßenbahnbenutzer, als die Betreiberfirma zuvor erwartet hat. Damit beginnt der Siegeszug der Straßenbahn.
22. 10 1876 - Das neue Verkehrsmittel von den Münchner äußerst positiv angenommen
München * Im Bericht den Münchner Neuesten Nachrichten heißt es: „Auf dem Promenadeplatz hatte sich eine speziell geladene Gesellschaft eingefunden. Es rollten sieben mit sehr hübschen, muthigen Pferden bespannte elegante Waggons heran. Signalpfeifen der sechs in blauer Uniform gekleideten Condukteurs ertönten und die Fahrt begann. In ca. 20 Minuten hatte der Zug sein Ziel, die Endstation Burgfrieden an der Nymphenburgerstraße, erreicht“.
Trotz anfänglicher Probleme wird das neue Verkehrsmittel von den Münchner äußerst positiv angenommen. Edouard Otlets Unternehmen schaffte für München 49 „geschlossene Waggons mit zwei offenen Plattformen an jeder Seite“ an. Gebremst wird das Gefährt vom Wagenführer per Fuß mit einer einfachen Hebelbremse. Als jedoch bei einer Probefahrt ein Wagen auf dem abschüssigen Rosenheimer Berg beim Gasteig nicht zum Stehen kommt, sondern einfach weiter rutscht, wird die Fertigungsfirma zum Einbau einer Spindelbremse verpflichtet.
Die weiß-blau gestrichenen Trambahnwagen sind mit bequem gepolsterten Sitzen ausgestattet. Für Kinder ist in den Waggons eigens eine Messlatte angebracht, da sie bei einer Körpergröße unter einem Meter - in Begleitung eines Erwachsenen - kostenlos mitfahren konnten. Haltestellen gibt es zwar, aber jeder steigt ein und aus, wo es ihm passt. Eine Münchner Zeitung berichtet:
„Ein weiterer Übelstand ist das leider viel zu wenig kontrollierte Absteigen. Es wird vielen Mitfahrenden geradezu angst und bange, wenn jemand Anstalten zum Absteigen macht. Ohne große Ausnahme geschieht dies immer in entgegengesetzter Fahrtrichtung, und ... bums, da liegen sie im Kot.“
29. 10 1876 - Dr. Bernhard von Gudden wird der betreuende Arzt von Prinz Otto
München * Dr. Bernhard von Gudden wird der betreuende Arzt von Prinz Otto. Er führt das System der Prinzenärzte ein. Seine Assistenzärzte übernehmen freiwillig Prinz Ottos Betreuung für ein oder zwei Monate.
19. 12 1876 - Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Haidhausen
München-Haidhausen * Gründung der 5. Compagnie der Freiwilligen Feuerwehr München in Haidhausen.
1877 - 60 „Ziegeleien“ zwischen Ramersdorf und Unterföhring
München-Ramersdorf - Unterföhring * Zwischen Ramersdorf und Unterföhring werden 60 „Ziegeleien“ gezählt.
1877 - Der „Metzgersprung“ lässt sich regelmäßig nachweisen
München-Graggenau * Der „Metzgersprung“ lässt sich regelmäßig nachweisen.
1877 - Eine Durchfahrt für die Trambahn durch das „Alte Rathaus“
München-Graggenau * Um eine Durchfahrt durch das „Alte Rathaus“ für die Trambahn zu schaffen, wird die breite Treppe und der „Pranger des Stadtgerichts“ beseitigt.
1877 - Der „Coulmiersplatz“, der heutige „Haidenauplatz“, erhält seinen Namen
München-Haidhausen * Der „Coulmiersplatz“ in Haidhausen, der heutige „Haidenauplatz“, erhält seinen Namen.
1877 - Die „Kunstgewerbeschule“ zieht an die Luisenstraße 37
München-Graggenau - München-Maxvorstadt * Die „Kunstgewerbeschule“ zieht von ihren Räumen am „Hofgarten“ in die umfangreich erweiterte ehemalige „Glasmalerschule“ an der Luisenstraße 37.
1877 - Die „Braugrafen“ Butler-Haimhausen und die „Singlspielerbrauerei“
München-Au * In den Jahren zwischen 1872 und 1877 produzieren die „Braugrafen“ Butler-Haimhausen in der „Singlspielerbrauerei“ jährlich zwischen 20.000 und 25.000 Scheffel Malz Bier.
1877 - Die „Eberl-Faber-Aktiengesellschaft“
München * Der „Faber-Bräu“ und die „Eberlbrauerei“ verschmelzen endgültig zur „Eberl-Faber-Aktiengesellschaft“.
1877 - Arnold Zenetti beantragt die Aufstellung einer „Berufsfeuerwehr“
München * „Stadtbaurat“ Arnold Zenetti beantragt die Aufstellung einer „Berufsfeuerwehr“.
1877 - Ein „Frauenbad“ auf der „Flaucherinsel“ wird eröffnet
Thalkirchen * Ein „Frauenbad“ wird - durch die Isar in „angemessenem Abstand“ getrennt - auf der „Flaucherinsel“ eröffnet.
1877 - Die „Unheilbaren“ kommen ins „Krankenhaus Rechts der Isar“
München-Au - München-Haidhausen * Die Insassen des „St.-Nicolai-Spitals der Unheilbaren“ am Kolumbusplatz können nach Haidhausen, ins „Krankenhaus Rechts der Isar“, umziehen.
Nach der Verlegung werden die Gebäude auf Abbruch versteigert.
1877 - Irene Gräfin von Arco stirbt - ihr Mann heiratet morganatisch
München * Irene Gräfin von Arco stirbt.
Aloys (Louis) Graf von Arco-Stepperg heiratet in zweiter (morganatischer) Ehe die Tänzerin Pauline Oswald, die Mutter seiner inzwischen neunjährigen Tochter Sophie Gräfin von Arco-Stepperg.
1877 - Die „Einführung der Leichenverbrennung“ wird beantragt
München - München-Obergiesing * Mit der Sammlung von Unterschriften beantragt man beim Magistrat die „Einführung der Leichenverbrennung“.
Dieser befürwortet den Antrag, da sich für die rasant wachsende Großstadt mit der Feuerbestattung das Problem der „Grabplatz-Knappheit“ lösen würde.
Ab 1877 - Ludwig Thoma besucht verschiedene Schulen
Neuburg - Burghausen - München - Landshut * Bis zum Jahr 1885 besucht Ludwig Thoma die Schulen in Neuburg an der Donau, Burghausen, München [„Wilhelms-Gymnasium“] und Landshut.
1. 1 1877 - Sendling wird nach München eingemeindet
München-Sendling - München-Theresienwiese * Sendling wird mit den Gemeindeteilen Untersendling, Mittersendling, Neuhofen und Sendlinger Haid nach München eingemeindet, weshalb die Stadt bei der Vergabe der Bierbuden keine Rücksichten mehr nehmen muss.
6. 8 1877 - Die Polytechnische Schule wird zur Technischen Hochschule
München-Maxvorstadt * Die Polytechnische Schule wird in Technische Hochschule in München umbenannt.
25. 8 1877 - Die Grotte bei Schloss Linderhof wird fertiggestellt
Schloss Linderhof * Die Grotte bei Schloss Linderhof wird fertiggestellt.
Um den 10 1877 - „Siemens & Halske“ verbessert das Bell'sche Telefon
Berlin * Das von Graham Bell entwickelte ein elektromagnetisches Telefon kommt nach Deutschland und - da es hier nicht patentrechtlich geschützt war - von Firmen wie „Siemens & Halske“ nachgebaut wird.
Werner von Siemens erkennt frühzeitig die Bedeutung des „Telephons“ und verbessert die „Bell‘schen Apparate“ erneut.
Damit beginnt der Siegeszug des „Telephons“.
6. 11 1877 - Der stolze Wildschütz Jennerwein wird ermordet
Rinnerspitz * Girgl Jennerwein, der berühmte „stolze Wildschütz‘“, der in „seinen schönsten Jahren“ als Wilderer wird auf dem Rinnerspitz in den Schlierseer Bergen ermordet. Er ist auf dem Friedhof Westenhofen in Schliersee beerdigt.
Ab dem Jahr 1878 - Die „Pferde-Trambahn“ fährt über den Weißenburger Platz
München-Haidhausen * Von 1878 bis 1889 fährt die „Pferde-Trambahn“ über den Weißenburger Platz.
1878 - Das „Gasteiger-Brunnhaus“ wird aufgelassen
München-Kreuzviertel * Das „Gasteiger-Brunnhaus“ nördlich des „Neuhauser Tores“ wird aufgelassen.
An seiner Stelle entsteht ab 1896 das „Künstlerhaus“.
1878 - Von den Arbeitsbedingungen der Ziegeleiarbeiter
Berg am Laim - München-Haidhausen - Bogenhausen * Da die „padroni“ jenseits der Alpen bei den „Akkordanten“ komplette Arbeitstrupps anheuern, stellen sie anfangs auch keine Geräte zur Verfügung.
Das bedeutet, dass die Italiener Schaufeln und Hacken schleppen und selbst Schubkarren und anderes Gerät über die Alpen schieben müssen.
An ihrem Arbeitsplatz in München angelangt, liegt ihnen ausschließlich daran, durch möglichst viel Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen.
Durch das Bezahlen von „Akkordlöhnen“ entziehen sich die Italiener den Kontrollen, die man zur überwachung der gesetzlichen Vorgaben eingeführt hat.
Frauen und Kinder übernehmen die körperlich weniger schweren Tätigkeiten.
Manchmal bilden Familien ein Team, mit dem „stampadore“ an der Spitze.
Frau und Kinder haben ihm zuzuarbeiten und je besser die einzelnen Arbeitsschritte koordiniert sind, desto besser ist auch das Gesamtergebnis.
Schon zehnjährige Buben verdingen sich als Handlanger.
Die „mulis“ stehen an der untersten Stelle der Hierarchie, haben den Mund zu halten und müssen einfach funktionieren.
Zwar sieht die „Reichsgewerbsordnung“ aus dem Jahr 1878 Bestimmungen zum „Arbeitsschutz für Kinder und Frauen“ vor, so eine „Beschränkung der Arbeitszeit“ sowie das „Verbot von körperlich schwerer Arbeit“.
Doch die Verordnung wird in der Praxis unterlaufen und die Strafen sind so lächerlich niedrig, dass sie wirkungslos bleiben.
Wenn kontrolliert wird, dann, so ein resignierter Fabrikinspektor, „[...] braucht sich der Jugendliche nur neben der [Arbeits-]Bank auf den Boden zu setzen, um Jedermann ad oculos zu demonstrieren, daß er seine Ruhepause in echt italienischer Weise feiert“.
1878 - Die „Wolfgang-Kapelle“ in Haidhausen wird abgerissen
München-Haidhausen * Die „Wolfgang-Kapelle“ in Haidhausen wird abgerissen.
1878 - Jeder Vortrag in einem „Tingeltangel“ muss polizeilich genehmigt werden
Berlin * In einer „Reichspolizeiverordnung“ wird festgelegt, dass jeder Vortrag in einem „Tingeltangel“ polizeilich genehmigt werden muss, dass diese Genehmigung nur für ein bestimmtes Lokal gilt und dass die Erlaubnis zudem zurückgezogen werden kann.
Außerdem wird die Aufführung von Dramen, Lustspielen, Possen, Opern, Operetten, Sing- und Liederspielen, Tänzen und Balletts als unzulässig erklärt.
Nur Gesangs- und Deklamationsstücke mit einer Besetzung von höchstens zwei Personen sind erlaubt.
Die vortragenden Personen dürfen aber nur in bürgerlicher Kleidung (Gesellschaftsanzug) auf der Bühne erscheinen.
Alle Vorträge im Kostüm sind verboten.
Als Ausnahme wird der Auftritt im „wirklichen Nationalkostüm“ (Tracht) genehmigt.
Auch Kulissen, Vorhänge und jede Art von Requisiten werden von der Bühne verbannt.
Außerdem durften die vorgetragenen Gesangs- und Deklamationsstücke in Inhalt und Vortragsweise nicht gegen die Religion, die Sittlichkeit, die staatlichen Einrichtungen, den öffentlichen Anstand und die öffentliche Ordnung verstoßen.
Die Vorträge dürfen frühestens um 18 Uhr beginnen und müssen spätestens um 23 Uhr beendet sein.
1878 - Erstaufführung von Richard Wagners Opern
München-Graggenau * Erstaufführung von Richard Wagners Opern „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ sowie die erste vollständige Aufführung des „Ring der Nibelungen“ im Münchner „Hof- und Nationaltheater“.
1878 - Der „Heumarkt“ wird an den „Schlachthof“ an der Kapuzinerstraße verlegt
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Der ursprünglich am „Isartor“ gelegene „Heumarkt“ wird an den „Städtischen Schlachthof“ an der Kapuzinerstraße verlegt.
1878 - Der „Velociped-Klub“ führt immer wieder Rennen in den „Isarauen“ durch
München * Der „Münchner Velociped-Klub“ führt in den kommenden Jahren immer wieder Rennen in den „Isarauen“ durch, hat allerdings das Problem, dass sie tagsüber verboten sind und die Obrigkeit nichts davon erfahren darf.
So auch anno 1878, als die Fahrer in der vorletzten Runde „von der bewaffneten Macht, die von der Veranstaltung Wind bekommen hatte, mit donnerndem Halt zum Absitzen gezwungen wurden“.
Der Attraktivität des neuen Sports schadeten diese Maßnahmen in keinster Weise.
Auch wenn die Rennen wegen der Verbote in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlegt werden mussten, war das Publikumsinteresse am „Reiten auf den Velocipeden“ riesengroß.
Schon deshalb erlebt die Stadt seither ständig neue radsportliche Höhepunkte.
Die ehrgeizigen Münchner „Velo-Clubs“ verfügen immer über die besten und schnellsten Rennbahnen.
1878 - Der „Velo-Club“ den „Polizeidirektor“ zum „Faschingsball“ ein
München * Um die polizeilichen Unfreundlichkeiten und Schikanen gegenüber den Radfahrern abzumildern, lädt der Münchner „Velo-Club“ den „königlichen Polizeidirektor“ zum „Faschingsball“ ein.
Durch gutes Zureden - bei Kaviar und Champagner - erreichen die „Radlnarrischen“ schließlich eine bessere Grundstimmung der Polizei gegenüber ihren Interessen.
Ab 1878 - Franz Stuck besucht die „Kunstgewerbeschule“
München-Maxvorstadt * Franz Stuck besucht die „Kunstgewerbeschule“ in München bei Ferdinand Barth.
Ab dem Jahr 1878 - Das Streckennetz des „Stadtomnibuses“ wird ausgeweitet
München-Haidhausen - München-Au * In der Zeit von 1878 bis 1880 wird das Streckennetz des „Stadtomnibuses“ auch auf Haidhausen und zum „Mariahilfplatz“ ausgeweitet.
Die Betriebszeit ist „von 7:30 Uhr morgens bis 7:30 Uhr abends“.
Die klassische „Linie 1“ verkehrt alle sechs Minuten, die anderen Linien in einem zeitlichen Abstand von zwölf Minuten.
Der „Fahrpreis“ ist inzwischen auf zehn Pfennige festgelegt worden.
1878 - Das „katholische Stadtpfarramt“ lehnt die „Leichenverbrennung“ ab
Gotha * In Gotha entsteht Deutschlands erste „Leichenverbrennungsanlage“.
Der Münchner Magistrat befragt daraufhin die drei „Religionsgemeinschaften“ über Einwände gegen die „Feuerbestattung“.
Während die „Israelitische Kultusgemeinde“ keinerlei Einwand sieht und das „protestantische Stadtpfarramt“ Änderungen des Ritus für unnötig erachtet, lehnt das „katholische Stadtpfarramt“ die „Leichenverbrennung“ kategorisch ab.
Fürsprecher findet diese Bestattungsform bei den Sozialdemokraten.
Sie fordern eine allgemeine Einführung der „Feuerbestattung“ als einzige Möglichkeit, Chancengleichheit zu gewähren, da mit der „Leichenverbrennung“ endlich die „Klassenbegräbnisse“ hinfällig werden würden.
28. 2 1878 - Joseph Schülein ist Miteigentümer eines Unternehmens für Bankgeschäfte
München * Joseph Schülein ist - gemeinsam mit Gustav und Jakob Schülein - Miteigentümer eines Unternehmens für Bank- und Wechselgeschäfte, das beispielsweise bei der Finanzierung des Münchner Vieh- und Schlachthofes mitwirkt.
16. 3 1878 - Prinz Ottos ärztliche Überwachung und Betreuung wird intensiviert
München * Prinz Ottos ärztliche Überwachung und Betreuung wird intensiviert.
16. 3 1878 - König Ludwig II. entmündigt seinen Bruder Prinz Otto
München * König Ludwig II. entmündigt seinen Bruder Prinz Otto.
6. 4 1878 - Erich Mühsam wird in Berlin geboren
Berlin * Erich Mühsam wird in Berlin geboren.
Ab 5 1878 - Georg von Dollmann und die Planungen für „Schloss Herrenchiemsee“
Schloss Herrenchiemsee * Georg von Dollmann wirkt bei den Planungen für „Schloss Herrenchiemsee“ mit.
21. 5 1878 - Grundsteinlegung für Schloss Herrenchiemsee
Schloss Herrenchiemsee * Der Grundstein für das neue Schloss Herrenchiemsee wird gelegt.
13. 6 1878 - Der Berliner Kongress soll die Balkankrise beenden
Berlin * In Berlin beginnt unter der Führung des Reichskanzlers Otto von Bismarck ein Kongress, der die Balkankrise beenden und eine neue Friedensordnung für Südosteuropa aushandeln soll. Der Berliner Kongress endet am 13. Juli mit dem Berliner Vertrag.
13. 7 1878 - Der Berliner Kongress endet mit dem Berliner Vertrag
Berlin * Der Berliner Kongress endet mit dem Berliner Vertrag, in dem die bisherigen türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina dem Habsburgerreich zur Okkupation überlassen werden.
9 1878 - Ein „Wachsfigurenkabinett“ zeigt unappetitliche Krankheitssymptome
München-Theresienwiese * Ein „anatomisch und ethnologisches Wachsfigurenkabinett“ zeigt unappetitliche Krankheitssymptome.
Diese „unsittliche Zurschaustellung“ erregt die Öffentlichkeit.
5. 10 1878 - Das Kil's Colosseum erhält die Konzession für Singspielhallen
München-Isarvorstadt * Die Singspielhalle Kil's Colosseum erhält die Konzession für Singspielhallen und Café chantants. Sie wird in Bezug zum Bayerischen Polizei-Strafgesetzbuch vom 16. Dezember 1871 gestellt, in dem festgelegt ist: „das sogenannte Chansonetten-Kostüm selbst in der abgeschwächten Form des kurzen ausgeschnittenen Kleides mit kurzen Ärmeln und mit Trikot ist verboten.
Die Chansonetten und Coupletsängerinnen dürfen nur in langem Gesellschaftskleide auftreten. Nur das National-Costüm von echten National-Sängern ist von den Bestimmungen [...] ausgenommen“.
Um den 18. 10 1878 - Prinz Otto wird in Schloss Schleißheim untergebracht
Schloss Schleißheim * Prinz Otto wird in Schloss Schleißheim untergebracht.
21. 10 1878 - Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie
Berlin - Deutsches Reich - München-Au * Da die Zahl der Anhänger der sozialistischen Arbeiterbewegung ständig wächst und von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilt, setzt Reichskanzler Otto von Bismarck das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie in Kraft.
Davon unabhängig fördern die Bischöfe die katholischen Werktätigen finanziell und ideell mit der Organisation von Arbeitervereinen, darunter den Katholischen Arbeiterbund und dem Kolpingverein. Auch die Josephshäuser in der Hochstraße zeugen von diesen Aktivitaten.
Während es den sozialdemokratischen Arbeitervertretungen um eine harte Vertretung der Arbeitnehmerinteressen gegenüber den Unternehmern und dem Staat geht, ist das oberste Ziel der katholischen Arbeitervereine die „christliche Lebensführung der Arbeiterfamilien“ und die Förderung sowie den Erhalt von „Religion und Sittlichkeit bei den Arbeitern“.
28. 10 1878 - Der Reichstag verabschiedet das Sozialistengesetz
Berlin * Der Reichstag verabschiedet mit den Stimmen der Konservativen und Nationalliberalen das Gesetz zur Bekämpfung der gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Es gilt bis 1890.
1879 - München hat 101 „Weinwirtschaften“
München * München hat 101 „Weinwirtschaften“.
1879 - Carl von Linde gründet die „Gesellschaft für Lindes Eismaschinen AG“
Wiesbaden * Carl von Linde gibt seine akademische Laufbahn auf und gründet in Wiesbaden die „Gesellschaft für Lindes Eismaschinen AG“.
1879 - Die italienischen „Ziegeleiarbeiter“ kommen schneller nach Bayern
Friaul - Königreich Bayern * Durch die neue Bahnlinie verkürzt sich die Reisedauer der italienischen „Ziegeleiarbeiter“ auf zwei Tage.
Bis dahin mussten sie den ganzen Weg über die Alpen zu Fuß zurücklegen. Das dauerte etwa 10 Tage.
1879 - Franz Lenbach wird „Allotria-Präsidenten auf Lebenszeit“
München * Die Künstlervereinigung „Allotria“ wählt Franz Lenbach zu ihrem „Präsidenten auf Lebenszeit“.
1879 - In „Landgerichtsgefängnis München II“ umbenannt
München-Au * Das „Bezirksgefängnis am Lilienberg“ wird in „Landgerichtsgefängnis München II“ umbenannt.
1879 - Der Kampf gegen die privaten Arbeitsvermittler
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Nach einem Bericht des „Münchener Gewerkschaftsvereins“ liegen die Einschreibegebühren für die privaten Arbeitsvermittler zwischen 50 Pfennigen und einer Mark.
Nach der Vermittlung eines Arbeitsplatzes ist eine entsprechende Gebühr fällig, die sich nach dem zu erwartenden Lohn ausrichtet.
Sie beträgt, bei einem Monatsverdienst von 10 bis 50 Mark, die Hälfte bis zu einem doppelten Monatslohn.
Die Vermittlungsgebühr zahlt zuerst der Arbeitgeber, der sie dann zumeist dem Arbeitnehmer vom Lohn abzieht.
Die Einrichtung von zentralen städtischen oder staatlichen Arbeitsvermittlungen ist ein besonderes Anliegen der Gewerkschaften, deren Einsatz die Münchner Stadtverwaltung zu einem fortschrittlichen Handeln bewegen wird.
1879 - Hauptamtliche „Feuerwehrmänner“ beziehen das „Hauptfeuerhaus“
München-Angerviertel * Zwölf hauptamtliche „Feuerwehrmänner“, ein „Telegraphist“ und ein „Oberfeuerwehrmann“ beziehen das „Hauptfeuerhaus“ am Heumarkt 13, dem heutigen Jakobsplatz.
Ziel und Zweck der „hauptamtlichen Wache“ ist:
„Bei jedem im Burgfrieden der Stadt München ausbrechenden Brande in möglichster Schnelligkeit nach der Brandstätte zu eilen, und ein dortselbst ausgebrochenes Schadenfeuer wo möglich im Entstehen zu unterdrücken, oder wenn dies nicht mehr möglich ist, zu versuchen, dasselbe so lange zu beschränken, bis die Abteilungen der freiwilligen oder der städtischen Feuerwehr zur Hilfe auf der Brandstätte erschienen sind“.
1879 - Das „Neue Vorstadt-Theater“ beim „Damenwirth“ wird gegründet
München-Au * Das „Neue Vorstadt-Theater“ in der Au beim „Damenwirth“ wird gegründet.
1879 - Die „Marianum“-Mädchen bei den „Armen Schulschwestern“
München-Obergiesing * Seit der Gründung der Privatstiftung „Marianum“ werden die vierundzwanzig Mädchen bei den „Armen Schulschwestern“ in der Kistlerstraße in Obergiesing im Näherei- und Stickereihandwerk ausgebildet.
1879 - Eine Beschreibung Untergiesings
München-Untergiesing * Im „Münchner Fremdenblatt“ sind - 25 Jahre nach der Eingemeindung - über Giesing folgende Zeilen zu lesen:
„(...) Viel berechtigter wäre der Ausspruch: „Die neue Wittelsbacherbrücke sei über die Isar gebaut, um bei ihrem prächtigen Anblick zu vergessen, welche Enttäuschung folgt, wenn man sie überschritten hat und sich einer Vorstadt nähert.
Da wir einmal auf dem Wege sind, wollen wir uns auf dem Schyrenplatz, so genannt zum Andenken der Wittelsbacher Ahnen, weiter wagen; denn es ist Schönwetter und die Police der Unfallversicherung in unserer Tasche.
Die Stadt hat aufgehört und liegt hinter uns - das Dorf beginnt, und zwar ein schmutziges Dorf.
Lassen wir den Tummelplatz des Rieser und niederbayerischen Federviehs (den Weideplatz der Martinsvögel, die jedoch hier zu jeder Zeit vertilgt werden, wenn sie nur 'gansln'), links liegen und haben wir die blauweiße Tafel passiert, auf der geschrieben steht „Gänsemarkt“, so kommen wir rechts vor dem Eingang in das eigentliche Giesing, an eine eigentümliche Fallgrube.
Auf unser Befragen hin wurde uns mitgeteilt, das sie die Universalabtrittsgrube der Adjazenten [= Anwohner] weit herum bilde, die in ihren Häusern des allernötigsten Rückzugsortes entbehren, der für alle zivilisierten Völker der notwendigste ist.
Gleich neben der Kommunegrube arbeitet die Wasserversorgungsanstalt, welche die Vorstadt mit filtriertem (?) Isarwasser beglückt.
Und wieder nur einen Schritt weiter kommen wir an eine Pfütze, an ein Stinkwasser, das von Zeit zu Zeit ein ärgeres Parfüm ausströmt, als alle Böcke von Bar el Maserim - und wahrhaftig diese stinken arg.
Giesing hat eine Gemeinschaft mit allen orientalischen Städten, nämlich: man soll sie von weitem anschauen, aber nicht hineingehen. [...]
Links ein eingeplankter Garten, rechts Holzhütten, in deren Vergleich die Troglodyten [= Höhlenbewohner] noch besser logiert haben, schließen eine Straße ein, zu deren Herstellung respektive Erweiterung schon längst hätte energisch vorgegangen werden müssen - wenn eben Giesing kein Stiefkind der Stadt wäre.
Einstimmig muß man von den Giesingern hören:
„Wir sind nur gut genug, Steuern und Abgaben zu bezahlen, im übrigen schert sich kein Mensch um uns“. [...]
In dem ganzen zur Stadt gehörigen Giesing ist mit Ausnahme der Tegernseer Landstraße kein Trottoir; bei jedem Regen stehen die Tümpel in den Straßen, die nach längerer Zeit die Luft verpesten und die Gesundheit schädigen.
Während in den übrigen Vorstädten die Nacht hindurch die bestimmten Gaslaternen noch Licht haben, ist diese Wohltat für die Giesinger nicht gegeben; um 1 Uhr nachts sind alle Lichter gelöscht - um diese Zeit hat eben der Giesinger nichts mehr auf der Straße zu suchen!“
1879 - Der „Steyrer Hans“ lässt einen schwereren Steinbrocken anfertigen
München * Droht ihm ein Bewerber beim „Steinheben“ den Rang abzulaufen, lässt der „Steyrer Hans“ einen schwereren Steinbrocken anfertigen.
Mit 508 Pfund erreicht er seinen ersten Höhepunkt, den er wenig später um weitere zwanzig Pfund überbietet. Eine Steigerung ist dann allerdings nicht mehr drin.
Den schweren Brocken am Mittelfinger der rechten Hand hängend, verschafft er der linken schließlich noch ein wenig Beschäftigung zum Ausgleich: Mit ihr hält er gleichzeitig eine 100 Pfund schwere Eisenkugel mit gestreckter Hand in der Waagerechten.
1879 - Der „Glaspalast-Brunnen“ wird abgebaut und eingelagert
München-Maxvorstadt * Der Brunnen im „Münchner Glaspalast“ am „Alten Botanischen Garten“ wird abgebaut und im Bauhof eingelagert.
1879 - Friedrich Fabri stellt die „Frage nach deutschen Kolonien“
Deutsches Reich * Friedrich Fabri, ein aus Franken stammender „Missionsleiter, Expansionspublizist, Kolonial- und Sozialpolitiker“, veröffentlicht eine aufsehenerregende Broschüre, in der er die Frage stellte: „Bedarf Deutschland der Kolonien?“.
Fabri gilt gemeinhin als „Vater der deutschen Kolonialbewegung“.
Er sieht in der „Überbevölkerung“, der „Überproduktion“ und dem „Kapitalüberschuss“ die eigentlichen Ursachen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisenerscheinungen des Kaiserreichs.
Friedrich Fabris „Krisentherapie“ besteht aus einer „Exportoffensive“ an Waren, Kapital und Menschen. Durch eine „gelenkte Auswanderung“ und gegebenenfalls auch der „Deportation“ der Kräfte aus der sich emanzipierenden sozialistischen „Arbeiterschaft“, die an ihren „systemverändernden Absichten“ festhielten, könnte auch die „Soziale Frage“ nach „Übersee“ exportiert werden.
Friedrich Fabri stilisierte damit die „Frage nach deutschen Kolonien“ zu einer deutschen „Überlebensfrage“ hoch.
1 1879 - Der Rohbau von „Schloss Herrenchiemsee“ ist fertiggestellt
Schloss Herrenchiemsee * Der Rohbau von „Schloss Herrenchiemsee“ ist weitestgehend fertiggestellt.
Der Innenausbau beginnt im Frühjahr.
8. 4 1879 - Volkssänger Georg Schwarz wird zu sechs Mark Strafe verurteilt
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Münchner Volkssänger Georg Schwarz wird zu sechs Mark Strafe verurteilt. Er hat bei Abendauftritten am 27. November 1878 im <em>„Fraunhofergarten“</em> und am 4. Dezember 1878 im <em>„Braunauerhof“</em> Bärte, Perücken, Zylinder und <em>„andere Versatzstücke“</em> benutzt.</p>
24. 8 1879 - Einweihung der neuen Johann-Baptist-Pfarrkirche
München-Haidhausen * Einweihung der neuen Johann-Baptist-Pfarrkirche in Haidhausen.
9 1879 - Der Steyrer Hans betreibt eine „Braubude“ auf dem „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Von 1879 bis 1903 bewirtschaftet der Steyrer Hans eine „Braubude“ auf dem „Oktoberfest“.
Zuerst betreibt er eine „Festbude“ der „Pschorr-Brauerei“, um dann in den 1890er Jahren das „Kraftbier“ der Spatenbrauerei zu verzapfen. Dazu pachtet er gemeinsam mit seinem Schwager, dem Gastwirt Wilhelm Schäffer, zwei nebeneinanderliegende Budenplätze und errichtet darauf eine „Doppelbude“.
Eine „Athleten-Kapelle“ spielt zur Unterhaltung auf. „Kraftbier“, „Kraftfleisch“, „Kraftsemmeln“ und eine „Kraftbrühe“ werden angeboten.
Hier zeigt er auch sein viel bewundertes „Athleten-Kunststück“. Der „Steyrer“ packt ein mit dreißig bis vierzig Litern Bier gefülltes Fass mit zwei Fingern am Rand und hebt es vom Boden auf den Schanktisch.
Der „Steyrer Hans“ versteht es außerordentlich gut, für sich und seine Geschäfte zu werben und so seine Popularität zu steigern. Er will in seiner „Festbude“ seine schwergewichtigen Requisiten, darunter seine „Schnupftabakdose“, ausstellen. Als ihm der „Magistrat“ dazu die Erlaubnis verweigert, drückt er sein Bedauern in Anzeigen aus, nicht jedoch ohne darauf hinzuweisen, dass das Publikum das interessante Schauerlebnis jederzeit im Saal seines Gasthauses nachholen könne.
7. 10 1879 - Der Zweibund wird in Wien geschlossen
Wien * Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn schließen sich in Wien zum sogenannten Zweibund zusammen.
24. 12 1879 - Mit minus 13,5 Grad erlebt München den kältesten Heiligabend
München * Die Münchner erleben mit minus 13,5 Grad den kältesten Heiligabend seit es Wetteraufzeichnungen gibt.
Anno 1880 - Der „Irrenweg” wird in Balanstraße umbenannt
München-Au - München-Haidhausen * Die Balanstraße erhält ihren Namen erst, nachdem sich einige Anwohner des ursprünglich „Irrenweg” genannten Verkehrswegs gegen diese seit dem Jahr 1867 gültige amtliche Bezeichnung wenden.
Die neue Straßenbezeichnung leitet sich von der am 1. September 1870 tobenden Schlacht des nahe Sedan gelegenen Balan ab.
An sie knüpfen sich „ruhmreiche Erinnerungen für die bayerische Armee, in Sonderheit für die Münchner Regimenter“.
1880 - Aus dem „Zengerbräu“ wird die „Aktienbrauerei Bürgerliches Bräuhaus“
München-Haidhausen * Der „Zengerbräu“ wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in „Aktienbrauerei Bürgerliches Bräuhaus München“ umbenannt.
Um 1880 - Georgenstraße 8/10 wird als symmetrisches Doppelhaus hergestellt
Schwabing * Das Gebäude Georgenstraße 8/10 wird nach dem Entwurf von Josef Hoelzle als symmetrisches Doppelhaus hergestellt.
1880 - Ein 15 x 4 Meter großes Monumentalgemälde des Malers Karl von Piloty
München-Graggenau * Der große „Sitzungssaal“ für die „Gemeindebevollmächtigten“ im „Neuen Rathaus“ wird mit einem 15 x 4 Meter großen Monumentalgemälde des Malers Karl von Piloty geschmückt.
1880 - Der „Bildhauer“ Anton Heß will in seinen Antiquitäten leben
München-Maxvorstadt * Der „Bildhauer“ Anton Heß lässt sich durch den Architekten Leonhard Romeis neben seinem „Atelierbau“ ein villenartiges Wohnhaus im Stil der „deutschen Renaissance“ errichten.
Der Bildhauer will ein Wohnhaus, in dem er seine über Jahrzehnte angesammelten Antiquitäten, vornehmlich aus der Renaissancezeit, als Wohngegenstände gebrauchen kann.
Leonhard Romeis muss deshalb „von innen nach außen“ planen.
Fußböden, Holzdecken und Wandvertäfelungen bilden die Vorgaben, nach deren Abmessungen sich die Zimmergrößen der einzelnen Räume zu richten haben.
Aus den Maßen der Zimmereinrichtung ergibt sich die Zimmergröße und -höhe, aus der Zimmergröße der Grundriss und erst daraus kann er die Gestaltung der Fassade entwickeln.
Architekt Romeis hat also zum einen die Aufgabe, fünf komplette Zimmer mit Wandvertäfelung und zum Teil auch Erker und Sitznische sowie verschiedene Decken in einen Bau zu integrieren, als auch gleichzeitig fehlende Teile im Stil der historischen Teile zu entwerfen, um eine einheitliche Wirkung des ganzen Hauses zu erzielen.
Anton Heß verzichtet in einigen Bereichen auf Komfort und zieht unpraktische Möbel, wie kurze, gotische Betten, oder zum Teil niedrigere Türen einem Wohnen in zeitgenössischem Mobiliar vor.
Der Bildhauer sammelt die Gegenstände also zur wirklichen Benutzung und strebt keine „Stilreinheit“ an.
So kombiniert er in seinem Haus Südtiroler Stuben aus Kurtatsch und Montan aus dem Jahr 1576 mit Türen und einem Treppengeländer aus Münchner Bürgerhäusern, Portal- und Türverkleidungen aus Kloster Seeon, um 1620, und Plafonds aus Ulm.
1880 - Die Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“ beschäftigt 37 Personen.
München-Graggenau * Die Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“ beschäftigt 37 Personen.
1880 - Die „Münchner-Kindl-AG“ erwirbt die „Singlspielerbrauerei“
München-Au * Ein anonymes Finanzkonsortium erwirbt die „Singlspielerbrauerei“ und betreibt sie unter dem Namen „Münchner-Kindl-Aktiengesellschaft“ weiter.
Die neue Leitung der Aktiengesellschaft vermehrt den Immobilienbesitz an der Rosenheimer Straße beachtlich.
Der Bierausstoß kommt nicht über den einer mittleren Brauerei hinaus.
1880 - Die „Franziskaner-Brauerei“ liegt an dritter Stelle beim Bierausstoß
München-Au * Mit einem Bierausstoß von 360.000 Hektolitern liegt die „Franziskaner-Brauerei“ an dritter Stelle in München.
Acht Dampfmaschinen erzeugen eine Leistung von 800 PS.
Fünf Kälteerzeugungsmaschinen ersetzen täglich 4.000 Zentner Eis und diesen zur Kühlung der Lagerkeller.
1880 - Im „Thalia-Theater“ in der Bayerstraße wird eine „Rollschuhbahn“ eröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Im „Thalia-Theater“ in der Bayerstraße 16a wird eine abends beleuchtete und geschmückte „Rollschuhbahn“ für 150 bis 200 Personen eröffnet.
1880 - Hugo Alois von Maffei, Mitbegründer der „Allianz-Versicherung“
München * Joseph Anton Ritter von Maffei's Neffe und Nachfolger, Hugo Alois von Maffei, gehört zu den Gründern der „Bayerischen Rückversicherungsgesellschaft“, aus der später die „Allianz-Versicherung“ hervorgeht.
1880 - Eduard Theodor Grützner erhält den „Verdienstorden des Heiligen Michael“
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützner erhält den „Verdienstorden des Heiligen Michael, Ritterkreuz erster Klasse“.
1880 - Die „Hypotheken- und Wechselbank“ ersteigert die „Giesinger Mühle“
München-Untergiesing * Die von dem „Bayerischen Hofbankier“ Simon von Eichthal mitbegründete „Bayerische Hypotheken- und Wechselbank“ ersteigert die „Giesinger Mühle“ um 80.000 Mark,
Ab 1880 - Der Steyrer Hans zeigt seine „Kunststücke“ auch im Ausland
München - Paris - Amsterdam * Der Steyrer Hans dehnt seine „Gastauftritte“ auch auf das Ausland - nach Paris und Amsterdam - aus.
Das ist zwischen 1880 bis 1885. Engagements in Amerika reizen den „bayerischen Herkules“ ebenso, doch scheitern diese Reisen an der Furcht des „Kraftmenschen“ vor einer „Seekrankheit“. Also bleibt er auf dem europäischen Kontinent und zeigt hier seine „Kunststücke“.
1880 - Der Rohbau von „Schloss Neuschwanstein“ ist vollendet
Schloss Neuschwanstein * Der Dachstuhl von „Schloss Neuschwanstein“ wird aufgesetzt.
Damit ist der Rohbau vollendet.
1880 - Die Regierung lehnt die Pläne der „Bell-Telephone-Company“ ab
München - Nürnberg * Die „Bell-Telephone-Company“ will in München und Nürnberg eine „Ortssprechanlage“ aufstellen.
Diese Pläne stoßen aber bei der bayerischen Landesregierung auf Ablehnung, da diese das „Telephonwesen“ unter staatlicher Aufsicht wissen will.
Um das Jahr 1880 - Sigmund Feuchtwanger gründet eine „Kunstbutterfabrik“ in Haidhausen
München-Haidhausen * Sigmund Feuchtwanger, Lion Feuchtwangers Vater, gründet eine „Kunstbutterfabrik“ [= Margarine] in der Grillparzerstraße in Haidhausen.
1880 - Ernst von Possart holt Josef Kainz nach München
München * Ernst von Possart holt den jungen österreichischen Schauspieler Josef Kainz nach München.
Um 4 1880 - Leonhard Romeis bereist Südtirol
Südtirol * Leonhard Romeis bereist Südtirol, um dort für das Wohnhaus seines ersten Bauherrn und Kollegen an der „Kunstgewerbeschule“, den „Bildhauer“ Anton Heß, Burgen und Schlösser zu studieren.
26. 6 1880 - Die erste deutsche Radrennbahn wird an der Auenstraße eröffnet
München-Isarvorstadt * Die erste deutsche Radrennbahn auf der Lautner'schen Eisbahn an der Auenstraße wird eröffnet. Die Aschenbahn ist 333 Meter lang.
3. 7 1880 - Carl von Eichthal stirbt in München
München * Carl von Eichthal, der Kgl. Bay. Hofbankier und Mitbegründer der Bayerischen Vereinsbank, stirbt in München.
26. 7 1880 - Das Gas-Konsortium erwirbt Grund am Kirchstein
Bogenhausen * Das Gas-Konsortium erwirbt am Kirchstein von dem Ziegeleibesitzer Nicolaus Huber ein Areal von insgesamt 6,077 Hektar.
30. 7 1880 - Die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen kauft die Spießmühle
München-Au * Die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen, Wiesbaden, kauft die Spießmühle in der Au mit den dazugehörigen Wasserechten.
8 1880 - Joseph Kißlinger wird neuer Scharfrichter
München * Der Scharfrichter Lorenz Schellerer stirbt nach 72 selbst vorgenommenen Enthauptungen in der Psychiatrie, in die er wegen Verfolgungswahns eingeliefert worden ist.
In der Zwischenzeit ist Joseph Kißlinger, ebenfalls ein Verwandter der Reichharts, zum Henker ernannt worden.
13. 8 1880 - Das Gas-Konsortium kauft weitere 2,976 Hektar an
München - Bogenhausen * Das Gas-Konsortium kauft weitere 2,976 Hektar am Kirchstein an.
22. 8 1880 - Ludwig Gandorfer wird in Pfaffenberg bei Straubing geboren
Pfaffenberg * Ludwig Gandorfer, der spätere Bauernführer, wird in Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen geboren.
Um 9 1880 - Auf dem „Oktoberfest“ sind jährlich 6 bis 8 „Fischbrater“ vertreten
München-Theresienwiese * Auf dem „Oktoberfest“ sind jährlich 6 bis 8 „Fischbrater“ vertreten.
Hauptsächlich werden einheimische „Renken“ aus dem Starnberger See, „Weißfische“, „Nasen“ und „Braxen“ gebraten danach verkauft.
Der „Brathering“ verschwindet am Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Speisenangebot.
Dafür werden „Fischbratereien und -bäckereien“ mit verschiedenen Fischsorten erwähnt.
Auch „Krebssiedereien“ bieten ihre Waren an.
9 1880 - 401 Wirts-, Verkaufs- und Schaubuden auf der „Theresienwiese“
München-Theresienwiese * 401 Wirts-, Verkaufs- und Schaubuden - darunter auch Völker- und Abnormitätenschauen, Menagerien, Varietés, Zirkuszelte und Museen - befinden sich auf der „Theresienwiese“.
18. 11 1880 - Der Nockhergarten kommt in den Alleinbesitz von Franz Xaver Schmederer
München-Au * Das Anwesen Nockhergarten kommt in den Alleinbesitz von Franz Xaver Schmederer. Es umfasst 3,614 Tagwerk.
6. 12 1880 - Eröffnung der Mariahilf-Volksschule am Mariahilfplatz
München-Au * Eröffnung der Mariahilf-Volksschule am Mariahilfplatz.
12. 12 1880 - König Ludwig II. bewohnt erstmals Schloss Neuschwanstein
Schloss Neuschwanstein * König Ludwig II. bewohnt erstmals Schloss Neuschwanstein.
31. 12 1880 - Der Export Münchner Bieres liegt bei 254.450 Hektoliter
München * Der Export Münchner Bieres liegt bei 254.450 Hektoliter.
31. 12 1880 - 28.530 evangelische Einwohner in München
München * In München leben 28.530 evangelische Personen.
31. 12 1880 - Die Zahl der Seelen in der Anna-Pfarrei ist auf 17.000 angestiegen
München-Lehel * Die Zahl der Seelen in der Anna-Pfarrei ist inzwischen auf 17.000 angestiegen.
1881 - Installation der Wasserturbine und der Linde-Kälteanlage für das Eiswerk
München-Au * Installation der Wasserturbine und der Linde-Kälteanlage für das Eiswerk mit einer Leistung von 80 Tonnen Blockeis am Tag.
1881 - Das Gaswerk am Kirchstein in Steinhausen entsteht
<p><strong><em>Bogenhausen</em></strong> * Auf dem vom Gas-Konsortium aufgekauften Grund beginnen die Bauarbeiten für das Gaswerk am Kirchstein in Steinhausen. </p>
1881 - Ein Brauer Geyer erwirbt die „Brauerei zur Schwaige“ in Haidhausen
München-Haidhausen * Die mittlerweile in eine „Aktiengesellschaft“ umgewandelte „Brauerei zur Schwaige“ in Haidhausen wird von einem „Brauer“ Geyer erworben.
1881 - Aus der „Löwenhauserbrauerei“ wird die „Gambrinusbrauerei“
München-Angerviertel * Die „Löwenhauserbrauerei“ in der Sendlinger Straße wird in „Gambrinusbrauerei“ umbenannt.
1881 - Adolf Friedrich von Schack schließt seine Sammlung ab
München-Maxvorstadt * Adolf Friedrich von Schack schließt seine Sammlung, die er 1857 begonnen hat, endgültig ab.
1881 - Das Restaurationsgebäude der Brauerei „Zum Münchner Kindl“ entsteht
München-Au * Baumeister N. Debold errichtet für die Brauerei „Zum Münchner Kindl“ ein „Restaurationsgebäude“ an der Rosenheimer Straße.
1881 - Friedrich August von Kaulbach malt Coletta Möritz
München * Coletta Möritz erzählt, wie sie der Maler Friedrich August von Kaulbach im Jahr 1881 auf die Leinwand gebannt hat, als „draußen auf der Wiesn das große deutsche Bundesschießen stattfinden sollte. [...] Dort kam ihm plötzlich der Einfall: „Die Coletta - die mal ich als Wirtshausschild“.
Und weiter erzählte die betagte Maßkrugschlepperin: „Gleich ist’s ans Modellstehen gegangen, Krügl hab ich in der Hand tragen und den Fuß hab i heben müssen, als tät ich auf einem Fuß tanzen, und der Kaulbach hat gezeichnet und dann daheim im Atelier die Schützenscheibe g’malt“.
1881 - Johann Bucher gründet seine „Drahtfabrik“ in der Au
München-Au * Johann Bucher gründet seine gleichnamige „Drahtfabrik“ in der Zeppelinstraße in der Au.
Ab 1881 - Die „Kohleninsel“ wird mit einer Kaimauer gegen Hochwasser geschützt
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Die „Kohleninsel“ wird mit einer Kaimauer gegen Hochwasser geschützt.
Die Arbeiten dauern bis 1904 an.
Ab dem Jahr 1881 - Teilverlagerung des „Hofbräuhauses“ an die Innere-Wiener-Straße
München-Graggenau - München-Haidhausen * Das „Sud-, Gär- und Kühlhaus“ sowie das Verwaltungsgebäude des „Hofbräuhauses“ werden an den neuen Standort in der Inneren-Wiener-Straße verlegt.
1881 - Der Bau der „Schwemmkanalisation“ wird begonnen
München * Der Bau der „Schwemmkanalisation“ wird begonnen.
Damit kann sich der durch Miststätten, Latrinen und Versitzgruben verseuchte Boden wieder selbst reinigen.
1881 - Michael Schottenhamel darf keine zusätzliche Plätze ersteigern
München-Theresienwiese * Die Anfrage des Münchner Wiesnwirts Michael Schottenhamel, ob er mehrere Plätze ersteigern darf, wird abgelehnt.
Ab 1881 - Franz Stuck besucht die „Akademie der bildenden Künste“
München-Maxvorstadt * Franz Stuck studiert an der „Akademie der Bildenden Künste“ bei Wilhelm Lindenschmidt und Ludwig Löfftz, auch wenn er dem Unterricht häufig fern bleibt.
1 1881 - Will Graf von Schack seine „Galerie“ der „Stadt Berlin“ übereignen?
München - Berlin * Die Münchner Presse verbreitet das Gerücht, dass Graf von Schack seine „Galerie“ der „Stadt Berlin“ oder der „Preußischen Nationalgalerie“ übereignen will.
Schack stellt daraufhin klar, dass er, so lange er lebt, mit seiner Sammlung in München zu bleiben gedenke.
14. 1 1881 - Joseph Schülein erhält das Münchner Bürger- und Heimatrecht
München * Joseph Schülein erhält das Münchner Bürger- und Heimatrecht übertragen.
27. 2 1881 - Prinz Wilhelm II. heiratet Auguste Viktoria
Berlin * Prinz Wilhelm II. von Preußen, der spätere Kaiser, heiratet Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
21. 3 1881 - Die Geheime Wahl wird eingeführt
München-Kreuzviertel * Das Landtags-Wahlgesetz vom 4. Juni 1848 wird geändert und darin die Geheime Wahl eingeführt. Es werden zwar weiterhin in einer Urwahl zunächst die Wahlmänner bestimmt, die dann in einem elitären Kreis noch elitärere Kandidaten zum Landtags-Abgeordneten wählen.
Doch bis dahin mussten die Urwähler den Wahlzettel unterschreiben. Diese Vorschrift entfällt jetzt.
22. 3 1881 - Graf von Schack erhält die Münchner „Ehrenbürgerschaft“
München * Um Graf Adolf Friedrich von Schack bei Laune zu halten, wird ihm die Münchner „Ehrenbürger-Würde“ angetragen.
30. 4 1881 - König Ludwig II. wird auf den Schauspieler Josef Mainz aufmerksam
<p><strong><em>München</em></strong> * Bei einer Separatvorstellung von Victor Hugos <em>„Marion de Lorme“</em> wird König Ludwig II. auf den jungen österreichischen Schauspieler Josef Kainz aufmerksam. </p>
21. 5 1881 - „Das Münchener Aquarium“, Münchens erstes Panoptikum, wird eröffnet
<p><strong><em>München-Hackenviertel</em></strong> * <em>„Das Münchener Aquarium“</em> am Färbergraben wird eröffnet. Der Eintrittspreis beträgt 1 Mark.</p> <ul> <li>Die namensgebende Attraktion - das Aquarium - befindet sich im Keller des Anwesens. Dort gibt es in einer Tropfsteinhöhle eine <em>„Tauchergrotte“</em> und 30 offene oder verglaste <em>Süß- und Salzwassergrotten</em> zum bestaunen. In den Becken tummeln sich - neben einheimischen Fischen und diversem Meeresgetier - auch Seehunde, Haie und zwei Nilkrokodile.</li> <li>Im Erdgeschoss sind Affen, ein junger Bär, Schlangen, Eidechsen und eine Anzahl exotischer Vögel ausgestellt.</li> <li>Der erste Stock beherbergt eine umfangreiche <em>Kunstsammlung,</em> die ein Sammelsurium von Gegenständen beinhalten: Chinesische Skulpturen, historische Waffen, ausgestopfte Tiere, Spieluhren und moderne mechanische und elektrische Automaten; darunter auch einige lebensgroße mechanische Wachspuppen. Ein sogenanntes <em>Lachkabinett</em>, bestehend aus verschiedenen <em>Vexierspiegeln</em>, sorgt für zusätzliches Vergnügen.</li> <li>Im zweiten Stock befindet sich <em>„Ein wunderbar perspektivisches Gemälde von Neapel mit dem Vesuv“</em> sowie 19 verschiedene <em>Wachsfigurengruppen</em> und eine Sammlung von <em>Totenmasken</em>.</li> <li>Im als <em>Steingrotte</em> eingerichteten Innenhof des Anwesens können die Besucher im Gartenlokal <em>„Alhambra“</em> - wenn sie wollen - <em>„noch ein Stündchen im trauten Gespräch beim Glase Spatenbier das Gesehene am Geistesauge vorbeiziehen lassen“</em>.</li> </ul> <p>Dort oder in einem Konzert- bzw. Vorstellungssaal finden darüber hinaus regelmäßig diverse Sonderdarbietungen statt: Tiere und Menschen werden zur Schau gestellt, aber auch Automaten.</p>
Um den 25. 6 1881 - Ludwig II. verpflichtet Josef Mainz zu einer Schweiz-Reise
Schloss Linderhof - Schweiz * König Ludwig II. lädt den jungen österreichischen Schauspieler Josef Kainz nach Schloss Linderhof ein und verpflichtet ihn zu einer Reise in die Schweiz. Dort soll Kainz, an den Originalschauplätzen von Schillers Wilhelm Tell Passagen aus dem Werk zitieren.
27. 6 1881 - König Ludwig II. und Josef Kainz reisen in die Schweiz
München - Schweiz * König Ludwig II. und der Schauspieler Josef Kainz begeben sich auf eine Reise in die Schweiz. Dort soll Kainz, an den Originalschauplätzen von Schillers „Wilhelm Tell“ Passagen aus dem Werk zitieren.
Auf dieser Reise entsteht auch das berühmte Erinnerungsfoto, bei dem Kainz die Hand auf die Schulter des Königs legt. Die Hand wird später durch Retusche entfernt.
14. 7 1881 - Die gemeinsame Schweiz-Reise endet enttäuschend
Schweiz - München * Die gemeinsame Schweiz-Reise von König Ludwig II. und dem Schauspieler Josef Kainz endet. Beide sind vom Ausgang der Reise enttäuscht.
- Der Schauspieler konnte die hohen Erwartungen des Königs nicht erfüllen.
- Er war den körperlichen Strapazen länger alpiner Wanderungen und dem unausgesetzten Forderungen des Königs nach empathischem Deklamieren nicht gewachsen.
- Er verweigerte sich aus Erschöpfung und Übermüdung.
- Damit überschritt er für König Ludwig II. eine rote Linie zwischen König und Untertan.
Das ist für den Bayernmonarchen unverzeihlich.
25. 9 1881 - Metzgermeister Johann Rössler brät einen ganzen Ochsen
München-Theresienwiese * Der Metzgermeister Johann Rössler kommt mit einem selbst entworfenen Apparat aufs Oktoberfest. In einem Plakat beschreibt er die neue Attraktion:
„Auf der Theresienwiese. Seltene Volksbelustigung! Das Braten eines ganzen Ochsen.
Sonntag, den 25, September 1881 wird ein ganzer Ochse auf einer eigens dazu construirten Maschine am Spiess gebraten. Anfang der Zubereitung Früh 8 Uhr. Beginn des Bratens 9 Uhr. Das Garsein wird auf Abends halb 5 Uhr festgesetzt und wird durch drei Böllerschüsse bekannt gegeben. Preis per Portion 50 Pfg. Entrée 50 Pfg. Von 2 Uhr an Musik-Produktion. Ausschank von gutem, alten Hacker-Bier. Die Maschine steht von Montag, den 26. September an gegen Entrée von 10 Pfg. ausgestellt, Wozu ergebenst einladen die Unternehmer J. Rössler & A. Schibanek.“
Die Ochsenbraterei wird in den Polizeiberichten als „Schaustellung“ und nicht als gastronomischer Betrieb geführt.
9. 10 1881 - Victor Klemperer wird in Landsberg an der Warthe geboren
Landsberg an der Warthe * Victor Klemperer wird in Landsberg an der Warthe geboren.
25. 11 1881 - Angelo Giuseppe Roncalli wird in der Provinz Bergamo geboren
Sotto il Monte * Angelo Giuseppe Roncalli, der spätere Papst Johannes XXIII., wird in Sotto il Monte, in der Provinz Bergamo, geboren.
1882 - Joseph Selmayr junior wird „Bürgermeister“ von Bogenhausen
Bogenhausen * Joseph Selmayr junior wird mit 32 Jahren „Bürgermeister“ von Bogenhausen.
Der „Eingemeindungsbürgermeister“ bringt es noch zum „Landrat von Oberbayern“ und zum „Königlichen Kommerzienrat“.
1882 - Franz Lenbach wird in den „persönlichen Adelsstand“ gehoben
München * Franz Lenbach wird in den „persönlichen Adelsstand“ gehoben.
1882 - Leonhard Romeis lehnt eine Berufung nach Magdeburg ab
München - Magdeburg * Leonhard Romeis lehnt eine Berufung als „Direktor der Kunsthandwerkerschule der Stadt Magdeburg“ ab.
1882 - Coletta Möritz heiratet den Schwabinger Gastwirt Franz Xaver Buchner
Schwabing * Coletta Möritz heiratet den Schwabinger Gastwirt Franz Xaver Buchner.
1882 - Oskar von Miller organisiert die „Internationale Elektrizitäts-Ausstellung“
München-Maxvorstadt * Oskar von Miller organisiert die „Internationale Elektrizitäts-Ausstellung“.
Sie findet im „Glaspalast“ statt.
Die Sensation ist die übertragung von Gleichstrom von Miesbach nach München. Der in 57 Kilometern erzeugte Strom treibt im Ausstellungsgebäude einen Motor an, der wiederum einen Wasserfall in Gang setzt.
1882 - Im Haus in der Reichenbachstraße 13 ist ein Gastwirtschaft untergebracht
München-Isarvorstadt * Im Haus in der Reichenbachstraße 13, in dem sich heute die „Deutsche Eiche“ befindet, ist ein Gastwirtschaft untergebracht.
Der Name „Deutsche Eiche“ entstand nach der „Reichsgründung“ 1870/71 und sollte „Nationalstolz sowie Recht und Ordnung“ demonstrieren.
1882 - Im Gasthaus „Neudeck“ wird der „TSV Turnerbund“ gegründet
München-Au - München-Untergiesing * Im Gasthaus „Neudeck“ wird der traditionsreichste Giesinger und Auer Sportvereins, der „TSV Turnerbund“, gegründet.
An der Pilgersheimerstraße 11, dort wo sich heute das „Obdachlosenasyl“ erhebt, stand bis in die Zeit des „Zweiten Weltkriegs“ die Halle des Sportvereins.
1882 - Die „Giesinger Kunstmühle“ wird an die „Kunstmühle Bavaria AG“ verkauft
München-Untergiesing * Die „Bayerische Hypotheken- und Wechselbank“ verkauft die „Giesinger Kunstmühle“ an die „Kunstmühle Bavaria AG“.
1882 - Die protestantische „Schule an der Herrnstraße“
München-Graggenau * Für die evangelischen Schulkinder des Münchner Ostens ist die protestantische „Schule an der Herrnstraße“ zuständig.
Lediglich den Kindern des ersten und des zweiten Schuljahres ist es wegen der Länge und Gefährlichkeit des Schulweges gestattet, die entsprechenden Klassen in einer katholischen Schule zu besuchen.
Von diesem Entgegenkommen machen jedoch nur wenige Schüler Gebrauch, da die Mehrzahl der Eltern befürchtet, ihre Kinder würden von dem „katholischen Geist dieser Klassen“ negativ beeinflusst werden und nehmen deshalb lieber den Weg in die Stadt in Kauf.
1882 - Die „Ostbahnhalle“ beim „Centralbahnhof“ wird abgerissen
München-Maxvorstadt * Die „Ostbahnhalle“ beim „Centralbahnhof“ wird abgerissen.
1882 - Das „Neuguinea-Konsortium“ wird gegründet
Berlin * Das „Neuguinea-Konsortium“ wird gegründet, um den nordöstlichen Teil der Insel zu erwerben.
„Neuguinea“, die größte melanische Insel ist das erste konkrete „Kolonialobjekt“.
9. 3 1882 - Eduard Grützner stellt einen Bauantrag für seine Künstler-Residenz
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützner stellt einen Bauantrag für seine Künstler-Residenz, nachdem er zuvor das Anwesen des Realitätenbesitzers Wilhelm Wiesinger in der Praterstraße 7 und 8 gekauft hat. Josef Wiedmann wird darin als Baumeister und Leonhard Romeis als Architekt benannt.
1. 5 1882 - Das „Marianum“ bezieht Mieträume im sogenannten „Eichthal-Schlößchen“
München-Untergiesing * Mit der Gründung des Vereins kann das „Marianum“ Mieträume im sogenannten „Eichthal-Schlößchen“ an der Pilgersheimerstraße beziehen und dort eine „gesunde, Licht und Luft reichlich bietende Heimat“ finden.
Die „Frauen von Maria-Stern“ aus Augsburg übernehmen das „Marianum“.
Die Klosterfrauen leiten die Anstalt und betreuen die Bewohnerinnen.
Das Ziel des Vereins „Marianum für Arbeiterinnen e.V.“ ist, den „Mädchen sittlichen Halt und Schutz zu bieten und sie in allen weiblichen Handarbeiten zu unterrichten, teils um sie tüchtig auszurüsten für den hauslichen Beruf, teils um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, als Arbeiterinnen sich selbst zu ernähren“.
Letzteres gilt besonders für die körperlich behinderten Heimbewohnerinnen.
3. 5 1882 - Sarah Sonja Lerch wird in Warschau geboren
Warschau * Sarah Sonja Lerch wird als Sarah Rabinowitz in Warschau geboren.
7. 5 1882 - Arnold Wadler wird in Österreich geboren
Österreich * Arnold Wadler wird in Österreich geboren.
16. 5 1882 - Kunstmaler Grützner gibt den Abriss der Wiesinger-Gebäude bekannt
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützner gibt den Abriss der beiden Wiesinger-Gebäude in der Praterstraße 7 und 8 bekannt.
20. 5 1882 - Italien schließt sich Deutschland und Österreich-Ungarn an
Wien * In Wien schließt sich Italien dem „Zweibund“ Deutschland und Österreich-Ungarn an. Damit entsteht der „Dreibund“.
4. 6 1882 - Valentin Ludwig Fey (= Karl Valentin) wird in der Vorstadt Au geboren
München-Au * Valentin Ludwig Fey wird als Sohn des Tapeziermeisters Johann Valentin Fey und seiner Ehefrau Johanna Maria in der Entenbachstraße 64/I, heute: Zeppelinstraße 41, geboren.
10. 6 1882 - Valentin Ludwig Fey wird getauft
München-Ludwigsvorstadt * Valentin Ludwig Fey wird in der Matthäuskirche nach evangelischem Ritus getauft.
7 1882 - Bau einer staatlichen „Telefonanlage“ in München
München * Die „Generaldirektion der königlichen Verkehrsanstalten“ beginnt in München mit dem Bau einer „Telephonanlage“.
Doch auch jetzt hat die Landesregierung noch Bedenken und behält sich das Recht vor, die Anlage nach zwei Jahren wieder aufzulösen.
Um den 15. 8 1882 - Die Attraktivität des neuen Kommunikationsmittels Telephon
München * Die Bedenken der Landesregierung sind ausgeräumt, nachdem die Menge der eingegangenen Anmeldungen die Attraktivität des neuen Kommunikationsmittels Telephon bewiesen haben. Der erste Auftraggeber ist der Verleger und Schriftsteller Dr. Georg Hirth. Ihm folgen weitere Geschäftsleute.
27. 10 1882 - Max Fey stirbt im Alter von 6 Jahren an der Diphtherie
München-Au * Max Fey, Karl Valentins Bruder, stirbt im Alter von 6 Jahren an der Diphtherie.
24. 11 1882 - Karl Fey stirbt im Alter von 8 Jahren an der Diphterie
München-Au * Karl Fey, der älteste Bruder von Karl Valentin, stirbt im Alter von 8 Jahren ebenfalls an der Diphtherie.
6. 12 1882 - Durch gezielte Propaganda den kolonialen Gedanken beleben
Frankfurt am Main * Der Deutsche Kolonialverein tritt an die Spitze der kleineren und mittleren Kolonialorganisationen. Er will durch gezielte Propaganda den kolonialen Gedanken beleben und fasst die konkrete Einrichtung von Handelsstationen als Ausgangspunkt für größere Unternehmungen ins Auge.
Um 1883 - Hubert Herkomer macht sich einen Namen als Porträtist
London * Hubert Herkomer macht sich einen Namen als Porträtist.
Queen Viktoria und Richard Wagner sitzen ihm Modell.
1883 - Hubert Herkomer betreibt in Bushey, England, eine „Kunstschule“
Bushey * Hubert Herkomer betreibt in Bushey, England, eine „Kunstschule“.
Sie schließt 1904.
1883 - Der „Panoramenmaler“ Ernst Philipp Fleischer wohnt in München
München - Bogenhausen * Der „Panoramenmaler“ Ernst Philipp Fleischer wohnt bis 1911 in München.
1883 - Johann Valentin Fey führt das „Möbeltransport-Geschäft Falk & Fey“ selbst
München-Au * Johann Valentin Fey führt das „Möbeltransport-Geschäft Falk & Fey“ in eigener Regie.
1883 - Carl Gabriel heiratet in Dresden Margarete Meisel
Dresden * Carl Gabriel heiratet in Dresden Margarete Meisel, deren Vater ein „anatomisch-ethnologisch-naturhistorisches Museum und Panoptikum“ betreibt.
Mit dieser Schau reist das neuvermählte Paar mehrere Jahre durch Europa.
1883 - Oskar von Miller verlässt München in Richtung Berlin
München - Berlin * Oskar von Miller verlässt München.
In Berlin nimmt er die Aufgabe eines „Technischen Direktors“ bei der „Deutschen Edison-Gesellschaft“, der späteren „Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft - AEG“, wahr.
Seine Hauptaufgabe besteht im Bau elektrischer Zentralstationen zur Versorgung kleiner Stadtbezirke.
1883 - Aus der „ständigen Wache“ wird die „Berufsfeuerwehr“
München-Angerviertel * Die „ständige Wache“ wird in „Berufsfeuerwehr“ umbenannt.
1883 - Eine „Musikerbörse“ wird ins Leben gerufen
München-Isarvorstadt * Eine „Musikerbörse“ wird in der Singspielhalle „Neue Welt“ in der Blumenstraße ins Leben gerufen.
1883 - „Das Aquarium“ am Färbergraben schließt seine Pforten
München-Hackenviertel * „Das Aquarium“ am Färbergraben, am 21. Mai 1881 eröffnet, schließt seine Pforten.
1883 - Das „Panorama“ an der Theresienstraße 78 wird eröffnet
München-Maxvorstadt * Das „Panorama“ an der Theresienstraße 78 wird eröffnet.
1883 - Das „Seehaus“ am „Kleinhesseloher See“ wird als Bootshaus errichtet
München-Englischer Garten - Schwabing * Das „Seehaus“ am „Kleinhesseloher See“ wird von Gabriel von Seidl als Bootshaus errichtet.
Später nimmt es das „See-Restaurant Kleinhesselohe“ auf.
1883 - Ein „Radfahrergruß“ wird eingeführt
München * Ein „Radfahrergruß“ wird eingeführt.
Wo immer sich zwei „Velozipedisten“ begegnen, grüßen sie sich mit „All Heil“.
1883 - Das Fahrrad ist ein Luxusartikel
München * Das Fahrrad ist ein Luxusartikel. Es kostet um die fünfhundert Mark.
Das „Rad fahren“ ist ein Modesport und ein Privileg wohlhabender bürgerlicher Kreise, „die darin ein Mittel sahen, sich gegen die 'niederen Schichten' des Volkes abzusetzen“.
Durch steigende Produktionszahlen und Rationalisierung in der Herstellungstechnik sinken die Preise und das Fahrrad wurde zum Gebrauchsgegenstand.
Obwohl „die Arbeiterschaft im Allgemeinen (...) eine ausgesprochene Abneigung diesem neuen Verkehrsmittel gegenüber an den Tag legte - sie betrachtete das Radfahren als einen Sport für Bourgeoisjünglinge“ - wird das Fahrrad für sie nun zum Gebauchsgegenstand, mit dem sie den täglichen Arbeitsweg wesentlich schneller bewältigen können.
1883 - Die Münchner Fahrrad-Vereine bieten Attraktionen
München * In München kämpfen neben dem „Münchner-Velociped-Club“ noch zwei weitere „Fahrradvereine“ um die Gunst des Publikums: der „Münchner Bicyle Club“ und „Bavaria“.
Sie brauchen jetzt selbstverständlich auch eine Bahn und so wird am „Heumarkt“ an der Kapuzinerstraße eine 400 Meter lange Strecke eröffnet, die sich allerdings als unzweckmäßig erweist.
Daher entsteht kurze Zeit später auf der „Theresienwiese“ eine neue Bahn - mit einem eingebauten Hügel als Hindernis -, die auf dem „Oktoberfest“ mit den „Wiesenrennen“ eine zusätzliche Attraktion bietet.
1883 - Die „Wasserversorgung aus dem Mangfalltal“
München * Die „Wasserversorgung aus dem Mangfalltal“ bringt reines, gesundes Wasser nach München.
1883 - Robert Koch entdeckt die „Cholera-Erreger“
Ägypten - Indien * Robert Koch entdeckt die „Cholera-Erreger“, die die akute bakterielle Darminfektion verursachen.
1883 - Die Planungen für „Burg Falkenstein“ bei Pfronten beginnen
Pfronten * Die Planungen für „Burg Falkenstein“ bei Pfronten beginnen.
Ab dem Jahr 1883 - Vorgetäuschte Pannen für Stammkunden
München * Zur Schonung der Pferde darf mit den weiß-blau gestrichenen „Trambahnwagen“ nur noch an den hierfür bestimmten Stellen gehalten werden.
Das Fahrpersonal ermöglichte aber Stammkunden - durch vorgetäuschte Pannen - das Einsteigen vor ihrem Haus.
1883 - Der Schauspieler Josef Kainz verlässt München
München * Der Schauspieler Josef Kainz verlässt München, nachdem er noch in zwei „Separatvorstellungen“ für König Ludwig II. aufgetreten ist.
Eine Audienz zum Abschied verweigert König Ludwig II..
1883 - Das „Cuvilliés-Theater“ wird als erste Bühne Deutschlands elektrifiziert
München-Graggenau * König Ludwig II. lässt das „Cuvilliés-Theater“ als erste Bühne Deutschlands elektrifizieren.
13. 2 1883 - Richard Wagner stirbt in Venedig
Venedig * Richard Wagner stirbt in Venedig in den Armen seiner Frau Cosima.
Zu Recht behauptet König Ludwig II. von sich, er hat Richard Wagner „zuerst erkannt“ und „der Welt gerettet“.
15. 2 1883 - Fritz Gerlich wird in Stettin geboren
Stettin * Karl Albrecht Fritz Gerlich wird in Stettin in Pommern geboren und streng im „calvinistischen Glauben“ erzogen.
1. 3 1883 - Die Münchner „Telephonabonnenten“ können probeweise telefonieren
München * Die Münchner „Telephonabonnenten“ können erstmals probeweise - mit 118 Anschlüssen - telefonieren.
14. 3 1883 - Karl Marx stirbt in London
London * Karl Marx stirbt in London im Alter von 64 Jahren.
17. 3 1883 - Karl Marx wird beerdigt
<p><em><strong>London</strong></em> * Karl Marx wird auf dem Highgate Cemetery im Londoner Stadtbezirk Camden beigesetzt. Friedrich Engels hält die Trauerrede. </p>
5. 4 1883 - Der Landtag beschäftigt sich mit den königlichen Schulden
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der 30. Landtag dauert vom 5. April 1883 bis zum 1. Juli 1886 und steht ganz im Zeichen der wachsenden Schulden des <em>„Märchenkönigs“</em> Ludwig II. auf Grund seiner Schlösserbauten. Weitere Themen sind die Entmündigung sowie der Tod Ludwigs II.. </p>
1. 5 1883 - Die Münchner „Telefonanlage“ wird ihrer Bestimmung übergeben
München * Die Münchner „Telefonanlage“ wird ihrer Bestimmung übergeben.
Sie umfasst inzwischen 145 Teilnehmer.
Die große Nachfrage führte anfangs noch zu Engpässen; später entwickelt sich das Telefonnetz kontinuierlich weiter.
1. 5 1883 - Heinrich Vogelsang erwirbt die heutige „Lüderitzbucht“
Deutsch-Südwestafrika * Der 22 Jahre alte „Kaufmannsgehilfe“ Heinrich Vogelsang erwirbt im Auftrag des Bremer „Tabakhändlers“ Adolf Lüderitz die „Bucht von Angra Pequena“, die heutige „Lüderitzbucht“ in „Deutsch-Südwestafrika“, und ein zirka 40 „Meilen“ langes und 20 „Meilen“ tiefes Landstück, um darauf einen „Handelsposten“ zu errichten.
Das Land gehörte bis dahin dem „Volk der Nama“ in Bethanien. Vogelsangs Verhandlungspartner war Josef Frederiks II..
Der vereinbarte Kaufpreis für das circa 70 mal 35 Kilometer große Gebiet beträgt 250 alte Gewehre und 100 englische Pfund. Adolf Lüderitz hoffte auf dem - allgemein als wertlos angesehenen - Land, das sich um die Bucht herum erstreckte, „Bodenschätze“ zu finden.
Nach dem Vertragsabschluss wird dem Verkäufer jedoch erklärt, dass es sich nicht um „englische Meilen“ [= 1,609 Kilometer], sondern selbstverständlich um „preußische Meilen“ zu 7,532 Kilometer handelte. Josef Frederik II. hatte damit einen Großteil seines Stammesgebietes von rund 300 mal 150 Kilometer an Heinrich Vogelsang verkauft. Adolf Lüderitz beansprucht fortan ein um das sechszehnfache größeres Gebiet.
Die „Nama“ fühlten sich von den Deutschen zurecht getäuscht, konnten sich aber trotz ihrer Proteste nicht durchsetzen. Dieser Handel ging als „Meilenschwindel“ in die Geschichte ein.
2. 5 1883 - Eduard Theodor Grützner lässt sich am „Praterbergl“ eine Villa bauen
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützner lässt sich am „Praterbergl“, in der heutigen Grütznerstraße 1 und schon damals in unmittelbarer Nähe zum „Maximilianeum“ gelegen, eine Villa durch den renommierten „Architekten“ Leonhard Romeis erbauen.
Das ist zwei Jahre bevor sich Franz von Lenbach durch Gabriel von Seidl sein „Palais“ errichten lässt.
Nun erhält er von der „Lokalbaukommission“ die allgemein vorgeschriebene „Wohnbewilligung“ erteilt, die eine ausreichende Wohnqualität sicherstellen soll, was bei diesem „Bauherrn“ freilich nur eine Formalie darstellt.
10. 5 1883 - Eugen Leviné wird in St. Petersburg geboren
Petersburg * Eugen Leviné wird in St. Petersburg geboren.
9. 6 1883 - Die erste Dampftrambahn Süddeutschlands fährt nach Nymphenburg
München-Maxvorstadt - Nymphenburg * Die erste Dampftrambahn Süddeutschlands fährt vom Stiglmaierplatz nach Nymphenburg.
1. 7 1883 - Jeder muss sich um eine Konzession bemühen
München * Mit dem Ergänzungsparagraphen 33a der Gewerbeordnung müssen Personen, die „gewerbsmäßig Singspiele, Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen von Personen oder theatralische Vorstellungen“ öffentlich veranstalteten, „ohne Rücksicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubnis zum Betriebe des Gewerbes“, um eine gesonderte Erlaubnis dafür nachzusuchen.
Das bedeutete, dass nicht nur der Besitzer und damit Betreiber der Singspielhalle, sondern auch der Direktor der Singspielhalle und der Direktor der Volkssänger-Gesellschaft eine Konzession benötigt. Außerdem muss jeder Unterhaltungskünstler für jede Stadt, in der er auftritt, eine ortspolizeiliche Erlaubnis vorweisen.
1. 8 1883 - Die Wasserleitung aus dem Mangfallgebiet wird eingeweiht
Mangfalltal - München * Die Wasserleitung aus dem Mangfallgebiet wird - mit den üblichen Gottesdiensten in der katholischen Frauenkirche, der evangelischen Matthäuskirche und in der Synagoge - offiziell eingeweiht.
11 1883 - Die „Bedeutung des Isarquaies für München“
München-Lehel * Ein Artikel in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ befasst sich mit der „Bedeutung des Isarquaies für München“.
Der Verfasser betont darin die städtebaulich „unvergleichlich günstige Lage des Mariannenplatzes“, der sogar als Bauplatz für den „Justizpalast“ in Erwägung gezogen worden ist.
Der evangelischen Kirchenverwaltung erscheint der Bauplatz als sehr teuer, weshalb sie noch das Gelände der „I. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung“ am Isartorplatz ins Gespräch bringt.
Die „Lokalbaukommission“ schlägt ihrerseits noch Standorte auf der „südlichen“ beziehungsweise „nördlichen Kohleninsel“ vor. Schließlich einigt man sich doch auf den Mariannenplatz als Standort für die „Lukaskirche“.
Das Gotteshaus sollte eigentlich die protestantische Kirche für den Münchner Osten werden, doch bereits 1889 wurde am Preysingplatz in Haidhausen die „Johanneskirche“ als evangelische „Notkirche“ erbaut.
Nun haben die Protestanten auch „ihren Sammelpunkt jenseits der Isar“. Doch das war bestimmt kein Zufall, denn der Architekt beider Kirchen ist Albert Schmidt, der gleichzeitig - heute kaum vorstellbar - den acht Mitgliedern der „protestantischen Kirchenverwaltung“ in München angehörte.
„Der soziale Status der protestantischen Gemeindemitglieder lag deutlich über dem Durchschnitt. Viele gehörten der geistigen und finanziellen Oberschicht an“, weshalb die Gruppierung sehr selbstbewusst auftrat, was im fundamental katholischen Bayern ganz bestimmt auch nötig war [und ist?].
1884 - Valentin Ludwig Fey geht in die „Kleinkinderbewahranstalt der Vorstadt Au“
Au * Valentin Ludwig Fey tritt in die „Kleinkinderbewahranstalt der Vorstadt Au“, in der Lilien-Ecke Ohlmüllerstraße, ein.
1884 - Der Auer „Pfarrer“ Simon Knoll schreibt über Herbergen
München-Au - München-Haidhausen -München-Giesing * Der Auer „Pfarrer“ Simon Knoll schreibt: „Die Entstehung der sogenannten Herbergenhäuser setzt eine besitzlose Bevölkerungsklasse voraus, welcher die Mittel zu der bisher üblichen Niederlassung auf eigenem Grund und Boden fehlte, und sich daher auf anderweite ebenso rasche wie billige Weise die nöthigen Wohnräume zu verschaffen suchte. [...]
Fülglich läßt die Herstellung solcher Häuser den Zufluß einer Bevölkerung erkennen, welche in der Wahl der Niederlassung beschränkt, sich deshalb nur auf abgelegenen, vordem unbenutzte und selbst ungesunde Plätze zusammengedrängt sieht.
So entstanden die Herbergen aus dem Bedürfnis heraus, in Orten, in denen die Zahl der Hausstellen aus räumlicher Beengung nicht vermehrt werden konnte, den Bewohnern gleichwohl die rechtlichen und sozialen Vorteile der Eigentümerstellung zu gewähren.
In jenen Gegenden, in denen genügend Bauland zur Verfügung stand, waren Herbergen nicht üblich.“
1884 - Barbara Grützner stirbt im Alter von 30 Jahren
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützners Ehefrau Barbara stirbt im Alter von 30 Jahren.
1884 - Beschreibung der „Villa Grützner“
Leipzig - München-Haidhausen * Ein Artikel der in Leipzig erscheinenden „Illustrierten Zeitung“ beschreibt die Villa des Kunstmalers Eduard Theodor Grützner: „Da haben nun die vereinigten Antiquitäten mehr oder weniger sich selbst die Räume geschaffen.
Das Haus ward lediglich nach denselben gebaut; nach dem dadurch bedingten Inneren gestaltete sich naturgemäß mit Hilfe der geschmackvollen Anordnung beider Künstler [gemeint waren Grützner und Romeis] auch das Äußere dieses anmuthigen Gebäudes, mit all seinen Winkeln und Vorsprüngen, mit seinen Erkern, Altanen und Thürmchen, die demselben solch ein charaktervolles, deutsch anheimelndes Aussehen verliehen“.
1884 - „Propaganda- und Reklamefahrten
München * In der Münchner Presse erscheint die nachstehende Nachricht:
„Dem die Maximilianstraße in München entlang prominierenden Publico bot sich gestern, Sonntag mittag um 12 Uhr, ein ebenso viel Entrüstung als Ärgernis erregendes Bild dar.
Auf einem doppelsitzigen Veloziped bewegte sich ein Pärchen in rascher Fahrt durch die Straßen.
Das Pärchen bestand aus einem Mannsbilde und einer - Donna, letztere in einem geblümten leinenen Rock, durch den die stampfenden, das Vehikel in Bewegung setzenden Beine sich jedem, so er darauf erpicht war, leicht präsentierten.
Ohne Scham, stolz wie eine Amazone, ließ die holde Donna sich männiglich mustern, ihre Fahrt ungeniert fortsetzend.
Wir fragen nun:
- Ist dies die neueste Art von Velozipedsport?
- Darf auf solche Art dem öffentlichen Sittlichkeitsgefühl ungestraft ein Faustschlag ins Gesicht versetzt werden?
- Endlich: Wo bleibt die Polizei, die hier ein erfolgreiches Feld für ihre Tätigkeit finden dürfte?"
Die beschriebene Dame ist die Ehefrau von Josef Stanigel, des Inhabers der „Ersten Münchner Velozipedfabrik", in der ab dem Jahr 1883 Fahrräder gekauft werden konnten.
Gemeinsam mit seiner Frau unternimmt Josef Stanigel „Propaganda- und Reklamefahrten" durch München und zu den umliegenden Bierkellern.
Er trägt dabei einen karierten Anzug, sie eine Pumphose und eine Jacke mit weiten Ärmeln.
„Ja schamts eich denn net, so Maschkera z'gehn?", werden die Radler beschimpft.
Für die „damische Radlerin" gibt es noch stärkere Sprüche:
„A so a ausgschaamte Person, de soll doch bei de Kinder dahoam bleibn!
Vom Radl sollt ma's obehau'n!"
1884 - König Ludwig II. entlässt Georg von Dollmann
Pfronten - München * Weil Georg von Dollmann - nach Meinung des „Märchenkönigs“ Ludwig II. - die „Burg Falkenstein“ zu wenig großzügig plant, wird er als Bauherr entlassen.
1884 - Der Innenputz der neuen „Heilig-Kreuz-Kirche“ ist fertiggestellt
Obergiesing * Der Innenputz der neuen „Heilig-Kreuz-Kirche“ ist fertiggestellt.
Mit der Innenausstattung wird begonnen.
1884 - Die „Reichsregierung“ stellt „Kolonie-Schutzbriefe“ aus
Berlin - Deutsches Reich * Die „Reichsregierung“ beginnt mit der Ausstellung von „Schutzbriefen“, um die bislang als private Besitztümer geltenden, hauptsächlich in Afrika gelegenen Landstriche offiziell als „deutsche Kolonien“ anzuerkennen und unter die „Verwaltung des Deutschen Reiches“ zu stellen.
1884 - Neuguinea erhält einen „kaiserlichen Schutz“
Neuguinea - Berlin * Mehrere „Erwerbsverträge“ für den Erwerb von Neuguinea werden abgeschlossen, mit denen ein Gebiet von mehr als 200.000 Quadratkilometern für die „Gesellschaft“ abgesichert werden können.
Es erhält einen „kaiserlichen Schutz“, weshalb die deutsche Flagge über Neuguinea gehisst werden kann.
24. 1 1884 - Hermann Schülein wird in München geboren
München * Dr. Hermann Schülein wird in München geboren.
28. 3 1884 - Carl Peters gründet die Gesellschaft für deutsche Kolonisation
Berlin * Carl Peters gründet die Gesellschaft für deutsche Kolonisation, in der überwiegend kleine Gewerbetreibende, Offiziere und Beamte sowie kleinere und mittlere Kaufleute vertreten sind. Während der Deutsche Kolonialverein das gehobene Besitz- und Bildungsbürgertum repräsentiert, ist die Gesellschaft eher nationalistisch-rassistisch geprägt und steht in harter Konkurrenz zum Deutschen Kolonialverein.
28. 3 1884 - Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft wird gegründet
Berlin * Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft wird gegründet, um eine deutsche Ackerbau- und Handelskolonien in Übersee zu errichten. Die deutsche Reichsregierung steht dem Projekt von Anfang an ablehnend gegenüber. Reichskanzler Otto von Bismarck spricht über das, was Peters der Regierung vorlegt abschätzig: „ein Stück Papier mit Neger-Kreuzen drunter“.
Nachdem aber Carl Peters damit drohte, das Land an König Leopold von Belgien zu geben, lenkt Bismarck ein und lässt einen kaiserlichen Schutzbrief für die Erwerbungen der Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft ausstellen. Damit ist der Grundstein für die spätere Kolonie Deutsch-Ostafrika gelegt.
Um 4 1884 - König Ludwig II. hat 7,5 Millionen Mark Schulden
München * Die Schulden König Ludwigs II. belaufen sich auf 7,5 Millionen Mark, obwohl er seit dem Jahr 1873 insgesamt 5 Millionen Mark aus dem von Otto von Bismarck verwalteten „Welfenfond“ erhalten hat.
24. 4 1884 - Ein Schutzbrief für das Lüderitzland
Berlin * Reichskanzler Otto von Bismarck telegraphiert an den deutschen Konsul in Kapstadt, dass Lüderitzland unter dem Schutz des Deutschen Reiches steht. Damit ist Adolf Lüderitz am Ziel seiner Wünsche.
2. 5 1884 - Franz Xaver Reichhart wird neuer „Scharfrichter“
Amberg * Franz Xaver Reichhart wird neuer „Scharfrichter“ und vollzieht an diesem Tag sein erstes Todesurteil auf der „Amberger Fronfeste“.
16. 5 1884 - König Ludwig II. kauft die Burgruine Falkenstein
Falkenstein * König Ludwig II. kauft die Burgruine Falkenstein bei Pfronten, unweit von Schloss Neuschwanstein.
30. 5 1884 - König Ludwig II. will ans Vermögen seines Bruders Otto
München * König Ludwig II. will eine Anleihe aus dem Vermögen von Prinz Otto entnehmen. Er scheitert aber am Hofsekretär Philipp Pfister, der den Bayernkönig auf das Bayerische Landrecht hinweist, das dem Vormund, also Ludwig, untersagt, bei seinem Mündel ein Darlehen aufzunehmen.
6 1884 - Ein Bankenkonsortium übernimmt die Schulden von König Ludwig II.
München * Ein Bankenkonsortium bestehend aus der „Bayerischen Bank“, der „Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank“ und der „Süddeutschen Bodenkreditbank“ übernimmt ein Darlehen in Höhe von 8 Millionen Mark, und Bismarck legt noch eine Million Mark aus seinem „Reptilienfond“ oben drauf, zur Tilgung der Schulden König Ludwigs II.
1. 6 1884 - Ein Bankenkonsortium übernimmt die Schulden von König Ludwig II.
München * König Ludwig II. hat durch seine ungezügelten Baumaßnahmen bis zum Frühjahr 1884 Schulden in Höhe von 7,5 Millionen Mark angehäuft. Und das, obwohl er neben seiner üblichen Apanage seit dem Jahr 1873 fünf Millionen Mark aus dem von Otto von Bismarck verwalteten Welfenfond erhalten hat.
Nun übernimmt ein Bankenkonsortium, bestehend aus der Bayerischen Bank, der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank und der Süddeutschen Bodenkreditbank ein Darlehen in Höhe von acht Millionen Mark. Zudem legt Reichskanzler Otto von Bismarck aus seinem „Reptilienfond“ noch einmal eine Million oben drauf.
Die Befürchtung, wonach die Gelder statt zur Schuldentilgung zum Weiterbau der Schlösser Verwendung finden würden, sollen sich bewahrheiten.
5. 7 1884 - Orte im heutigen Togo werden zum Deutschen Schutzgebiet erklärt
Togo * Plakkoo, der Stabträger [= Stellvertreter] des zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon verstorbenen Königs Mlapa III., und Gustav Nachtigal unterzeichnen einen Schutzvertrag, womit vereinzelte Orte im heutigen Togo zum Deutschen Schutzgebiet erklärt werden können. Weitere Verträge werden folgen.
7. 7 1884 - Jakob „Lion“ Feuchtwanger wird in München geboren
Lehel * Jakob „Lion“ Feuchtwanger wird in München geboren. Die Familie Feuchtwanger lebt in der Thierschstraße 9.
10. 7 1884 - Gustav Nachtigal trifft im heutigen Kamerun ein
Kamerun * Gustav Nachtigal, der zum Kaiserlichen Kommissar für die Westküste Afrikas ernannte Afrikaforscher und deutscher Generalkonsul in Tunis, trifft im heutigen Kamerun ein.
14. 7 1884 - Hissen der deutschen Flagge in der Stadt Duala
Duala - Kamerun * Nach der Unterzeichnung von Schutzverträgen mit den wichtigsten Führern der „Duálá“ kommt es zum Hissen der deutschen Flagge in der Stadt Duala. Gustav Nachtigal hat den Auftrag, die für den deutschen Handel interessanten Gebiete unter deutsches Protektorat zu stellen.
29. 7 1884 - Der Fischbrunnen geht wieder in Betrieb
Graggenau * Der umgestaltete Fischbrunnen wird wieder in Betrieb genommen.
9 1884 - Heinrich Roth gewinnt acht Jahre hintereinander das „Oktoberfest-Rennen“
Theresienwiese * Nachdem auf der „Theresienwiese“ neben der obligatorischen „Pferde-Rennbahn“ eine zusätzliche Spur für „Rad-Rennfahrer“ angelegt worden ist, gewinnt Heinrich Roth acht Jahre hintereinander das große „Oktoberfest-Rennen“.
Und jedes Mal gratuliert ihm bei der Preisverleihung der „Prinzregent“ und schüttelt ihm die Hand.
Nach dem sechsten Sieg sagt der bayerische Monarch: „Geh, Roth, lassen's halt aa amal de andern gwinna“.
Darauf erwidert der „Rennfahrer“ nur: „De braucha bloß schnella fahrn!“
16. 10 1884 - Julius Hofmann löst Georg von Dollmann als Oberhofbaudirektor ab
München * Julius Hofmann löst Georg von Dollmann als Oberhofbaudirektor ab.
28. 10 1884 - Über das Kolonialfieber die Reichstagswahlen beeinflussen
Berlin * Reichskanzler Otto von Bismarck ändert seine Einstellung gegenüber der Kolonialpolitik in Hinblick auf die Reichstagswahlen aus innenpolitischen Gründen. Über das Kolonialfieber will Bismarck die am 28. Oktober angesetzten Reichstagswahlen zugunsten der regierungsfreundlichen Parteien zu beeinflussen, da die bürgerliche Linke und die Sozialdemokratie offen zu ihrer Kolonialgegnerschaft steht.
Und tatsächlich verliert das linksliberale Lager, bestehend aus der Deutschen Fortschrittspartei, der Liberalen Vereinigung, der Deutschen Freisinnigen Partei und der Deutschen Volkspartei 41 Sitze im Reichstag und fällt von 115 auf 74 Mandate zurück. Unabhängig davon können die Sozialdemokraten - trotz der Behinderungen durch das Sozialistengesetz - ihre Mandate von 12 auf 24 verdoppeln.
Ab 15. 11 1884 - Die Kongo-Konferenz legt die Abgrenzung der Besitzstände fest
Berlin * Im Reichskanzler-Palais in Berlin, dem ehemaligen Hôtel Radziwill, findet unter dem Vorsitz von Otto von Bismarck eine internationale Konferenz, bei der es um Lösungen von Konflikten geht, die im Zusammenhang mit dem Wettlauf um Afrika stehen.
Dreizehn europäische Staaten, die USA und das Osmanische Reich beteiligen sich an der sogenannten Kongo-Konferenz. Es geht dabei um die Festlegung von Kriterien für die völkerrechtliche Anerkennung von Kolonialbesitz. Immerhin waren in etwas mehr als zwei Jahrzehnten über zehn Millionen Quadratmeilen afrikanischen Bodens und mindestens einhundert Millionen Afrikaner unter europäische Herrschaft gelangt.
Um die Besetzung der restlichen Gebiete und der abschließenden Abgrenzung der Besitzstände geht es auf dieser Konferenz. Das Ergebnis sind die wie mit dem Lineal gezogene Demarkationslinien, wobei die Grenzen oft quer durch die Lebensräume einheimischer Ethnien verlaufen.
Afrika wird als herrenloses Land definiert, das nunmehr als Kronland und Eigentum europäischer Staaten an Kolonialgesellschaften, Konzessionäre und Siedler vergeben werden kann. Damit folgt die schrittweise Verdrängung der Eingeborenen aus ihren Wohn- und Lebensgebieten bis hin zur Eingrenzung in Reservate.
Zu dieser Konferenz ist kein einziger afrikanischer Vertreter eingeladen worden und die Souveränitätsrechte der betroffenen Staaten werden schlicht ignoriert. Wozu auch, es geht doch den europäischen Mächten um so hehre Ziele wie den Zivilisationsauftrag und die Verbesserung der „sittlichen und materiellen Wohlfahrt der eingeborenen Völkerschaften“.
Die Kongo-Konferenz endet mit der Verabschiedung einer Generalakte am 26. Februar 1885.
16. 11 1884 - Die Marke „Marco Polo Tee“ im Register der geschützten Markenzeichen
Berg am Laim * Die Marke „Marco Polo Tee“ wird unter der Nummer 347 ins Register der geschützten Markenzeichen eingetragen. Das Produkt der Firma Franz Kathreiner‘s Nachfolger ist eines der ältesten geschützten deutschen Markenzeichen.
24. 12 1884 - König Ludwig II. ordnet den Bau des Hubertuspavillons an
München * König Ludwig II. ordnet den Bau des Hubertuspavillons nach dem Vorbild der Amalienburg im Nymphenburger Schlosspark an. Er wird in der Nähe von Schloss Linderhof erbaut, aber nicht fertiggestellt.
1885 - Hubert Herkomer wird „Professor der Schönen Künste“
Oxford * Hubert Herkomer wird „Professor der Schönen Künste“ an der Universität in Oxford.
Diese Funktion bekleidet er bis 1894.
Um 1885 - Toni Aron malt „Die schöne Coletta“
München * Toni Aron malt „Die schöne Coletta“ im Auftrag der „Löwenbräu AG“.
1885 - „Krankenunterstützungsverein der Münchner Volkssänger“ gegründet
München * Nach Wiener Vorbild wird der „Krankenunterstützungsverein der Münchner Volkssänger“ gegründet.
1885 - Seit 1800 über 500 Theaterbrände
Europa * Die Zahl der bekannten Theaterbrände seit 1800 wird mit „mehr als 500“ angegeben.
1885 - Das „Panorama“ an der Goethestraße 45 wird eröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Das „Panorama“ an der Goethestraße 45 wird eröffnet.
1885 - Der Raddampfer „Maximilian“ kommt zum Ammersee
Starnberger See - Ammersee * Der im Jahr 1851 im „Eisenwerk Hirschau“ von Joseph Anton von Maffei produzierte Raddampfer „Maximilian“ wird nach 34 Dienstjahren auf dem Starnberger See in zwei Teile zerlegt und zum Ammersee transportiert.
Dort ist er weitere zehn Jahre im Einsatz.
Um 1885 - Das „lebende Reck“, eine „Spezialität“ des Steyrer Hans
München * Eine der „Spezialitäten“ des Steyrer Hans ist das sogenannte „lebende Reck“.
Dabei hält der „Steyrer Hans“ mit ausgestreckten Armen eine Hantel mit achtzig Pfund Gewicht waagrecht vor sich, an der sein zwölfjähriger Sohn Turnübungen ausführt.
1885 - Namensgebung für die evangelischen Kirchen
München-Ludwigvorstadt - München-Maxvorstadt * Die beiden evangelischen Kirchen erhalten ihre Namen: „Matthäuskirche“ und „Markuskirche“.
3. 4 1885 - Die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika übernimmt
Berlin - Deutsch-Südwestafrika * Die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika übernimmt als Verwaltungsgesellschaft das von Adolf Lüderitz erworbene Land und ihre Verbindlichkeiten und Rechte, darunter vor allem auch die Bergbaurechte.
12. 5 1885 - Die letzte Separatvorstellung im Nationaltheater für König Ludwig II.
München-Graggenau * Die letzte Separatvorstellung im Hof- und Nationaltheater für König Ludwig II..
Es ist die 209..
König Ludwig II. hält sich letztmals in München auf.
21. 5 1885 - Max Levien wird in Moskau geboren
Moskau * Max Levien wird als Sohn einer deutschen Kaufmannsfamilie in Moskau geboren.
7 1885 - Eduard Theodor Grützner wird „Ehrenmitglied“ der Akademie
München * Eduard Theodor Grützner wird zum „Ehrenmitglied der Akademie der bildenden Künste“ ernannt.
Um 8 1885 - Hubert Herkomers „Leben und Arbeit in den bayerischen Bergen“
Bushey * Unter dem Titel „Leben und Arbeit in den bayerischen Bergen“ malt Hubert Herkomer eine Serie von 40 Bildern.
29. 8 1885 - Weitere Schulden. Es muss etwas geschehen!
München * Finanzminister Emil von Riedel muss feststellen, dass König Ludwig II. inzwischen weitere sechs Millionen Mark Schulden aufgehäuft hat. Damit ist der Schuldenstand des Königs auf die wenig märchenhafte Summe von fast 14 Millionen Mark angewachsen.
Johann von Lutz, der Vorsitzende des bayerischen Ministerrats stellt daraufhin - devot zwar im Ton, aber unmissverständlich in der Aussage - die Forderung nach Sanierung des königlichen Haushaltes. Er meint damit konkret die Unterbrechung des Schlösserbaus. Da aber König Ludwig II. keinerlei Verständnis für die Vorschläge zeigt, muss - auch in Hinblick auf den Ansehensverlust der Monarchie - etwas geschehen.
Man hat zwar in Bayern das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie eingeführt und zusätzlich verschärft, aber dennoch das unaufhaltsame Anwachsen der Arbeiterbewegung nicht verhindern können.
9 1885 - Das „Oktoberfest“ wird mit 16 elektrischen Bogenlampen beleuchtet
München-Theresienwiese * Das „Oktoberfest“ wird mit 16 elektrischen Bogenlampen beleuchtet.
Acht davon brennen die ganze Nacht.
9 1885 - Erstmals Ankündigungsplakate für das „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Der Magistrat versendet erstmals Ankündigungsplakate für das „Oktoberfest“.
23. 9 1885 - Carl Spitzweg stirbt in München
München • Carl Spitzweg stirbt in München.
29. 9 1885 - Bei den Konservativen besteht keine Neigung für eine Finanzhilfe
München-Kreuzviertel * Die Sitzungsperiode des Bayerischen Landtags beginnt.
Nachdem Reichskanzler Otto von Bismarck die Übernahme der Schulden von König Ludwig II. durch den Landtag vorgeschlagen hat, entwickelt sich bei den Abgeordneten der Patriotenpartei eine für den König sehr ungünstige Stimmung. Pläne zur Erhöhung der Zivilliste, um König Ludwig II. - unter strengen Auflagen - die Abzahlung seiner Schulden zu ermöglichen, werden zwar diskutiert, aber nicht weiter verfolgt.
Bei den Konservativen besteht keine Neigung für eine Finanzhilfe. „Wir halten fest zu unserem angestammten Fürstenhause, zu unserem Könige, aber was auch kommen möge, wir werden auch die Interessen des Volkes hoch halten, Wünschen gegenüber, die mit dem Volkswohl nicht im Einklang stehen“. Eine Diskussion des Themas im Landtag wird sogar als gefährlich bezeichnet, „denn die Stimmung im Lande sei der Art, daß jede Discussion die Aufregung bis zum Überlaufen steigern und Dinge ans Licht bringen könne, über die man sich entsetzen würde“.
31. 12 1885 - Der Pro-Kopf-Bier-Verbrauch liegt in München bei 465 Liter
München * Der Pro-Kopf-Bier-Verbrauch liegt in München bei 465 Liter.
31. 12 1885 - München hat 262.000 Einwohner. Viele sind zugezogen.
München * München hat 262.000 Einwohner.
- Nur 37 Prozent sind eingeborene Münchner. Die anderen sind aus Bayern zugezogen.
- 6 Prozent kommen aus anderen deutschen Länder, 4 Prozent aus dem Ausland, überwiegend aus Österreich und Ungarn.
1886 - Die Firma „Gebrüder Schmederer“ wird eine Aktiengesellschaft
München-Au * Die Firma „Gebrüder Schmederer“ wird eine Aktiengesellschaft.
1886 - Joseph Selmayr jun. übernimmt den „Hansmarterhof“
Bogenhausen * Joseph Selmayr jun., der „Bürgermeister“ von Bogenhausen, übernimmt den „Hansmarterhof“.
Neben der Landwirtschaft betreibt er noch Ziegeleien an der Ismaninger Straße.
16,7 der 22,4 Hektar (~ 75 Prozent) Grund des entstehenden Villenviertels gehören Joseph Selmayr.
1886 - Die „Aktienbrauerei zu Schwaige“ erwirbt den „Gambrinusbräu“
München-Haidhausen * Die Haidhauser „Aktienbrauerei zu Schwaige“ erwirbt den „Gambrinusbräu“, der auf die 1551 gegründete „Löwenhauserbrauerei“ zurückgeht.
Zugleich wird die Haidhauser Brauerei in „Gambrinusbrauerei“ umbenannt.
1886 - Leonhard Romeis wird zum „Architekturprofessor“ berufen
München-Maxvorstadt * Leonhard Romeis wird zum „Architekturprofessor“ an die „Kunstgewerbeschule“ berufen.
1886 - Der „Bavariaring“ wird angelegt
München-Theresienwiese * Der „Bavariaring“ wird angelegt und damit die Ausdehnung der „Festwiese“ des „Oktoberfestes“ festgelegt.
1886 - Das „Panorama“ in der Theresienhöhe 2a wird eröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Das „Panorama“ in der Theresienhöhe 2a, zwischen „Hacker- und Bavariakeller“, wird eröffnet.
1886 - Die Dampfschifffahrt auf dem Main
Main * Die Dampfschifffahrt auf dem Main erlebt mit der Errichtung der „Kettenschleppschifffahrt“ eine neue Blüte.
1886 - Die „Pschorrbrauerei“ erwirbt die Wirtschaft des Johann Georg Messerer
München-Au * Die „Pschorrbrauerei“ erwirbt die ehemalige Wirtschaft des Johann Georg Messerer.
1886 - „Buffalo Bill“ hält sich mit seiner „Wildwest-Schau“ in München auf
München - München-Untergiesing * William Frederick Cody, besser bekannt unter seinem Pseudonym „Buffalo Bill“, hält sich mit seiner „Wildwest-Schau“ in München auf.
Die Münchner sind begeistert von den „tollkühnen Zugstücken“, worunter man die Reiterkünste bei einem nachgespielten Überfall auf einen Eisenbahnzug versteht.
In der Schau treten neben der „ritterlich schönen Erscheinung“ Buffalo Bills noch „nordamerikanische Indianer“ und „mexikanische Baqueros“ auf.
Die Zuschauer schwärmen von den „Künsten der Naturreiter“ und ihren „wahrhaft schönen und sicheren Sitz und ihrer prächtigen Haltung“ und vom Anblick der Indianer, „deren nackte, ebenmäßige Glieder so bunt bemalt sind, als trügen die braunen Herrschaften grellfarbene Tricots“.
Beim Rennen gegen „Buffalo Bill“ treten „die besten Hochradfahrer Europas“ an: der in Haidhausen wohnende Heinrich Roth und der aus dem „Westend“ stammende Josef Fischer.
Ausgetragen wird das ungleiche „Rennen zwischen Roß und Stahlroß“ auf der „500-Meter-Radrennbahn“ am „Schyrenplatz“.
Die Rennstrecke haben die Konkurrenten zuvor auf fünfzig Kilometer festgelegt.
Auf der mit Sand aufgefüllten Innenbahn spornt „Buffalo Bill“ seine extra aus Amerika mitgebrachten Pferde an.
Auf der Außenbahn mit den „überhöhten Kurven“, die hohe Geschwindigkeit zulassen, strampelten sich die „Radrennfahrer“ ab.
Und so verläuft das Rennen: „Die Radfahrbahn kann die Masse der Zuschauer nicht fassen. (...)
Buffalo Bill jagt sein erstes Pferd fünf Runden in halsbrecherischem Tempo neben den Radfahrern.
Dann - den Zuschauern bleibt der Atem weg - voltigiert er in vollem Galopp auf das zweite Pferd.
Dieser kühne Wechsel wiederholt sich mehrere Male.
Buffalo Bills Helfer treibt mit einem Peitschenschlag das nächste Pferd an die Seite des dahinstürmenden Reiters - ein kraftvoller Schwung, Oberst Cody sitzt im Sattel des frischen Tieres.
Rücksichtslos bearbeiten die talergroßen Sporen die Flanken des keuchenden Pferdes, dem blutiger Schaum vom Mund flockt.
Die Radfahrer fallen zurück, aber sie geben nicht auf.
Als Buffalo Bill auf sein letztes Pferd wechselt, sind sie bereits wieder in Führung.
Der schnelle Hengst, den der Oberst sich bis zum Schluß aufgespart hat, vermag daran nichts mehr zu ändern: Heinrich Roth und Josef Fischer gehen als Sieger durchs Ziel und kassieren den unwahrscheinlich hohen Siegespreis von 1.500 Mark, der ihnen in 150 blanken 10-Mark-Stücken aus funkelndem Gold ausbezahlt wird“.
1886 - Die „katholische Kirche“ droht mit der „Exkommunikation“
München * Die „katholische Kirche“ droht ihren Mitgliedern mit der „Exkommunikation“, wenn sie ihre Leiche verbrennen lassen oder in einen entsprechenden Verein eintreten würden.
Ab 1886 - Ludwig Thoma studiert „Forstwirtschaft“ und „Jura“
München - Erlangen * Ludwig Thoma studiert zunächst „Forstwirtschaft“, dann „Jura“ in München und Erlangen.
Er gehört der „schlagenden Studentenverbindung Suevia“ an.
20. 2 1886 - Der zweite Münchner Konsumverein wird gegründet
München-Sendling * Den zweiten Münchner Konsumverein, den „roten“, gründen „elf biedere Metallarbeiter“ im Sendlinger Maibräu. Der Sendlinger Verein macht den Auern bald harte Konkurrenz und mausert sich bis zum Ersten Weltkrieg zur größten Konsumentenorganisation Süddeutschlands.
3 1886 - Die Planungen für „Burg Falkenstein“ sind weitgehend abgeschlossen
Pfronten * Die Planungen für „Burg Falkenstein“ bei Pfronten sind weitgehend abgeschlossen.
23. 3 1886 - Ein Gutachten soll die Geisteskrankheit des Königs beweisen
<p><strong><em>München</em></strong> * Da König Ludwig II. kein Verständnis für die Forderungen nach Sanierung des königlichen Haushalts aufbringt und er sich auch sonst als beratungsresistent zeigt, beauftragt der Bayerische Ministerpräsident Freiherr Johann von Lutz den Psychiater und Leiter der Kreisirrenanstalt von München und Oberbayern, Dr. Bernhard von Gudden, mit der Erstellung eines wissenschaftlichen Gutachtens, das die Geisteskrankheit und Handlungsunfähigkeit des Königs beweisen soll.</p> <p>Vor der Erteilung des Auftrags muss der Ministerpräsident aber erst die Einwilligung des Hauses Wittelsbach einholen. Und nachdem Ludwigs Bruder Otto wegen seiner Geisteskrankheit als Verhandlungspartner ausscheidet, wendet sich der Regierungschef an dessen Onkel, den Prinzen Luitpold. Dieser gibt nach langem Zögern seine Zustimmung, hätte es aber lieber gesehen, wenn sein Neffe von sich aus abdanken würde.</p> <p>Mit Reichskanzler Otto von Bismarck wird über das weitere Vorgehen gegen König Ludwig II. Einvernehmen hergestellt, um jede mögliche Intervention und Missbilligung Preußens und des Deutschen Reiches auszuschließen.</p>
1. 5 1886 - Am „Haymarket“ in Chicago kommt es zu blutigen Straßenkämpfen
Chicago * Am „Haymarket“ in Chicago kommt es zu blutigen Straßenkämpfen mit der Polizei.
In der Folge werden acht Gewerkschaftsführer verhaftet und nach einer konstruierten Anklage zum Tode verurteilt.
Vier davon werden auch hingerichtet.
2. 5 1886 - Die königliche Finanzmisere wird öffentlich diskutiert
Nürnberg * Der „Nürnberger Anzeiger“ schreibt zur Finanzmisere König Ludwigs II. folgende Zeilen:
„[...] der Staat soll Schulden machen, um die Kalamität der Kabinettskassa zu beseitigen, wozu eine Summe von 12 bis 20 Millionen Mark - nach den verschiedenen Lesearten - nötig sein wird.
Ob hierzu wirklich so leicht die Genehmigung der 2/3-Mehrheit der Landboten zu erhalten ist, wollen wir doch erst abwarten, nach unserer Meinung kann hierzu eine Volksvertretung ihre Zustimmung unmöglich geben“.
16. 5 1886 - Die erste Profi-Radrennbahn der Welt auf dem Schyrenplatz
München-Untergiesing * Auf dem Schyrenplatz geht die erste Profi-Radrennbahn der Welt in Betrieb. Bei der Eröffnung der 500 Meter langen Bahn mit den überhöhten Kurven beeindrucken drei „Geldpreisfahrer“ aus dem Ausland mit ihren außergewöhnlichen Leistungen.
23. 5 1886 - Einvernehmen über das Entmündigungsverfahren Ludwigs II. hergestellt
München - Berlin - Wien * Am 23./24. Mai wird mit Preußen und Österreich Einvernehmen über das Entmündigungsverfahren König Ludwigs II. hergestellt, um mögliche Interventionen und Missbilligungen zu vermeiden.
6 1886 - Der Münchner Radrennsportler Heinrich Roth gewinnt das Rennen
München - Freising * Für den Münchner Radrennsportler Heinrich Roth ergibt sich eine erste sportliche Herausfordeung, nachdem sich Mitglieder des „Freisinger Trabrennvereins“ mit den „Hochrad-Fahrern“ aus München messen wollen.
An einem Junimorgen steht der 17-jährige Heinrich Roth mit seinem 1,37 Meter über den Boden ragenden „Hochrad“ vor dem „Großen Wirt“ in Schwabing - gemeinsam mit fünf anderen „Radfahrern“ - am Start zum Rennen nach Freising.
Für die dreißig Kilometer lange Strecke braucht damals
- ein guter „Traber“ rund zwei Stunden,
- die neuartige „Eisenbahn“ bewältigt die Entfernung in siebzig Minuten.
- Der „Renn-Radler“ legte die Strecke in exakt einer Stunde und vier Minuten zurück.
Heinrich Roth siegt damit nicht nur mit einer halben Stunde Vorsprung vor seinen Konkurrenten, sondern unterbietet auch noch die Fahrzeit der Eisenbahn um sechs Minuten.
Die Sensation ist damit perfekt.
Doch das war erst der Anfang der Karriere des ambitionierten „Rennfahrers“ und es sollte weiter steil nach oben gehen.
7. 6 1886 - Die entscheidenden Schritte zur Entmündigung werden eingeleitet
München * In den Ministerrats-Sitzungen vom 7., 8. und 9.Juni 1886 werden - unter dem Vorsitz des Bayernprinzen Luitpold - die entscheidenden Schritte zur Entmündigung von König Ludwig II. und der Übernahme der Regentschaft durch Prinz Luitpold in die Wege geleitet.
8. 6 1886 - Professor Bernhard von Gudden attestiert eine unheilbare Paranoia
München * Professor Dr. Bernhard von Gudden und drei weitere Ärzte attestieren König Ludwig II. - rund zehn Wochen nach Auftragserteilung - eine sehr weit fortgeschrittene und unheilbare Paranoia. Sie stützen sich dabei im Wesentlichen auf Aussagen der Hofbediensteten und ohne mit dem Patienten auch nur ein einziges Wort gesprochen zu haben.
Mit dem psychiatrischen Gutachten sind aber die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Beendigung der Regentschaft von König Ludwig II. gegeben.
Ludwigs Onkel, Prinz Luitpold, erklärt sich nach längerem Zögern und Zaudern zur definitiven Übernahme der Regentschaft - nach der Entmündigung des Königs - bereit und verständigt noch am selben Tag die größeren deutschen Souveräne und Kaiser Franz Joseph von Österreich.
9. 6 1886 - Die Ministerkonferenz stellt die Regierungsunfähigkeit des Königs fest
München * Prinz Luitpold lädt zur Ministerkonferenz ein, auf der
- die Regierungsunfähigkeit des Königs festgestellt,
- seine Entmündigung vollzogen und
- dem Einladenden die Regentschaft - vorbehaltlich der Unterrichtung des Landtags - übertragen wird.
Zur Wahrung der privatrechtlichen Interessen des Märchenkönigs Ludwig II. setzt man die Grafen Clemens Maria von Toerring-Jettenbach und Max von Holnstein als Vormund ein.
10. 6 1886 - Prinzregent Luitpold unterzeichnet die Regentschaftsproklamation
München * Die Regentschaftsproklamation des Prinzen Luitpolds wird vom Gesamtministerium gegengezeichnet. Der 65-jährige Luitpold von Bayern wird damit zum Verweser des Königreichs Bayern, oder kurz gesagt zum Prinzregenten.
In der Zwischenzeit hat sich eine elfköpfige „Fang-Kommission“ - unter Beteiligung des Ministers Krafft Freiherr von Crailsheim, der Vormünder, Dr. Bernhard von Gudden und anderen - auf den Weg nach Schloss Neuschwanstein gemacht. Sie sollen den König von seiner Regierungsunfähigkeit und der Übernahme der Regentschaft durch Prinz Luitpold unterrichten und ihn in irrenärztliche Pflege übernehmen. Der rechtzeitig informierte König Ludwig II. lässt die Kommission von Gendarmen aus Füssen festnehmen.
Erst am Nachmittag, nachdem sich die Regentschaftsproklamation Luitpolds auch in Füssen herumgesprochen hat, werden die Gefangenen wieder freigelassen.
11. 6 1886 - Eine effektivere Fang-Kommission nimmt einen neuen Anlauf
Schloss Neuschwanstein - Schloss Berg * Eine kleinere, effektivere Fang-Kommission nimmt einen neuen Anlauf. Diesmal mit mehr Erfolg. Dem König wird die Entmündigung eröffnet. Er lässt sich festnehmen und nach Schloss Berg am Starnberger See überführen. Dort kommt es in der Folge zum sogenannten Königsdrama.
Ursprünglich sollte der Ex-König Ludwig II. nach Schloss Fürstenried gebracht werden. Man kommt von dem Gedanken aber wieder ab, da man die Brüder nicht im selben Haus untergebracht haben will. Statt dessen werden Pfleger vom Prinzen Otto abgezogen.
13. 6 1886 - Ex-König Ludwig II. und Dr. Gudden werden tot aufgefunden
Schloss Berg * Am Pfingstsonntag gegen 18.30 Uhr treten der abgesetzte und entmündigte König Ludwig II. und der Leiter der Kreisirrenanstalt von München und Oberbayern, Professor Dr. Bernhard von Gudden, einen Spaziergang an. Nachdem sie um 20 Uhr noch immer nicht zum Abendessen erschienen sind, beginnt man mit der Suche.
Gegen 23 Uhr findet man die Leiche des Ex-Königs auf dem See schwimmen, das Gesicht nach unten. Nur ein paar Meter entfernt treibt der tote Dr. Gudden. Bei der Leichenschau finden sich an Ludwig II. keine Verletzungen, jedoch im Gesicht des 61-jährigen Psychologen Kratzwunden über dem rechten Auge. An der Stirn wird eine Beule festgestellt. Ein Fingernagel ist abgerissen und am Hals finden sich Würgemale.
Das Volk gibt die Schuld an der Königstragödie dem Prinzregenten.
14. 6 1886 - Prinz Luitpold tritt auch die Regentschaft für König Otto I. an
München - Schloss Fürstenried * Nachfolger auf dem Thron des Märchenkönigs und damit Bayerns fünfter König wird dessen 38-jähriger, schwer geisteskranke, seit dem 16. März 1878 entmüdigte und seit März 1880 in Schloss Fürstenried weggesperrte Bruder Otto I.. Er wird offiziell zum König proklamiert, wobei man die feierliche Ausrufung durch einen Herold allerdings unterlässt. Pro forma werden aber die Truppen auf den neuen König Otto I. vereidigt.
Obwohl er den Königstitel seit dem Tag seiner Proklamation bis zu seinem Lebensende - am 11. Oktober 1916 - trägt, wird er in den bayerischen Geschichtsbetrachtungen kaum erwähnt. Otto ist dreißig Jahre lang bayerischer König; so lange wie kein anderer Wittelsbacher. Der um drei Jahre jüngere Bruder des Märchenkönigs ist allerdings wegen „schwerer und unheilbarer geistiger Umnachtung“ nicht in der Lage, die Regierungsgeschäfte wahrzunehmen.
Ein von drei unabhängigen Ärzten verfasstes und in Einstimmigkeit unterzeichnetes Gutachten „über den Geisteszustand seiner Majestät Otto I. von Bayern“ kommt zu dem abschließenden Ergebnis, dass „Seine Majestät Otto I. König von Bayern in Folge langjähriger und unheilbarer Geistesstörung als verhindert an der Ausübung der Regierung zu betrachten sei, und daß diese Verhinderung mit Bestimmtheit für die ganze Lebenszeit andauern werde“.
Auch der „Besondere Ausschuß der Kammer der Reichsräte“ befasst sich mit dem Gesundheitszustand des fünften Bayernkönigs. Deshalb tritt Prinz Luitpold auch die Regentschaft für König Otto I. an und damit in die in der Bayerischen Verfassung aus dem Jahr 1818 vorgesehene Regelung der Reichs-Verwesung ein.
Diese ist vorgesehen, „während der Minderjährigkeit des Monarchen“ oder „wenn derselbe an der Ausübung der Regierung auf längere Zeit verhindert ist, und für die Verwaltung des Reichs nicht selbst Vorsorge getroffen hat, oder treffen kann“.
Der Regent unterzeichnet als „des Königreichs Baiern Verweser“ oder - populär ausgedrückt - als Prinzregent. Die Bayerische Verfassung schließt also die Thronfolge trotz der gegebenen Regierungsunfähigkeit nicht aus.
15. 6 1886 - König Otto I. wird die Thronfolge- und Regentschaftsproklamation verlesen
Schloss Fürstenried * Oberhofmarschall Ludwig Freiherr von Malsen und General Siegmund Freiherr von Pranckh besuchen den neuen König Otto I. und melden ihm den Tod seines Bruders Ludwig. II.. Otto zeigt keine Regung auf die Todes-Nachricht.
Danach wird ihm die Thronfolge- und Regentschaftsproklamation verlesen. Er freut sich offensichtlich darüber, künftig mit Majestät angesprochen zu werden. Ob er jedoch die Nachricht in Gänze begriffen hat, wird schon damals bezweifelt.
17. 6 1886 - Geheimes Protokoll über den Gesundheitszustand König Ottos I.
München * In einem geheimen Protokoll wird über den Gesundheitszustand des fünften bayerischen Königs das Nachfolgende ausgeführt: „Der Zustand seiner Majestät des Königs Otto sei ein solcher, daß auch der Laie die Regierungsunfähigkeit zu bestätigen vermöge.
Das Leiden hat seinen Anfang genommen [...] wie bei Seiner Majestät König Ludwig. Zuerst seien Seine Majestät König Otto zur Führung einer längeren Conversation befähigt gewesen, jetzt könnten sich Seine Majestät gar nicht mehr artikuliert ausdrücken, wenn auch ein gewißes Verständnis und Erkennungsvermögen bestehe.
Wenn Ihre Majestät die Königinmutter oder ein Curator das Schloß Fürstenried besuche, so erkennen Seine Majestät dieselben, lachen und springen davon, weil Seine Majestät außer Stande sind, zusammenhängend zu sprechen.“
Und an einer anderen Stelle der gleichen Protokollnotiz steht geschrieben: „Hienach finden sich bei Seiner Majestät König Otto bald Exaltations-, bald Depressions-Zustände mit Aufregungen, lebhaften Sinnestäuschungen, zuckende Bewegungen, Wahnideen sowie Geistesschwäche vor, und ist dieser Zustand als ein unheilbarer zu erachten.“
19. 6 1886 - Der Leichnam König Ludwigs II. wird beigesetzt
München-Kreuzviertel * Der Leichnam König Ludwigs II. wird in der Krypta der Michaelskirche beigesetzt.
20. 6 1886 - Kritik an König Ottos I. Inthronisation
München * Der Journalist Anton Memminger schreibt in der Bayerischen Landeszeitung: „Um sich auf seinen Sesseln weiter halten und in gewohnter Weise fortwursteln zu können, hat das Ministerium Lutz den Prinzen Otto zum König eingesetzt. [...]
Allein der klare Wortlaut der Verfassung widerspricht der Ernennung Ottos zum König. In der Urkunde heißt es, dass der König den Eid auf die Verfassung leisten muss. Ein Prinz, der aber nichtfähig ist einen Eid zu leisten, weil er den selben weder verstehen noch halten kann, soll der nun fähig sein, König zu werden? [...]
Das ganze Volk war auch völlig verblüfft, als ihm das Ministerium einen irrsinnigen Prinzen als König vorstellte. [...] Wo soll das hinaus? Man kann doch dem Volke nicht zumuten, dass es die Ehrfurcht, Liebe und Achtung, die es dem genialen König Ludwig II. auch im Unglück nicht versagte, auf einen unheilbaren blödsinnigen Prinzen überträgt.“
Der Verfasser der Zeilen wird wenig später deswegen verurteilt.
21. 6 1886 - Die Kammer der Reichsräte stimmt der fortgesetzten Regentschaft zu
München-Kreuzviertel * Die Kammer der Reichsräte gibt seine Zustimmung zu der für König Ludwig II. übernommenen und für den geisteskranken König Otto I. fortzusetzende Regentschaft durch den Prinzen Luitpold.
26. 6 1886 - Auch die Abgeordnetenkammer stimmt der fortgesetzten Regentschaft zu
München-Kreuzviertel * Die Kammer der Abgeordneten erteilt seine Zustimmung zu der für König Ludwig II. übernommenen und für den geisteskranken König Otto I. fortzusetzende Regentschaft durch den Bayernprinzen Luitpold.
14. 7 1886 - Franz Stuck wird ausgemustert
München * Franz Stuck wird als „untauglich zum Dienst im Heer und Marine“ ausgemustert.
1. 8 1886 - Die Königsschlosser werden zur Besichtigung freigegeben
Herrenchiemsee - Linderhof - Neuschwanstein * Schloss Herrenchiemsee, Schloss Linderhof und Schloss Neuschwanstein werden zur öffentlichen Besichtigung freigegeben.
16. 8 1886 - Das Königsherz in Altötting
Altötting * Die Urne mit dem Herzen des verstorbenen Königs Ludwig II. wird nach Altötting überführt.
9 1886 - Michael Schottenhamel errichtet das erste „Leinwandzelt“ auf der „Wiesn“
München-Theresienwiese * Michael Schottenhamel errichtet das erste „Leinwandzelt“ auf der „Wiesn“.
9. 9 1886 - Der Verband zum internationalen Schutz des Urheberrechtstagt in Bern
Bern * Der Verband zum internationalen Schutz des Urheberrechts tagt in Bern. Die souveränen Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Haiti, Italien, Schweiz, Spanien und Tunis erklären in der Berner Übereinkunft, die Rechte des Autors am eigenen Werk in den teilnehmenden Staaten schützen und vertreten zu wollen.
29. 9 1886 - Die Familie Feuchtwanger zieht in die Hildegardstraße 9
München-Lehel * Die Familie Feuchtwanger zieht in die Hildegardstraße 9.
10 1886 - Der Leichnam König Ludwigs II. wird in einen Sarkophag umgebettet
München-Kreuzviertel * Der Leichnam König Ludwigs II. wird in einen neoklassizistischen Sarkophag umgebettet.
Um den 10 1886 - Der „Wintergarten auf der Münchner Residenz“ wird aufgelassen
München-Graggenau * Nach dem Tod König Ludwigs II. wird der „Königliche Wintergarten auf dem Festsaalbau der Münchner Residenz“ aufgelassen.
- Die Pflanzen werden nach „Schloss Nymphenburg“ gebracht,
- das kupferne Seebecken wird verkauft.
13. 10 1886 - Die Öffentlichkeit erfährt von der Krankheit des Prinzen Otto
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten informiert die Bevölkerung ausführlich über die Lebensumstände und den Gesundheitszustand des neuen Bayernkönigs Otto I.. Die Öffentlichkeit erfährt erst jetzt, dass Prinz Otto an Verrücktheit oder Paranoia leidet.
„Der kranke König wird durch anhaltende Sinnestäuschungen (Halluzinationen) und Wahnvorstellungen so sehr vom realen Leben abgezogen, daß der Nichtunterrichtete [...] jeden geistigen Zusammenhang des Monarchen mit der Außenwelt für aufgehoben hält. Nur gelegentlich zeigen sich vorhandene Reste normaler Geisteskräfte. [...] Die Prognose geht mit Bestimmtheit dahin, daß an Heilung nicht gedacht werden kann. Auf die Lebensdauer hat das Leiden keinen Einfluß.“
16. 10 1886 - Leonhard Romeis heiratet Anna Ramis
München * Der Architekt Leonhard Romeis heiratet die Bamberger Kaufmannstochter Anna Ramis. Sie werden fünf Kinder zusammen haben.
31. 10 1886 - Die Giesinger Heilig-Kreuz-Kirche wird eingeweiht
München-Obergiesing * Nach zwanzigjähriger Bauzeit kann die Heilig-Kreuz-Kirche eingeweiht werden.
11 1886 - Franz von Lenbach erwirbt die größere Südhälfte des Heß-Anwesens
München-Maxvorstadt * Franz von Lenbach erwirbt die größere Südhälfte des Heß-Anwesens in der Luisenstraße 16 (heute HsNr. 33).
29. 12 1886 - Schwabing wird ein Stadtwappen in Aussicht gestellt
Schwabing * Prinzregent Luitpold verleiht der künftigen Stadt Schwabing [Stadterhebung am 1. Januar 1887] ein eigenes Stadtwappen. In einem blauen Schild werden zwölf goldene Ähren von einem silbernen, zu einer Schleife verschlungenen Band zusammengehalten.
1887 - Das Buch „Zur Lage der arbeitenden Klasse in Bayern“ erscheint
München * Dr. Bruno Schoenlanks Buch „Zur Lage der arbeitenden Klasse in Bayern“ erscheint.
1887 - Forderungen nach protestantischen Schulen und Kirchen
München-Haidhausen - München-Au - München-Giesing * Die protestantischen Bewohner der Vorstädte Haidhausen, Au und Giesing fordern neben der Errichtung einer „Notkirche“ die Einrichtung von „evangelischen Klassen“.
Es war nämlich zu dieser Zeit den evangelischen Kindern nicht erlaubt, in Haidhausen die Schule zu besuchen; sie mussten in die protestantische Schule an der Herrnstraße im Tal ausweichen.
Nur Erst- und Zweitklässlern gestattete man - wegen der Länge des Schulwegs - den Besuch der Haidhauser Schule an der Kirchenstraße.
Doch die meisten protestantischen Eltern machten aus Angst vor „dem katholischen Geist dieser Klassen“ keinen Gebrauch davon.
1887 - Kommentierte Berichte der „Fabrikinspektoren“
München * Dr. Bruno Schoenlank, Vordenker in der „SPD“, kommentiert die Berichte der „Fabrikinspektoren“ in seinem Buch „Zur Lage der arbeitenden Klasse in Bayern“, das während der Zeit der „Sozialistengesetze“ verboten ist, wie folgt:
„[...] Das harte Werk, der lange Arbeitstag, der in den oberbayerischen Ziegeleien, diesen Musteranstalten rücksichtslosester Ausbeutung der Arbeitskraft herrscht, ist vom Fabrikinspektor oft genug denunziert worden.
Aber was nützt es? Die Herren Ziegeleibrenner lassen sich, um den einheimischen Arbeitern die Lebenshaltung noch tiefer als sie bereits steht, herabzudrücken, beständig neue Waggonladungen italienischer Kulis von ihren Lieferanten aus dem Lande kommen, wo die Citronen und die Schmutzconkurrenz blüh‘n.
So nimmt es Keinen, der die Verhältnisse selbst zu beobachten Gelegenheit gehabt, Wunder, wenn es über die Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen betreffs der Kinderarbeit von den Ziegeleien heißt:
‚In einer namhaften Zahl derartiger Anlagen, die ich im Berichtsjahr theils zum erstenmale, theils nach mehrjähriger Zwischenpause besucht habe, fanden sich nicht einmal die Arbeitsbücher und man war anscheinend entweder noch in völliger Unkenntniß der die jugendlichen Arbeiter betreffenden Vorschriften, oder man hat sie mangels genügender Controle einfach außer Acht gelassen. Das behufs dieser Mißstände weiter Erforderliche ist eingeleitet‘.
Mangel an Controle, weil Mangel an Aufsichtspersonal, und darum eine Gesetzesverletzung nach der anderen, begangen durch die sittenstrengen Stützen der bürgerlichen Gesellschaft, die Moral, Ehrbarkeit, Gesetzlichkeit und Schutz nationaler Arbeit in Erbpacht haben, ferner Unkenntnis der Gesetze, d.h. derjenigen, die den Profit der Kapitalisten ein wenig zu beschneiden bestimmt sind.
O diese unschuldvollen, ahnungslosen Engel von Kapitalisten!“
1887 - Die Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“ erwirbt ein Grundstück
Berg am Laim * Die Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“ erwirbt an der Mühldorfstraße 20, nahe dem „Ostbahnhof“, ein 34.000 qm großes Areal mit Gleisanschluss.
1887 - Adolf Friedrich von Schack tritt aus dem „Kapitel des Maximiliansordens“ aus
München * Aus Verärgerung tritt Adolf Friedrich von Schack aus dem „Kapitel des Maximiliansordens“ aus.
Der Grund ist die Weigerung Prinzregent Luitpolds, den österreichischen Schriftsteller Ludwig Anzengruber - wegen Bedenken klerikaler Kreise - nicht in den „Maximiliansorden“ aufzunehmen.
1887 - Gründung der Zeitschrift „Radfahr-Humor und Radfahr-Chronik“
München * Der aus München stammende Kaufmann Heinrich Hildebrand ist in der „Zweiradbranche“ tätig und gründet die sehr erfolgreiche Zeitschrift „Radfahr-Humor und Radfahr-Chronik“.
Als „Chefredakteur“ kann er ein beachtliches Vermögen anhäufen, das er zum größten Teil für seinen Traum eines „Motor-Zweirades“ reinvestiert.
1887 - Das Gartenlokal „Rosenau“ wird eröffnet
Milbertshofen * „Die Rosenau“, ein Gartenlokal in der Schleißheimer Straße 128, wird eröffnet.
Es wird besonders an den Wochenenden von Soldaten und ihren Liebschaften frequentiert.
1. 1 1887 - Die Gemeine Schwabing wird zur Stadt erhoben
Vorstadt Schwabing * Die Gemeine Schwabing wird zur Stadt erhoben.
8. 1 1887 - Die Stadt Schwabing erhält ein Stadtwappen
München - Vorstadt Schwabing * Die Regierung von Oberbayern, Kammer des Innern übergibt der Stadt Schwabing ihr neues Stadtwappen. Es zeigt zwölf goldene Ähren im blauen Schild, deren Halme von einem silbernen, zu einer Schleife verschlungenen Band zusammengehalten werden.
5. 2 1887 - Bittschrift an Prinzregent Luitpold um Aufhebung des Kostümverbots
München * Johann Kögel ersucht in einer Bittschrift an Prinzregent Luitpold um die Aufhebung des Kostümverbots. Er begründet sein Schreiben damit, dass nicht jeder Volkssänger in konzessionierten Singspielhallen auftreten kann und deshalb die weniger etablierten Künstler weiter ins berufliche Abseits gedrängt werden würden.
8. 3 1887 - Kostümierungserlaubnisse sollen auf Singspielhallen begrenzt werden
München * Das Bayerische Innenministerium stellt einen Antrag an Prinzregent Luitpold, Kostümierungserlaubnisse alleine auf Singspielhallen zu beschränken, da diese leichter zu überwachen sind, als andere Etablissements.
Um 5 1887 - Franz von Lenbach löst sein römisches Künstleratelier auf
Rom * Franz von Lenbach löst sein römisches Künstleratelier auf.
4. 6 1887 - Franz von Lenbach heiratet Magdalena von Moltke
Breslau * Franz von Lenbach heiratet Magdalena von Moltke in Breslau.
26. 6 1887 - Ein Festzug zur Einweihung eines Kriegerdenkmals in Tölz
Tölz * Die Marktgemeinde Tölz hat „zur Erinnerung an die Gefallenen des Krieges gegen Frankreich 1870/71“ ein Kriegerdenkmal errichtet. Dazu wird die Figur des Kaiserlichen Feldhauptmanns und Herzoglichen Pflegers zu Tölz“ Kaspar Winzer, verwendet werden.
Als besonderen Glanzpunkt der Enthüllungsfeier und des dazugehörigen Festzugs wird der „Einzug des Feldobersten Kaspar von Winzer zu Roß an der Spitze seiner Landsknechte, Hackenschützen und Hellbeardierer in Tölz nach der Siegeschlacht von Pavia 1525“ nachgestellt. Der Münchner Restaurator Karl Joseph Zwerschina gewinnt dazu Freunde und Kollegen, die in den Kostümen nicht nur eine „gute Figur“ machen, sondern sich auch in ihre Rollen hinein leben. Sie nennen sich „Winzerer Fähndl“.
9 1887 - Alle 20 „Festwirte“ setzen 395.800 Mass „Wiesnbier“ ab
München-Theresienwiese * Alle 20 „Festwirte“ setzen 395.800 Mass „Wiesnbier“ ab.
So viel, wie heute an einem Tag.
9 1887 - Der Steyrer Hans zieht mit festlich geschmückten Wagen zur „Wiesn“
München-Theresienwiese * Der Steyrer Hans zieht mit festlich geschmückten Wagen zur „Theresienwiese“.
Er selbst fährt mit seiner Familie im Vierspänner, es folgen sieben Zweispänner, beladen mit Musikanten sowie Schank- und Bedienungspersonal. Der Aufzug beginnt am „Restaurant Steyrer Hans“ in der Tegernseer Landstraße in Obergiesing.
Nach einem Umtrunk im „Schneider Weißen“ im Tal wird Steyrers „Wiesneinzug“ von der Polizei gestoppt.
Ein Gerichtsverfahren endet mit einer Geldbuße wegen „Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“, was jedoch die Sympathie für den bayerischen „Kraft-Athleten“ bei der Bevölkerung vermehrt. Das wiederum wirkt sich positiv aufs Geschäft aus.
Damit ist der Steyrer Hans der Erfinder des „Einzugs der Wiesnwirte“.
Um 9 1887 - Letztmals: Jeder Wirt darf nur den Platz für eine Bude ersteigern
München-Theresienwiese * Die Vorschrift, wonach jeder Wirt nur Platz für eine Bude ersteigern darf, wird letztmalig bekräftigt.
16. 9 1887 - Die Münchner Haupt-Synagoge wird eingeweiht
München-Angerviertel - München-Kreuzviertel * In den Morgenstunden begehen die jüdischen Gläubigen Münchens in der alten Münchner Synagoge an der Westenriederstraße den letzten Gottesdienst und überführen anschließend die Thora-Rollen in das neue israelitische Gebetshaus. Dort angekommen legen sie den Schlussstein der Kirche, der eine Kapsel mit einer Urkunde über den feierlichen Akt sowie sämtliche Tageszeitungen und die in Umlauf befindlichen Münzen enthält.
Um 17 Uhr erfolgt dann - unter interessierter Beteiligung der Münchner Öffentlichkeit und der offiziellen Repräsentanten von Stadt und Staat - die feierliche Einweihung der neuen, nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellten Münchner Haupt-Synagoge an der Herzog-Max-Straße 7. Ausgestattet mit 1.000 Männer- und 800 Frauen-Betstühlen ist sie - nach der Berliner und der Breslauer Synagoge - das drittgrößte deutsche jüdische Gotteshaus und Zentrum der liberal ausgerichteten Mehrheitsgemeinde.
Die zeitgenössischen Kritiker würdigen den Bau als „ein völlig selbständiges Werk von ausgeprägter Eigenart, ein Denkmal, nicht nur des Meisters, der es geschaffen hat, sondern auch der Zeit, in der es entstand“. Und das Münchner Tagblatt vermerkt überschwänglich, dass das „architektonische Schmuckkästchen“ München nun wieder „um eine köstliche Perle reicher geworden“ ist.
13. 10 1887 - Die vier Moriskentänzer werden zurückgekauft
München-Graggenau * Die vier Moriskentänzer aus dem Besitz des Conte Palavicini-Barrocco werden um 8.000 Francs wieder zurückgekauft.
4. 11 1887 - Die Moriskentänzer werden restauriert
München-Hackenviertel * Da die vier Moriskentänzer aus dem Besitz des Conte Palavicini-Barrocco „hier mit kleineren Defecten angekommen“ sind, werden sie der Firma Radspieler zur Restaurierung übergeben und die Figuren neu gefasst.
1888 - Ludwig Petuel nennt seine Brauerei „Salvatorbrauerei“
Vorstadt Schwabing * Ludwig Petuel nennt seine Brauerei „Salvatorbrauerei“.
Ein langwieriger Kampf um den Markennamen entzündet sich.
1888 - Valentin Ludwig Fey besucht die Klenzeschule
München-Isarvorstadt * Der „Ernst des Lebens“ beginnt auch für Valentin Ludwig Fey. Er besucht die Klenzeschule.
1888 - Der kleine „Sitzungssaal“ wird von Wilhelm von Lindenschmitt gestaltet
München-Graggenau * Der kleinere „Sitzungssaal“ für den „Magistrat“ im „Neuen Rathaus“ wird von Wilhelm von Lindenschmitt mit einem Fresko ausgeschmückt.
Es zeigt eine „Monachia“, die von König Ludwig I. gekrönt wird. Man wollte damit „pflichtschuldig“ daran erinnern, dass München „seinen Aufstieg zu einer erstrangigen Kunststadt Europas alleine dem Bauwillen und dem Sammlungseifer dieses Regenten zu verdanken hatte“.
1888 - Joseph Schülein kauft die verwahrloste und stillgelegte Unionsbrauerei
München-Haidhausen * Joseph Schülein kauft, gemeinsam mit seinen Brüdern Gustav und Julius sowie Josef Aischberger die verwahrloste und stillgelegte Unionsbrauerei in der Äußeren-Wiener-Straße, der heutigen Einsteinstraße.
1888 - Die „Gambrinusbrauerei“ wird in „Unionsbrauerei“ umbenannt
München-Haidhausen * Die „Gambrinusbrauerei“ in der heutigen Einsteinstraße 42 in Haidhausen wird in „Unionsbrauerei“ umbenannt.
Der Brauereibesitzer Geyer hat dennoch kein glückliches Händchen, weshalb die Brauerei verwahrlost und stillgelegt werden muss.
1888 - Der Grundstein für die Sankt-Benno-Kirche wird gelegt
München-Maxvorstadt * Der Grundstein für die Sankt-Benno-Kirche wird gelegt.
1888 - Leonhard Romeis lehnt eine Berufung nach Straßburg ab
Straßburg * Leonhard Romeis lehnt eine Berufung als Direktor der Kunstgewerbeschule in Straßburg ab.
1888 - Das „Kreuzviertel“ wird als „Stadtbezirk IV“ bezeichnet
München-Kreuzviertel * Das „Kreuzviertel“ wird als „Stadtbezirk IV“ bezeichnet.
1888 - Das „Weinrestaurant und Wiener Café Isarlust“ auf der „Feuerwerkinsel“
München-Lehel - Praterinsel * „Stadtbaurat“ Friedrich Loewel erbaut das „Weinrestaurant und Wiener Café Isarlust“ auf der „Feuerwerkinsel“.
Er realisiert hier ein Rokoko-Schlösschen, das mit seinem hohen Mittelbau fast an einen Theaterbau erinnert und deren mächtige Kuppel und reiche Dachlandschaft sich schön zwischen die hohen Bäume einfügt. „Die prunkvolle Rokokoausstattung des Innern lässt noch deutlich den seinerzeitigen Einfluss der Prachtbauten Ludwigs II. erkennen“.
Nach der „Kunstgewerbe-Ausstellung“ wird die „Isarlust“ eine gehobene Restauration für die feine Gesellschaft, in der auch Künstlerfeste stattfinden.
1888 - Das Hauptfeuerhaus am Jakobsplatz wird aufgestockt
München-Angerviertel * Das Hauptfeuerhaus am heutigen Jakobsplatz wird aufgestockt.
Ab 1888 - Die Ausgestaltung der „Frühlingsanlagen“ beginnt
München-Untergiesing - München-Au * Bis 1893 erfolgt die eigentliche, planmäßige Ausgestaltung der „Frühlingsanlagen“.
Dabei wird das gesamte Gelände um den „Kulturgarten“ als Bestandteil der Isaranlagen im „spätlandschaftlichen Stil mit geschwungenen Wegen“ gestaltet.
Da mit der Zunahme der städtischen Grünflächen und Alleen die „Stadtgärtendirektion“ ein erweitertes Aufgabengebiet erhalten hat, wird die Einrichtung einer „Stadtgärtnerei“ und eines größeren „Kulturgartens“ notwendig.
Vor 1888 - Der Magistrat macht sich an die Beseitigung des Müllproblems
München * Nachdem die Trinkwasser- und Abwasserproblematik gelöst ist, macht sich der Magistrat an die Beseitigung des Müllproblems. Um die Entsorgung der Abfälle ist es äußerst schlecht bestellt. Von einer regelmäßigen Sammlung des festen Hausmülls ist man in München noch weit entfernt.
Die Bürger werfen ihre Abfälle weiterhin in eine der 2.700 Asche-, Kehricht- und Düngegruben, die jährlich mindestens einmal entleert werden müssen. Das war's dann schon, mehr Müllbeseitigung gibt es bis dahin noch nicht.
1888 - Die Methoden der Müllbeseitigung studieren
München * Eine eigens gebildete Kommission geht auf Reisen, um in Frankfurt, Hannover, Bremen, Hamburg, Dresden, Leipzig, Prag und Berlin die dortigen Methoden der Müllbeseitigung zu studieren. Danach will man die Zustände in München ändern.
Bis 1888 - Abbruch der „alten“ Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing
München-Obergiesing * Bis zum Abbruch der „alten“ Heilig-Kreuz-Kirche steht diese und auf gleicher Höhe wie das „neue“ Gotteshaus.
1888 - Der eingeborene Münchner ist bieder, schwerblütig und genussfreudig
München * Meyers Konversations-Lexikon beschreibt den „autochthonen [= einheimischen] Münchner“ folgendermaßen: „Insoweit sich noch typische Figuren des echten Münchners finden, zeigt dieser sich bieder, trockenen Humors, schwerblütig und genussfreudig, aber auch bei schwerer Arbeit ausdauernd und kräftig, für das Fremde nicht leicht einzunehmen, auf seine Stadt und ihre Schönheit stolz, wenn auch mit mancher großstädtischer Neuerung nicht immer sofort einverstanden.
Im Hofbräuhaus, wo man sich selbst bedient, statt des Stuhls mit einem Fass, statt des Tellers mit einem Blatt Papier oder auch der flachen Hand begnügt, um Stand und Würden des Nachbarn unbekümmert, mit demselben rasch ein gemütliches Gespräch anknüpft, oder in den zahlreichen Lagerbierkellern [...] der Vorstädte, wo auch das schöne Geschlecht, das in München seinen Namen mit Recht führt, vertreten ist, spielen sich köstliche Volksbilder ab, deren Drastik sich steigert zur Zeit des Bocks, einer im Mai zum Ausschank gelangenden, besonders kräftigen Biersorte, oder des Salvators, der schon um Ostern im sogenannten Zacherlbräu verabreicht wird.“
1888 - Der erste deutsche „Kolonialkrieg“ beginnt in „Deutsch-Ostafrika“
Deutsch-Ostafrika [= Tansania] * Angefangen haben die „Kolonialkriege“ in den deutschen „Kolonien“ bereits im Jahr 1888, als es in „Deutsch-Ostafrika“, dem heutigen „Tansania“, zum Aufstand der Küstenbevölkerung unter Buschri bin Salim gegen die Versuche der deutschen Inbesitznahme kam.
Der junge Offizier Hermann Wißmann wird als „Reichskommissar“ nach Ostafrika geschickt, um mithilfe einer „Söldnertruppe“ aus deutschen Offizieren sowie „Sudanesen“ und „Zulu“ den Aufstand niederzuringen.
Dies geschieht dann auch mit einem beispiellosen „Terrorfeldzug“.
Die Städte, in denen sich die „Aufständischen“ mit ihren Familien verschanzt haben, werden von Kanonenbooten aus beschossen und zerstört.
Noch lange nach der Niederschlagung des „Aufstands“ werden „Säuberungsaktionen“ und „Bestrafungsaktionen“ durchgeführt.
1. 1 1888 - Die Deutschen Kolonialgesellschaft wird gegründet
Berlin * Der Deutsche Kolonialverein und die Gesellschaft für deutsche Kolonisation schließen sich offiziell zur Deutschen Kolonialgesellschaft als Dachverband der organisierten Kolonialbewegung zusammen. Sie bringt wöchentlich die Deutsche Kolonialzeitung heraus und kann ihren Mitgliederstand von 14.838 im Dezember 1887 auf über 42.000 zu Beginn des Ersten Weltkriegs steigern.
23. 3 1888 - Auf dem Nockherberg findet die große „Salvator-Schlacht“ statt
<p><strong><em>München-Au</em></strong> * Auf dem Nockherberg findet die große <em>„Salvator-Schlacht“</em> statt. Sie entwickelt sich aus einer kleinen Schlägerei.</p>
6 1888 - Franz von Lenbachs „Ateliergebäude“ in der Luisenstraße 33 ist bezugsfertig
München-Maxvorstadt * Franz von Lenbachs „Ateliergebäude“ in der Luisenstraße 33 ist bezugsfertig und wird vom Ehepaar Lenbach bewohnt.
15. 6 1888 - Wilhelm II. von Preußen wird Deutscher Kaiser
Berlin * Wilhelm II. von Preußen wird Deutscher Kaiser und übernimmt damit die Macht im Deutschen Reich. Die Kolonialbewegung ist inzwischen zu einem ernstzunehmenden Faktor in der deutschen Innenpolitik herangewachsen. In den Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik entwickelt sich ein Großmachtstreben.
27. 6 1888 - Forderung nach Errichtung einer ersten und zweiten Klasse
München - München-Haidhausen * Die „protestantischen Einwohner der Vorstädte rechts der Isar“ erheben bei der Lokalschulkommission die Forderung nach Errichtung je einer ersten und zweiten Klasse in Haidhausen.
Die Schulbehörde ist jedoch - aufgrund der in Haidhausen herrschenden Schulraumnot - nicht in der Lage, dem Antrag zu entsprechen, stellt aber die Errichtung der gewünschten Klassen nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaues der Wörthschule für das Jahr 1891/92 in Aussicht.
15. 7 1888 - Der Kunstmaler Eduard Grützner verlobt sich mit Anna Wirthmann
München - München-Haidhausen * Die Zeitschrift Die Kunst für Alle meldet:
„Professor Ed. Grützner hat sich mit der Tochter des Münchner Stadtkommandanten, Fräulein Anna Wirthmann, verlobt.
Die Red. d. Bl. wünscht dem trefflichen Künstler hierzu ebensoviel Glück und Freude, als er mit seinen Bildern anderen bisher geschaffen“.
Doch seine um siebzehn Jahre jüngere Frau wird den Künstler und ihren gemeinsamen Sohn, Karl Eduard, später wegen eines Wiener Sängers verlassen.
29. 7 1888 - Die Centenarfeier für König Ludwig I.
<p><strong><em>München</em></strong> * Aus Anlass des 100. Geburtstags von König Ludwig I. findet vom 29. bis zum 31. Juli 1888 eine Centenarfeier als rauschende Festfolge statt. Eigentlich hätten die Münchner das Fest schon zwei Jahre zuvor feiern wollen, da König Ludwig I. ja bereits 1786 geboren worden war. Doch die Hoftrauer um den im Starnberger See ums Leben gekommenen Enkel des Jubilars und <em>„Märchenkönigs“</em> machen entsprechende Festlichkeiten im eigentlichen Jubiläumsjahr 1886 unmöglich. Aus diesem Grund verschob man das Fest und führte es parallel zur Deutsch-Nationalen Kunstgewerbe-Ausstellung durch. </p>
31. 7 1888 - Die Elefanten-Katastrophe
<p><strong><em>München</em></strong> * Zum Höhepunkt der Centenarfeier, dem drei Kilometer langen Festzug, formieren sich tausende Menschen und Tiere. Der <em>„Künstler- und Handwerkerzug“</em> beginnt am Karlsplatz-Stachus, führt zum Marienplatz und von da durch die Dienerstraße zum Max-Joseph-Platz. Von hier aus bewegte er sich über den Odeonsplatz zum Siegestor, wo der Zug wendet, um auf der westlichen Straßenseite wieder zurück zur Briennerstraße zu gelangen, von wo aus der Weg weiter zum Königsplatz führen soll. </p> <p>Die Festzugsgruppe der <em>„Kauf- und Handelsleute“</em> präsentiert sich dabei mit einem Wagen, zu dem acht indische Elefanten gehören. Diese entstammen einer Leihgabe des Zirkusdirektors Carl Hagenbeck. Beim Umzug durch die Ludwigstraße trotteen die exotischen Tiere gelassen und brav einher. Als der Festzug jedoch am Siegestor eine Schleife macht, treffen die von Berbern berittenen Elefanten auf die als feuerspeienden Drachen dekorierte Straßenlokomotive in der Gruppe der Eisenindustrie. Die Elefanten erschrecken durch ein unachtsames Dampfablassen und von dem Rattern und Gezische des grotesken Vehikels derart, dass sie scheuten und wild trompetend davonrasen. Die aufgescheuchten Elefanten lösen wiederum eine Massenpanik unter den Besuchern aus. </p> <p>Den Anfang macht ein Elefantenbulle, der wild zu trompeten beginnt, durch die Ludwigstraße nach Norden trampelt und vor der Staatsbibliothek randaliert. Drei Tiere folgen ihm, Panik bricht aus, im Gedränge sterben Menschen. Die Zirkuswärter brauchen die Hilfe der schweren Reiterei, um die Elefanten zu bändigen. </p> <p>Vier weitere Elefanten nehmen in die entgegengesetzte Richtung Reißaus und verbreiten Angst und Schrecken. Im ungezügelten Galopp rennen sie über die Ludwig- in die Maximilianstraße, steuern den Hofgraben zu, wo sie an der Königlichen Münze das Hauptportal einrennen. Über den Alten Hof laufen sie weiter zum Viktualienmarkt und richten unter den Verkaufsständen verheerende Verwüstungen an. Ein Elefant soll sogar ins Hofbräuhaus gerannt sein, bei denen Münchner Wirtshausbrüder und Elefanten einander Rüssel an Nase begegnen. </p> <p>Ihr weiterer Weg führt zum Gärtnerplatztheater und von dort zur Auenstraße 46, wo sie sich im Hof einfangen und beruhigen lassen. Später bringt man einen an die Vorgänge erinnernden Gedenkstein an. Immerhin verlieren durch die <em>„Elefanten-Katastrophe“</em> und der damit verbundenen Massenpanik zwei, nach anderer Quelle vier Menschen ihr Leben. Zudem verursacht sie 42 Verletzte. </p>
Um 8 1888 - Johann Bucher kauft die Anwesen Entenbachstraße 11
München-Au * Johann Bucher kauft die Anwesen Entenbachstraße 11 (heute Zeppelinstraße) und Lilienstraße 89.
Dort kann er im Innenhof eine große Werkstätte mit Schmiedefeuer und einem Webstuhl zur Drahtgitterherstellung einrichten und betreiben.
In Handarbeit stellt er und seine Beschäftigten Siebe, Wurfgitter für Baustellen sowie Kies- und Sandgewinnungs-Unternehmen „Rabitzgewebe“ und verschiedene Formen von Ziergitter her.
9 1888 - Der Wiesnwirt Steyrer Hans muss eine Strafe von 100 Mark zahlen
München-Theresienwiese * Als sich der Wiesnwirt Steyrer Hans nicht an das polizeiliche Verbot hält und erneut mit seiner Belegschaft in festlich geschmückten Wagen zum Oktoberfest fährt, muss er eine Strafe von 100 Mark zahlen.
9 1888 - Am Mariannenplatz soll die dritte evangelische Kirche entstehen
München-Lehel * Die Münchner „Gemeindekollegien“ beschließen, der protestantischen Kirchengemeinde den Mariannenplatz zum Bau ihrer dritten Kirche zu überlassen.
Als Bedingungen werden gestellt, dass der Bau innerhalb der nächsten drei Jahre begonnen und als ein der „Quaistraße“ entsprechender und monumentaler Bau ausgeführt werden muss.
15. 11 1888 - Herzog Max in Bayern stirbt in München
München - Tegernsee * Herzog Max in Bayern stirbt in München. Seine Grabstätte befindet sich in der Gruft von Schloss Tegernsee.
7. 12 1888 - Der Brite John Boyd Dunlop erfindet den luftgefüllten Gummireifen
Großbritannien * Der Brite John Boyd Dunlop, eigentlich ein Tierarzt, erfindet den luftgefüllten Gummireifen. Angeblich hat ihn das Geschepper der Eisenräder des Dreirades seines Sohnes so geärgert, dass er Gummiplatten zusammenklebte und mit einer Fußballpumpe aufblies.
1889 - Gabriel von Seidl baut ein Villa für Friedrich August von Kaulbach
München-Maxvorstadt * Die Villa in der Kaulbachstraße 15 wird vom Architekten Gabriel von Seidl für den „Kunstmaler“ Friedrich August von Kaulbach erbaut.
1889 - Erweiterungsarbeiten am „Neuen Rathaus“ beginnen
München-Graggenau * Erweiterungsarbeiten am „Neuen Rathaus“ beginnen im Bereich Diener- und Landschaftsstraße.
1889 - Die Stadt München kauft das ehemalige „Langer-Schlössl“
München-Haidhausen * Die Stadt München kauft das ehemalige „Langer-Schlössl“ und lässt es abreißen, um dafür ein Verwaltungsgebäude, Stallungen, Wagenhallen sowie Werkstätten für „Trambahnzwecke“ zu erstellen.
In letzter Minute erkennt der „Chemiker“ Adolf Keim den Wert und die Unersetzbarkeit der Wandgemälde.
Da aber die Stadt kein Geld zur Abnahme und Übertragung der Gemälde an einen geeigneteren Ort hat, finanziert Adolf Keim die Verlagerung der Fresken aus seiner eigenen Tasche.
Selbst die Zusage der Landeshauptstadt München, die Finanzierung von fotografischen Aufnahmen der Fresken für Dokumentationszwecke zu übernehmen, lassen die Verantwortlichen auch wieder fallen.
So werden die Wandgemälde - privat finanziert - in die „Städtische Handelsschule an der Herrenstraße“ übertragen, wo sie im Zweiten Weltkrieg endgültig zerstört werden.
1889 - Ein Konsortium baut und betreibt das „Wasserkraftwerk Höllriegelskreuth“
Höllriegelskreuth * Der Münchner „Bauunternehmer“ Jakob Heilmann erbaut und betreibt in Zusammenarbeit mit dem befreundeten „Bankier“ Wilhelm von Finck, Mitinhaber des „Bankhauses Merck, Finck & Co.“ und Johannes Kaempf, „Vorstandsmitglied der Bank für Handel und Industrie“, der späteren „Danat-Bank“, das achte deutsche Drehstrom-Kraftwerk „Zentrale I“, das später „Wasserkraftwerk Höllriegelskreuth“ genannt werden wird.
Es ist bis 1940 in Betrieb und wird dann durch einen Neubau ersetzt.
1889 - Sebastian Kneipp legt sich mit den „Bohnenkaffee-Herstellern“ an
Bad Wörrishofen * Sebastian Kneipp, katholischer Pfarrer und Erfinder der „Kneipp-Wasser-Kuren“, legt sich mit den „Bohnenkaffee-Herstellern“ an.
Deren Produkte prangert Kneipp als „giftig“ an, während er den „Malzkaffee“ in den „Siebten Himmel“ lobt.
Herbst 1889 - Sprünge im Mauerwerk der „Neuen Isarkaserne“
München-Isarvorstadt * In den Stallgewölben der „Neuen Isarkaserne“ an der Zweibrückenstraße bemerkt man besorgniserregende Sprünge im Mauerwerk.
Die Fäkalien der Pferde haben das tragende Mauerwerk stark angegriffen.
1889 - Die Isar hat sich eingegraben
Isar * Die Isar hat sich seit der Flussregulierung der Jahre 1806 bis 1812 so eingegraben, dass das Flussbett von 44 auf 60 Meter verbreitet werden muss.
1889 - Das Fahren mit dem Rad ist im „Englischen Garten“ verboten
München-Englischer Garten - München-Graggenau - München-Haidhausen - Bogenhausen * Das Rad fahren im „Englischen Garten“, in den „Maximiliansanlagen“ und im „Hofgarten“ ist untersagt.
Auch viele Straßen der Innenstadt sind für „Velocipedisten“ tagsüber nur zu Fuß zu benutzen, das Rad muss geschoben werden.
1889 - Der „Turnverein München 1860“ erhält eine „Turnhalle“ an der Auenstraße
München-Isarvorstadt * Nachdem der „Turnverein München von 1860“ die Trainingsstätte dem Bau der heutigen Hans-Sachs-Straße weichen muss, errichten die „Sechziger“ eine neue „Turnhalle“ an der Auenstraße.
Anno 1889 - Der „Konsumverein von 1864“ kauft ein Grundstück für einen Holzhof
Berg am Laim * Der „Konsumverein von 1864“ kauft ein Grundstück an der „Bergamlaimstraße 2 ½“ für einen Holzhof.
Das Grundstück stellt sich als absolut ungeeignet heraus, kann aber erst im Jahr 1919 mit Verlust verkauft werden.
1889 - Almon B. Strowger meldet den „Hebdrehwähler“ zum Patent an
Cansas City * Almon B. Strowger meldet einen sogenannten „Hebdrehwähler“ zum Patent an.
Den Anstoß zur Entwicklung eines automatisierten Vermittlungssystems gibt eine Telefonistin.
Nach einer gerne erzählten Anekdote ärgerte sich der Bestattungsunternehmer Almon B. Strowger aus Cansas City über ein ihm missgesonnenes „Fräulein vom Amt“.
Die Bedienkraft in der Telefonvermittlung vermittelte potenzielle Kunden grundsätzlich an Konkurrenzunternehmen des Herrn Strowger.
Kein Wunder, dass der Bestattungsunternehmer alles daran setzte, einen Vermittlungsapparat zu entwickeln, der ihn von menschlichen Einwirkungen unabhängig und die ungeliebte Telefonistin überflüssig machen würde.
1889 - Ein „Zweirad mit Dampfmotor“ wird entwickelt
München * Die Brüder Heinrich und Wilhelm Hildebrand beginnen mit der Konstruktion eines „Zweirades mit Dampfmotor“, nachdem Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach mit ihrem kleinen und schnell laufenden „Benzinmotor“ in der 1880er Jahren die Voraussetzung für die Weiterentwicklung des „Velocipedes“ zum „Motorzweirad“ geschaffen hatten.
Zur Verwirklichung ihres „Dampf-Kraftrades“ wenden sich die Brüder Hildebrand an zahlreiche Fahrrad- und Motorfirmen, die ihr Projekt - eine Dampfmaschine mit Kessel, Wasser- und Kohlevorrat - allerdings immer wieder ablehnen.
Wilhelm steigt schließlich aus Frust aus dem Projekt aus, doch Heinrich Hildebrand kann den Ingenieur Alois Wolfmüller gewinnen und mit ihm Zweiräder mit einem „wassergekühlten Zweizylinder- Viertaktmotor“ ausstatten.
Das ist der Durchbruch.
23. 1 1889 - Hedwig Kämpfer wird in München geboren
München * Hedwig Nibler (Kämpfer) wird in München geboren.
30. 1 1889 - 2 Millionen Mark für Strafmaßnahmen in Deutsch-Ostafrika
Berlin * Für Strafmaßnahmen in Deutsch-Ostafrika stellt der Reichstag zwei Millionen Reichsmark zur Verfügung gestellt.
20. 4 1889 - Adolf Hitler wird in Braunau am Inn geboren
<p><em><strong>Braunau am Inn</strong></em> * Adolf Hitler, der spätere deutsche Reichskanzler, wird in Braunau am Inn in Österreich geboren. </p>
17. 5 1889 - Die Mutter des Märchenkönigs stirbt auf Schloss Hohenschwangau
Schloss Hohenschwangau * Königinmutter Marie Friederike, Ludwig II. Mutter, stirbt auf Schloss Hohenschwangau Ihre Grabstätte befindet sich in der Fürstengruft der Theatinerkirche in München.
23. 5 1889 - Ernst Niekisch wird im schlesischen Trebnitz geboren
Trebnitz * Ernst Niekisch wird im schlesischen Trebnitz geboren.
28. 5 1889 - Die Familie Feuchtwanger zieht an den St.-Anna-Platz 2
München-Lehel * Die Familie Feuchtwanger zieht an den St.-Anna-Platz 2.
3. 7 1889 - Ein Pferdestraßenbahn-Betriebshof wird errichtet
München-Haidhausen * Die Verwaltung der Landeshauptstadt München kauft von der Münchner-Kindl-Brauerei das Anwesen des Schloßwirths, das an der Stelle des ehemaligen Langerschlößls steht. Die Wirtschaft wird abgerissen und an seiner Stelle ein Pferdestraßenbahn-Betriebshof errichtet. Der im Münchner Volksmund seit altersher als Depot bezeichnete Betriebshof entsteht auf einem 4.800 Quadratmeter großen Areal. Es beherbergt ein
- dreistöckiges Wohngebäude mit Bureaux,
- eine zweistöckige Etagenstallung für 180 Pferde mit einer Rampe zum Obergeschoss,
- eine achtzehngleisige Wagenhalle für vierundfünfzig Trambahnwagen mit dem
- darüber befindlichen Hafer-, Heu- und Strohmagazin und
- ein zweistöckiges Werkstättengebäude
- mit einer Schreinerei und
- einer Schlosserei im Parterre sowie
- einer Lackiererei und
- einer Sattlerei im ersten Stock.
Die Wagen können mit einem Aufzug in die letztgenannten Werkstätten hochgezogen werden. Außerdem ermöglicht eine besondere Durchfahrt im Werkstättengebäude das Ein- und Ausrücken der Trambahnwagen.
29. 7 1889 - Das Winzerer Fähndl hat ihren ersten öffentlichen Auftritt in München
München * Aus Anlass des VII. Deutschen Turnfestes hat das Winzerer Fähndl ihren ersten öffentlichen Auftritt in München. Sie stellen den Zug Herzog Wilhelms IV. zum Turnier im Jahre 1518 dar.
9 1889 - Ein Mord wird zum Ausgangspunkt für die „Lex Heinze“
Berlin * Das Berliner Ehepaar Gotthilf und Anna Heinze, er ein „Zuhälter“, sie eine „Prostituierte“, halten über mehrere Tage ein Mädchen fest, missbrauchen es sexuell und ermorden es schließlich.
Das ist der Ausgangspunkt für die Gesetzgebung für das „Kuppelei-Gesetz“, die sogenannte „Lex Heinze“.
23. 9 1889 - In München findet der erste Bayerische Katholikentag statt
München • In München findet der erste Bayerische Katholikentag statt.
10 1889 - Die „Menges‘sche Ost-Afrikaner-Karawane“ auf dem „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Die „Menges‘sche Ost-Afrikaner-Karawane“ wird auf dem „Oktoberfest“ gezeigt.
20. 10 1889 - Einweihung der protestantischen Johanneskirche
München-Haidhausen * Aktive Protestanten haben über 30.000 Mark an Spendengeldern gesammelt, um am Haidhauser Preysingplatz eine Notkirche, die Johannes-Kirche, mit 200 Sitzplätzen zu errichten. An diesem Tag wird die Kirche eingeweiht.
14. 11 1889 - Karl Gareis wird in Regensburg geboren
Regensburg * Karl Gareis wird in Regensburg geboren.
1890 - Die „Gastwirtschaft zum Roten Turm“ muss weichen
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Die „Gastwirtschaft zum Roten Turm“ muss dem Neubau der „Ludwigsbrücke“ weichen.
??? 1890 - Oskar von Miller gründet sein eigenes „Ingenieur-Büro“
München * Oskar von Miller gründet sein eigenes „Ingenieur-Büro“ in München, das sich zu einem der bedeutendsten europäischen Planungsbüros für Kraftwerkanlagen entwickeln wird.
1890 - Sechs „Filialwachen der Berufsfeuerwehr“ werden eingerichtet
München * Die Einrichtung von sechs „Filialwachen der Berufsfeuerwehr“ wird vom Magistrat beschlossen.
1890 - Andreas Schärfl gründet einen Metallverarbeitungsbetrieb
München-Haidhausen * Der „Schlossermeister“ Andreas Schärfl gründet in der Weißenburger Straße 11 einen Betrieb zur Metallverarbeitung.
1890 - Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien
München * Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien liegt bei 1.222.838 Hektoliter.
1890 - Werbung: „Auftreten einer Komiker- und Sängergesellschaft“
München-Isarvorstadt * Die „Kapuziner-Brauerei“ wirbt mit „Jeden Samstag und Sonntag Auftreten einer Komiker- und Sängergesellschaft“.
1890 - Die „Westendhalle“ wird in ein „Volkstheater“ umgewandelt
München-Ludwigsvorstadt * Nach 15 Jahren „Varieté-Betrieb“ wird die „Westendhalle“ in der Sonnenstraße in ein „Volkstheater“ umgewandelt.
Ab 1890 - Die Prinzregentenstraße wird angelegt
München-Lehel * Die Prinzregentenstraße wird angelegt.
Das hat einen Flächenverlust im Süden des „Englischen Gartens“ zur Folge.
Nach 1890 - Hugo Alois von Maffei und die „Siemens-Schuckert AG“
München * Hugo Alois von Maffei ist stellvertretender Vorsitzender der „Siemens-Schuckert AG“.
1890 - Einführung von „Jugendturnspielen“ an den „städtischen Volksschulen“
München * Die Stadtgremien beschließen die Einführung von „Jugendturnspielen“ an den „städtischen Volksschulen“.
Jede Jahrgangsstufe soll - neben dem eigentlichen Turnen - ihrem Alter angemessene Spiele ausüben können.
Um den Jugendlichen diese Möglichkeiten zu geben, müssen in den folgenden Jahren in allen Stadtteilen geeignete Spielplätze und umfangreiches Spielgerät zur Verfügung gestellt werden.
Die auf diesen Sportplätzen durchgeführten „Spielnachmittage“ zeigen reges Interesse und ständig steigende Teilnehmerzahlen.
Schnell kristallisiert sich als beliebteste Betätigung das Spiel mit dem „Fußball“ heraus.
1890 - Eine starke Geruchsbelästigung in der Lohe
München-Untergiesing * Die inzwischen zur „Aktiengesellschaft“ umgewandelte Produktionsstätte der „Untergiesinger Lederfabrik“ umfasst einen Personalbestand von 360 Arbeitern und Angestellten.
Der Fabrikbesitzer, inzwischen Julius von Eichthal, ist zu einem der wichtigsten Münchner Arbeitgeber aufgestiegen. Auf dem 8,8 Hektar großen Fabrikgelände zwischen der Pilgersheimer- und der Lohstraße werden jährlich 60.000 Rinder- und 15.000 Schweinehäute in fünfzig hölzernen „Wasserkästen“, 420 „Gargruben“ und diversen „Gartrommeln“ verarbeitet und schließlich im Freien zum Trocknen aufgehängt.
Die Bewohner der Lohe sind dadurch ständig einer starken „Geruchsbelästigung“ ausgesetzt.
1890 - Probleme der Abfallbeseitigung
München * Im Verwaltungsbericht „Über den Stand der Gemeindeangelegenheiten der königlichen Haupt- und Residenzstadt München“ werden die Zweifel an den bisherigen Methoden der Abfallsammlung deutlich formuliert.
Im Abschnitt „Reinlichkeitspolizei“ heißt es:
„Die innerhalb eines Anwesens sich ansammelnden Abfälle, insbesondere der sogenannte Hauskehricht (Kehricht, Asche, Küchenabfälle), sind in München bisher zumeist in Gruben aufgespeichert worden, welche jährlich mindestens einmal geleert werden mußten.
In diesem Kehricht befinden sich fäulniserregende Stoffe, welche die Träger von Krankheiten sein können.
Dies ist für die Gesundheit umso nachtheiliger, als erfahrungsgemäß die Verschlüsse jener Gruben schlechte sind, ein oftmaliges Öffnen derselben nicht vermieden werden kann, ja dieselben häufig wegen Überfüllung überhaupt offen stehen bleiben.
Die Sorge für die Gesundheit der Stadt verlangt eine rasche Entfernung dieser Stoffe [...] aus den genannten Anwesen.
Desgleichen verlangt die Gesundheitspflege, daß bis zu dem Zeitpunkt ihrer Entfernung die Stoffe in gut verschließbaren Behältern aufbewahrt bleiben.
Der Transport der Abfälle muß in gesicherter Weise stattfinden, sodaß weder sanitäre Gefahr entsteht, noch die Reinlichkeit verletzt wird“.
Um 1890 - Der „Steyrer Hans“ ist eine stattliche, auch furchteinflößende Erscheinung
München-Obergiesing * Mit einem Körpergewicht von beinahe zweieinhalb Zentnern und seinem vierzig Zentimeter langem Schnurrbart war der „Steyrer Hans“ eine stattliche, mitunter auch furchteinflößende Erscheinung.
Kein Wunder, dass ihm die Münchner unterstellten, er würde „Oachkatzln“ schnupfen, die er in seiner zigarrenschachtelgroßen, dreiundvierzig Pfund schweren Tabakdose aus Marmor und Zinn untergebracht hätte.
Dieses Ungetüm reicht der „Steyrer Hans“ mit besonderem Vergnügen herum, weil sie kaum jemand halten konnte.
Verheiratet ist er mit Mathilde, der Tochter des „Schweinemetzgers“ Schäffer.
Sie betreiben nacheinander mehrere Gaststätten in München, so das Gasthaus „Zum bayerischen Herkules“ in der Lindwurmstraße, ein weiteres in der Bayerstraße.
Dann übernehmen sie eine kleine Wirtschaft in Obergiesing, den „Tegernseer Garten“, den sie ausbauen und bis zu seinem Tod als „Restaurant Steyrer Hans“ bewirtschaften.
Dieses Wirtshaus an der Tegernseer Landstraße 75 ist ein beliebter Treffpunkt der Athleten und „Kraftmenschen“.
Um das Jahr 1890 - Das „Briefgeheimnis“ scheint bei den Damen nicht sicher
München * Auch wenn der Arbeitsplatz der „Telephonistin“ früher als typischer Beruf für Mädchen aus gutem Hause gilt, so ist der Dienst am Klappenschrank ursprünglich eine männliche Domäne.
Denn weder die „Königlich-bayerische Post“, noch die „Reichspost“ wollen etwas von Frauen in ihren Reihen wissen.
So erklärt der spätere „Reichspostminister“ Heinrich von Stephan, dass „keine Anstalten weniger als die Reichs-Verkehrsanstalten dazu geeignet sind, Frauen in Beschäftigung zu setzen“.
Das „Briefgeheimnis“ scheint bei den Damen nicht sicher und für „gehobene Stellungen“ gelten Frauen sowieso als ungeeignet.
Um das Jahr 1890 - Das „Luxuscafé“ setzt sich in München durch
München * Das „Luxuscafé“ setzt sich in München durch.
Den großen Vorbildern „Café Luitpold“ und „Café Prinzregent“ folgt eine Flut von Nachahmungen, die sich im Ausstattungsniveau, im technischen Standard und in der Dienstleistung an diesen hohen Vorgaben orientieren.
Zwischen 1890 und 1897 wurden eine ganze Reihe von größeren und kleineren Kaffeehäusern gegründet oder ältere dem „Geschmack der Neuzeit entsprechend“ restauriert.
Ab 1890 - Ludwig Thoma absolviert sein „Rechtspraktikum“
Traunstein * Ludwig Thoma absolviert sein „Rechtspraktikum“ in Traunstein.
1890 - München hat 349.024 Einwohner
München * München hat 349.024 Einwohner.
1. 1 1890 - Neuhausen wird nach München eingemeindet
München-Neuhausen * Die selbstständige Gemeinde Neuhausen wird mit dem Gemeindeteil Friedenheim nach München eingemeindet.
10. 1 1890 - Ignaz von Döllinger stirbt
München * Ignaz von Döllinger stirbt - exkommuniziert und unversöhnt mit der römisch-katholischen Kirche.
27. 1 1890 - Hans Unterleitner wird in Freising geboren
Freising * Hans Unterleitner wird in Freising geboren.
15. 3 1890 - Die Altkatholiken verlieren die Rechte einer öffentlichen Korporation
<p><strong><em>München</em></strong> * Der bayerische Ministerpräsident Johann von Lutz stellt die Trennung der Altkatholiken von der Katholischen Kirche fest. Die Altkatholiken verlieren dadurch die Rechte einer öffentlichen Korporation. </p>
20. 3 1890 - Otto von Bismarck wird als Deutscher Reichskanzler entlassen
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Otto von Bismarck wird von Kaiser Wilhelm II. als Deutscher Reichskanzler entlassen. </p>
6. 4 1890 - Willi Budich wird in Cottbus geboren
<p><strong><em>Cottbus</em></strong> * Willi Budich, einer der späteren Führer der <em>Münchner KPD</em>, wird in Cottbus geboren. </p>
19. 4 1890 - Buffalo Bill zeigt seine „Wild-West-Show“
<p><strong><em>München-Theresienwiese</em></strong> * William Frederick Cody, besser bekannt als <em>„Buffalo Bill“</em>, gastiert mit seiner <em>„Buffalo Bill‘s Wild West Show“</em> im Rahmen seiner Europa-Tournee bis zum 4. Mai 1890 auf der Theresienwiese. Er ist mit über 200 Cowboys und Indianern sowie 170 Pferden, Mauleseln und rund 20 Bisons unterwegs. Mit dabei ist auch die junge <em>„Kunstschützin“</em> Annie Oakley.</p>
24. 4 1890 - Sebastian Kneipp macht Reklame für „Kneipps-Malzkaffee“
Bad Wörrishofen * Die Gründer der Firma Franz Kathreiner‘s Nachfolger“, Emil Wilhelm und Adolph Brougier, schließen mit dem Bad Wörrishofener „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp einen Vertrag. Damit können sie ihr Malzkaffee-Produkt als „Kneipps-Malzkaffee“ mit einem Kneipp-Porträt und seiner Unterschrift in den Handel bringen.
1. 5 1890 - Arnold Zenetti wird mit dem „Kronenorden“ geadelt
München * In Anerkennung seiner Verdienste erhält Arnold Zenetti viele hohe Auszeichnungen:
- die „Goldene Bürgermedaille der Stadt München“,
- den Titel „Oberbaurat“ und
- zu seinem 40jährigen Dienstjubiläum den mit dem persönlichen Adel verbundenen „Kronenorden“, der ihm vom Prinzregenten Luitpold persönlich an die Brust geheftet wird.
7 1890 - „D'Münchner“ geben im „Bamberger Hof“ ein komisches Singspiel
München-Hackenviertel * Nach Buffalo Bills Gastspiel geben „D'Münchner“ im „Bamberger Hof“ das komische Singspiel „Biffola Bull“ oder „Der Indianerhäuptling 'Hau Wau' von Holzkirchen“.
23. 8 1890 - Die Instandsetzungsarbeiten an der Neuen Isarkaserne beginnen
München-Isarvorstadt * Die Instandsetzungsarbeiten an der Neuen Isarkaserne beginnen. Die Reparaturen sind bis zum Frühjahr 1893 abgeschlossen.
25. 8 1890 - Leonhard Romeis erhält den Verdienstorden vom heiligen Michael
München * Leonhard Romeis erhält den Verdienstorden vom heiligen Michael IV. Klasse. Anlass ist die Walhalla-Feier. Romeis hat den Sockel für eine von Ferdinand von Miller jun. gegossene Büste König Ludwigs I. entworfen.
30. 9 1890 - Das Sozialistengesetz läuft aus
Berlin * Das stets befristete Ausnahmegesetz „Gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ läuft aus. Reichskanzler Otto von Bismarck ist im März 1890 grollend abgetreten.
20. 11 1890 - Die Stadt Schwabing wird nach München eingemeindet
München-Schwabing * Die bislang selbstständige und mit einem eigenen Wappen versehene Stadt Schwabing wird mit den Gemeindeteilen Biederstein, Hirschau, Neuschwabing, Riesenfeld nach München eingemeindet.
4. 12 1890 - Die Riegermühle in der Au brennt ab
München-Au * Die Riegermühle in der Au brennt ab und wird nicht mehr aufgebaut.
31. 12 1890 - Der Bierverbrauch pro Kopf der Münchner beträgt 339 Liter
München * Der Export Münchner Bieres liegt bei 1.277.595 Hektoliter. Der Bierverbrauch pro Kopf der Münchner Bevölkerung beträgt 339 Liter.
1891 - „Papa Geis“ eröffnet den „Salvator-Anstich“ mit einer heiteren Ansprache
München-Au * Der populäre Volkssänger Jakob Geis, genannt „Papa Geis“, eröffnet erstmals vor einem „äußerst gewählten Herrenpublikum“ den „Salvator-Anstich“ auf dem „Nockherberg“ mit einer heiteren Ansprache.
1891 - Die Prinzregentenstraße wird angelegt.
München-Lehel - Bogenhausen - München-Haidhausen * Die Prinzregentenstraße wird angelegt.
1891 - Anton Azbé betreibt eine private „Mal- und Zeichenschule“
München-Schwabing - München-Maxvorstadt * Der „Maler“ und „Lehrer“ Anton Azbé betreibt in der Georgenstraße 16 und an der Amalienstraße 57 („Damenabteilung“) eine „Mal- und Zeichenschule“.
Einer seiner Schüler war Wassily Kandinsky.
1891 - Hubert Herkomer malt ein gewaltiges Gruppenbild
München-Lehel * Hubert Herkomer malt ein gewaltiges Gruppenbild mit dem Titel „Die Magistratssitzung“.
Es wird auf der ersten Ausstellung der „Münchner Secession“ gezeigt.
1891 - Eugen Allwein verkauft den Haidhauser „Kotterhof“
München-Haidhausen * Eugen Allwein verkauft den Haidhauser „Kotterhof“ an Sigmund und Rosalie Rottenkolber.
1891 - Die Marke „Kathreiner‘s Kneipp Malzkaffee“ wird patentiert
Berg am Laim * Die Marke „Kathreiner‘s Kneipp Malzkaffee“ wird patentiert.
Das Produkt steigt zum namhaftesten Markenartikel der deutschen Kaffeebranche auf.
1891 - Pastor Friedrich von Bodelschwingh gründet das „Brockenhaus“.
Bethel - Berlin * Der evangelische Pastor Friedrich von Bodelschwingh gründet in Bethel und Berlin ein sogenanntes „Brockenhaus“.
Mit dieser neuen Form einer Sozialeinrichtung will Bodelschwingh durch die Abholung und Verarbeitung schadhafter oder im Haushalt nicht mehr verwendeter Gegenstände arbeitslosen und erwerbsbeschränkten Personen Beschäftigung verschaffen und gleichzeitig Hilfsbedürftigen billige Gebrauchsgegenstände vermitteln.
Die Idee setzt sich rasch durch und schon bald darauf arbeiteten die „Brockenhäuser“ in allen größeren Städten Deutschlands.
1891 - Mitglieder des „Winzerer Fähndls“ beginnen mit dem „Armbrustschießen“
München * Mitglieder des „Winzerer Fähndls“ beginnen mit dem „Armbrustschießen“.
Sie nennen sich „Armbrustschützengilde des Winzerer Fähndls“.
Dabei war die „Armbrust“ - im Gegensatz zum „Spieß“, der „Hellebarde“ und dem „Bihänder“, dem zweihändig geführten „Schlachtschwert“, nie eine Landsknechtswaffe und gehörte damit eher in das städtische Wehrwesen.
Anders verhielt es sich bei der „Armbrust“ als Jagdwaffe.
Doch bei höfischen Jagdgesellschaften hatten Landsknechte nichts verloren.
1891 - Das Ausflugslokal in der „Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Über das zur „Schwabinger Brauerei“ gehörende Ausflugslokal in der „Hirschau“ heißt es:
„Diese Wirtschaft steht ganz abseits. Werktags kommen nur Maffei-Arbeiter zum Essen.
Die Gassenschänke ist nur für diese da.
Ohne Maffei wäre das Gasthaus nicht lebensfähig“.
1891 - In München wird der „Verein für Feuerbestattung” gegründet
München * In München wird der „Verein für Feuerbestattung” gegründet.
Er setzt sich für die „Einführung der Leichenverbrennung“ in München ein.
Der Magistrat steht dem Gedanken der „Feuerbestattung“ noch immer positiv gegenüber, doch für die „Errichtung eines Krematoriums“ benötigt man die Erlaubnis der bayerischen Staatsregierung.
Den Antrag dafür sollte deshalb der „Verein für Feuerbestattung“ stellen.
1891 - Der „Verband der süddeutschen katholischen Arbeitervereine“
München * Der „Verband der süddeutschen katholischen Arbeitervereine“ wird in München gegründet.
1891 - Das „Schlierseer Bauerntheater“ wird gegründet
Schliersee * Das „Schlierseer Bauerntheater“ wird gegründet.
1891 - Deutschland will seinen „Kolonialbesitz“ ausweiten
Berlin * Neben der „Deutschen Kolonialgesellschaft“ zählt bald auch der im Jahr 1891 gegründete, extrem nationalistische „Alldeutsche Verband“, dessen Programm stark von rassistischem und antisemitischem Gedankengut geprägt ist.
Nun versucht Deutschland durch den Erwerb weiterer „Handelsvertretungen“ seinen „Kolonialbesitz“ auszuweiten.
Im Vordergrund stehen jetzt aber Fragen des nationalen Prestiges und der Selbstbehauptung in einer „sozialdarwinistisch“ verstandenen Konkurrenz der Großmächte.
Denn Deutschland als „kolonialpolitischer Nachzügler“ muss den ihm zustehenden Anteil jetzt einfordern.
1891 - Der „Reichstag“ bewilligt finanzielle Mittel für „Strafaktionen“
Kamerun * Um den Widerstand der in Kamerun lebenden Völker zu brechen, bewilligt der „Reichstag“ finanzielle Mittel zum Aufbau einer bewaffneten „Streitmacht“, die die Interessen der deutschen Handelsgesellschaften durchsetzen sollen.
Die „Polizeitruppe“ für Kamerun wird vom „Premierleutnant“ Hans Dominik geleitet.
Er erhält mit seinen „Kriegszügen“ und den nachfolgenden „Straf- und Säuberungsaktionen“ den Namenszusatz „Schrecken von Kamerun“.
Dominiks Grundsatz lautet: „Die Neger müssen wissen, dass ich der Herr bin und der Stärkere; so lange sie das nicht glauben, müssen sie es eben fühlen, und zwar hart und unerbittlich, so dass ihnen für alle Zeiten das Auflehnen vergeht; ist das erreicht, dann kann man sie mit großer Freundlichkeit und Milde behandeln“.
2 1891 - Eine „Strafexpedition“ in Deutsch-Ostafrika kostet 200 Menschen das Leben
Deutsch-Ostafrika [= Tansania] * Hermann Wißmann leitet eine „Strafexpedition“ gegen den „Häuptling“ Sina von Kobisho, nachdem dieser es gewagt hatte, die deutsche Flagge vom Mast zu reißen.
Die „Strafexpedition“ kostet 200 Menschen das Leben.
Das „Offizierskorps“ ist eine „Brutstätte von Kolonialchauvins und nationalistischen, antidemokratischen Frondeuren. Mit Mord und Terror versuchen sie, die deutsche Herrschaft bis in die entferntesten Gebiete auszudehnen“.
20. 2 1891 - Der Dichter Stephan George lässt sich in München nieder
München-Schwabing * Der Dichter Stephan George lässt sich in München nieder. In Schwabing bildet sich um ihn der Kreis der „Kosmiker“.
3 1891 - Franz Stuck und der „Verein für Original-Radierung“
München * Franz Stuck ist Gründungsmitglied des „Vereins für Original-Radierung“ in München.
2. 4 1891 - Franz Stuck stellt im Münchner Kunstverein 200 Zeichnungen aus
<p><strong><em>München</em></strong> * Franz Stuck stellt im Münchner Kunstverein 200 Zeichnungen aus. </p>
9. 5 1891 - Die Münchener Gasgesellschaft unterzeichnet einen Ablösungsvertrag
München * Die Private Münchener Gasgesellschaft, die das Beleuchtungsmonopol in München bis zum Jahr 1899 besitzt, unterzeichnet einen Ablösungsvertrag. Dadurch kann die Stadtgemeinde eine Kraftanlage zur Erzeugung von Strom aufbauen.
1. 6 1891 - Das Gewerbegerichtsgesetz tritt in Kraft
München * Das Gewerbegerichtsgesetz tritt in Kraft. In ihm ist festgelegt,
- dass Arbeitsstreitigkeiten vor einem Gewerbegericht ausgehandelt werden können.
- Zudem verbietet es die Sonntagsarbeit und regelt die Kinderarbeit.
1. 6 1891 - Weitere Verbesserungen für Kinderarbeiter in Fabriken
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Nach einer weiteren Änderung der Reichsgewerbeordnung wird </p> <ul> <li>das Mindestalter von Fabrikarbeitern auf 13 Jahre erhöht und </li> <li>die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in Fabriken grundsätzlich verboten. </li> </ul>
1. 7 1891 - Eine Richtlinie zur richtigen Entsorgung des Mülls
München - München-Giesing * „Innerhalb der Anwesen bzw. Grundstücke sich ansammelnder Unrat“ darf nicht mehr in Gruben gelagert, sondern ist „in dichten - Feuerungsreste und Asche überdies in metallenen - mit Deckel versehenen Behältern aufzubewahren [...] und zur Abfuhr bereitzuhalten“.
Der Müll wird zweimal in der Woche abgeholt. Alle, die im Einzugsgebiet wohnen, müssen bei der neumodischen Müllabfuhr mitmachen und dafür Gebühren zahlen. Die außerhalb des Anschlussgebiets weiterhin benutzten Gruben müssen nun mindestens zweimal jährlich geleert werden.
Bald nach Erlass der Richtlinie von 1891 konstruiert ein Schmiedemeister aus Giesing namens Fischer einen Sammelwagen, den er patentieren lässt. Der Wagen ist einachsig, wird von einem Pferd gezogen, kann nach unten entleert werden und fasst 2,85 Kubikmeter Unrat. Er bekommt den etwas eigenartigen Namen „Harritsch“. Diese Namensgebung soll vom englischen carriage für Wagen, in das eher bayerische Harritsch umgewandelt worden sein. Auch diese Unrat-Sammelgefäße sind normiert.
1. 7 1891 - Georg von Vollmar (SPD) hält seine sogenannten Eldorado-Reden
München * Der bayerische Sozialdemokrat Georg Heinrich von Vollmar hält am 1. und am 6. Juli seine sogenannten „Eldorado-Reden“ [so genannt nach dem Lokal]. Nach dem Auslaufen der „Sozialistengesetze“ - so Vollmar - könne man „den Weg der Verhandlungen betreten und versuchen, auf der Grundlage der heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung Verbesserungen wirtschaftlich und politischer Art herbeizuführen“. Die Idee, eine gewaltsame soziale Revolution sei unvermeidlich, ist damit ebenso aufgegeben wie die Theorie von Karl Marx. Außerhalb Bayerns werden Vollmars Ansichten nur wenig akzeptiert.
9 1891 - Manche Wiesn-Wirte führen den „Ein-Liter-Glaskrüge“ ein
München-Theresienwiese * Manche Wiesn-Wirte führen den „Ein-Liter-Glaskrüge“ ein.
1. 9 1891 - Arnold Ritter von Zenetti stirbt im Alter von 67 Jahren
München * Arnold Ritter von Zenetti stirbt im Alter von 67 Jahren in München. Seine Grabstelle befindet sich im Alten südlichen Friedhof.
8. 9 1891 - Kaiser Wilhelm II. besucht die Stadt München
München-Graggenau * Kaiser Wilhelm II. besucht - verkleidet in der Uniform seines bayerischen Ulanenregiments - die Stadt München. Im Neuen Rathaus trägt er sich mit den Worten „Suprema lex regis voluntas“ [= Das höchste Gesetz ist der Wille des Königs] ins Goldene Buch der Stadt ein. Der mit einer Adlerfeder geschriebene - völlig unzeitgemäße - Satz erregt bei vielen Bayern Ärger.
10 1891 - Der Mordprozess gegen das Berliner Ehepaar Heinze beginnt
Berlin * Der Mordprozess gegen das Berliner Ehepaar Heinze beginnt.
In der Verhandlung wird der Zusammenhang mit „Kuppelei“ und „Prostitution“ hergestellt.
Daraus schließt man, dass „Obszönität“ eine der Hauptursache für kriminelles und von der Norm abweichendes Verhalten sei.
1. 11 1891 - Evangelische Klassen in der Alten Schlossschule
München-Haidhausen * Die evangelischen ABC-Schützen aus Haidhausen können je eine erste und zweite Klasse im Alten Schloßschulhaus bilden.
1. 11 1891 - Die Prinzregent-Luitpold-Terrasse wird der Öffentlichkeit übergeben
Bogenhausen - München-Haidhausen * Die Prinzregent-Luitpold-Terrasse am Standort des späteren Friedensengels wird der Öffentlichkeit übergeben.
12 1891 - Die erste antisemitische Gesellschaft in München gegründet
München * Mit dem „Deutsch-Sozialen-Verein“ wird in München erstmals eine antisemitische Gesellschaft gegründet.
Er fordert unter anderem die „Aufhebung des Emanzipationsgesetzes von 1869“, das die jüdische Bevölkerung erstmals offiziell vor dem Gesetz gleichstellt.
Darüber hinaus die „Beschränkung der Gewerbefreiheit“, die „Einführung von Befähigungsnachweisen“ sowie ein „Verbot der neuen, die Existenz der ortsansässigen Detailhändler und des heimischen Handwerks bedrohende Verkaufsformen“, worunter in erster Linie die gerade aufkommenden „Warenhäuser“ gemeint sind.
8. 12 1891 - Der Katholische Arbeiterverein München-Au-Giesing wird gegründet
München-Au * Im Falkenhof in der Au wird der Katholische Arbeiterverein München-Au-Giesing gegründet.
31. 12 1891 - In München gibt es erst 34 Cafès
München * In München gibt es erst 34 Cafès.
1892 - Valentin Ludwig Fey geht in die rein protestantische „Herrn-Schule“
München-Au - München-Graggenau * Valentin Ludwig Fey wechselt in die rein protestantische „Schule an der Herrnstraße“ über.
Den Schulbesuch empfindet er als „Siebenjährige Zuchthausstrafe“.
1892 - Der „Chinesische Teesalon“ in der Burgstraße 16
München-Graggenau * Die Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“ eröffnet in ihrem Stammhaus an der Burgstraße 16 einen „Chinesischen Teesalon“.
1892 - Carl Gabriel kommt nach München
München * Carl Gabriel kommt nach München.
1892 - Die „Münchner-Kindl-Brauerei“ nennt ihren Gerstensaft „Wiesn-Bier“
München-Au * Die „Münchner-Kindl-Brauerei“ nennt ihren Gerstensaft „Wiesn-Bier“.
Ab 1892 - Konrad Dreher und sein „Schlierseer Bauerntheater“
Schliersee * Der Münchner Schauspieler und Komiker Konrad Dreher ist mit seinem „Schlierseer Bauerntheater“ häufig unterwegs.
1892 - Der „Giesinger Berg“ wird reguliert
München-Obergiesing * Der „Giesinger Berg“ wird reguliert.
Dadurch entsteht um die Kirche herum eine Terrassenanlage, die den Turm am Giesinger Berg wie ein Wahrzeichen erscheinen lässt.
1892 - Almon B. Strowger installiert die erste „Vermittlungsstelle“ der Welt
La Porte * Die „Strowger Automatic Telephone Exchange Company“ installiert in La Porte, Indiana, die erste „Vermittlungsstelle“ der Welt.
Weil Almon B. Strowger mit der „Bell Telephone Company“ in Amerika nicht so recht ins Geschäft kommen kann, konzentriert er sich auf den Export.
1. 1 1892 - Bogenhausen wird nach München eingemeindet
München-Bogenhausen * Die bis dahin selbstständige Gemeinde Bogenhausen wird mit den Gemeindeteilen Brunnthal, Neuberghausen und Priel mit seinen 1.570 Einwohner auf 441 Hektar nach München eingemeindet.
26. 1 1892 - Herzogin Ludowica Wilhelmine in Bayern stirbt im Alter von 84 Jahren
München * Herzogin Ludowica Wilhelmine in Bayern stirbt im Alter von 84 Jahren. Ihre Grabstätte befindet sich in der Gruft von Schloss Tegernsee. Ihr jüngster Sohn, Herzog Max Emanuel in Bayern, erbt Schloss Biederstein.
30. 1 1892 - Franz von Lenbachs Tochter Marion kommt zur Welt
München * Franz von Lenbachs Tochter Marion kommt zur Welt.
Um 2 1892 - Ernst Philipp Fleischer erhält eine Professur in Berlin
Berlin * Ernst Philipp Fleischer erhält für das Panoramengemälde „200 Jahre aus der Geschichte der Hohenzollern“ in Berlin den Professorentitel.
29. 2 1892 - Gründung des „Vereins Bildender Künstler Münchens e.V. - Secession“
München * Im Atelier des 29-jährigen Josef Block kommt es zu einem Treffen von elf Künstlern und Kunstprofessoren. Sie gründen einen neuen Verein und verfassen ein Pamphlet, in dem es heißt:
„Die heute versammelten haben sich als Club zur Verfolgung derjenigen Maßregeln constituirt, welche ihrer Überzeugung nach im Interesse der münchner Kunst unabhängig von der münchner Künstlergenossenschaft erforderlich sind.“ Sie begründen damit den späteren Verein Bildender Künstler Münchens e.V. - Secession.
Unterzeichnet ist das Papier von Josef Block und dessen Professor Bruno Piglhein sowie den Professoren Fritz von Uhde, Hugo Freiherr von Habermann und Paul Hoecker. Außerdem von Franz Stuck, Heinrich Zügel, Gotthardt Kuehl, Victor Weishaupt, Ludwig Dill und Otto Hierl-Doronco.
Sieben der elf Unterzeichner des Ursprungspamphlets haben während der Münchner Jahresausstellungen relevante Funktionen ausgeführt.
- Habermann, Hoecker, Piglhein, Uhde und Weishaupt gehörten der Vierzehner-Commission an.
- Mitglieder in der 1889er-Jury waren Dill, Habermann, Hoecker, Piglhein und Weishaupt.
- Franz Stuck und Fritz von Uhde waren Mitglieder der 1891er-Jury.
3 1892 - Zahlreiche Behörden ziehen in die „Alte Isarkaserne“
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Die „Garnisonsverwaltung“ zieht von der „Alten Isarkaserne“ auf der „Kohleninsel“ nach Neuhausen.
Damit beginnt die Übergabe des Geländes an die Stadt München.
Diese quartiert in der ehemaligen Kaserne zahlreiche Behörden ein:
- die „städtische Desinfektionsanstalt“,
- die „Inspektion für Blitzableiteranlagen“,
- das „polizeiliche Krankenträgerinstitut“,
- den „Sanitätsverband“,
- die „Lehrwerkstätten des Volksbildungsvereins“ und
- die „Berufsschule für Friseure“.
3 1892 - „Es müßte ein Festspielhaus für das Volk werden, ...“
München * Im März 1892 hält „Generalintendant“ Carl von Perfall einen Vortrag zum Thema „Festspielhaus“ vor den Bürgermeistern der Landeshauptstadt München.
In dieser Rede sagt er unter anderem: „Welch eine große That für die Kunst wäre es, welch eine ruhmreiche Zierde für die Kunststadt München, welch eine neu sich erschließende enorme Geldquelle für die Stadt, wenn die Prinz-Regenten-Straße ihren Abschluß durch Erbauung eines Kunsttempels fände!
Es müßte ein Festspielhaus für das Volk werden, das die verschiedenen Kunstrichtungen von Bayreuth, Salzburg und Worms in sich vereinigte, dessen Pforten im Gegensatz zu Bayreuth jedem aus dem Volke um ein im Verhältnis geringes Entgelt sich eröffneten“.
1. 5 1892 - Im „Münchner-Kindl-Keller“ treffen sich über 5.000 Arbeiter
München-Au * Im „Münchner-Kindl-Keller“ treffen sich über 5.000 Arbeiter zur „1.-Mai-Feier“.
Die Anwesenden stellen die Forderungen nach „Verkürzung der Arbeitszeit“ und zum „Arbeitsschutz“.
7 1892 - Kurt Eisner heiratet die Protestantin Lisbeth Hendrich
Eberswalde * Kurt Eisner heiratet in Eberswalde - gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Eltern - die Protestantin Lisbeth Hendrich.
9 1892 - Kein Bierausschank wegen fehlender Toiletten
München-Theresienwiese * Wegen fehlender Toiletten darf der „Ochsenbrater“ Johann Rössler kein Bier ausschenken.
Und weil Ochs‘ ohne Bier in München gar nicht geht, erleidet Rössler einen geschäftlichen Misserfolg.
22. 10 1892 - Die Anna-Basilik ist die neue Pfarrkirche des Lehels
München-Lehel * Mit der Einweihung der neuen Anna-Basilika wird die alte Anna-Kirche nur mehr Franziskaner-Klosterkirche. Die Vorstadtbasilika ist nun die Pfarrkirche des Lehels.
6. 11 1892 - Der Bayerische Kanalverein wird gegründet
Nürnberg * In Nürnberg wird aufgrund der Initiative des Prinzen Ludwig [III.] der Verein zur Hebung der Fluss- und Kanalschifffahrt in Bayern - kurz Bayerischer Kanalverein - gegründet.
12. 12 1892 - Elisabeth Wellano - alias Liesl Karlstadt - wird geboren
München * Elisabeth Wellano, die spätere Liesl Karlstadt, wird als Fünftes von 9 Kindern geboren.
27. 12 1892 - In Toulon wird die Französisch-Russische Allianz geschlossen
Toulon * In Toulon wird die Französisch-Russische Allianz geschlossen.
31. 12 1892 - 177 Beschäftigte bei der Firma Franz Kathreiner‘s Nachfolger
Berg am Laim * Die Zahl der Beschäftigten der Firma Franz Kathreiner‘s Nachfolger ist auf 177 angewachsen.
31. 12 1892 - Die Zahl der Cafès hat sich bereits auf 84 erhöht
München * Die Zahl der Cafès hat sich bereits auf 84 erhöht. Das Wachstum hält bis kurz vor die Jahrhundertwende an. Nicht ohne Grund melden die Münchner Neuesten Nachrichten: „Cafés schießen wie Pilze aus dem Boden.“
1893 - Das „Brunnhaus auf der Kalkofeninsel“ wird ein Elektrizitätswerk
München-Haidhausen * Das „Brunnhaus auf der Kalkofeninsel“ wird zu Münchens erstem Elektrizitätswerk umgebaut.
Die dazu notwendige Energie liefert der Auer Mühlbach.
1893 - Der „Ziegenmilchmarkt am Freibankeck“
München-Angerviertel - Viktualienmarkt * Eine Münchner Zeitung beschreibt unter dem Titel „Kuranstalt“ den „Ziegenmilchmarkt am Freibankeck“ mit nachstehenden Zeilen:
„Knapp an der nördlichen Schrannenhalle stellen sich frühmorgens einige Frauen mit etwa zwei Dutzend Ziegen ein und verzapfen brühwarme Ziegenmilch an die leidende Menschheit“.
1893 - Graf Adolf Friedrich von Schack vermacht Berlin seine Sammlung
München-Maxvorstadt * In der letzten Fassung seines Testaments geht Graf von Schack davon aus, dass seine Sammlung nach seinem Tod nach Berlin überführt wird.
Er billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.
1893 - Patentschutz für die Schärfl'sche „Hebelblechschere“
München-Haidhausen * Der „Schlossermeister“ Andreas Schärfl erhält für seine Erfindung einer „Hebelblechschere“ Patentschutz unter der Nummer 77960.
1893 - Die „Ochsenbraterei“ soll eine Bierbude bauen
München-Theresienwiese * Der Magistrat der Stadt teilt Johann Rössler von der „Ochsenbraterei“ mit, dass er für eine Ausschankgenehmigung eine Bierbude bauen müsse.
Dafür fehlt dem „Metzgermeister“ aber das Geld.
1893 - Die „Armbrustschützengilde des Winzerer Fähndls“ in Landshut
Landshut * Einem größeren Publikum wird die „Armbrustschützengilde des Winzerer Fähndls“ erstmals beim „II. Niederbayerischen Bundesschießen“ in Landshut vorgeführt.
1893 - Die amerikanische Tänzerin Loïe Fuller tritt erstmals in München auf
München * Die amerikanische Tänzerin Loïe Fuller tritt mit ihrem „Serpentinentanz“ erstmals in München auf.
1893 - Im „Café Luitpold“ wird ein „Anthropologisches Museum“ eröffnet
München-Maxvorstadt * Im „Café Luitpold“ in der Brienner Straße wird ein „Panoptikum und Anthropologisches Museum“ eröffnet.
1893 - Alois Wolfmüller beschäftigt sich intensiv mit den Motorproblemen
Landsberg * Alois Wolfmüller beschäftigt sich in seiner Geburtsstadt Landsberg intensiv mit den Motorproblemen.
Beim Lesen der Zeitschrift „Radfahr-Humor und Radfahr-Chronik“ wird der Ingenieur auf den Münchner „Chefredakteur und Sportjournalisten“ aufmerksam. Es kommt zu einer geschäftlichen Vereinbarung zwischen Alois Wolfmüller und Heinrich Hildebrand.
Unter Mithilfe seines Jugendfreundes aus Landsberg, des Ingenieurs Hans Geisenhof, entstehen die ersten Modelle. Die „Tüftler“ mieten dafür den „Stadel“ des „Unterzehetmayrhofes“ in der Münchner Straße 133 in Unterföhring an und bringen dort den neuartigen Motor zum Laufen. Doch bei den ersten Fahrversuchen „zeigte das Vehikel eine Neigung zum Krebsgang“, wie es Alois Wolfmüller ausdrückt. Das heißt, dass das Gefährt rückwärts läuft. Als er wenige Tage später vorwärts lief, ist die Beschleunigung so groß, dass der Motor abgestellt werden muss und danach einfach nicht mehr anspringen will. Die „Zündung“ ist eines der noch nicht gelösten Probleme.
Die Polizei untersagt zeitweise alle Fahrversuche, da wegen „der großen Schnelligkeit die Leute auf dem Trottoir (...) einen Nervenschock bekommen“ könnten. Alois Wolfmüllers Ansuchen, sein „Motorrad“ auf dem Hauptplatz in Landsberg erproben und vorführen zu dürfen, wird abgelehnt, da man alles absperren und sämtliche Vierbeiner, vor allem Pferde und Kühe, aus der Stadt verbannen müsste, da keines dieser Tiere je ein mit einem Verbrennungsmotor angetriebenes Fahrzeug gehört, gerochen oder gesehen habe.
Nachdem das Motorrad seine erste „Einhundert-Kilometer-Strecke“ bestanden hat, reichen die Konstrukteure das „Patent“ für ihr „Zweirad mit Petroleum- oder Benzinmotorbetrieb“ ein.
1893 - Radrennfahrer Josef Fischer gewinnt ein Rennen gegen das „Traberpferd“
München-Untergiesing * Josef Fischer gewinnt auf dem „Schyrenplatz“ ein Rennen über viertausend Meter gegen das „Traberpferd Flora I.“ in 6 Minuten 47 Sekunden.
Der „Dauerradfahrer“ hat dabei einen Vorsprung von 5,4 Sekunden.
1893 - Franz Stuck wird zum Professor ernannt
München * Franz Stuck wird zum Professor ernannt.
Bis zum Jahr 1893 - Bis dahin ist das „Fräulein vom Amt“ ist ein Mann
Deutsches Reich * Bis dahin ist das „Fräulein vom Amt“ ist ein Mann.
Erst ab jetzt wird verstärkt weibliches Personal für den „Fernsprechdienst“ eingestellt.
Aufgrund der steigenden Nachfrage bei den Telefonanschlüssen ist die Einstellung von Frauen ein betriebswirtschaftlicher Faktor, da die Lohnkosten der weiblichen Vermittlungskräfte um über 25 Prozent unter denen ihrer männlichen Kollegen liegen.
1893 - „Den Ruf als Bierstadt büaß ma ein, ...“
München-Lehel * Aus Anlass der Eröffnung des „Café Prinzregent“ - in der Prinzregentenstraße 4 - dichtete ein namentlich nicht überlieferter Münchner „Volkssänger“ folgende Zeilen:
Jetzt werd, wohin man schaut,
Kaffeehaus um Kaffeehaus baut.
Den Ruf als Bierstadt büaß ma ein,
bald wern ma a Kaffeestadt sein!
Und tatsächlich genossen die „Cafés“ in München bis zum Ersten Weltkrieg einen hohen Stellenwert im gesellschaftlichen Leben.
1893 - Der Innenraum der „Anna-Klosterkirche“ erhält einige Umgestaltungen
München-Lehel * Der Innenraum der „Anna-Klosterkirche“ erhält einige Umgestaltungen im Sinne des an die „Nazarenerkunst“ orientierten Zeitgeschmacks.
Dabei gehen wertvolle Altarblätter von Cosmas Damian Asam für immer verloren.
20. 4 1893 - Johann Reichhart kommt in Tiefenthal zur Welt
<p><strong><em>Tiefenthal</em></strong> * Der spätere Scharfrichter Johann Reichhart kommt in Tiefenthal im Landkreis Regensburg zur Welt. Sein Vater besitzt eine kleine Landwirtschaft und ist im Nebenerwerb Wasenmeister. </p>
12. 6 1893 - Herzog Max Emanuel in Bayern stirbt im Alter von 43 Jahren
München - München-Schwabing * Herzog Max Emanuel in Bayern stirbt im Alter von 43 Jahren. Schloss Biederstein erbt seine Gemahlin Amalie.
15. 6 1893 - Bei der Reichstagswahl sind über 106.800 Münchner wahlberechtigt
München - Deutsches Reich - Berlin * Bei der Reichstagswahl des Jahres 1893 sind über 106.800 Münchner Männer wahlberechtigt.
- Den Wahlkreis München I (Altstadt, Lehel, Maxvorstadt) gewinnt Georg Birk [SPD],
- der Wahlkreis München II (Isarvorstadt, Ludwigsvorstadt, Au, Haidhausen, Giesing), München-Land, Starnberg, Wolfratshausen, wird von Georg von Vollmar [SPD] erobert.
22. 6 1893 - Forderungen nach weiteren evangelischen Klassen
München-Haidhausen * Der protestantische Kirchenbauverein wendet sich an die Lokalschulkommission, um eine dritte und vierte evangelische Klasse in Haidhausen zu errichten.
7 1893 - Der „XIV. Deutsche Feuerwehrtag“ findet in München statt
München * Der „XIV. Deutsche Feuerwehrtag“ findet in München statt.
Aus diesem Anlass präsentiert sich die „Münchner Feuerwehr“ auf dem Marsplatz mit all ihren Geräten und Fahrzeugen.
In der „Schrannenhalle“ gibt es einen überblick über die neueste Fahr- und Gerätetechnik zu sehen.
12. 7 1893 - In Bayern finden Landtagswahlen statt
Königreich Bayern * Bei der Neuwahl zum Bayerischen Landtag können zwei neue Parteien in die Abgeordnetenkammer einziehen.
- Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD erhält fünf Mandate,
- der Bayerische Bauernbund - BBB stellt sogar neun Abgeordnete.
- Das Zentrum, das aus der Patriotischen Partei hervorgegangen ist, verfügt nur noch über 74 Mandate.
Aufgrund der unterschiedlichen Bestimmungen in Reich, Land und Stadt sind
- bei der Landtagswahl 56.100, hingegen
- bei der Reichstagswahl 106.800, und
- bei der Kommunalwahl aber nur 19.292 Münchner wahlberechtigt.
Um 8 1893 - Cosima Wagner macht Ärger
München - Bayreuth * Carl von Perfalls Nachfolger, der im Jahr 1893 zum „Generaldirektor“ ernannte Ernst von Possart, organisiert sofort nach seinem Amtsantritt fünfundzwanzig „Musteraufführungen“ der Werke Richard Wagners.
Er will damit Bayreuth ganz bewusst eine künstlerische Konkurrenz erwachsen lassen.
Das ruft umgehend Cosima Wagner, die Witwe des Komponisten und selbst ernannte „Gralshüterin von Bayreuth“, auf den Plan. Frau Wagner sieht in dem Münchner Theater natürlich nicht nur das Erbe Bayreuths gefährdet, sondern auch ihren eigenen Plan, mithilfe „deutscher Bundesfürsten“ ein zweites, größeres „Richard-Wagner-Festspielhaus“ zu erbauen, bedroht.
Sie macht Ärger und bezeichnet die „Münchner Festspiele“ als „eine Affenfratze unseres ernsten mühseligen Strebens. Alles Lüge und Hohlheit [...] Es ist ein Treiben an Stelle des Strebens. Der Schacher an Stelle des Dienstes“.
8 1893 - Der „Wachsplastiker“ Emil Eduard Hammer beantragt ein „Panoptikum“
München * Der „Wachsplastiker“ Emil Eduard Hammer stellt bei der „Königlich Bayerischen Polizeidirektion München“ ein „Gesuch um die ortspolizeiliche Erlaubnis zur Einrichtung und Betrieb eines Panoptikums“.
Noch im selben Monat erhält er die Genehmigung.
3. 8 1893 - Fahrradkarten werden ausgegeben
München * Fahrradkarten werden ausgegeben.
- Radfahrer müssen am Lenker ein Nummernschild anbringen.
- Kinder unter dreizehn Jahren dürfen überhaupt nicht radeln,
- Jugendliche zwischen dreizehn und achtzehn Jahren sowie
- Frauen dürfen nur dann den Radschein erwerben, wenn der Vater, der Vormund oder der Ehemann bei der Polizei seine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben hat.
Im Nebenraum eines Wirtshauses können sie dann den Betrieb des Fahrzeugs erlernen und sich anschließend einer Prüfung unterziehen.
28. 9 1893 - Der 32. Landtag beginnt
München-Kreuzviertel * Der 32. Landtag dauert vom 28. September 1893 bis zum 10. Juni 1899.
Ab 10 1893 - Die antisemitische Aktion „Kauft nicht bei Juden“
München * Im „Deutschen Volksblatt“ wird die von den Antisemiten propagierte Aktion „Kauft nicht bei Juden“ mit dem Abdruck einer Liste jüdischer Geschäftsinhaber in München begleitet.
Ziel ist dabei der Boykott der jüdischen Geschäfte durch die „christlichen Konsumenten“.
7. 10 1893 - Das Haberfeldtreiben von Miesbach gleicht einer Schlacht
Miesbach * Das letzte Haberfeldtreiben von Bedeutung findet in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1893 im oberbayerischen Miesbach statt. Es soll „eine großartige Manifestation des Haberertums gegen die auf Beseitigung des Brauches gerichteten Bestrebungen der geistlichen und weltlichen Behörden“ werden.
Den 300 bis 350 Haberern stehen lediglich 22 „Schandarm“ gegenüber. Es kommt zu einer Schießerei, bei der dem Gendarmen Würdinger in die Hoden geschossen wird. Auch ein Haberer trägt eine Oberschenkelverletzung davon. Das Haberfeldtreiben gleicht dadurch einer Schlacht.
9. 11 1893 - Ein monumentaler Brunnen am Weißenburger Platz als Sieges-Monument
München-Haidhausen * Der aus Haidhausen stammende Gemeindebevollmächtigte Anton Forster schlägt „Zum Gedenken an die 25. Wiederkehr der glorreichen Siege von 1870/71“ einen monumentalen Brunnen am Weißenburger Platz vor.
Sein Antrag wird am 1. März 1894 genehmigt und anschließend ein Künstler-Wettbewerb ausgeschrieben. Aus diesem Vorschlag entsteht letztlich der Friedensengel.
22. 11 1893 - Reinhart Eisner wird in Marburg geboren
Marburg * Reinhart Eisner, Sohn von Kurt Eisner und seiner ersten Ehefrau Lisbeth, geb. Hendrich, kommt in Marburg zur Welt. Das Kind gehört keiner Konfession an.
1. 12 1893 - Ernst Toller wird in Samotschin/Posen geboren
Samotschin/Posen * Ernst Toller wird in Samotschin/Posen geboren.
2. 12 1893 - Emil Karl Maenner wird in München geboren
München * Emil Karl Maenner wird in München geboren.
5. 12 1893 - Nur 19.292 Münchner haben das Wahlrecht für die Stadtratswahl
München * Kommunalwahl: Von den rund 380.800 Einwohner Münchens haben gerade einmal 19.292 das Wahlrecht für die Stadtratswahl. Die Wahlberechtigten setzen sich vor allem Haus- und Grundbesitzern, selbstständigen Handwerkern, Geschäftsleuten und Industriellen zusammen.
- Nur der darf wählen, der das (gebührenpflichtige) Bürgerrecht besitzt.
- Voraussetzung dafür sind unter anderem der Besitz des Heimatrechts, ein ständiger Wohnsitz in München, die Entrichtung von Steuern sowie Unbescholtenheit und Volljährigkeit.
- Tagelöhner, Handwerksgesellen, kleine Gewerbetreibende und Frauen sind vom politischen Leben nahezu ausgeschlossen.
Trotzdem kann Georg Birk als erster Sozialdemokrat in das Gemeindekollegium einziehen.
31. 12 1893 - Der Englische Garten umfasst 272,40 Hektar
München-Englischer Garten * Der Englische Garten umfasst 272,40 Hektar.
31. 12 1893 - Zwölf Bicycle-und Velozipedisten-Clubs
München * Das Münchner Stadtadressbuch verzeichnet zwölf Bicycle-und Velozipedisten-Clubs sowie sieben Veloziped-Fahrschulen.
1894 - Das „Warenzeichengesetz“ tritt in Kraft
Berlin * Das „Warenzeichengesetz“ tritt in Kraft.
1894 - Ein „Stadtpalais“ für Prinz Friedrich von Hohenzollern
München-Bogenhausen * Die Villa an der Maria-Theresia-Straße 17 wird als „Stadtpalais“ für Prinz Friedrich von Hohenzollern gebaut.
1894 - Das „Feuer- und Spritzenhaus“ und das „Tröpferlbad“ wird eröffnet
München-Haidhausen * Das „Feuer- und Spritzenhaus“ wird gemeinsam mit dem „Brause- und Wannenbad“ an der Schloss-/ Ecke Kirchenstraße eröffnet.
1894 - Das „städtische Wehramt“ zieht auf die „Kohleninsel“
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Das „Städtische Wehramt“, das zuvor im Rathaus untergebracht war, zieht auf die „Kohleninsel“.
Die Musterung der Wehrpflichtigen findet anfangs noch in der „Schrannenhalle“ statt, weshalb die notwendigen Akten jedes Mal vom „Wehramt“ zum Musterungslokal und danach wieder zurückgebracht werden müssen.
Das war nicht ganz ungefährlich, wie nachstehender Bericht beweist: „[...] bei einem solchen Transport [hat] ein Windstoß eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Stammrollen entführt und den grünen Fluten der Isar zugetragen, die sie nicht mehr herausgab“.
1894 - Die „Firma Andreas Schärfl“ zieht in die Kellerstraße 27/Steinstraße 50
München-Haidhausen * Die „Firma Andreas Schärfl“ zieht in die Gebäude der ehemaligen „Brückenwaagenfabrik Greiner“ in der Kellerstraße 27 und Steinstraße 50.
1894 - Zwei Kegelbahnen für das Ausflugslokal in der „Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Der Pächter des Ausflugslokals in der „Hirschau“ bittet den Magistrat um Genehmigung von zwei Kegelbahnen, „um auch Normalpublikum in mein Etablissement zu bekommen“.
Sie werden genehmigt.
1894 - Eduard Theodor Grützner in der Pfaffen-Falle
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützner schreibt: „Daß ich immer und immer wieder Pfaffen male, daran trage ich die Schuld nur zum kleineren Theile.
Bei jeder Ausstellung fast heißt es: 'Aber Pfaffen müssen's sein oder doch wenigstens einige davon darunter sein!' Male ich etwas anderes, sagen die Leute: 'Es ist kein echter Grützner'. Was ist da zu thun?!“
Tatsächlich kommen in mehr als Dreiviertel seiner Werke Klosterbrüder vor.
Daneben gibt es aber auch Jägerszenen, solche mit dem schier unverwüstlichen Sir John Falstaff sowie Bilder aus dem Theaterleben.
1894 - Der Münchner „Radrennfahrer“ Josef Fischer besiegt seine Gegner
München * Der Münchner „Radrennfahrer“ Josef Fischer besiegt seine Gegner bei der „Fernfahrt Mailand - München“ souverän und machte sich damit einen internationalen Namen, sodass er sich an den ersten Rennen der „Tour de France“ beteiligen kann.
1894 - Der Bildhauer Matthias Gasteiger schenkt München das „Brunnenbuberl“
München-Kreuzviertel * Der Bildhauer Matthias Gasteiger schenkt seiner Heimatstadt die „Brunnengruppe Satyrherme & Knabe“, die im Volksmund als „Brunnenbuberl“ bezeichnet wird.
Es ist sein berühmtestes Werk, für das er 1892 im „Glaspalast“ eine Goldmedaille erhalten hatte und für das er weitere Auszeichnungen in Berlin und Wien bekam, wo er sogar das „besondere Wohlgefallen“ des „Österreichischen Erzherzogs“ fand.
Das Kunstwerk zeigt einen Knaben und eine Satyrherme. Während das „Buberl“ spielerisch das Rohr an der Herme zuhält, spritzt aus dem Mund des „Satyrn“ ein Wasserstrahl auf den Kopf des Jungen.
Und obwohl die Münchner Kunstkritiker Matthias Gasteigs Werk als „prächtige Bereicherung“ Münchens bezeichnen, haben die Münchner Stadtväter große Probleme mit dem nackten Buberl.
1894 - Die „Münchner Bäcker-Innung“ kauft dIe „Giesinger Mühle“
München-Untergiesing * Die „Giesinger Mühle“ gehört der „Münchner Bäcker-Innung“, deshalb der Name „Bäcker-Kunstmühle“.
Sie kauft die Mühle „mit allem lebenden und toten Inventar“ für 482.000 Mark. Nach umfangreichen Umbauarbeiten kann die Mühle noch im gleichen Jahr als „Bäcker-Kunstmühle der Bäcker-Innung München“ eröffnet werden.
Die Wasserkraft des „Auer Mühlbachs“ erzeugt hier 200 PS. Die Turbine wird circa 50.000 Stunden im Jahr betrieben. Der Elektromotor leistet 50 PS und läuft an etwa 1.500 Stunden im Jahr.
In dem vollautomatischen Mahlbetrieb gibt es zwei getrennte Mahlsysteme, in denen 2.995 Tonnen Roggen und 6.412 Tonnen Weizen, also eine Gesamtleistung von 9.407 Tonnen im Jahr, gemahlen werden können.
1894 - In Paris wird Thomas Alpha Edisons „Kinetoscope“ vorgestellt
Paris * In Paris wird Thomas Alpha Edisons „Kinetoscope“ vorgestellt.
Das Bild hat eine sehr geringe Größe und muss in einem Kasten betrachtet werden.
1894 - Für die neue „Heilig-Kreuz-Kirche“ wird ein Pfarrhof erbaut
München-Obergiesing * Für die neue „Heilig-Kreuz-Kirche“ wird an der Gietlstraße ein neuer Pfarrhof erbaut, da das alte Pfarrhofgebäude wegen der Regulierung des „Giesinger Berges“ abgebrochen werden musste.
Der nach den Plänen des damaligen Bauamtmanns und späteren Professors an der „TH München“, Carl Hocheder, errichtete Pfarrhof „enthält im Erdgeschoß die Geschäftsräume, im ersten Stock die Wohnung des Stadtpfarrers, in einem vollständig ausgebauten Dachgeschoss die Wohnräume der Hilfsgeistlichen.
Im Nebengebäude sind Waschküche und Holzlege untergebracht“.
1894 - Das „Deutsche Theater“ entsteht als Spekulationsobjekt
München-Ludwigsvorstadt * Der geschäftstüchtige Münchner „Kommerzienrat“ Friedrich Haenle, der mit der Herstellung von Silberbeschlägen reich geworden ist, besitzt an der Schwanthalerstraße ein 5.400 Quadratmeter großes Grundstück.
Dieses will er gewinnbringend veredeln und sein Geld mit einem weiteren Projekt vermehren.
Zusammen mit dem aus Frankreich stammenden Architekten Alexander Bluhm, der auch als „Konzessionär“ verantwortlich zeichnet, baut er ein Theater für „Aufführungen von Schauspiel, Lustspiel, Schwank und Ballett“.
Und wer mit einem „Unterhaltungspalast“ sein Geld verdienen möchte, darf „nicht knausern“.
Die Beiden lassen es also krachen und setzen auf „mondänen Luxus“, sodass die „Münchner Fremdenzeitung“ über die ehrgeizige Ausstattung euphorisch jubiliert:
„Überall ist nur das Beste gewählt, die ersten Firmen der Welt wurden mit Lieferungen betraut, ohne Rücksicht auf Entfernung oder Unkosten, die bis jetzt schon sechs Millionen verschlungen haben. Welches Finanzkonsortium hat diese sechs Millionen gezahlt? Was kümmert‘s uns und Euch!“.
Das Bauprogramm hat sich aber keineswegs nur auf das „Deutsche Theater“ beschränkt.
Die sogenannte „Schwanthaler Passage“ ist eine interessante Kombination.
Neben dem „Bühnenhaus“ besteht die „Schwanthaler Passage“ aus dreißig Wohnungen mit insgesamt 114 Zimmern.
Zusätzlich bieten zwanzig Läden vielfältige Möglichkeiten für einen Einkaufsbummel.
1894 - Theodor Fischer verändert die Straßenverläufe im „Franzosenviertel“
München-Haidhausen * Theodor Fischer, der „Vorstand des Münchner Stadterweiterungsbüros“,
verzichtet im „Franzosenviertel“ auf die spiegelbildlichen Gegenstücke zum Pariser- und Weißenburger Platz.
Er krümmt die Breisacher Straße - die damals noch Pariser Straße heißt -, die Elsässer Straße und - geringfügig - auch die Metzstraße in ihren Verläufen.
Damit umgeht er das „Kloster der Frauen zum guten Hirten”.
Ab dem Jahr 1894 - Es kommt zur massenhaften Einstellung von Frauen bei der Post
Deutsches Reich * Es kommt zur massenhaften Einstellung von Frauen bei der Post.
Um eine klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche zu schaffen, wird der „Telegraphendienst“ in seiner Gesamtheit von den männlichen Beschäftigten übernommen.
Damit kann der „Fernsprechdienst“ ausschließlich mit weiblichem Personal aufgebaut werden.
Die Frauen werden also für ein Arbeitsgebiet eingestellt, das dem direkten Vergleich mit der Arbeit der Männer entzogen ist. Damit schließen die Männer eine Konkurrenz ihrer Berufszweige gegenüber den Frauen aus.
Sofort kommt es zur Aufspaltung des behördlichen Arbeitsmarktes in einen weiblichen - bis zum Jahr 1922 sogar laufbahnlosen [!] - Beschäftigungszweig und in männliche Berufsfelder mit vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten.
1894 - Die Herkunft der Straßennamen des „Franzosenviertels”
München-Haidhausen * Der „Königlich-bayerische Major a.D.“, Karl Graf von Rambaldi, beschreibt in seinem Buch „Die Münchner Straßennamen und ihre Erklärung” - in einer patriotisch-kriegsverherrlichenden Art und Weise - den Hintergrund der Straßenbenennung in diesem Stadtteil.
So erhält beispielsweise die Weißenburger Straße ihren Namen „Zur Erinnerung an das Treffen bei Weißenburg im Elsaß am 4. August 1870, mit welchem die 4. Bayerische Division ‚Bothmer‘ die Operationen der III. deutschen Armee im Kriege gegen Frankreich so glücklich eröffnete. [...]
Der Gesamtverlust auf deutscher Seite betrug 91 Offiziere und 1.400 Mann”.
Die Wörthstraße erinnert an die Schlacht vom 6. August 1870.
Bei Rambaldi liest sich das so:
„Heiß war der Kampf, die die Weinberge dicht besetzt haltenden Turkos und Zuaven wehrten sich grimmig: Aber unaufhaltsam war das Vordringen der Deutschen [darunter bayerische Armeekorps].
Der Sieg war mit einem eigenen Verlust von 489 Offizieren und 10.153 Mann erkauft”.
1894 - Die „bayerische Staatsregierung“ lehnt die „Leichenverbrennung“ ab
München * Die „bayerische Staatsregierung“ lehnt die „Einführung der Leichenverbrennung“ in München ab.
Noch immer müssen Münchner, die eine „Feuerbestattung“ vorziehen, die hohen Kosten für den „Sargtransport“ zu einem auswärtigen „Krematorium“ akzeptieren.
In Frage kommen dafür Gotha, später Heidelberg und Jena.
1 1894 - Eine Großspende für ein Bad für das unbemittelte Volk
München-Haidhausen * Johann Karl Bernhard Müller vermacht der Stadt seinen gesamten Münchner Immobilienbesitz, um dafür ein Bad „für das unbemittelte Volk“ zu errichten.
20. 1 1894 - Die Patentschrift für ein Motorrad
München * Das Reichspatent 78553 tritt in Kraft. In der Patentschrift wird erstmals das Wort Motorrad gebraucht. Der Patent-Mitinhaber Hans Geisenhof wird finanziell abgefunden. Nachdem die Versuche, das Patent zu verkaufen erfolglos bleiben, entschließen sich Heinrich Hildebrand und Alois Wolfmüller zur Eigenproduktion der Motorräder.
28. 1 1894 - Felix Fechenbach wird in Mergentheim geboren
Mergentheim * Felix Fechenbach wird in Mergentheim geboren.
2 1894 - Das „Restaurant Panoptikum“ in der Neuhauser Straße 1 wird eröffnet
München-Hackenviertel * Das „Restaurant Panoptikum“ in der Neuhauser Straße 1 wird eröffnet.
20. 2 1894 - Das Muffatwerk auf der Kalkofeninsel liefert erstmals Strom
München-Haidhausen * Die Stromerzeugungsanlage im ehemaligen Muffatwerk auf der Kalkofeninsel liefert erstmals Strom für die Straßenbeleuchtung. 278 Bogenlampen erhellen nun die Stadt.
21. 3 1894 - Spaten braut erstmals das Münchner Hell
München - Dresden * Das Münchner Hell wird von der Spaten-Brauerei zum ersten Mal gebraut, abgefüllt und per Pferdefuhrwerk nach Dresden verschickt. Zuvor hat es in München fast nur dunkles Lagerbier gegeben.
4 1894 - Der Tenor Josef „Beppo“ Benz kommt an das „Gärtnerplatz-Theater“
München-Isarvorstadt * Der Tenor Josef „Beppo“ Benz kommt aus dem Schwarzwald an das „Gärtnerplatz-Theater“, um den „Zigeunerbaron“ zu singen.
18. 4 1894 - Adolf Friedrich von Schack stirbt in Rom
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Adolf Friedrich von Schack stirbt in Rom. Er hinterlässt eine Sammlung von 267 Werken deutscher Maler. Davon sind 183 Originale und 84 Kopien, die er nach Gemälden alter Meister - darunter 17 von Franz Lenbach und 4 durch Hans von Mareés - hat erstellen lassen.</p>
5 1894 - Kaiser Wilhelm II. tritt Adolf Friedrich von Schacks Erbe an
München-Maxvorstadt * Kaiser Wilhelm II. tritt Adolf Friedrich von Schacks Erbe an.
Der Nachlass soll in München bleiben. Das ist keineswegs so großzügig wie es den Anschein hat, sondern beruht auf politischem Kalkül.
Der Kaiser will mit der Verlegung der „Schack-Galerie“ nach Berlin das seit der „Reichsgründung“ angespannte Verhältnis zwischen Preußen und Bayern nicht noch mehr belasten.
Selbstverständlich ist jedoch, dass vor der „Galerie“ in der Brienner Straße - und später an der Prinzregentenstraße - das „kaiserliche Hoheitszeichen“ - der „Reichsadler“ - auf hohen Standarten aufgerichtet wird.
5 1894 - Im „Internationalen Handels-Panoptikum“ treten „Hawai-Tänzerinnen“ auf
München-Hackenviertel * Im „Internationalen Handels-Panoptikum“ treten „Hawai-Tänzerinnen“ auf.
Es gibt Programme für Familien und „Elite-Vorstellungen“ nur für Herren.
6. 5 1894 - Herzogin Amalie in Bayern stirbt
München-Schwabing * Herzogin Amalie in Bayern, Erbin von Schloss Biederstein, stirbt im Alter von 48 Jahren, ein Jahr nach ihrem Ehemann.
6 1894 - Die „Firma Hildebrand & Wolfmüller“ mietet eine Werkstatt für 150 Arbeiter
München * Die „Firma Hildebrand & Wolfmüller“ mietet eine Werkstatt für 150 Arbeiter.
6 1894 - Der „Original-Edison-Phonograph“ im „Internationalen Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * Im „Internationalen Handels-Panoptikum“ lauschen die Besucher den „Wort-, Gesangs- und Tierstimmenreproduktionen“ des „Original-Edison-Phonographen“.
5. 6 1894 - Das erste in Serie gefertigte Motorrad der Welt
München * Sowohl die Hochräder als auch die später entwickelten Niedrigräder üben eine ungeheuere Faszination auf die Zuschauer und an der Technik interessierten Besucher der Rennbahn am Schyrenplatz aus.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Idee eines Fahrrades mit Motorantrieb geboren und in die Tat umgesetzt werden wird. Und auch diese Premiere können die Münchner in Untergiesing bestaunen, als hier das erste in Serie gefertigte Motorrad der Welt vorgestellt wird.
22. 7 1894 - Oskar Maria Graf wird in Berg geboren
Berg am Starnberger See * Oskar Graf, der spätere Schriftsteller Oskar Maria Graf, wird als neuntes von elf Kindern im elterlichen Bäckerhaus in Berg am Starnberger See geboren.
9 1894 - Die „Dinka-Neger-Karawane“ begeistert die „Oktoberfest-Besucher“
München-Theresienwiese * Die „Dinka-Neger-Karawane“ begeistert die „Oktoberfest-Besucher“.
14. 9 1894 - Gründung des Velociped Clubs Wild West
München-Untergiesing * Das Rennen zwischen dem Reiter F. S. Cody und dem Radrennfahrer Josef Fischer nimmt der radbegeisterte Heinrich Zierle zum Anlass, den Velociped Club Wild West zu gründen. Der Cowboy-Club löst sich in den 1920er-Jahren wieder auf.
17. 10 1894 - Ludwig Thoma ist Rechtsanwalt am Amtsgericht Dachau
Dachau * Ludwig Thoma ist Rechtsanwalt am Amtsgericht Dachau.
31. 10 1894 - Gründung der Isarwerke GmbH
München * Der Münchner Bauunternehmer Jakob Heilmann, Wilhelm von Finck, Mitinhaber des Bankhauses Merck, Finck & Co. und die Darmstädter Bank für Handel und Industrie gründen mit einem Stammkapital von 2 Millionen Goldmark die Isarwerke GmbH.
Sie übernimmt den Betrieb des Drehstrom-Kraftwerks Zentrale I, das spätere Wasserkraftwerk Höllriegelskreuth, nachdem die Stadt München kein Interesse an diesem Projekt gezeigt hat. Die Isarwerke GmbH sind somit das erste regionale Elektrizitätsversorgungsunternehmen in Deutschland.
1. 11 1894 - Die Berufsfeuerwehr bezieht ihre Unterkunft in der Kellerstraße 2 a
München-Haidhausen * Die Nebenwache IV der Berufsfeuerwehr bezieht ihre Unterkunft in der Kellerstraße 2 a.
1. 11 1894 - Nikolaus II. wird Zar von Russland
Petersburg * Nikolaus II. wird Zar von Russland.
27. 12 1894 - Johann Ueblacker erwirbt ein Anwesen an der Preysingstraße
München-Haidhausen * Der Holzhändler Johann Ueblacker erwirbt ein Anwesen in der Preysingstraße „mit 0,047 Tagwerk zum Preis von 9.912 Mark und 57 Pfennig, für das Wohnhaus mit angebauter Stallung, Abort, Schutzdach, Wagenremise und Hofraum“.
Das sogenannte Üblackerhäusl entstand schon im 18. Jahrhundert und war eines der ersten aus Ziegeln erbauten Herbergsanwesen an der Preysingstraße, das bis zum Jahr 1970 bewohnt war und dann wegen Baufälligkeit gesperrt werden musste.
1895 - Valentin Ludwig Fey besucht die „Privat-Bürgerschule Dr. Ustrich“
München-Graggenau * Valentin Ludwig Fey beginnt mit seiner Ausbildung in der „Privat-Bürgerschule Dr. Ustrich“ in der Münzstraße 4.
1895 - Die „Unionsbrauerei Schülein & Compagnie“ wird ausgebaut
München-Haidhausen * Die „Unionsbrauerei“ an der Äußeren-Wiener-Straße in Haidhausen, der heutigen Einsteinstraße 42, wird in „Unionsbrauerei Schülein & Compagnie“ umbenannt und zu einer gut gehenden Braustätte ausgebaut.
1895 - Leonhard Romeis erhäölt den „Verdienstorden vom heiligen Michael“
München-Maxvorstadt * Anlässlich der Vollendung der „Sankt-Benno-Kirche“ erhält Leonhard Romeis den „Verdienstorden vom heiligen Michael III. Klasse“.
1895 - In München gibt es 34.708 Gewerbebetriebe
München * In München gibt es 34.708 Gewerbebetriebe bei 413.255 Einwohner.
1895 - In München gibt es 147 „Arbeitsnachweise“
München * In München gibt es 147 „Arbeitsnachweise“.
Davon sind 99 gewerbsmäßige Stellenvermittlungen, 18 Arbeitgeber- und 23 Arbeitnehmerbüros. Weitere 7 Vermittlungsbüros werden von karitativen Vereinigungen betrieben.
1895 - Der „arbeitsfreie Sonntag“ wird im Kaiserreich gesetzlich verankert
Berlin * Der „arbeitsfreie Sonntag“ wird im Kaiserreich gesetzlich verankert.
1895 - Konrad Drehers „Schlierseer Bauerntheater“ auf USA-Tournee
New York * Konrad Drehers „Schlierseer Bauerntheater“ gastiert während seiner USA-Tournee auch an der „Metropolitan Opera“ in New York.
1895 - Das „Maffei-Kraftwerk“ am Eisbach wird erbaut
München-Englischer Garten - Hirschau * Das „Maffei-Kraftwerk“ am Eisbach, das heutige „Tivoli-Kraftwerk“, wird zur Stromerzeugung für das „Maffei-Lokomotivenwerk“ erbaut.
Es dient der Firma zur Deckung des eigenen Strombedarfs.
1895 - Ernst von Possart wird „Generalintendant der kgl. Hofbühnen“
München * Ernst von Possart wird zum „Generalintendanten der kgl. Hofbühnen“ befördert.
Er setzt schließlich den Bau eines „Münchner Festspielhauses“ durch.
1895 - Die „Volksschule“ an der Kolumbusstraße wird als „Musterschule“ errichtet
München-Au - München-Untergiesing * Zwischen 1895 und 1897 wird die „Volksschule“ an der Kolumbusstraße als „Musterschule“ durch Carl Hocheder errichtet.
Sie löst eine seit 1885 bestehende „Schulbaracke“ in der Pilgersheimer Straße ab.
Der Architekt Carl Hocheder muss für die „Volksschule an der Kolumbusstraße“ eine völlig neuartige architektonische Lösung entwickeln.
Da das Grundstück, wegen des unregelmäßigen Zuschnitts, eine geschlossene Bebauung nicht zulässt, gliedert Hocheder die Schule in einzelne Baukörper.
Zum ersten Mal verwendet er hier die - für das „Münchner Schulhaus“ später so typische - „Turnsaalterrasse“ und stellt sie an die Ecke des spitzwinkeligen Grundstücks.
Als Gegengewicht zu dem breit gelagerten Komplex entsteht der schlanke „Uhrenturm“.
Carl Hocheder orientiert sich bei der Gestaltung der Schule an süddeutsche Klosterbauten des 18. Jahrhunderts.
1895 - Amazonen-Wettrennen zwischen Pferd und Fahrrad
München-Untergiesing * Nicht nur die Männer liefern sich die ungleichen Wettrennen zwischen Pferd und Fahrrad.
Es kommt auch zu einem Wettkampf zwischen einer amerikanischen Präriereiterin und einer Münchner Radfahrerin.
„Daß Damen sich auch an den öffentlichen Wettfahrten betheiligen, ist [...] das Eigenartigste auf diesem Gebiete des Sports. [...]
Dieser Wettkampf fand kürzlich zu München auf dem „Neuen Sportplatze“ zwischen der amerikanischen Prairiereiterin Miß Nelly und der Münchener Radfahrerin Fräulein Amanda Löschke statt.
Das Publikum hatte sich zu dieser noch nie dagewesenen Schaustellung überaus zahlreich eingefunden und verfolgte mit lebhaftester Spannung den Verlauf dieses Wettkampfes, aus dem die Reiterin als Siegerin hervorging“.
Um 1895 - Die ersten „Arbeiter-Radfahr-Klubs“ entstehen
München * Die ersten „Arbeiter-Radfahr-Klubs“ entstehen.
Sie lehnen allerdings das „patriotische Klimbim“ und „Rennfahrten“ ab und „wollten gemeinsam mit ihren Klassengenossen in die Ferne schweifen und die Schönheiten der Natur genießen“.
1895 - So etwas „Unanständiges“ wie die „Brunnengruppe Satyrherme & Knabe“
München-Ludwigsvorstadt * Nach Auffassung des Münchner Magistrats kann man so etwas „Unanständiges“ wie die „Brunnengruppe Satyrherme & Knabe“ des Bildhauers Matthias Gasteiger unmöglich an einem viel besuchten Platz aufstellen, weshalb der Brunnen in die Nähe des „Toilettenhäuschens“ in der „Stachusgrünanlage“ zur Aufstellung kommt.
Aber so gut kann man das „Brunnenbuberl“ gar nicht verstecken, dass sich nicht doch „Moralapostel“ und „Sittlichkeitsvereine“ über diese „Sauerei“ ereifern.
Es kommt zum Skandal, in deren Folge der Münchner Polizeipräsident bei Matthias Gasteiger vorspricht, um ihm „allen Ernstes zu erklären, daß das Bildwerk höchst anstößig sei und daß das Interesse der Aufrechterhaltung der Moral und guten Sitten unbedingt erfordere, daß 'etwas' geschehen“.
Matthias Gasteiger unternimmt nichts. Er will keinesfalls ein Feigenblatt an seinem „Buberl“ akzeptieren.
1895 - „Krao, das Affenmädchen“ im „Internationalen Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * „Krao, das Affenmädchen“, eine am ganzen Körper behaarte junge Frau aus Burma, lockt die Besucher ins „Internationale Handels-Panoptikum“.
1895 - 57.478 Protestanten leben in München
München * Die evangelische Gemeinde Münchens umfasst 57.478 Mitglieder.
2 1895 - Die Brüder Lumiére erhalten das Patent für einen „Cinématographe“
Paris * Die Brüder August und Louis Lumiére erhalten das Patent für einen „Cinématographe“.
Ab 3 1895 - Der „Cinématographe“ der Brüder Lumiére wird dem Publikum vorgestellt
Paris * Der „Cinématographe“ der Gebrüder Lumiére wird in Paris einem Fachpublikum vorgestellt und vorgeführt.
3 1895 - Premierleutnant Hans Dominik bekämpft das „Volk der Bakoko“
Kamerun * Hans Dominik bekämpft das „Volk der Bakoko“, das vom Zwischenhandel zwischen Nordkamerun und der Küstenregion lebt.
Da den deutschen „Kolonialherren“ damit die Ausbeutung des Kameruner Hinterlandes entgeht, wird diese „Strafexpedition“ eingeleitet.
1. 3 1895 - Die Firma Hildebrand & Wolfmüller hat 850 Beschäftigte
München * Der Briefkopf der „Firma Hildebrand & Wolfmüller“ weist folgende Fabrikationslokalitäten auf: Colosseumstraße 1, Müllerstraße 44, Müllerstraße 48, Baumstraße 4a und Zenettistraße 11. Im Frühjahr 1895 sind bereits 850 Beschäftigte in den über die Stadt verteilten Betriebe tätig. Die Zahl der Arbeiter steigt bis zum Konkurs der Firma noch auf 1.200 Arbeiter an.
13. 3 1895 - Franz von Lenbachs zweite Tochter Erika wird geboren
München * Franz von Lenbachs zweite Tochter Erika wird geboren.
22. 3 1895 - Der Magistrat beschließt einen unentgeltlichen „Arbeitsnachweis“
München * Seit 1893 plant die Stadt München einen zentral organisierten, unparteiisch geleiteten und unentgeltlichen „Arbeitsnachweis“.
Am 22. März 1895 fasst der Magistrat der Stadt den maßgebenden Beschluss zu dieser Einrichtung zur Vermittlung von Arbeitsstellen.
Und nachdem das achtköpfige Gremium gewählt ist, wird mit der Einrichtung des „Städtischen Arbeitsamtes“ in der Zweibrückenstraße 20 begonnen und deren Eröffnung durch Plakate, Annoncen und Zeitungsartikel bekannt gegeben.
Ab 26. 6 1895 - Schöne, junge Samoanerinnen als Hauptattraktion der Völkerschauen
Deutsches Reich - Österreich * 1895, also noch bevor Samoa Teil des deutschen Kolonialbesitzes geworden ist, reisen Inselbewohner nach Deutschland, um in den sogenannten Völkerschauen aufzutreten. Die Reise der Truppe dauert bis Dezember 1897, dabei besuchen sie in Deutschland unter anderem Berlin, Köln, aber auch Wien.
Die Hauptattraktion sind natürlich die schönen, jungen Samoanerinnen. Diese „Marzipanpüppchen mit Chocoladenüberzug“ begeistern freilich in erster Linie die Männerwelt.
11. 7 1895 - Margaretha Geertruida Zelle, alias Mata Hari, heiratet in Amsterdam
Amsterdam * Margaretha Geertruida Zelle, alias Mata Hari, heiratet in Amsterdam den zwanzig älteren niederländischen Kolonialoffizier John MacLeod. Sie hatte den Uniformträger über eine Zeitungsannonce kennen gelernt.
21. 7 1895 - Franz Stuck und die Königliche Akademie der bildenden Künste
München-Maxvorstadt * Franz Stuck wird an der Königlichen Akademie der bildenden Künste Nachfolger von Wilhelm von Lindenschmitt.
9 1895 - Mit Carl Gabriels „Hexenschaukel“ kommt eine Neuheit aufs „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Mit Carl Gabriels „Hexenschaukel“ kommt eine Neuheit aufs „Oktoberfest“.
9 1895 - Der Magistrat will das „Oktoberfest“ attraktiver gestalten
München-Theresienwiese * Der Magistrat will das „Oktoberfest“ attraktiver gestalten.
Dazu soll das „Winzerer Fähndl“ einen „Festzug in historischen Kostümen“ organisieren.
9 1895 - Die „Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl“ erhält eine Bierburg
München-Theresienwiese * Der Verein „Winzerer Fähndl“ bekommt für seine Beteiligung am „Wiesnumzug“ das Recht eingeräumt, eine eigene „Bierbude“ auf dem „Oktoberfest“ zu bewirtschaften.
Dafür wird ein Vertrag mit der „Thomas-Brauerei“ geschlossen.
Die „Bierbude“ entsteht neben der „Oktoberfest-Zielstatt für das Adler-, Stern- und Scheibenschießen“ der „Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl“.
Die „Festburg Winzerer Fähndl“ ist die erste große „Bierhalle“ auf der „Theresienwiese“, die außerhalb des bisherigen „Wirtsbudenrings“ Aufstellung findet.
Ein 26 Meter hoher „Lueg-ins-Land“ überragt sie.
Seine Vorderfront ziert eine riesige Darstellung eines „Geharnischten“, der einen Humpen „Thomasbräubier“ schwenkt.
18. 9 1895 - Der Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke tagt
München-Graggenau * Im Großen Saal des Alten Rathauses veranstaltet der „Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke“ unter der Leitung von Geheimrat von Pettenkofer eine öffentliche Veranstaltung.
27. 9 1895 - Ein Militärverbot für die Bierbude Nr. 3
München-Theresienwiese * Von der Polizei-Kommandantur wird über die Bierbude Nr. 3 ein Militärverbot verhängt. Der Grund ist die Erklärung des Budeninhabers, er werde dem sozialistischen Gewerkschaftsverein für jeden auf der Festwiese gezapften Hektoliter eine Mark spenden.
30. 9 1895 - Das Winzerer Fähndl zeigt einen Jagdzug aus dem 16. Jahrhundert
München * Das Winzerer Fähndl zeigt einen Jagdzug aus dem 16. Jahrhundert, an dem 200 Personen und 26 Pferde beteiligt sind.
23. 10 1895 - Ilse Hedwig Eisner kommt in Marburg zur Welt
Marburg * Ilse Hedwig Eisner, Tochter von Kurt Eisner und seiner ersten Ehefrau Lisbeth, geb. Hendrich, wird in Marburg geboren. Das Kind gehört keiner Konfession an.
1. 11 1895 - Das Städtische Arbeitsamt München öffnet seine Pforten
München-Isarvorstadt * Mit sieben Mitarbeitern beginnt die Arbeitsvermittlung von „gewerblichen Arbeitern, Handlungsangestellten, Dienstboten, Tagelöhnern und Lehrlingen“ im Südpavillon auf der Kohleninsel. Damals öffnet das Städtische Arbeitsamt München seine Pforten für arbeitsuchende Münchnerinnen und Münchner.
Die bayerische Hauptstadt übernimmt mit dieser Einrichtung im Bereich der kommunalen Arbeitsvermittlung - neben einigen Städten in Württemberg - eine Vorreiterrolle.
2. 11 1895 - Das Konkursverfahren gegen die Firma Hildebrand & Wolfmüller beginnt
München * Das Konkursverfahren vor dem Königlichen Amtsgericht München I gegen die Firma Hildebrand & Wolfmüller wird eröffnet. Wie viele Motorräder wirklich produziert worden sind, lässt sich nicht mehr bestimmen; es waren aber kaum mehr als einhundert.
Was war geschehen und warum wurde der kometengleiche Aufstieg der Firma so jäh wieder beendet? Denn immerhin erreichte das Auftragsvolumen nur wenige Wochen nach der Firmengründung zwei Millionen Reichsmark, was die Unternehmer in die Lage versetzte, ihre Motorräder für einen Stückpreis von 650 Mark an die Händler abzugeben.
Alois Wolfmüller und Heinrich Hildebrand wagten sich zu früh an die Öffentlichkeit. Der Konstrukteur musste sich - wie sein Geldgeber - um die Produktion kümmern, und fand schon deshalb keine Zeit, sich um die Verbesserung seiner sonst so fortschrittlichen Erfindung zu kümmern.
Das Grundproblem des Hildebrand & Wolfmüller-Motorrades war die ungenügende Funktion der Zündung. Das Anlassen der H&W-Maschine - ohne Kickstarter und ohne Batterie - war laut der Beschreibung für das Motorrad für einen Geübten in drei bis fünf Minuten zu bewerkstelligen. Heute wissen wir allerdings, dass der Vorwärm-Mechanismus - ähnlich wie bei Dieselfahrzeugen - viel Fingerspitzengefühl erforderte und sicherlich 13 bis 15 Minuten dauerte - oder gar nicht gelang. Die Unzufriedenheit der Kunden war also vorhersehbar und der Konkurs der Münchener Firma damit unabwendbar.
Auch sonst war man bei diesem Pionierstück der Motorrad- Geschichte noch von vielen heute üblichen Lösungen weit entfernt. Beim Betrachten des H&W-Motorrades fällt sofort der an ein Lokomotivengestänge erinnernde Antrieb auf. Über zwei lange Pleuelstangen wurde die Kraft der beiden Kolben - wie bei einer Dampfmaschine - direkt auf das Hinterrad des H&W-Motorrades übertragen. Der gravierende Unterschied lag im Antrieb, der bei dem Motorrad über einen Benzinmotor erfolgte.
Da bei einem Benzinmotor die Kraft durch die Explosion eines Gasgemisches erfolgt, war ohne Kupplung und Getriebe ein gefühlvolles und ruckfreies Anfahren überhaupt nicht möglich. Die mit einem für heutige Verhältnisse außergewöhnlich hohen Hubraum von 1.530 cm³ ausgestattete Maschine wurde bei jeder Zündung um 1½ Meter nach vorne „geworfen“. Um den Vorwärtsdrang dieses Hubraumriesen etwas geschmeidiger zu gestalten, kamen zwei starke Gummibänder zum Einsatz, die beidseitig am Motorrad angebracht wurden, einen Teil der Energie speicherten und diese dann während der Rückhubphase des Kolbens abgaben.
Um mit dem H&W-Motorrad überhaupt in Fahrt zu kommen, musste der Fahrer - auf dem Sattel sitzend - beidseitig mit den Beinen so lange anschieben, bis der 2,5-PS-Motor seine Arbeit aufnahm, um in den Stillstand zu kommen, der Motor sogar „abgewürgt“ werden.
Die einzige Bremse des Fahrzeugs bestand aus zwei Holzklötzen, die direkt auf die Lauffläche drückten. Dennoch konnte mit dem Motorrad eine Geschwindigkeit von dreißig bis vierzig Kilometern in der Stunde erreicht werden. Sonderanfertigungen brachten es sogar auf neunzig Stundenkilometern.
Aus dieser - bei Weitem nicht vollständigen - Funktionsbeschreibung geht eindeutig hervor, dass die richtige Bedienung des Hildebrand & Wolfmüller-Motorrades durch einen Laien kaum zu bewerkstelligen war. Und genau das war auch der Grund, weshalb die H&W als Serien-Motorrad nicht erfolgreich war.
28. 12 1895 - Erste Filmvorführungen im Pariser Grand Café
Paris * Die Brüder Louis und Auguste Lumiére zeigen im Pariser Grand Café mit einem „Cinematographe“ genannten Gerät „lebende Bilder“. Umgehend nimmt Carl Gabriel Verhandlungen auf und erreicht die Absendung eines Operateurs nach München.
31. 12 1895 - 1.359 Einwohner und 905 italienische Ziegelarbeiter
Berg am Laim * Berg am Laim hat 1.359 Einwohner. Hinzu kommen während der Saison noch 905 italienische Ziegelarbeiter.
1896 - Karl Valentins „Erweckungserlebnis“
München-Isarvorstadt * Valentin Ludwig Feys Zitherlehrer, Ignaz Hepper, nimmt seinen „Zögling“ mit in das „Kolosseum“, wo der „Gesangshumorist“ Karl Maxstadt auftritt.
Das war Valentins „Erweckungserlebnis“.
Später schrieb er: „Ich wollte Varieté-Humorist werden wie Karl Maxstadt“.
Ab 1896 - Martin Dülfer erbaut die herrschaftliche Villa Berchtoldsheim
München-Bogenhausen * Der Architekt Martin Dülfer erbaut die herrschaftliche Villa in der Maria-Theresia-Straße 27 für Clemens von Berchtolsheim, dem „Erfinder der Milchzentrifuge“.
Es handelt sich hier um eines der ersten Jugendstilhäuser in München.
Ab 1896 - Die „Unionsbrauerei“ steigert ihren Ausstoß um das Fünfzehnfache
München-Haidhausen * Zwischen 1896 und 1899 wird der Haidhauser „Unionsbräu“ modernisiert.
Innerhalb von 10 Jahren steigert die „Unionsbrauerei Schülein & Cie“ ihren Ausstoß von 16.000 Hektolitern um das Fünfzehnfache.
1896 - Der Bebauungsplan für die Richard-Wagner-Straße wird eingereicht
München-Maxvorstadt * Der Architekt Leonhard Romeis reicht einen Bebauungsplan für die künftige Richard-Wagner-Straße ein.
Das macht er im Auftrag von Michael Bleibinhaus, der einen Großteil der zu bebauenden Grundstücke besitzt.
1896 - Der „Kaisergarten“ an der Lilienstraße 2 wird abgerissen
München-Au * Der „Kaisergarten“ an der Lilienstraße 2 wird abgerissen und dafür der heute noch bestehende Bau errichtet.
Das neue Wirtshaus trägt den Namen „Gasthaus & Singspielhalle zum Kaisergarten“.
1896 - Ludwig Schlecht beantragt die „Singspielhallen-Konzession“
München * Ludwig Schlecht beantragt die „Singspielhallen-Konzession“ für sein „Theater“ im „Münchner Hof“, das bislang als klassische „Varieté-Bühne“ geführt wurde.
1896 - Emil Reichenbach kauft die „Deutsche Eiche“
München-Isarvorstadt * Emil Reichenbach kauft die „Deutsche Eiche“.
Seine Familie betreibt das Lokal fast 100 Jahre.
1896 - Der „Holzmarkt“ findet in unmittelbarer Nähe des „Schyrenbades“ statt
München-Untergiesing * In unmittelbarer Nähe des „Schyrenbades“ findet der „Holzmarkt“ statt.
Er wird vom „Isartor“ dorthin verlegt.
1896 - Die „Baumschule“ auf der „Kalkofeninsel“ kommt an die Sachsenstraße
München-Haidhausen - Kalkofeninsel - Untergiesing * Die „Baumschule“ auf der „Kalkofeninsel“ muss wegen der Erbauung des „Müller'schen Volksbades“ und der Erweiterung des „Muffatwerks“ - an die Sachsenstraße, im Anschluss an das „Schyrenbad“, verlegt werden.
Der „Kulturgarten“ ist noch immer für die Öffentlichkeit zugänglich.
Im Garten befindet sich noch heute der Sitz der „Hauptabteilung Gartenbau“ der „Stadtgärtendirektion“.
1896 - Am „Schyrenplatz“ entsteht ein „Jugendsportplatz“
München-Untergiesing * Am „Schyrenplatz“ entsteht ein „Jugendsportplatz“.
1896 - Josef Fischer gewinnt die Rennstrecke „Paris - Roubaix“
Paris - Roubaix * Der „Westendler“ Josef Fischer gewinnt die damals zum ersten Mal ausgetragene Rennstrecke „Paris - Roubaix“ und ist bis heute der einzige deutsche Sieger.
Der Münchner bekommt damals 1.000 Francs Siegprämie, das Siebenfache eines durchschnittlichen Monatslohns, für die Schinderei durch das ärmliche Nordfrankreich, das man schon „Hölle des Nordens“ nannte, bevor sich der erste Radrennfahrer über die armseligen Sträßchen kämpfte.
1896 - Die „Schlangendomptöse Miss Clio“ im „Internationalen Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * Die „Schlangendomptöse Miss Clio“ beeindruckt das Münchner Publikum im „Internationalen Handels-Panoptikum“ mit sechs „Riesenschlangen“.
1896 - Kino und Menschen-Flöhe im „Internationalen Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * Auch das „Kinetoscope“ wird im „Internationalen Handels-Panoptikum“ in München vorgeführt uns als „Edison's Wunderwerk“ bejubelt.
Doch um die Massen zu begeistern braucht es mehr, weshalb stündlich der „Pariser Original-Flohmarkt mit ca. 300 dressierten Menschen-Flöhen“ auftritt.
1896 - Dritte und vierte evangelische Klassen in Haidhausen
München-Haidhausen * Nach wiederholten Gesuchen an die „Lokalschulkommission“ werden in Haidhausen eine dritte und vierte evangelische Klasse eingerichtet.
1896 - Ludwig Thoma arrangiert eine „25-Jahr-Siegesfeier“
Dachau * Ludwig Thoma arrangiert eine „25-Jahr-Feier“ zum „deutsch-bayerischen Sieg“ gegen Frankreich 1870/71.
Außerdem liefert er eine schwülstige nationale Rede zu den „Siegesfeierlichkeiten“.
1. 1 1896 - Das Muffatwerk erzeugt jetzt Strom mit 600 PS
München-Haidhausen * Das Muffatwerk erzeugt jetzt Strom mit 600 PS.
4 1896 - Die erste Film-Vorführung im „Internationalen Handels-Panoptikum“
Wien - München * Der „Cinématographe“ der Herren August und Louis Lumiére wird im „Jugendstil-Salon der französischen Botschaft“ in Wien gezeigt.
Der „Schausteller“ Carl Gabriel kann ein „Aufnahme- und Wiedergabegerät“ erwerben.
Noch im gleichen Monat findet die erste öffentliche Vorführung im „Internationalen Handels-Panoptikum“ in München durch den „Operateur“ Francis Doublier statt.
4. 4 1896 - Albert Langen startet die Satire-Zeitung „Simplicissimus“
<p><em><strong>München</strong></em> * Der von Köln über Paris kommende Zuckerfabrikanten-Erbe Albert Langen startet die Satire-Zeitung <em>„Simplicissimus“</em>. </p> <p>In seiner Begleitung befinden sich der Hannoveraner Frank Wedekind und der aus Leipzig stammende Thomas Theodor Heine, die Pariser Flair und Esprit ins <em>„Isar-Athen“</em> bringen möchten. Thomas Theodor Heine hatte seine Karriere als Zeichner bei den <em>„Fliegenden Blätter“</em> begonnen. </p>
9. 4 1896 - Die Geburt von Franz Stucks Tochter Mary
<p><strong>München</strong> * Franz Stucks Tochter Mary wird <em>„unehelich“</em> geboren. Ihre Mutter ist die Bäckerstochter Anna Maria Brandmaier. </p>
13. 4 1896 - Rudolf Egelhofer wird in Schwabing geboren
München-Schwabing * Rudolf Egelhofer wird in Schwabing geboren.
9. 5 1896 - Die Grundsteinlegung für das Friedensdenkmal
München-Bogenhausen * Am 9. und 10. Mai, exakt 25 Jahre nach dem - für Bayern und das Reich siegreichen - Krieg gegen Frankreich, findet die Grundsteinlegung für das Friedensdenkmal auf der Prinzregent-Luitpold-Terrasse statt.
26. 5 1896 - Der letzte Biersud wird im alten Hofbräuhaus am Platzl gebraut
München-Graggenau * Der letzte Biersud wird im alten Hofbräuhaus am Platzl gebraut.
Um den 7 1896 - Der „Turnverein Haidhausen“ ist schon bald am Ende
München-Haidhausen * Schon seit der Mitte der 1890er Jahre treffen sich Haidhauser Arbeiter zu sportlichen Übungen im „Turnverein Haidhausen“.
Doch nur wenige Monate später ist der Verein finanziell schon wieder am Ende und muss Ende 1896 aufgelöst werden.
Um vor allem die finanziellen Probleme des Vereins in den Griff zu bekommen, nehmen Mitglieder des aufgelösten Vereins Kontakt mit der SPD und den Gewerkschaften auf.
Nachdem den „Arbeitersportlern“ Unterstützung zugesagt worden ist, kann eine zweite Gründung erfolgen.
Ein solches Wohlwollen war zu dieser Zeit keineswegs selbstverständlich, da viele Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre den Sportvereinen ablehnend gegenüberstehen und diese als „Klimbim-Vereine“ abqualifizieren.
In Gewerkschaftsversammlungen werden alle Debatten über Sportvereine abgelehnt, da man fürchtet, dass deren Mitglieder über ihr sportliches Engagement die politische Arbeit total vergessen könnten.
11. 7 1896 - Im Panoptikum werden erstmals lebende Bilder gezeigt
München-Hackenviertel * In der bayerischen Haupt- und Residenzstadt werden erstmals „lebende Bilder“ gezeigt. Die Aufführung findet - „unter lebhafter Anteilnahme des Münchner Publikums“ - in Carl Gabriels und Emil Eduard Hammers Panoptikum statt. Der Vorführapparat wird mit Theaterkulissen umspannt und dann „drauflos gekurbelt“. Die Vorführungen richtet Carl Gabriel nach französischem Vorbild ein.
Das ganze Programm ist circa 100 Meter lang und läuft innerhalb von einer Viertelstunde ab. Drei bis fünf kleine Filme werden gezeigt:
- Ein heranbrausener Eisenbahnzug,
- Eine Schlangendomteuse,
- Ein Kettensprenger und
- Das Aufziehen der Hauptwache.
Schon einer der ersten Filme verursacht einen Skandal. Er heißt „Endlich allein“ und zeigt ein Brautpaar am Hochzeitstag. Die Schlussszene wird umgehend zensiert.
13. 7 1896 - Die Ehe Franz von Lenbachs wird geschieden
München * Die Ehe der Lenbachs wird geschieden. Die ältere Tochter Marion wird dem Vater, die jüngere Tochter Erika der Mutter zugesprochen.
8 1896 - Die künftige Richard-Wagner-Straße soll einen Knick erhalten
München-Maxvorstadt * Der „Direktor der Königlichen Kunstgewerbeschule“ fordert die „Baulinienkommission“ auf, die künftige Richard-Wagner-Straße mit einem Knick zu versehen.
10. 8 1896 - Erstmals wird in Haidhausen „Hofbräubier“ gebraut
München-Haidhausen * Erstmals wird in Haidhausen „Hofbräubier“ gebraut.
9 1896 - Der Architekt Gabriel von Seidl baut eine prächtige „Bierburg“
München-Theresienwiese * Der „Franzislaner-Leist-Bräu“ lässt Michael Schottenhamel auf der „Theresienwiese“ eine prächtige „Bierburg“ bauen.
Gabriel von Seidl hat das Gebäude „von auffälliger Stattlichkeit“ entworfen. Es ist in einer L-Form mit Walmdach gebaut und besitzt einen viereckigen, girlandengekrönten Turm.
9 1896 - Kinopremiere auf dem Münchner „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Nach der Münchner Kinopremiere im „Internationalen Handelspanoptikum“ von Carl Gabriel ist die nächste Spielstätte das „Oktoberfest“.
Der „Filmpionier“ Johann Dienstknecht zeigt dort die Filme.
11. 9 1896 - Der Kunstsaustall der Schwanthaler Bagage
München-Ludwigsvorstadt * Gut zwei Wochen vor der Eröffnung des Deutschen Theaters und der Schwanthaler Passage steht das Unternehmen am Rande des Bankrotts. Eine Gläubigerversammlung mit rund 120 Handwerkern und Lieferanten mahnt ihre ausstehenden Zahlungen an. Theaterdirektor Alexander Bluhm schafft es gerade noch, die Gläubiger zu einem Stillhaltabkommen zu überreden und sie für sechs Monate von Pfändungen abzuhalten.
Denn wenn der Theaterbetrieb erst einmal laufen würde, so argumentiert der optimistische Theaterdirektor, dann wären auch alle finanziellen Probleme gelöst. Doch nur wenige Stunden vor der Premiere muss er eine größere Summe Geld auftreiben, weil der Lieferant der roten Teppiche im Foyer ansonsten mit einem Skandal droht.
Zum Glück gibt es aber im Hintergrund noch den reichen Kommerzienrat Friedrich Haenle, der für sechzig Prozent aller offen stehenden Forderungen eintreten will. Dieses Angebot führt allerdings in der Familie des Unternehmers zu Überlegungen, den Patriarchen „entmündigen“ zu lassen, um dadurch weiteres Unheil zu verhindern.
Aber nicht nur die verschwenderische Ausgestaltung der Schwanthaler Passage bringt die Unternehmung an den Rand des Desasters. Theaterdirektor Alexander Bluhm hat auch beim Künstlerpersonal kräftig hingelangt. Neben dem üppig besetzten Schauspieler-Ensemble leistet er sich ein mit fünfzig Musikern besetztes Orchester und ein stattliches Ballett: 36 Tänzerinnen, 16 Tänzer, 48 Figuranten und 60 Komparsen gehören zum festengagierten Stammpersonal.
Weil aber Direktor Bluhm schon zwei Monate vor der Premiere kein Geld mehr für Gagen besitzt, müssen die Proben abgesagt werden.
In München machen die Probleme des neuen Theaters schnell die Runde. Für die hiesigen Lästermäuler wird aus der Schwanthaler Passage ganz schnell die „Schwanthaler Blamage“, während man die Betreiber des Etablissements als „Schwanthaler Bagage“ verhöhnt.
Die erzkonservative Zeitung Das Bayerische Vaterland blickt sowieso mit Schaudern auf die Programmankündigung des Unterhaltungstempels an der Schwanthalerstraße und sieht schon dadurch die „moralischen Grundsätze des christlichen Abendlands“ als gefährdet an. Die Zeitung befürchtet, dass es sich bei dem neuen Theater um ein „Institut für moralische Schweinezüchterei“, ja sogar um einen „Kunstsaustall“ handelt.
Neben der veröffentlichten Meinung bereiten aber auch die genehmigenden staatlichen Behörden dem Theaterdirektor Alexander Bluhm große Probleme, indem sie ihm zunächst „die ortspolizeiliche Productionsbewilligung für theatralische Vorstellungen“ verweigern. Im Hintergrund agiert hier der einflussreiche Münchner Hoftheaterdirektor Ritter Ernst von Possart, der in dem neuen Theater in der Schwanthaler Passage eine „dauernde schwere Schädigung der materiellen Interessen der königlichen Hofbühne“ sieht.
Aber nicht nur die Angst vor einer unliebsamen Konkurrenz, die den Hoftheatern die Zuschauer abspenstig machen könnten, sondern auch eine tief empfundene Abneigung gegen alles Moderne bringen Ritter Ernst von Possart gegen das neue Theater in Rage. Der den Traditionalisten angehörende Hoftheaterintendant pflegt auf seinen Hofbühnen einen antiquierten, stark verstaubten Stil, der kaum mit dem zeitgenössischen Theater der Naturalisten zu vereinbaren ist.
5. 10 1896 - Franz von Lenbach heiratet Charlotte von Hornstein
München * Franz von Lenbach heiratet Charlotte „Lolo“ von Hornstein.
22. 10 1896 - 42 Haidhauser gründen den Kirchenbauvereins St. Wolfgang
München-Haidhausen * In Erinnerung an das Haidhauser Wolfgangskirchlein finden sich 42 Bürger zur Gründung des Kirchenbauvereins St. Wolfgang zusammen.
29. 11 1896 - Die evangelische Lukaskirche wird eingeweiht
München-Lehel * Die evangelische Lukaskirche wird eingeweiht. Ihr Baustil ist historisierend mit eindeutig herausragenden Jugendstilelementen. Das Evangelische Gemeindeblatt stellt mit Genugtuung fest, dass die „Kirchengemeinde die Kosten des großen Werkes, ohne Lotterie, Kollekte oder dergleichen, auf ihre eigenen Schultern genommen“ hat.
Die Lukaskirche wird oftmals als der Dom der evangelischen Mitbürger in München bezeichnet. Sie wird heute vom tosenden Verkehr und Lärm der Steinsdorfer Straße eingezwängt.
12 1896 - Ludwig Ganghofer und sein Wohnzimmer-Biergarten
München-Lehel * Ludwig Ganghofer lässt sich in seinem Wohnzimmer einen Biergarten samt Bühne einrichten.
Einer der Schreiner, der die Bühne errichtet, ist ein gewisser Valentin Ludwig Fey, der später als „Karl Valentin“ eine steile Karriere als „Volkssänger“ und Schauspieler machen wird.
Ludwig Ganghofer wird in dem angehenden Schreiner und weiteren Münchner Bühnen-Talenten zu Beginn ihrer Karriere unterstützend unter die Arme greifen.
19. 12 1896 - „O mei, o mei, o mei. Mei Muatta is a Mörtlwei“
München * Im Simplicissimus wird das Gedicht „Mörtelweibs Tochter“ veröffentlicht.
1897 - Das „Muffatwerk“ hat 1.370 PS zur Stromerzeugung
München-Haidhausen * Dem „Muffatwerk“ stehen 1.370 PS zur Stromerzeugung zur Verfügung.
Seit dem Jahr 1897 - Der 15jährige Valentin Ludwig Fey tritt bereits als „Vereinshumorist“ auf
München * Der 15-jährige Valentin Ludwig Fey tritt bereits als „Vereinshumorist“ auf.
Dabei begleitete er sich selbst mit der Zither und der Ziehharmonika, um anschließend mit dem Teller bei den Gästen ein wenig Geld einzusammeln. Diese Tätigkeit nannte man „schuberln“.
Sein „Auftrittsverzeichnis“ umfasst bis zum Jahr 1908 eine Vielzahl von Engagements.
1897 - Planungen für den westlichen Erweiterungstrakt des „Neuen Rathaues“
München-Graggenau * Die Planungen für den westlichen Erweiterungstrakt des „Neuen Rathaues“ werden in Angriff genommen.
1897 - Der „Verein der Brauereibesitzer in München“ hat 15 Mitglieder
München * Der „Verein der Brauereibesitzer in München“ hat 15 Mitglieder.
1897 - Die Unternehmensgründer scheiden aus
Berg am Laim * Die beiden Gründer der Firma „Franz Kathreiner‘s Nachfolger“ scheiden aus dem Unternehmen aus.
Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 217.
1897 - Johann Bucher erstellt einen Neubau für seine „Drahtfabrik“
München-Au * Als in diesem Jahr das Niveau der Zeppelinstraße um einen Meter angehoben wird, bietet sich für Johann Bucher ein Neubau seines Hauses für seinen Laden und seine „Drahtfabrik“ förmlich an.
1897 - Theodor Fischer beschreibt die „Lilienstraße“
München-Au * Der „Architekt und Städteplaner“ Theodor Fischer schreibt zur „Lilienstraße“ folgende Zeilen:
„[...] in ihrer im Laufe der Jahre gewachsenen natürlichen Form versprach die Straße, daß sie, wenn sie erst einmal ausgebaut sein würde, zu den schönsten der Stadt gehören werde“.
1897 - Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien liegt bei 1.434.283 Hektoliter
München * Der Malzverbrauch aller Münchner Brauereien liegt bei 1.434.283 Hektoliter.
1897 - Carl Gabriel scheidet aus dem „Internationalen Handels-Panoptikums“ aus
München-Hackenviertel * Carl Gabriel scheidet aus der „Direktion“ des „Internationalen Handels-Panoptikums“ in der Neuhauser Straße aus.
Eduard Hammer führt das Unternehmen alleine weiter.
1897 - Die bayerischen Juden lehnen die „Zionistische Bewegung“ ab
München * Die „Israelitische Kultusgemeinde München“ wehrt sich massiv gegen die „Zionistische Bewegung“ von Theodor Herzl, der in der bayerischen Haupt- und Residenzstadt den ersten „Zionisten-Kongress“ abhalten will.
Herzl hat sich für München als Veranstaltungsort entschieden, weil „diese Stadt als gastfreundlich gilt und ein geeigneter Verkehrsmittelpunkt“ ist.
Der zionistische Gedanke, der auf die Verwirklichung einer jüdischen Nation mit einem eigenen Staat „Palästina“ hinzielt, wird von den bayerischen Juden abgelehnt.
Sie fühlen sich als deutsche Staatsbürger und sehen durch das zionistische Gedankengut ihre Bemühungen um Integration gefährdet.
Sie wollen alles unterlassen, was den antisemitischen Parolen von der „fremden jüdischen Rasse“ und „dass die Juden Liebe und Anhänglichkeit zu ihrem Vaterlande nicht besitzen“ neue Argumente liefern könnte.
Der Widerstand der Münchner Juden bewirkt, dass der erste „Zionisten-Kongress“ in Basel stattfinden muss.
1897 - Der Heumarkt ist in unmittelbarer Nähe des Schyrenbades
München-Untergiesing * In unmittelbarer Nähe des Schyrenbades findet nun auch der vom Städtischen Schlachthof an der Kapuzinerstraße dorthin verlegte Heumarkt statt. Der Heumarkt ist für die zahlreich vorhandenen Pferde der Fuhrunternehmer, Brauereien usw. unverzichtbar.
1897 - Die „Gesellschaft Hausmüllverwertung München“
München - Puchheim * Die Stadtverwaltung schließt mit der „Gesellschaft Hausmüllverwertung München“ einen Vertrag, worin sich die Stadt verpflichtet, dieser Gesellschaft den „gesamten Hausunrat ohne Ausnahme“ zur Trennung in verwertbare und nicht verwertbare Teile zu überlassen.
Die Gesellschaft baut dafür in Puchheim eigens eine entsprechende Anlage.
Die Stadt sorgt dafür, dass der „Müll“ mit der Eisenbahn nach Puchheim transportiert wird.
Aufgabe der Gesellschaft ist es, aus dem „Hausmüll“ landwirtchaftlich verwertbaren Dünger herzustellen und die hierfür nicht geeigneten Bestandteile des Mülls „hygienisch einwandfrei zu verwerten“.
Ausgesondert werden Glas, Papier, Knochen, Lumpen und Metalle, außerdem Gummi, Kork und Holz.
Was übrig bleibt, wird auf unfruchtbarem Moorgrund aufgeschüttet.
Nach Darstellung der „Süddeutschen Sonntagspost“ ist danach der Moorboden so fruchtbar, dass darauf sogar Futterrüben angebaut werden können.
1897 - „Miss Alwanda“ beeindruckt die Besucher des „Handels-Panoptikums“
München-Hackenviertel * „Miss Alwanda“ beeindruckt die Besucher des „Internationalen Handels-Panoptikums“ mit ihren Tätowierungen von verschiedenen europäischen Staatsoberhäuptern auf ihrem Körper.
Ab 1897 - In verschiedenen Etablissements werden die Filme vorgeführt
München * In verschiedenen Etablissements werden die Filme vorgeführt.
Feste „Filmtheater“ gibt es noch nicht. Neben „Konzertsälen“, verschiedenen „Theatern“, dem „Panoptikum“ und dem „Volksgarten“ dienen auch Gaststätten und Bierkeller als Filmvorführstätten.
1897 - Der Bau der „Heilig-Kreuz-Kirche“ ist nahezu vollendet
München-Obergiesing * Bis auf wenigen Ausnahmen ist der Bau der „Heilig-Kreuz-Kirche“ vollendet.
Den Innenraum der Kirche bestimmen lediglich drei Materialien: Stein, Holz und Gold. Bis auf die Glasmalereien der Fenster und die Seitenaltäre ist er völlig unfarbig.
Der „Hochaltar“ der „Heilig-Kreuz-Kirche“, mit einer Gesamthöhe von 16 Metern, ist - wie die meisten Einrichtungsgegenstände - Geschenke oder Stiftungen reicher Münchner Privatiers. Seine Plastiken werden mit einer grauen, steinfarbenen Fassung versehen, die Gewänder haben Goldsäume. Ebenfalls vergoldet ist der Hintergrund des Mittelbildes.
Das Kreuz gegenüber der Kanzel stammt noch aus der „alten“ Kirche.
Ab 1897 - Das um 25 Prozent in den Lohnkosten billigere „Fräulein vom Amt“
Deutsches Reich * Die Zahl der Beschäftigten im „Telephondienst“ nimmt zwischen 1897 und 1907 um fast das Vierfache zu.
Da ist die Kostenersparnis durch das um 25 Prozent in den Lohnkosten billigere „Fräulein vom Amt“ schon von erheblicher Bedeutung.
1897 - Der „Königliche Wintergarten
München-Graggenau * Die Halle aus Glas und Eisen, die den „Königlichen Wintergarten auf dem Festsaalbau der Münchner Residenz“ bedeckt hatte, wird abgebaut und auf dem Gelände der „Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg - MAN“ in Nürnberg wieder aufgerichtet.
Sie wird im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs zerstört.
1897 - Ein erster „Führer durch die Residenz zu München“ erscheint
München-Graggenau * Ein erster „Führer durch die Residenz zu München“ erscheint.
Täglich außer an Sonn- und Feiertagen kann die „Residenz“ besichtigt werden.
Ausgenommen sind natürlich die von der Herrscherfamilie noch bewohnten Zimmerfolgen.
1897 - Die „SPD“ fordert die „Trennung von Staat und Kirche“
München * Der „Bayerische Bauernbund - BBB“ fordert unter anderem
- die „Aufhebung der kirchlichen Schulaufsicht“ und
- die „Abschaffung der aristokratischen Ersten Kammer“.
Georg von Vollmar, der Führer der „SPD“ fordert die „Trennung von Staat und Kirche“ und kritisiert die „Vormundschaft der Kirche über die Lehrer“.
Das Zentrum sieht darin ein Streben nach „Entchristlichung der Schule“, wie sie auch den „Liberalen“ vorschwebe, und fordert im Umkehrschluss „die volle Emanzipation der Kirche von den Fesseln staatlicher Bevormundung“.
1897 - Ludwig Thomas Erstlingswerk „Agriccola“ erscheint
München * Ludwig Thomas Erstlingswerk „Agriccola. Bauerngeschichten“ erscheint.
1897 - In Deutsch-Südwestafrika bricht eine „Rinderpest“ aus
Deutsch-Südwestafrika * Die „Herero“ erwirtschafteten ihren Lebensunterhalt traditionell mit der „Rinderzucht“.
Als es im Jahr 1897 zu einer „Rinderpest“ ausbricht, werden die Herden der „Herero“ stark dezimiert.
Durch die zunehmende „Aneignung des Landes“, insbesondere wertvoller „Weidegründe“, durch die sich die „deutschen Siedler“ in den Besitz der Rinder bringen wollen, kommt es in der Folge zu empfindlichen Einbußen der „Herero“.
Das betrifft nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Werte.
Hinzu kommen noch „Betrügereien“ der Siedler.
Durch die daraus resultierende Verarmung waren viele „Herero“ gezwungen, Lohnarbeit auf deutschen Farmen anzunehmen. Andere, noch Vieh besitzende „Herero“, geraten immer öfter in Konflikte mit den „Siedlern“, wenn sie ihre Herden auf dem nunmehr von den Deutschen beanspruchtem Land weiden ließen.
Zornige „Siedler“ vertreiben die „Hirten“ oftmals gewaltsam.
Neben dem existenzbedrohenden Verlust immer größerer „Weidegebiete“ war es die „rassistische Diskriminierung der Herero“, die als Auslöser für den „Aufstand“ wirkt.
Weitere schwere Vergehen waren „Vergewaltigung“ und „Mord“, deren sich „Siedler“ gegenüber den „Herero“ schuldig gemacht hatten.
Dass diese Fälle vielfach nicht oder nur milde bestraft werden, verstärkt die Spannungen weiter.
1897 - Das Ende des Rügebrauchs vor Gericht
Miesbach * Insgesamt 98 „Verdächtigte“ des „Haberfeldtreibens“ vom 7./8. Oktober 1893 in Miesbach werden angeklagt.
95 Angeklagte werden wegen „Landfriedensbruch“ zu Gefängnisstrafen von neun Monaten bis zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.
Der Polizei- und Justizerfolg bringt das Ende des „Rügebrauchs“.
Zwischen 1901 und 1922 werden nur noch vier „Haberfeldtreiben“ gezählt.
9. 1 1897 - Im Deutschen Theater findet der erste Maskenball statt
München-Ludwigsvorstadt * Im Deutschen Theater findet der erste Maskenball statt. „Das mit Glühlichtern festlich beleuchtete Haus strahlte nur so von herrlichen Masken und Dominos“, heißt es in der Chronik. Es gibt eine strenge Kleiderordnung. Die Herren müssen im Frack erscheinen, die Damen im Domino, einem schwarz-weißen Abendkleid.
4. 2 1897 - Ludwig Erhard wird in Fürth geboren
Fürth * Ludwig Erhard, der spätere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sowie CDU-Vorsitzende, wird in Fürth geboren.
5. 2 1897 - Anton Graf von Arco auf Valley wird geboren
Sankt Martin * Anton Graf von Arco auf Valley wird in Sankt Martin im Innkreis, Oberösterreich, geboren. Sein Vater stammt aus dem bayerischen Adel, seine Mutter ist eine geborene Oppenheim aus der gleichnamigen jüdischen Bankiersfamilie.
4. 3 1897 - Valentin Ludwig Fey beginnt eine Lehre beim Schreiner Johann Hallhuber
München-Haidhausen * Valentin Ludwig Fey beginnt auf Wunsch seines Vaters eine Lehre beim Schreinermeister Johann Hallhuber in der Weißenburger Straße 28, Rückgebäude. Der Vater muss für seinen Buben insgesamt 500.- Mark Lehrgeld bezahlen.
Um den 8. 3 1897 - Franz Stuck erhält das Münchner Bürger- und Heimatrecht
München * Franz Stuck erhält das Münchner Bürger- und Heimatrecht übertragen.
15. 3 1897 - Franz Stuck heiratet Mary Lindpaintner
München * Franz Stuck heiratet Mary Lindpaintner, geborene Hoose, die Witwe des Münchner Arztes Julius Lindpaintner.
16. 3 1897 - 56 Turngenossen gründen den Arbeiter-Turn-Verein-München Ost
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * 56 sportbegeisterte Turngenossen gründen in einem Gaststättensaal an der Pariser Straße 30 den Arbeiter-Turn-Verein-München Ost. Der Arbeiter-Turn-Verein München-Ost hat die benötigte finanzielle Hilfestellung von der SPD und den Gewerkschaften erhalten. Damit können die Turner wieder ihre organisierten Übungsstunden abhalten. Als monatlichen Beitrag müssen die Mitglieder 50 Pfennige aufbringen.</p> <p>Im ersten Monat liegt das Beitragsaufkommen - inclusive Spenden - bei 28 Reichsmark. Nach Abzug von 40 Mark für die Anschaffung des notwendigen Turngeräts und der fälligen Turnhallenmiete muss ein Minderbetrag von zwölf Reichsmark von der SPD und der Gewerkschaft übernommen werden.</p> <p>Da es in Haidhausen keine anmietbare Turnhalle gibt, findet der Turnbetrieb des Arbeiter-Turn-Vereins München-Ost in den Nebenzimmern von Gaststätten statt. Dazu müssen die eigenen Geräte mitgebracht werden. </p>
4 1897 - Eine „Witwenverbrennung in Indien“ im „Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * Im „Internationalen Handels-Panoptikum“ wird eine „Witwenverbrennung in Indien“ und der „Tod eines lebenslänglich Verurteilten in den sibirischen Bergen“ gezeigt.
Mit solchen Darstellungen soll den Besuchern die Überlegenheit der westlichen Zivilisation insbesondere gegenüber der außereuropäischen Welt vor Augen geführt werden.
1. 5 1897 - Mata Hari wandert mit ihrem Mann nach Java aus
Amsterdam - Java * Das Ehepaar Margaretha Geertruida und John MacLeod reist nach Batavia, dem heutigen Jakarta, auf Java, in die damalige „Kolonie Niederländisch-Indien“, wo der Ehemann im Rang eines „Majors“ dient.
2. 5 1897 - Doris Hildegard Eisner wird in Marburg geboren
Marburg * Doris Hildegard Eisner, genannt Hildegard, Tochter von Kurt Eisner und seiner ersten Ehefrau Lisbeth, geb. Hendrich, kommt in Marburg zur Welt. Das Kind gehört keiner Konfession an.
Um den 6 1897 - Franz Stuck erwirbt ein Grundstück an der „Äußeren Prinzregentenstraße“
München-Haidhausen * Auf Betreiben seiner Frau erwirbt Franz Stuck ein Grundstück an der „Äußeren Prinzregentenstraße“ und beginnt umgehend mit den Planungsarbeiten für seine Villa.
24. 8 1897 - Stucks Baupläne werden genehmigt
München-Haidhausen * Franz Stuck legt der Lokalbaukommission die überarbeiteten Pläne für seine Künstler-Villa vor. Jetzt erhält er - nach Zustimmung der Königlichen Regierung von Oberbayern - die Genehmigung zum Bauen.
9 1897 - Johann Rössler soll mit seiner „Ochsenbraterei“ wieder auf die „Wiesn“
München-Theresienwiese * Johann Rössler erhält ein Schreiben vom Münchner Magistrat, in dem dieser ihn bittet, den Wunsch vieler Münchner zu erfüllen und die zur Attraktion gewordene „Ochsenbraterei“ wieder auf der „Wiesn“ zu präsentieren.
9 1897 - Die 24 Plätze für die Wirtsbuden werden jährlich neu versteigert
München-Theresienwiese * Die 24 Plätze für die Wirtsbuden werden jährlich neu an die meistbietenden „in München gewerbsberechtigten Inhaber von Schankwirtschaften“ versteigert.
26. 9 1897 - Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini wird nahe Brescia geboren
Concesio * Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, der spätere Papst Paul VI., wird in Concesio, nahe Brescia, geboren.
11 1897 - Junge, leicht bekleidete Modelle im Goldrahmen
München-Hackenviertel * Im „Internationalen Handels-Panoptikum“ werden „lebende Gemälde“ vorgeführt.
Junge, leicht bekleidete Modelle stellen im Goldrahmen vor dem entsprechenden Hintergrund bei passender Beleuchtung bestimmte Themen wie „Morgen, Nacht, Amor, Salome“ dar.
14. 11 1897 - Kaiser Wilhelm II. lässt die Kiautschou-Bucht besetzen
Kiautschou-Bucht - China * Nachdem am am 1. November 1897 zwei deutsche Missionare ermordet worden sind, lässt Kaiser Wilhelm II. die Kiautschou-Bucht besetzen. Die Aktion ist jedoch keinesfalls eine spontane Reaktion auf die Ermordung der Deutschen, sondern nur der offizielle Vorwand eines über Jahre sorgfältig vorbereiteten Unternehmens.
6. 12 1897 - Kolonien für die zu spät gekommene Nation
Berlin * Der spätere deutsche Reichskanzler Bernhard von Bülow fordert „einen Platz an der Sonne“ für die angeblich „zu spät gekommene Nation“, wobei neben dem Besitz von Kolonien ein Mitspracherecht in allen kolonialen Angelegenheiten gemeint ist.
31. 12 1897 - Die Biereinfuhr nach München beträgt 9.295 Hektoliter
München * Die Biereinfuhr nach München beträgt 9.295 Hektoliter. Sie hat sich seit 1830 nur um 636 Hektoliter erhöht.
31. 12 1897 - Der Bierverbrauch in München beträgt 1,7 Millionen Hektoliter
München * Der Export Münchner Bieres liegt bei 1,5 Millionen Hektoliter. Der Bierverbrauch in München beträgt 1,7 Millionen Hektoliter.
1898 - Ernst Philipp Fleischers Panorama „Kaiser Franz Joseph und seine Zeit“
München-Bogenhausen * Der Panoramenmaler Ernst Philipp Fleischer fertigt das Rundgemälde „Kaiser Franz Joseph und seine Zeit“.
1898 - Die hohe sozialpolitische Bedeutung der Herbergen
München-Au * Dr. Joseph Freudenberger schreibt über die hohe sozialpolitische Bedeutung der Herbergen: Es ist „nicht zu verkennen, daß sie gegen die sozialistischen Irrlehren vielfach feit, die ja bekanntlich darauf hinausgehen, Unzufriedenheit und Haß zu säen, und den diesen Gefühlen Verfallenen zum Kampfe gegen die Besitzenden aufzustacheln, wogegen jeder, der einen, wenn auch noch so kleinen Besitz hat, veranlaßt und verpflichtet ist, für Erhaltung der bestehenden Verhältnisse einzutreten.
Nimmt man ihm aber diesen Besitz, fertigt man ihn und seine Ansprüche mit einer schnöden Summe Geldes ab, so wirft man ihn der Umsturzpartei [gemeint waren damit die Sozialdemokraten] förmlich in die Hände.“
1898 - Carl Ungerer lässt sich das Doppelhaus Brienner Straße 38/40 erbauen
München-Maxvorstadt * Der Fabrikant Carl Ungerer lässt sich das hochherrschaftliche Doppelhaus an der Brienner Straße 38/40 erbauen. Architekt ist Eugen Drollinger. Carl Ungerer lebt hier bis 1905.
1898 - Das Münchner Arbeitsamt vermittelt Arbeitsplätze
München-Isarvorstadt * Das Münchner Arbeitsamt ist die Hauptvermittlungsstelle für die Bezirke Oberbayern, Schwaben und Neuburg. Seine Hauptaufgabe ist, möglichst viele am Münchner Arbeitsmarkt gemeldete Arbeitslose auf das Land zu vermitteln.
Doch für die Landbevölkerung stellt das Leben in der Stadt die wünschenswertere Perspektive dar, weshalb die meisten Zuzügler nicht zur Rückkehr zu bewegen sind. Deshalb bietet man diesen Arbeitern und Dienstboten nur mehr landwirtschaftliche Stellen an. Die anderen Stellenangebote werden dagegen nur den Münchnern vorgelegt.
1898 - Die arische Wiener „Alpine Gesellschaft D‘Reichensteiner“
Wien * Die Wiener „Alpine Gesellschaft D‘Reichensteiner“ beschließt bei ihrer Gründung einen Arier-Paragraphen, um damit jüdische Mitbürger von der Mitgliedschaft auszuschließen.
1898 - Die Feuerwehr und die Vergnügungsetablissements
München * In der Feuerdienstordnung der königlichen Polizei-Direktion München wird die „Vorgehensanweisung für Vergnügungsetablissements“ festgeschrieben.
1898 - Im Oberpollinger müssen zehn Tische entfernt werden
München-Kreuzviertel * In der Folge des Pariser Basarbrands müssen im Oberpollinger zur Freihaltung von Fluchtwegen zehn Tische entfernt werden. Damit verringern sich die Sitzplätze von 300 auf 220, was natürlich den Umsatz und damit das Einkommen der Gastronomie und der auftretenden Künstler erheblich schmälert.
1898 - Hohe Geldstrafen für Verstöße gegen die Betriebsordnung
Berg am Laim * Bei der Firma Franz Kathreiner's Nachfolger beträgt das Wochenleistungsmaß 57 Stunden.
- Die Beschäftigten müssen nach der geltenden Betriebsordnung um 7 Uhr morgens im Betrieb sein und dürfen ihn vor abends 19 Uhr nicht mehr verlassen.
- Es gibt zwar eine allgemeingültige Gewerbeordnung für alle Unternehmen, doch wird diese durch innerbetriebliche spezielle Arbeitsordnungen, in der die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer noch eindeutiger festgelegt sind, ergänzt.
- Verstöße gegen diese Hausordnung werden durch von der Firmenleitung einseitig festgelegte Geldstrafen geahndet.
- Es gibt eine Paragraphen-Liste für die sogenannten „50-Pfennig-Strafen“. Diese können fällig werden, wenn ein Beschäftigter während der Arbeitszeit schlafend angetroffen wird. Das ist zwar ein nicht akzeptierbares Verhalten, doch bei einer 57-Stunden-Arbeitswoche, oftmals verbunden mit schweren körperlichen Arbeit kann das schon vorkommen.
- Selbst das Führen von Unterhaltungen am Arbeitsplatz, die von der Geschäftsleitung als „arbeitsstörend“ eingestuft werden, führen zu dieser Strafe. Das gilt gleichfalls für das „Müßiggehen“ in den Geschäftsräumen.
- Daneben regelt die Arbeitsordnung das Verhalten der Arbeitnehmer. So darf niemand die Arbeit niederlegen, bevor nicht das Glockenzeichen oder die Dampfpfeifen ertönt sind.
- Die Geldstrafen für Verspätungen sind bei der Firma Franz Kathreiner's Nachfolger GmbH noch differenzierter geregelt. Da müssen jene Beschäftigte, die zu spät an ihren Arbeitsplatz kommen, außer beim ersten Mal, eine Mindeststrafe von 20 Pfennigen entrichten. Sind die Verspätungen größer als zwanzig Minuten, dann ist pro Minute ein Pfennig fällig.
1898 - Anderl Welsch tritt zwischen 1898 und 1905 im Apollotheater auf
München-Maxvorstadt * Anderl Welsch tritt zwischen 1898 und 1905 im Apollotheater in der Dachauer Straße 19 - 21 auf.
1898 - Die Münchner Architektur ist auch im Ausland ein Qualitätsbegriff
München * Um die Jahrhundertwende ist die Bezeichnung Münchner Architektur auch im Ausland ein Qualitätsbegriff. Speziell zwei Gebäudetypen werden dabei zu einem beliebten Exportartikel: der Bierpalast und das Schulhaus.
Natürlich ist die Konzeption des Schulhausbaues eine langjährige Entwicklung, doch mit Carl Hocheders Volksschule am Kolumbusplatz ist der vorläufige Höhepunkt erreicht. Schulgärten, Brausebäder und die Turnsaalanbauten sind feste Bestandteile in den Volksschulen. Schulküchen, Schulwerkstätten und Horte werden bei Bedarf eingefügt. Die Bauform ergibt sich durch Aneinanderschieben der L-förmigen Jungen- und Mädchentrakte. An der Gelenkstelle entstehen die übereinanderliegenden Turnsäle.
1898 - Die Radrennbahn auf der Theresienwiese stellt ihren Betrieb ein
München-Theresienwiese * Die Radrennbahn auf der Theresienwiese stellt ihren Betrieb ein.
1898 - „Krao, das Affenmädchen“ erneut im Internationalen Handels-Panoptikum
München-Hackenviertel * „Krao, das Affenmädchen“, die junge Frau aus Burma mit der Ganzkörperbehaarung, lockt - nach 1895 - erneut die Besucher ins Internationale Handels-Panoptikum an der Neuhauser Straße 1.
1898 - Josef Turner eröffnet im Frankfurter Hof eine Volkssänger-Bühne
München-Ludwigsvorstadt * Im Frankfurter Hof wird von dem Pächter Josef Durner eine Volkssänger-Bühne eröffnet, in der die Gesellschaft von Hans Blädel spielt, bis sie 1907 in den Peterhof am Marienplatz umzieht.
1898 - Der Bäcker Josef Bernbacher verkauft sein Brot in der Quellenstraße 42
München-Au * Der Bäcker Josef Bernbacher verkauft sein Brot in der Quellenstraße 42.
1898 - Das sogenannte Fünf-Prozent-Grün wird eingeführt
München - München-Haidhausen * Mit einer Ministerialentschließung wird das sogenannte „Fünf-Prozent-Grün“ eingeführt. Diese legt fest, dass in allen zu erstellenden Baulinienplänen fünf Prozent der Gesamtfläche als Grünanlagen und Spielplätze auszuweisen sind. Haidhausen und das Franzosenviertel ist mit Grünanlagen nicht gerade gesegnet. Eine Begründung lässt sich auch darin finden, dass eine Sicherung von Grünanlagen ohne staatliche Verordnung seinerzeit nicht denkbar ist. Daran hat sich übrigens bis heute nichts geändert.
Bei der Bebauung eines Gebiets durch Terraingesellschaften sind die Flächen unentgeltlich an die Stadt abzutreten. Diese städtebaulich und sanitär bedeutende Entscheidung betrifft anfänglich nur die großen Grundbesitze, da die entsprechenden fünf Prozent hier auch tatsächlich eine größere zusammenhängende Fläche ergeben. Später werden die Fünf-Prozent-Flächen durch Grundabtausch erstellt.
Zwar sind im Franzosenviertel mit dem Orleans-, Weißenburger-, Pariser- und Bordeauxplatz die ersten stadtteilbezogenen Grünanlagen geschaffen worden. Diese dienen jedoch mit ihren regelmäßigen Formen und überschaubaren Größen rein als Schmuckplätze und Mittelpunkt eines Wohngebiets. Zum Spielen und als Aufenthalt für Kinder sind sie jedoch nicht geeignet, da zudem noch der Straßenverkehr über diese Plätze führt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich im dicht besiedelten Franzosenviertel lediglich noch zwischen Orleans-, Lothringer- und Pariser Straße ein unbebautes Areal erhalten: die Postwiese.
Walter Heerde weist in seinem Haidhausen-Buch darauf hin, dass die Postwiese ihren Namen völlig zu unrecht trägt, „denn es handelte sich nicht um eine Wiese, sondern um eine große, häßliche Grube, die zwar von der Haidhauser Jugend von je her als Spielplatz und winterliche Rodelstätte benützt wurde, aber sonst einen Schandfleck und ein Sorgenkind Haidhausens bildete“.
Ab 1898 - Der Hundemarkt hat seinen Platz an der Schrannenhalle
München-Angerviertel * Der Hundemarkt hat seinen Platz an der Faßeiche am Schrannenpavillon.
1. 1 1898 - Die Richard-Wagner-Straße erhält ihren Namen
München-Maxvorstadt * Die kleine, 210 Meter lange Straße, welche an der Nordseite der Brienner Straße, unmittelbar gegenüber der einstigen Gartenvilla Richard Wagners, zur Gabelsbergerstraße führt, wird mit dem Namen Richard-Wagner-Straße benannt. Eine bereits vorhandene Richard-Wagner-Straße in Neuhausen ist kurz zuvor in Nibelungenstraße umbenannt worden.
15. 1 1898 - Eine Muster-Mülltonne wird eingeführt
München * Die Vorschrift tritt in Kraft, wonach „Neubeschaffene sowie nachbeschaffene Behälter in Bezug auf Maß und Form genau der beim Stadtbauamt aufbewahrten Mustertonne entsprechen“ müssen. Diese sind bis zum Jahr 1983 offiziell in Gebrauch.
28. 2 1898 - Das Wettrüsten mit Großbritannien wird ausgelöst
Berlin * Das Flottengesetz des Deutschen Reichstags in Berlin löst das Wettrüsten mit Großbritannien aus.
28. 2 1898 - Admiral Tirpitz erhält den Auftrag zum Aufbau einer Kriegsflotte
Berlin * Admiral Alfred Peter Friedrich Tirpitz erhält von Kaiser Wilhelm II. den Auftrag, eine Kriegsflotte aufzubauen, um England einzuschüchtern und zu Bündnisverhandlungen zu bewegen.
5 1898 - Die vier Bekrönungsfiguren auf der Villa Stuck werden aufgestellt
München-Haidhausen * Die vier Bekrönungsfiguren auf der Villa Stuck werden aufgestellt.
11. 6 1898 - Der Prinzregent eröffnet die II. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung
München-Isarvorstadt * Prinzregent Luitpold eröffnet die II. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung. Als Ausstellungsgelände dient die Kohleninsel, die auch „zu etwas anderem gut sei als zu schmutzigen Schuppen, nächtlichem Aufenthalt lichtscheuen Gesindels und ab und zu einer verschwiegenen Mord- oder Gewalttat“.
Der Ausstellungsbau ist ein gewaltiges Gebäude im neoklassizistischen Stil mit einer imponierenden, säulengeschmückten Eingangshalle, einem 45 Meter hohen Rundturm, dessen Aussichtsgalerie über einen elektrischen Fahrstuhl erreicht werden kann, und weiteren Nebengebäuden. Zusammen mit der integrierten Isarkaserne stehen rund 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung.
Architektonisch folgt man zwar den großen Vorbildern der Weltausstellungen, doch der schöne Schein ist trügerisch, denn die Bauten bestehen aus zusammengenagelten und weiß getünchten Brettern, die Säulen und der üppige Figurenschmuck sind lediglich Gips und Stuck - und damit nur für eine begrenzte Dauer konzipiert.
Im südlichen Teil der Insel erreicht man über einen Park das Hauptrestaurant. Dem gegenüber befindet sich das Automatenrestaurant, in dem man sich - eine absolute Neuheit für die Münchner - gegen Geldeinwurf verpflegen kann. Im Park gibt es außerdem eine große Gartenschau und täglich stattfindende Standkonzerte.
13. 6 1898 - Eingeschränkte Teilnahme an einer Hinrichtung
München * In Bayern dürfen nur noch solche Personen an einer Hinrichtung teilnehmen, die ein „ernstes Interesse“ an ihr bekunden können.
9 1898 - Die Ochsenbraterei ist wieder auf dem Oktoberfest vertreten
München-Theresienwiese * Die Ochsenbraterei ist - sehr zur Freude der Münchner - wieder auf dem Oktoberfest vertreten.
9 1898 - Georg Lang erhält die Genehmigung zur Aufstellung eines Großzeltes
München-Theresienwiese * Der aus Nürnberg stammende „Krokodilwirt“ Georg Lang erhält vom Stadtmagistrat - bei einer Gegenstimme - die Genehmigung zur Aufstellung eines Großzeltes, und das, obwohl Lang gleichzeitig drei Zulassungsbedingungen umgeht.
- Er stammt nicht aus München,
- bewirtschaftet seinen Wiesnausschank nicht selbst und
- baut seine Riesenhalle auf fünf Wirtsbudenplätze alter Größe. Diese lässt er über fünf Münchner Wirte als Strohmänner ersteigern und dort die „Lang‘s Riesenhalle“ errichten.
Da die Stadt nichts dagegen unternimmt, macht sie den Weg für die Bierhallen im großen Stile frei. Da diese Form des Bierausschanks finanzkräftige Investoren voraussetzt, verlagert sich die Trägerschaft von den Wirten auf die Brauereien.
Michael Schottenhamel war noch im Jahr 1881 mit dem selben Ansinnen vom Magistrat abgewiesen worden.
Um 9 1898 - Kurt Eisner erhält ein Job-Angebot beim Vorwärts
Berlin * Wilhelm Liebknecht bietet Kurt Eisner beim SPD-Parteiorgan Vorwärts eine Tätigkeit im Redaktionsteam an. „Eisner ist eine scharfe Klinge, die hoffentlich manchen Kopf abschlägt. Möglich, dass es uns endlich gelingt, das Blatt journalistisch zu heben.“
9 1898 - Georg Lang ist der Erfinder der Bierzelt-Stimmung
München-Theresienwiese * Der Krokodilwirt Georg Lang gilt als Erfinder der Bierzelt-Stimmung. Er engagiert für sein Festzelt eine eigene, dreißigköpfige Festkapelle, die in der Tracht auftritt und als „Lang‘s Original Oberlandler“ bekannt wird. Die Blaskapelle ist in Tracht gekleidet und greift auf ein breites Spektrum beliebter Unterhaltungsmusik zurück. Die Polizeibehörde hat gegen den Einsatz einer Hauskapelle, die noch dazu vom Festwirt bezahlt wird, keinerlei Einwände, da dadurch das lästige Sammeln der Musiker mit dem Teller entfällt.
Die revolutionäre Tat Georg Langs folgt einer Mode jener Jahre. In vielen Bierpalästen, Singspielhallen und Volkssängerlokalen sind Musikkapellen in Oberländer oder Dachauer Tracht gang in gäbe. Mit der Musik steigert er den Bierumsatz.
10. 9 1898 - Die österreichische Kaiserin Elisabeth wird in Genf ermordet
Genf * Die österreichische Kaiserin und Apostolische Königin von Ungarn, Elisabeth [Sisi], wird in Genf ermordet. Gegen 13:30 Uhr stößt ihr der 25-jährige italienische Anarchist Luigi Lucheni eine scharf geschliffene Feile ins Herz.
Kaiserin Elisabeth war zur falschen Zeit am falschen Ort, denn Ihr Mörder hat es ursprünglich nicht auf sie abgesehen, sondern auf den französischen Thronanwärter, den Prinzen Henri Philippe d’Orléans. Da das auserkorene Opfer aber kurzfristig seine Reisepläne änderte, ermordet Lucheni kurzerhand die 60-jährige Elisabeth, die im Hotel Beau Rivage abgestiegen war. Sisi bemerkt den Einstich nicht, kann ihre Vorhaben zunächst weiter verfolgen, bricht dann aber zusammen und stirbt um 14:40 Uhr.
10. 10 1898 - Die II. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung erbringt ein Defizit
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Die II. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung auf der Kohleninsel wird geschlossen. Trotz der 600.000 Besucher müssen die Veranstalter ein Defizit von 200.000 Mark zur Kenntnis nehmen.
29. 10 1898 - Ludwig Thomas erster Artikel erscheint im Simplicissimus
München * Ludwig Thomas erster Artikel erscheint im Simplicissimus. Thoma wird in der Folge über 800 Artikel für die Zeitschrift schreiben. Er benutzt dazu auch Pseudonyme wie „Peter Schlemihl“ oder „Schmiernazi“.
1. 12 1898 - Kurt Eisner wird Mitglied der SPD
Berlin * Kurt Eisner wird Mitglied der SPD.
1899 - Valentin Ludwig Fey arbeitet als Schreinergeselle bei verschiedenen Meistern
München-Maxvorstadt * Nach Ablegen seiner Gesellenprüfung arbeitet Valentin Ludwig Fey beim Schreinermeister Röder in der Arcisstraße 66 und später beim Schreinermeister Nürnberger, Barer Straße 70. Er verdient in der Woche zwischen 20.- und 25.- Mark.
1899 - Hubert Herkomer wird in den deutschen Adelsstand erhoben
Berlin * Hubert Herkomer wird von Kaiser Wilhelm II. zum Ritter des Ordens Pour le Merite für Künste und Wissenschaft ernannt.
1899 - Eine Villa für Rudolf Diesel in Bogenhausen
München-Bogenhausen * Zwischen 1899 und 1901 entsteht an der heutigen Maria-Theresia-Straße 27 die neobarocke Villa für Rudolf Diesel. Sie kostet 900.000 Mark.
1899 - Der zweite Bauabschnitt für das Neue Rathaus beginnt
München-Graggenau * Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Neuen Rathauses beginnen. Sie dauern bis 1909 an. Insgesamt 43 baierische Herrscher, davon eine Frau, sind am Neuen Rathaus angebracht worden. Es ist der größte Herrscherzyklus an einen deutschen Rathaus und ist als Antwort auf die Verherrlichung der Hohenzollern in der Berliner Sieger Allee zu verstehen. Insgesamt 102 Figuren und Figurengruppen schmücken das Neue Rathaus.
1899 - „... eine fast unausrottbare Abneigung gegen Lehmarbeit“
München * Die Tonindustrie-Zeitung stellt fest: „In den Alpenländern hat der Arbeiterstand eine fast unausrottbare Abneigung gegen Lehmarbeit, sodass es wirklich schwer fällt, einheimische Kräfte heranzuziehen.“
1899 - Joseph Schüleins Kampf mit dem Münchner Brauereibesitzerverein
München-Haidhausen * Die Haidhauser Unionsbrauerei, damals noch nicht Mitglied im Verein der Brauereibesitzer in München, hat - durch Unterbieten der Preise und Gewährung von Sonderkonditionen - mehrere unabhängige Wirte „an sich gerissen“. Das führt zu harten Auseinandersetzungen mit dem Münchner Brauereibesitzerverein.
1899 - Gabriele von Lenbach wird geboren
München-Maxvorstadt * Gabriele, die gemeinsame Tochter von Franz und Lolo von Lenbach kommt zur Welt.
1899 - Schon einer der ersten Filme verursacht einen Skandal
München-Hackenviertel * Schon einer der ersten im Internationalen Handels-Panoptikum gezeigten Filme verursacht einen Skandal. Er heißt „Endlich allein“ und zeigt ein Brautpaar am Hochzeitstag. Die Schlussszene wird umgehend zensiert. Auch in den folgenden Jahren sorgen Filme wie „Im Bad einer Pariserin“ oder „Im Chambre séparée“ für Aufregung.
Die Neue Bayerische Zeitung schreibt über das neue Medium Kino: „Es scheinen für dieses Etablissement überhaupt nur Nacktheiten als sehenswert und interessant zu existiren. Wir enthalten uns jeglicher weiterer Ausführungen und stellen nur die ergebene Anfrage: Wo bleibt die Münchner Sittenpolizei? Schläft sie oder existirt sie nicht mehr?“
Freilich werden neben solchen Filmen auch regelmäßig Aufnahmen von den verschiedenen und aktuellen Kriegsschauplätzen gezeigt.
1899 - Die erste Münchner Sportartikelschau
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Um das Defizit der II. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung etwas zu mindern, findet in der Ausstellungsanlage auf der Kohleninsel die Allgemeine Deutsche Sport-Ausstellung München statt. Es ist die erste Sportartikelschau, die in München durchgeführt wird.
1899 - Die arische Alpenvereins-Sektion Brandenburg des DuOeAV
Brandenburg * Die Alpenvereins-Sektion Brandenburg des DuOeAV wird ausschließlich für „christlich getaufte, deutsche Staatsbürger“ gegründet.
1899 - Eduard Theodor Grützner lässt sich von seiner Frau Anna scheiden
München-Haidhausen * Eduard Theodor Grützner lässt sich von seiner Frau Anna scheiden. Der Name seiner zweiten Ehefrau darf in seinem Haus nie mehr genannt werden.
1899 - Gründung eines Ludwig-II.-Denkmalvereins
München-Isarvorstadt * Der „Verein zur Erbauung eines Monuments für Weiland Seine Majestät König Ludwig II. e.V.“ wird gegründet. Er wird die Summe von 185.000 Mark sammeln und den Auftrag für ein 3,40 Meter hohes und von Ferdinand von Miller entworfenes und gegossenes Denkmal auf der Corneliusbrücke erteilten.
1899 - Die Parkanlage am Tassiloplatz wird angelegt
München-Au * Die Parkanlage am Tassiloplatz wird zwischen 1899 und 1901 an der Rückseite der zum Ostbahnhof führenden Gleisanlagen angelegt. Um den nahezu rechteckigen Platz führt ein geschwungener Weg mit kleinen ovalen und runden Sitzplätzen. Ein Diagonalweg durchschneidet die tiefergelegten Rasenflächen. An den Wegegabelungen befinden sich jeweils kleine Strauchgruppen. Eine Pflanzung aus Kastanien, Ulmen und Sträuchern schirmt den Park von den Straßen ab.
Die Ausstattung mit einem Betonteich macht den Tassiloplatz zur wohl typischsten Anlage um die Jahrhundertwende. Der dreihundert Quadratmeter große Teich mit seinen geschwungenen Uferlinien wird von Spöttern „Vierwaldstätter See en miniature“ genannt.
1899 - Ludwig Thoma verkauft seine Anwaltskanzlei in Dachau
Dachau * Ludwig Thoma verkauft seine Anwaltskanzlei in Dachau.
1899 - Ludwig Thoma polemisiert im Simplicissimus gegen politisierende Frauen
München * Ludwig Thoma polemisiert im Simplicissimus gegen politisierende Frauen mit den Worten: „Sie taugen nichts im Hause, nichts im Bett.“ Die Frauenrechtlerin Rosa Luxemburg ist für ihn eine „gebildete, blutlose Emanze“, die „sicherlich - was gilt die Wette? - mehr als ein Loch in ihren woll‘nen Strümpfen“ hat.
1. 1 1899 - Nymphenburg wird nach München eingemeindet
München-Nymphenburg * Die selbstständige Gemeinde Nymphenburg wird mit den Gemeindeteilen Ebenau, Gern und Hirschgarten nach München eingemeindet.
8. 1 1899 - Der Pasinger Kirchenbauverein wird gegründet
Pasing * Der Pasinger Pfarrer Engelbert Wörnzhofer gründet einen Kirchenbauverein zum Neubau der späteren Pfarrkirche Maria Schutz. Er kann dafür Prinz Ludwig [III.] als Schirmherrn gewinnen.
6. 3 1899 - Innerhalb des Turnvereins München von 1860 gründen sich die Fußballer
München-Isarvorstadt * Innerhalb des Turnvereins München von 1860 gründet sich eine vereinseigene Spielriege, aus der die Fußballer hervorgehen.
Ab 4 1899 - Aus dem „Hafer- und Heumagazin“ werden Büros
München-Haidhausen * Das künftig überflüssig werdende „Hafer- und Heumagazin“ über der „Motorwagenhalle“ wird zu neuen „Bureau-Lokalitäten“ für die „Straßenbahn-Direktion“ umgebaut.
15. 4 1899 - Leonhard Romeis Bebauungspläne werden genehmigt
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Lokalbaukommission genehmigt die von Leonhard Romeis vorgelegten Bebauungspläne für die Richard-Wagner-Straße.</p>
27. 4 1899 - Die Fußball-Abteilung des „TSV 1860 München“ wird gegründet
München-Isarvorstadt * Die Fußball-Abteilung des „TSV 1860 München“ wird gegründet, was fast einer revolutionären Tat gleichkommt.
Doch die Gruppe derer, die hinter dem Fußball herläuft, wird immer größer.
Ist schon die Gründung einer Fußball-Abteilung innerhalb eines Turnvereins nicht gerade einfach, so stellt die Suche nach einem geeigneten Spiel- und Trainingsplatz ein weiteres Problem dar.
Zur Abhaltung eines geregelten Übungs- und Wettkampfbetriebs braucht ein solcher Verein nicht nur eine beliebige freie Wiese, sondern einen gut planierten und gepflegten Rasen mit einem deutlich erkennbar abgegrenzten Spielfeld.
Die Vereine wenden sich deshalb an den „Magistrat der königlichen Haupt- und Residenzstadt München“ mit der Bitte um Mitbenutzung der bereits vorhandenen und nach den oben genannten Kriterien angelegten „Jugendturnspielplätzen“.
Der „Turnverein München von 1860“ stellte den Antrag auf Mitbenutzung des nahe dem Vereinsheim an der Auenstraße gelegenen „Jugendturnspielplatzes an der Schyrenwiese“ und kann daraufhin auf dem „Schyrenplatz“ - allerdings unter strengsten Auflagen - üben und Wettkämpfe veranstalten.
So darf der Platz nur im Sommerhalbjahr bespielt werden, an Regentagen oder bei noch nicht abgetrockneten beziehungsweise durchweichtem Boden jedoch nicht.
Jährlich - bis Mitte April - hat der Verein ein Gesuch einzureichen, in dem er seine Wünsche angibt, an welchem Tag und zu welcher Stunde er welchen Platz benutzen will.
Dabei muss der „Sportclub“ auf die Belegung durch die Schulgruppen Rücksicht nehmen.
Nach jeder Benutzung kommt ein Inspektor vorbei, um den Rasen abzunehmen.
Dabei kommt es öfter zu Schwierigkeiten, denn dem städtischen Beamten ist „ein geknickter Grashalm fast zu viel“, beschwert sich der „FC Bayern“, der seinen ersten Übungsplatz ebenfalls auf der „Schyrenwiese“ hat, in einer frühen Festschrift.
Die Fußballer des „Turnvereins München von 1860“ trainieren scheinbar lange Zeit und mit großer Ausdauer nur für sich alleine.
Bis zum Frühjahr 1908 spielen die Fußballer in den 1860-Vereinsfarben „grün-gold“
2. 5 1899 - Pater Rupert Mayer erhält die „Priesterweihe“
Rottenburg * Pater Rupert Mayer erhält in Rottenburg die „Priesterweihe“.
16. 5 1899 - Pläne für die Erweiterung des Münchner-Kindl-Kellers
München-Au * Friedrich von Thiersch und das Baugeschäft Heilmann & Littmann unterzeichnen Pläne für die Erweiterung des Münchner-Kindl-Kellers an der Rosenheimer Straße. Thiersch gestaltet einen in den Proportionen wesentlich verbesserten Bau in Formen des Jugend- und Heimatstils. Die Fassadengestaltung strahlt eine Münchner Behäbigkeit aus.
Der weit über Münchens Grenzen hinaus bekannte Biertempel wird so beschrieben: „Die neue Hauptfront des Erweiterungsbaues ist in Deutschrenaissance gehalten. Die Mitte des Baues besteht aus einem 25 Meter hohen Giebel, an dessen beiden Seiten Türme angebracht sind; eine geräumige Terrasse, von Kreuzgewölben getragen, mit seitlichen Treppentürmchen versehen, erstreckt sich in der Höhe des ersten Stockwerkes.
Dass man sich vor einem modernen Bierpalast befindet, kennt man sofort an der originellen, dekorativen Weise, in der der Bau ausgeführt ist. Die an Maßkrugdeckel erinnernden Turmhauben und das große Bild des Münchner Kindls aus farbigen Tonplatten an der oberen Giebelfläche ist der beste Beweis hierfür”.
- Mit einem Flächeninhalt von 1.600 Quadratmetern und einem Fassungsvermögen von über 5.000 Personen entsteht hier der größte Saalbau Münchens und der viertgrößte im Reich.
- Hinzu kommt noch ein 500 Plätze fassendes „Bräustüberl” und ein Biergarten, in dem ebenfalls 5.000 Sitzplätze zur Verfügung stehen.
Am weithin sichtbaren Giebel, der von zwei Türmen mit kupfergedeckten Hauben flankiert ist, findet sich ein Mosaik mit dem Münchner Kindl. Zwischen den Turmgeschossen sind stilisierte Eichenbäume mit Blattwerk angebracht. An der Ecke zur Hochstraße, an der die Stützmauer des Biergartens mit schönen alten Kastanienbäumen die Höhe eines Vollgeschosses erreicht, schiebt sich ein Balkon zur Straße vor, überwölbt von einem Bogen, auf dem ein maßkrugschwingendes „Münchner Kindl“ steht.
Thiersch hat die Baugruppe zu einem Blickfang an der von der Isar her ansteigenden Rosenheimer Straße gestaltet. Die Formensprache seines Anbaus zeigt keinerlei Anklänge an die Renaissancearchitektur des bestehenden Altbaus, der streng symmetrisch gegliedert war.
Sehr geschickt löst er die Aufgänge zum Biergarten und die Stützmauern aus Sichtbeton. Als Abschluss des Wirtschaftsgartens ist an der südlichen Grenze desselben noch eine gedeckte hölzerne Halle errichtet, die die unschönen Brandmauern der benachbarten Brauereien abdeckt.
26. 5 1899 - Jenny Eva Eisner wird in Groß-Lichterfelde geboren
Groß-Lichterfelde * Jenny Eva Eisner, genannt Eva, Tochter von Kurt Eisner und seiner ersten Ehefrau Lisbeth, geb. Hendrich, kommt in Groß-Lichterfelde zur Welt. Das Kind gehört keiner Konfession an.
Um 7 1899 - Der gesamte Straßenbahnbetrieb wird auf Elektrizität umgestellt
München-Haidhausen * Der gesamte Straßenbahnbetrieb wird auf Elektrizität umgestellt.
Umbauarbeiten sind notwendig, die sich aber beim „Depot“ an der Äußeren- Wiener-Straße - im Gegensatz zu anderen „Betriebshöfen“ - in Grenzen halten.
Mit der Elektrifizierung wird die Straßenbahn zum innerstädtischen Massenverkehrsmittel, das die Entstehung dezentraler Wohngebiete und damit das Flächenwachstum der Stadt fördert.
Das erhöht andererseits das Verkehrsaufkommen und fordert den weiteren Linienausbau.
Diese rasante Entwicklung wirkt sich natürlich auch auf den Haidhauser „Betriebshof“ aus.
16. 7 1899 - Der Friedensengel wird eingeweiht
München-Bogenhausen * Das Friedensdenkmals wird feierlich eingeweiht. Das ist „der Tag, an dem vor 28 Jahren die bayerischen Truppen ihren Siegeszug in München gehalten“ haben.
17. 7 1899 - Zentrum und SPD schließen ein Wahlbündnis
Bayern * Bei den Wahlen erhalten die Liberalen nur noch 44 Mandate [- 23], das Zentrum, der Bayerische Bauernbund und die SPD können leicht zulegen, die Sozialdemokraten ihr Ergebnis von fünf auf elf Mandate mehr als verdoppeln.
Bei dieser Wahl schließen das Zentrum und die SPD, die sonst nur wenig Gemeinsamkeiten haben, erstmals ein Bündnis, wonach sie sich gegenseitig in den drei Wahlbezirken München, Zweibrücken und Speyer ihre Stimmen geben, je nach den größeren Wahlchancen der örtlichen Kandidaten. Auf diese Weise sollen die Tücken des Mehrheitswahlrechts überwunden werden, wonach sämtliche Stimmen für die unterlegenen Kandidaten innerhalb eines Wahlkreises verfallen.
20. 7 1899 - Salvator wird ein gesetzlich geschütztes Warenzeichen
Berlin * Die Bezeichnung „Salvator“ wird vom Kaiserlichen Patentamt in Berlin als gesetzlich geschütztes Warenzeichen anerkannt. Der Firmenname wird daraufhin von Gebrüder Schmederer Aktienbrauerei in Paulaner-Salvator-Brauerei umbenannt.
15. 8 1899 - Gisela Royes wird im Hause Fey als Köchin angestellt
München-Au * Gisela Royes, Karl Valentins spätere Ehefrau, wird im Hause Fey als Dienstmädchen [Köchin] angestellt.
9 1899 - Die Beschränkung auf Münchner Wirte wird aufgehoben
München-Theresienwiese * In der Versteigerungsausschreibung für die Wirtsbuden wird auf die Beschränkung auf Münchner Wirte verzichtet. Davo profitiert hauptsächlich der aus Nürnberg stammende Krokodilwirt Georg Lang.
9 1899 - Verband zur Bekämpfung betrügerischen Einschenkens gegründet
München-Theresienwiese * Der Verband zur Bekämpfung betrügerischen Einschenkens wird gegründet. Sein Vereinsemblem zeigt einen am Galgen baumelnden Schankkellner. Die Vereinsmitglieder werden als „Drei-Quartl-Fuchser“ verunglimpft.
9 1899 - „Ein Prosit der Gemütlichkeit!“
München-Theresienwiese * Der Krokodilwirt Georg Lang führt auf dem Oktoberfest den Trinkspruch „Ein Prosit der Gemütlichkeit - Eins, zwei, drei, gsuffa!“ ein. Der Autor des Liedes ist Bernhard Dietrich aus Chemnitz, der auch Kirchenlieder komponiert.
Damit die Gäste die Stimmungslieder mitsingen können, verteilt Georg Lang Texthefte auf den Tischen. Mit Postkarten und Werbeartikel macht er auf sich aufmerksam. Der Festwirt lässt sogar Steckerl zum Taktschlagen und dirigieren an die Gäste austeilen.
13. 9 1899 - Die Luitpoldbrücke wird ein Opfer der Fluten
München-Bogenhausen * Die Isar schwillt auf 1.290 Kubikmeter in der Sekunde an. Bei diesem sogenannten Jahrhunderthochwasser wird die Luitpoldbrücke in Bogenhausen von den Fluten des Gebirgsflusses weggerissen.
13. 9 1899 - Erste Nachrichten über ein geplantes Theater am Prinzregentenplatz
München-Bogenhausen - München-Haidhausen * Die Münchener Neuesten Nachrichten berichten von einem geplanten Theaterprojekt am Prinzregentenplatz.
15. 9 1899 - Das erste Demonstrations-Fußballspiel auf Münchner Boden
München * Im Rahmen der Allgemeinen Deutschen Sportausstellung findet ein Demonstrations-Spiel statt. In diesem ersten offiziellen Fußballspiel auf Münchner Boden spielt eine Mannschaft aus der damals führenden süddeutschen Fußballstadt Karlsruhe gegen die noch junge Mannschaft des Männerturnvereins von 1879 - MTV, um beim Münchner Publikum Begeisterung für die Sportart des Association Football zu erzeugen. Das Spiel wird für die Münchner zum Desaster, denn die Karlsruher gewinnen mit 10:0 Toren.
Am Anfang distanzieren sich noch viele bürgerliche und Arbeiter-Turnvereine von dieser Form des Wettkampfsports. Verhindern können sie diese Sportart auf Dauer natürlich nicht, da sie sonst zu viele fußballbegeisterte Sportler an andere Vereine verloren hätten.
17. 9 1899 - Die neuen Büros der Straßenbahn-Direktion können bezogen werden
München-Haidhausen * Die neuen Bureau-Lokalitäten für die Straßenbahn-Direktion können bezogen werden.
28. 9 1899 - Beginn der Sitzungsperiode des 33. Landtags
Kreuzviertel * Die Sitzungsperiode des 33. Landtags dauert vom 28. September 1899 bis zum 11. August 1904. Ein erneuter Versuch der Änderung des Wahlrechts scheitert in beiden Kammern.
11 1899 - „Sioux-Indianer“ im „Internationalen Handels-Panoptikum“ ausgestellt
München-Hackenviertel - München-Schwabing * Eine Gruppe von „Sioux-Indianern“ wird im „Internationalen Handels-Panoptikum“ ausgestellt.
„Red-Tail“, ein Mitglied der Truppe stirbt in München an Tuberkolose.
Der Todesfall und die Beerdigung am „Schwabinger Friedhof“ sorgt für großes Aufsehen in der Presse.
11 1899 - Die USA und das „Deutsche Reich“ teilen sich die „Samoa-Inseln“
Samoa * Die „Vereinigten Staaten von Amerika“ und das „Deutsche Reich“ teilen sich die „Samoa-Inseln“ untereinander auf, wobei wobei das „Deutsche Reich“ den größeren Anteil der Insel in Besitz nehmen kann.
12 1899 - 2.000 Münchner Haushalte sind an das Elektrizitätsnetz angeschlossen
München * Bereits 2.000 Münchner Haushalte sind an das öffentliche Elektrizitätsnetz angeschlossen.
12 1899 - Theodor Fischers Bebauungskonzept für die „Kohleninsel“
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * „Stadtbaumeister“ Theodor Fischer entwickelt ein neues Bebauungskonzept für die „Kohleninsel“.
Eine kleine Idealstadt soll entstehen, „umrauscht von der Isar und mit Blick auf die Alpen“.
Nach Fischers Vorstellungen soll „um einen mit Brunnen und Monumenten geschmückten Platz, ähnlich den Marktplätzen in manchen Tiroler und altbayerischen Städten, gruppieren sich die verschiedenen malerischen Bauten mit offenen Lauben und Säulenhallen zu einem reizenden architektonischen Gesamtbild“.
Die Bebauung der „Kohleninsel“ sollte eine Art Münchner Gegenstück zur „Mathildenhöhe“ von Darmstadt werden. Doch der Magistrat lehnt die Planungen ab.
15. 12 1899 - Finanzielle Absicherung für einen Theaterneubau
München * Auf Betreiben Ernst von Possarts wird - noch bevor es einen offiziellen Bauherrn gibt - ein Vertrag geschlossen, der festgelegt, dass der geplante Theaterneubau für zehn Jahre und gegen einen geringen Zins an die Königliche Civilliste verpachtet und von der Königlichen Hofbühne bespielt werden wird.
Damit ist der Gewinn gesichert, weshalb die drei Immobiliengesellschaften des Konsortiums am darauffolgenden Tag die Gesellschaft Prinzregenten-Theater [GmbH] als Auftraggeber des Theaterneubaus gründen.
17. 12 1899 - Die Gesellschaft Prinzregenten-Theater wird gegründet
München * Die „Gesellschaft Prinzregenten-Theater [GmbH]“ als Auftraggeber des Theaterneubaus wird gegründet. Da trifft es sich gut, dass der Architekt Max Littmann noch vor der endgültigen Entscheidung über den neuen Theaterbau, fünf Projektskizzen für
- ein Wagnertheater nach Bayreuther Vorbild und
- Volkstheater ohne soziale Rangunterschiede,
- ausgestattet mit den modernsten bühnentechnischen Mitteln erstellt hat.
1900 - Die Anbaufläche für Baierwein ist auf 50 Hektar geschrumpft
<p><em><strong>Königreich Bayern</strong></em> * Die Anbaufläche für Baierwein ist auf 50 Hektar geschrumpft.</p>
Um 1900 - Das Haus Georgenstraße 8 wird vollständig umgebaut
München-Schwabing * Das Haus Georgenstraße 8 wird nach dem Entwurf von Josef Hoelzle vollständig umgebaut. Das palastähnliche Bauwerk im Wiener Ringstraßen-Stil wird dem päpstlichen Nuntius Eugenio Pacelli als Residenz angeboten. Eine Kapelle befindet sich im Osttrakt des Bauwerks.
1900 - Das Betz‘sche Wirtshaus wird als repräsentative Gaststätte neu gebaut
München-Bogenhausen * Das Betz‘sche Wirtshaus in Bogenhausen wird als repräsentative Gaststätte neu gebaut. In ihr gibt es die „Millionärs-Trinkstube“, in der sich unter anderen die „Heiligen Drei Könige von Bogenhausen“ treffen: Selmayr, Kaffl und der Wirt Betz.
Um 1900 - Ein Mörtelweib verdient weniger als die Hälfte des Mannes
München * Der durchschnittliche Stundenlohn für eine Speisträgerin, ein sogenanntes Mörtelweib, liegt bei 22 Pfennige. Ein männlicher Mörtelträger erhält für die gleiche Arbeit 50 Pfennige in der Stunde. Die Mörtelweiber arbeiten im Akkord und bilden zu je Zweien eine Partie, die in einer Trage den Mörtel, auch Speis genannt, zu den Maurern hinaufbringen.
Besonders in den Bauboom-Jahren vor der Jahrhundertwende sind die Mörtelweiber in ihren dicken, unförmigen und langen Röcken, ihren kalkzerfressenen Blusen und den straff gebundenen Kopftüchern, aus dem Münchner Stadtbild nicht wegzudenken. Den robusten und anspruchslosen Frauen und Mädchen, die für Hungerlöhne Fronarbeit leisten, ist der Aufbau Münchens in der Gründerzeit zu verdanken. Der Arbeitstag dieser Frauen beginnt um sechs Uhr früh; dabei befindet sich die Baustelle oft in der entgegengesetzten Richtung, irgendwo in Schwabing oder in Nymphenburg, was erstmals einen - zum Teil - mehrstündigen Fußmarsch - schon vor Arbeitsbeginn - bedeutet.
Zur Brotzeit „gönnt“ man sich eine Halbe Bier, ein paar „Maurerloabe und einige Radi“. Mittags gibts einen Krug Bier, mehrere Scheiben Brot und „ein Fünftel warmen Leberkäs’ minderer Sorte“. Das „Nachtessen“ besteht aus Bergen von gerösteten Kartoffeln mit Zwiebeln.
1900 - Umbenennung zum Verein Münchner Brauereien
München * Der Verein der Brauereibesitzer in München nennt sich in Verein Münchner Brauereien um.
1900 - Das Haus in der Richard-Wagner-Straße 27 ist bezugsfertig
München-Maxvorstadt * Das Wohn- und Geschäftshaus in der Richard-Wagner-Straße 27 ist bezugsfertig. Sein Eigentümer, Clemens Schuster, betreibt im Erdgeschoss sein Geschäft für Polsterei, Tapeten und Linoleum.
1900 - Otto Bohner lässt ein Haus in der Richard-Wagner-Straße 16/18 erbauen
München-Maxvorstadt * Der Installationsgeschäftsinhaber Otto Bohner lässt sich von Leonhard Romeis in der Richard-Wagner-Straße 16 und 18 ein Wohn- und Geschäftshaus erbauen.
Um 1900 - Brauereien stehen unangefochten an der Spitze der Münchner Wirtschaft
München * Die Brauereien stehen unangefochten an der Spitze der Münchner Wirtschaft.
1900 - Wirte können Singspielgruppen für 3 bis 5 Mark Tagesgage buchen
München-Hackenviertel * Über eine Agentur in der Sendlinger Straße können Wirte Singspielgruppen für 3 bis 5 Mark Tagesgage buchen.
1900 - Die Ringbahn um den Münchner Norden wird gebaut
München-Englischer Garten * Die Ringbahn um den Münchner Norden wird gebaut. Das Obersthofmeisteramt hat sich lange Zeit den Planungen widersetzt, da diese Bahnstrecke die Hofjagd stark beeinträchtigen würde.
1900 - Die Abwasserrohre münden noch direkt in die Isar
München * Rund 12.000 Anwesen und damit 78 Prozent der Einwohner sind an das Abwassersystem angeschlossen. Die Abwasserrohre münden allerdings noch direkt in die Isar.
1900 - Die 2.000. Lokomotive verlässt das Maffei‘sche Werk
München-Englischer Garten - Hirschau * Die 2.000. Lokomotive verlässt das Maffei‘sche Werk und wird an die Kgl. Bay. Staatsbahn geliefert.
1900 - Franz Stuck erhält auf der Pariser Weltausstellung eine Goldmedaille
Paris - München-Haidhausen * Franz Stuck erhält auf der in Paris stattfindenden Weltausstellung eine Goldmedaille für die Möbel im Empfangszimmer der Villa Stuck.
1900 - Die Spatenbrauerei wird Teilhaber am Deutschen Theater
München-Ludwigsvorstadt * Die Spatenbrauerei wird Teilhaber am Deutschen Theater.
1900 - Josef „Beppo“ Benz „erheiratet“ das Haus an der Leopoldstraße 50
München-Schwabing * Josef „Beppo“ Benz „erheiratet“ das Haus an der Leopoldstraße 50, in dem sich eine gutbürgerliche Gaststätte befindet. Die Benz-Kleinkunstbühne wird bald zum Stammlokal von Ludwig Thoma, Ignatius Taschner, Albert Langen, Ferdinand von Reznicek, Rudolf Wilke und Dr. Georg Hirth.
Im Jahr 1900 - An der Orleansstraße wird eine Notkirche für die Wolfgangskirche errichtet
München-Haidhausen * An der Orleansstraße wird eine Notkirche für die Wolfgangskirche errichtet.
Um das Jahr 1900 - Einstellungsbedingungen für Frauen im Fernsprechdienst
München * Für Frauen im Fernsprechdienst gelten folgende Einstellungsbedingungen:
- „Die Bewerberinnen - Mädchen oder kinderlose Witwen - müssen
- zwischen 18 und 25 Jahre alt sein,
- eine gute häusliche Erziehung erhalten und
- sich sittlich tadellos geführt haben,
- von entstellenden Gebrechen frei und
- körperlich vollkommen gesund sein,
- namentlich ein gutes Seh- und Hörvermögen sowie
- normale Atmungswerkzeuge besitzen und
- nicht zu Ohrenleiden, Nervosität und Bleichsucht neigen.
- Zur Einstellung als Telegraphengehülfin ist im allgemeinen eine Körpergröße von mindestens 158 cm erforderlich.
- Die Bewerberinnen dürfen keine Schulden haben.
- Es können in der Regel nur solche Bewerberinnen angenommen werden, welche in dem Orte der Beschäftigung dauernd festen Familienanhalt durch nahe Verwandte haben und bei diesen wohnen.
- Ausnahmen hiervon unterliegen der Genehmigung der Ober-Postdirektion. [...]
- Die Beschäftigung ist eine widerrufliche und gewährt keinen Anspruch auf Zulagen, Unterstützungen usw.
- Die Verheiratung hat den Verlust der Stelle zur Folge.“
Neben den günstigen Lohnkosten werden die Damen auch wegen ihrer - als weibliche Sozialisation beschriebenen - geschlechtsspezifischen Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit, Genauigkeit, Höflichkeit, Geduld, einfach „die ausgleichenden und vermittelnden Qualitäten der Frau“, eingestellt. Gerade in der Anfangsphase des Vermittlungsdienstes müssen die Frauen die Pannen, Störungen und Kapazitätsprobleme der Technik mit ihrer „natürlichen Veranlagung“ ausgleichen.
- Sie kommen meistens aus gutem Hause,
- sind unverheiratet,
- besitzen eine ordentliche Schulbildung - zum Teil sogar mit Fremdsprachenkenntnissen - und
- verfügen über einen einwandfreien Leumund.
Mit diesen Voraussetzungen garantieren sie ein adäquates Benehmen im Umgang mit den „sozial hochgestellten Telefonabonnenten“. Aus einer Vielzahl von Bewerberinnen können die bestqualifiziertesten Frauen ausgewählt werden, die aufgrund ihrer Vorbildung, Sozialisation und Jugend als hoch motivierte Arbeitskräfte mit wenig anderen Berufs- oder Aufstiegschancen anerkannt sind. Die jungen Damen haben eine Aufnahmeprüfung in Rechnen, Geographie und Aufsatz zu absolvieren. Nach einer halbjährigen Probezeit müssen sie eine mündliche Prüfung ablegen und praktisch beweisen, dass sie Telefon- und Telegrafenapparate bedienen können.
Die Tätigkeit in der Telefonvermittlung wird jetzt als dauerhafte Beschäftigung für Frauen verstanden. Wie schwer der Beruf der Telefonistin war, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, beispielsweise von der Größe der Stadt und der Art der Vermittlungsstelle. Die Arbeit einer Ortsvermittlungskraft gilt als monoton und - darüber sind sich die Arbeitsmediziner einig - stellt hohe Anforderungen an das Nervensystem. „Eine über mehrere Jahre tätige Telephonistin musste einfach hysterisch werden“.
- Die wöchentliche Arbeitszeit schwankt - je nach Schwere des Dienstes - zwischen 42 und 48 Stunden,
- nur jeder dritte Sonntag ist frei.
- Die Dienstschicht dauert elf Stunden;
- Urlaub gibt es keinen.
Der Durchschnittsverdienst einer Telefonvermittlungskraft liegt etwas über dem von weiblichen Kaufhausangestellten und etwas unterhalb der Einkünfte von Lehrerinnen. Nur einzelne Kräfte können zur Aufsicht aufrücken.
Während des Dienstes ist das Tragen einer einheitlichen Dienstbluse aus dunkelblauem Stoff vorgeschrieben, da man befürchtet, dass „bei der Eigenart der weiblichen Natur nur zu leicht ein gegenseitiges Überbieten in der äußeren Erscheinung Platz greifen würde“.
1900 - Afrika und Asien werden für die Landnahme auserkoren
Deutsches Reich * Im Deutschen Reich herrscht die Auffassung vor, dass das Alte Europa nicht genügend Platz hat, um die sich ständig vermehrende Bevölkerung auf Dauer angemessen zu ernähren und am Wohlstand teilhaben zu lassen. Afrika und Asien sind für die Landnahme auserkoren.
Aus der Evolutions-Theorie von Charles Darwin wird die Überlegenheit des weißen Mannes gegenüber anderen „Rassen“ abgeleitet.
1. 1 1900 - Eine Neubegründung von Herbergen ist künftig ausgeschlossen
Berlin - München * Das Bürgerliche Gesetzbuch - BGB tritt inkraft und schließt eine Neubegründung von Herbergen künftig aus.
1. 1 1900 - Die zweite „Samoa-Schau“ gastierte auch in München
Samoa - München * Die zweite „Samoa-Schau“ dauert vom 1. Januar 1900 bis 5. Dezember 1901. Im Dezember 1900 gastiert die Truppe auch in München.
1. 1 1900 - Thalkirchen wird mit Obersendling nach München eingemeindet
München-Thalkirchen * Die selbstständige Gemeinde Thalkirchen wird mit den Gemeindeteilen Maria-Einsiedel und Obersendling nach München eingemeindet.
1. 1 1900 - Laim wird nach München eingemeindet
München-Laim * Die selbstständige Gemeinde Laim wird nach München eingemeindet.
27. 1 1900 - Europäische Einrichtungen wollen vor den Boxern geschützt werden
Shandong - China * Die Kolonialmächte fordern die chinesische Regierung auf, europäische Einrichtungen vor den Boxern zu schützen.
Im Frühjahr und Sommer 1900 führen Attacken der sogenannten Boxerbewegung gegen Ausländer und chinesische Christen zu einem Krieg zwischen China und den Vereinigten acht Staaten, die sich zusammensetzten aus dem Deutschen Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Österreich-Ungarn, Russland und den USA.
Getragen wird der Boxeraufstand von den Verbänden für Gerechtigkeit und Harmonie. Die Boxer bekämpfen den europäischen, US-amerikanischen und japanischen Imperialismus. Die Bezeichnung Boxer bezieht sich auf eine traditionelle chinesische Kampfkunstausbildung, die sich selbst als Yihetuan, also Verband für Gerechtigkeit und Harmonie, nennt. Bei den Boxern handelt es sich um eine soziale Bewegung die sich zwischen 1898 und 1900 als unmittelbare Reaktion auf die Krisenstimmung gegen Ende des 19. Jahrhunderts gebildet hatte.
Ihr ursprünglicher Schwerpunkt lag in der Provinz Shandong, wo das Deutsche Reich“einige Bergbau- und Eisenbahnkonzessionen besaß. Im Frühjahr und Sommer 1900 breitet er sich dann über weite Teile Nordchinas aus.
Die Boxer machen die Ausländer und die chinesischen Christen für die Störungen der natürlichen Umwelt und der sozialen Harmonie verantwortlich. Sie fordern die Beseitigung der Feinde Chinas mit Gewalt, um die Harmonie wieder herzustellen und treten dabei als Unterstützer der herrschenden Quing-Dynastie auf. Eine ihrer Parolen lautet: „Unterstützt die Quing und vernichtet die Fremden.“
6. 2 1900 - Die „Lex Heinze“ wird beschlossen
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Im Reichstag wird die <em>„Lex Heinze“</em> beschlossen, die <em>„unsittliche"</em> Darstellungen in der Kunst verbietet.</p>
27. 2 1900 - Die Fußball-Abteilung des FC Bayern München wird gegründet
München * Die Fußball-Abteilung des FC Bayern München wird gegründet. Während sich innerhalb des Turnvereins München von 1860 - wie er damals noch hieß - eine eigene Fußballriege herausbilden kann, die den aus England kommenden Association Football pflegen, ist die Geburt des Fußballclubs Bayern München etwas komplizierter.
Zwar entstammen die Fußballer dem Männerturnverein von 1879 - MTV, der sich schon sehr früh dieser Sportart geöffnet hat und die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten fördert. Zur Abspaltung der Fußball-Abteilung vom MTV 1879 kommt es aber, nachdem sich
- die Deutsche Turnerschaft gegen diese ausländische Kampfsportart ausspricht,
- eine Doppelmitgliedschaft im Verband Süddeutscher Fußballvereine ablehnt und
- dem Männerturnverein von 1879 eine solche untersagt.
Daraufhin treten die Fußballer aus ihrem bisherigen Verein aus und gründen den Fußballclub Bayern München, der die Landesfarben weiß-blau als Clubfarben übernimmt.
3 1900 - Antisemitische Ausschreitungen im „Kreuzbräu“
München-Hackenviertel * Als der Wiener Gemeinderat Lucian Brunner im Münchner „Kreuzbräu“ im Auftrag des Historikers und Pazifisten Ludwig Quidde für den liberalen „Demokratischen Verein“ einen Vortrag halten soll, kommt es durch Parteigänger der „Christlich-Sozialen-Vereinigung“ zu Ruhestörungen und einer Massenschlägerei.
Als Quidde das Rednerpult betritt, „ging ein wütendes Gejohle und Gepfeife an, unterbrochen von Rufen: [...] „Raus mit dem Juden".
Am Veranstaltungslokal bringen die Antisemiten ein Plakat mit folgender Aufschrift an: „Hier werden wegen Kohlemangels Juden verbrannt“.
1. 3 1900 - Die deutsche Flagge wird über Samoa gehisst
Samoa * Die deutsche Flagge wird - als Zeichen der Inbesitznahme - über Samoa gehisst.
15. 3 1900 - Gründung des Goethe-Bundes zum Schutze freier Kunst und Wissenschaft
<p><em><strong>München</strong></em> * In München wird der <em>„Goethe-Bund zum Schutze freier Kunst und Wissenschaft“</em> gegründet. Ihm gehören unter anderen an: Paul Heyse, Max Halbe, Georg Hirth, Friedrich August von Kaulbach, Otto Falckenberg, Franz von Lenbach, aber auch der Volkssänger Jakob Geis. </p> <p>Das Ziel der Vereinigung ist, den <em>„Angriffen auf die freie Entwicklung des geistigen Lebens, insbesondere von Wissenschaft, Kunst und Literatur gemeinsam entgegenzutreten“</em>. </p>
21. 3 1900 - Ludwig Thoma ist festangestellter Chefredakteur beim Simplicissimus
München-Kreuzviertel * Ludwig Thoma wird festangestellter Chefredakteur beim Simplicissimus. Er will das Satire-Blatt zur „größten Kunstzeitschrift der Welt“ machen.
15. 4 1900 - Kaiserwitwe Cixi und die „Boxer“ als Verbündete gegen die Ausländer
<p><em><strong>Shandong - China</strong></em> * Die <em>„Boxer“</em> werden offiziell verboten. Da sich jedoch reguläre kaiserliche Truppen mit ihnen verbünden, lässt sich das Verbot nicht durchsetzen. </p> <p>Nun ändert die Kaiserinwitwe Cixi und ein Teil der hohen Beamtenschaft erneut ihre Meinung und beginnen, in den <em>„Boxern“</em> Verbündete gegen die Ausländer zu sehen. </p>
18. 4 1900 - Die Firma Heilmann und Littmann baut das Prinzregententheater
<p><em><strong>München-Bogenhausen - München-Haidhausen</strong></em> * Der Firma Heilmann und Littmann wird die Bauausführung für das neue Festspielhaus am Prinzregentenplatz übertragen.</p>
27. 4 1900 - Die Erdaushubarbeiten für das neue „Festspielhaus“ beginnen
München-Bogenhausen - München-Haidhausen * Die „Firma Heilmann und Littmann“ beginnt mit den Erdaushubarbeiten für das neue „Festspielhaus“ am Prinzregentenplatz.
5. 5 1900 - Die Firma Heilmann & Littmann bebaut den „Herzogpark“ mit Villen
München-Bogenhausen * Zunächst verkauft Graf Maximilian Joseph von Montgelas gleichnamiger Sohn seine Bogenhausener Besitzungen an Herzog Max in Bayern.
Über dessen Erben geht das Bauerwartungsland an die „Terrain-Aktiengesellschaft Herzogpark München-Gern“ von Jakob Heilmann und Max Littmann.
Unter der Bezeichnung „Herzogpark“ wird es mit Villen für betuchte Münchner Bürger bebaut.
18. 5 1900 - Die sogenannten Boxer beginnen ihre Attacken gegen Ausländer
Provinz Shandong - China * Die sogenannten Boxer beginnen ihre Attacken gegen Ausländer sowie gegen die an die Küste führenden Bahnlinien. Ausschreitungen fordern alleine an diesem 18. Mai 73 Todesopfer.
21. 5 1900 - Eine Versuchsvermittlungsstelle für 400 Teilnehmer in Hildesheim
Hildesheim * Mit der Technik der Strowger Automatic Telephone Exchange Company kann die Reichstelephonverwaltung eine Versuchsvermittlungsstelle in Hildesheim für 400 Teilnehmer in Betrieb nehmen. Diese ist jedoch noch ohne Verbindung zum öffentlichen Netz.
29. 5 1900 - Der Bauplatz für das Marianum an der Humboldtstraße 2 wird erworben
München-Untergiesing * Der Bauplatz für das Marianum für Arbeiterinnen e.V. an der Humboldtstraße 2 wird erworben und der Bau im Folgejahr fertiggestellt. Es dient Waisenkindern und behinderten Jugendlichen als Heim und Arbeitsstätte. Die Kosten für das Gebäude und den Bauplatz belaufen sich auf 270.000 Mark. Mehrere Lotterien unterstützten die Finanzierung der Sozialeinrichtung. Selbst eine Amateur-Kunstausstellung sorgt für Geld in der Kasse.
5. 6 1900 - Gerüchte über König Ottos I. Gesundheitszustand
München * Die Augsburger Abendzeitung meldet, dass König Otto I. an Blasenkrebs leidet. Die Meldung basiert auf Gerüchte.
6. 6 1900 - Wladimir Iljitsch Lenin trifft in München ein
München * Der russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin trifft während seiner Emigration in München ein. Er lebt hier illegal unter dem Namen Meyer.
17. 6 1900 - Deutsche Truppen erobern die Taku-Forts
Taku-Forts - Provinz Shandong - China * Deutsche Truppen erobern die Taku-Forts an der Mündung des Paiho-Flusses.
25. 6 1900 - Das Kuppelei-Gesetz „Lex Heinze“ tritt in Kraft
Berlin * Das Kuppelei-Gesetz „Lex Heinze“ tritt in abgeschwächter Form in Kraft.
7 1900 - Das „Deutsche Reich“ schickt 12.000 Soldaten nach China
Provinz Shandong - China * Das „Deutsche Reich“ schickt 12.000 Soldaten nach China.
7 1900 - Gegen die „Abschaffung der Prügelstrafe“
Windhuk * Die Bürger von Windhuk wehren sich gegen die „Abschaffung der Prügelstrafe“ mit folgender Begründung:
„Für Milde und Nachsicht hat der Eingeborene auf die Dauer kein Verständnis: er sieht nur Schwäche darin und wird infolgedessen anmaßend und frech gegen den Weißen, dem er doch nun einmal gehorchen lernen muss, denn er steht geistig und moralisch doch so tief unter ihm“.
Oftmals mit Lattenstöcken und Rhinozerospeitschen wurden die häufig nackt über ein Bierfass gebundenen Opfer so lange misshandelt, bis sie schwerste Verletzungen davontrugen.
Der „Kolonialbeamte“ Wilhelm Vallentin fasste seinen Eindruck in die Worte: „Ein rohes, gehacktes Beefsteak ist nichts dagegen!“.
27. 7 1900 - Kaiser Wilhelm II. hält seine berühmt-berüchtigte Hunnenrede
Bremerhaven * Kaiser Wilhelm II. hält in Bremerhaven seine berühmt-berüchtigte „Hunnenrede“. Anlässlich der Verabschiedung des deutschen Ostasiatischen Expeditionskorps zur Niederschlagung des Boxeraufstandes im Kaiserreich China spricht der Kaiser die Worte: „Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht!“
„Wie vor tausend Jahren die Hunnen [...] sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bestätigt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.“
Um den 15. 8 1900 - „Die gefangenen Chinesen haben wir alle totgeschossen
Berlin - Provinz Shandong - China * Im Reichstag verlesen Sozialdemokratische Abgeordnete Briefe von deutschen Soldaten, die an der brutalen Niederschlagung des Boxer-Aufstandes in China teilgenommen haben. Darin heißt es: „Die gefangenen Chinesen haben wir alle totgeschossen, aber auch alle Chinesen, die wir sahen und kriegten, haben wir alle niedergestochen und -geschossen“.
26. 8 1900 - Weitere Briefe von der Niederschlagung des Boxer-Aufstandes in China
Berlin - Provinz Shandong - China * In einem anderen Brief eines deutschen Soldaten, der an der Niederschlagung des Boxer-Aufstandes in China teilgenommen hat, heißt es: „68 Gefangene sind gezwungen worden, ihr eigenes Grab zu schaufeln; dann wurden sie mit den Zöpfen aneinander gebunden, worauf sie erschossen wurden und rückwärts in das Grab fielen.“
Oder ein anderer Bericht, der besagte: „Am Sonntagnachmittag haben wir 74 Gefangene mit dem Bajonett erstechen müssen.“
9 1900 - Die „Pschorr-Alm“ befindet sich auf dem Budenplatz Nr. 19
München-Theresienwiese * Die „Pschorr-Alm“ befindet sich auf dem Budenplatz Nr. 19.
12. 9 1900 - Die Familie Feuchtwanger zieht an die Galeriestraße 15 um
München-Graggenau * Die Familie Feuchtwanger zieht an die Galeriestraße 15 um.
21. 10 1900 - Das Museum für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen wird eröffnet
München-Au * In den aufgelassenen Räumen der München-Dachauer-Aktiengesellschaft für Maschinenpapierfabrikation, am Kegelhof 3 in der Au, wird das Museum für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen eröffnet Es ist das erste Museum dieser Art im deutschsprachigen Raum.
1. 11 1900 - Der Ostfriedhof wird eingeweiht
München-Obergiesing * Der Ostfriedhof wird eingeweiht. Die Baukosten betragen 1.052.510 Mark und sind für damalige Verhältnisse sehr hoch. Die Gräberanlagen werden nach Bedarf angelegt und deren Ausführung erst im Jahr 1912 abgeschlossen. Der 28,43 Hektar große Friedhof wird dann Platz für 34.300 Gräber bieten.
Zum ersten Mal in Deutschland werden die Grabdenkmäler und die Grabbepflanzung einem strengen Reglement unterworfen, das gleichzeitig mit der Eröffnung des Friedhofs in Kraft tritt. Der Architekt will dadurch die Gräber einer Sektion in einem Typus halten und die Gleichheit der Menschen vor dem Tod auf dem Friedhof nicht durch prunkvollen und teuren Grabschmuck durchbrechen. Seine Vorbilder sind die Friedhöfe von Glaubensgemeinschaften älterer Zeit und noch intakte Dorffriedhöfe in Oberbayern und Tirol.
Ein Zugeständnis an die bürgerliche Oberschicht Münchens schafft der Architekt Hans Grässel allerdings mit den Gruftarkaden in den Umfassungsmauern als traditionelle Grabplätze für das reiche Bürgertum. Interessenten wird allerdings zur Verpflichtung gemacht, „den Grabplatz, sei es durch Aufführung einer Kapelle, sei es durch eine sonstige offene, den ästhetischen Anforderungen entsprechende Überdachung, abzudecken“, um eine einheitliche architektonische Wirkung zu erzielen. Die Pläne mussten zur Baugenehmigung vorgelegt werden.
1. 12 1900 - Bayern hat 6.176.057 Einwohner
Königreich Bayern * Das Königreich Bayern hat 6.176.057 Einwohner.
31. 12 1900 - München hat 499.432 Einwohner
München * München hat 499.432 Einwohner. Davon sind lediglich 180.381 in München geboren.
1901 - Valentin Ludwig Fey arbeitet wieder beim Schreinermeister Hallhuber
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * Valentin Ludwig Fey arbeitet wieder als Geselle beim Schreinermeister Johann Hallhuber. Diesem entwendet er einen Nagel, <em>„schlug ihn in die Wand und hing an demselben das goldene Handwerk der Schreiner für immer auf“</em>.</p>
1901 - Die „Max-Joseph-Brücke“, Bogenhausens fünfte Brücke, entsteht
München-Bogenhausen * Die „Max-Joseph-Brücke“, Bogenhausens fünfte Brücke, entsteht.
Sie hält bis zum heuten Tag.
1901 - Für die „italienischen Arbeiter“ genügen die Zustände ohnehin
Oberföhring * Der „Oberföhringer Bürgermeister und Ziegeleibesitzer“ Fritz Meyer antwortet dem „Bezirksamt“ auf detaillierte Beanstandungen folgendermaßen:
„Für unsere italienischen Arbeiter [...], die sich vom frühen Morgen bis zum Eintritt der Dämmerung im Freien aufhalten und bei Eintritt der rauheren Jahreszeit wieder in ihre Heimat reisen, genügen die Dachschlafräume in den Trockenstädeln vollkommen.
Sie sind leicht ventilierbar und gegen Zugluft abgesperrt und wenn in denselben noch für genügend Abstand der Bettstellen, für mehr Licht, Ordnung und Reinlichkeit gesorgt wird, dann sind sie sogar gesund zu nennen.
Auf alle Fälle sind sie viel gesünder als die Schlafstätten der meisten Arbeiter in München“.
Die Auflage nach stabil gebauten „Toiletten“ nannte er „sehr wohl gemeint, praktisch aber wirkungslos“, denn, so der „Ziegeleibesitzer“ weiter, „der Italiener kennt am Haus keinen Sitzabort und geht auch bei uns nur ungern in einen solchen und wenn er nicht in nächster Nähe ist, gar nicht, und die für unsere Landwirtschaft so wertvollen Fäkalien gehen verloren“.
1901 - Die „Actien-Ziegelei München“ beteiligt sich am „Prinzregententheater“
München-Bogenhausen - München-Haidhausen * Die „Actien-Ziegelei München“ beteiligt sich mit 130.000 Goldmark an der für den Bau des „Prinzregententheaters“ zuständigen Gesellschaft.
1901 - Leonhard Romeis wird das Prädikat „sehr gut“ ausgesprochen
München-Maxvorstadt * Leonhard Romeis erhält in einer „Qualifikationsliste“ der Lehrer der „Kunstgewerbeschule“ in den Kategorien „Fleiß und Eifer“, „Lehr- und Erziehungsgabe“ und „Gesamtqualifikation“ jeweils das Prädikat „sehr gut“ ausgesprochen.
1901 - Die „weibliche Abteilung der Kunstgewerbeschule“
München-Maxvorstadt * Die „weibliche Abteilung der Kunstgewerbeschule“ erhält in der Richard-Wagner-Straße 10 eine neue Unterkunft.
157 „Schülerinnen“ nehmen am Unterricht teil. Der Architekt ist Leonhard Romeis.
1901 - Das „Restaurant Richard Wagner“
München-Maxvorstadt * Zwischen 1901 und 1914 ist in dem Haus an der Richard-Wagner-Straße 27 das „Restaurant Richard Wagner“ untergebracht.
1901 - Die Gebäude des „Bezirksamtes am Lilienberg“ werden renoviert
München-Au * Die Gebäude des „Bezirksamtes am Lilienberg“ werden renoviert.
1901 - Der „Salzburger Hof“ im Besitz der „Aktienbrauerei zum Eberl-Faber“
München-Haidhausen * Der „Salzburger Hof“ an der Rosenheimer Straße 1 kommt in den Besitz der „Aktienbrauerei zum Eberl-Faber“.
1901 - Die Gründung eines „Brockenhaus-Vereins“ wird geplant
München-Isarvorstadt - Museuminsel * Münchner Bürger beabsichtigen die Gründung eines „Brockenhaus-Vereins“.
Da man anfangs jedoch gegenüber dem Projekt finanzielle Bedenken äußerte, übernahm zunächst Kommerzienrat Kaspar Baerwindt das geschäftliche Risiko der karitativen Einrichtung als persönlich Haftender.
Die Stadt München stellt Räumlichkeiten auf der „Kohleninsel“ zur Verfügung.
1901 - Das „Panorama“ an der Theresienstraße 78 wird abgerissen
München-Maxvorstadt * Das „Panorama“ an der Theresienstraße 78 wird abgerissen.
1901 - Das „Maffei'sche Eisenwerk“ in der „Hirschau“ erhält einen Gleisanschluss
München-Englischer Garten - Hirschau * Das „Maffei'sche Eisenwerk“ in der „Hirschau“ erhält einen vom Prinzregenten Luitpold genehmigten Gleisanschluss zum „Schwabinger Güterbahnhof“.
Bis dahin mussten über 2.000 Lokomotiven auf Straßenfahrzeuge verladen werden.
Anfangs wurden die Maschinen von vielen Pferden, später von einer „Lokomobile“ durch die ganze Stadt zur „Zentralwerkstätte der Eisenbahn“ gezogen und dort mit den separat transportierten Radsätzen erneut zusammengebaut.
1901 - Das Ausflugslokal in der „Hirschau“ soll erweitert werden
München-Englischer Garten - Hirschau * Der Pächter des Ausflugslokals in der „Hirschau“ beantragt „einen Umbau vornehmen zu dürfen, da das Gastlokal zwar bis zum vorigen Jahr genügte, jetzt aber der Andrang zu dem Mittagstische so groß wird, besonders seitens der Arbeiter der Maffei'schen Fabrik, daß sich der Raum als unzureichend erweist“.
1901 - Das „Wasser- und Dampfkraftwerk der Maffei-Eisenwerke“ wird erweitert
München-Englischer Garten - Hirschau * Das „Wasser- und Dampfkraftwerk der Maffei-Eisenwerke“ wird erweitert.
Dazu werden die das Fabrikgelände durchziehenden Wasserläufe zum „Eisbach“ vereinigt.
In der neuen Kraftzentrale kommen drei „Francis-Turbinen“ mit einer Leistung von 1.000 PS zum Einsatz.
1901 - Die „Baumschule Bischweiler“ in den „Frühlingsanlagen“
München-Untergiesing * Die „Baumschule Bischweiler“ wird vom damaligen „Stadtgartendirektor“ Jakob Heiler als Teil der „Frühlingsanlagen“ geplant.
Ihren Namen hat die „Baumschule“ von der „Bischweilerstraße“ erhalten, die einst dort entlang führte. Die „Gartenanlage“ hat in ihrer Grundstruktur und ihrem Wegenetz die Zeiten überdauert.
Heute kultiviert das „Baureferat“ dort die „Ziergehölze“ für die städtischen Beete.
Doch trotz ihrer eher technokratischen Aufgabenstellung ist sie nicht nur eine „Baumschule“.
In „Themengärten“ lassen sich Blumen und Pflanzen mit allen Sinnen erleben.
Die „Stadtgärtner“ legten hier einen „Rosen- und Duftgarten“ an. Diese werden ergänzt durch einen „Tast-, Flieder- und Giftpflanzengarten“.
Die „städtische Baumschule“ ist auf „Zier- und Klettergehölze“ spezialisiert.
Über sechzig verschiedene Pflanzenarten und Sorten gibt es zu sehen.
Sie bestechen durch auffällige Blüten, Früchte und Farben.
Alle Pflanzen sind beschildert, sodass sich die Gartenfreunde Anregungen für ihren Garten holen können.
1901 - Die „Eisenbeton-Bahn“ im „Volksgarten“ wird wieder geschlossen
München-Nymphenburg * Die „Eisenbeton-Bahn“ im „Nymphenburger Volksgarten“ wird wieder geschlossen.
1901 - Doppelte Aufnahmekapazität durch den Neubau
München-Untergiesing * Durch den Neubau des „Marianums für Arbeiterinnen e.V.“ an der Humboldtstraße 2 kann die Zahl der aufzunehmenden Mädchen verdoppelt werden.
Die Zahl der ständigen Heimbewohner wächst auf 43, wovon die Hälfte körperliche Gebrechen hat.
Gearbeitet wird im „Nähsaal“, im „Goldsticksaal“, im „Weißsticksaal“, im „Blumenbindesaal“ oder in Einrichtungen zum „Wäschewaschen“ und „Feinbügeln“.
Mehrfach betonten die Geschäftsberichte, dass die Tage, „für welche Herr Reichsrat Freiherr von Cramer-Klett Chokolade mit Kuchen stiftete, freudig begrüßt waren“.
Ab 1901 - Für besonderes Aufsehen sorgen die „Damenringkämpfe“
München-Hackenviertel * Für besonderes Aufsehen sorgen die in den Jahren 1901/02 im „Internationalen Handels-Panoptikum“ abgehaltenen „Damenringkämpfe“.
1901 - Das „Hotel Oberpollinger“ wird an ein Textilunternehmen verkauft
München-Kreuzviertel * Das „Hotel Oberpollinger“ wird an ein Textilunternehmen verkauft.
1901 - Turnübungen im Wirtshaus-Nebensaal
München-Au * Nach einer vierjährigen Odyssee durch die verschiedensten Wirtshäuser des Münchner Ostens gelingt es dem „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ schließlich, im „Schleibinger Keller“ am Rosenheimer Berg, einen „großen Saal mit einem schönen Spielplatz“ anzumieten.
22. 1 1901 - Edward VII. besteigt in London den britischen Königsthron
London * Nach dem Tod von Queen Victoria besteigt Edward VII. in London den britischen Königsthron.
9. 2 1901 - Max von Pettenkofer stirbt in München
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Max von Pettenkofer erschießt er sich in seiner Wohnung in der Münchner Residenz. </p>
5. 3 1901 - Mathias Kneißl wird niedergeschossen und gefangen genommen
Geisenhofen bei Aufkirchen * Der „Räuber“ Mathias Kneißl wird im Aumacheranwesen in Geisenhofen bei Aufkirchen von einem aus sechzig Mann bestehenden Polizeiaufgebot aufgespürt, niedergeschossen und gefangen genommen.
Weil die Todesstrafe nur an gesunden Personen vollzogen werden darf, lästern die Bayern: „An Kneißl Hias hams zerst zuagricht, dann hamsn hergricht und erst dann hamsn higricht.“
4 1901 - Der Civilingenieur Karl Müller wird in den Adelsstand erhoben
<p><strong><em>München</em></strong> * Der <em>„Civilingenieur“</em> Karl Müller wird in den Adelsstand erhoben. Er nennt sich jetzt Ritter Karl von Müller.</p>
4 1901 - „20 schöne Mädchen“ im „Internationalen Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * Im „Internationalen Handels-Panoptikum“ finden „Elite- oder Separatvorstellungen“ nur für männliche Personen und Mitglieder wissenschaftlicher Vereine unter dem Titel „20 schöne Mädchen“ statt.
13. 4 1901 - „Die Elf Scharfrichter“ eröffnen ihre Bühne
München-Maxvorstadt * „Die Elf Scharfrichter“ eröffnen ihre Bühne in der Türkenstraße 28.
Um den 6. 6 1901 - Der Kirchenbauverein fordert ein evangelisches Schulhaus
München-Haidhausen * In Haidhausen gibt es vier evangelische Knaben- und fünf evangelische Mädchenklassen. Da aber die protestantischen Klassen in der Unterbringung gegenüber den katholischen Klassen wesentlich benachteiligt sind, fordert der evangelische Kirchenbauverein die Erbauung eines evangelischen Schulhauses in Haidhausen.
19. 6 1901 - Das Gesetz betreffend das Urheberrecht wird verabschiedet
Berlin * Das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst wird verabschiedet.
20. 6 1901 - Der Antrag für ein evangelisches Schulhaus wird genehmigt
München-Haidhausen * Die Lokalschulkommission entspricht dem Antrag des evangelischen Kirchenbauvereins auf Errichtung einer evangelischen Schule in Haidhausen.
15. 7 1901 - Der Glaspalast-Brunnen wird vor dem Ostbahnhof aufgebaut
München-Haidhausen * Der aufwändige, mit romanischen und gotischen Ornamenten geschmückte Schalenbrunnen aus dem Münchner Glaspalast wird vor dem Ostbahnhof neu aufgestellt und in Betrieb genommen.
Der Glaspalastbrunnen war 1879 abgebaut und in der Zwischenzeit in einem Bauhof einglagert worden.
27. 7 1901 - Prinzregent Luitpold besucht erstmals das seinen Namen tragende Theater
Bogenhausen - Haidhausen * Der fast 80-jährige Prinzregent Luitpold besucht erstmals das seinen Namen tragende Theater „Von der Galerie über der Haupteinfahrt tönten während der Auffahrt Fanfaren und der Einzug der Götter in Walhall aus Rheingold.“ Generalintendant Ernst von Possart hält eine Ansprache und der Prinzregent dankt ihm mit der Verleihung eines Ordens.
6. 8 1901 - Der Probenbetrieb für die Festspiele beginnt
München-Bogenhausen - München-Haidhausen * Auf der Bühne des neuen Festspielhauses am Prinzregentenplatz beginnt der Probenbetrieb für die Festspiele.
24. 8 1901 - Die Süddeutsche Bauzeitung beschreibt das Prinzregenten-Theater
München-Bogenhausen - München-Haidhausen * Die Süddeutsche Bauzeitung schreibt über das Prinzregenten-Theater:
„Das Amphitheater des Prinzregenten-Festspielhauses umfaßt 1.028 Plätze gegen 1.345 des gleich großen Bayreuther Hauses. [...] Die Begeisterung für den hohen Kunstgenuß kann nur bis zu einer gewissen Grenze über die Unbilden eines Martersitzes nach dem Bayreuther Muster hinwegtäuschen und die Durchschnittskorpulenz jener Gesellschaftsklassen, welche sich zur Ausgabe von M. 20 für die Karte und M. 30 für ein Zimmer versteigen können, erfordert gewisse Rücksichtnahmen.“
9 1901 - Carl Gabriel präsentiert das „Beduinen-Lager“ auf dem „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Carl Gabriel präsentiert auf dem „Oktoberfest“ mit dem „Beduinen-Lager“ erstmals eine seiner berühmten „Völkerschauen“.
Auf einem 7.500 qm großen „Karawanenplatz“ baut er ein „Beduinendorf“ auf und bietet damit seinen Besuchern neben speziellen Darbietungen aus einem Rahmenprogramm auch Einblicke in das Alltagsleben dieses „fremdartigen Volksstammes“.
9 1901 - In der „Ochsenbraterei“ wird der 200. Ochse gebraten
München-Theresienwiese * In der „Ochsenbraterei“ wird der 200. Ochse gebraten.
9 1901 - Das „Schottenhamel-Festzelt“ wird elektrisch beleuchtet
München-Theresienwiese * Das „Schottenhamel-Festzelt“ wird mit elektrischen Bogenlampen beleuchtet, was die Gäste „zu Begeisterungsstürmen hinreißt“.
9 1901 - Das „Bräurosl-Festzelt“ wird mit elektrischen Glühbirnen beleuchtet
München-Theresienwiese * Das „Bräurosl-Festzelt“ wird mit elektrischen Glühbirnen beleuchtet.
Die vom preußischen „Hofmaler“ Schultheiss gemalte „Bräurosl“ ziert die ehemalige „Pschorr-Alm“.
Es soll sich um die Brauertochter Rosl Pschorr handeln, die jeden Abend ihre Runden auf einem Bräuross drehend eine Mass Bier geleert haben soll. Ob‘s wahr ist?
14. 11 1901 - Der Prozess gegen den Räuber Mathias Kneißl beginnt
Augsburg * Der Prozess gegen den Räuber Mathias Kneißl beginnt vor dem Oberlandesgericht Augsburg. Nach vier Verhandlungstagen fällen die zwölf Geschworenen das Urteil: Mathias Kneißl wird zum Tode verurteilt. Ein eingereichtes Gnadengesuch lehnt Prinzregent Luitpold ab. Der Ablauf des Gerichtsverfahrens und das Urteil selbst sind heftig umstritten.
Seit 1902 - Karl Valentin beginnt mit dem Bau eines „Orchestrions“
München-Au * Karl Valentin beginnt mit dem Bau eines gigantischen, über 300 kg schweren Musikapparats, dem „Orchestrion“, das aus mehr als 20 Musikinstrumenten besteht.
Ab 1902 - Benno Beckers Villa in der Maria-Theresia-Straße 26
München-Bogenhausen * Benno Becker, „Landschaftsmaler“ und „Schriftführer der Münchner Secession“, lässt sich in der Maria-Theresia-Straße 26 eine Villa erbauen.
Die Pläne stammen von Paul Ludwig Troost, der 30 Jahre später zum „Lieblingsarchitekten“ Adolf Hitlers aufstieg.
1902 - Eine 17-stündige Arbeitszeit in der Ziegelei
Oberföhring * Ein Arbeitsvertrag der „Ziegelei Grimmeisen“ in Oberföhring legt die tägliche Arbeitszeit in den Monaten Mai mit August zwischen „4 Uhr früh und 9 Uhr abends“ fest.
1902 - Die „Unionsbrauerei“ beschäftigt 168 männliche und 5 weibliche Kräfte
München-Haidhausen * Die „Unionsbrauerei“ in Haidhausen beschäftigt 168 männliche und 5 weibliche Kräfte.
1902 - Emil Zeckendorf lässt das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 bebauen
München-Maxvorstadt * „Kommerzienrat“ Emil Zeckendorf lässt das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 durch Leonhard Romeis bebauen.
Der Mitbegründer der „Getreidegroßhandlung Bauer & Zeckendorf“ bewohnt mit seiner Frau, zwei Kindern und zwei weiblichen Dienstboten das Erdgeschoss und das „Piano Nobile“.
Im 2. Stock lebt der „Kaufmann“ Markus Cohen mit fünf Personen, darunter ein Dienstmädchen.
1902 - Adolph Brougier lässt das Miethaus in der Richard-Wagner-Straße 3 bauen
München-Maxvorstadt * Leonhard Romeis baut für den „Rentier“ und „Kommerzienrat“ Adolph Brougier das Miethaus in der Richard-Wagner-Straße 3.
Auf fünf Etagen sind neun Wohnungen untergebracht, in denen 49 Menschen, darunter zwölf weibliche Dienstboten, leben.
1902 - Heinrich Nöhbauer und das Anwesen Richard-Wagner-Straße 5
München-Maxvorstadt * Architekt Leonhard Romeis errichtet für den „Schankwirt“ Heinrich Nöhbauer das Anwesen Richard-Wagner-Straße 5.
Auf fünf Stockwerken befindet sich je eine Wohnung.
1902 - Karl Wildt bebaut das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9
München-Maxvorstadt * Leonhard Romeis bebaut für den „Ingenieur“ Karl Wildt das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9.
Um 1902 - Fritz Gerlich wird Mitglied in der „Nationalsozialistischen Partei“
München * Fritz Gerlich wird Mitglied in der „Nationalsozialistischen Partei“ und ist längere Zeit ehrenamtlich als Sekretär des „Liberalen Arbeitervereins München“ tätig.
1902 - Die ältesten Münchner Filmaufnahmen entstehen
München-Kreuzviertel * Die ältesten Münchner Filmaufnahmen entstehen.
Sie zeigen die Fahrt einer „Pferdetrambahn“ am Promenadeplatz und am Maximiliansplatz.
1902 - Der Vergnügungsteil der „Auer Dult“ auf der „Kohleninsel“
München-Lehel - Kohleninsel * Auf dem nördlichen Teil der „Kohleninsel“ findet der Vergnügungsteil der „Auer Dult“ statt.
Gegenüber dem „Münchner Arbeitsamt“ war ein Karussell und das „Schichtl-Varieté“ aufgestellt worden. Durch ihre Musik fühlten sich besonders die Arbeitgebervertreter gestört.
1902 - Das ehemalige „Frauenhaus“ (Stadtbordell) wird abgerissen
München-Angerviertel * Das ehemalige „Frauenhaus“ (Stadtbordell) wird abgerissen.
An seiner Stelle entsteht der Bau der „Städtischen Hauptfeuerwache“.
1902 - Gründung der „Anstalt für musikalisches Aufteilungsrecht“
Berlin * Gründung der „Anstalt für musikalisches Aufteilungsrecht“.
1902 - Die „Schank- und Bierwirtschaft Hirschau“ ist erweitert worden
München-Englischer Garten - Hirschau * Durch einen ebenerdigen Anbau wird die „Schank- und Bierwirtschaft Hirschau nebst Kegelbahnen und Gartenbetrieb“ erweitert.
1902 - Die Zeitschrift „Hammer, Blätter für deutschen Sinn“
Leipzig * Der „Publizist“ Theodor Fritsch, der seine politischen Aktivitäten auf den Mittelstand konzentriert, gibt die Zeitschrift „Hammer, Blätter für deutschen Sinn“ heraus.
Schon 1887 hatte er einen „Antisemiten-Katechismus“ verfasst, der anno 1907 neu überarbeitet unter dem Titel „Handbuch der Judenfrage“ neu erschienen war.
Sein Leipziger „Hammerverlag“ verlegt nicht nur zahlreiche völkische Bücher und Zeitschriften, wie die „Antisemitische Correspondenz“, die „Deutschsozialen Blätter“ sowie den bereits erwähnten „Hammer, Blätter für deutschen Sinn“, sondern auch den „Deutschen Müller“, eine damals bekannte Wirtschaftszeitung.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg erzielen die Produkte des „Hammerverlags“ Aufmerksamkeit und hohe Auflagen.
1902 - Protestantischen Klassen werden in die „Wörthschule“ verlegt
München-Haidhausen * Protestantischen Klassen werden in die „Wörthschule“ verlegt und dafür kleinere katholische Klassen der „Wörthschule“ in den von den evangelischen Kindern verlassenen Schulräumen an der Kirchenstraße übersiedelt.
1902 - Der „Konsumverein München von 1864“ erwirbt ein Grundstück in der Au
München-Au *Der „Konsumverein München von 1864“ erwirbt ein Grundstück mit Bahnanschluss zum Ostbahnhof an der Auerfeldstraße und bringt dort zunächst einen geräumigen Holz- und Kohlenhof unter.
Später siedelt sich hier die ganze Zentrale an.
Bis dahin war der Verein in der Au überhaupt nicht vertreten.
1902 - Ludwig Thomas Komödie „Die Lokalbahn“ wird uraufgeführt
München-Graggenau * Im „Residenztheater“ wird Ludwig Thomas Komödie „Die Lokalbahn“ uraufgeführt.
1 1902 - Das „Zucht-, Arbeits- und Korrekturhaus Au“ wird aufgelöst
München-Au * Das „Zucht-, Arbeits- und Korrekturhaus Au“ wird aufgelöst und umgebaut.
Die Gefangenen kommen in die aufgelassene „Klosterkirche der Benediktinerinnen am Lilienberg“.
1 1902 - Frauen und Männer aus Togo im „Internationalen Handels-Panoptikum“
München-Hackenviertel * Erneut werden „Elite- oder Separatvorstellungen“ im „Internationalen Handels-Panoptikum“ gezeigt.
Dieses Mal stellt man „24 Frauen und Mädchen, 4 Männer und 3 Kinder aus der deutschen Kolonie Togo“ zur Schau.
17. 2 1902 - Mathias Kneißl: „Sakradi, de Woch' fangt scho guat o!“.
Augsburg * Am Montag teilt die Gefängnisleitung dem Räuber Mathias Kneißl mit, dass er am Freitag hingerichtet wird. Sein Kommentar: „Sakradi, de Woch' fangt scho guat o!“
21. 2 1902 - Mathias Kneißl wird hingerichtet
Augsburg * Der „Räuber“ Mathias Kneißl wird vom Scharfrichter Franz Xaver Reichhart in Augsburg hingerichtet.
3 1902 - Mata Hari kehrt aus Java zurück
Java - Holland - Paris * Nach der Rückkehr von Java in die Niederlande trennen sich Margaretha Geertruida, alias „Mata Hari“, und John MacLeod.
Margaretha versucht nun ihr Glück in der Stadt ihrer Träume - Paris.
4 1902 - Die erste Abhol-Aktion für das „Brockenhaus“ startet
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Die erste Abhol-Aktion für das „Brockenhaus“ startet.
Ab 5 1902 - Karl Valentin besucht die „Münchner Varieté-Schule Lehmann & Grimm“
München * Valentin Ludwig Fey besucht bis August 1902 die „Münchner Varieté-Schule Lehmann & Grimm“.
Die Ausbildung kostet 400.- Mark. Da Valentin noch nicht volljährig ist, unterschreibt sein Vater als „Erziehungsberechtigter“ den Vertrag und bezahlt die damals „stolze Summe“.
12. 5 1902 - Provisorische Eröffnung des Brockenhauses auf der Kohleninsel
München-Isarvorstadt * Provisorische Eröffnung des Brockenhauses auf der Kohleninsel.
Die Initiative ist sofort erfolgreich und erwirtschaftet bereits im ersten Jahr ihres Bestehens einen Überschuss.
4. 6 1902 - Die Neue Isarkaserne wird an die Garnisonverwaltung übergeben
München-Isarvorstadt * Die Neue Isarkaserne an der Zweibrückenstraße wird an die Garnisonverwaltung übergeben.
27. 7 1902 - Die Sechziger tragen ihr erstes offizielles Fußballspiel aus
München-Untergiesing * Die Sechziger tragen auf dem Schyrenplatz ihr erstes offizielles Fußballspiel gegen einen konkurrierenden Münchner Club aus. Gegner ist der 1. Münchner Fußball-Club von 1896 - 1. MFC. Im gegenseitigen Einvernehmen wird kein Wettspiel sondern ein Gesellschaftsspiel abgehalten. Der TVM 1860 unterliegt mit 2 : 4 Toren. Der Erfolg lässt also noch auf sich warten; aber der Anfang ist immerhin gemacht.
5. 8 1902 - „Ich heiße jetzt und für immer KARL VALENTIN“
München-Au * In einem Liebesbrief an seine spätere Ehefrau Gisela Royes schreibt Valentin Ludwig Fey: „Ich heiße jetzt und für immer KARL VALENTIN - Münchner Original Humorist“.
Wirklich unveränderlich wird sein Name allerdings erst ab 1907.
9 1902 - Carl Gabriel stellt ein „Hippodrom“ auf dem „Oktoberfestes“ auf
München-Theresienwiese * Der Magistrat erlaubt dem „Schausteller-Unternehmer“ Carl Gabriel ein „Hippodrom“ auf dem Festplatz des „Oktoberfestes“ aufzustellen.
Es ist seinem griechischen Namen entsprechend eine „Reitarena“. Im Inneren des Etablissements befindet sich eine 60 Meter lange „Pferdereitbahn“, in der Besucher des Restaurationsbetriebs gegen Bezahlung reiten können. Der Umritt dauert 5 Minuten und kostet 50 Pfennige.
Der Bierausschank ist dem Inhaber anfangs verboten. Doch die Gäste können die Reitkünste der nicht immer nüchternen oder sich sonst nicht sonderlich geschickt anstellenden Damen und Herren bewundern.
So manches Kleid rutscht hoch und gibt den Blick auf ein Damenbein frei.
Kein Wunder, dass für das „Hippodrom“ bald der Name „Stilaugenzelt“ auftaucht. „Der unerschöpfliche Unterhaltungsstoff, den die erstmaligen Reitversuche von Herren und Damen den Zuschauern bieten, macht das Hippodrom zur ersten Volksbelustigung der Festwiese“.
10 1902 - Theodor Klopfer lässt sich eine Villa von Gabriel von Seidl erbauen
München-Maxvorstadt * Der „Bankier“ und „Handelsrichter“ Theodor Klopfer lässt sich an der Ecke Brienner Straße 41 und Richard-Wagner- Straße eine Villa von Gabriel von Seidl erbauen.
Das Haus hat 15 Zimmer.
1. 10 1902 - Karl Valentin tritt im Nürnberger Zeughaus auf
Nürnberg * Karl Valentin tritt im Nürnberger Zeughaus auf.
5. 10 1902 - Karl Valentin über seinen Nürnberger Auftritt im Zeughaus
Nürnberg - München-Au * Karl Valentin schreibt an seine Eltern über seinen Auftritt im Nürnberger Zeughaus:
„Mir geht es sehr gut. Ich bin unberufen sehr gesund und habe mir den ersten Abend Asthma geholt. Ein Zimmer habe ich, da ist unser Knechtzimmer ein Salon dagegen. - Das Programm besteht aus 8 Damen (keine Angst haben) und aus mir.“
7. 10 1902 - Karl Valentin muss ein Engagement in Nürnberg abbrechen
Nürnberg * Noch vor Vorstellungsbeginn erhält Karl Valentin ein Telegramm von seiner Mutter, in dem sie ihm mitteilt, dass sein Vater plötzlich schwer erkrankt ist. Er macht sich sofort auf den Weg nach Hause. Doch als er am nächsten Morgen um 8 Uhr in München ankommt, ist Johann Valentin Fey bereits im Alter von 69 Jahren verstorben.
Karl Valentin muss sich jetzt um die Firma Falk & Fey und um seine Mutter kümmern. Der in Geschäftsdingen nicht sonderlich glücklich agierende Valentin fährt das Unternehmen innerhalb von vier Jahren voll an die Wand, sodass nicht nur die Firma, sondern gleich das ganze Anwesen verkauft werden muss.
12. 10 1902 - Franz von Lenbach erleidet einen Schlaganfall
München-Maxvorstadt * Franz von Lenbach erleidet einen Schlaganfall und ist kurzfristig linksseitig gelähmt.
21. 11 1902 - Der Verein Münchner Brockenhaus wird gegründet
München-Isarvorstadt * Der Verein Münchner Brockenhaus wird gegründet.
1903 - Friedrich Wilhelm von Bissing erwirbt das Gebäude an der Georgenstraße 10
München-Schwabing * Der „Privatgelehrte“ Friedrich Wilhelm von Bissing erwirbt das Gebäude an der Georgenstraße 10 und lässt es nach seinen Vorstellungen umbauen.
Es entsteht eine schöne Verbindung des Münchner Jugendstils mit traditionellen Elementen Altmünchner Bürgerhäuser.
1903 - Joseph Schülein wohnt in der Richard-Wagner-Straße 7
München-Maxvorstadt * Joseph Schülein bewohnt das vierstöckige Haus in der Richard-Wagner-Straße 7, mit 12 Zimmern und 5 Kammern, mit seiner Familie und zwei weiblichen Dienstboten.
1903 - Adolph Brougier ist Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 5
München-Maxvorstadt * Der „Rentier“ und „Kommerzienrat“ Adolph Brougier ist Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 5.
1903 - Theresia Herzog lässt sich ein Haus in der Richard-Wagner-Straße 15 bauen
München-Maxvorstadt * Die „Metzgerswitwe“ Theresia Herzog lässt sich durch das „Baugeschäft Carl und August Zeh“ ein Mietshaus in der Richard-Wagner-Straße 15 mit 8 Wohneinheiten erbauen.
1903 - Besitzerwechsel in der Richard-Wagner-Straße 16 und 18
München-Maxvorstadt * Die Anwesen in der Richard-Wagner-Straße 16 und 18 gehen in das Eigentum des „Großhändlers“ Heicheiner über.
1903 - Die „Kohleninsel“ als Standort für das „Deutsche Museum“ beschlossen
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Die endgültige Nutzung der „Kohleninsel“ als Standort für das „Deutsche Museum“ wird vom Magistrat beschlossen.
Seit dem Jahr 1903 - Michael Faulhaber stuft Frauen als „Menschen zweiter Wahl“ ein
Straßburg - Speyer * Bis zu seiner Ernennung zum Bischof von Speyer im Jahr 1911 ist Michael Faulhaber Inhaber eines Lehrstuhls eines Professors für alttestamentarische Exegese und biblische Theologie an der Kaiser-Wilhelm-Universität in Straßburg.
Bereits während dieser Zeit nimmt er ultrakonservative Positionen ein. Unter anderem stuft er Frauen als „Menschen zweiter Wahl“ ein, wenn er sagt: „Die hausrechtliche Stellung der Frau ist dem Gotteswort umzirkelt, das Weib soll die Gehilfin des Mannes sein. [...] Diese untergeordnete Stellung ist der ursprüngliche Wille des Schöpfers.“
Demzufolge ist auch die Entscheidung der Reichsregierung, wonach eine verheiratete Frau auch Lehrerin werden darf, gegen den Willen Gottes. Er bezeichnet die Regelung als eine „Missgeburt mit einem doppeltem Gesichte, weil man nicht im Nebenamt Mutter sein und weil eine Person nicht zwei Berufe erfüllen kann“.
Natürlich hat die Kirche nichts gegen die Frauenbildung, doch auf den Hochschulen sollen die Damen die Ausnahme und in der Kirche haben sie stumm zu sein. Gerne zitiert er das Paulus-Wort: „Wenn sie [die Frauen] lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Es ist eine Schande, wenn in den gottesdienstlichen Versammlungen eine Frau das Wort nimmt.“
1 1903 - Keine neue Chance für Emil Eduard Hammer
München-Hackenviertel - München-Ludwigsvorstadt * Der Versuch des „Wachsplastikers“ und ehemaligen Betreibers des „Internationalen Handels-Panoptikums“ in der Neuhauser Straße 1, Emil Eduard Hammer, sein Unternehmen in einem Neubau an der Bayerstraße 13/15 fortzuführen, wird aus feuerpolizeilichen Gründen untersagt.
30. 3 1903 - Das erste allgemeine Kinderschutzgesetz
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Der Deutsche Reichstag verabschiedet mit dem <em>„Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben“</em> ein erstes allgemeines Kinderschutzgesetz, von dem die landwirtschaftliche Kinderarbeit jedoch weiterhin ausgeklammert ist.</p>
14. 4 1903 - Das Hotel Oberpollinger wird abgerissen
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Das <em>„Hotel Oberpollinger“</em> wird abgerissen. In zweijähriger Bauzeit erstellte die Firma Heilmann & Littmann ein Kaufhaus, dessen charakteristische Fassade an der Neuhauser Straße noch erhalten ist.</p>
6 1903 - Die Münchner „Brockensammlung
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * In den „Mittheilungen der Münchner Brockensammlung“ heißt es:
„Die Münchner Brockensammlung erbittet und läßt kostenfrei durch ihre Leute abholen: Alte, auch zerbrochene Möbel, jeder Art gebrauchter Kleiderstücke, Wäsche, abgetragene Schuhe, Hüte, Strümpfe, alle Arten Bücher, Broschüren, Zeitungen, Papier, Marken, Zeugreste und Lumpen, Schirme, Zigarrenabschnitte, Korke, Staniolkapseln, Flaschen, Glas, Körbe, altes Werkzeug, Metall und Geschirre aller Art, Militär-Effekten, kurz alles, was im Hause unnütz umherliegt“.
Da stellen also die wohlhabenden Bürger Münchens ihre ausgedienten oder aus der Mode gekommenen Möbel und Dinge des täglichen Bedarfs, kurz „all den Kram des Speichers und Kellers, der überflüssig, hindernd und störend im Wege liegt“, kostenlos zur Verfügung, um sie dann an Interessenten zu verkaufen oder - zu kleinsten Preisen - den Bedürftigen zur Verfügung zu stellen.
Lumpen, Knochen und Altmetall werden in eigens aufgestellten Tonnen gesammelt und dann zur Weiterverarbeitung an einschlägige Unternehmer weiterverkauft.
Die privaten Organisatoren geben die Gegenstände an die Bedürftigen ausdrücklich nicht gratis ab.
Im Gegenteil, sie legen großen Wert darauf, dass die Käufer eine - wenn auch noch so geringe - Eigenleistung erbringen.
Man will den Bedürftigen zwar tätige Hilfe zukommen lassen, ohne sie jedoch in die Rolle von würdelosen Almosenempfängern zu drängen.
8. 6 1903 - Die Unionsbrauerei Schülein & Cie wird eine Aktiengesellschaft
München-Haidhausen * Die Unionsbrauerei Schülein & Cie wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Bis zum Jahr 1912 besteht der Vorstand der AG lediglich aus Joseph und dessen ältesten Sohn Julius Schülein.
16. 6 1903 - Wahlen zum 11. Deutschen Reichstag
Deutsches Reich - Berlin * Bei den Wahlen zum 11. Deutschen Reichstag erringen die Sozialdemokraten 81 Mandate und bilden damit die zweitstärkste Fraktion.
9 1903 - Carl Gabriel lässt ein „Aschanti-Dorf“ auf dem „Oktoberfest“ errichten
München-Theresienwiese * Carl Gabriel lässt ein „Aschanti-Dorf“ auf dem „Karawanenplatz“ auf dem „Oktoberfest“ errichten.
9 1903 - Das „Hippodrom“ sorgt für unendlichen Gesprächsstoff
München-Theresienwiese * Die Reitversuche der Damen und Herren im „Hippodrom“ sorgen für unendlichen Gesprächsstoff.
Einem anderen Antrag auf Zulassung eines „Hippodroms“ eines anderen Schaustellers lehnt der Stadtmagistrat mit folgender Begründung ab: „Aus Sittlichkeitsgründen kann das Unternehmen keine Konkurrenz vertragen, das männliche Publikum geht sicher auch nur hinein, weil es vermutet, Pikantes erleben zu können“.
15. 9 1903 - Grundsteinlegung für Lenbachs Sommervilla am Starnberger See
Starnberger See * Franz von Lenbach legt den Grundstein für eine Sommervilla am Starnberger See.
10 1903 - Mata Hari wird mit ihrem „Schleiertanz“ zum Star von Paris
Paris * Margaretha Geertruida MacLeods Aufstieg in Paris ist die Geschichte eines Glamour-Girls, das von den Gefälligkeiten einflussreicher Männer profitiert, aber letztlich erstaunlich unabhängig agiert – und sich selbst immer wieder neu erfindet.
Sie versucht sich als Mannequin, als Modell für Maler und als Zirkusreiterin, bevor sie ihre große Chance wittert: mit einem „Schleiertanz“, wie ihn Paris noch nie gesehen hat.
Margaretha Geertruida MacLeod nennt sich jetzt „Mata Hari“, was auf javanisch „die Sonne des Tages“ oder die „Morgenröte“ bedeutet.
Vor allem Männern mit Vermögen erweist sie ihre Gunst: Banker, Fabrikanten, Rechtsanwälte, Diplomaten und höhere Offiziere zählen zu ihren Favoriten.
4. 12 1903 - Hans Kurt Eisner wird in Groß-Lichterfelde geboren
Groß-Lichterfelde * Hans Kurt Eisner, genannt Kurt, Sohn von Kurt Eisner und seiner ersten Ehefrau Lisbeth, geb. Hendrich, kommt in Marburg zur Welt. Das Kind gehört keiner Konfession an.
1904 - Das „Wirtshaus Neuberghausen“ liegt zu Nahe an der Kirche
München-Bogenhausen * Da nach Auffassung des Bogenhausener Pfarrers das „Wirtshaus Neuberghausen“ zu Nahe an der Kirche, dem Friedhof und der Schule liegt, werden die beliebten Musik- und Tanzveranstaltungen, vor allem im Garten, nicht mehr gestattet.
Nur sanfte Musik, ohne Blech- und Schlaginstrumente werden im Ausnahmefall genehmigt.
Die Gastwirtschaft verliert dadurch ihre Attraktivität und Anziehungskraft, weshalb die Brauerei anno 1904 den Rückgang des Bierkonsums innerhalb von zwanzig Jahren auf ein Zehntel beklagen muss.
1904 - Ein zweistöckiges Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße 1
München-Maxvorstadt * Der Architekt Ludwig C. Lutz plant ein zweistöckiges Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße 1, das der Arzt Dr. Heinrich Bock mit drei weiteren Erwachsenen und einem Kind unter 14 Jahren sowie zwei weiblichen und einem männlichen Dienstboten bewohnen wird.
Im Haus befindet sich auch eine Arztpraxis.
1904 - Bei Pullach geht das zweite „Isarkraftwerk“ der „Isarwerke GmbH“ in Betrieb
Pullach * Das zweite „Isarkraftwerk“ der „Isarwerke GmbH“ wird mit der Bezeichnung „Zentrale II“ bei Pullach in Betrieb genommen.
Es wird heute „Wasserkraftwerk Pullach“ genannt.
Ab 1904 - Adolf von Hildebrand entwirft den Neubau der „Preußischen Gesandtschaft“
München-Lehel * Adolf von Hildebrand entwirft im Auftrag des „Preußischen Gesandten“ Friedrich Graf von Pourtalès den Plan für einen Neubau der der „Preußischen Gesandtschaft“ und der „Schack-Galerie“ genügend Platz bietet.
1904 - Grunderwerb für einen neuen „Ausstellungspark“
München-Theresienhöhe * Die Stadt kauft vom „Landwirtschaftlichen Verein“ für 1,1 Millionen Mark Grundstücke auf der „Theresienhöhe“, um dort einen neuen „Ausstellungspark“ zu errichten.
1904 - Der „Kocherlball“ wird aus „Mangel an Sittlichkeit“ polizeilich verboten
München-Englischer Garten - Lehel * Der sogenannte „Kocherlball“ am „Chinesischen Turm“ im „Englischen Garten“ wird aus „Mangel an Sittlichkeit“ polizeilich verboten.
Bis dahin vergnügten sich sonntags ab fünf Uhr früh die „Dienstboten“.
1904 - Das Ausflugslokal „Tivoli“ wird als „Ort der Mode“ beschrieben
München-Englischer Garten - Tivoli * Das am Ostrand des „Englischen Garten“ gelegene Ausflugslokal „Tivoli“ wird als „Ort der Mode“ beschrieben.
„An schönen Sommerabenden war es mit zahlreichen Menschen angefüllt, die besonders dem Tanzvergnügen huldigten.
An Werktagen fanden sich bis in unsere Zeit noch Beamte aus den höchsten Kreisen dort ein“.
1904 - Die „Pschorrbrauerei“ errichtet einen Neubau für den „Falkenhof“
München-Au * Die „Pschorrbrauerei“ errichtet für die ehemalige Wirtschaft des Johann Georg Messerer einen Neubau, der im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört wird.
1904 - Der Eintrag ins amtliche Vereinsregister
München-Au * Ab 1904 bis zum Jahr 1917 kann der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ seinen Betrieb im „Schwanensaal“ des „Münchner-Kindl- Kellers“ abhalten.
Ebenfalls im Jahr 1904 erfolgt der Eintrag ins amtliche Vereinsregister.
Ab 1 1904 - Drei Monate Haft wegen Majestätsbeleidigung für Rosa Luxemburg
Zwickau * Rosa Luxemburg verbüßt in Zwickau eine dreimonatige Haftstrafe wegen Majestätsbeleidigung.
12. 1 1904 - Die Herero erheben sich in Deutsch-Südwestafrika
Deutsch-Südwestafrika * Es kommt zur Erhebung der Herero. Die Taktik der Herero-Krieger ist einfach. Mit ihren rund 8.000 Mann wollen sie die nur aus 2.000 Mann bestehende deutsche Schutztruppe überrumpeln. Dass jedoch das Deutsche Reich in kürzester Zeit zusätzliche Truppenkontingente nach Afrika verlegen kann, kommt in den Planungen der Herero nicht vor.
Der damalige Gouverneur und Kommandeur der Schutztruppe, Theodor Leutwein, versucht den Krieg so zu führen, dass die spätere wirtschaftliche Ausbeutung des Landes unter Zuhilfenahme der Herero nicht gefährdet wird. Seine Strategie ist darauf angelegt, die Herero in eine ausweglose Lage zu bringen, danach aber - im Rahmen eines Friedensvertrages - zumindest ein weiteres Zusammenleben zu ermöglichen.
Doch diese Strategie ist den Verantwortlichen im Berliner Generalstab zu langwierig, weshalb man Theodor Leutwein ablöst und den Generalleutnant Lothar von Trotha nach Deutsch-Südwestafrika schickt.
Um 4 1904 - Eine „Studienreise“ für den Betrieb eines „Ratskellers“
München * Eine Kommission des Stadtmagistrats geht auf „Studienreise“ nach Stuttgart, Deidesheim, Mainz, Wiesbaden, Koblenz, Köln, Bremen, Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, Wien, Großinzersdorf und Salzburg begeben, „um Einrichtung und den Betrieb der Ratskeller einer Anzahl größerer Städte kennen zu lernen“.
Ergebnis dieser „Studienreise“ war der Beschluss der „Gemeindekollegien“ dass im „Ratskeller“ nur noch „Pfalzweine, Rheinweine, Mosel- und Saarweine, Frankenweine, badische Weine, österreichische und ungarische Weine sowie Bordeaux-, Burgunder- und Schaumweine“ angeboten und verkauft werden durften, welche von einer vom Magistrat eingesetzten Kommission „nach vorgenommener Kostprobe angekauft und in der städtischen Weinkellerei eingelagert und behandelt worden sind“.
Für die Auswahl der „ruhigen“ Weine war „vor allem maßgebend, dass die Weine naturecht, das heißt aus dem vergorenen Saft der Weintraube sind und keinerlei Zusatz an Zucker oder Zuckerwasser enthalten“.
6. 4 1904 - Kurt Georg Kiesinger wird in Ebingen in Württemberg geboren
Ebingen * Kurt Georg Kiesinger, der spätere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wird in Ebingen in Württemberg geboren.
8. 4 1904 - Frankreich und Großbritannien vereinigen sich zur „Entente cordiale“
London * Frankreich und Großbritannien vereinigen sich in London zur „Entente cordiale“ [= „Herzliches Einverständnis“ - „Entente“ = Bündnis].
6. 5 1904 - Der Kunstmaler Franz von Lenbach stirbt
München-Maxvorstadt * Der Kunstmaler Franz von Lenbach stirbt.
11. 6 1904 - Lothar von Trotha: „Die Würfel sind gegen die Herero gefallen“
Deutsch-Südwestafrika - Swakopmund * Nachdem Generalleutnant Lothar von Trotha in Swakopmund eingetroffen ist, will ihn Leutwein dazu bewegen, „die Belange der Kolonie und der Eingeborenen in der Kriegsführung zu berücksichtigten und den Feldzug so durchzuführen, dass das Volk der Herero als solches erhalten bleibe“. Doch Lothar von Trotha meint nur: „Die Würfel sind gegen die Herero gefallen.“
11. 7 1904 - Die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr ist bezugsfertig
München-Angerviertel * Die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr an der Blumenstraße 34 ist bezugsfertig.
11. 8 1904 - Es kommt zur Entscheidungsschlacht am Waterberg
Deutsch-Südwestafrika - Waterberg * Es kommt zur Entscheidungsschlacht am Waterberg. Diese tobt inmitten der notdürftig errichteten Dörfer, wohin die Herero bereits unter Gouverneur Theodor Leutwein getriebenen worden waren.
Am Waterberg befindet sich das Volk der Herero - mit Frauen und Kindern sowie allen Habseligkeiten und dem gesamten Viehbestand - insgesamt zwischen 30.000 bis 40.000 Menschen. Nun, unter dem Kommando von Lothar von Trotha sind sie eingeschlossen.
12. 8 1904 - 25.000 bis 30.000 Herero gelingt die Flucht in die Wüste Omaheke
Deutsch-Südwestafrika - Waterberg * Gerade einen Tag können die Herer“ den technisch weit überlegenen deutschen Truppen Widerstand entgegen setzen. Den Herero gelingt an der schwächsten Stelle der Umzingelung der Durchbruch durch die deutschen Linien.
Etwa 25.000 bis 30.000 können in Richtung der Wüste Omaheke fliehen. Die Fliehenden versuchen zunächst die wasserlose Wüste zu umgehen.
9 1904 - Das „Untersuchungsgefängnis Neudeck“ wird eröffnet
München-Au * Das „Untersuchungsgefängnis Neudeck“ wird eröffnet.
17. 9 1904 - Carl Gabriels Völkerschau trägt den Titel Tunis in München
München-Theresienwiese * Carl Gabriels Völkerschau trägt den Titel „Tunis in München“ und konfrontiert die Besucher mit Sitten und Gebräuchen der Nordafrikaner.
17. 9 1904 - Josef Pravida und seine Fischerhütte zum Holländer
München-Theresienwiese * Josef Pravida lässt neben der Augustiner-Festburg ein Fischerhäuschen errichten und nennt sie „Fischerhütte zum Holländer“. Die Bedienungen sind in holländischer Tracht gekleidet.
17. 9 1904 - Ein früherer Wiesnbeginn wird festgelegt
München-Theresienwiese * Nach einem Beschluss des Magistrats soll der Hauptsonntag des Oktoberfestes - die Allerhöchste Genehmigung immer vorausgesetzt - in der Zeit zwischen dem 28. September und dem 4. Oktober liegen. Das bedeutet einen um eine Woche früheren Wiesnbeginn.
17. 9 1904 - Proteste gegen den Hungerkünstler Ricardo Sacco
München-Theresienwiese * Als sich der Hungerkünstler Ricardo Sacco während des Oktoberfestes zur Schau stellt, kommt es zu Protesten der Münchner Bevölkerung. Sie will es nicht dulden, dass ein Mensch inmitten der „Genüsse des Festes“ hungert.
Um 10 1904 - Die deutschen „Siedler“ fordern die Entwaffnung der „Nama“
Deutsch-Südwestafrika * Die Kämpfe verlagern sich nun in den Süden des „Schutzgebietes“, wo die „Witbooi-Nama“ aus ähnlichen Gründen wie die „Herero“ den Krieg beginnen.
Die „Nama“ werden schon damals abwertend als „Hottentotten“ bezeichnet.
Ausschlaggebend für die „Nama“ ist die Forderung der deutschen „Siedler“, nun, nachdem sich starke Truppen im Land befinden, auch die „Nama“ zu entwaffnen und endgültig zu unterwerfen.
Allerdings unterscheidet sich die Kriegsführung der „Nama“ von der der „Herero“, dass sie in kleinen, für die deutschen Truppen nahezu unsichtbaren Gruppen agieren und einer Entscheidung im offenen Kampf ganz bewusst ausweichen.
Dieser „Guerillakrieg“ zermürbt die wesentlich besser ausgerüsteten deutschen Soldaten auf Dauer.
2. 10 1904 - Generalleutnant Lothar von Trotha erlässt den Vernichtungsbefehl
Deutsch-Südwestafrika * Generalleutnant Lothar von Trotha erlässt den „Vernichtungsbefehl“. In diesem heißt es: „Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet, gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten, und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen.
[…] Das Volk der Herero muss das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot-Rohr [= Geschütz] dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück, oder lasse auf sie schießen.“
3. 10 1904 - Die Flurschule wird eröffnet
München-Haidhausen * Die Flurschule wird als 5. Haidhauser Schule eröffnet. Sie ist zugleich die 5. evangelische Schule in München.
3. 10 1904 - Zwischen 20.000 und 25.000 Herero verdursten unter furchtbaren Qualen
Deutsch-Südwestafrika * General Lothar von Trotha lässt die Wüste Omaheke systematisch und vollständig abgeriegeln sowie sämtliche Wasserstellen am Rande der Wüste besetzen. Die Absperrungen bestehen bis März 1905. In der Zwischenzeit sind zwischen 20.000 und 25.000 Herero unter furchtbaren Qualen in der Wüste verdurstet.
17. 11 1904 - Leonhard Romeis stirbt an einem akuten Nierenleiden
München-Maxvorstadt * Leonhard Romeis stirbt an einem akuten Nierenleiden in seiner Wohnung am Ferdinand-Miller-Platz.
19. 11 1904 - Leonhard Romeis wird auf dem Moosacher Friedhof beigesetzt
Moosach * Leonhard Romeis wird auf dem Moosacher Friedhof beigesetzt.
1. 12 1904 - Das Landgerichtsgefängnis am Lilienberg wird geschlossen
München-Au * Das Landgerichtsgefängnis München II am Lilienberg wird geschlossen.
4. 12 1904 - Sofie Gräfin von Moy gründet den Hauspflege-Verein München e.V.
München * Sofie Gräfin von Moy gründet mit engagierten Münchner Bürgern den Hauspflege-Verein München e.V..
12. 12 1904 - Die Münchner Kindl AG fusioniert mit der Unionsbrauerei
München - München-Haidhausen - München-Au * Die Generalversammlung der Aktionäre der Münchner Kindl AG beschließt die Fusion mit der Haidhauser Unionsbrauerei. Die neue Unionsbrauerei steigt dadurch zu einer der fünf größten Münchner Brauereien auf.
12. 12 1904 - Der Schießbefehls gegen die Nama und Herero wird aufgehoben
Berlin - Deutsch-Südwestafrika * Der Schießbefehls des Lothar von Trotha gegen die Nama und Herero wird aufgehoben.
Um den 20. 12 1904 - Konzentrationslager als Internierungslager für Unterstützer
Deutsch-Südwestafrika * Das Erscheinungsbild des Krieges gegen die Herero und Nama ist nicht nur durch die eigentlichen Kampfhandlungen geprägt, sondern mindestens ebenso sehr durch die von der Militäradministration errichteten Konzentrationslager.
Sie dienen als Internierungslager, in denen auch Stämme aus dem Gebiet des Guerillakampfes festgesetzt werden, um so den Kämpfern den Rückhalt in der Bevölkerung zu nehmen. Es sind also keine reinen Kriegsgefangenenlager nach europäischen Standards, sondern werden auch zur Inhaftierung von Frauen, Greisen und Kindern genutzt. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hierbei um einen Krieg gegen ein ganzes Volk handelte.
Die Lebensbedingungen in den Konzentrationslagern sind völlig unzureichend. Es fehlte an allem, von den Lebensmitteln bis zum Brennmaterial. Viele Insassen erkranken an Skorbut und Typhus. Die Sterblichkeit ist entsetzlich hoch. „Es kamen an manchen Tagen bis 27 Sterbefälle vor. Karrenweise wurden die Toten zum Friedhofe gebracht.“
1905 - 141 „Weinwirtschaften“ in München
München * Die Zahl der „Weinwirtschaften“ in München ist auf 141 angewachsen.
1905 - Der „Ratskeller“ und der „Regieweinkeller“ werden doppelt so groß
München-Graggenau * Mit dem Ausbau des Neuen Rathauses wird der „Ratskeller“ von 956 qm auf 1.931 qm, und der „Regieweinkeller“ von 586 auf 1.697 qm vergrößert.
1905 - Die legendären Automobilrennen des Hubert von Herkomer
Deutschland - Österreich * Hubert von Herkomer betreibt in den Jahren 1905 bis 1907 legendäre Automobilrennen, die „Herkomerkonkurrenz“, die durch Deutschland und Österreich führt.
1905 - Die „Georgskirche“ wird letztmals mit Schindeln gedeckt
München-Bogenhausen * Die Kuppel der Bogenhausener „Georgskirche“ wird letztmals mit Schindeln gedeckt.
1905 - Das „Münchner Kindl“ kommt auf die Turmspitze des „Neuen Rathauses“
München-Graggenau * Das „Münchner Kindl“ kommt auf die Spitze des zwölfstöckigen, 85 Meter hohen Turm des „Neuen Rathauses“.
1905 - Wilhelm Reischl gehört die Doppelhaus-Villa Brienner Straße 38/40
München-Maxvorstadt * Neuer Eigentümer der Doppelhaus-Villa an der Brienner Straße 38/40 ist der „Fabrikant“ und „Leutnant a. D.“ Wilhelm Reischl.
1905 - Das Haus Richard-Wagner-Straße 13 wird gebaut
München-Maxvorstadt * Das Haus Richard-Wagner-Straße 13, mit dem einladenden „Salve“ auf der Haustüre, wird gebaut.
In den vier Stockwerken befindet sich jeweils eine Wohnung mit fünf Zimmern.
1905 - Paul Nicolaus Cossmann konvertiert zum katholischen Glauben
München * Paul Nicolaus Cossmann konvertiert vom jüdischen zum katholischen Glauben.
Während des Ersten Weltkriegs tauscht er seine liberalen Ideen gegen einen skrupellosen Nationalismus ein.
In den „Süddeutschen Monatsheften“ wird er später verbissen die „Dolchstoß“-Theorie propagieren.
1905 - Die Ausstellung „Die Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung“ wird gezeigt
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * In einem kleinen Ausstellungsbau auf der „Kohleninsel“ wird die Wanderausstellung „Die Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung“ gezeigt.
1905 - Die „Sektion Wien“ wird mit einem „Arier-Paragraphen“ gegründet
Wien * Die „Sektion Wien des Deutsch- und Österreichischen Alpenvereins - DuOeAV“, die aus dem „Turnverein“ hervor gegangen war, wird mit einem „Arier-Paragraphen“ gegründet.
Vor 1905 - Die Zensur in allen Bereichen des Theaterwesens
München * Eine nicht datierte Aktennotiz vermerkt:
Die „Zensur“ betrifft auch „das kleine Theaterwesen, die Varietées, Tingeltangel, Singspielhallen, Cabarets; ferner die Volkssänger, Komiker, Rezitatoren sind vermittels der Präventivzensur nach Möglichkeit in ordnungsgemäßen Bahnen zu halten, zumal da erfahrungsgemäß gerade auf diesem Weg die Kenntnis von Unsittlichkeiten und Unanständigkeiten aller Art in die breitesten Schichten der Bevölkerung getragen wird“.
1905 - Die Isar hat sich bereits in die „Flinzschicht“ eingegraben
München * Die Isar hat sich in die „Flinzschicht“ eingegraben.
Die Eintiefung beträgt 8,5 Meter.
1905 - Zucht und Ordnung auch in der Badeanstalt
München *Der „Magistrat der königlichen Haupt- und Residenzstadt“ erlässt eine „Badeordnung“, die nur wenig mit den heutigen Vorstellungen von Freizeitvergnügen vereinbar ist. Es herrscht „Zucht und Ordnung“.
Es gibt zum Beispiel eine eigens ausgewiesene „Einsprungstelle“ ins Becken. „Das Herumliegen auf dem Boden ist nicht gestattet“. Außerdem bestimmt die „Badeordnung“, dass „Zuschauer (...) keinen Zutritt in das Bad“ haben.
Im Liegeraum darf man nicht lesen, „weil dies die Gehirntätigkeit beeinflußt“.
Sogar einen Tipp gegen „Sonnenstich“ kann man der Anweisung entnehmen. Darin heißt es: „Den Gästen wird empfohlen, den Kopf mit einem Tuche zu beschatten und sich bei großer Hitze öfter abzubrausen“.
Und sogar für schlechtes Wetter gibt die „Badeordnung“ den Freibadbenutzern eindeutige Verhaltensmaßregeln mit auf den Weg: „Wenn Regen eintritt“, heißt es hier, „so kann man sich noch ca. ¼ Stunde lang dem Regen aussetzen, dann aber ist der Körper zu bekleiden“.
Natürlich gibt es auch Vorschriften über die angemessene Bekleidung in der Badeanstalt. Die „Badeordnung“ schreibt hierbei Folgendes vor: „Jeder Badende muß mit einer geordneten Badehose versehen sein, der Gebrauch von Schürzen und ähnlichen Bekleidungsstücken ist untersagt“.
1905 - Carl Gabriel eröffnet sein erstes „Kinematographentheater“
Berlin * Carl Gabriel eröffnet sein erstes „Kinematographentheater“ in Berlin.
1905 - Das „letzte Floß“ verlässt Mittenwald in Richtung München
Mittenwald * Das „letzte Floß“ verlässt Mittenwald in Richtung München.
Ab dem Jahr 1905 - Neue Abteilungen und Sportarten
München-Au * Fast jedes Jahr gründet der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ eine neue Abteilung oder nimmt eine weitere Sportart auf.
1905 - Wegen Überlastung schmoren die Sicherungen durch
Berlin - Karlsruhe * Ein Firmenkonsortium unter der Leitung der Firma „L. Loewe & Co“ erhält den Auftrag über eine „Ortsvermittlungsstelle für Wählbetrieb“.
Der Fabrikationsauftrag für die Herstellung der „Strowger-Wähler“ und damit die Lizenz wird den zum „Loewe-Konzern“ gehörenden „Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken Berlin - Karlsruhe“ übertragen.
Diese verfügen über entsprechend ausgebildetes Personal und über moderne feinmechanische Werkstätten.
Die Erfahrung im Umgang mit elektrischen Schaltungen steuern Mitarbeiter der „Firma Siemens & Halske“ bei.
Da alle angeschlossenen Teilnehmer sofort nach Inbetriebnahme der neuen Vermittlungsstelle ihren eigenen „Fernsprech-Selbstwählanschluss“ ausprobieren wollen, schmoren in der Folge von Überlastung und Blockade der Wähler in den ersten Betriebsstunden ständig die Sicherungen durch.
Empörte Teilnehmer stürmen daraufhin das Dienstgebäude.
Erst als diese wieder besänftigt waren, gelingt es dem Wartungspersonal die Schwachstellen des Systems abzustellen.
Seither arbeitet die Anlage störungsfrei.
1905 - Die Stadt wagt einen erneuten Vorstoß für ein „Krematorium“
München-Obergiesing * Die Stadt wagt einen erneuten Vorstoß für ein „Krematorium“ - wieder ohne Erfolg.
1905 - Ludwig Thomas „Lausbubengeschichten“ werden veröffentlicht
München * Ludwig Thomas Buch „Lausbubengeschichten“ wird veröffentlicht.
Es enthält autobiographische Züge.
1905 - Mata Hari ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere
Madrid - Monte Carlo - Wien * „Mata Hari“ steht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.
Sie tritt in Madrid, Monte Carlo und Wien auf.
Die Kritiker liegen ihr zu Füßen.
1905 - Die Kraftdroschken-Gesellschaft wird gegründet
München * Die erste „Kraftdroschken-Gesellschaft“ wird in München von 22 Personen gegründet.
2. 1 1905 - Der Aufstand der Nama wird brutal niedergeschlagen
Deutsch-Südwestafrika * In der entscheidenden Schlacht schlagen die deutschen Kolonialtruppen die Aufständischen vernichtend. Im Winter 1904/05 haben sich in Deutsch-Südwestafrika die Nama, die von den Deutschen „Hottentotten“ genannt werden, erhoben. Doch das beendet den Krieg nicht.
22. 1 1905 - Zaristische Truppen erschießen zahlreiche Demonstranten in Petersburg
Petersburg * Der Petersburger Blutsonntag. Zaristische Truppen erschießen zahlreiche Demonstranten einer friedlichen Kundgebung in Petersburg.
3. 2 1905 - Solidaritätskundgebung für die Opfer der ersten Russischen Revolution
München-Au * Im Münchner-Kindl-Keller findet eine Solidaritätskundgebung zu Gunsten der Opfer der ersten Russischen Revolution statt.
15. 3 1905 - Das Deutsche Reich will Marokkos Wirtschaftsinteressen verteidigen
<p><strong><em>Berlin</em></strong><em> * </em>Reichskanzler Bernhard von Bülow gibt im Reichstag bekannt, dass das Deutsche Reich Schritte zur Verteidigung der Wirtschaftsinteressen in Marokko unternehmen wird. Dabei hatte Deutschland bis dahin niemals Einwände gegen die von Frankreich ausgeübte Kontrolle des Militärs, der Polizei, der Verwaltung, der Banken und des Handels in Marokko erhoben. </p>
31. 3 1905 - Kaiser Wilhelm II. besucht die marokkanische Hafenstadt Tanger
<p><strong><em>Tanger</em></strong> * Während seiner traditionellen Mittelmeerreise besucht Kaiser Wilhelm II. die marokkanische Hafenstadt Tanger. In seiner Rede betont der deutsche Kaiser die <em>„Unabhängigkeit des Scherifenreichs“</em> Marokko und bietet hierfür den <em>„Schutz Deutschlands“</em> an. Er beabsichtigt mit seiner Ansprache, Frankreich und Großbritannien über die <em>„Marokkofrage“</em> zu spalten und fordert eine internationale Konferenz zur Regelung der <em>„Souveränität Marokkos“</em>. </p> <p>Es kommt zur sogenannten <em>„Marokko-Krise“</em>, die, weil das deutsche Verhalten für Frankreich eine scharfe Provokation darstellt, sofort zu einem Krieg führen könnte. Angesichts dieser drohenden Gefahr gehen die Großmächte auf die Forderung Deutschlands ein und rufen eine internationale Konferenz über die weitere Zukunft Marokkos zusammen. </p>
22. 4 1905 - Lothar von Trotha droht den Nama ebenfalls mit Vernichtung
<p><em><strong>Deutsch-Südwestafrika</strong></em> * General Lothar von Trotha erlässt eine ähnliche Proklamation wie gegen die Herero und droht den Nama ebenfalls mit Vernichtung.</p> <p>Da die Proklamation jedoch nicht zur massenweisen Unterwerfung der Nama führt und die gewünschte Wirkung verpufft, bleiben entscheidende Erfolge für die deutschen Truppen aus. Der Guerillakrieg setzt sich fort. </p>
5 1905 - Ludwig Thoma veröffentlicht seinen Roman „Andreas Vöst“
München * Ludwig Thoma veröffentlicht seinen Roman „Andreas Vöst“.
Er handelt vom Streit eines Bauern mit einem Pfarrer und thematisiert den Aufstieg des kirchenkritischen „Bayerischen Bauernbundes“.
20. 6 1905 - Der Schnitterin-Brunnen am Thierschplatz geht in Betrieb
München-Lehel * Der Schnitterin-Brunnen am Thierschplatz im Lehel geht in Betrieb.
26. 6 1905 - Ludwig Thoma wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
München * Ludwig Thoma wird für sein Gedicht „An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine“ zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Um den 15. 7 1905 - Die Kranken werden in die neue Anstalt nach Eglfing verlegt
Eglfing * Die Kranken der Kreis-Irrenanstalt für Oberbayern können in die neue Anstalt nach Eglfing verlegt werden.
17. 7 1905 - Erneutes Wahlbündnis zwischen der SPD und dem Zentrum
Königreich Bayern * Die Landtagswahlen sind von einem erneuten und ausgeweiteten Wahlbündnis“zwischen der SPD und dem Zentrum geprägt. Bei den Bayerischen Landtagswahlen erhält
- das Zentrum 102 (bisher 83),
- die Fortschrittspartei 22 (44),
- die SPD 12 (11) Mandate.
Die Liberalen setzten ihren Abstieg fort und können nur noch 22 [- 22] Mandate erringen. Doch damit ist der Weg für eine Zweidrittelmehrheit geebnet, welche zu einer Wahlrechtsreform benötigt wird.
Um 8 1905 - „Des is ja bloß a luthrischer Komödiant“
München-Au * Johann Royes besucht seine 24-jährige Tochter Gisela, die spätere Ehefrau von Karl Valentin, in der Au.
Dabei bemerkt er die unübersehbare Schwangerschaft seiner Tochter.
Sie erhält von dem „frommen Katholiken“ eine saftige Watschn, nachdem er erfahren hat, dass der Vater des Kindes „bloß a luthrischer Komödiant“ sei.
Also ein Taugenichts und Habenichts.
5. 8 1905 - Anton Azbé stirbt im Alter von 43 Jahren
München-Schwabing * Der Kunstmaler und Lehrer Anton Azbé stirbt im Alter von 43 Jahren.
Seit 9 1905 - Das „Oktoberfest“ dauert 16 Tage
München-Theresienwiese * Das „Oktoberfest“ dauert 16 Tage.
Es beginnt am 3. September-Samstag um 12 Uhr - zunächst noch ohne feierliches Zeremoniell.
28. 9 1905 - Große Veränderung bringt die Landtags-Sitzungsperiode
München-Kreuzviertel * Große Veränderung bringt die Sitzungsperiode des 34. Landtags, der vom 28. September 1905 bis zum 23. März 1907 tagt.
19. 10 1905 - Karl Valentins Tochter Gisela wird geboren
Aufhausen/Oberpfalz * Karl Valentins Freundin Gisela Royes bringt die gemeinsame uneheliche Tochter Gisela zur Welt. Um kein Aufsehen zu erregen und weil das Kind zum unpassenden Zeitpunkt geboren wird, findet die Geburt in Aufhausen in der Oberpfalz statt. Das ist der Wohnsitz der Familie der Mutter.
20. 10 1905 - Allen Redakteuren beim Vorwärts wird gekündigt
Berlin * Allen Redakteuren beim Vorwärts wird gekündigt, ihnen aber die Möglichkeit der Bewerbung um Wiedereinstellung gelassen. Kurt Eisner kündigt daraufhin von sich aus.
25. 10 1905 - Hendrik Witbooi, der Anführer der Nama, stirbt
Deutsch-Südwestafrika * Der charismatische Anführer der Nama, Hendrik Witbooi, stirbt an den Folgen einer Schussverletzung. Das tut aber dem Widerstand der Nama keinen Abbruch. Vereinzelte Überfälle und Gefechte ziehen sich bis zum Jahr 1908 hin.
30. 11 1905 - In Bayern wird die Direkte Wahl eingeführt
München-Kreuzviertel * Im bayerischen Abgeordnetenhaus wird ein Wahlgesetz einstimmig angenommen. Es ersetzt die bisherige Landtagswahl mittels Wahlmänner durch direkte Wahl.
9. 12 1905 - Franz Stuck wird geadelt
München * Franz Stuck erhält das Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone und damit den persönlichen Adel.
26. 12 1905 - Der Schlieffen-Plan wird in Berlin vorgelegt
Berlin * Der sogenannte Schlieffen-Plan wird in Berlin vorgelegt. Er sieht für den Fall eines Zweifrontenkrieges vor,
- die Masse des deutschen Heeres zunächst im Westen gegen Frankreich einzusetzen,
- mit dem Nordflügel die französischen Befestigungen zu umgehen und
- das französische Heer entscheidend im Rücken zu fassen.
- Nach einem Sieg über Frankreich sollen die deutschen Truppen nach Osten verlegt werden, um dort gegen Russland vorzugehen.
Der preußische Offizier Alfred Graf von Schlieffen will auf diese Weise den Krieg gegen Frankreich und Russland in zwei aufeinander folgende Feldzüge aufzuteilen.
Anno 1906 - Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ gründet eine „Damenabteilung“
München-Au * Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ gründet eine „Damenabteilung“, die zugleich eine der Ersten im „Deutschen Reich“ ist.
1906 - Das „Brausen- und Wannenbad“ an der Pilgersheimerstraße wird erweitert
München-Untergiesing * Das „Brausen- und Wannenbad“ an der Pilgersheimerstraße wird durch den Einbau von Wannenbädern im Kellergeschoß erweitert.
Es enthält jetzt zehn Wannenbäder für Männer und sechs für Frauen, sowie neun Brausenabteilungen für Männer und drei für Frauen.
Die Anlage umfasst Keller- und Erdgeschoß, sowie ein Obergeschoß über dem Mitteltrakt, die als Badewärterwohnung dient.
1906 - Die größte, beste und schnellste „Radrennbahn der Welt“ in Milbertshofen
Milbertshofen * Die Münchner bauen die größte, beste und schnellste „Radrennbahn der Welt“ in Milbertshofen.
Auf ihr fährt der Franzose Paul Guignard mit 101,2 Stundenkilometern einen Aufsehen erregenden „Weltrekord“.
1906 - Eine große Gründungswelle an „Kinematographentheatern“
München * In Deutschland setzt eine große Gründungswelle an „Kinematographentheatern“ ein.
Vermutlich am 1906 - Ein Teil der Entenbachstraße wird in Zeppelinstraße umbenannt
München-Au * Ein Teil der Entenbachstraße wird in Zeppelinstraße umbenannt.
1906 - Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ beharrt auf seine Eigenständigkeit
München - München-Au * Die drei Arbeiter-Sportvereine der linken Isarseite schließen sich zum „Arbeiter-Turnverein München“ zusammen.
Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ beharrt dagegen auf seine Eigenständigkeit.
1906 - „Reichskanzler“ Bernhard von Bülow fordert „einen Platz an der Sonne“.
Berlin * Der deutsche „Reichskanzler“ Bernhard von Bülow fordert „einen Platz an der Sonne“.
In Afrika hatte Deutschland seit den 1880er Jahren mit Deutsch-Ostafrika, Togo, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika Gebiete an der Ost- und Westküste besetzen können.
Deutschland wirft konkret ein Auge auf den belgischen und französischen Kongo.
1906 - In Ulm wird ein „Krematorium“ eröffnet
Ulm * Mit der Errichtung eines „Krematoriums“ in Ulm wird dann meist dieser Zielort gewählt.
Der Ulmer Gemeinderat lässt sich die Kosten für ihr „Krematorium“ durch die vielen Aufträge aus München finanzieren.
Anschließend wird die zurückgelieferte Urne in einem „Erdgrab“ bestattet.
Das heißt, es werden dafür - bis zum Jahr 1904 - die gleichen Kosten wie für einen Sarg berechnet.
1906 - Das Interesse an der „Feuerbestattung“ ist beträchtlich gestiegen
München - München-Obergiesing * Das Interesse an der „Feuerbestattung“ ist in München mittlerweile beträchtlich gestiegen, weshalb die Stadt erneut einen Antrag zur Errichtung eines „Krematoriums“ stellt.
Schließlich einigt man sich auf einen Kompromiss.
Der „Verein für Feuerbestattung“ pachtet von der Stadt München die auf dem „Ostfriedhof“ errichtete „Verbrennungsanlage für Sargbretter und Grabkränze“ und lässt die Anlage auf eigene Kosten zu einer „Leichenverbrennungsanlage“ umbauen.
1906 - Ludwig Thoma veröffentlicht „Tante Frieda. Neue Lausbubengeschichten“
München * Mit „Tante Frieda. Neue Lausbubengeschichten“ veröffentlicht Ludwig Thoma ein weiteres Buch.
Ab 1906 - Ludwig Thoma schreibt für die Zeitschrift „März“
München * Ludwig Thoma schreibt bis zur Einstellung der Zeitschrift „März“ im Jahr 1917 exakt 215 Artikel.
1906 - Ludwig Thoma kauft ein Grundstück auf der „Tuften“
Tegernsee * Ludwig Thoma kauft ein Grundstück auf der „Tuften“ in Tegernsee.
1. 1 1906 - Der FC Bayern erstmals mit roten Hosen und weißen Hemden
München * Nachdem die „Bayern“ mit dem Münchner Sport-Club - MSC fusionieren, dabei aber ihre Eigenständigkeit und Verwaltung behalten, übernehmen die Bayern, Fußballabteilung des Münchner Sport-Clubs die Spielkleidung des MSC und begegnen künftig ihren Gegnern mit roten Hosen und weißen Hemden auf dem Spielfeld.
2. 1 1906 - Franz Stuck darf den Namenszusatz „von“ führen
München * Franz von Stuck wird in die Adelsmatrikel eingetragen. Seither darf er den Namenszusatz „von“ führen.
16. 1 1906 - Die Konferenz zur Souveränität Marokkos beginnt in Algeciras
Algeciras * Die Internationale Konferenz zur Souveränität Marokkos beginnt im spanischen Algeciras.
18. 1 1906 - Münchens erste Automobildroschke
München * Die erste Automobildroschke fährt auf Münchens Straßen. Bis dahin erledigten die Aufgabe der Personenbeförderung rund 500 Pferdedroschken.
Für die Kraftdroschken wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 15 Stundenkilometer festgelegt. Doch schon bald beschweren sich die Kutscher, dass sich ihre motorisierten Kollegen nicht an die Höchstgeschwindigkeit hielten und rücksichtslos die Kurven schneiden.
6. 4 1906 - Die direkte Wahl der Abgeordneten wird Gesetz
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Das neue bayerische Landtagswahlgesetz tritt in Kraft. Es sieht die direkte Wahl der Abgeordneten,vor.</p>
7. 4 1906 - Die Internationale Konferenz im spanischen Algeciras endet
<p><strong><em>Algeciras</em></strong> * Die Internationale Konferenz im spanischen Algeciras endet. Auf der Konferenz wird zwar die Souveränität Marokkos formell anerkannt. Doch die Polizei in den marokkanischen Häfen und das Bankwesen darf Frankreich gemeinsam mit Spanien verwalten. Deutschland erhält keinen Zugriff auf diese Kontrollen Marokkos. </p> <p>Damit hat Frankreich sein Hauptziel erreicht, während das Deutsche Reich aufgrund seines aggressiven Vorgehens immer mehr an Ansehen verliert und zusehends in die außenpolitische Isolierung treibt. <br /> Auch für die sich bildende marokkanische Unabhängigkeitsbewegung stellte das Konferenzergebnis eine Niederlage dar. </p>
9. 4 1906 - Der Entwurf zum Wahlgesetz wird eingebracht
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Entwurf zum Wahlgesetz wird erstmals nicht von der Regierung eingebracht, sondern vom Landtag in Form eines Antrags. </p> <ul> <li>Der Vorsitzende des. Ministerrats, Clemens Graf von Podewils, unterstützt das Anliegen. </li> <li>In der Kammer der Reichsräte bemüht sich besonders Prinz Ludwig [III.] um die Annahme des Entwurfs. </li> </ul> <p>Damit wird die <em>„direkte Wahl“</em> und die <em>„gesetzlich geregelten Wahlkreise“</em> eingeführt. Noch immer aber gilt das <em>„relative Mehrheitswahlrecht“</em>, das die kleineren Parteien benachteiligt. </p>
15. 4 1906 - In der Kaufingerstraße eröffnet Münchens erstes fest installiertes Kino
München-Hackenviertel * In der Kaufingerstraße eröffnet mit dem „Welt-Kinematograph“ das erste fest installierte Kino in München.
3. 6 1906 - Josephine Baker wird geboren
<p><strong><em>St. Louis, Missouri</em></strong> * Die spätere Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Josephine Baker wird als Freda Josephine McDonald in St. Louis geboren. Sie ist die uneheliche Tochter des Schlagzeugers Eddie Carson und der Waschfrau Carrie McDonald. Sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf.</p>
2. 8 1906 - Der Reichstag lehnt weiteres Geld für die Kolonialkriege ab
Berlin * Durch den anhaltenden und mit hohen Kosten verbundenen Kolonialkrieg zuerst gegen die Herero und jetzt gegen die Nama ist die deutsche Regierung gezwungen, im Deutschen Reichstag einen Nachtragshaushalt in Höhe von 29 Millionen Reichsmark zu beantragen.
Vor allem die SPD verweigert angesichts der „rücksichtslosen Kriegsführung“ mit zahlreichen Opfern ihre Zustimmung. Auch der Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger kritisiert die Ausgaben scharf und argumentiert gegen die Kolonialkriege, weshalb auch die Zentrumsfraktion - zum Teil gegen ihren Willen - den Nachtragshaushalt ablehnt.
Vertreter beider Parteien wollen der in Deutschland vorherrschenden patriotischen Kolonialbegeisterung eine realistischere Sicht auf die Lage in den Kolonien entgegensetzen, um den in Deutsch-Südwestafrika tobenden Krieg zu beenden.
25. 8 1906 - Der Steyrer Hans stirbt
München * Der Steyrer Hans stirbt und wird unter großer Anteilnahme der Münchner Bevölkerung am Ostfriedhof beigesetzt.
9 1906 - Die „Festwiese“ des „Oktoberfestes“ hat die heutigen Ausmaße erreicht
München-Theresienwiese * Die „Festwiese“ des „Oktoberfestes“ hat die heutigen Ausmaße erreicht.
11. 9 1906 - Der etablierte Spediteur Jean Hopp stirb
München - München-Au * Der etablierte Spediteur Jean Hopp stirb im Alter von 39 Jahren. Er kaufte kurz vor seinem Tod die Firma Falk & Fey samt Inventar um 2.000 Mark. Der erst 1903 aus der damals bayerischen Rheinpfalz nach München zugewanderte Unternehmer will durch den Firmenkauf als „lange eingeführte Firma“ erscheinen.
6. 10 1906 - Ludwig Thoma muss eine sechswöchige Haft antreten
München-Stadelheim * Ludwig Thoma muss eine sechswöchige Haft in der Vollzugsanstalt Stadelheim antreten. Anlass ist sein Gedicht „An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine“.
16. 10 1906 - Ludwig Thoma tritt eine sechswöchige Haftstrafe an
München-Obergiesing * Ludwig Thoma tritt eine sechswöchige Haftstrafe in der Strafvollzugsanstalt Stadelheim an. Er ist für schuldig befunden worden, mit seinem Gedicht „An die Sittlichkeitsprediger“ die Kirche beleidigt zu haben.
12. 11 1906 - Kaiser Wilhelm II. eröffnet die Ausstellung des Deutschen Museums
München-Isarvorstadt - Museuminsel - München-Lehel * Kaiser Wilhelm II. eröffnet die provisorische Ausstellung des Deutschen Museums im Alten Nationalmuseum an der Maximilianstraße, dem heutigen Museum Fünf Kontinente.
15. 11 1906 - Karl Valentin und seine Mutter ziehen nach Zittau um
München-Au - Zittau * Karl Valentin und seine Mutter melden sich in München ab und ziehen um nach Zittau.
12. 12 1906 - Rosa Luxemburg wird zu zwei Monaten Haft verurteilt
Weimar * Rosa Luxemburg wird in Weimar zu zwei Monaten Haft wegen Anreizung zum Klassenhass verurteilt.
13. 12 1906 - Mehrheit gegen die Fortsetzung des südwestafrikanischen Kolonialkrieges
Berlin * Bei der Abstimmung im Reichstag kommt eine knappe Mehrheit von 177 zu 168 gegen den Nachtragshaushalt zur Fortsetzung des südwestafrikanischen Kolonialkrieges zustande. Daraufhin lässt Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow - in Einvernehmen mit Kaiser Wilhelm II. - noch am gleichen Tag den Reichstag auflösen.
14. 12 1906 - Das erste deutsche U-Boot wird in Betrieb gestellt
Eckernförde * Das erste deutsche U-Boot mit der Bezeichnung SM U 1 wird in Eckernförde in Betrieb gestellt.
1907 - Der Künstlername „Karl Valentin“ ist unveränderlich
München * Spätestens ab jetzt ist Valentin Ludwig Feys Künstlername „Karl Valentin“ unveränderlich.
1907 - Hubert von Herkomer wird die „englische Ritterwürde“ verliehen
London * Hubert von Herkomer wird die „englische Ritterwürde“ verliehen.
Er darf sich jetzt Sir Hubert von Herkomer nennen.
1907 - Hermann Leveling ist Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9
München-Maxvorstadt * Hermann Leveling, „Rentier, Ritter und Edler“ ist Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9.
1907 - Die „Brockensammlung“ erhält zusätzliche Räume in der „Alten Isarkaserne“
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Der Verkaufsraum der „Brockensammlung“ auf der „Kohleninsel“ ist zu klein, weshalb die karitative Einrichtung zusätzlich zwei Ställe der „Alten Isarkaserne“ erhält.
1907 - Das „Arbeitsamt“ sucht auch nach einer geeigneten „Koststelle“ für Kinder
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Als neue Dienstleistung übernimmt das „Arbeitsamt“ für Frauen mit Kindern die Suche nach einer geeigneten „Koststelle“.
1907 - Die „Akademische Sektion Wien“ nimmt den „Arier-Paragraphen“ auf
Wien * Die „Akademische Sektion Wien des DuOeAV“ nimmt den „Arier-Paragraphen“ in ihre Satzung auf.
1907 - Johann Dienstknecht gründet den „allerersten“ Filmverleih
München * Johann Dienstknecht gründet den „allerersten“ Filmverleih und wird damit bis zu seinem Tod im Februar 1910 der unumschränkte Herrscher auf dem Filmmarkt sein.
1907 - Die „Straßenbahn-Direktion“ braucht neue Büroräume
München-Haidhausen * Die „Straßenbahn-Direktion“ braucht neue Büroräume, die in der ehemaligen „Lackiererei“ - im ersten Stock des „Werkstättengebäudes“ - eingerichtet werden.
Ab 1907 - Im „Simplicissimus“ erscheinen die „Filserbriefe“ von Ludwig Thoma
München * Im „Simplicissimus“ erscheinen bis 1914 insgesamt 41 „Filserbriefe“ aus der Feder von Ludwig Thoma.
25. 1 1907 - Die Hottentottenwahl bringt massive Mandatsverluste für die SPD
Deutsches Reich * Die Reichstagswahl, die sogenannte Hottentottenwahl, führt im Reich zu einem konservativen Richtungsumschwung in der Sozialdemokratischen Partei.
Die Reichstagswahl bringt für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD herbe Mandatsverluste ein. Die Sozis stürzten - auch aufgrund des ungerechten Dreiklassen-Wahlrechts - von 81 auf 43 Sitze im Reichstag ab und verlieren somit 38 Mandate. Das ist die schwerste Wahlschlappe, die die SPD bis dahin einstecken musste.
Der Reichsregierung ist dies zweifellos mit ihrem Appell an die vaterländischen Instinkte gelungen. Gleichzeitig war dadurch die Kolonialismus-kritische schwarz-rote Mehrheit im Reichstag gebrochen. Die Konservativen, bestehend aus der Deutschkonservativen Partei, der Deutschen Reichspartei und der Nationalliberalen Partei billigen umgehend den Nachtragshaushalt und damit die weitere Finanzierung des Kolonialkrieges in Übersee.
Für die Sozialdemokratie hat der Ausgang der Wahl einen erzieherischen Einfluss. Die SPD-Parteiführung will künftig ihre nationale Zuverlässigkeit stärker in den Mittelpunkt stellen. Das bedeutet aber gleichzeitig die „Bereitschaft zur Vaterlandverteidigung“ nach vorne und die Kritik an der deutschen Weltpolitik nach hinten zu stellen.
Diesen Schritt will Kurt Eisner - aufgrund seiner aus der „Marokkokrise“ gezogenen Erkenntnisse - keinesfalls mitgehen. In der Fränkischen Tagespost, der er seit März 1907 angehört, warnt er nachdrücklich vor dem „Nachlassen im Kampf gegen den Militarismus“.
3 1907 - Kurt Eisner tritt in die Redaktion der Fränkischen Tagespost ein
Nürnberg * Kurt Eisner tritt in die Redaktion der SPD-nahen Fränkischen Tagespost in Nürnberg ein.
9. 3 1907 - Fritz Gerlich legt sein Doktorexamen ab
München-Maxvorstadt * Fritz Gerlich legt sein Doktorexamen an der Philosophischen Fakultät der Universität München ab.
Ab 16. 3 1907 - „Charles Fey - der Musical-Fantast“ geht auf Tournee
<p><strong><em>Halle</em></strong> * Unter dem Pseudonym <em>„Charles Fey - Musical-Fantast“ </em>geht Karl Valentin mit seinem <em>„Orchestrion“</em> auf Tournee. Er will mit dem <em>„Lebenden Orchestrion“</em> möglichst gleichzeitig bis zu zwanzig verschiedene Instrumente bedienen und damit ein großes Orchester imitieren. Am 16. März tritt <em>„Charles Fey“</em> in Halle in <em>„Süssmilch‘s Walhalla-Theater“</em> auf.</p>
17. 3 1907 - Dem „Musical-Fantast“ Charles Fey wird gekündigt
Halle * Die Geschäftsführung des „Süssmilch‘s Walhalla-Theaters“ in Halle kündigt dem „Musical-Fantast“ Charles Fey.
26. 3 1907 - Ludwig Thoma heiratet Marietta de Rigardo
München * Ludwig Thoma heiratet Marietta de Rigardo.
21. 5 1907 - Dr. phil. Fritz Gerlich tritt seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst an
München * Dr. phil. Fritz Gerlich tritt im Kgl. Allgemeinen Reichsarchiv seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst an.
31. 5 1907 - Ergebnis der bayerischen Landtagswahlen 1907
Königreich Bayern * Bei den bayerischen Landtagswahlen erhalten
- das Zentrum 98 (- 4),
- die Fortschrittspartei 25 (- 3) und
- die Sozialdemokratische Partei 20 (+ 8) Mandate.
31. 5 1907 - Landtagswahlen mit dem neuen Mehrheitswahlrecht
Königreich Bayern * Die Wahlen werden erstmals nach dem neuen Wahlgesetz durchgeführt. Durch das Mehrheitswahlrecht erreicht
- das Zentrum mit 44 Prozent der Stimmen 60 Prozent der Mandate,
- die Liberalen erhalten 16 Prozent der Mandate bei 24 Prozent der Stimmen,
- die SPD benötigt für zwölf Prozent der Mandate 17,7 Prozent der Stimmen.
Um 6 1907 - Die Tournee des „Musik-Clowns“ Karl Valentin endet im Fiasko
Deutsches Reich * Die Tournee des „Musik-Clowns“ Karl Valentin endet im Fiasko.
In einem „Anfall von einem Löwenbräubierriesenrausch“ zerstört er - angeblich - seinen Musikapparat.
14. 6 1907 - Die Errichtung eines Alpinen Museums wird beschlossen
München - Innsbruck * Die Generalversammlung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins - DuOeAV beschließt die Errichtung eines Alpinen Museums. Innsbruck und München bewerben sich. Die bayerische Hauptstadt erhält den Zuschlag.
15. 6 1907 - Karl Valentin ist wieder in München gemeldet
München-Angerviertel * Karl Valentin ist wieder in München gemeldet. Sein erster Wohnsitz ist in der Bierwirtschaft Stubenvoll, in der Schlafstellen vermietet werden. Karl Valentin ist ein sogenannter Schlafgänger. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit Zithervorträgen in verschiedenen Lokalen.
2. 7 1907 - Die Maffei-Lokomotive „S 2/6“ erreicht einen Weltrekord
München-Englischer Garten - Hirschau * Die „S 2/6“, eine speziell für Schnellfahrversuche bei Maffei in der Hirschau gebaute Lokomotive erreicht mit einer Geschwindigkeit von 154,5 km/h einen Weltrekord, der bis 1936 Bestand hat.
6. 7 1907 - Freia Eisner kommt in München zur Welt
München * Freia Eisner, die erste gemeinsame Tochter von Kurt Eisner und Else Belli, wird in München geboren.
31. 8 1907 - Russland tritt der Entente cordiale bei
Petersburg * In Petersburg tritt Russland der Entente cordiale bei. Frankreich, Großbritannien und Russland bilden damit die „Triple Entente“ [„Entente“ = Bündnis]
9 1907 - Aus der „Fischerhütte zum Holländer“ wird die „Fischer-Vroni“
München-Theresienwiese * Josef Pravida nennt seine „Fischerhütte zum Holländer“ in „Fischer-Vroni“ um.
Angeblich bezieht sich der Name „Vroni“ auf eine Bedienung Josef Pravidas, die im Wirtshaus „Zum goldenen Stern“ eine besonders herzliche Atmosphäre verbreitet und damit auch auf dem Münchner Oktoberfest die „gute Seele“ des Fischbrat-Unternehmens verkörpert.
Seither befindet sich auch der alte „Fischerkahn“ am Seiteneingang der „Fischer-Vroni“. Er ist ein beliebter Treffpunkt.
27. 9 1907 - Der 35. Landtag will das Verhältniswahlrecht durchsetzen
München-Kreuzviertel * Der 35. Landtag dauert vom 27. September 1907 bis zum 14. November 1911. Die SPD will gemeinsam mit den Liberalen und dem Bauernbund das Verhältniswahlrecht durchsetzen. Doch so weit kommt es nicht.
Um 12 1907 - Karl Valentin reist zu seiner Mutter nach Zittau
München - Zittau * Karl Valentin reist, von Schulden und ständigen Geldsorgen geplagt, zu seiner Mutter nach Zittau, um sich Geld von ihr zu leihen.
Unverrichteter Dinge muss er jedoch wieder abreisen.
31. 12 1907 - Das Königlich Bayerische Arbeitermuseum zählt 16.000 Besucher
München-Lehel * Das Königlich Bayerische Arbeitermuseum zählt 16.000 Besucher.
31. 12 1907 - Die Brauereien Beschäftigen etwa 4.000 Menschen
München * Die Brauereien nehmen mit etwa 4.000 Beschäftigten den 9. Platz unter den wichtigsten Gewerbezweigen ein.
1908 - Karl Valentin tritt als „Blödsinnkönig Valentin“ auf
München * Karl Valentin tritt als „Blödsinnkönig Valentin“ auf.
1908 - Die „Mörtelweiber“ verschwinden von den Baustellen
München * Mit dem „Änderungsgesetz der Gewerbeordnung“ verschwinden die „Mörtelweiber“ von den Baustellen, da darin die Verwendung von Arbeiterinnen beim Transport von Materialien aller Art untersagt wird.
Bis dahin betrug der „Frauenanteil im Baugewerbe“ knapp 10 Prozent.
Bis 1908 - Die Stimmabgabe bei politischen Wahlen ist an Besitz gebunden
Berg am Laim * Bis zur Änderung des „Kommunalwahlrechts“ ist die Stimmabgabe bei politischen Wahlen weitgehend an Besitz gebunden.
Von den 2.200 Berg am Laimer Gemeindebewohnern dürfen nur 50 männliche Gemeindebürger wählen.
Kein Wunder also, dass nahezu alle Bürgermeister betuchte „Ziegeleibesitzer“ sind und sich auch der „Gemeinderat“ zu etwa einem Drittel aus diesem Berufsstand rekrutiert.
1908 - Die „Actien-Ziegelei München“ betreibt in Unterföhring ein Werk
Unterföhring * Die „Actien-Ziegelei München“ betreibt in Unterföhring ein Werk, in dem sie vor allem „Trottoir- und Klinkerwaren, Verblendsteine für Tiefbauten und Handmauersteine“ herstellt.
1908 - Umzug der „Preußischen Gesandtschaft“ ins Lehel
München-Maxvorstadt - München-Lehel * Der Umzug der „Preußischen Gesandtschaft“ vom „Palais Dürckheim“ in der Türkenstraße 4 in die Prinzregentenstraße 9 erfolgt.
1908 - Die „Brauerei zum Franziskaner-Leistbräu“ wird eine Aktiengesellschaft
München-Au * Die „Brauerei zum Franziskaner-Leistbräu“ wird von Gabriel Sedlmayer in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Sie bleibt jedoch, von kleineren Beteiligungen abgesehen, in Familienbesitz.
1908 - Die Nicolai-Kirche am Gasteig ist in einem desolaten Zustand
München-Haidhausen * Der Zustand der Nicolai-Kirche am Gasteig ist derartig schlecht, dass ihr Abbruch ins Auge gefasst wird. Man einigt sich dann jedoch auf das Trockenlegen und Neuaufrichten der Wände. Das geschieht allerdings erst im Jahr 1912.
1908 - Der „Münchner Volkssänger-Verband“ wird gegründet
München * Der „Verband zur Wahrung und Förderung der Interessen der Münchner Volkssänger“ wird gegründet.
1908 - Der von der „Maffei-Maschinenfabrik“ entwickelte neue Lokomotiventyp
München-Englischer Garten - Hirschau * Der von der „Maffei'schen Maschinenfabrik“ entwickelte neue Lokomotiventyp S3/6 ist mit einer „Heißdampfmaschine“ ausgerüstet.
Sie kommt mit wesentlich weniger Kohle aus als vergleichbare Lokomotiven mit „Nassdampfmaschinen“ und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern.
1908 - De „Maffei'sche Maschinenbaufabrik“ hat 8.165 Lokomotiven produziert
München-Englischer Garten - Hirschau * Bisher hat die „Maffei'sche Maschinenbaufabrik“ in der „Hirschau“ insgesamt 8.165 Lokomotiven produziert.
1908 - Prinz Leopold ist ein gern gesehener Gast im „Imperial-Thater“
München * Prinz Leopold ist ein gern gesehener Gast im „Imperial-Thater“.
1908 - Jedem Katholiken wird die „Feuerbestattung“ verboten
München * Das „katholische Stadtpfarramt“ bekräftigt noch einmal ihre Haltung und verbietet jedem Katholiken die „Feuerbestattung“.
1908 - Ein überarbeiteter „Führer durch die Residenz zu München“ erscheint
München-Graggenau * Die zweite und überarbeitete Ausgabe des „Führers durch die Residenz zu München“ erscheint.
Frühestens 1 1908 - Karl Valentins Auftritte beim „Baderwirt“ in der Dachauer Straße 1a
München-Maxvorstadt * Karl Valentin tritt mit dem selbstironischen „Ich bin ein armer magrer Mann“, vor allem aber mit seiner Geschichte vom „Aquarium“ beim „Baderwirt“ in der Dachauer Straße 1a auf.
Ein Riesenerfolg!
8. 2 1908 - Ludwig Greiner erfindet den „Skelett-Gigerl“
<p><strong><em>München</em></strong> * Karl Valentin lebt für 3 Monate beim Ehepaar Ludwig und Therese Greiner als Zimmerherr.</p> <p>Sie bringen ihn auf die Straße des Erfolgs. Ludwig Greiner erfindet die neue Bühnenfigur, den <em>„Skelett-Gigerl“</em>; Therese Greiner näht ihm die hautengen und viel zu kurzen Klamotten, die sein ausgezehrtes, klapperdürres Gestell in unnachahmlicher Weise zur Geltung bringen.</p>
28. 2 1908 - Ernst Philipp Fleischer wird wegen Ehebruchs geschieden
München * Ernst Philipp Fleischers Ehe wird „wegen Ehebruchs mit der früheren Modellsteherin Maria Reitmaier“ geschieden.
3 1908 - Das „Landgerichtsgefängnis München II am Lilienberg“ wird abgerissen
München-Au * Die Gebäude des ehemaligen „Landgerichtsgefängnisses München II am Lilienberg“ werden abgerissen.
12. 3 1908 - Das Glockenspiel am Neuen Rathaus wird der Öffentlichkeit vorgeführt
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Das Glockenspiel am Turm des Neuen Rathauses wird der Öffentlichkeit vorgeführt. Die 37 Glocken sind eine Stiftung des Münchner Geschäftsmannes Karl Rosipal.</p>
31. 3 1908 - Der Wirtschaftsbetrieb im Café Isarlust auf der Praterinsel endet
<p><strong><em>München-Lehel</em></strong> * Der Wirtschaftsbetrieb im Café Isarlust auf der Praterinsel wird eingestellt. Der neue Besitzer, der Deutsche und Österreichische Alpenverein - DuOeAV, verfolgt mit der Immobile andere Ziele. </p>
8. 4 1908 - Ludwig Thoma bezieht sein neues Haus „Tuften 12“
Tegernsee * Ludwig Thoma und seine Frau Marietta beziehen ihr neues Haus „Tuften 12“.
16. 4 1908 - Der Waldspielplatz des ATV München-Ost wird eingeweiht
Gronsdorf * Der Waldspielplatz des Arbeiter-Turn-Vereins München-Ost in Gronsdorf kann eingeweiht werden.
24. 6 1908 - Hannes König wird in München geboren
München * Hannes König, der spätere Begründer des Valentin-Musäums, wird in München geboren.
1. 7 1908 - Karl Valentin tritt erstmals im Frankfurter Hof auf
München-Ludwigsvorstadt * Josef Durmer, der Besitzer des Hotels Frankfurter Hof, Schillerstraße 49, besuchte eine Veranstaltung von Karl Valentin und engagiert ihn umgehend für ein dauerhaftes Engagement an seiner renommierten Volkssängerbühne. Am 1. Juli tritt der 26-jährige Künstler erstmals im Frankfurter Hof für eine Gage von 5.- Mark am Abend auf.
Zum gleichen Zeitpunkt meldet er sein Gewerbe als „Singen im Stadtbezirk“ an. Nun ist er „amtlich gemeldeter Volkssänger“.
1. 7 1908 - Elisabeth Wellano erhält eine Anstellung im Kaufhaus Hermann Tietz
München-Angerviertel * Nach einer Textillehre bei der Firma Eder am Viktualienmarkt erhält Elisabeth Wellano eine Anstellung im Kaufhaus Hermann Tietz.
15. 8 1908 - Das neue Bayerische Gemeindewahlrecht bringt die Verhältniswahl
München * Mit dem neuen Bayerischen Gemeindewahlrecht wird die Verhältniswahl eingeführt.
9 1908 - Das „Schottenhamel-Festzelt“ wird auf 8.000 Plätze erweitert
München-Theresienwiese * Das „Schottenhamel-Festzelt“ ist auf 8.000 Plätze erweitert worden.
16. 9 1908 - Österreich-Ungarn erhält Bosnien und Herzegowina
Wien - Petersburg * Österreich-Ungarn und Russland beschließen, dass Österreich Bosnien und Herzegowina erhält. Russland soll im Gegenzug die freie Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen erhalten.
10 1908 - Karl Valentin holt seine Mutter aus Zittau nach München
München-Au * Nachdem sich seine finanzielle Lage verbessert hat, holt Karl Valentin seine Mutter aus Zittau nach München.
Sie wohnen in der Ackerstraße 1 in der Au.
5. 10 1908 - Österreich-Ungarn annektiert Bosnien und Herzegowina
Wien - Bosnien - Herzegowina - Paris - London - Petersburg - Berlin * Österreich-Ungarn annektiert - ohne Rücksprache mit den Großmächten - Bosnien und Herzegowina, gliedert sie also in die k.u.k. Monarchie ein.
Die Großmächte Frankreich, England und Russland sowie die Balkanstaaten protestieren gegen die österreichische Annektion. Ein Krieg wird nur verhindert, weil sich das Deutsche Reich mit Hinweise auf die Nibelungentreue auf die Seite von Österreich-Ungarn stellt.
27. 10 1908 - Kurt Eisner erhält die bayerische Staatsangehörigkeit
Ansbach * Kurt Eisner erwirbt „durch Aufnahme in Gemäßheit der Bestimmung in § 7 des Reichsgesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 die Staatsangehörigkeit im Königreiche Bayern“.
20. 11 1908 - Die Komödie „Moral“ von Ludwig Thoma wird in Berlin uraufgeführt
Berlin * Die Komödie „Moral“ von Ludwig Thoma wird in Berlin uraufgeführt.
21. 11 1908 - Ludwig Thomas Komödie „Moral“ wird auch in München erstmals aufgeführt
München * Einen Tag nach der Uraufführung in Berlin wird die von Ludwig Thoma geschriebene Komödie „Moral“ auch in München erstmals aufgeführt.
3. 12 1908 - Die Kreislehrerinnenbildungsanstalt kommt an die Frühlingstraße
München-Au * Der von Hans Grässel geschaffene Neubau für die Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern in der Frühlingstraße [heute: Eduard-Schmid-Straße] wird seinem Zweck übergeben.
10. 12 1908 - Der Brunnenweibchen-Brunnen geht in Betrieb
München-Au * Der Brunnenweibchen-Brunnen an der Gebsattelbrücke geht in Betrieb.
1909 - Elisabeth Wellanos 15jähriger Bruder xxx stirbt
München * Elisabeth Wellanos 15jähriger Bruder xxx stirbt.
1909 - Planungen für einen Kirchenneubau der „Georgskirche“
München-Bogenhausen * Es entstehen Planungen für einen Kirchenneubau der „Georgskirche“ nahe der heutigen „Gebeleschule“ in Bogenhausen.
1909 - Theodor Geist ist Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 3 und 5
München-Maxvorstadt * Der „Großhändler“ Theodor Geist ist Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 3 und 5.
1909 - Die „Brockensammlung“ zieht in Räume der „Neuen Isarkaserne“
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Die „Brockensammlung“ zieht von der „Kohleninsel“ in aufgelassene Räume der „Neuen Isarkaserne“ an der Kohlstraße.
1909 - Eine Festuniform für die Professoren der „Akademie der Bildenden Künste“
München-Maxvorstadt * Noch zur „Jahrhundertfeier 1909“ lassen sich die Professoren der „Akademie der Bildenden Künste“ ihre „Festuniform“ nach den Vorgaben von 1808 schneidern.
1909 - Die „Zentrale der städtischen Abfallentsorgung“ in der Sachsenstraße
Untergiesing * Die „Zentrale der städtischen Abfallentsorgung“ wird in der Sachsenstraße eröffnet.
Gleichzeitig werden die „Reparaturwerkstätten der städtischen Hausunratabfuhranstalt“ von der Landsberger Straße hierher verlegt. Es gibt bereits 650 „Harritschwägen“.
Der damalige Jahresbericht erzählt von 19.631 „Pferdeschichten“ und 33.336 „Mannschichten“ die geleistet wurden, um 117.577 Tonnen „Unrat“ bei den 550.000 Münchnern einzusammeln.
Rund 69.000 Fuhren werden per Bahn zur „Hausmüllverwertungsanlage“ nach Puchheim verfrachtet.
Der Giesinger Wagenschmiedmeister Fischer darf nur die ersten 36 „Harritschwägen“ liefern.
Alle weiteren bauen die Schmiede und Wagner der städtischen „Unratabfuhr“ selbst in ihren Werkstätten.
Die Wägen bleiben Eigentum der Stadt und werden an private „Abfuhrunternehmer“ für die „Mülleinsammlung“ ausgeliehen.
Diese haben eigene Stallungen und beschäftigen die „Harritschkutscher“.
Um 6 Uhr in der Frühe müssen die „Müllmänner“ ihre Pferde striegeln und anschirren.
Dann rücken die Gespanne unter Hufgeklapper aus.
Dieses Müllsammlungs-, Verwertungs- und Beseitigungssystem ist in Deutschland einmalig und dient vielen Kommunen als Vorbild.
Es funktioniert bis zum Zweiten Weltkrieg.
Dann kommt die „Abfallsortierung“ in der Puchheimer „Verwertungsanlage“ aus Mangel an Ersatzteilen zum Erliegen.
Damit hat München keine geordnete „Müllbeseitigung“ mehr.
Anno 1909 - Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ gründet eine Schülerriege
München-Au * Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ gründet eine Schülerinnen- und Schülerriege.
1909 - Das erste vollautomatische Großstadtwählamt Europas in Schwabing
München-Schwabing * Das in Schwabing befindliche erste vollautomatische Großstadtwählamt Europas macht eine Vielzahl von Vermittlungskräften überflüssig.
Die Eröffnung des „Selbstwählamtes“ führt zu Protesten.
In einem Gutachten äußert ein Münchner Arzt, „dass durch das Wählen die Fernsprechteilnehmer eine Schädigung ihres Nervensystems erfahren würden“.
Die Aufregung legt sich erst, nachdem die „Telephonabonnenten“ die Vorteile des Selbstwählens erkannt haben.
1909 - Ein Gutachten soll die „Geruchsbelästigung für die Anwohner“ prüfen
München-Obergiesing * Der Umbau der „Verbrennungsanlage für Sargbretter und Grabkränze“ ist beendet.
Jetzt muss aber noch ein Gutachten abgewartet werden, das die „Geruchsbelästigung für die Anwohner“ prüft.
Die Prüfungen werden sich bis zum Jahr 1912 hinziehen.
1. 1 1909 - Die provisorische Ausstellung des Deutschen Museums wird erweitert
München-Isarvorstadt * Der zweite Teil der provisorischen Ausstellung des Deutschen Museums wird in den aufgelassenen Räumen der Neuen Isarkaserne in der Zweibrückenstraße eröffnet.
1. 1 1909 - Erich Mühsam zieht nach München
München * Erich Mühsam zieht nach München.
2 1909 - Lion Feuchtwanger und der „Phoebus-Skandal“
München-Maxvorstadt * Lion Feuchtwanger organisiert als Vorsitzender der „Phoebus“-Gruppe zum Ausklang der Faschingssaison im „Löwenbräukeller“ einen aufwändigen Ball.
Weil sich der Sponsor der Veranstaltung als Betrüger herausstellt, kommt es zum Eklat.
Handwerker und Arbeiter reißen noch während des Faschingballs die Dekoration herunter und fordern ihre Löhne und die unbezahlten Rechnungen ein.
Feuchtwanger und seine Mitstreiter holen ein Großaufgebot der Polizei, was alles nur noch schlimmer macht.
Denn jetzt verlassen die Gäste den „Löwenbräukeller“ und fordern ihr Eintrittsgeld zurück.
Der „Phoebus-Skandal“ ist geboren.
Kurt Eisner, der spätere Revolutionär und „Ministerpräsident des Freistaates Bayern“ ist zu diesem Zeitpunkt Redakteur der SPD-Zeitung „Münchner Post“, bezeichnet den „Phoebus-Vorstand“ als „Margarine-Barönchen“.
Sein Ball hätte so viel „mit Apollon zu tun, wie Herr Lion Feuchtwanger mit der Literatur oder sein Vater mit der Naturbutter“.
18. 2 1909 - Premiere des Münchner Glockenspiels
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Das Glockenspiel auf dem Münchner Rathaus erlebt seine öffentliche Erstaufführung. Gleichzeitig wird es von der Stadt endgültig abgenommen und sein Betrieb genehmigt. </p>
7. 3 1909 - Das neue Pasinger Gotteshaus wird gesegnet
Pasing * Mit der Segnung des neuen Pasinger Gotteshauses, der späteren Pfarrkirche Maria Schutz, wird dieses für die Gottesdienste geöffnet.
1. 4 1909 - Else Belli kauft eine Villa in Großhadern
<p><em><strong>Großhadern</strong></em> * Else Belli, die spätere Ehefrau von Kurt Eisner, kauft mit Unterstützung ihres Vaters eine Villa in der Hadener Lindenallee 8 (heute: Pfingstrosenstraße 8). Kurt Eisner zieht mit zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Lisbeth Eisner, geb. Hendrich: Ilse und Hans Kurt Eisner, zu Else Belli. </p>
11. 4 1909 - Der Bildhauer Anton Heß stirbt
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Bildhauer Anton Heß stirbt.</p>
5 1909 - Die Arbeiten zum „Fleischer-Schlössl“ in Bogenhausen beginnen
München-Bogenhausen * Die Arbeiten zum 108 x 29 Meter messenden „Fleischer-Schlössl“, auf dem 2,38 Hektar großen Parkgrundstück in Bogenhausen beginnen.
Das Hochparterre sollte eine Wohnfläche von 1.600 qm bieten. Das Atelier wäre 150 qm groß geworden.
22. 6 1909 - Elisabeth Wellanos Mutter stirbt
München * Elisabeth Wellanos (= Liesl Karlstadt) Mutter stirbt.
4. 7 1909 - Ritter Karl von Müller stirbt in der Nähe von Bozen
Bozen * Ritter Karl von Müller, der Sponsor des Volksbades, stirbt in der Nähe von Bozen.
14. 7 1909 - Theobald von Bethmann Hollweg wird zum Reichskanzler ernannt
Berlin * Theobald von Bethmann Hollweg wird in Berlin zum Reichskanzler ernannt.
9 1909 - Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet auf der Theresienhöhe statt
München-Theresienhöhe * Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet erstmals im „Städtischen Ausstellungspark auf der Theresienhöhe“ statt.
4. 9 1909 - Karl Valentin tritt im Münchner-Kindl-Keller auf
München-Au * Karl Valentin tritt - neben vielen anderen Künstlern - beim Bürgerrechts-Verein München-Ost und dem Sozialdemokratischen Verein, Sektion München-Ost im Münchner-Kindl-Keller - an herausgehobener Position - als Instrumental-Karikaturen-Komiker auf.
18. 9 1909 - Kaiser Wilhelm II. eröffnet die Schack-Galerie
München-Lehel * Der Deutsche Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II., eröffnet die Schack-Galerie an der Prinzregentenstraße 9. Die Münchner Neuesten Nachrichten schreiben: „Als Kunstfreund und Mäcen ist der Kaiser bei uns erschienen, nachdem er erst als oberster Kriegsherr, umgeben vom Glanz seines militärischen Gefolges, die friedlichen Schlachtfelder im Frankenland verlassen“.
Im Giebelfeld des neuen Kultur-Tempels, das von massigen Säulen getragen wird, befindet sich der preußische Adler und die Inschrift: „Kaiser Wilhelm II. der Stadt Muenchen zur Mehrung ihres Ruhmes und grossen Kuenstlern zum Gedaechtnis“. In diesem Sinne ist auch die kaiserliche Eröffnungsrede gehalten, in der er die wohlgesetzten Worte spricht: „Ich weiß mich eins mit der vaterländischen Gesinnung des Münchner Bürgertums, auf welches ganz Deutschland, von der Meeresküste bis zu den bayerischen Bergen, ein Recht hat, stolz zu sein.“
10 1909 - In zwölf Großgaststätten werden Kinofilme gezeigt
München * In zwölf Großgaststätten werden Kinofilme gezeigt:
- im „Gasthaus Herzogpark“ an der Mauerkirchener Straße,
- im „Mühldorfer Hof“ an der Einsteinstraße,
- in den „Unionsbräuhallen“ an der Einsteinstraße,
- im „Münchner-Kindl-Keller“ an der Rosenheimer Straße,
- im „Franziskaner-Keller“ an der Hochstraße,
- im „Salvatorkeller“ an der Hochstraße,
- im „Bergbräukeller“ an der Tegernseer Landstraße,
- in den „Bergbräubierhallen“ an der Bergstraße im Münchner Osten und
- im „Schwabingerbräu“ an der Leopoldstraße,
- in der „Gaststätte zur Blüte“ in der Blütenstraße,
- im „Alten Hackerkeller“ an der Bayerstraße und
- im „Neuen Hackerkeller“ auf der Theresienhöhe im Westen.
30. 10 1909 - Ruth Eisner kommt in Großhadern auf die Welt
Großhadern * Ruth Eisner, die zweite gemeinsame Tochter von Kurt Eisner und Else Belli, kommt in Hadern zur Welt.
11 1909 - Karl Valentin zieht mit seiner Mutter in die Kanalstraße 16
München-Lehel * Karl Valentin zieht mit seiner Mutter von der Ackerstraße 1 in die Kanalstraße 16 (27/I) im Lehel um.
31. 12 1909 - Die Schulden König Ludwigs II. sind restlos getilgt
München * Die Schulden des „Märchenkönigs“ Ludwig II. sind auch mit den Geldern seines Bruders Otto restlos getilgt.
1910 - Eine Alpenvereinssektion für „Akademiker germanischer Abstammung“
<p><strong><em>München</em></strong> * In München gründen ein paar Professoren eine Alpenvereinssektion für <em>„akademisch gebildete Herren germanischer Abstammung“</em>.</p>
1910 - Das Postgebäude am Ostbahnhof mit automatischer Telegraphenzentrale
München-Haidhausen * Das „Postgebäude München-Ostbahnhof mit automatischer Telegraphenzentrale“ wird gebaut.
1910 - Die Dienstvilla für den Direktor des „Muffatwerkes“
München-Haidhausen * Die Dienstvilla für den Direktor des „Muffatwerkes“ an der Zellstraße 8 wird bezogen.
1910 - Bei Elisabeth Wellano [Liesl Karlstadt] wird das „Theaterfeuer“ gelegt
München-Hackenviertel * Ihr Bruder lädt Elisabeth Wellano im Alter von 17 Jahren in den „Bamberger Hof“ ein, wo die „Münchner Alpensängergesellschaft Schnackl Franz“ auftritt.
Dadurch wird bei ihr das „Theaterfeuer“ gelegt.
1910 - Schichtunterricht in den Bogenhausener Schulen
München-Bogenhausen * Die Schülerzahl in Bogenhausen steigt in kürzester Zeit derart an, dass Schichtunterricht abgehalten werden muss.
1910 - Das „Bad Brunnthal“ wird abgebrochen
München-Bogenhausen * Das „Bad Brunnthal“ wird abgebrochen.
1910 - Eine „Privatklinik“ in der Richard-Wagner-Straße 19
München-Maxvorstadt * Auf den bei Baubeginn noch dem „Unionsbrauerei-Gründer“ Joseph Schülein gehörenden Grundstück Richard-Wagner-Straße 19 lässt dessen Schwiegersohn Dr. med. Alfred Haas eine äußerlich einem herrschaftlichen Wohnhaus ähnelnde „Privatklinik“ errichten.
Dr. Alfred Haas ist mit Elsa Schülein verheiratet.
1910 - Dr. Fritz Gerlich erhält die bayerische Staatsangehörigkeit
München * Nach Ablegen seiner „archivarischen Staatsprüfung“ erwirbt der „preußische Staatsangehörige“ Dr. phil. Fritz Gerlich, „aufgrund seiner Niederlassung in der Stadt München [...], die Staatsangehörigkeit im Königreich Bayern“.
1910 - Ein Schankkellner wird wegen schlechten Einschenkens verurteilt
München * Ein Münchner Richter spricht sechs „Schankkellner“ mit dem Hinweis frei, dass dem hiesigen Publikum das schlechte Einschenken ohnehin bekannt sei, und „Auswärtige werden es wohl bald erfahren“.
Auf Einspruch des Staatsanwalts gibt es später aber doch noch eine Strafe.
Sonst hätte nämlich der Verteidiger recht behalten, der argumentiert hatte, Bier sei nichts anderes als eine Mischung von Flüssigkeit und Schaum.
„Wenn also diese Mischung einschließlich des Schaumes den Eichstrich erreicht, so bleibt an der einwandfreien Füllung des Trinkgefässes kein Zweifel“.
1910 - Ärmere Arbeiterfamilien essen Pferdefleisch, aber auch Hundefleisch
München * Infolge der hohen Fleischpreise steigen ärmere Münchner Arbeiterfamilien auf billige Fleischarten wie Pferdefleisch, aber auch Hunde- und Katzenfleisch um.
1910 - Die „Lustbarkeitssteuer“ wird in Deutschland eingeführt
Berlin * Die „Lustbarkeitssteuer“ wird in Deutschland eingeführt.
1910 - Die Staatsregierung bremst die Elektrifizierung
München-Englischer Garten - Hirschau * Aufgrund der zur Serienreife entwickelten neuen „Maffei'schen“ Lokomotive mit Heißdampfmaschine verfolgt das „Bayerische Verkehrsministerium“ die Elektrifizierung der Bahn mit wesentlich geringerem Nachdruck.
1910 - Auf zehn verschiedene Stadtbezirke verteilte „Brause- und Wannenbäder“
München * Neben dem „Karl-Müller-Volksbad“ betreibt die Stadtgemeinde München zehn auf verschiedene Stadtbezirke verteilte „Brausen- und Wannenbadeanstalten“, die ganzjährig gegen ein geringes Entgeld benutzt werden können.
Anno 1910 stürzten sich 497.924 Personen in ein Wannenbad. Die billigeren Brausebäder benutzten 621.212 Münchner. München hat zu dieser Zeit 596.497 Einwohner.
Statistisch gesehen badet oder duscht jeder Münchner keine zwei Mal im Jahr.
1910 - Den „Verein bayerischer Kinematographeninteressenten“ gegründet
München * Auf Anregung von Carl Gabriel wird der „Verein bayerischer Kinematographeninteressenten“ als Interessensverband der Kinobesitzer gegründet.
Der Grund der Vereinsgründung ist der Versuch der Münchner „Lokalschulkommission“, ein „Kinderverbot im Kinematographentheater“ durchzusetzen.
Damit wäre ein treuer Kundenstamm des Kinos ausgeschlossen worden.
1910 - Gustl Annast betreibt das Münchner Kabarett „Serenissimus“
München * Der aus Salzburg stammende Gustl Annast betreibt bis 1913 das Münchner Kabarett „Serenissimus“.
1910 - Die „katholischen Lehrerinnenvereine“ sprechen sich für das „Zölibat“ aus
München * Die „katholischen Lehrerinnenvereine“ vertreten die Auffassung, dass die Ehe die Entfaltung der Kräfte in Erziehung und Unterricht verhindert.
Mit dieser „Zölibat-Diskussion“ blamieren sich die deutschen Lehrervereinigungen europaweit, denn fast überall lehren dort verheiratete Frauen an den Schulen.
1910 - Die Kicker des „FC Union“ schließen sich dem „ATV München-Ost“ an
München-Haidhausen * Die Kicker des anno 1909 gegründete Fußballverein „FC Union“ aus den Herbergsvierteln schließen sich dem „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ an.
Damit erhält der Verein seine eigene Fußballabteilung.
Der „FC Union“ gibt sich seinen Namen nach der nahen „Unionsbrauerei” und trägt seine Spiele auf dem Sportplatz an der Trogerstraße aus.
Um 1910 - Dienst und Ehe schließen sich für die Vermittlungskräfte aus
München - Berlin * Dienst und Ehe schließen sich für die Vermittlungskräfte aus.
In einem Weisungsbuch heißt es:
„Das weibliche Postpersonal bedarf zur Eingehung einer Ehe der Erlaubnis der zuständigen Dienstbehörde.
Da sich aber aus der Verwendung von verheirateten Beamtinnen [...] Schwierigkeiten verschiedener Art ergeben können, kann dem unterstellten weiblichen Personal [...] die Erlaubnis zur Eingehung einer Ehe nicht erteilt werden“.
Ab 1910 - Der „Hundemarkt“ ist im „Gasthof Oberottl“ untergebracht
München-Hackenviertel * Der „Hundemarkt“ ist bis zum Jahr 1922 im „Gasthof Oberottl“ an der Sendlinger Straße untergebracht.
1910 - München hat 595.467 Einwohner
München * München hat 595.467 Einwohner.
10. 2 1910 - Die dritte „Völkerschau aus Samoa“ geht auf Reisen
Samoa - Deutschland * Die dritte „Völkerschau aus Samoa“ nimmt ihren Anfang am 10. Februar 1910 und endet am 22. November 1911.
Um 4 1910 - Die Arbeiten zum Fleischer-Schlössl müssen eingestellt werden
<p><strong><em>München-Bogenhausen</em></strong> * Die Arbeiten zum Fleischer-Schlössl in Bogenhausen müssen wegen finanzieller Schwierigkeiten des Bauherrn eingestellt werden.</p>
1. 5 1910 - Die erste polizeilich genehmigte Münchner „Maikundgebung“
München-Theresienwiese * Auf der Theresienwiese findet die erste polizeilich genehmigte „Maikundgebung“ statt.
6. 5 1910 - George V. wird britischer König
London * George V. wird britischer König.
19. 6 1910 - Das Denkmal für den Märchenkönig wird eingeweiht
München-Isarvorstadt * Das 3,40 Meter hohe Standbild für den Märchenkönig Ludwig II. wird auf der Corneliusbrücke eingeweiht. Es zeigt den jungen Monarchen im Krönungsornat vor seinem Thron.
17. 9 1910 - Das Oktoberfest wird 100 Jahre alt
München-Theresienwiese * Das 100. Jubiläums-Oktoberfest wird eröffnet. Gleichzeitig findet das Zentral-Landwirtschaftsfest statt. Organisiert wird die Festlichkeit ausschließlich vom Magistrat der königlichen Haupt- und Residenzstadt.
- Zehn Bierhallen bilden das Wahrzeichen des Oktoberfestes.
- Auf dem Oktoberfest gibt es die Nummer „La Course á la Mort“ zu bewundern. Todesmutige Fahrradfahrer radeln in einer Stahlkonstruktion direkt über den Mäulern von hungrigen und gefährlichen Löwen.
- Carl Gabriels Teufelsrad dreht sich erstmals auf der Wiesn.
- Die Feierlichkeiten auf der Jubiläums-Wiesn dauern bis zum 2. Oktober.
Vor dem 17. 9 1910 - Der Winzerer-Fähndl-Pachtvertrag geht an die Thomas-Brauerei
München-Theresienwiese * Der Magistrat verlängert den Pachtvertrag mit dem Winzerer Fähndl für die Schießanlage und die dazugehörige Festbude nicht mehr, sondern schließt einem Vertrag mit der Thomas-Brauerei. Dabei muss die Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl mit überraschung feststellen, dass ihr Name für das Festzelt inzwischen von der Brauerei patentrechtlich geschützt worden ist.
Am Ende der Entwicklung steht ein eigenes Winzerer-Fähndl-Festzelt und eine Winzerer-Fähndl-Schießanlag“ mit einer kleinen Wirtsbude. Da diese Schießanlage wiederholt ihren Platz wechselt, stehen heute das Winzerer-Fähndl-Festzelt und das Armbrustschützenzelt (mit der Schießanlage der Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl) an ganz verschiedenen Stellen der Wirtsbudenstraße.
17. 9 1910 - Der Simplicissimus ernennt Schottenhamel zum Rector Magnificus
München-Theresienwiese * In einer Karikatur im Simplicissimus ernennt Thomas Theodor Heine den Festwirt Michael Schottenhamel zum „Rector Magnificus“, weil während der Wiesntage sowieso alle Studenten bei ihm „hören“.
Ab 17. 9 1910 - Eine Völkerschau aus Samoa als Hauptattraktion auf der Jubiläums-Wiesn
München-Theresienwiese * Die dritte Völkerschau aus Samoa ist die Hauptattraktion auf dem Jubiläums-Oktoberfest. Unter der Führung des Schaustellers Carl Gabriel besucht Prinzregent Luitpold die Ausstellung. Prinz Ludwig überreicht dem „Samoanerhäuptling Tamsese einen wertvollen Ring zum Geschenk, wofür der Fürst dem Prinzen schriftlich in samoanischer Sprache seinen Dank zum Ausdruck brachte“.
21. 10 1910 - Karl Valentins zweite Tochter Berta wird unehelich geboren
München-Lehel * Karl Valentins zweite Tochter Berta wird unehelich geboren.
4. 11 1910 - Michael Faulhaber wird Bischof von Speyer
Speyer * Michael Faulhaber wird Bischof von Speyer. Die Pfalz gehört zum Königreich Bayern.
24. 11 1910 - Carl Gabriel eröffnet das „Gabriels Tonbildtheater“ in der Lilienstraße
München-Au * Carl Gabriel eröffnet im ehemaligen Varieté-Theater im Kaiserhof an der Lilienstraße 2 das „Gabriels Tonbildtheater“ mit 220 Plätzen. Das Kino sind die heutigen Museum-Lichtspiele.
31. 12 1910 - Der Pro-Kopf-Bier-Verbrauch liegt in München bei 309 Liter
München * Der Pro-Kopf-Bier-Verbrauch liegt in München bei 309 Liter.
31. 12 1910 - 194 Kraftdroschken zur Personenbeförderung
München * In München sind bereits 194 Kraftdroschken unterwegs. Die Pferdedroschken haben sich auf 286 reduziert.
1911 - Das Wirtshaus „Neuberghausen“ in Bogenhausen wird stillgelegt
München-Bogenhausen * Das Wirtshaus „Neuberghausen“ in Bogenhausen wird stillgelegt und das Anwesen an Friedrich Lauer verkauft.
Nach weiteren Zukäufen errichtet er hier seine 3.000-Quadratmeter-Villa.
1911 - Dr. Hermann Schülein ist „Brauerei-Direktor“
München-Haidhausen - München-Au * Dr. Hermann Schülein ist „Direktor“ der „Unionsbrauerei“ und der „Münchner-Kindl-Brauerei“.
1911 - Julius Freundlich kauft die Villa an der Brienner Straße 43
München-Maxvorstadt * Das Haus an der Brienner Straße 43 geht in das Eigentum des „Geheimen Kommerzienrats“ Julius Freundlich über.
Die „Villa Freundlich“ wird durch Gabriel von Seidl und der „Firma Heilmann & Littmann“ umgebaut.
1911 - Lolo von Lenbach kauft Grundstücke zu
München-Maxvorstadt * Lolo von Lenbach kauft einen Teil des Grundstücks-Nachlasses des „Rentiers“ Schäfer an der Brienner Straße 43 und lässt es bebauen.
Es trägt die Anschrift Richard-Wagner-Straße 2.
1911 - Franz Rank baut an der Richard-Wagner-Straße 17 und 19
München-Maxvorstadt * Franz Rank baut auf den Grundstücken der „Firma Gebrüder Rank“ an der Richard-Wagner-Straße 17 und 19 ein Wohnhaus im „klassizierenden Jugendstil“.
Architekt für HausNr. 19 ist Max Neumann.
1911 - Die Suche einer „Koststelle“ übernimmt der „städtische Berufsvormund“
München * Die Suche nach einer geeigneten „Koststelle“ übernimmt an Stelle des „Arbeitsamtes“ ab sofort der „städtische Berufsvormund“.
1911 - Die Erhöhung des Schaumraumes in den Krügen gefordert
München-Theresienwiese * Der „Verband zur Bekämpfung betrügerischen Einschenkens“ fordert die Erhöhung des Schaumraumes in den Krügen oberhalb des Eichstrichs auf 4 Zentimeter.
Bis zur Umsetzung der Forderung werden noch weitere 73 Jahre vergehen.
1911 - Die katholische Kirche verlegt „Heiligenfeste“ und „Patrozinien“ auf Sonntag
Königreich Bayern * Auf Drängen der bayerischen Industrie verlegt die katholische Kirche zwei „Heiligenfeste“ und sämtliche „Patrozinien“ der Kirchen- und Ortspatrone auf Sonntage; drei „Marienfeiertage“ werden sogar ganz gestrichen.
1911 - Der „Kirchenbauverein St.-Wolfgang“ erwirbt einen Bauplatz
München-Au * Der - immer in Geldnöten steckende - örtliche „Kirchenbauverein St.-Wolfgang“ erwirbt auf dem Gelände der aufgelassenen „Kreisirrenanstalt“ einen Bauplatz zu günstigen Bedingungen.
1911 - Umbenennung in „Freie Turnerschaft München“
München-Au * Der „Arbeiter-Turnverein München“ benennt sich in „Freie Turnerschaft München“ um.
1911 - „Der Wittiber“ von Ludwig Thoma kommt in die Buchläden
München * Der neue Roman „Der Wittiber“ von Ludwig Thoma kommt in die Buchläden.
Es geht darin um einen Landwirt, der nach dem Tod seiner Frau zum Alkoholiker wird.
1911 - Der „Wehrverein“ formuliert seine „Kolonialpolitik“
Berlin * Der im Jahr 1911 gegründete „Wehrverein“ formuliert seine „Kolonialpolitik“ so:
„Ein vorwärtsstrebendes Volk wie wir, das sich so entwickelt, braucht Neuland für seine Kräfte, und wenn der Friede das nicht bringt, so bleibt schließlich nur der Krieg“.
15. 2 1911 - Elisabeth Wellano kündigt ihren Job bei „Hermann Tietz“
München * Elisabeth Wellano kündigt ihren Job bei „Hermann Tietz“ und steht für 3.- Mark Gage jeden Abend auf der Bühne im „Frankfurter Hof“.
19. 2 1911 - Michael Faulhaber wird im Kaiserdom zu Speyer inthronisiert
Speyer * Michael Faulhaber wird im Kaiserdom zu Speyer als Bischof inthronisiert.
Um den 4 1911 - Frankreich geht in Marokko militärisch gegen aufständische „Berber“ vor
Marokko * Frankreich geht in Marokko militärisch gegen Gruppen vor, die die Kooperation der Regierung des „Scharifenreichs“ mit den europäischen Mächten bekämpfen.
Deutschland sieht darin eine günstige Gelegenheit, seine Interessen in Afrika entscheidend weiterzuentwickeln.
Wenn schon die Franzosen ihren Kampf gegen aufständische „Berber“ aufgenommen haben, dann will die deutsche Regierung auf alle Fälle die deutschen „Kolonialisten“ vor den Kämpfern schützen.
Und wenn die sich schon nicht bedroht fühlten, dann musste eben das deutsche „Auswärtige Amt“ in Marokko ansässige Firmen auffordern, ein „Hilfeersuchen“ zu stellen, damit man eingreifen kann.
29. 4 1911 - Während Karl Valentins Auftritt wird nicht serviert
München-Graggenau * Im Café Perzl am Marienplatz [heute: Kaufhaus Ludwig Beck am Rathauseck] wird ein Ehrenabend anlässlich des 20. Bühnenjubiläums von Constantin Pfrang, genannt „Stanzl“, durchgeführt.
Unter „Nummer 6“ tritt Karl Valentin als „Karikatur“ auf.
Er ist der einzige Künstler, bei dem während seines Auftritts nicht serviert wird.
Vielleicht 5 1911 - Karl Valentin und Elisabeth Wellano im „Hotel Frankfurter Hof“
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin und Elisabeth Wellano treffen im „Hotel Frankfurter Hof“ aufeinander.
Der bereits etablierte Karl Valentin kommt auf die „dantschige“ Nachwuchs-Schauspielerin zu und meint:
„Sie, Fräulein, Sie sind als Soubrette aufgetreten.
Heut hab ich Sie zum ersten Mal gesehen.
Des is nix. Wissen‘s, Sie sind zu schlank für a Soubrette.
Als Soubrette muss man kess sein, die muss an großen Busen haben.
Außerdem sind Sie viel zu schüchtern. Und so brav schaun Sie aus, fast wia a Kommunionmäderl. -
Aber Sie sind sehr komisch.
Sie müssen sich aufs Komische verlegen.
Das ist geeignet für Sie“.
Daraufhin ist das Fräulein Wellano empört und schwer beleidigt.
Doch Karl Valentin meint es ehrlich, weshalb er weiter auf Liesl Wellano einredet und meint:
„Ich schreib Ihnen einmal in der nächsten Zeit a komisches Soubrettencouplet, also eine Parodie auf eine richtige Soubrette. Und des bringens dann“.
Er schreibt ihr also ein Couplet mit dem Titel „Das Gretchen“.
Die talentreiche Nachwuchsschauspielerin ist zwar nicht überzeugt davon, lässt sich aber auf das Abenteuer ein, lernt das Lied auswendig und trägt es vor. „Ich hab mich aber nicht so schön angezogen im Flitterkleid, sondern schon a bissl komisch gmacht“, schreibt sie später.
Und weiter: „Damals war es Mode, dass man irgend einen Herrn im Publikum ansingt als Soubrette“.
Liesl sucht ihr Opfer aus und singt in der letzten Strophe: „O nimm mir diesen Stein vom Herzen“.
Dabei greift sie in ihren Ausschnitt, zieht einen Isarkiesel hervor, schmeißt ihn auf den Boden und schmettert dann weiter:
„Bereit mir nicht so viel Kummer, Sorg und Schmerzen, Sag‘ es aufrichtig, hast Du mich lieb, Du kecker Herzensdieb“.
Das war ein Riesenerfolg und ein großer Lacher - und machte aus der einst „feschen Soubrette“ eine „komische Soubrette“.
Um 5 1911 - Bischof Faulhaber löst sämtliche Simultankirchen auf
Speyer * Kurz nachdem Michael Faulhaber zum Bischof ernannt worden ist, löst er im Bistum Speyer sämtliche Simultankirchen auf. Das sind Gebetshäuser, in denen seit langer Zeit Katholiken und Protestanten - zu verschiedenen Zeitpunkten - ihre Andachten abhalten.
6. 5 1911 - Elisabeth Wellano unterschreibt einen Bühnenkontrakt
München * Elisabeth Wellano unterschreibt einen Bühnenkontrakt bei Adalbert Meiers „Gesellschaft die lustigen Dachauer“. Ihre monatliche Gage ist doppelt so hoch wie ihr Verdienst im Kaufhaus Hermann Tietz war.Das Engagement dauert vom 1. Juni 1911 bis 1. Juli 1912.
6 1911 - Ludwig Thomas Ehe mit Marietta de Rigardo wird geschieden
München * Ludwig Thomas Ehe mit Marietta de Rigardo wird geschieden.
1. 7 1911 - Das Kanonenboot Panther vor Agadir löst die Zweite Marokkokrise aus
Agadir * Das Kanonenboot Panther kreuzt in den Gewässern vor der marokkanischen Hafenstadt Agadir auf. Frankreich und die anderen Großmächte sind total überrascht und natürlich nicht darauf vorbereitet. Frankreich fühlt sich erpresst. Und auch die englische Regierung erklärt, dass sie eine Schwächung ihres Bündnispartners zugunsten Deutschlands keines Falls akzeptieren wird. Damit wird die Zweite Marokkokrise zwischen Deutschland und Frankreich ausgelöst.
Es kommt zu zähen Verhandlungen, in denen Frankreich einen Zipfel Togos an Deutschland abtreten muss, den sogenannten „Entenschnabel“. Deutschland erklärt dafür im Gegenzug sein Desinteresse an der französischen Marokkopolitik.
Der im Jahr 1911 gegründete Wehrverein formulierte es so: „Ein vorwärtsstrebendes Volk wie wir, das sich so entwickelt, braucht Neuland für seine Kräfte, und wenn der Friede das nicht bringt, so bleibt schließlich nur der Krieg.“
18. 7 1911 - Lion Feuchtwanger zieht in die Burgstraße 10
München-Graggenau * Lion Feuchtwanger zieht in die Burgstraße 10.
31. 7 1911 - Karl Valentin (Fey) heiratet Gisela Royes
München-Lehel * Karl Valentin (Fey) heiratet Gisela Royes in der St.-Anna-Basilika im Lehel.
26. 9 1911 - Die Berufsfeuerwehr wird Automobilisiert
München * Der Münchner Magistrat beschließt die Automobilisierung der Berufsfeuerwehr.
29. 9 1911 - Italien erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg
Rom - Konstantinopel * Italien, Mitglied im Dreibund, erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg, um in den Besitz von Libyen zu kommen. Doch anders als von Italien erwartet, begrüßt die einheimische Bevölkerung die Italiener nicht als Befreier, sondern als feindliche Invasoren.
6. 10 1911 - Das Heß‘sche Anwesen in der Luisenstraße 35 wird versteigert
München-Maxvorstadt * Das Heß‘sche Anwesen in der Luisenstraße 35 wird versteigert.
23. 10 1911 - Italienischen Truppen gehen gegen die arabische Bevölkerung vor
Tripolis * Die italienischen Besatzungstruppen gehen in einem Pogrom gegen die arabische Bevölkerung vor und erschießen dabei innerhalb von fünf Tagen wahllos tausende Araber, verbrennen deren Hütten und beschlagnahmen das Vieh.
Auch in den folgenden Wochen führte die Besatzungsmacht Massenhinrichtungen auf öffentlichen Plätzen durch und deportierte etwa 4.000 Araber auf Strafinseln.
1. 11 1911 - Die ersten Zwei-Kilo-Bomben auf lebende Ziele
Tripolis * Der italienische Leutnant Giulio Cavotti lässt über zwei Oasen bei Tripolis die ersten Zwei-Kilo-Bomben auf lebende Ziele abwerfen. Der Angriff dient keinem militärischen Zweck, sondern geschieht im Rahmen der Vergeltungsaktionen gegen die arabische Bevölkerung.
14. 11 1911 - Prinzregent Luitpold löst den Landtag vorzeitig auf
München-Kreuzviertel * Das Zentrum verweigert die Beratung des Verkehrsetats, weil ihr der linksliberale Verkehrsminister Heinrich von Frauendorfer zu sozialistenfreundlich ist und dem der SPD nahestehenden Süddeutschen Eisenbahnerverband ein Streikrecht einräumt.
Das Zentrum will sich dem Prinzregenten als regierungsfähig darstellen und versucht sich mit einem scharfen antisozialdemokratischen Kurs zu profilieren. Daraufhin macht Prinzregent Luitpold von seinem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch, löst den Landtag vorzeitig auf und setzt Neuwahlen an. Die letzte derartige Landtags-Auflösung fand im Jahr 1869 statt.
Bei der Verkündung dieses Beschlusses in der Abgeordnetenkammer vermerkt das Protokoll „lebhaften Beifall links und bei den Sozialdemokraten“.
1912 - Paul Ludwig Troost lebt bis zu seinem Tod in der Kaulbachstraße 10
München-Maxvorstadt * Paul Ludwig Troost, der Architekt des „Hauses der Deutschen Kunst“ und der „Parteibauten am Königsplatz“, lebt bis zu seinem Tod am 21. Januar 1934 in der Kaulbachstraße 10, EG, links.
Er gilt als der Architekt, der in seinen Planungen bereits die Grundzüge der nationalsozialistischen Stadtplanung festgelegt hat, wie sie später im gesamten Deutschen Reich zur Ausführung kommen.
Ab 1912 - Elisabeth Wellano tritt als „Blödsinnkönigin Frl. Lisi“ auf
München * Die 20-jährige Elisabeth Wellano tritt - solo und selbstbewusst - als „Blödsinnkönigin Frl. Lisi“ auf.
1912 - Karl Valentin dreht die Stummfilmgroteske „Karl Valentins Hochzeit“
München * Karl Valentin dreht - immerhin 2 Jahre bevor Charly Chaplin mit „Making a living“ beim Film debütiert - seine erste Version der Stummfilmgroteske „Karl Valentins Hochzeit“.
ab 1912 - Karl Valentin stellt seine eigenen „Volkssänger-Ensembles“ zusammen
München * Karl Valentin stellt seine eigenen „Volkssänger-Ensembles“ zusammen.
Das ist das Ende seines „Ein-Mann-Unternehmens“.
1912 - Lolo von Lenbach erwirbt das „Heß-Anwesen“
München-Maxvorstadt * Lolo von Lenbach erwirbt das „Heß-Anwesen“, nachdem zuvor das Inventar versteigert worden war.
1912 - Professor Dr. Ernst von Romberg wohnt in der Richard-Wagner-Straße 2
München-Maxvorstadt * Professor Dr. Ernst von Romberg bewohnt das Haus in der Richard-Wagner-Straße 2.
Der berühmte „Internist und Herzspezialist“ ist Professor an der „I. Medizinischen Klinik der Universität München“.
1912 - Siegfried Steinhard ist Eigentümer der Richard-Wagner-Straße 9
München-Maxvorstadt * Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9 ist der „Kaufmann“ Siegfried Steinhard.
1912 - Die „Privatklinik Dr. Alfred Haas“ wird eröffnet
München-Maxvorstadt * Die „Privatklinik Dr. Alfred Haas“ in der Richard-Wagner-Straße 19 wird eröffnet.
1912 - Der „Franziskaner-Keller“ an der Hochstraße
München-Au * Der „Franziskaner-Keller“ an der Hochstraße wird wiefolgt beschrieben:
„Der Franziskaner-Keller in der Hochstraße wurde im Auftrage der Franziskaner-Leistbrauerei nach dem Entwurfe des Professors Dr. Gabriel von Seidl errichtet.
Die Halle im Erdgeschoss besitzt eine mit Malerei dekorierte sichtbare Eisenkonstruktion. Im 1. Stock befindet sich ein kleiner Saal mit Terrassen, der mit einem Bilde von Rudolph von Seitz geschmückt ist“.
1912 - Die „Brockensammlung“ besteht seit zehn Jahren
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * In der Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der „Brockensammlung“ heißt es: „Kein Bazar und kein noch so großes Kaufhaus“ kann sich in „Vielseitigkeit des hier zum Verkauf Ausgestellten“ mit dem „Brockenhaus“ messen.
In den ersten zehn Jahren konnten 90.000 Mark an Institutionen der „Wohlfahrtspflege“ abgegeben werden.
Der Erfolg hält bis zu den im „Ersten Weltkrieg“ behördlich angesetzten Sammlungen an.
1912 - Die „Gaststätte am Chinesischen Turm“ geht in Betrieb
München-Englischer Garten - Lehel * Die „Chinesische Wirtschaft“ aus dem Jahr 1790 wird durch die noch heute stehende „Gaststätte am Chinesischen Turm“ ersetzt.
1912 - Der Mitarbeiterstamm bei „Maffei“ hat sich auf 2.026 Personen erhöht
München-Englischer Garten - Hirschau * Der Mitarbeiterstamm bei „Maffei“ hat sich auf 2.026 Personen erhöht.
1912 - Der „Holzmarkt“ am Schyrenplatz wird aufgelassen
München-Untergiesing * Der „Holzmarkt“ am Schyrenplatz wird aufgelassen, da inzwischen „stationäre Holz- und Kohlenhändler“ die Funktion des „Holzmarktes“ übernommen haben.
1912 - Ein Kinogründungs-Boom setzt ein
München * Mit dem Wegfall einer restriktiven, die Gewerbeordnung beschränkende „Polizeiordnung“ setzt ein Kinogründungs-Boom ein.
1912 - Die „Thule-Gesellschaft“ und ihre Wurzeln
München-Graggenau * Die „Thule-Gesellschaft“ hat ihren Ursprung in den vom „Mühleningenieur“ und „Publizisten“ Theodor Fritsch gegründeten „Reichshammerbund“.
Bei der Konstituierung des „Reichshammerbundes“ wird zugleich der „Germanenorden“ aus der Taufe gehoben.
Er soll die „geheime Kommandozentrale“ für die gesamte „völkische Bewegung“ werden, ein „deutsch-völkischer Generalstab“.
Nur „bis ins dritte Glied reinblütige Deutsche“ werden in den „Orden“ aufgenommen.
Besonderer Wert wird auf die „Propaganda der Rassenkunde“ gelegt.
Es sollen die Erfahrungen, die man „im Tier- und Pflanzenreiche gemacht hat, auf den Menschen angewandt“ und gezeigt werden, „wie die Grundursache aller Krankheit, allen Elends, in der Rassenvermanschung liege“.
Der „Orden“ will die „Prinzipien der Alldeutschen“ auf die „ganze germanische Rasse“ ausdehnen und den Zusammenschluss „aller Völker germanischen Blutes“ anbahnen.
Bis zum Jahr 1912 - Der „Arbeiter-Turn-Verein München-Ost“ nennt sich um
München-Au * Die Zahl der Mitglieder des „Arbeiter-Turn-Vereins München-Ost“ wächst auf über achthundert an.
Um dem Verein ein progressiveres Aussehen zu geben und ihn gleichzeitig für bürgerliche Sportinteressenten lukrativ zu machen, nennt sich der Arbeiter-Sportverein in „Turn- und Sportverein München-Ost“ um.
Der „Arbeiter“ muss zwar den Vereinsnamen verlassen, dennoch zeigt die neue Vereinsfahne noch immer die aufgehende Sonne des „Sozialismus“.
1912 - Der „Konsumverein von 1864“ errichtet ein Büro- und Wohngebäude
München-Au * Der „Konsumverein München von 1864“ errichtet an der Auerfeldstraße ein sechsstöckiges Gebäude mit Büros und Privatwohnungen.
1912 - Die Anlage der Gräber des „Ostfriedhofs” sind abgeschlossen
München-Obergiesing * Die Anlage der Gräber des „Ostfriedhofs” sind abgeschlossen.
Der 28,43 Hektar große Friedhof bietet nun Platz für 34.300 Gräber.
1912 - Ein „Mischehenverbot für Samoa“ wird erlassen
Samoa * Angesichts des freien „Sexuallebens“ und der unkomplizierten ehelichen Verbindungen wird ein „Mischehenverbot für Samoa“ erlassen.
Die Nachkommen aus bis dahin als legal angesehenen „Mischehen“ werden zu „Weißen“ erklärt und können sogar auf Antrag den Europäern gleichgestellt werden.
Man nennt sie dann „Kulturdeutsche“.
1. 1 1912 - Forstenried wird nach München eingemeindet
München-Forstenried * Die selbstständige Gemeinde Forstenried mit den Gemeindeteilen Fürstenried, Maxhof und Unterdill wird nach München eingemeindet.
8. 1 1912 - Pater Rupert Mayer kommt nach München
München * Pater Rupert Mayer kommt nach München. Er ist Seelsorger für katholische Zuwanderer und arbeitet in den Katholischen Arbeiter- und Arbeiterinnen-Vereinen mit.
12. 1 1912 - Bei den Reichstagswahlen wird die SPD stärkste Fraktion
Deutsches Reich * Bei der Reichstagwahl 1912 erreicht
- die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD 34,8 Prozent der abgegebenen Stimmen und wird mit 110 Abgeordneten [+ 67] zur stärksten Fraktion,
- das Zentrum wird mit 91 [- 14] Abgeordneten, aber lediglich 16,4 Prozent der Stimmen zur zweitstärksten Fraktion,
- die Nationalliberale Partei - NLP kommt auf 13,6 Prozent und 45 Abgeordnete [- 10],
- die Fortschrittliche Volkspartei - FVP erreicht mit 12,3 Prozent 42 Abgeordnete [-7].
Die Wahlbeteiligung liegt bei 85 Prozent. Die Benachteiligung der Sozialdemokraten kommt durch die seit dem Jahr 1871 unveränderte Wahlkreiseinteilung und anderen Verzerrungen durch das Mehrheitswahlrecht, zum Beispiel das Dreiklassenwahlrecht in Preußen.
Es ist die letzte Wahl, bei der die Frauen nicht stimmberechtigt sind.
12. 1 1912 - Arbeitslosen-Demonstration vor dem Rathaus
München-Graggenau * 1.500 Arbeitslose demonstrieren vor dem Münchner Rathaus.
2 1912 - Arbeitslosen-Demonstrationen am Gasteig
München-Au - München-Haidhausen * Im Münchner-Kindl-Keller und im Eberl-Bräukeller finden in den Faschingswochen „Arbeitslosen-Massenveranstaltungen“ statt.
2. 2 1912 - „Lichtmess“ ist letztmals ein offizieller Feiertag
München * Zum letzten Mal wird „Lichtmess“ als offizieller Feiertag begangen. Wenige Monate später wird eine Neuordnung der Feiertage den Wegfall mehrerer katholischer Traditionstage mit sich bringen. Neben Lichtmess fallen auch Mariä Verkündigung [25. März] und Mariä Geburt [8. September] der Reform zum Opfer.
2. 2 1912 - Das Flaschenpfand wird eingeführt
München * Das Flaschenpfand wird eingeführt. Bis wenige Jahre zuvor konnte man Bier nur im Wirtshaus und im offenen Krug kaufen. Flaschenbier wurde - wenn überhaupt - nur für den Export abgefüllt. Flaschenbier wurde in München erst ab dem Jahr 1894 in größerem Stil angeboten. Weil die Nachfrage schnell anstieg, ließen die Probleme nicht lange auf sich warten.
- Der Flaschenverlust für die Brauereien erreichte ungeahnte Höhen und
- „die Verschandelung der Wälder in der Umgebung der Stadt und der Ausflugsorte durch die weggeworfenen Bierflaschen und durch Flaschenscherben [nahm] ein unerträgliches Maß“ an.
5. 2 1912 - Die absolute Mehrheit des Zentrums kann nicht gebrochen werden
Königreich Bayern * Bei den Bayerischen Landtagswahlen erringt
- das Zentrum 87 (-12),
- die Liberalen 30 (+5),
- die SPD 30 (+10) und
- der Bauernbund 8 (-5) Mandate.
Die absolute Mehrheit des Zentrums kann nicht gebrochen werden.
9. 2 1912 - Georg von Hertling wird Vorsitzender des Ministerrats
<p><strong><em>München</em></strong> * Nach dem Rücktritt von Clemens von Podewils-Dürniz überträgt Prinzregent Luitpold dem Zentrumsvorsitzenden Georg Freiherr von Hertling das Ministerium des Königlichen Hauses und des Äußeren sowie den Vorsitz im Ministerrat.</p>
15. 2 1912 - SPD-Antrag zur Erhaltung „geeigneter Herbergsanwesen“ für die Nachwelt
München * Die „SPD-Fraktion des Gemeindebevollmächtigtenkollegiums“ beantragt:
„Einen beliebigen Block geeigneter Herbergsanwesen von besonderer Eigenart für die Nachwelt zu erhalten“.
13. 3 1912 - Bulgarien, Serbien, Griechenland, Montenegro gründen den „Balkanbund“
<p><strong><em>Sofia - Belgrad - Athen - Montenegro</em></strong> * Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro gründen den <em>„Balkanbund“</em>. </p> <ul> <li>Ihr gemeinsames Ziel ist die Verdrängung des <em>Osmanischen Reiches</em> vom Balkan und die Aufteilung seiner verbliebenen europäischen Provinzen. </li> <li>Federführend ist Russland, das sich als <em>Patron der Balkanvölker </em>versteht und damit die Kontrolle über die Meerengen des <em>Schwarzen Meeres</em> erhalten will. </li> <li>Das beunruhigte Frankreich wird von Russland mit der Aussage beschwichtigt, dass sie die Balkanstaaten kontrollieren kann. </li> </ul>
25. 3 1912 - „Mariä Verkündigung“ letztmals ein offizieller Feiertag
München * Zum letzten Mal wird „Mariä Verkündigung“ als offizieller Feiertag begangen.
12. 5 1912 - Ein breites Militärbündnis gegen das Osmanische Reich
Belgrad - Sofia * Serbien und Bulgarien vereinbaren ein Militärbündnis gegen das Osmanische Reich, dem sich Griechenland und Montenegro anschließen.
28. 6 1912 - Lion Feuchtwanger heiratet Marta Löffler
München * Lion Feuchtwanger heiratet Marta Löffler.
4. 8 1912 - Haidhausens erstes Kino öffnet am Orleansplatz
München-Haidhausen * Haidhausens erstes Kino eröffnet als „Erstes Münchner Lichtspielhaus“ am Orleansplatz.
Es wird 1919 erweitert und als „Zwecks Lichtspielhaus am Orleansplatz“ wieder eröffnet.
Mehrere Namensänderungen folgen.
Ab 1930 heißt es schlicht „OLI“.
1970 schließt das Kino für immer seine Pforten.
9 1912 - Unter dem Titel „Tripolis“ zeigt Carl Gabriel eine „Völkerschau“
München-Theresienwiese * Unter dem Titel „Tripolis“ zeigt Carl Gabriel eine „Völkerschau“ auf dem „Oktoberfest“.
9 1912 - Auf dem „Oktoberfest“ werden Abnormitäten gezeigt
München-Theresienwiese * Auf dem „Oktoberfest“ werden Abnormitäten gezeigt: „Josefa, Rosa und Franzi, die zusammengewachsenen Zwillinge und ihr Kind“.
8. 9 1912 - Mariä Geburt letztmals ein offizieller Feiertag
München * Zum letzten Mal wird Mariä Geburt als offizieller Feiertag begangen.
Ab 10 1912 - Deutliche Anzeichen einer wirtschaftlichen Depression
München * In München sind deutliche Anzeichen einer wirtschaftlichen Depression spürbar.
8. 10 1912 - Montenegro erklärt der Türkei den Krieg
Montenegro * Montenegro erklärt - in Abstimmung mit den Bündnispartnern Bulgarien, Serbien und Griechenland - der Türkei den Krieg.
10. 10 1912 - Wiesnwirt Michael Schottenhamel stirbt beim Kartenspielen
München * Mit einem Herz-Solo in der Hand stirbt Michael Schottenhamel beim Kartenspielen im Kreis seiner Freunde.
17. 10 1912 - Der Beginn des Ersten Balkankrieges
Balkan * Die Bündnispartner von Montenegro - Bulgarien, Serbien und Griechenland - greifen in den Krieg gegen das Osmanische Reich ein. Das ist der Beginn des Ersten Balkankrieges.
17. 10 1912 - Die Weißbierbrauerei Schneider kauft die Sankt-Michaels-Brauerei
Berg am Laim * Die Weißbierbrauerei Schneider & Sohn kauft die Sankt-Michaels-Brauerei in der heutigen Baumkirchner Straße 5.
17. 10 1912 - Albino Luciani, der spätere Papst Johannes Paul I., wird geboren
Forno di Canale * Albino Luciani, der spätere Papst Johannes Paul I., wird in Forno di Canale geboren.
18. 10 1912 - Der Italienisch-Türkische Krieg endet
Rom - Konstantinopel * Der Italienisch-Türkische Krieg endet. Bereits Ende 1914 führt jedoch eine erneute Revolte zum Rückzug der Italiener. Der geplante Vergeltungs-Feldzug wird jedoch wegen des Ersten Weltkrieges nicht ausgeführt.
18. 10 1912 - Die verbündeten Balkanstaaten beginnen den Krieg gegen die Türkei
Balkan * Die verbündeten Balkanstaaten - Montenegro, Bulgarien, Serbien und Griechenland - beginnen den Krieg gegen die Türkei.
Um 12 1912 - Das „Zwangsversteigerungsverfahren“ für das „Fleischer-Schlössl“
München-Bogenhausen * Das „Zwangsversteigerungsverfahren“ für das „Fleischer-Schlössl“ wird eingeleitet.
11. 12 1912 - Der Ministerrat fordert die Beendigung von König Ottos Regenschaft
München * Der Ministerrat fordert die Beendigung von König Ottos Regenschaft.
12. 12 1912 - Prinzregent Luitpold stirbt - Ludwig III. wird Prinzregent
München-Graggenau * Der 91-jährige Prinzregent Luitpold stirbt. Er wird von der Kritik - wegen seines Desinteresses in politischen und wirtschaftlichen Fragen - schlicht für unfähig gehalten.
Luitpolds 67jähriger Sohn Prinz Ludwig III. tritt seine Nachfolge als Prinzregent an. Der letzte bayerische Monarch „von Gottes Gnaden“ wird jedoch die Herzen seiner Untertanen nie erreichen.
30. 12 1912 - Sarah Sonja Rabinowitz heiratet Dr. Eugen Heinrich Lerch
Gießen * Sarah Sonja Rabinowitz heiratet in Gießen den Privatdozenten Dr. Eugen Heinrich Lerch. Anschließend zieht das Ehepaar Lerch nach München.
31. 12 1912 - Die Zahl der Münchner Cafès sinkt wieder auf Neunzig
München * Die Zahl der Münchner Cafès sinkt wieder auf Neunzig.
31. 12 1912 - Ludwig Thomas Bildergeschichte „Ein Münchner im Himmel“
München * Im Heft 54 des Simplicissimus erscheint die Bildergeschichte „Ein Münchner im Himmel“. Der Text stammt von Ludwig Thoma, die Zeichnungen liefert Olaf Gulbransson. Es geht darin um den vom Schlag getroffenen Dienstmann Alois Hingerl, der als Engel den Auftrag erhält, die göttlichen Eingebungen der bayerischen Staatsregierung zu überbringen.
Der „Engel Aloisius“ wird allerdings beim Anblick des Münchner Hofbräuhauses seinen Auftrag vergessen und sich eine Mass nach der anderen schmecken lassen. „Und so wartet die bayerische Staatsregierung noch heute auf die göttlichen Eingebungen!“
1913 - Der Film „Karl Valentins Hochzeit“ wird nochmal gedreht.
München * Weil die ersten Filmaufnahmen von „Karl Valentins Hochzeit“ unterbelichtet waren, wird der Streifen nochmal gedreht.
Jetzt ist auch Liesl Karlstadt mit im Team.
1913 - Karl Valentin zieht von der Kanalstraße 16 in die Kanalstraße 8 um
München-Lehel * Karl Valentin zieht von der Kanalstraße 16 in die Kanalstraße 8/2, Gartenhaus, um.
1913 - Der Film „Die lustigen Vagabunden“ entsteht
München * Der Film „Die lustigen Vagabunden“ entsteht.
Karl Valentin spielt darin einen ziemlich vertrottelten Polizisten.
1913 - Der Stummfilm „Karl Valentin privat und im Atelier“ entsteht
München * Der Stummfilm „Karl Valentin privat und im Atelier“ entsteht.
Dazu gehört auch das 18 Meter lange Fragment „Der Kuss“.
1913 - Emil Zeckendorf wird „k.k. östereichisch-ungarischen Vizekonsul“
München-Maxvorstadt * Emil Zeckendorf, Besitzer der Richard-Wagner-Straße 11, wird zum „k.k. östereichisch-ungarischen Vizekonsul“ ernannt.
1913 - Dr. Fritz Gerlich: „Geschichte und Theorie des Kapitalismus“
München * Dr. Fritz Gerlichs Buch „Geschichte und Theorie des Kapitalismus“ erscheint.
1913 - Das „Städtische Arbeitsamt“ zieht an die Thalkirchner Straße
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Nachdem das Gebäude des „städtischen Arbeitsamtes“ an der Thalkirchner Straße bezugsfertig ist, erfolgt der Umzug von der „Kohleninsel“.
1913 - Gründung des „Vereins der Freunde des Alpinen Museums“
München-Lehel - Praterinsel * Die Begeisterung für das „Alpine Museum“ auf der „Praterinsel“ führt zur Gründung des „Vereins der Freunde des Alpinen Museums“.
Er will die Lücken der Ausstellung schließen und den Ausbau des Museums fördern.
Im Süden des Anwesens wird ein „Alpenpflanzengarten“ angelegt und rund um das Haus Gesteinsblöcke der „Geologischen Schausammlung“ ausgestellt.
1913 - Faulhabers Kampf gegen die Geburtenkontrolle
Speyer * Der Bischof von Speyer, Michael von Faulhaber, bezeichnet die Empfängnisverhütung als „die eigentliche Todsünde unserer Zeit“. Er meint, dass sich „keine Religionsgemeinschaft [...] der Seuche des Geburtenrückgangs so kraftvoll erwehren [wird] wie die katholische Kirche“.
1913 - Das „Karussell am Chinesischen Turm“ geht in Betrieb
München-Englischer Garten - Lehel * Das heutige „Karussell am Chinesischen Turm“, ein Gemeinschaftswerk des Schwabinger Bildhauers Joseph Erlacher und des Dekorationsmalers August Julier, geht in Betrieb und dreht noch heute seine Runden.
1913 - Thomas Mann kauft ein Grundstück im „Herzogpark“
München-Bogenhausen * Thomas Mann erwirbt ein Grundstück im Münchner „Herzogpark“ und lässt sich von den Architekten Aloys und Gustav Ludwig eine Villa erbauen.
Die Anschrift lautet: Poschingerstraße 1.
1913 - München hat 45 „Lichtspieltheater“
München * In München gibt es 45 „Lichtspieltheater“.
Zum Vergleich: 1909 waren es nur acht.
1913 - 86.000 Protestanten leben in München
München * Münchens evangelische Gemeinde hat 86.000 Mitglieder.
Ab 1913 - Gustl Annast betreibt das „Varieté Savoy“ im „Hotel Reichsadler“
München * Gustl Annast betreibt bis 1926 das „Varieté Savoy“ im „Hotel Reichsadler“.
1913 - Zusätzliche „Direktionsbüros“ statt „Dienstwohnungen“
München-Haidhausen * Um zusätzliche „Direktionsbüros“ in der „Straßenbahn-Direktion“ zu schaffen, müssen die „Dienstwohnungen“ im Wohngebäude umgebaut werden.
1913 - Deutschland führt vier Millionen Kilo Rohseide ein
Deutsches Reich * Deutschland führt im Jahr 1913 vier Millionen Kilo Rohseide im Wert von 158 Millionen Mark ein.
1. 4 1913 - Moosach wird nach München eingemeindet
München-Moosach * Die selbstständige Gemeinde Moosach wird mit den Gemeindeteilen Fasanerie, Hartmannshofen und Nederling nach München eingemeindet.
1. 4 1913 - Die Stadt Milbertshofen wird nach München eingemeindet
München-Milbertshofen * Die Stadt Milbertshofen wird mit den Gemeindeteilen Neufreimann und Riesenfeld nach München eingemeindet.
12. 4 1913 - Gründung des Loos-Vereins Wild West
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Brüder Fred und Hermann Sommer sowie Martin Fromberger gründen den <em>„Loos-Verein Wild West“</em>, den späteren <em>„Cowboy Club München 1913 e.V.“</em>. </p> <ul> <li>Es ist am Anfang also ein Sparverein, zu dem sich die drei Wild West-begeisterten jungen Münchner zusammenschließen. Sie wollen nach Amerika auswandern, haben aber das Geld für die Überfahrt nicht. Die drei Burschen aus dem Arme-Leute-Milieu hätten nie und nimmer genug Geld zusammenkratzen können, weshalb höhere Mächte einspringen müssen: das Glück, Fortuna.</li> <li>Sie gründen besagten <em>„Los-Verein“</em>, zahlen Geld ein und nehmen an diversen Lotterien teil.,Einmal, so hoffen sie, würde das Glück schon zuschlagen und den Hauptgewinn ausschütten - und dann nichts wie weg über den großen Teich. Doch der erhoffte Geldsegen stellt sich nicht ein. </li> </ul>
26. 4 1913 - Eröffnung der „Alhambra-Lichtspiele“
München-Ludwigsvorstadt * Carl Gabriel eröffnet die „Alhambra-Lichtspiele“ an der Lindwurmstraße 124 mit etwa 200 Plätzen.
1. 5 1913 - Bischof Michael Faulhaber wird in den Adelsstand erhoben
München * Bischof Michael Faulhaber wird das Ritterkreuz des Kgl. Verdienstordens der bayerischen Krone verliehen. Seither kann er den Zusatz „von“ in seinem Namen führen.
30. 5 1913 - Der Erste Balkankrieg ist beendet
London * Nach vernichtenden Niederlagen muss die Türkei unter Vermittlung der europäischen Großmächte den Londoner Vertrag unterzeichnen, der den Ersten Balkankrieg beendet.
- Die Osmanen verzichten darin auf alle europäischen Gebiete;
- der Kretische Staat vereinigt sich offiziell mit Griechenland.
- Die Türkei behält aber - sehr zum Ärger Russlands - die Kontrolle über die Meerengen.
Durch die Schaffung des Staates Albanien erhält Serbien den ersehnten Zugang zur Adria aufgrund einer Forderung Österreich-Ungarns nicht.
29. 6 1913 - Der Zweite Balkankrieg beginnt
Sofia - Belgrad - Athen - Bukarest - Konstinopel - Balkan * Der Zweite Balkankrieg beginnt. Bulgarische Truppen greifen gleichzeitig die griechischen und serbischen Armeen an, ohne dass Bulgarien den beiden Staaten offiziell den Krieg erklärt hat.
Bald treten auch noch Rumänien und die Türkei in den Krieg ein, da alle Beteiligten mit Gebietszuwächsen rechnen. Die Großmächte müssen wieder vermitteln.
7 1913 - Aus Elisabeth Wellano wird Liesl Karlstadt
München-Maxvorstadt * Elisabeth Wellano tritt im „Serenissimus“ in der Akademiestraße als „Lisl Mackstadt“ auf.
Kurz darauf erfolgt die Umbenennung in „Liesl Karlstadt“. Es ist einer der wenigen Fälle, in dem ein exotisch klingender Name zugunsten eines „normalen“ aufgegeben wird.
Die Umbenennung ist für beide zufriedenstellend: Karl Valentin muss nicht länger befürchten, dass der exotische Name „Wellano“ von ihm ablenkt und ihr von Anfang an eine zu große Aufmerksamkeit garantiert. Sie war froh, ihn endlich los zu sein.
Ihren Namen hat sie nie sehr geliebt, da er für sie untrennbar mit ihrer Kindheit verbunden war, als sie mit „Wellano - Italiano - lebst aa no?“ verspottet wurde.
1. 7 1913 - Eingemeindung von Berg am Laim
München-Berg am Laim * Die selbstständige Gemeinde Berg am Laim wird mit den Gemeindeteilen Baumkirchen, Echarding, Josephsburg, Steinhausen und Zamdorf nach München eingemeindet.
1. 7 1913 - Eingemeindung von Oberföhring
München-Oberföhring * Die selbstständige Gemeinde Oberföhring mit dem Gemeindeteil St. Emmeram wird nach München eingemeindet.
8. 7 1913 - Serbien und Griechenland erklären Bulgarien den Krieg
Belgrad - Athen - Sofia * Serbien und Griechenland erklären Bulgarien den Krieg.
10. 7 1913 - Rumänien erklärt Bulgarien den Krieg
Bukarest - Sofia * Rumänien erklärt Bulgarien den Krieg.
11. 7 1913 - Das Osmanische Reich erklärt Bulgarien den Krieg
Konstantinopel - Sofia * Das Osmanische Reich erklärt Bulgarien den Krieg.
Um den 8 1913 - Premiere des Karl-Valentin-Stücks „Alpengesangsterzett Alpenveilchen“
München-Ludwigsvorstadt * Premiere des Karl-Valentin-Mehrpersonenstücks „Alpengesangsterzett Alpenveilchen“ im „Frankfurter Hof“, Schillerstraße 49.
Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten erstmals gemeinsam in einem Stück auf.
Das Bühnenstück wird insgesamt 385 Mal aufgeführt.
10. 8 1913 - Der „Bukarester Frieden“ beendet den „Zweiten Balkankrieg“
Bukarest - Sofia - Belgrad - Athen - Konstantinopel - Wien - Petersburg * Im „Bukarester Frieden“ verliert Bulgarien einen Großteil seiner Eroberungen aus dem „Ersten Balkankrieg“.
- Serbien und Griechenland teilen sich Mazedonien,
- Rumänien kann sich weiter zum „Schwarzen Meer“ hin ausweiten und
- die Türkei erhält einen Teil seines europäischen Besitzes zurück.
Die „k.u.k-Monarchie“ Österreich-Ungarn ist jedoch spätestens jetzt fest entschlossen, ein weiteres Vordringen des zur „Mittelmacht“ aufgestiegenen Balkanstaats Serbien mit aller Macht zu verhindern - auch um den Preis eines Krieges mit Russland.
25. 8 1913 - Prinzregent Ludwig lädt die Bundesfürsten in die Befreiungshalle
Kelheim * Die 22 deutschen Bundesfürsten treffen sich nach Einladung durch Prinzregent Ludwig [III.] bei der Befreiungshalle in Kelheim. Die Befreiungshalle war am 18. Oktober 1863, dem 50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, der Öffentlichkeit übergeben worden und stellt ein Wahrzeichen des deutschen Patriotismus dar.
Gefeiert wird die endgültige Vertreibung Napoleons aus Deutschland vor einhundert Jahren. Es ist eine glänzende patriotische Feier, die zum ersten - und zum letzten - Mal alle regierenden Fürsten Deutschlands zusammenführt. Es ist sozusagen das „Totenfest des deutschen Monarchismus“.
Prinzregent Ludwig preist die Verdienste seiner Wittelsbacher Vorfahren um das deutsche Nationalbewusstsein und lobt das immer mehr erstarkte „Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Teile des Reichs in Freud und Leid“. Er warnt zugleich: „Wer gleichwohl im Auslande je mit der Uneinigkeit, der Eifersucht der Reichsglieder rechnet, wird diese Rechnung grausam enttäuscht sehen.“
9 1913 - Das letzte monarchisch orientierte „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Das „Oktoberfest“ steht letztmals unter monarchischem Protektorat.
9 1913 - Die „Bräurosl-Festhalle“ fasst 12.000 Menschen
München-Theresienwiese * Die „Bräurosl-Festhalle“ ist das bisher größte „Wiesnzelt“.
Mit seinen 5.500 qm bietet es Platz für 12.000 Menschen. Das Mammutzelt hat eine Firsthöhe von 15 Metern, fast 28 Meter Breite werden stützenfrei überspannt.
Da die Aufbau- und Abbauzeit fünf Monate dauert und damit die vorgegebene Zeit der Stadt weit überschreitet, wird eine Konventionalstrafe fällig.
Um den 9 1913 - Der „Bayerische Kurier“ warnt vorm Oktoberfest-Besuch
München-Theresienwiese * Die Polizei warnt im „Bayerischen Kurier“ vorm Oktoberfest-Besuch:
„In den Buden wie außerhalb derselben drohen allerlei Gefahren, die sich in den Abendstunden steigern“.
29. 9 1913 - Serbien geht als Sieger aus den beiden Balkankriegen hervor
Petersburg - Sofia - Konstantionopel - Athen - Belgrad * Russland greift in die Verhandlungen ein. Im Vertrag von Konstantinopel erhält Bulgarien - mit Russlands Unterstützung - mit Westthrakien doch noch einen Zugang zur Ägäis. Das verursacht einen neuen Konflikt mit Griechenland, das die Region für sich beansprucht.
Insgesamt erkämpfen die Balkanstaaten weitere Gebiete der zerfallenden Türkei. Serbien geht als strahlender Sieger aus den beiden Balkankriegen hervor und kann sein Territorium nahezu verdoppeln.
29. 9 1913 - Rosa Luxemburg ruft zum Widerstand gegen den Militärdienst auf
Frankfurt am Main-Bockenheim * Rosa Luxemburg ruft in Anbetracht der Kolonialpolitik und des Militarismus des Deutschen Kaiserreichs zum Widerstand gegen den Militärdienst auf. Sie wird vors Gericht gezerrt und am 14. April 1914 wegen Aufforderung zur Ungehorsamkeit gegen Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.
18. 10 1913 - Eröffnung der Sendlingertor-Lichtspiele
München-Hackenviertel * Carl Gabriel eröffnet die Sendlingertor-Lichtspiele mit 680 Plätzen. Der Neubau wird von Jacob Heilmann und Max Littmann geplant und ausgeführt. Es ist das erste Münchner Großkino und das erste Kino mit Balkon.
30. 10 1913 - Verfassungsänderung zur Beendigung der Regentschaft
München-Kreuzviertel * Die Abgeordnetenkammer beschließt ein verfassungsänderndes Gesetz mit 122 gegen 27 Stimmen der Sozialdemokraten. Mit diesem Gesetz kann der „Regent die Regentschaft für beendet und den Thron für erledigt erklären“, wenn „wegen eines körperlichen oder geistigen Gebrechens des Königs“ auch „nach Ablauf von zehn Jahren keine Aussicht auf Regierungsfähigkeit“ besteht. Damit hat der Prinzregent die Möglichkeit, seinen noch lebenden geisteskranken Cousin, den legitimen König Otto I., zu entthronen.
Prinzregent Ludwig III. wollte politisch eine Veränderung herbeiführen und konnte mit dem Zentrum und den Liberalen auf eine breite parlamentarische Mehrheit bauen. Doch eine schlichte Proklamation Ludwigs III. zum König wurde von den Abgeordneten als nicht ratsam erachtet, da auch der Prinzregent eine Übertragung der Krone durch den Landtag ablehnte. Schließlich wollte Ludwig III. kein „König von Volkes Gnaden“, sondern ein „König von Gottes Gnaden“ sein.
3. 11 1913 - Den ganzen Monarchismus lächerlich finden
Trier * Die politisch dem Zentrum nahestehende Zeitung Trierischer Volksfreund schreibt über die Monarchie:
„In modernen Ländern entscheidet das Volk über die Regierungsform und bestimmt das Volk den Herrscher, der es regieren soll. […] Kein Mensch glaubt heute mehr, dass es besondere Menschen gäbe, in die die Gnade Gottes hineingefahren wäre. […] Als vernünftige Menschen müssen wir den ganzen Monarchismus lächerlich finden.“
4. 11 1913 - Prinzregent Ludwig III. erklärt die Regentschaft für beendet
München-Kreuzviertel * Auch die Kammer der Reichsräte billigt die Verfassungsänderung. Damit kann Prinzregent Ludwig III. die „Regentschaft für beendet und den Thron für erledigt“ erklären.
5. 11 1913 - Prinzregent Ludwig III. proklamiert sich selbst zum König
München * Prinzregent Ludwig III. proklamiert sich selbst zum König. König Otto I. wird damit durch seinen Vetter Prinzregent Ludwig III. entthront. Eine 27-jährige Regentschaft geht dadurch zu Ende.
Nachdem diese unumstößlichen Fakten geschaffen sind, erkennt der Landtag an, „daß am 4. November 1913 die verfassungsmäßigen Voraussetzungen für die Beendigung der Regentschaft bestanden haben“. Die Abgeordneten stimmen dem Antrag brav zu. Daraufhin erklärt König Ludwig III., dass durch seine Thronbesteigung der Titel und die Ehrenrechte König Ottos I. nicht berührt werden. Bayern hat damit - bis zum Tod König Ottos I. am 11. Oktober 1916 - zwei Könige und damit eine Doppelmonarchie.
Doch die Vorgänge um die Inthronisation schadet dem Ansehen König Ludwigs III. und der Monarchie schwer. Deshalb rührt sich auch keine Hand, als exakt fünf Jahre später die Monarchie in Bayern als erster deutscher Einzelstaat sang- und klanglos zusammenbricht.
8. 11 1913 - König Ludwig III. leistet den Treueeid auf die Verfassung
München * Der neu ernannte König Ludwig III. leistet seinen Treueeid auf die Verfassung. Der Sozialist Kurt Eisner bemerkt dazu nur kurz: „Soeben hat Prinzregent Ludwig der Monarchie das Grab geschaufelt.“
Auf den Tag genau, fünf Jahre später, fällt Ludwig in die Grube, die er sich selbst und der Monarchie geschaufelt hat.
17. 11 1913 - Marie Therese, die erste Katholikin auf dem bayerischen Königinsthron
Lindau * Die Lindauer Volkszeitung schreibt: „Die Gemahlin des Königs Ludwig III. von Bayern wird die erste katholische Königin sein. [...] Die hohe Frau, die weithin als das Vorbild einer christlichen Frau und Mutter schon lange erschien, verdient es wahrhaftig, eine Landesmutter zu sein, verehrt und geliebt von allen treuen Bayern.“
18. 12 1913 - Willy Brandt wird als Herbert Ernst Karl Frahm in Lübeck geboren
Lübeck * Willy Brandt, der spätere Regierende Bürgermeister von Berlin und Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und SPD-Vorsitzende, wird als Herbert Ernst Karl Frahm in Lübeck geboren.
Um 1914 - Der Karl-Valentin-Film „Erbsen mit Speck“ entsteht
München * Der Karl-Valentin-Film „Erbsen mit Speck“, auch unter dem Titel „Ein Teller Erbsensuppe“ genannt, entsteht.
Der Film ist verschollen.
Um 1914 - Karl Valentins Stummfilm „Der neue Schreibtisch“ wird gedreht
München * Karl Valentins Stummfilm „Der neue Schreibtisch“ wird gedreht.
Sein erster „Atelierfilm“ bringt ihm einen Gewinn von 200.- Mark ein.
1914 - Friedrich von Bissing verschenkt seine „Sammlung altägyptischer Kunst“
München * Friedrich Wilhelm von Bissing schenkt seine „Sammlung altägyptischer Kunst“ der bayerischen „Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst“.
1914 - Die späteren „Togal-Werke“ werden gegründet
München-Ludwigsvorstadt * Das Unternehmen „Pharmacia M. Schmidt & Co“, die späteren „Togal-Werke“, wird in gemieteten Räumen in der Goethe- und Schillerstraße gegründet.
4 Mitarbeiter hat das Unternehmen.
1914 - Der Neubau der Bogenhausener „Gebeleschule“ wird bezogen
München-Bogenhausen * Der Neubau der Bogenhausener „Gebeleschule“ wird bezogen.
1914 - In das alte Schulgebäude am Kirchplatz 3 zieht ein „Kindergarten“
München-Bogenhausen * In das alte Schulgebäude am Kirchplatz 3 zieht ein „Kindergarten“ ein, der als „praktische Übungsstätte“ des zum „Annalyzeums“ im Lehel gehörenden „Kindergärtinnenseminars“ genutzt wird.
Es ist Bestandteil der „Städtischen Frauenschule“.
1914 - Im Bogenhausener „Brunnthal“ entstehen neoklassizistische Villen
München-Bogenhausen * Im Bogenhausener „Brunnthal“ entstehen vornehme neoklassizistische Villen.
1914 - Die „Firma Falk & Fey“ an seinem Standort in der Richelstraße
München-Neuhausen * Die „Firma Falk & Fey“ hat an seinem Standort in der Richelstraße 72 Möbelwagen als Pferdefuhrwerke sowie mehrere Speditionswagen und Lastkraftwagen im Einsatz.
1914 - Dr. Hermann Schülein wohnt in der Richard-Wagner-Straße 17
München-Maxvorstadt * Dr. Hermann Schülein bewohnt ein großzügiges Appartement in der Richard-Wagner-Straße 17.
1914 - In München gibt es etwa 800 „Volkssänger“
München * In München gibt es etwa 800 als „Volkssänger“ gemeldete Personen.
Sie organisieren sich im „Volkssängerverband“, mit eigener Zeitung, Krankenversicherung und Künstlerbörse, organisieren.
1914 - Karl Winter gründet die Firma „Fisch Winter KG“
München-Untersendling * Karl Winter gründet die Firma „Fisch Winter KG“.
Der „Fischgroßhändler“ verkauft „Seefische“, „Feinfische“, „Süßwasserfische“, „Räucherfische“, „Salzheringe“ und „Marinaden“.
Er beliefert seine Kundschaft mit dem Handkarren und eröffnet gleichzeitig - gemeinsam mit seiner Frau Philippine - die „Sendlinger Fischhalle“ in Untersendling, an der Alram-/ Ecke Aberlestraße.
Anfang 1914 - Thomas Mann bezieht seine Villa in der Poschingerstraße 1 im „Herzogpark“
München-Bogenhausen * Thomas Mann und seine Familie beziehen ihre Villa in der Poschingerstraße 1 im „Herzogpark“. (Heute: Thomas-Mann-Allee 10)
Bis 1914 - Planungen für den Bau einer evangelischen Kirche in Giesing
München-Giesing * Bis zum Ersten Weltkrieg steigt die Zahl der Protestanten in Giesing so sehr an, dass man einen eigenen Kirchenbau plant.
1914 - „Papa“ Steinicke eröffnet in der Adalbertstraße eine „Volkssänger-Bühne“
München-Maxvorstadt * Georg „Papa“ Steinicke im Hinterhof einer Buchhandlung in der Adalbertstraße eine „Volkssänger-Bühne“.
1914 - Im „Karl-Valentin-Geburtshaus“ wird ein Ausstellungsraum eingerichtet
München-Au * Im Vordergebäude des „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der Zeppelinstraße 41 wird ein Ausstellungsraum für Kraftfahrzeuge der Firma Weinberger eingerichtet.
Der Hauseingang wird wieder an die Vorderseite verlegt.
1914 - Der „Konsumverein“ kauft von „Paulaner“ noch weitere Grundstücke
München-Au * Der „Konsumverein München von 1864“ kauft von der „Paulaner-Brauerei“ noch weitere Grundstücke ab, sodass das Gelände zwischen der Auerfeld-, Staatsbahn, Balanstraße und Tassiloplatz fast in seiner Hand ist.
21. 1 1914 - Georg von Vollmar hält seine letzte Landtagsrede
München-Kreuzviertel * Georg von Vollmar hält seine letzte Rede im Bayerischen Landtag. Seine Kriegsverletzung, die er sich im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 zugezogen hatte, gestattet ihm die aktive Teilnahme am parlamentarischen Betrieb nicht mehr.
21. 3 1914 - Rosa Luxemburg spricht im Münchner-Kindl-Keller
München-Au * Rosa Luxemburg hält im brechend vollen Münchner-Kindl-Keller eine mitreißende Rede zum Thema „Militarismus und Volksfreiheit“. Sie fordert auf, die Waffen nicht gegen die ausländischen Klassenbrüder zu erheben und das Wettrüsten zu stoppen. Die Sozialdemokraten gehen zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass der Krieg zu verhindern ist.
Rosa Luxemburg sagt: „Wenn ein Mann von Blut und Eisen wie Bismarck trotz Ausnahmegesetz nicht mit uns fertig geworden ist, wie wollen das die Knirpse fertig bringen, die heute an der Spitze stehen!“
31. 3 1914 - Sir Hubert von Herkomer stirbt in England
Großbritannien * Sir Hubert von Herkomer stirbt in England an den Folgen eines Magenkrebs.
14. 4 1914 - Rosa Luxemburg wird zu einem Jahr Gefängnis verurteilt
<p><em><strong>Frankfurt am Main</strong></em> * Rosa Luxemburg steht wegen Aufforderung zur Ungehorsamkeit gegen Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit in Frankfurt vor dem Landgericht. Sie wird zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der Knast bleibt der gehbehinderten Frau, die Berufung gegen das Urteil einlegt, vorerst erspart. </p>
14. 4 1914 - Erzherzog Franz Ferdinand besucht München
München-Ludwigsvorstadt * Der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand trifft mit einem Sonderzug auf dem Münchner Hauptbahnhof ein.
Der weithin als reaktionär geltende Erzherzog wird ein viertel Jahr später in der bosnischen Haupstadt Sarajewo samt seiner Ehefrau Sophie von Hohenberg Opfer eines Anschlags werden.
Um den 30. 4 1914 - Eine Sammlung zugunsten der Arbeitslosen
<p><em><strong>München</strong></em> * In München findet eine großangelegte Sammlung zugunsten der Arbeitslosen statt. </p>
28. 6 1914 - Das Attentat von Sarajevo auf den Erzherzog Franz Ferdinand
Sarajevo * Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este und seine Ehefrau, die Herzogin Sophie von Hohenberg, besuchen die bosnische Hauptstadt Sarajevo. Am Bahnhof besteigen sie ein offenes Auto und lassen sich damit Richtung Rathaus kutschieren. Schon bald nach der Abfahrt misslingt ein erster Attentatsversuch mit einer serbischen Handgranate. Franz Ferdinand kann den Sprengkörper abwehren, sodass er erst hinter dem Auto explodiert. Der Erzherzog kommt mit dem Schrecken davon, absolviert anschließend seinen Empfang im Rathaus und fährt danach im offenen Automobil weiter.
Der Wagen des Erzherzogs kommt unmittelbar vor einem besonders entschlossenen Mitglied des Terrorkommandos zum stehen. Der 19-jährige Gavrilo Princip schießt mit seiner 9-mm-Pistole zwei Mal. Der erste Schuss trifft die Herzogin Sophie von Hohenberg in den Unterleib, die zweite Kugel den Erzherzog. Beide Schüsse sind tödlich.
- Gavrilo Princip ist Mitglied der Organisation „Mlada Bosna“ [„Junges Bosnien“], eines national-revolutionären Netzwerks von Schülern und Studenten.
- Der Bund strebt die Vereinigung von Bosnien-Herzegowina mit dem Königreich Serbien an.
- Die selben Ziele verfolgt auch die Terror-Organisation „Vereinigung oder Tod“, auch bekannt als „Schwarze Hand“, ein im Jahr 1911 in Belgrad gegründeter serbischer Geheimbund.
29. 6 1914 - Grundsteinlegung für die evangelische Johanneskirche
München-Haidhausen * Der Grundstein für die evangelische Johanneskirche in Haidhausen wird gelegt. Mit dem Anwachsen der evangelischen Kirchengemeinde ist der Behelfsbau zu klein geworden. Eine neue Kirche auf dem gleichen Platz muss her.
Als Architekt wird Albert Schmidt erkoren, der zuvor schon die Lukas-Kirche erbaut hat. Außerdem hat er sich einen Namen gemacht mit dem Bau der Synagoge, der Deutschen Bank und des Löwenbräukellers.
29. 6 1914 - Rosa Luxemburg steht in Berlin erneut vor Gericht
Berlin * Rosa Luxemburg steht in Berlin erneut vor Gericht. Es gibt Ovationen im Zuhörerraum, nachdem die bürgerlich-konservative Presse und ihre Repräsentanten immer lauter gefordert haben, die „schamlosen Umtriebe dieser Matrone“ endlich zu unterbinden.
Um 7 1914 - Die Tänzerin „Mata Hari“ tritt in Berlin auf
Berlin * Die Tänzerin „Mata Hari“ befindet sich auf der Suche nach neuen Engagements in Berlin, wo ihr in der Oper „Der Millionendieb“ am Metropol-Theater eine Rolle zugesagt worden ist.
5. 7 1914 - Kaiser Wilhelm II. sichert Österreich-Ungarn Unterstützung zu
Berlin * Exakt eine Woche nach dem Attentat von Sarajevo sichert Kaiser Wilhelm II. seinem Verbündeten Österreich-Ungarn die volle Unterstützung zu, auch wenn die Russen ihrem Bündnispartner Serbien zu Hilfe kommen würden. Diese Zusage geht als „Blankoscheck“ in die Geschichte ein, denn für die Habsburger ist damit die Kriegsentscheidung gefallen.
6. 7 1914 - Das Infanterie-Leibregiment feiert ihren 100. Gründungstag
München-Schloss Nymphenburg * Das Infanterie-Leibregiment feiert vor Schloss Nymphenburg, im Beisein König Ludwigs III., ihren 100. Gründungstag.
21. 7 1914 - Baubeginn für Franz Stucks Atelierbau
München-Haidhausen * Die Bauarbeiten für den neuen Atelierbau an der Villa von Franz von Stuck beginnen. Den dafür erforderlichen Grund hat er zuvor von seinem Freund, dem kgl. Bayerischen Hofschauspieler und Dichter Konrad Dreher abgekauft.
23. 7 1914 - Österreich-Ungarn setzt Serbien ein 48-stündiges Ultimatum
Berlin * Da man in Berlin befürchtet, dass Österreich-Ungarn an Geltung verlieren könnte, wenn es sich nicht gegen diesen Affront wehren würde, stellte die k.u.k.-Regierung dem Königreich Serbien ein auf 48 Stunden befristetes Ultimatum, in dem sie die Belgrader Regierung auffordert, einer österreichischen Kommission zu gestatten, auf serbischem Gebiet die Umstände des Attentats von Sarajevo zu untersuchen.
Außerdem soll sich Serbien verpflichten, alle an der Mitwirkung an dem Attentat verdächtigten serbischen Beamten und Offiziere zu entlassen.
25. 7 1914 - Flammender Protest gegen das verbrecherische Treiben der Kriegshetzer
Berlin * Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei - SPD veröffentlicht einen Massenprotest gegen den drohenden Krieg, in dem es heißt:
- „Parteigenossen, wir fordern euch auf, sofort in Massenversammlungen den unerschütterlichen Friedenswillen des klassenbewussten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. Eine ernste Stunde ist gekommen, ernster als irgendeine der letzten Jahrzehnte. Gefahr ist im Verzuge! Der Weltkrieg droht!
- Die herrschenden Klassen, die euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen euch als Kanonenfutter missbrauchen. Überall muss den Gewalthabern in die Ohren klingen: Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Kriege! Hoch die internationale Völkerverbrüderung“.
In 160 Städten finden bis Ende Juli 288 Versammlungen und Aufmärsche statt, an denen sich nach Angaben des Veranstalters mehr als eine Dreiviertel Million Menschen beteiligen. Alleine die große Antikriegsdemonstration der SPD in Berlin am 28. Juli umfasst über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das, obwohl die Kundgebung vom Berliner Magistrat ausdrücklich verboten worden ist.
25. 7 1914 - Die Serben antworten auf das österreichisch-ungarische Ultimatum
Wien - Belgrad - Petersburg * Die Serben antworten - in Abstimmung mit ihren Bündnispartner Russland - am Abend auf das österreichisch-ungarische Ultimatum und versprechen, dass nahezu alle Forderungen erfüllt werden würden. Lediglich die Untersuchung des Attentats durch eine Kommission unter österreichischer Aufsicht - bei jederzeitiger Einmischung - lehnen sie ab.
Die Entente-Verbündeten Frankreich, England und Russland bewerten die serbische Antwort als ein weitgehendes Entgegenkommen. Österreich-Ungarn weist die Botschaft aber als „ungenügend“ und „vom Geist der Unaufrichtigkeit erfüllt“ zurück. Und die deutsche Regierung unterstützt diese Sichtweise.
25. 7 1914 - Rege Diskussionen zur politischen Lage beherrschen das Geschehen
München * In München versammeln sich Menschenmassen, um auf Extra-Ausgaben der Zeitungen zu warten. Rege Diskussionen zur politischen Lage beherrschen das Geschehen. Spontane antiserbische und antirussische Kundgebungen folgen.
25. 7 1914 - Österreich-Ungarn reagiert mit einer Teilmobilmachung
Wien - Belgrad - Petersburg * Österreich-Ungarn reagiert mit einer Teilmobilmachung und bricht die diplomatischen Beziehungen zu Serbien ab. Der russische Kronrat führt daraufhin einen Beschluss zur Unterstützung des Königreichs Serbien herbei.
26. 7 1914 - Betrunkene und fanatisierte Patrioten demolieren das Café Fahrig
München-Kreuzviertel * Am 25. Juli, nur wenige Stunden nachdem Serbien das Ultimatum für Österreich-Ungarns nicht ausreichend devot umgesetzt hat, berauschen sich im Café Fahrig, in der Neuhauser Straße, die Gäste an der Aussicht, dass jetzt Krieg droht. Die Menschen - im Café Fahrig und sonst wo - lassen Bayerns König Ludwig III. und Deutschlands Kaiser Wilhelm II. hochleben. Die Kapelle spielt die „Wacht am Rhein“, „Heil Dir im Siegerkranz“ und viele andere patriotische Lieder. Es wird viel gelacht, gefeiert, gesungen und natürlich getrunken.
Weil der Sohn des Gaststättenhabers Franz Fahrig einen Streit unter Gästen schlichten will, lässt er die Musik kurz unterbrechen. Doch plötzlich fliegen Stühle durchs Lokal. Die Polizei wird angefordert und räumt das Café gegen zwei Uhr früh. Die sozialdemokratische Münchener Post schreibt über die Vorgänge: „Durch ungeschicktes Benehmen des Kapellmeisters wurde die betrunkene und fanatisierte Menge wild und demolierte das ganze Lokal“.
Doch das ist noch nicht das Ende der Affäre. Wilde Gerüchte sind im Umlauf. Einer erzählt, eine serbische Kapelle hätte den Kaiser und das Reich geschmäht. Der andere hat Spione im Café Fahrig gesehen. Da ist es zu dem Schritt, der Café-Inhaber Franz Fahrig steht mit dem Feind im Bunde nicht mehr weit. Die Volksseele kocht. Um kurz vor drei Uhr fliegt der erste Pflasterstein in eine der Fensterscheiben des Lokals. Am Morgen ist das Café Fahrig innen und außen verwüstet.
26. 7 1914 - Die Angst vor ausländischen Spionen hat um sich gegriffen
München * Die „Spionitis“, die Angst vor ausländischen Spionen, hat um sich gegriffen. Die Polizei ruft - vergeblich - zur Zurückhaltung auf. Ausländisch aussehende oder ausländische Kleidung tragende Passanten werden zum Teil tätlich angegriffen. Ausländer verlassen fluchtartig die Stadt.
26. 7 1914 - Österreich hat seine Truppen an der Grenze zu Russland mobilisiert
Berlin * Während im Berliner Lustgarten die SPD noch „flammenden Protest gegen das verbrecherische Treiben der Kriegshetzer“ erhebt und sich in den folgenden Tagen bei weiteren Straßendemonstrationen Tausende Menschen gegen den Krieg beteiligen, hat Österreich-Ungarn bereits seine Truppen an der Grenze zu Russland mobilisiert.
27. 7 1914 - Panische Bürger stürmen die Geldhäuser
München * Schon frühmorgens bilden sich durch Hamsterkäufe lange Schlangen vor den Läden. Besonders begehrt sind Mehl und Kolonialwaren.
Andrang herrscht auch vor den Münchner Banken. Allein bei der Münchner Stadtsparkasse heben panische Bürger alleine an diesem Montag etwa eine Million Mark ab. Die Bank fürchtet um ihre Zahlungsfähigkeit und muss darauf reagieren: Wer mehr als 500 Mark abheben will, hat sich fortan einen Monat zuvor anzumelden. Andere Banken warnen in Zeitungsanzeigen: Die Kunden sollten ihr Geld nicht ohne zwingenden Grund abheben, da sonst ihre Einlagen gefährdet wären.
27. 7 1914 - Das Deutsche Reich lehnt britischen Konferenz-Vorschlag kategorisch ab
Berlin * Das Deutsche Reich lehnt den britischen Vorschlag einer Außenministerkonferenz zur Beilegung des Konflikts kategorisch ab und besteht auch weiterhin auf einer Lokalisierung des Konflikts.
Der aus dem Urlaub zurückgekehrte Kaiser Wilhelm II. sieht in der serbischen Antwort eine „Kapitulation demütigster Art“, mit der jeder Grund zum Krieg entfallen sei. Sein Auftrag an Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, in Wien entsprechend zu intervenieren, wird von diesem jedoch ignoriert und erst verspätet weitergegeben.
27. 7 1914 - Die Münchner Sozialdemokraten laden zu einer Massenkundgebung ein
München-Au * Die Münchner Sozialdemokraten haben zu einer Massenkundgebung im Münchner-Kindl-Keller eingeladen. Als Referent für diese Veranstaltung ist der Schriftsteller Kurt Eisner angekündigt.
Ausgerechnet für Kurt Eisner, dem späteren Kriegsgegner und Revolutionär, ist der Krieg zu diesem Zeitpunkt eine unabänderliche Tatsache und nicht mehr zu verhindern. „Denn niemand von uns will, dass das Kosakentum über Europa herrscht. Sagte doch Bebel, gegen Russland würde auch er noch die Flinte auf seinen alten Buckel nehmen“. Und an anderer Stelle meinte er: „Wir sind bereit, einen Angriff des Feindes abzuwehren und unser Vaterland zu schützen“.
Das bedeutet aus Eisners damaliger Sicht für die sozialdemokratisch orientierte Arbeiterschaft: „Dann muss jeder seine Pflicht tun, nichts weiter“. Und diese Pflicht besteht in der Verteidigung des Vaterlandes gegen den russischen Agressor.
28. 7 1914 - Österreich-Ungarn erklärt dem Königreich Serbien den Krieg
Wien - Belgrad * Österreich-Ungarn erklärt dem Königreich Serbien den Krieg und lässt noch am gleichen Tag seine Truppen aufmarschieren. Damit verschärft sich die internationale Lage in rasanter Geschwindigkeit und mache aus der österreichisch-serbischen Krise einen europäischen Flächenbrand.
28. 7 1914 - Der Kaffeehaus-Besitzer Franz Fahrig verteidigt sich im Staatsanzeiger
München-Kreuzviertel * Im Bayerischen Staatsanzeiger erklärt der Kaffeehaus-Besitzer Franz Fahrig,
- dass er kein Ausländer sei,
- dass es im Café Fahrig keinen Serbenstammtisch gibt und
- dass er kein Verbot ausgesprochen hat, patriotische Lieder zu spielen.
Der Café-Betreiber wird dennoch auch weiterhin von den Patrioten angefeindet.
28. 7 1914 - Die drohende Kriegsgefahr ist kein Thema im Landtag
München-Kreuzviertel * Trotz der drohenden Kriegsgefahr wird im Bayerischen Landtag der bevorstehende Krieg nur indirekt zum Thema erhoben. Wenigstens der SPD-Abgeordnete Max Süßheim aus Nürnberg erklärt: „Wir Sozialdemokraten erwarten, dass der Friede erhalten und Europa vor den Gräueln und Schrecknissen eines Weltkriegs bewahrt werde“. Das war auch schon die einzige kritische und nachdenkliche Stimme im Bayerischen Landtag.
28. 7 1914 - Der Eine ist zu alt, der Andere zu jung
Wien * Der bei Kriegsbeginn kurz vor seinem 84. Geburtstag stehende österreichisch-ungarische Kaiser Franz Joseph I. ist zu schnellen und grundsätzlichen Entscheidungen kaum noch in der Lage, auch wenn er versucht, täglich seine Akten pflichtbewusst und akribisch zu bearbeiten.
Sein Thronfolger, Erzherzog Karl, ist gerade 27 Jahre alt und politisch wie militärisch noch ohne Erfahrung. Weil aber die Oberbefehlsgewalt von einem adeligen Mitglied des Erzhauses übernommen werden muss, fällt die Wahl auf der 58-jährigen Erzherzog Friedrich. Er besitzt allerdings nur wenige Eigenschaften, die ihn zum Oberbefehlshaber der österreichisch-ungarischen Armee befähigen. Erzherzog Friedrich wird als eher ängstlich beschrieben, der nur wenig persönliche Initiative entwickelt und sich hauptsächlich mit seiner Frau beratschlagt, welche Uniform er tragen soll.
28. 7 1914 - Der Erste Weltkrieg beginnt
Wien - Belgrad * Mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien beginnt der Erste Weltkrieg.
28. 7 1914 - Suche nach überzeugenden Argumenten
Berlin - Wien * Der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg bemüht sich inzwischen halbherzig, die Wiener Regierung von ihrem harten Kurs abzubringen. Er ist zwar von der „Unvermeidbarkeit“ eines Großen Krieges überzeugt, will aber gegenüber der Öffentlichkeit den Nachweis führen, dass die Aggression von Russland ausgeht.
Denn, so Bethmann Hollweg in einem Schreiben an die K.u.K.-Regierung, ein europäischer Krieg lässt sich ohne Zustimmung der Bevölkerung nicht führen, weshalb es „eine gebieterische Notwendigkeit [ist], dass die Verantwortung für das eventuelle Übergreifen des Konflikts [...] unter allen Umständen Russland trifft“.
Die Mahnung verhallt ungehört, weil gleichzeitig der deutsche Generalstabschef Helmuth von Moltke seinem österreichischen Kollegen Conrad von Hötzendorf versichert, dass Deutschland selbstverständlich den österreichisch-ungarischen Kriegskurs unterstützen wird.
28. 7 1914 - Über 100.000 TeilnehmerInnen an der großen Antikriegsdemo der SPD
Berlin * Die große Antikriegsdemonstration der SPD in Berlin umfasst über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das, obwohl die Kundgebung vom Berliner Magistrat ausdrücklich verboten worden ist.
29. 7 1914 - Österreich-Ungarn beginnt mit der Beschießung Belgrads
Belgrad * Österreich-Ungarn beginnt mit der Beschießung von Belgrad. Zar Nikolaus II. gibt daraufhin den Befehl zur Teilmobilisierung, zieht diesen jedoch - aufgrund eines vermittelnden Telegramms Kaiser Wilhelms II. - wieder zurück.
29. 7 1914 - Die Leichtigkeit des Seins auch im Krieg
Wien * Die österreichische Heeresführung vertraut sehr stark darauf, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Eine Reihe von k.u.k-Offizieren begreifen den Krieg als Fortsetzung ihres Lebensstils unter erschwerten Bedingungen. Sie „legten Wert auf mehrgängige Menüs, die möglichst formvollendet serviert wurden, und ließen sich von Ehefrauen, Mätressen und Prostituierten begleiten, die für körperliches Wohlbefinden zu sorgen hatten“.
Eindrucksvoll, aber natürlich karikaturhaft überzeichnet wird die Situation in dem Roman „Der brave Soldat Schweik“ von Jaroslav Hašek.
30. 7 1914 - Großbritannien lehnt die Neutralitätszusage für den Kriegsfall ab
London * Großbritannien lehnt die vom Deutschen Reich geforderte Neutralitätszusage für den Kriegsfall ab.
30. 7 1914 - Russland erklärt die Generalmobilmachung
Moskau * Zar Nikolaus II. wird von seinem Außenminister zur Generalmobilmachung überredet. Die Münchner Neuesten Nachrichten berichten am Nachmittag: „Der russische Botschafter hat dem Grafen Berchtold die Mitteilung gemacht, dass die russische Regierung eine bindende Erklärung, die Neutralität zu wahren, nicht geben kann. Infolgedessen steht die allgemeine Mobilisierung der österreichischen Armee innerhalb der nächsten Tage zu erwarten.“
Damit ist der entscheidende Schritt zum Großen Krieg getan und ein Schuldiger gefunden. Denn zu diesem Zeitpunkt ging es nur noch um die Frage, welche Macht als Erste mobilmachen würde. Sämtliche nun folgenden politischen Aktivitäten der beteiligten Regierungen sind ausnahmslos darauf ausgerichtet, der jeweils anderen Seite die Schuld an der kommenden Katastrophe zuzuschieben. Die Öffentlichkeit soll erkennen und davon überzeugt werden, dass man zu einem Verteidigungskrieg gezwungen worden ist. Und Russland hat damit - aus deutscher Sicht - eindeutig und zweifelsfrei seine Bereitschaft zum Krieg gezeigt.
30. 7 1914 - Das Bayerische Wochenblatt verurteilt die Kriegshetze
Königreich Bayern * Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges findet sich im Bayerischen Wochenblatt der folgende Artikel: „Dass sich an der gewissenlosen Kriegshetze vor allem die Zentrumspresse beteiligt, passt durchaus zu der Sorte ‚Christentum‘, die diese verkommene Partei vertritt.
- Die Sozialdemokratie wird von ihr als ‚vaterlandsfeindlich‘ verlästert, weil sie nicht gewissenlos genug ist, das Vaterland in einen Krieg von unabsehbaren Folgen hinein hetzen zu helfen.
- Und ‚religionsfeindlich‘ ist die Sozialdemokratie wahrscheinlich deshalb, weil sie im Gegensatz zu den schwarzen Maulchristen bemüht ist, die Lehre Christi in die Tat umzusetzen.“
31. 7 1914 - Kaiser Wilhelm II. verhängt den Kriegszustand - außer in Bayern
Berlin - München * Mit der kaiserlichen Verhängung des Kriegszustands verändern sich auch die Rahmenbedingungen für Bayerns Eigenständigkeit grundlegend. Die bisher auf den bayerischen König vereidigte Armee wird damit nämlich dem Deutschen Kaiser unterstellt. Doch ist dazu zuvor eine offizielle Feststellung des Kriegszustandes von Seiten des bayerischen Königs notwendig.
31. 7 1914 - Ausfuhrverbot von Futtermitteln, Tieren und anderer Waren
Berlin * Gleichzeitig mit der Kriegserklärung erlässt der deutsche Kaiser das „Verbot der Ausfuhr von Nahrungsmitteln aller Art ins gegnerische Ausland“. Damit dürfen nur noch neutrale und die verbündeten Länder Österreich, Ungarn und Türkei sowie die deutschen Truppen im Ausland mit Bier beliefert werden.
Das Versandbuch der Paulanerbrauerei macht diese Krise des Exportes deutlich sichtbar. Erst nach beiden Weltkriegen können die Münchner Brauereien in den 1970er Jahren wieder Exportzahlen wie um 1900 erzielen.
31. 7 1914 - Österreich-Ungarn erklärt die Generalmobilmachung
Wien * Österreich-Ungarn erklärt die Generalmobilmachung und macht damit den Ersten Weltkrieg unausweichlich.
31. 7 1914 - Kaiser Wilhelm II. verhängt den Zustand drohender Kriegsgefahr
Berlin * Kaiser Wilhelm II. bereitet sein Volk auf den kommenden gerechten Verteidigungskrieg gegen angreifende Feinde vor. „Infolge der andauernden und bedrohlichen Rüstungen Russlands“ verhängt er gemäß des Artikels 68 der deutschen Reichsverfassung den „Zustand drohender Kriegsgefahr“.
Nachfolgend die Kernsätze seiner Rede, die mit der Überschrift „An mein Volk!“ in schriftlicher Form verbreitet wird: „Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Ich hoffe, dass, wenn es nicht in letzter Stunde meinen Bemühungen gelingt, die Gegner zum Einsehen zu bringen und den Frieden zu erhalten, wir das Schwert mit Gottes Hilfe so führen werden, dass wir es mit Ehren wieder in die Scheide stecken können.
Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg vom deutschen Volk erfordern. Den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland anzugreifen. Und nun empfehle ich Euch Gott! Jetzt geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für unser braves Heer!
Kaiser Wilhelm II.“
31. 7 1914 - Deutschland fordert von Russland die Einstellung der Mobilmachung
Berlin - Petersburg - Paris * Die deutsche Regierung teilt Russland mit, dass sie ein Vorgehen gegen Österreich nicht unbeantwortet lassen würde und fordert von Russland ultimativ die Einstellung der Mobilmachung. Zudem verlangt Kaiser Wilhelm II. von Frankreich eine Neutralitätserklärung im Fall eines bewaffneten Konflikts.
31. 7 1914 - Die Königstochter Wiltrud ist stolz auf Bayern und ihren Vater
München-Maxvorstadt * Voller Stolz beschreibt die Königstochter Wiltrud die Situation: „Wie herrlich sticht hervor, dass Bayern doch die größte Selbstständigkeit besitzt gegenüber anderen Staaten, denn im Reiche außer Bayern verhängte den Kriegszustand Kaiser Wilhelm II., hier aber Papa.“
31. 7 1914 - König Ludwig III. verhängt den Kriegszustand
München-Maxvorstadt * Am Nachmittag wendet sich der 69-jährige König Ludwig III. am Nachmittag an die Kundgebungsteilnehmer vor dem Wittelsbacher Palais. Er bedankt sich zunächst für die Huldigungen, die er als „Ausdruck der Treue und der Vaterlandsliebe“ betrachtet.
Im Wissen, auf welche Katastrophe das Deutsche Reich zusteuert, weist der Bayernherrscher auf die ernste und schwere Zukunft hin und erklärt: „Es sind [...] sehr schwere und ernste Zeiten, denen wir entgegen gehen. Aber ich vertraue darauf, dass das bayerische Volk wie seit vielen Jahrhunderten auch jetzt in Treue zu seinem Herrscherhaus stehen wird.“ Dann verhängt auch König Ludwig III. den Kriegszustand, verbunden mit der Anordnung des Standrechtes und den Übergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden.
Der Text seiner Verordnung lautete kurz und bündig: „Wir finden uns bewogen, auf Grund des Artikels I des Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. November 1912 zu verordnen: Über das Gesamtgebiet des Königreichs wird der Kriegszustand verhängt.
Gegeben zu München, den 31. Juli 1914. Ludwig.“
Um 8 1914 - Das „Städtische Wehramt“ zieht an die Winzererstraße
München-Schwabing * Das „Städtische Wehramt“ zieht von der „Kohleninsel“ an die Winzererstraße.
Heute ist dort das „Stadtarchiv“ untergebracht.
8 1914 - Mata Hari kann in die Niederlande einreisen
Berlin - Den Haag * Ohne gültige Aufenthaltspapiere und ohne Gepäck schafft „Mata Hari“ gerade noch die Ausreise in die Niederlande.
Dort absolviert sie ein paar Auftritte am Theater und findet in Den Haag eine standesgemäße Bleibe.
Sie will jedoch weiter nach Paris.
1. 8 1914 - Der Bundesrat stimmt für die Kriegserklärung an Russland
München-Kreuzviertel - Berlin * Der Bayerische Ministerrat führt einen einstimmigen Beschluss zur Frage herbei, wie sich Bayern im Bundesrat zur Kriegserklärung an Russland verhalten soll. Entsprechend ermächtigt stimmt der Bundesratsbevollmächtigte - wie alle anderen deutschen Länder - der Kriegserklärung an Russland ohne jede Diskussion zu.
Die dazu notwendigen Gesetze und Verordnungen nimmt der Ministerrat sogar ohne nähere Kenntnis der Inhalte an.
1. 8 1914 - Lügen für die These vom deutschen Verteidigungskrieg
München * Eine Zeitungs-Extraausgabe erscheint, in der es heißt, dass russische Patrouillen noch vor der Kriegserklärung auf deutsche Soldaten geschossen und französische Flugzeuge Bomben in der Umgebung von Nürnberg abgeworfen haben.
Bei beiden Meldungen handelte es sich um Lügen, die einzig und alleine den Zweck erfüllen sollen, die Feinde in der deutschen Öffentlichkeit als Aggressoren und Angreifer darzustellen und damit die These vom deutschen Verteidigungskrieg zu erhärten.
1. 8 1914 - Nun erfolgt auch die Mobilmachung der bayerischen Armee
München - Berlin * Nun erfolgt auch die Mobilmachung der bayerischen Armee. König Ludwig III. telegraphiert an Kaiser Wilhelm II. die folgenden Zeilen: „Das bayerische Heer ist heute mit dem Beginn der Mobilisierung unter deinen Befehl als Bundesfeldherr getreten. [...] In dieser Erwartung heiße ich Bayerns Söhne, sich um ihre Fahnen zu scharen, und bitte zu Gott, er möge, wenn der Kampf entbrennt, den deutschen Waffen den Sieg verleihen“.
An die Armee richtete er das Manifest „An mein Heer!“
1. 8 1914 - Kaiser Wilhelm II. erklärt Russland den Krieg
Berlin * Am Nachmittag versammelt sich vor dem Berliner Schloss eine große Menschenmenge. Spannung liegt in der Luft. Man wartet nicht mehr auf die Erhaltung des Friedens, sondern auf die Erklärung des Krieges.
Gegen 17:30 Uhr ordnet Kaiser Wilhelm II. für das Deutsche Reich - mit Ausnahme von Bayern - die Mobilmachung an und erklärt gleichzeitig Russland den Krieg. Damit geht der Oberbefehl über die bayerischen Truppen auf das Kaiserreich über.
Wilhelm II. erklärt: „Ich bin gezwungen, zur Abwehr eines durch nichts gerechtfertigten Angriffs das Schwert zu ziehen und mit aller Deutschland zu Gebote stehenden Macht den Kampf um den Bestand des Reiches und unserer nationalen Ehre zu führen“.
Die Menge singt anschließend Nun danket alle Gott und Extrablätter verbreiten die Generalmobilmachung.
1. 8 1914 - Die Mobilmachung wird Bayern 108 Millionen Mark kosten
Berlin - München * Mobilmachung bedeutet, dass das bestehende Friedensheer erst durch die Reservisten verstärkt und damit operationsfähig gemacht werden muss. Die Reservisten werden eingezogen und damit mobilisiert.
In Friedenszeiten umfasst das Heer reichsweit circa 750.000 Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften und 158.000 Pferde. Nach dem Abschluss beträgt die Stärke des deutschen Heeres 3.840.000 Mann und 880.000 Pferde.
Das Heer teilt sich in das Besatzungsheer und das eigentliche Feldheer, das 2.398.000 Mann und 730.000 Pferde umfasst. Die sogenannten Ersatztruppen, deren Soldaten zum Ausgleich der erwarteten Verluste bereitstehen, zählen 954.000 Mann. Damit sind in den Heimatgarnisonen - nach dem Ausmarsch des Feldheeres - mehr Soldaten vorhanden als in Friedenszeiten.
Die bayerische Armee ist ein Teil des deutschen Reichsheeres - mit eigener Verwaltung. Im Frieden umfasst sie rund 90.000 Soldaten und 17.000 Pferde. Nach der Mobilmachung steigt die Zahl der Soldaten auf 416.000, die der Pferde auf 90.000. Das bayerische Feldheer zählt 300.000 Mann und 82.000 Pferde. Die Mobilmachung wird Bayern 108 Millionen Mark kosten.
1. 8 1914 - Italien erklärt sich für neutral
Rom * Italien erklärt sich für neutral, obwohl das Land am 20. Mai 1882 dem Dreibund mit Deutschland und Österreich-Ungarn beigetreten war. Natürlich erwarten die Mittelmächte, dass sich Italien jetzt auf die Seite der Bündnispartner stellt. Doch die italienische Regierung zögert, weil sie formal gesehen nicht gezwungen ist, in die kriegerischen Auseinandersetzung einzugreifen.
Der Bündnisvertrag sieht lediglich eine militärische Unterstützung für Österreich vor, wenn es von außen angegriffen wird. Da aber Österreich-Ungarn Serbien angegriffen hat, ist das militärisch nicht gut vorbereitete Land vom Krieg nicht besonders begeistert.
Der eigentliche Grund für die abwartende Haltung Italiens liegt jedoch in seinen Annexions-Ansprüchen. Das Land will nach einem siegreichen Krieg Gebietserweiterungen zugesprochen bekommen. Weil das aber zu Lasten des Habsburger-Reiches gehen würde, weigert sich Österreich dagegen.
Die Mächte der Entente treten den territorialen Expansionswünschen Italiens freilich von Anfang an aufgeschlossener gegenüber.
1. 8 1914 - Karl Valentin erzählt über den Kriegsausbruch
München * Karl Valentin erzählt über den Kriegsausbruch:
„Für 1. August 1914 war ich wieder bei Benz engagiert. Eine Revue ‚Im Lande der Kastanien‘ sollte einstudiert werden, mehrere Nachmittage wurde fest geprobt, [...] - mitten im Kampfe ein Trommelwirbel aus der Ferne? ... Wir unterbrachen die Probe und eilten auf die Straße, da stand, [...] ein Trommler [...] und neben ihm ein Sergant, der Folgendes vorlas: ‚Im Namen seiner Majestät, König Ludwig III. von Bayern - Frankreich hat heute den Krieg erklärt usw.‘.
Schweigend gingen wir in das Haus zurück, die Probe war aus und acht Tage später gingen schon mindestens zehn Männer aus dem Hause Benz hinaus und sangen mit Blumen geschmückt; ‚Ich hatt‘ einen Kameraden‘.
Vierzehn Tage nach Ausbruch des Krieges durfte, um den in der Heimat weilenden Artisten, Schauspielern usw. Verdienstmöglichkeiten zu geben, wieder gespielt werden mit der Bedingung, zeitgemäße Darbietungen zu bringen.
Jeder Theaterdirektor empfahl patriotische Darbietungen zu bringen. Auch ich musste, obwohl es eigentlich von mir als Blödsinn-Interpret niemand gewohnt war, auch ernste Sachen bringen, so unter anderem eine Kriegsmoritat. Der Erfolg war groß und zwei Monate sang ich als Komiker traurige, ernste Vorträge.
Karl Valentin und Liesl Karlstadt beteiligen sich im Ersten Weltkrieg an insgesamt rund 120 Lazarett-Vorstellungen. Im Gegensatz zu „einigen großen Persönlichkeiten der Münchner Hofbühne“, die den kranken Soldaten „blutige Schlachtengedichte“ vortragen, leisten sie den Genesenden mit ihrem „lustigen, harmlosen Späßen“ einen wesentlich größeren Nutzen.
1. 8 1914 - Der Post- und Telefonverkehr wird massiv eingeschränkt
Deutschland * Sämtlicher Post- und Telefonverkehr wird massiv eingeschränkt. Private Telefongespräche ins Ausland und in einige Grenzgebiete sind nicht mehr möglich. Briefe ins Ausland und in bestimmte Schutzgebiete dürfen - zur einfacheren Überprüfung - nur mehr unverschlossen versandt werden.
1. 8 1914 - Aufruf an die deutschen Juden!
Berlin * Der Verband der Deutschen Juden und der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens erlassen einen „Aufruf an die deutschen Juden!“ Darin fordern sie ihre Glaubensgenossen auf, ihre Kräfte „über das Maß der Pflicht hinaus“ dem „Vaterlande zu widmen“.
Und weiter heißt es: „Eilet freiwillig zu den Fahnen! Ihr alle - Männer und Frauen - stellet Euch durch persönliche Hilfeleistung jeder Art und durch Hergabe von Geld und Gut in den Dienst des Vaterlandes!“
1. 8 1914 - Ein Ausfuhrverbot weiterer Lebensmittel wird erlassen
Berlin * Ein Ausfuhrverbot weiterer Lebensmittel wie Kaffee, Salz, Zucker und Bier wird erlassen. Damit dürfen nur noch neutrale und die verbündeten Länder Österreich, Ungarn und Türkei sowie die deutschen Truppen im Ausland mit Bier beliefert werden.
1. 8 1914 - Das herbeigesehnte und gefürchtete reinigende Gewitter ist da
München * Für viele Münchner und Deutsche ist nun endlich das teils herbeigesehnte, teils gefürchtete „reinigende Gewitter“ hereingebrochen. Denn für viele Zeitgenossen war der Krieg auf längere Sicht absolut unvermeidbar.
Durch die offizielle Berichterstattung über die außenpolitischen Krisen und die angebliche feindliche Einkreisung des Deutschen Reiches war diese Erkenntnis plausibel gemacht geworden.
1. 8 1914 - München wird zur Drehscheibe der bayerischen Truppenverladung
München * München, das nach Berlin die zweitgrößte Garnison im Deutschen Reich besitzt, wird zur Drehscheibe der bayerischen Truppenverladung. Einberufene und Kriegsfreiwillige strömen hier zusammen.
Auf den Münchner Bahnhöfen, die unter militärische Kontrolle stehen, herrscht riesiger Trubel; alleine am Hauptbahnhof verkehren täglich bis zu 700 Züge.
1. 8 1914 - König Ludwig III. gibt die Mobilmachung bekannt
München-Maxvorstadt * Gegen 19:30 Uhr tritt der greise König Ludwig III. auf den Balkon des Wittelsbacher Palais und gibt die Mobilmachung bekannt. Jubelnd und hüteschwenkend versammeln sich begeisterte Bürger, die den Kriegsausbruch feiern.
Der versammelten Menschenmenge ruft er zu, er sei zuversichtlich, dass sich seine Soldaten „im Verein mit ihren deutschen Bundesgenossen ebenso wie vor 44 Jahren tapfer schlagen werden und [er] hoffe zu Gott, er möge sie ehrenvoll mit Sieg gekrönt wieder in die Heimat zurückkehren lassen“.
Als erster Mobilmachungstag wird der 2. August bestimmt. Die vollziehende Gewalt geht damit von den Zivilbehörden auf die kommandierenden Generale der drei bayerischen Armeekorps in München, Nürnberg und Würzburg über. In der Pfalz übernimmt der Kommandeur der 3. Division diese Aufgabe. Auch die öffentliche Sicherheit wird den Militärbefehlshabern anvertraut.
Für die bayerische Regierung sind weitreichende Anordnungen der Militärs auch dann „statthaft, wenn sie im Widerspruch mit bestehenden Gesetzen stehen und sich nicht auf einen gesetzlichen Vorbehalt gründen“. Damit ist das öffentliche Leben weitgehend unter militärischer Kontrolle.
1. 8 1914 - Die Gewerkschaften und der Krieg
Berlin * Das Correspondenzblatt, das Organ der Generalkommission der Gewerkschaften, schreibt:
„Der Krieg 1870 und 71 wird als bedeutungslos verschwinden, wird keinen Vergleich aushalten mit dem, was uns an Verwüstungen von wirtschaftlichen, kulturellen Werten und Menschenleben der kommende Krieg in Aussicht stellt“.
2. 8 1914 - SPD-Abgeordneten stimmen gegen die Haushaltsgesetze
München * Anfang August schließt die Münchner Börse kurzfristig, um Panikverkäufe zu verhindern. Und selbst das bayerische Finanzministerium zeigte sich alarmiert: Es warnt davor, dass die Bürger die Banknoten zum Teil nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren würden.
Bei der Sitzung des Bayerischen Landtags stimmen die 21 anwesenden SPD-Abgeordneten gegen die Haushaltsgesetze. Das ist aber auch schon die einzige Reaktion gegen den Krieg.
Die beiden Kammern des Landtags befassen sich ebenfalls nicht mit dem Krieg sondern mit ungleich wichtigeren Fragen, wie beispielsweise dem Verbot des freireligiösen Unterrichts oder der Beschneidung des Streikrechts der Staatseisenbahner.
2. 8 1914 - Einmarsch in das neutrale Luxemburg
Luxemburg * Bereits in den frühen Morgenstunden überschreiten deutsche Truppen die luxemburgischen Grenzen. Damit starten die Deutschen den Westfeldzug.
2. 8 1914 - Viele Bürger akzeptieren die Banknoten nicht mehr
München * Das Bayerische Finanzministerium vermerkt, dass viele Bürger die Banknoten nicht mehr akzeptieren.
2. 8 1914 - Am Sonntag die Möglichkeit zum Einkaufen und zum Heiraten
München * Die Militärpflichtigen nutzen am Sonntag die Möglichkeit zum Einkaufen und zum Heiraten. Denn an diesem 2. August hatten sowohl die Geschäfte, wie auch die Standesämter geöffnet. Im August 1914 heiraten rund vier Mal so viele Paare wie im April. Und auch die katholischen Kirchen sind voll. Man nutzte die Zeit zum Beichten und zur Kommunion.
2. 8 1914 - Die Stadt hat sich durch den Krieg sofort verändert
München * Den Frauen werden Sanitätskurse angeboten, da nur wenige über entsprechende Kenntnisse verfügen. Pensionierte Lehrerinnen und Lehrer werden aufgefordert, sich für die Dauer der Schulferien um die Kinder zu kümmern. Nicht eingezogene Studenten und alle in den Wehrkraftvereinen organisierten Jugendlichen sollen sich als Erntehelfer melden.
Schauspieler und Autoren sollen während der Dauer des Krieg auf ihre Tantiemen verzichten und sich mit dem Zehrpfennig für Speise und Trank begnügen. Theaterdirektoren sollen ihren Ausstattungsetat möglichst weit herunterfahren: „Das Publikum wird in diesen Zeiten eine einfache Ausstattung und andere Mängel gerne in Kauf nehmen. Spielt deutsche und patriotische Stücke zu mäßigen Preisen“.
Hausbesitzer klagen, dass viele Mieter infolge des Kriegszustandes keine Miete zahlen wollen.
2. 8 1914 - Die Fremden müssen die Stadt verlassen
München * Laut einer Anordnung haben „Alle Fremden, die sich über den Zweck ihres Aufenthalts nicht gehörig ausweisen können oder sich lästig machen, [...] auf Aufforderung der Distriktspolizeibehörden das Gebiet des Deutschen Reiches und zwar bis auf weiteres über Lindau binnen 24 Stunden zu verlassen“.
Alle Angehörigen feindlicher Nationen - darunter die Künstler Wassily Kandinsky, Marianne Werefkin und Alexej von Jawlensky fliehen deshalb zunächst in die Schweiz. Doch auch Angehörige befreundeter Nationen verlassen die Stadt. So beispielsweise die Ziegeleiarbeiter in Berg am Laim und Oberföhring.
2. 8 1914 - Berlin fordert von Brüssel die Genehmigung für den Durchmarsch
Berlin - Brüssel * Berlin fordert von Brüssel die Genehmigung für den Durchmarsch der deutschen Truppen durch Belgien. Das Deutsche Reich bietet zum Ausgleich die Übernahme und Vergütung sämtlicher Kosten an.
Doch wider Erwarten lehnt Belgiens König Albert I. dieses Ansinnen mit Hinweis auf seine „Neutralität“ ab. Er sagt: „Wenn die belgische Regierung die ihr übermittelten Vorschläge annehmen würde, würde sie sich gegen die Ehre der Nation vergehen und Belgiens Pflichten gegenüber Europa verraten“.
2. 8 1914 - Ausländische Studenten verlassen die Universitätsstadt München
München * An den Münchner Hochschulen, wozu die Ludwig-Maximilians-Universität, die Technische Hochschule, die Königliche Akademie der Künste und die Königliche Akademie der Tonkünste gehören, sind
- 412 Studierende aus Österreich-Ungarn,
- 376 aus Russland und
- 50 Studenten aus dem Königreich Serbien eingeschrieben.
Diese verlassen die Stadt - aus unterschiedlichen Gründen - umgehend.
2. 8 1914 - Ein eigener Militärfahrplan wird in Kraft gesetzt
München * Um die Soldaten mit der Eisenbahn an die Front zu befördern, wird ein eigener Militärfahrplan in Kraft gesetzt. Deshalb gibt es bei den Bayerischen Staatsbahnen ab Mitte August nur einen sehr eingeschränkten zivilen Personen- und Güterverkehr.
2. 8 1914 - Das 2. Infanterie-Regiment Kronprinz begibt sich an die Westfront
Frankreich - Westfront * Das 2. Infanterie-Regiment Kronprinz begibt sich unter dem Kommando von Prinz Karl an die Westfront.
2. 8 1914 - Das Große Hauptquartier der OHL befindet sich in Berlin
Berlin * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL befindet sich im Generalstabsgebäude in Berlin.
3. 8 1914 - Adolf Hitler will in ein bayerisches Regiment eintreten
München * Adolf Hitler richtet an König Ludwig III. ein Immediatgesuch, ein unmittelbar an die höchste Behörde gerichtetes Gesuch. Darin äußert der Österreicher die „Bitte, in ein bayerisches Regiment eintreten zu dürfen“.
3. 8 1914 - Deutschland erklärt Frankreich und Belgien den Krieg
Berlin - Paris - Brüssel * Deutschland erklärt Frankreich und Belgien den Krieg.
3. 8 1914 - Deutschland bringt ein Weißbuch heraus
Berlin * Als erste kriegführende Macht bringt Deutschland ein Weißbuch heraus. Darin enthalten sind Aktenstücke, die beweisen sollen, dass sich Deutschland bis zuletzt um den Frieden bemüht hat und damit die Burgfriedenspolitk gegen kritische Fragen erhärten kann. Das Weißbuch wird vom Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg dem Reichstag vorgelegt.
Auch die anderen, am Krieg beteiligten Nationen bringen ähnliche Dokumentsammlungen in ihren Landesfarben heraus. Doch alle derartigen Publikationen erhalten neben Flüchtigkeitsfehlern auch gezielte Fälschungen.
3. 8 1914 - Arbeitskräfte-Mangel zu Kriegsbeginn
München * Der Krieg hat viele und einschneidende Auswirkungen:
- Von der Löwenbrauerei werden 300 Mitarbeiter zum Kriegsdienst eingezogen.
- Das Residenztheater muss ihren Spielbetrieb einstellen, weil zu viel Personal eingezogen worden ist.
- Das Metzgerhandwerk und die städtischen Straßenbahnen suchen händeringend Arbeitskräfte.
- Die Firma Kustermann muss ihre Filiale am Stachus schließen, um wenigstens den Betrieb im Hauptgeschäft aufrecht zu erhalten.
3. 8 1914 - Die Arbeitslosigkeit steigt mit Kriegsbeginn
München * Während in vielen Betrieben Arbeitskräfte-Mangel herrscht, nimmt beispielsweise im Baugewerbe die Arbeitslosigkeit in erschreckendem Ausmaß zu. Die Bautätigkeit ist mit Kriegsbeginn nahezu vollständig zu erliegen gekommen. Reparaturarbeiten werden nicht mehr beauftragt. Circa 5.000 Münchner Bauarbeiter, Schreiner und Zimmerer werden nicht mehr gebraucht.
- Viele wohlhabende Münchner beginnen beim Personal zu sparen.
- Lohnkürzungen oder Kündigungen sind die Auswirkungen.
- Auch den Handlungsgehilfen wird der Lohn bis zu 50 Prozent gekürzt.
- Doch im Unterschied zu den Dienstboten und Köchinnen wissen sie sich zu wehren.
- Rechnungen für gelieferte Waren werden oft nicht mehr bezahlt.
3. 8 1914 - Die Versorgung der Münchner Bevölkerung mit Brot gewährleistet
München * Die außerordentliche Versammlung der Münchner Bäckerinnung stellt fest, dass - trotz der Einberufung zahlreicher Bäckermeister und Gehilfen - die Versorgung der Münchner Bevölkerung mit Brot gewährleistet ist. Daneben sehen sich die verbliebenen Bäcker in der Lage, zusätzlich 20.000 Leibe Brot fürs Militär zu backen. Freilich können verschiedene Bäckereibetriebe nur mehr die gangbarste Brotsorte herstellen.
Die Versorgung Münchens mit Mehl ist für die nächsten vier Wochen gesichert; danach kommt ohnehin das Getreide der gerade anstehenden Ernte zur Vermahlung. Und weil das Militär die sechs Pferde eingezogen hat, die bisher für den Hefe-Transport benutzt wurden, kann die Hefe nicht mehr an jeden Bäcker geliefert werden.
3. 8 1914 - Deutsche Truppen überschreiten die Grenze zu Belgien
Belgien * Schwerbewaffnete deutsche Truppen überschreiten die Grenze zu Belgien. Daraufhin verlangt der britische Außenminister den Erhalt der belgischen Neutralität. Ansonsten wird England in den Krieg eintreten.
Nach dem 4. 8 1914 - Die Münchner Berufsfeuerwehr zieht in den Krieg
München * Mit Beginn des Ersten Weltkriegs ziehen 90 Münchner „Berufsfeuerwehrmänner“ auf die Schlachtfelder.
Zur Aufrechterhaltung des „Löschwesens“ werden jetzt die noch nicht eingezogenen Mitglieder der „Freiwilligen Feuerwehr“ herangezogen.
4. 8 1914 - Die „Kriegskredite“ werden auch von der SPD bewilligt
Berlin * Mit 96 zu 14 Stimmen beschließt die SPD-Reichstagsfraktion die Bewilligung der „Kriegskredite“.
Hugo Haase, der stellvertretende Vorsitzende der SPD und Kriegskreditgegner, gibt - gegen seine Überzeugung - die Erklärung ab:
„Wir lassen das Vaterland in der Stunde der Gefahr nicht im Stich“.
Kaiser Wilhelm II. gibt daraufhin seine ebenso berühmte Antwort:
„Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“.
4. 8 1914 - Die bayerischen Truppen stehen unter dem Kommando des Kronprinzen
Frankreich - Westfront * Bei Kriegsausbruch stehen die bayerischen Truppen hauptsächlich in der „6. Armee“ unter dem Kommando des Kronprinzen Rupprecht von Bayern an der Westfront in Französisch-Lothringen.
Nach ersten Erfolgen bleiben die deutschen Angriffe noch im Verlauf des Jahres 1914 stecken.
Nach dem 4. 8 1914 - Bewohnerinnen des „Marianums“ fertigen Uniformteile und Helmpolster
München-Untergiesing * Im Ersten Weltkrieg produzieren die Bewohner des „Marianums“ unter anderem Uniformteile und Helmpolster.
4. 8 1914 - Großbritannien tritt in den Krieg ein
Berlin - London * Am Abend hält „Reichskanzler“ Theobald von Bethmann Hollweg dem britischen Botschafter vor, wie furchtbar es wäre, wenn es zwischen Deutschland und England - „wegen eines Fetzens Papier“ - zum Krieg kommen würde.
Diese abschätzige Bezeichnung Bethmann Hollwegs für den „Vertrag über die belgische Neutralität“ wirft ein grelles Licht auf die deutsche Haltung und wird daher von der englischen Propaganda sofort in einem Plakat umgesetzt.
Die Verletzung der belgischen „Neutralität“ durch das „Deutsche Reich“ leistet einen entscheidenden Beitrag, die öffentliche Meinung in Großbritannien für den Krieg gegen Deutschland zu mobilisieren.
Großbritannien erklärt daraufhin konsequenterweise Deutschland den Krieg.
Die Armeen der „Mittelmächte“ haben eine Kriegsstärke von 3,5 Millionen Soldaten, davon 2,1 Millionen deutsche; die „Entente“ verfügt dagegen über 5,7 Millionen Soldaten.
Nach dem 4. 8 1914 - Durchhalteparolen von Bischof Michael von Faulhaber
München * Als an allen Fronten Katholiken auf Katholiken schießen und ihre Stoßgebete an den gleichen Gott schicken, ist es Michael von Faulhaber, der mit „Durchhalteparolen“ und „Hurra-Patriotismus“ den deutschen Soldaten in den Schützengräben den „Kampfesmut“ vorbetet.
Nach dem 4. 8 1914 - Die Maria-Theresia-Schule kommt in die Kreislehrerinnenbildungsanstalt
München-Au * Die Maria-Theresia-Kreisrealschule wird - kriegsbedingt - bis 1919 im Gebäude der Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern in der Frühlingstraße [heute: Eduard-Schmid-Straße] untergebracht.
Nach dem 4. 8 1914 - Von 903 Mitgliedern müssen 475 ihren Wehrdienst ableisten
München-Au * Einen herben Rückschlag erleidet der Haidhauser „Turn- und Sportverein München-Ost“ mit Beginn des Ersten Weltkrieges.
Von den inzwischen 903 Mitgliedern müssen 475 ihren Wehrdienst ableisten.
Damit werden mehr als die Hälfte der Mitglieder der Vereinsarbeit entzogen und dadurch die Arbeit und die Existenz des „TSV München-Ost“ gefährdet.
4. 8 1914 - Die bayerischen „Truppentransporte“ mit der Eisenbahn beginnen
München * Die bayerischen „Truppentransporte“ mit der Eisenbahn beginnen.
4. 8 1914 - König Ludwig III. schwört seine Untertanen auf den Krieg ein
München * König Ludwig III. schwört seine Untertanen auf den Krieg ein.
In seiner Bekanntmachung „An meine Bayern!“ wendet er sich nicht nur an die Soldaten, sondern vor allem an die Menschen in der Heimat:
„Deutschland hat den Kampf nach zwei Fronten aufgenommen.
Der Druck der Ungewissheit ist von uns gewichen, das deutsche Volk weiß, wer seine Gegner sind. In ruhigem Ernst, erfüllt von Gottvertrauen und Zuversicht, Scharen unsere wehrhaften Männer sich um die Fahnen.
Es ist kein Haus, das nicht teil hätte an diesem uns frevelhaft aufgedrungenen Krieg.
Bewegten Herzens sehen wir unsere Tapferen ins Feld ziehen.
Der Kampf, der unser Heer erwartet, geht um die heiligsten Güter, um unsere Ehre und Existenz.
Gott hat das deutsche Volk in vier Jahrzehnten rastloser Arbeit groß und stark gemacht, er hat unser Friedenswerk sichtbar gesegnet. Er wird mit unserer Sache sein, die gut und gerecht ist.
Wie unsere tapferen Soldaten draußen vor dem Feind, so stelle auch zu Hause jeder seinen Mann.
Wollen wir, jeder nach seiner Kraft, im eigenen Land Helfer sein für die, die hinausgezogen sind, um mit starker Hand den Herd der Väter zu verteidigen.
Tu jeder freudig die Pflicht, die sein vaterländisches Empfinden ihn übernehmen heißt. [...]
Bayern! Es gilt das Reich zu schützen, das wir in blutigen Kämpfen mit erstritten haben.
Wir kennen unsere Soldaten und wissen, was wir von ihrem Mut, ihrer Manneszucht und Opferwilligkeit zu erwarten haben.
Gott segne unser tapferes deutsches Heer, unsere machtvolle Flotte und unsere treuen österreichisch-ungarischen Waffenbrüder!
Er Schütze den Kaiser, unser großes deutsches Vaterland, unser geliebtes Bayern!“.
4. 8 1914 - Königin Marie Therese erlässt einen „landesmütterlichen“ Aufruf
München * Gleichzeitig richtet die Königin Marie Therese einen „landesmütterlichen“ Aufruf an die „Frauen und Jungfrauen Bayerns!“, damit auch diese ihren solidarischen Beitrag leisten:
„Euch aber, denen es nicht vergönnt ist, mit Blut und Leben für des Vaterlandes Ehre einzutreten, bitte ich innigst, nach Kräften mitzuwirken zur Linderung der Not jener Braven, welche das feindliche Geschoss oder die Beschwerden des Krieges verwunden oder sich zu Boden werfen.
So stellt euch denn, die ihr wohl alle liebe Angehörige bei der Armee wisst, in den Dienst des Roten Kreuzes, gleich Meinen Töchtern Hildegard, Helmtrud und Gundelinde.
Draußen fließt Blut, herinnen fließen Tränen, am bittersten da, wo zur Sorge der Seele die Not des Leidens kommt.
Auch hier muss und wird geholfen werden.
Das Notwendige bereiten wir eben vor [...].
Soldaten, die ihr ins Feld zieht, Ich, die Königin, sage euch, euere tapferen Frauen und eure lieben Kinder sollen nicht Not leiden; schaut voraus gegen den Feind, euren Lieben gehört nun unsere Sorge“.
4. 8 1914 - Erklärung zum unberechtigten Einmarsch ins „neutrale“ Belgien
Berlin - Brüssel * „Reichskanzler“ Theobald von Bethmann Hollweg gibt vor dem „Reichstag“ eine Erklärung zum unberechtigten Einmarsch ins „neutrale“ Belgien ab.
Die Reaktionen der Abgeordneten finden sich in den eckigen Klammern wieder:
„Meine Herren, wir sind jetzt in der Notwehr; [lebhafte Zustimmung] und Not kennt kein Gebot! [Stürmischer Beifall]
Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt, [Bravo!] vielleicht schon belgisches Gebiet betreten. [Erneutes Bravo.]
Meine Herren, das widerspricht den Geboten des Völkerrechts.
Die französische Regierung hat zwar in Brüssel erklärt, die Neutralität Belgiens respektieren zu wollen, so lange der Gegner sie respektiere.
Wir wussten aber, dass Frankreich zum Einfall bereit stand. [Hört! Hört!]
Frankreich konnte warten, wir aber nicht!
Ein französischer Einfall in unsere Flanke am unteren Rhein hätte verhängnisvoll werden können. [Lebhafte Zustimmung.]
So waren wir gezwungen, uns über den berechtigten Protest der luxemburgischen und der belgischen Regierung hinwegzusetzen. [Sehr richtig!]
Das Unrecht - ich spreche offen - das Unrecht, das wir damit tun, werden wir wieder gutzumachen suchen, sobald unser militärisches Ziel erreicht ist. [Bravo!]
Wer so bedroht ist wie wir und um sein Höchstes kämpft, der darf nur daran denken, wie er sich durchhaut! [Anhaltender brausender Beifall und Händeklatschen im ganzen Hause und auf den Tribünen.]
Meine Herren, wir stehen Schulter an Schulter mit Österreich-Ungarn“.
Ab 4. 8 1914 - Frauen werden für die „Heimatfront“ mobilisiert
München * Der Kriegsbeginn bewirkt eine umgehende „Mobilisierung der Frauen“, die ihren Einsatz an der „Heimatfront“ hauptsächlich in den klassischen Frauen-Aufgaben „Krankenpflege“ und „Fürsorge“ sahen.
4. 8 1914 - Schwere Belagerungsgeschütze gegen die belgischen Forts
Belgien * Belgien hat etwas über 100.000 Mann unter Waffen; die Deutschen greifen mit 2,4 Millionen Soldaten an.
Zwingende Voraussetzung für einen zügigen deutschen Vormarsch ist die Erstürmung der „Festungsstadt Lüttich“, die durch ein Dutzend Außenforts gesichert ist.
Das deutsche Heer setzt die ersten neuartigen Waffen dieses Krieges ein: schwere Belagerungsgeschütze.
Sie bestehen aus den von Österreich geliehenen „Skoda-Mörsern“ des Kalibers 30,5 Zentimeter und der „Dicke Bertha“ genannten „Krupp-Kanonen“, die ein Kaliber von unglaublichen 42 Zentimetern aufweisen und eine gewaltige Zerstörungskraft erzeugen.
Diese Geschütze lassen die als unzerstörbar geltenden Betonkuppeln der Lütticher Forts „aufplatzen wie Kürbisse“.
Der deutsche Vormarsch und die deutschen Waffen schlagen in der Folge eine Schneise der Verwüstung durch Belgien.
4. 8 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (I)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Unheimlich grelle, lange sichtbare, in horizontaler Linie verlaufende Blitze. Und es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Seit 3 Tagen rasen die Götter. Wie furchtbar sind diese Zeiten! Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod!“
4. 8 1914 - Eine staatlich reglementierte Kriegszwangswirtschaft wird eingeführt
Berlin * Das „Gesetz über die Ermächtigung des Bundesrates zu wirtschaftlichen Maßnahmen“ etabliert eine staatliche Planwirtschaft.
Damit kann eine staatlich reglementierte Kriegszwangswirtschaft eingeführt, die dem Bundesrat ermöglicht, Maßnahmen zur „Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen“ anzuordnen.
5. 8 1914 - Krieg auch in den deutschen Kolonien
Großbritannien * Die britische Regierung beschließt, den Krieg auch in die deutschen Kolonien zu tragen.
5. 8 1914 - Freudig begrüßte Nachwuchs-Soldaten
München * In den Münchner Neuesten Nachrichten ist zu lesen:
„Heute Abend kam ein ganzer Zug von Gebirglern an. Wie der über den Bahnhof marschierte, da gab es ein Rufen und Winken; an allen Fenstern im Kaufhaus Tietz [später Hertie, heute Karstadt am Bahnhofsplatz] würde es lebendig, alle Verkäuferinnen winkten mit Tüchern. [...]
Und wenn man sie alle sieht, diese Prachtkerle, dann mischt sich in die ersten Erwägungen, was werden kann und werden mag, das Gefühl tröstlicher Zuversicht. Wo so viele Arme zugreifen, so viele Herzen fürs Vaterland schlagen, da kann es nicht gefehlt sein“.
Um den 5. 8 1914 - Französische und englische Fremdwörter sind verpönt
München * Französische und englische Fremdwörter sind plötzlich verpönt.
„Wir brauchen keine Menus, keine Dinners, kein Dejeuner, keinen Five o‘clock tea u.s.f. Wir können ohne sie leben; uns genügt ein schlichter Speisezettel, ein Mittagessen, Frühstück, Fünfuhr- oder Abendtee“.
Der Begriff Restaurant wird durch Speisehaus ersetzt, statt im Delikatessengeschäft kauft man jetzt im Feinkostladen ein. Kinos heißen nun Lichtspielhaus und aus dem Abonnement in der Oper wird die Platzmiete.
Über Nacht wird aus dem Hotel Englischer Hof in der Dienerstraße das Hotel Posch und aus dem Hotel Bellevue am Stachus das Hotel Königshof.
5. 8 1914 - Rosa Luxemburg gründet die Gruppe Internationale
Berlin * Rosa Luxemburg gründet mit sechs anderen Parteilinken, wie Franz Mehring und Clara Zetkin, die Gruppe Internationale, der sich wenig später auch Karl Liebknecht anschließt.
6. 8 1914 - Österreich-Ungarn erklärt Russland den Krieg
Wien - Petersburg * Österreich-Ungarn erklärt Russland den Krieg.
6. 8 1914 - Der erste Luftangriff des Ersten Weltkriegs
Lüttich * In Lüttich wird von einem deutschen Zeppelin eine Bombe abgeworfen. Bei diesem ersten Luftangriff des Ersten Weltkriegs werden neun Menschen getötet.
6. 8 1914 - Der Kunstmaler Franz Marc meldet sich als Freiwilliger
München * Der Kunstmaler Franz Marc meldet sich in der Max-II-Kaserne als Freiwilliger.
6. 8 1914 - Serbien erklärt Deutschland des Krieg
Belgrad - Berlin * Serbien gibt seine Kriegserklärung gegen Deutschland ab.
7. 8 1914 - Montenegro erklärt Österreich-Ungarn den Krieg
Montenegro * Montenegro erklärt Österreich-Ungarn den Krieg.
7. 8 1914 - Wenig bemittelten Soldatenfrauen und Kinder werden unterstützt
München * Bürgermeister Dr. Wilhelm von Borscht gibt bekannt, dass die Fürsorge für die wenig bemittelten Soldatenfrauen und deren Kinder durch einen städtischen Wohlfahrtsausschuss in Zusammenarbeit mit karitativen Vereinen und Einrichtungen geregelt werden würde.
Für die Familienangehörigen von eingezogenen städtischen Mitarbeiter bezahlte die Stadt 60 Prozent des zuletzt bezogenen Wochenlohns für die Ehefrau, für jedes Kind unter 15 Jahren zusätzlich 5 Prozent. Der Höchstsatz darf aber 80 Prozent nicht überschreiten.
7. 8 1914 - Die Festung Lüttich fällt
Lüttich * Die Festung Lüttich fällt.
7. 8 1914 - Kronprinz Rupprecht verlässt mit seinem Stab München
München * Kronprinz Rupprecht, der als Generaloberst die - fast ausschließlich aus bayerischen Einheiten bestehende - 6. Armee befehligt, verlässt mit seinem Stab die bayerische Landeshauptstadt München.
Um den 8. 8 1914 - König Ludwig III. fordert die Angliederung des Elsass an Bayern
München * Nur wenige Tage nach Kriegsbeginn fordert König Ludwig III. - im Falle eines deutschen Sieges - die Angliederung des Elsass an Bayern. In einem Brief an den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg verlangt er ein Kriegsergebnis, das die schweren Blutopfer aufwiege.
8. 8 1914 - Auswirkungen des Krieges auf die gewerbliche Wirtschaft
München * Das bayerische Außenministerium beauftragt die Kreisregierungen, innerhalb von sechs Wochen über die „Auswirkungen des Krieges auf die gewerbliche Wirtschaft“ zu berichtigen.
8. 8 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (II)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Deutschlands Rüsterei, der unstillbare Ehrgeiz, die Militärhegemonie zu sein, hat das Unglück verschuldet“.
9. 8 1914 - Das „lärmende Treiben“ in den Straßen ist einem „feierlichen Ernst“ gewichen
München * In der Münchner Stadtchronik wird festgestellt, dass das „lärmende Treiben“ in den Straßen einem „feierlichen Ernst“ gewichen sei.
- Auf den Straßen wird es ruhiger. Der Autoverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen.
- Wer Benzin kaufen will, braucht einen „Erlaubnisschein des Stellvertretenden Generalkommandos“.
- Vor dem Hauptbahnhof und am Stachus warten nur mehr wenige Taxis auf Kundschaft.
- Die Straßenbahnen fahren nun mehr bis 23 Uhr.
9. 8 1914 - Die Invasion Belgiens verläuft nicht nach Plan
Belgien * Die Invasion Belgiens verläuft keineswegs nach Plan. Nur unter großen Anstrengungen und dem Einsatz schwerster Geschütze gelingt es den deutschen Soldaten, die belgischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Der Vormarsch des deutschen Heeres gerät immer wieder ins Stocken. Die Ursache hierfür ist ein nicht erwarteter, zeitweise sogar erbitterter Widerstand der belgischen Armee und der einheimischen Miliz-Einheiten.
Überrascht vom starken Verteidigungswillen der - laut dem deutschen Generalstab - angeblich so „wenig leistungsfähigen belgischen Truppen“, kommt es zu häufigen Übergriffen deutscher Soldaten auf belgische Zivilisten. Kaiser Wilhelm II. warnt vor einem drohenden Volksaufstand in Belgien.
9. 8 1914 - Kronprinz Rupprecht schlägt in Saint-Avold sein Hauptquartier auf
Saint-Avold * Kronprinz Rupprecht schlägt in der lothringischen Garnisonsstadt Saint-Avold sein Hauptquartier auf.
10. 8 1914 - Die bayerische Armee trifft auf den französischen Feind
Hattingen - Cirey-sur-Vezouze * „Mit donnerndem Hurra“ überschreitet das bayerische „I. Infanterieregiment König“ - unter der Führung des bayerischen „Kronprinzen“ Rupprecht - die deutsch-französische Grenze bei Hattingen.
Dort trifft es bei Cirey-sur-Vezouze in Lothringen zum ersten Mal auf den französischen Feind.
10. 8 1914 - Die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch während der Kriegszeit
München * Im „Bayerischen Innenministerium“ wird die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch während der Kriegszeit besprochen.
Da aus allen Regierungsbezirken eine gute bis sehr gute Heuernte gemeldet wird und sowohl die Kartoffel- wie die Getreideernte zufriedenstellend ausfiel, sehen die Viehzüchter keinen Grund zur Sorge.
Nur der Verbrauch von Kalbfleisch sollte eingeschränkt werden.
Außerdem sollte die Haltung von Kaninchen gefördert werden, weil diese „innerhalb kurzer Zeit ein großes Quantum von Fleisch für den Haushalt liefern“.
Als Bilanz der Besprechung wird festgestellt, dass Bayern hinsichtlich der Fleischversorgung vollkommen sicher sei, selbst wenn sich der Krieg länger hinziehen sollte.
Solche Besprechungen machen deutlich, dass man sich über Fragen der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderer lebenswichtiger Gebrauchsgüter keine Gedanken machte.
Niemand rechnete ernsthaft mit einem längeren Krieg.
10. 8 1914 - Auf dem Johannisplatz zur „Truppenaussegnung“
München-Haidhausen * Erstmals marschieren in Haidhausen die Truppen auf dem Johannisplatz zur „Truppenaussegnung“ auf, um vor dem Abmarsch noch den kirchlichen Segen zu erhalten.
„Der Kommandeur hielt eine kernige Ansprache und bat zum Schluss um Gottes Beistand.
Der Priester war unter dem Thronhimmel vor die Kirche getreten und erteilte, das Allerheiligste nach allen Seiten zeigend, den Segen. [...]
In allen katholischen Gotteshäusern wurde der Hirtenbrief des Kardinals verlesen, darauf drei Gebete für das Vaterland und unsere Krieger gehalten“.
Solche abendlichen und nächtlichen Aufmärsche mit kirchlichem Segen werden sich noch mehrmals wiederholen.
11. 8 1914 - Österreich-Ungarn gibt seine Kriegserklärung gegen Frankreich ab
Wien - Paris * Österreich-Ungarn gibt seine Kriegserklärung gegen Frankreich ab.
11. 8 1914 - Blutige Gefechte der bayerischen 6. Armee bei Lagarde
Lagarde * Blutige Gefechte der bayerischen 6. Armee bei Lagarde.
12. 8 1914 - Großbritannien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg
London - Wien * Großbritannien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg.
12. 8 1914 - Montenegro erklärt Deutschland den Krieg
Celinje - Berlin * Montenegro erklärt Deutschland den Krieg.
12. 8 1914 - Es kommt zu einem ersten Gefecht bei Badonviller
Badonviller * Es kommt zu einem ersten Gefecht zwischen dem bayerischen I. Infanterieregiment König und den Franzosen bei Badonviller.
13. 8 1914 - England und Frankreich erklären Österreich-Ungarn den Krieg
London - Paris - Wien * England und Frankreich erklären Österreich-Ungarn den Krieg.
13. 8 1914 - Die erste [aufgebauschte] positive Nachricht trifft von der Front ein
München * Die erste [aufgebauschte] positive Nachricht trifft von der Front ein: „Prinz Heinrich von Bayern [hat] mit Eskadron eine Abteilung französischer Dragoner vernichtet. [...] Durch die Siege bei Mühlhausen und Lagarde [ist] der deutsche Boden nunmehr vom Feinde frei“.
Um den 13. 8 1914 - Generalstabs-Chef Helmuth von Moltke beschuldigt belgische Zivilisten
Berlin - Brüssel * Der preußische Generalstabs-Chef Helmuth von Moltke beschuldigt belgische Zivilisten, sich entgegen dem Kriegsrecht an den Kämpfen beteiligt und „in grausamer Weise Verwundete erschlagen und Ärzte [...] niedergeschossen“ zu haben. Moltke droht damit, dass „jeder Nichtuniformierte, der [...] in irgendeiner Weise unberechtigt an der Kriegshandlung teilnimmt“, fortan „als Franktireur behandelt und sofort standrechtlich erschossen“ wird.
Damit können sich die vor Ort agierenden Soldaten und Befehlshaber auf allerhöchste Weisungen berufen. In den ersten beiden Kriegsmonaten kommen 5.500 belgische und rund 900 französische Zivilisten ums Leben. Der Auslöser dieser brutalen Aktionen und drakonischen Strafmaßnahmen sind häufig unerwartete Schusswechsel und Explosionen, deren Verursacher meistens unbekannt blieben.
Es kann sich dabei um versprengte belgische Soldaten, Angehörige der Miliz oder vor Ort agierende Widerstandskämpfer handeln, aber möglicherweise sind es auch nur betrunkene oder orientierungslose deutsche Soldaten, die sich in einem feindlichen Hinterhalt wähnen und nun das Feuer auf die eigenen Leute eröffnen.
13. 8 1914 - Die Franzosen sollen in die Falle gelockt werden
Lothringen * Um die Franzosen - gemäß dem Schlieffen-Plan - zum Vorrücken zu animieren und damit in die Falle zu locken, ziehen sich die Bayern wieder zurück. Die Franzosen sollen über Lothringen ins Reichsgebiet vorrücken und dann von der 6. Armee unter Kronprinz Rupprecht und der 7. Armee unter der Führung von Generalstabschef Konrad Krafft von Dellmensingen in die Zange genommen und eingekesselt werden.
Und weil in der Zwischenzeit, so der deutsche Feldzugsplan, die über Belgien nach Südosten geschwenkte deutsche Armee die Franzosen umfasst hätte, könnten die im Reichsgebiet befindlichen französischen Truppen nicht mehr mit weiterer Unterstützung rechnen und dadurch vernichtet werden. Voraussetzung wäre, dass die Armeen unter dem Kronprinzen und seinem Generalstabschef die Franzosen immer wieder in hinhaltende Gefechte verwickeln, aber letztlich nicht stoppen sollen. Nur der Durchbruch zum Rhein musste verhindert werden.
13. 8 1914 - Der Vorabdruck des Romans „Der Untertan“ wird eingestellt
München * Die Zeitschrift „Zeit im Bild“ stellt den seit 1. Januar 1914 laufenden Vorabdruck des Romans von Heinrich Mann „Der Untertan“ ein. Begründung: „Im gegenwärtigen Augenblick kann ein großes öffentliches Organ nicht in satirischer Form an deutschen Verhältnissen üben“. Außerdem meint die Redaktion, „dürften wir bei der geringsten direkten Anspielung politischer Natur, etwa auf die Person des Kaisers, die ärgsten Zensurschwierigkeiten bekommen“.
13. 8 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (III)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Wer am meisten Menschen mordet, gewinnt“.
14. 8 1914 - Die ersten Verwundeten kommen am Münchner Hauptbahnhof an
München-Ludwigsvorstadt * Zwei Wochen nach Kriegsbeginn kommen die ersten Verwundeten am Münchner Hauptbahnhof an. Von dort werden die verwundeten Soldaten mit umgebauten ehemaligen Sommerwagen der Trambahn in die verschiedenen Krankenhäuser und Lazarette gebracht. Die Lazarette sind über die ganze Stadt verteilt.
14. 8 1914 - Der französische Vorstoß beginnt
Lothringen * Der französische Vorstoß beginnt. Durch den Rückzug der Bayern dringen die Franzosen vierzig Kilometer ins Reichsgebiet vor. Plangemäß können die beiden angreifenden französischen Armeen von einander getrennt werden.
15. 8 1914 - 10.000 Gläubige pilgern nach Maria Eich in Planegg
Planegg * An Maria Himmelfahrt pilgern etwa 10.000 Gläubige nach Maria Eich in Planegg. Sie nehmen den 20 Kilometer langen Weg auf sich, um dafür zu beten, dass die „Gottesmutter ihren Mantel ausbreiten [möge] über all die Hunderttausende von Gatten und Vätern, von Brüdern und Söhnen, die jetzt draußen kämpfen um unsere heiligsten Güter“.
15. 8 1914 - Die Russen stoßen mit Soldaten auf ostpreußisches Gebiet vor
Ostpreußen * Bevor die Österreicher überhaupt angreifen können, stoßen die Russen mit über einer halben Million Soldaten auf ostpreußisches Gebiet vor. Dieser Angriff erfolgt auf französischem Wunsch, weil sich die Pariser Regierung dadurch eine Entlastung der eigenen Front erwartet. Die in Ostpreußen stehenden deutschen Verbände werden von den Russen vollkommen überrumpelt.
Der russische Vormarsch kann zwar nach wenigen Tagen zum Stehen gebracht werden, doch bis dahin befinden sich schon große Teile Ostpreußens in Feindeshand. Die Hauptleidtragenden sind die ostpreußischen Zivilisten, die ihre Heimat verlassen müssen.
15. 8 1914 - Das ganze katholische Elsass soll an Bayern fallen
München * König Ludwig III. konfrontiert den preußischen Geschäftsträger in München mit der Klage, dass Bayern im Krieg von 1870/71 zu schlecht weggekommen sei.
- So etwas darf nie wieder passieren.
- Der Krieg darf keinesfalls zu einer einseitigen Vergrößerung Preußens führen, da dadurch das staatliche Gefüge des Reiches verschoben würde.
- Wenn Preußen durch Annexionen wächst, dann müssen auch die anderen größeren Bundesstaaten, insbesondere Bayern, einen Ausgleich erhalten.
Danach entwickelt er sein Konzept: eine Aufteilung des Reichslandes Elsass-Lothringen, bei der das ganze katholische Elsass an Bayern fallen soll.
15. 8 1914 - Der Hurrapatriotismus des Ludwig Thoma
München * Der Schriftsteller Erich Mühsam beklagt sich über den Simplicissimus: „Und immer der haltloseste Hurrapatriotismus, in dem sich Ludwig Thoma, der große Spötter, am lautesten jetzt hervortut.“
16. 8 1914 - 5.550 Truppenzüge mit 285.000 Wagen für die Truppentransporte
Königreich Bayern * 5.550 Truppenzüge mit 285.000 Wagen sind seit Beginn der Truppentransporte am 4. August auf dem bayerischen Eisenbahnnetz abgefertigt worden. Ebenso viele Züge kommen leer wieder zurück.
16. 8 1914 - Alle belgischen Forts sind durch deutsche Truppen erobert
Belgien * Alle belgischen Forts sind durch deutsche Truppen erobert.
16. 8 1914 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht nach Koblenz
Berlin - Koblenz * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht vom Generalstabsgebäude in Berlin in das Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium nach Koblenz.
Um den 17. 8 1914 - In der Kolumbusschule entsteht ein Lazarett
München-Au * Im Ersten Weltkrieg werden die Schulbänke aus den Klassenzimmern der Kolumbusschule geräumt und dafür mit Strohsackbetten für die Verwundeten eingerichtet.
17. 8 1914 - Russische Truppen marschieren bei Schirwindt in Ostpreußen ein
Schirwindt * Russische Truppen marschieren bei Schirwindt in Ostpreußen ein.
18. 8 1914 - Vier deutsche Armeen fallen in Belgien ein
Belgien * Vier deutsche Armeen fallen in Belgien ein.
18. 8 1914 - Die japanischen Studenten haben München verlassen
München * Nachdem die Studierenden aus dem befreundeten und aus dem feindlichen Ausland die Stadt gleich zu Kriegsbeginn verlassen haben, fallen jetzt die Studenten aus Japan im Straßenbild besonders auf.
„Die ziemlich zahlreichen Gelbgesichter mit ihren Schlitzaugen belebten mit eigenartigem Reiz das Bild des hiesigen Straßenpublikums. Die mittelgroßen Leutchen kamen meist sehr gesetzt einher, mit goldener Brille im ernsten Antlitz; waren stets zu zweit oder dritt oder hatten eine deutsche Freundin bei sich; studierten fleißig, beobachteten fleißig, zeigten aber nirgends ein aufdringliches oder lärmendes, eher ein fast bescheidenes, immer freundliches Wesen und waren darum mehr ein exotisches als störendes Element. Sie waren in gewissen Kreisen sogar wohlgelitten. - Ihr plötzliches Verschwinden befremdet“.
19. 8 1914 - Deutsche Truppen beziehen in Löwen [Leuven] ihre Stellung
Leuven * Deutsche Truppen beziehen in Löwen [Leuven] ihre Stellung. Zunächst bleibt es friedlich in der Stadt.
19. 8 1914 - Kronprinz Rupprecht erteilt den Befehl zum Angriff
Lothringen - Westfront * Da die Franzosen nur zögerlich voranschreiten, entscheidet sich Kronprinz Rupprecht zum aktiven Eingriff in das Geschehen und erteilt den Befehl zum Angriff für den nächsten Tag. Der Vorstoß ist allerdings in den Planungen des preußischen Generalstabschef Helmuth von Moltkes nicht vorgesehen.
Mag sein, dass Kronprinz Rupprecht so reagiert, weil er die negative Stimmung seiner Truppen erkannte, die sich bei den noch kriegsbegeisterten bayerischen Soldaten durch die auferlegte Defensive ausbreitete. Mehr werden jedoch Eifersüchteleien und Rivalitäten eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Denn Rupprecht, der Kronprinz von Bayern, und sein Generalstabschef Konrad Krafft von Dellmensingen wollen nicht diejenigen sein, die mit ihren Truppen immer weiter nach Deutschland zurückweichen, während der Kronprinz von Preußen mit seinen Einheiten nach Frankreich voran stürmt.
20. 8 1914 - Deutsche Truppen besetzen Brüssel
Brüssel - Antwerpen * Deutsche Truppen besetzen die belgische Hauptstadt Brüssel. Die dort stationierte belgische Armeeführung flieht daraufhin nach Antwerpen.
20. 8 1914 - Die Schlacht in Lothringen ist die erste große Schlacht an der Westfront
Lothringen * Die Schlacht von Lothringen beginnt; sie dauert bis zum 22. August und ist die erste große Schlacht an der Westfront und die letzte, in der die bayerische Armee geschlossen ins Feld zieht. Zunächst geht die Rechnung der Bayern auch auf. Die Armeen unter bayerischer Führung können den Franzosen eine schwere militärische Niederlage zufügen, weshalb sie sich aus Lothringen und dem Elsass bis östlich von Nancy zurückziehen müssen.
Um den 20. 8 1914 - Generaloberst Maximilian Freiherr von Prittwitz wird abgesetzt
Berlin - Ostpreußen * Helmuth von Moltke, der Chef der Obersten Heeresleitung, lässt den für Ostpreußen zuständigen und mit der Situation total überforderten Generaloberst Maximilian Freiherr von Prittwitz und Gaffron absetzen. Denn ein Verlust Ostpreußens als Kornkammer des Reiches hätte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für die Moral der Deutschen unabsehbare Folgen gehabt.
20. 8 1914 - Bayerische Soldaten stecken das Dorf Nomeny in Brand
Nomeny * Bayerische Soldaten stecken das Dorf Nomeny in Brand. Danach kommt es zu etlichen deutschen Gräueltaten in verschiedenen Orten. Manche Zivilisten haben das Glück, dass sie nur als Geisel mitgenommen und später wieder freigelassen werden. Unter der Führung von Kronprinz Rupprecht erringen zwei deutsche Armeen zwar einen Sieg, dennoch stecken die Truppen bald in ihren Stellungen fest.
21. 8 1914 - Deutsche Truppen äschern das Städtchen Seilles an der Maas ein
Seilles an der Maas * Deutsche Truppen äschern das gegenüber von Andenne gelegene Städtchen Seilles an der Maas ein. Weil Pioniere angegriffen wurden, während sie eine Brücke über die Maas schlugen, hat man etwa 200 Bewohner standrechtlich erschossen und den Ort danach total zerstört.
21. 8 1914 - Paul von Hindenburg wird Oberbefehlshaber der 8. Armee
Konstanz * Der 65-jährige Freiherr von Prittwitz wird durch den 66-jährigen und seit 1911 pensionierten Paul von Beneckendorff und Hindenburg ersetzt. Dabei geht es der Obersten Heeresleitung - OHL gar nicht um den kampferprobten Hindenburg, der bereits 1866 vor Königsgrätz kämpfte und 1870/71 am Deutsch-Französischen Krieg teilgenommen hat. Generalstabs-Chef Moltke bezweifelt sogar, dass Paul von Hindenburg über die erforderliche Tatkraft und Energie verfügen würde.
Für Hindenburg spricht eigentlich nur, „dass man von seinem Phlegma absolute Untätigkeit erwartete, um Ludendorff freie Hand zu lassen“. Man will eigentlich Erich Ludendorff zum Befehlshaber in Ostpreußen machen. Doch ein Generalmajor bürgerlicher Abstammung konnte unmöglich zum Oberbefehlshaber der 8. Armee aufsteigen, wo doch die anderen Armeekommandos in den Händen von Adeligen, häufig sogar Herzögen und Kronprinzen lagen. Dennoch sollte der Bürgerliche hinter einem wenig antriebsvollen und alten Vorgesetzten die aktive Rolle des Armee-Kommandierenden übernehmen.
22. 8 1914 - Pater Rupert Mayer tritt freiwillig in den Militärdienst ein
München * Pater Rupert Mayer tritt freiwillig in den Militärdienst als Feldgeistlicher beim 1. Bayerischen Armeekorps im Feldlazarett 2 ein.
22. 8 1914 - Erich Ludendorff wird Generalstabs-Chef in Ostpreußen
Konstanz * Generalstabs-Chef Helmuth von Moltke beruft den an der Westfront eingesetzten und als „Helden von Lüttich“ verehrten Erich Ludendorff ins große Hauptquartier in Koblenz, um ihn über seine neue Mission als Generalstabs-Chef in Ostpreußen in Kenntnis zu setzen.
Noch am Abend des selben Tages trifft Ludendorff in Konstanz ein, wird mit den Befehlen ausgestattet und fährt danach mit einem Sonderzug nach Marienburg, nimmt aber zuvor in Hannover noch Paul von Hindenburg auf. Nachdem er den neuen Oberbefehlshaber der 8. Armee knapp über die Lage informiert hat, legt sich Hindenburg wieder zum Schlafen.
23. 8 1914 - Kriegserklärung Japans an Deutschland
Tokyo - Berlin * Kriegserklärung Japans an Deutschland. Japan tritt als Verbündeter der Entente in den Krieg ein.
23. 8 1914 - Sächsische Truppen begehen ein besonders grausames Massaker
Dinant * In Dinant, einem malerischen Kleinstädtchen an der Maas, in der Provinz Namur, veranstalten sächsische Truppen ein besonders grausames Massaker. Weil sie von angeblichen Franktireurs beschossen wurden, starten die deutschen Soldaten - auf Befehl ihrer Vorgesetzten - eine Strafaktion. Sie zünden Häuser an, plündern und ermorden 674 der knapp 8.000 Einwohner. Frauen wie Männer, Greise, viele Kinder und vier Babys, die angeblich alle bewaffnet waren.
Die Bilder der zerstörten Stadt lösen Entsetzen und Empörung über die deutschen „Barbaren“ aus. Von Widersprüchen oder gar Verweigerungen, derartige Befehle auszuführen, haben sich keinerlei Informationen erhalten. Prinz Max, der Bruder des sächsischen Königs und Feldgeistlicher in Belgien, vertraut einem befreundeten Seelsorger folgende Worte an: „Wenn es einen gerechten Gott im Himmel gibt, müssen wir diesen Krieg verlieren wegen der Gräuel, die wir in Belgien verübt haben.“
Ab dem 23. 8 1914 - Kronprinz Rupprecht wird zunächst als bedeutender Feldherr gefeiert
München - Berlin * Gleich unmittelbar nach der Schlacht wird der bayerische Kronprinz Rupprecht als „bedeutender Feldherr“ gefeiert. Der „Sieger von Lothringen“ wird sowohl von seinem Vater, König Ludwig III., mit dem er in militärischen Fragen nur selten im Einklang steht, als auch von Kaiser Wilhelm II. mit den höchsten Auszeichnungen dekoriert. In zahlreichen Darstellungen auf Postkarten wird Rupprecht regelrecht zum Kriegshelden hochstilisiert.
Doch nur wenige Wochen später, nachdem die Kampfhandlungen eine ungünstige Wendung genommen haben, spricht man in den Kreisen führender Militärs laut und deutlich hörbar Kritik an Rupprechts Vorgehen in Lothringen aus. Es heißt, sein persönliches Prestigebedürfnis habe ihn zur Offensive entgegen dem Schlieffen-Plan angetrieben. Dieses Verhalten wird Deutschland nun sehr teuer zu stehen kommen.
Ab dem 23. 8 1914 - Generalmajor Erich Ludendorff trifft die Entscheidungen
Ostfront * Vor Ort erkennen die hohen Militärs die Problematik der Kriegssituation und entwickeln eine neue Strategie, die allerdings auch mit einem Risiko behaftet ist.
Und tatsächlich erweist sich Erich Ludendorff [„Ohne Opfer kein Sieg! Ohne Sieg kein Friede!“] vor und während der Schlacht um Tannenberg als das treibende Element, während der eigentliche Oberbefehlshaber der 8. Armee, Paul von Hindenburg, „mit großer Ruhe und noch größerem Schlafbedürfnis“ die Entscheidungen des Generalstabs-Chefs Erich Ludendorffs absegnet.
Der bürgerliche Generalmajor Ludendorff trifft die Entscheidungen, Hindenburg repräsentiert nach Außen hin.
23. 8 1914 - Mit der Herstellung von Kriegsbrot wird begonnen
München * Nur drei Wochen nach Kriegsbeginn wird mit der Herstellung von Kriegsbrot begonnen.
23. 8 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (IV)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Wo man hinhört: Gefallen, ermordet, gestorben, verschollen, verhaftet, wahnsinnig. Das ist die große erhebende veredelnde Kriegszeit.“
Ab dem 24. 8 1914 - Es kommt zum französischen Sieg von Trouée de Charmes
Lunéville * Zwischen dem 24. und 26. August kämpfen französische Armeekorps bei Lunéville, um dort die deutsche Offensive zu stoppen. Es kommt zum französischen Sieg von Trouée de Charmes. Dabei müssen die deutschen Truppen erhebliche Verluste hinnehmen. Danach bleibt die Front bis zum 3. September unverändert und ruhig.
24. 8 1914 - Die Schlacht zwischen Österreich-Ungarn und Russland beginnt
Galizien * In Galizien beginnt die Schlacht zwischen Österreich-Ungarn und Russland.
24. 8 1914 - Die Enttäuschung über Japan ist groß
München - Berlin * Zwischen dem 15. und 18. August reisten die Japaner angeblich nach Berlin. Mit großer Enttäuschung nimmt man in München von der Abreise, den japanischen Anschluss an die Entente und die Kriegserklärung an Deutschland zur Kenntnis.
„Die Herren hatten feine Witterung oder waren von zu Hause aus gut unterrichtet und ließen bei ihrem schnellen, stillen Abschied nur Vorsicht walten. Japan, das wir stolz als unseren gelehrigen, eifrigen Schüler bezeichneten, das wir bereitwilligste in viele Dinge Einblicke tun ließen, von dem wir, weil es ehemals der Gegner Russlands war, Hilfe oder doch Unterstützung erhofften, steht im Bunde mit England, also auf der Seite unserer Feinde.
O deutscher Michel!“
25. 8 1914 - Österreich-Ungarn erklärt Japan den Krieg
Wien - Tokyo * Österreich-Ungarn erklärt Japan den Krieg.
25. 8 1914 - In Frankreich erbeutete Kanonen und anderes Kriegsgerät wird ausgestellt
München-Graggenau * In Frankreich erbeutete Kanonen und anderes Kriegsgerät wird am Odeonsplatz ausgestellt.
25. 8 1914 - Die ersten drei bayerischen Verlustlisten werden veröffentlicht
München * In der Kriegs-Chronik der Münchner Neuesten Nachrichten werden die ersten drei bayerischen Verlustlisten veröffentlicht.
25. 8 1914 - In Löwen [Leuven] kommt es vollkommen unerwartet zu Schusswechseln
Leuven * Am Abend kommt es in Löwen [Leuven] plötzlich und zu diesem Zeitpunkt vollkommen unerwartet zu Schusswechseln. Historiker gehen heute davon aus, dass es sich dabei um ein sogenanntes friendly fire, also ein eigenes Geschützfeuer handelte, bei dem deutsche Soldaten versehentlich eigene Kameraden beschossen haben. Doch damals hieß es, belgische Freischärler [sogenannte Franktireurs] haben angegriffen.
Eine tragische Kettenreaktion kommt in dieser Nacht in Gang. Die größtenteils im Kampf unerfahrenen deutschen Soldaten dringen in ihrer Panik in die belgischen Häuser ein, in denen sie die Heckenschützen vermuten. In wilder Raserei nehmen sie Geiseln und töten Tausende Zivilisten, nachdem sie deren Wohnungen in Brand gesetzt haben. Immer mehr Gebäude im Zentrum Löwens fangen Feuer.
Ab dem 25. 8 1914 - Das deutsche Heer setzt ihren Vormarsch fort
Namur - Charleroi - Mons * Das deutsche Heer setzt ihren Vormarsch durch Belgien und Nordfrankreich fort. Die ersten großen Schlachten bei Namur, Charleroi und Mons werden mit Bravour geschlagen. Die französischen Einheiten und das aus etwa 50.000 Mann bestehende britische Expeditionskorps treten - angesichts der deutschen Übermacht - überstürzt den Rückzug an.
Die deutschen Armeeführer sind der Überzeugung, dass die Flüchtenden sich ungeordnet zurückziehen und verfolgen den Feind, um ihn endgültig zu schlagen und damit den Krieg zu beenden. Doch die Einheiten des Generaloberst Karl von Bülow sind derartig schnell unterwegs, dass das von Generaloberst Alexander von Kluck befehligte Heer nicht so schnell folgen kann und schon bald zwischen den beiden deutschen Armeen ein vierzig Kilometer breiter Spalt klafft.
26. 8 1914 - Die Schlacht von Tannenberg beginnt
Tannenberg * Die Schlacht von Tannenberg beginnt. Sie dauert bis zum 30. August. Die russischen Truppen werden vernichtend geschlagen. Zwei Männer treten hier besonders hervor: der reaktivierte Ruheständler Paul von Hindenburg und sein Stabschef Erich Ludendorff.
27. 8 1914 - Brandschatzung der Löwener Bibliothek
Leuven * Die in der Stadt Löwen verbliebenen etwa 10.000 Einwohner werden aus den rauchenden Ruinen vertrieben. 1.500 von ihnen transportiert man in Viehwagen nach Deutschland, wo sie monatelang unter schlimmsten Bedingungen im Truppenlager Munster in der Lüneburger Heide festgehalten werden.
Der deutsche Zerstörungsrausch gipfelt in der Brandschatzung der Löwener Bibliothek. In dem Feuer werden eine Vielzahl einmaliger Handschriften, Inkunablen und rund 300.000 Bücher vernichtet. Nahezu 2.000 Gebäude fallen in Löwen dem Feuer zum Opfer.
27. 8 1914 - Bei den „Masurischen Seen“ werden die Russen vernichtend geschlagen
Masurische Seen * Zum Glück übermitteln die Russen ihre Planungen ohne Verschlüsselung über Funk. Damit weis der deutsche Generalstab, dass der russische Gegner Nachschubprobleme hat und deshalb nicht auf breiter Front angreifen kann. Dieses Wissen nutzen die deutschen Befehlshaber und beginnen die russischen Verbände einzuschließen.
Als sich die Russen in eine Verteidigungsstellung bei den Masurischen Seen zurückziehen, werden sie von den Deutschen verfolgt und vernichtend geschlagen. Etwa 10.000 Russen ertrinken in den Masurischen Seen. Insgesamt fallen 50.000 russische Soldaten, 92.000 kommen in Gefangenschaft. Die deutschen Verluste sind dagegen vergleichsweise gering.
28. 8 1914 - Die ersten Weltkrieg-Toten werden begraben
München-Waldfriedhof * Am Waldfriedhof werden die ersten Weltkrieg-Toten begraben.
28. 8 1914 - Österreich-Ungarn gibt eine Kriegserklärung an Belgien
Wien - Brüssel * Österreich-Ungarn gibt eine Kriegserklärung an Belgien.
28. 8 1914 - Der Alltag ist komplizierter geworden
München * Der Alltag in München ist komplizierter geworden. Es gibt kaum noch einen Autoverkehr in der Stadt. Kaufleute werden nur mehr gegen Bargeld beliefert, weshalb auch sie ihre Kunden nicht mehr „Anschreiben“ lassen. Selbst beim Zahnarzt muss man sofort und bar bezahlen.
28. 8 1914 - Paul von Hindenburg wird zum „Retter des Vaterlandes“
Tannenberg - Gilgenburg - Ortelsburg * Paul von Hindenburg weiß, wie man Geschichte schreibt. Denn während die Presse noch zu Beginn von der „Schlacht bei Gilgenburg und Ortelsburg“ schreibt und Kaiser Wilhelm II. Hindenburg den Dank für den „Sieg bei Allenstein“ ausspricht, richtet der Oberbefehlshaber der 8. Armee seinen Blick auf Tannenberg. Dort wütete anno 1410 eine Schlacht zwischen dem Deutschen Orden und der Polnisch-Litauischen Union.
Paul von Hindenburgs Version klingt deshalb so: „Bei Tannenberg, das zwischen Gilgenburg und Hohenstein liegt, wurde 1410 das Ordensheer von den Polen und Litauern vernichtet. Jetzt, nach 504 Jahren, kam die Revanche.“ Die geschickte Verknüpfung mit Tannenberg trägt zur Entstehung des Mythos um den siegreichen Feldherrn Hindenburg, dem „Russen-Schreck“, bei. Tannenberg wird zum in Deutschland ersehnten Sieges-Mythos, Hindenburg zum „Retter des Vaterlandes“.
30. 8 1914 - Der amerikanische Gesandtschaftssekretär beobachtet die Lage in Löwen
Leuven * Der amerikanische Gesandtschaftssekretär Hugh Gibson macht sich ein Bild von der Lage in Löwen. Ein deutscher Offizier erklärt ihm: „Es wird die Belgier lehren, Deutschland zu respektieren und es sich zweimal zu überlegen, gegen Deutschland die Waffen zu erheben“.
Mit der Zerstörung der Löwener Bibliothek hat sich das Deutsche Reich weltweit den Ruf von „Barbaren“ eingehandelt. Als „Hunnen“, denen man das Schlimmste zutraut, werden sie fortan in der alliierten Propaganda verspottet.
30. 8 1914 - Die geplante Umzingelung von Paris wird nicht weiter verfolgt
Paris * Die ursprünglich geplante Umzingelung von Paris wird nicht weiter verfolgt. Generaloberst Alexander von Klucks Armee folgt einfach von Generaloberst Karl von Bülow an die Marne - und lässt damit seine gesamte rechte Flanke ungeschützt.
Jetzt stehen die Deutschen zwar kurz vor der französischen Hauptstadt, doch sind sie von ihrer eigenen Versorgung abgeschnitten. Sie haben keine Verbindung zum Hauptquartier in Luxemburg und sind durch die anstrengenden Gewaltmärsche für die anstehenden militärischen Auseinandersetzungen geschwächt. Außerdem ist die Kommunikation zwischen den beiden Armeen äußerst mangelhaft. Und weil die Übermittlung drahtloser Nachrichten ins Hauptquartier oft 24 Stunden und mehr dauern, sind die Franzosen bald über die Schwachstelle der Deutschen Armee bestens unterrichtet.
Die deutsche Armeeführung glaubt immer noch, dass die Franzosen wie aufgeschreckte Hasen davongelaufen sind. Doch zum Unterschied des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 ist es der französischen Führung gelungen, die Truppen neu zu sammeln. Einige ranghohe französische Offiziere werden dennoch wegen „Unfähigkeit vor dem Feind“ versetzt und die kämpfenden Truppen neu strukturiert.
30. 8 1914 - Franz Marc begibt sich an die französische Front
Frankreich * Franz Marc begibt sich mit der 2. Ersatzbatterie des 1. Feldartillerieregiments an die französische Front.
30. 8 1914 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht nach Luxemburg
Koblenz - Luxemburg * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht vom Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium in Koblenz in die ehemalige Deutsche Botschaft in Luxemburg.
31. 8 1914 - Zwei Krankenzüge bringen 725 Verwundete nach München
München * Zwei Krankenzüge bringen 725 Verwundete, darunter 50 Kriegsgefangene Franzosen, in Münchner Lazarette.
31. 8 1914 - Zum Patriotischen Abend erscheinen nur mehr 25 Leute
München-Maxvorstadt * Zu einem Patriotischen Abend ins Café Luitpold erscheinen nur mehr 25 Leute.
9 1914 - Die Gründer des „Loos-Vereins Wild West“ müssen an die Front
München * Der „Erste Weltkrieg“ bedeutet für die drei etwa 20-jährigen und wehrdiensttauglichen jungen Gründer des „Loos-Vereins Wild West“ die Einberufung zum Militär und den „Marschbefehl“ in Richtung Frankreich.
Nun heißt es „Verdun statt Wyoming!“
3. 9 1914 - Die französische Regierung verlegt ihren Sitz nach Bordeaux
Paris - Bordeaux * Die französische Regierung verlegt angesichts der vorrückenden deutschen Truppen ihren Sitz nach Bordeaux.
4. 9 1914 - Das Selbstbewusstsein der bayerischen Truppen ist geknickt
Trouée de Charmes * Das Scheitern vor Trouée de Charmes hat das Selbstbewusstsein der bayerischen Truppen geknickt. Um so wichtiger wäre aus psychologischer Sicht jetzt die Eroberung von Nancy.
Um 20:30 Uhr beginnen die Armeen auf Befehl des Kronprinzen Rupprecht mit dem Artilleriebeschuss von Vitrimont, Maixe und Friscati. Die Deutschen verfügen immerhin über 235 schwere Geschütze, darunter Mörser mit 21-, 30,5- und 42-Zentimeter-Granaten, dazu Fesselbalone und Flugzeuge.
5. 9 1914 - Kaiser Wilhelm II. kommt persönlich aufs Schlachtfeld
Nancy * Kaiser Wilhelm II. kommt persönlich aufs Schlachtfeld. Er will Nancy fallen sehen und - wie sein Vater im Jahr 1870 - als Sieger in die Stadt einreiten. Die Stadt Nancy erlebt ihren ersten Luftangriff. Zwei Flugzeuge werfen einige Bomben ab, wobei nur geringe Sachschäden erzielt werden.
5. 9 1914 - Die Schlacht an der Marne beginnt
Marne * Die Schlacht an der Marne beginnt.
6. 9 1914 - Mit dem Taxi zum Schlachtfeld an der Marne
Marne * Ein Ereignis, das zwar keinen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Marne-Schlacht hat, wird aber zu einem die Franzosen stark motivierenden Angriffsschub. Nachdem die Kämpfe an der Marne beginnen, lässt der französische Generalstabschef Joseph Joffre sämtliche Taxen von Paris requirieren und je zweimal mit jeweils fünf Soldaten von Meaux an die 50 Kilometer entfernte Front vor Paris an die Marne bringen.
7. 9 1914 - Der direkte Angriff auf Nancy beginnt
Nancy * Der direkte Angriff auf Nancy beginnt.
7. 9 1914 - Generalstabschef Helmuth von Moltke ist scheinbar überfordert
Marne * Rund 6.000 zusätzliche französische Soldaten stehen am Morgen den Deutschen gegenüber. In Luxemburg ist der deutsche Generalstabschef Helmuth von Moltke mit dieser Gesamtsituation scheinbar überfordert. Auf dem Höhepunkt der Kampfhandlungen zieht er überstürzt zwei Armeekorps nach Ostpreußen ab, damit sie Hindenburgs Armee an der Ostfront unterstützen. Dort wird zwar die sogenannte Schlacht von Tannenberg gewonnen, doch an der Westfront fehlen die Streitkräfte.
Den dort kämpfenden Soldaten ist spätestens jetzt die Siegeszuversicht und Euphorie der ersten Kriegstage vergangen. Dafür kommt jetzt das Gefühl der Verzweiflung hoch.
8. 9 1914 - Der französische Gegenangriff erfolgt
Nancy * Der französische Gegenangriff erfolgt.
8. 9 1914 - Oberstleutnant Richard Hentsch empfiehlt den Rückzug
Marne * Oberstleutnant Richard Hentsch wird im Auftrag der Heeresleitung an die Front an der Marne gesandt, um sich ein Bild über die Situation zu verschaffen. Da er die Gefahr einer Einkesselung erkennt, empfiehlt er den Rückzug der Truppen gerade in einem Moment, in dem die Militärs vor Ort zum entscheidenden Schlag ausholen wollen.
8. 9 1914 - Die bayerische Staatsregierung verlässt ihren Sparkurs
München * Auf Druck der betroffenen Wirtschaftskreise, insbesondere des Baugewerbes, verlässt die bayerische Staatsregierung ihren Sparkurs und ordnet eine Fortführung der Staatsbaumaßnahmen an. Mit Kriegsbeginn hatte der Staat - zur Schonung des von kriegsbedingten Einnahmeausfällen Betroffenen Haushalts - seine Aufträge weitestgehend storniert.
9. 9 1914 - Der deutsche Rückzug an der Marne beginnt
Marne * Die deutschen Truppen werden an der Marne gestoppt und müssen sich in die Stellungen an der Aisne zurückziehen.
11. 9 1914 - Österreichs Truppen ziehen sich aus Galizien zurück
Lemberg * Die österreichischen Truppen müssen sich nach der verlorenen Schlacht von Lemberg aus Galizien zurückziehen.
Ab dem 11. 9 1914 - Die deutschen Truppen werden zurückgedrängt
Westfront * Am 11. und 12. September werden die deutschen Truppen bis hinter die Grenze zurückgedrängt.
11. 9 1914 - Die Schlacht an der Marne ist verloren
Marne * Die Marne-Schlacht ist beendet. 250.000 Tote, Verwundete und Gefangene hat die Schlacht auf deutscher Seite gekostet, rund 300.000 auf alliierter Seite.
Generalstabschef Helmuth von Moltke erleidet einen Nervenzusammenbruch und sieht den Krieg verloren. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine, doch Kaiser Wilhelm II. will einen Siegfrieden und keinen Kompromissfrieden.
11. 9 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (V)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Es gibt kein Volk und kann keins geben, das zivilisiert genug wäre, um zivilisiert Kriege zu führen. Denn der Krieg selbst ist etwas unzivilisiertes.“
13. 9 1914 - Die Schlacht um Nancy ist beendet
Nancy * Die Schlacht um Nancy ist beendet - und zugleich der Plan des Kaiser Wilhelms II. gescheitert. Die Bedeutung der Schlacht um Nancy wurde und wird häufig unterschätzt. Wenn die Stadt gefallen wäre, hätten die Deutschen einen freien Weg nach Paris gehabt. Für manche Analytiker ging die Große Schlacht im Westen nicht an der Marne, sondern bereits in Lothringen verloren.
13. 9 1914 - Der Ausgang der Schlachten wird in Deutschland geheimgehalten
Nancy - Marne * Der Ausgang der Schlachten an der Marne und bei Nancy wird in Deutschland geheimgehalten. In den Zeitungen heißt es lediglich, die Deutschen haben sich aus strategischen Gründen zurückgezogen, einige tausend französische Gefangene gemacht und viele Geschütze erbeutet. Aber es gibt natürlich auch anderslautende Gerüchte.
Bis zum 14. 9 1914 - Die bayerischen Einheiten erleiden große Verluste
Westfront * Die bayerischen Einheiten erleiden z.B. im Angriffsgefecht bei Badonviller, in der Schlacht in Lothringen und den Kämpfen bei Nancy große Verluste.
14. 9 1914 - Erich von Falkenhayn ersetzt Helmuth von Moltke als Generalstabschef
Berlin * Kaiser Wilhelm II. entlässt Helmuth von Moltke als Generalstabschef und ersetzt ihn durch Generalleutnant Erich von Falkenhayn, einen kühlen Karrieristen und skrupellosen Strategen.
Um den 15. 9 1914 - Bereits 17.000 tote bayerische Soldaten an der Westfront
Königreich Bayern - Westfront * Seit Kriegsbeginn sind bereits 17.000 bayerische Soldaten im Kampf an der Westfront gestorben.
15. 9 1914 - Eine Schlacht an den Masurischen Seen
Masurische Seen * Der russische Vormarsch wird mit der Schlacht an den Masurischen Seen in Ostpreußen endgültig gestoppt.
21. 9 1914 - Ein deutsches U-Boot versenkt drei britische Panzerkreuzer
Holland • Ein deutsches U-Boot versenkt vor der niederländischen Küste drei britische Panzerkreuzer.
25. 9 1914 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht nach Charleville-Mézières
Luxemburg - Charleville-Mézières * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht von der ehemaligen Deutschen Botschaft in Luxemburg nach Charleville-Mézières.
26. 9 1914 - Das Oktoberfest fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Eigentlich müsste das Oktoberfest beginnen. Es fällt aber kriegsbedingt aus.
10 1914 - Der neue „Atelierbau“ an der „Villa Stuck“ ist als Rohbau vollendet
München-Haidhausen * Der Rohbau für den neuen „Atelierbau“ an der „Villa Stuck“ ist vollendet.
Danach beginnen die Innenarbeiten.
10. 10 1914 - Weißbrotverbot in Gaststätten
München * Das Bayerische Innenministerium verbietet wegen der Nahrungsmittelknappheit die Abgabe von Weißbrot in Gaststätten.
11. 10 1914 - Bevor Sie ins Feld ziehen, sollten Sie Ihre Stimme verewigen
München * Der geschäftstüchtige Karl Valentin veröffentlicht in den Münchner Neuesten Nachrichten ein Inserat:
„Bevor Sie ins Feld ziehen, sollten Sie Ihre Stimme verewigen.
Eine Aufnahme Mark 10.-. Schönstes Andenken!“
16. 10 1914 - Eine Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches
Berlin * In der Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches heißt es: „Unser Glaube ist, dass für die ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege hängt, den der deutsche ‚Militarismus‘ erkämpfen wird.“
20. 10 1914 - Die erste Flandern-Schlacht beginnt bei Ypern
Ypern * Die erste Flandern-Schlacht beginnt bei Ypern.
23. 10 1914 - Der Konsum von Weizenprodukten wird reduziert
München * Der Konsum von Weizenprodukten wird reduziert.
25. 10 1914 - Das Osmanische Reich tritt in den Krieg ein
Konstantinopel - Berlin - Wien * Das Osmanische Reich tritt an der Seite der Mittelmächte in den Krieg ein.
28. 10 1914 - Der Attentäter Gavrilo Prinzip wird zu 20 Jahren Festungshaft verurteilt
Sarajevo * In Sarajevo wird der Attentäter Gavrilo Princip zu 20 Jahren Festungshaft verurteilt.
Um den 30. 10 1914 - Ein Arbeitsausschuss für Arbeitslosenfürsorge wird eingerichtet
München * Die städtischen Kollegien sehen sich gezwungen, einen Arbeitsausschuss für Arbeitslosenfürsorge einzurichten.
Seit 11 1914 - Versorgungsschwierigkeiten mit Lebensmitteln
Königreich Bayern * In den kleineren Städten Bayerns entstehen erste Lebensmittel-Versorgungsschwierigkeiten.
2. 11 1914 - Russland erklärt der Türkei den Krieg
Petersburg - Konstantinopel * Russland erklärt der Türkei den Krieg.
2. 11 1914 - Großbritannien verhängt eine Seeblockade gegen das Deutsche Reich
London - Berlin * England verhängt eine Seeblockade gegen das Deutsche Reich. Großbritannien erklärt die Nordsee zum Kriegsgebiet.
4. 11 1914 - In der Schlacht bei Tanga erleidet Großbritannien eine Niederlage
Tanga * In der Schlacht bei Tanga [Deutsch-Ostafrika, heute: Tansania] erleidet die aus über 4.000 Inder bestehende Armee Großbritanniens eine Niederlage.
5. 11 1914 - Großbritannien erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg
London - Konstantinopel * Großbritannien erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg.
6. 11 1914 - Frankreich erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg
Paris - Konstantinopel * Frankreich erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg.
7. 11 1914 - Belgien und Serbien erklären der Türkei den Krieg
Brüssel - Belgrad - Konstantinopel * Belgien und Serbien erklären der Türkei den Krieg.
7. 11 1914 - Japan erobert die deutsche Kolonie Tsingtau in China
Tsingtau * Die deutsche Kolonie Tsingtau in China muss vor den Japanern kapitulieren.
10. 11 1914 - Singend gegen feindliche Stellungen ?
Ypern * In der Nähe der belgischen Stadt Ypern liegen die neu aufgestellten deutschen Reservekorps, darunter viele unerfahrene junge Kriegsfreiwillige.
Um halb sieben Uhr verlassen die Soldaten auf ein Signal hin ihre Gräben und bahnen sich mit aufgepflanzten Bajonetten mühsam einen Weg durch die aufgeweichten Rübenäcker, um die nächste Hügelkette zu erstürmen.
Der Angriff ist ein Himmelfahrtskommando. Eine dilettantisch agierende Führung lässt die jungen, unerfahrenen Soldaten ohne Drahtscheren und mit zu wenig Munition gegen den Feind anstürmen. Dort werden sie von erfahrenen britischen Truppen mit Maschinengewehren niedergemäht.
10. 11 1914 - Aus einem verunglückten Angriff wird ein Mythos gemacht
Berlin - Langemarck - Ypern * Die Oberste Heeresleitung - OHL macht aus einem verunglückten Angriff einen Mythos: „Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange ‚Deutschland, Deutschland über alles’ gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie.“
Dabei stimmt nicht einmal der Name der Ortschaft, denn das Dorf Langemarck liegt weiter weg, klingt aber markant und teutonisch, und auf jeden Fall besser als Bixschote oder Ypern.
Gesungen haben die Soldaten bestimmt nicht. Sie mussten mit ihrer 30 Kilo schweren Ausrüstung über den nassen schweren Lehmboden rennen und fühlten sich zu Recht als Kanonenfutter.
24. 11 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (VI)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch:
„Blut - Blut - Blut. Die ganze Erde ist eine Schlachthalle geworden.“
30. 11 1914 - 50.000 Münchner werden dauernd unterstützt
München * Im November 1914 werden 50.000 Personen beziehungsweise Familien vom Wohlfahrtsausschuss, von den Stiftungsverwaltungen und von der Armenpflege dauernd unterstützt.
2. 12 1914 - Karl Liebknecht verweigert sich den Kriegskrediten
Berlin * Der Sozialdemokrat Karl Liebknecht verweigert als erster und einziger Abgeordneter seine Zustimmung zu weiteren Kriegskrediten.
7. 12 1914 - König Ludwig III. fordert Gebietszuwächse für Bayern
München * König Ludwig III. fordert in einem Brief an Kronprinz Rupprecht,
- „dass Bayern eine wesentliche Gebietsvergrößerung erhält, nämlich Gebiete aus den bisherigen Reichslanden [= Elsass-Lothringen], aus Belgien und aus dem von Frankreich abzutretenden Territorium, je mehr je lieber.“
- Belgien muss „in das Deutsche Reich einverleibt werden“, zumindest „als selbstständiger Staat zu bestehen aufhören“.
Kein deutscher Bundesfürst erhebt gegen diese Kriegsziele einen Einwand, wohl aber gegen eine einseitige Begünstigung Bayerns.
13. 12 1914 - Liesl Karlstadt's Vater stirbt
München * Einen Tag nach Elisabeth Wellanos 22. Geburtstag stirbt ihr Vater.
13. 12 1914 - Neuwahl des Münchner Magistrats
München * Der Münchner Magistrat wird gewählt.
- Die 20 bürgerlichen Magistratsräte gehören folgenden Parteien an: Liberale Partei 8, Sozialdemokratische Partei 7, Zentrum 5.
- Die 60 Gemeindebevollmächtigten setzen sich zusammen aus: Sozialdemokratische Partei 22, Liberale Partei 18, Zentrum 17, Haus- und Grundbesitzer 3.
Oberbürgermeister bleibt Dr. Wilhelm von Borscht. II. rechtskundiger Bürgermeister wird Dr. Otto Merkt. Die Wahlperiode dauert drei Jahre.
24. 12 1914 - Der kurze Weihnachtsfrieden
Westfront * Deutsche und britische Soldaten verbrüdern sich - für wenige Stunden - beim sogenannten Weihnachtsfrieden.
25. 12 1914 - Kriegsweihnacht I
Straßburg * Die Straßburger Post schreibt in nationalistisch gefärbten Worten:
„Aus grauer Vorzeit bis auf den heutigen Tag hat sich an die Weihnacht der Begriff des Friedens und der Liebe geknüpft, und sie ist das eigentliche Fest der Deutschen geworden. […] Mit dem Schicksal, das über uns gekommen ist, ist auch unser weihnachtlicher Festeswille noch höher gewachsen. […]
Die Not, die uns bedrückt, ist eine gemeinsame. […] Darum ist die Weihnacht, die wir in diesem Jahr begehen, kein Fest der Familie mehr. […] Die Weihnacht von 1914 ist die hehrste von allen, […] weil auf die Liebe […] alle ein Anrecht besitzen, die in diesen Tagen sich zu unserem Volke bekannt haben.“
25. 12 1914 - In den Staub mit allen Feinden Deutschlands. Amen.
Luxemburg - Charleville-Mézières * Kaiser Wilhelm II. äußert seine Weihnachtswünsche an das deutsche Volk aus dem sich in Luxemburg befindlichen Großen Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL in Charleville-Mézières.
Der Kaiser will das Weihnachtsfest im Kreise seiner Militärs begehen. Seine Ansprache vor dem Weihnachtsbaum beschließt er mit einer Variation des Satzes des preußischen Dichters Heinrich von Kleist, mit dem sein Drama „Der Prinz von Homburg“ schließt: „In den Staub mit allen Feinden Deutschlands. Amen.“
25. 12 1914 - Das Proletariat und die Kriegsweihnacht
Wien * Die Wiener Arbeiterzeitung schreibt: „Das Proletariat hat noch nie von Herzen frohe Weihnachten feiern können.“
31. 12 1914 - Mehr als 1.800 Münchner sind bereits „gefallen“
München * Bereits mehr als 1.800 Münchner sind in dem bisher fünf Monate dauernden Krieg „gefallen“.
31. 12 1914 - Erich Mühsam und der Krieg (VII)
München * Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Der letzte Tag dieses fürchterlichen Jahres. Was aber vor uns liegt, ist grau und schrecklich.“
1915 - Die „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41
München-Maxvorstadt * Die „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41 gehört einer „Öffentlichen Anstalt für Volks- und Lebensversicherungen“.
1915 - Die „Cenovis-Werke“, eine „Nahrungsmittelfirma“, werden gegründet
München-Au * Aus der „Münchner Hefeverwertungs-Gesellschaft“ gehen die „Cenovis-Werke“, eine „Nahrungsmittelfirma“, hervor.
„Generaldirektor“ ist der jüngere Sohn des „Unionsbrauerei-Gründers“, Julius Schülein.
„Cenovis" bezeichnet eine „eiweißreiche Kraftnahrung“.
Der Firmenname setzt sich zusammen aus „cena“ = die Mahlzeit, „ovum“ = das Ei und „vis“ = die Kraft.
Die „Cenovis-Werke“ übernehmen die Brauereigebäude der „Münchner-Kindl-Brauerei“ an der Rosenheimer Straße.
1915 - Dr. Fritz Gerlich schreibt für die „Süddeutschen Monatshefte“
München * Dr. Fritz Gerlich schreibt für die „Süddeutschen Monatshefte“ von Professor Paul Nicolaus Cossmann.
Seit Frühjahr ??? 1915 - Kurt Eisner: Das Deutsche Reich trägt die Hauptschuld am Ersten Weltkrieg
München * Kurt Eisner ist davon überzeugt, dass das Deutsche Reich die Hauptschuld am Ersten Weltkrieg trägt.
Anfang 1915 - Lena Christ's Roman „Rumplhanni“ beschreibt den Kriegsbeginn
München * Lena Christ beschreibt in ihrem im Jahr 1916 erschienenen Roman „Rumplhanni“ den Kriegsbeginn auf dem Lande:
„[...] Kein Platz ist mehr zum Sitzen; die Bauern haben den Herrgottswinkel und das Ofeneck ausgefüllt, und an den übrigen Tischen hocken die Jüngeren und die Dienstigen.
Man redet vom Krieg. Und der eine meint: „Jano; s‘Belgien ham mir scho. s‘Frankreich ham mir aa scho glei; Paris kriagn man auf d‘Woch und s‘Rußland aufn Kirta.
Bis Allerheiling ham mir nachher an Engländer umbracht, und z‘Weihnachten sauf i mir mein Friedensrausch o.‘ -
‚Wenn dir der Italiener net ‘s Krüagl aus der Hand haut, deiweil!‘ meint der Meßmer von Niklasreuth; ‚woaßt, den Schlawiner tat i scheucha!‘
Aber, was!? Den Katzlmacha!‘ heißt‘s da; ‚den Polentafresser! Den Maronibruada möchst ferchten! Was willst denn! Was will denn der macha! Hat Ja grad oa Loch, wo er außi kann, der Italiener!‘ -
‚Und dees is zuapitschiert!‘ meint der Hauser. ‚Dees ham eahm d‘Östeireicher a so verpappt, daß er a Jahr braucht, bis er si durchefrißt!‘ Und so wird weiter disputiert und politisiert, bis Jeder voll ist und jeder genug hat [..]“.
Und solange die militärischen Erfolge Bestand haben, kann der sogenannte „Burgfrieden“ in der Arbeiterschaft auch weiterhin erhalten bleiben.
1915 - In Bayern wird eine „Landespreisstelle“ eingerichtet
München * In Bayern wird eine „Landespreisstelle“ eingerichtet.
Sie legt die Zuteilungen und die Höchstpreisbegrenzungen für rüstungswichtige Rohstoffe und Lebensmittel fest.
1915 - Die „Bayerischen Geschützwerke Fried. Krupp KG“ entstehen
Freimann * In Freimann entstehen die „Bayerischen Geschützwerke Fried. Krupp KG“ als Zweigstelle des „Krupp-Werkes“ in Essen.
Herbst ??? 1915 - Zwei bayerische „Schneeschuhbataillone“ in den Karpaten-Kämpfen
Karpaten - Ostfront * Bei den Kämpfen in den Karpaten kommen zwei bayerische „Schneeschuhbataillone“ zum Einsatz.
Auch an dieser Front rennen sich die deutschen Truppen fest.
Der entscheidende Durchbruch wird jedoch verfehlt.
1915 - Das „Panorama“ an der Theresienhöhe 2a brennt ab
München-Ludwigsvorstadt * Das „Panorama“ an der Theresienhöhe 2a brennt ab.
1915 - Das Kino wird durch Prinzregent Ludwig III. Kino „hoffähig“
München-Hackenviertel * Prinzregent Ludwig III. wird mit seiner Gattin Maria Theresia bei ihrem Kinobesuch in Carl Gabriels „Sendlingertor-Lichtspielen“ gefilmt.
Seither ist das Kino „hoffähig“.
1915 - Das „Karl-Valentin-Geburtshaus“ erhält einen Balkon
München-Au * Ludwig Weinberger sen. lässt an der ehemaligen Wohnung der Familie Fey im „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der Zeppelinstraße 41 einen Balkon anbringen.
Der Hof wird teilweise überdeckt.
1915 - Zwischen 60 und 70 Filialen auf Münchner Stadtgebiet
München * Die beiden Konsumvereine betreiben zusammen zwischen 60 und 70 Filialen auf Münchner Stadtgebiet.
32,1 Prozent der Münchner sind Mitglied in einer Konsumgenossenschaft.
1915 - In Dresden wird der Deutsche Seidenbauverband gegründet
Dresden * In Dresden wird der Deutsche Seidenbauverband gegründet. In seinem Leitfaden für die deutsche Seidenraupenzucht stellt er - den früheren Misserfolgen zum Trotz - fest:
- Der Maulbeerbaum gedeiht in Deutschland vorzüglich.
- Die damit gezüchteten Raupen liefern eine wertvolle Seide.
In einem Punkt unterscheidet sich der Deutsche Seidenbauverband dann aber doch von der früheren Euphorie, indem er feststellt, dass der Seidenbau keinesfalls eine „glänzende und gewinnbringende Erwerbsquelle für weite Volkskreise“ sein wird. Im Gegenteil, die Seidenraupenzucht muss als Liebhaberei und Nebenerwerb gesehen werden, ähnlich wie die Bienenzucht.
1915 - Eine Ortsgruppe München des Deutschen Seidenbauverbandes gegründet
München * Auch in München wird eine Ortsgruppe des Deutschen Seidenbauverbandes gegründet. In einem gemeinsamen Flugblatt wird dazu aufgerufen, die Seidenzucht als Nebenerwerb für Kriegsinvalide zu fördern. Denn: „Es ist die Ehrenpflicht des deutschen Volkes, nun mit allen Kräften für die bedauernswerten Opfer des blutigen Ringens um unsere Freiheit und Kultur zu sorgen“.
Auch Zeitungsartikel und weitere Flugschriften werben für den Seidenbau und für die notwendige Geduld, denn „die Kartoffel hat anderthalb Jahrhunderte gebraucht, um all die törichten Vorurteile des Volkes gegen dies billigste und gesunde Nahrungsmittel zu überwinden“.
1 1915 - Die Bäcker müssen dem Brot ein Drittel Roggenmehl beifügen
München * Die Bäcker müssen dem Brot ein Drittel Roggenmehl beifügen.
19. 1 1915 - Zeppelin-Flugschiffe greifen erstmals Großbritannien an
Great Yarmouth - King's Lynn * Mit der Bombardierung der ostenglischen Städte Great Yarmouth und King‘s Lynn durch deutsche Zeppelin-Luftschiffe beginnen die regelmäßigen Luftangriffe auf Großbritannien. Es kommen vier Zivilisten ums Leben.
23. 1 1915 - Die Karpaten-Offensive beginnt
Karpaten - Ostfront * Die deutsch-österreichisch-ungarische Offensive in den Karpaten beginnt. Sehr zum Ärger des österreichischen Generalstabschefs Conrad von Hötzendorf wird die Offensive durch den deutschen General Alexander von Lisingen geleitet.
Die Russen belagern die k.u.k.-Festung Przemyśl, wo 130.000 Soldaten und 30.000 Zivilisten eingeschlossen und vom Hungertod bedroht sind. Bis Ende April 1915 wird die k.u.k.-Armee rund 800.000 Mann verlieren [Tote, Verwundete, Vermisste und Gefangene].
25. 1 1915 - Die Brotkarte wird eingeführt
Berlin * In Deutschland wird die „Brotkarte“ eingeführt und damit die Versorgung mit Brot rationiert. Weitere Lebensmittelkarten werden folgen.
2. 2 1915 - Faschingstreiben und Starkbierausschank passen nicht zum Krieg
München * Das Stellvertretende Generalkommando gibt folgende Bekanntmachung heraus: „Faschingstreiben und Starkbierausschank in der im Frieden üblichen Weise passen nicht in unsere Zeit. Ich bestimme deshalb auf Grund des Kriegszustandsgesetzes:
- Faschingstreiben: Während des diesjährigen Faschings ist Faschingstreiben jeder Art, sowie der Verkauf von Karnevalsartikeln auf öffentlichen Plätzen und Straßen und in Wirthschaften, Kaffeehäusern usw. untersagt.
- Starkbierausschank: Der bisher übliche Sonderausschank von Starkbier darf nur im gewöhnlichen Schankbetrieb und in den diesem Betrieb dienenden Räumen ausgeschenkt werden. Konzerte, Volksgesänge und sonstige Belustigungen sowie der Verkauf von Scherzartikeln sind hiebei verboten“.
4. 2 1915 - Gewässer um Großbritannien zum Kriegsgebiet erklärt
Berlin - London * Das Deutsche Reich erklärt die Gewässer rings um Großbritannien zum Kriegsgebiet.
7. 2 1915 - Die „Winterschlacht von Masuren“ beginnt
Masuren - Ostfront * Deutsche Truppen beginnen an der „Ostfront“ die „Winterschlacht von Masuren“.
8. 2 1915 - Der amerikanische Ku-Klux-Klan wird neu gegründet
<p><em><strong>USA</strong></em> * Der amerikanische Ku-Klux-Klan wird als Massenorganisation neu gegründet. </p>
16. 2 1915 - Beginn einer britisch-französischen Großoffensive
Reims * Beginn einer britisch-französischen Großoffensive in der Champagne, die Ende März ergebnislos abgebrochen wird.
18. 2 1915 - Rosa Luxemburg muss ihre einjährige Haftstrafe antreten
Berlin * Rosa Luxemburg muss in Berlin eine einjährige Haftstrafe im Berliner Frauengefängnis in der Barnimstraße 10 antreten, zu der sie am 14. April 1914 verurteilt worden war.
22. 2 1915 - Den uneingeschränkten U-Boot-Krieg befohlen
Atlantik * Die deutsche Reichsregierung befiehlt den uneingeschränkten U-Boot-Krieges gegen Handelsschiffe Krieg führender und neutraler Staaten, die sich in diesem Bereich aufhalten.
27. 2 1915 - Die Russen ziehen sich endgültig aus Ostpreußen zurück
Masuren * Nach der Winterschlacht in Masuren ziehen sich die Russen endgültig aus Ostpreußen zurück.
Seit etwa ??? 3 1915 - Bayerische Soldaten werden an allen Kriegsfronten eingesetzt
Westfront - Ostfront * Bayerische Soldaten werden an allen Kriegsfronten eingesetzt.
20. 3 1915 - SPD-Gegenstimmen für den Kriegskredit
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die SPD-Abgeordneten Karl Liebknecht und Otto Rühle stimmen im Reichstag gegen den Etat und einen neuen Kriegskredit. Weitere 30 SPD-ler vermeiden die Abstimmung durch Verlassen des Sitzungssaales, darunter der SPD-Vorsitzende Hugo Haase. </p>
22. 3 1915 - Österreichisch-ungarische Kapitulation in Przemysl in Galizien
Przemysl - Ostfront * In Przemysl in Galizien kapitulieren die österreich-ungarischen Truppen vor den russischen Streitkräften.
28. 3 1915 - Ein U-Boot versenkt den britischen Passagierdampfer „Falaba“
Wales * Ein deutsches U-Boot versenkt vor der Küste von Wales den britischen Passagierdampfer „Falaba“. 104 Menschen ertrinken.
4 1915 - Ludwig Thoma als „Freiwilliger“ zum „Sanitätsdienst“ an der „Westfront“
Westfront * Ludwig Thoma hat sich als „Freiwilliger“ zum Dienst als „Sanitäter“ an der „Westfront“, später an der „Ostfront“ verpflichtet.
4 1915 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht ins oberschlesische Schloss Pleß
Charleville-Mézières - Pleß * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht von Charleville-Mézières in das Schloss Pleß in Oberschlesien.
3. 4 1915 - Italien kündigt den Dreibund auf
Rom * Italien kündigt den Dreibund mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn auf.
10. 4 1915 - Das Internationale Olympische Comitee verlegt seinen Sitz
<p><em><strong>Paris - Lausanne</strong></em> * Das Internationale Olympische Comitee verlegt - wegen der anhaltenden Kriegshandlungen - ihren Sitz von Paris nach Lausanne, in der neutralen Schweiz. </p>
13. 4 1915 - Der Lebensstandard der Kriegerfrauen verschlechtert sich
<p><em><strong>München</strong></em> * In der Magistratssitzung wird erklärt, dass die Kriegerfrauen sich von Woche zu Woche in einer unangenehmeren Situation befinden, weil die Mittel, die ihnen zugewiesen werden, nicht mehr den Wert repräsentieren, den sie haben sollen, um kaufen zu können, was sie notwendig brauchen. </p>
22. 4 1915 - Die Deutschen verwenden bei der „Schlacht von Ypern“ erstmals Giftgas
Ypern - Westfront * Die Deutschen verwenden bei der „Schlacht von Ypern“ erstmals Giftgas.
26. 4 1915 - Italien verbündet sich mit Frankreich, Großbritannien und Russland
Rom - Paris - London - Petersburg * Italien verbündet sich mit Frankreich, Großbritannien und Russland gegen die „Mittelmächte“ Deutschland und Österreich-Ungarn.
Die „Entente“ hat Italien in dem geheim gehaltenen „Londoner Vertrag“ bei Kriegsende große Gebietsgewinne in Aussicht gestellt.
Der „Gebirgskrieg“ an der „Italienfront“ beginnt.
28. 4 1915 - In Den Haag beginnt der Internationale Frauenfriedenskongress
Den Haag * Angeregt von Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann und Aletta Jacobs beginnt in Den Haag der Internationale Frauenfriedenskongress.
5 1915 - Die Lebensmittelpreise sind seit August 1914 um 31 Prozent gestiegen
München * Die Lebensmittelpreise sind seit August 1914 um 31 Prozent gestiegen.
1. 5 1915 - Die „Mittelmächte“ starten Angriffe an der Ostfront
Berlin - Wien * Die „Mittelmächte“ (Deutsches Reich und Österreich-Ungarn) starten Angriffe an der Ostfront.
5. 5 1915 - Die russischen Stellungen bei Gorlice-Tarnów fallen
Gorlice-Tarnów - Ostfront * Die Truppen der „Mittelmächte“ durchbrechen - unterstützt von der „11. Bayerischen Division“ - die russischen Stellungen bei Gorlice-Tarnów.
7. 5 1915 - Ein deutsches U-Boot versenkt den Passagierdampfer Lusitania
Irland * Ein deutsches U-Boot versenkt vor der Südküste Irlands den britischen Passagierdampfer „Lusitania“. In nur 18 Minuten sinkt das Schiff. 1.198 Menschen sterben, darunter 128 US-Amerikaner. Nur 761 Passagiere können gerettet werden. Amerikanische Proteste bewirken die vorübergehende Einstellung des Uneingeschränkten-Boot-Krieges des Deutschen Reichs.
9. 5 1915 - Die Grundsteinlegung für die St. Wolfgangskirche
München-Au * In Gegenwart von König Ludwig III. findet die Grundsteinlegung für die St.-Wolfgangskirche statt.
10. 5 1915 - Lion und Marta Feuchtwanger ziehen in die Thierschstraße 14
München-Lehel * Lion und Marta Feuchtwanger ziehen in die Thierschstraße 14/IV.
10. 5 1915 - Durchbruchsschlacht von Gorlice-Tarnów
Gorlice - Tarnów * Durchbruchsschlacht von Gorlice-Tarnów.
23. 5 1915 - Italien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg
Rom - Wien * Italien erklärt Österreich-Ungarn den Krieg und tritt als Verbündeter der Entente in die Kampfhandlungen ein.
27. 5 1915 - Deportationsgesetz gegen die Armenier verabschiedet
Konstantinopel * Das türkische Parlament verabschiedet ein Deportationsgesetz gegen die Armenier. Die Umsiedlungskampagne wird zum Tod von 600.000 bis 1.800.000 Zivilisten führen und wird als Völkermord an den Armeniern bezeichnet. Das Gesetz tritt am 1. Juni 1915 in Kraft und gilt bis zum 8. Februar 1916.
??? 6 1915 - Die Erstürmung der „Festung Przemysl“ in Galizien
Przemysl - Ostfront * Die Regimenter des „II. Reservekorps der bayerischen Armee“ erstürmen die „Festung Przemysl“ in Galizien.
1. 6 1915 - Valentin/Karlstadt übernehmen die Direktion des Kabarett Wien-München
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin und Liesl Karlstadt übernehmen gemeinsam die Direktion des Kabarett Wien-München im Hotel Wagner in der Sonnenstraße. Das Engagement dauert bis 15. Dezember 1916. Das sind fast eineinhalb Jahre.
6. 6 1915 - König Ludwig III. fordert einen deutschen Zugang vom Rhein zum Meer
Nürnberg * König Ludwig III. fordert in seiner sogenannten „Kanalrede“ - vor dem im Jahr 1891 gegründeten Bayerischen Kanalverein - als Kriegsziel für das Deutsche Reich einen „direkten Ausgang vom Rhein zum Meer“.
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg befürchtet durch diese offen vorgetragene Annexionspolitik des bayerischen Königs eine Verärgerung des neutralen Holland, weshalb die Forderung in der Veröffentlichung der Bayerischen Staatszeitung abgeschwächt wird.
8. 6 1915 - Die Kanalrede König Ludwigs III. in abgeschwächter Form
Berlin * Auf Druck der Reichsregierung unter Theobald von Bethmann Hollweg wird die Kanalrede von König Ludwig III. nur in abgeschwächter Form abgedruckt. Forderte der Bayernkönig zwei Tage zuvor noch als Kriegsziel „einen deutschen Zugang vom Rhein zum Meer“, so ist jetzt nur mehr von einer „günstigeren Wasserstraßenverbindung von Mittel- und Süddeutschland zum Meer“ die Rede.
Reichskanzler Bethmann Hollweg hat eine Verärgerung des neutralen Holland durch die königlichen Annexionspläne befürchtet.
16. 6 1915 - Ludwig III. über die Flaumacherei und Schlappheit verärgert
München - Berlin * König Ludwig III. teilt Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg mit, er sei „scharf verstimmt“ über die „Flaumacherei und Schlappheit“ der deutschen Außenpolitik. Man soll in Berlin keinesfalls seine Energie und Willenskraft in der Annexionsfrage unterschätzen.
17. 6 1915 - Gisela Fey ist bis 2. Mai 1916 an einem anderen Wohnort gemeldet
München * Karl Valentins Ehefrau Gisela Fey ist bis 2. Mai 1916 an einem anderen Wohnort gemeldet.
19. 6 1915 - SPD-Politiker veröffentlichen ein Manifest gegen den Krieg
Leipzig * Die SPD-Politiker Hugo Haase, Eduard Bernstein und Karl Kautsky veröffentlichen in der Leipziger Volkszeitung ein Manifest gegen den Krieg. Daraufhin wird das Erscheinen der Zeitung für mehrere Tage verboten.
20. 6 1915 - Professoren und Intellektuelle verlangen eine neue Kriegszielpolitik
Berlin * In der sogenannten „Intellektuellen-Denkschrift“ verlangen zahlreiche Professoren und Intellektuelle - darunter 136 Bayern - eine Kriegszielpolitik, die dem Deutschen Reich Industriegebiete im Westen und Siedlungsland im Osten bringt.
23. 6 1915 - Die erste Isonzo-Schlacht beginnt
Isonzo-Schlacht * Die erste Isonzo-Schlacht zwischen Italien und Österreich-Ungarn beginnt.
26. 6 1915 - König Ludwig III. zum preußischen Generalfeldmarschall ernannt
Berlin - München * Kaiser Wilhelm II. ernennt Bayerns König Ludwig III. zum preußischen Generalfeldmarschall.
4. 7 1915 - Titel ohne Mittel
Lille - München * In Hinblick auf die Ernennung seines Vaters, König Ludwig III., zum preußischen Generalfeldmarschall schreibt ihm Kronprinz Rupprecht aus seinem Kriegsstandort in Lille die Zeilen:
„Auszeichnungen sind billiger wie irgendwelche sachlichen Zugeständnisse und es dünkt mir, wie wenn an maßgebender Stelle ein immer schärferer unitaristischer [= Stärkung der Zentralmacht] oder vielmehr preußischer Wind wehe.“
9. 7 1915 - Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika kapituliert
Deutsch-Südwestafrika * Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika kapituliert vor den Südafrikanern.
13. 7 1915 - Die erste Moschee auf deutschem Boden wird eingeweiht
Wünsdorf * Am Beginn des islamischen Ramadans wird in Wünsdorf nahe Berlin die erste Moschee auf deutschem Boden feierlich eingeweiht.
15. 7 1915 - Handgranatenwerfen als neue Sportdisziplin
Hamburg * Beim Sportfest des Hamburger Leichtathletikverbandes wird Handgranatenwerfen als neue Sportdisziplin eingeführt.
??? 8 1915 - Liesl Karlstadt tritt als „chinesischer Salonkomiker“ auf
München * Liesl Karlstadt tritt als „chinesischer Salonkomiker“ auf.
„Mantsche, Mantsche, Pantsche ...“.
5. 8 1915 - Die Mittelmächte erobern Warschau
Warschau * Die Armeen der Mittelmächte erobern Warschau.
14. 8 1915 - Ein deutsches U-Boot versenkt britisches Truppentransportschiff
Ägäis * Ein deutsches U-Boot versenkt in der Ägäis das mit 1.700 Mann besetzte englische Truppentransportschiff Royal Edward.
19. 8 1915 - Deutsches U-Boot versenkt das britische Passagierschiff Arabic
Irische Küste * Ein deutsches U-Boot versenkt das britische Passagierschiff Arabic.
20. 8 1915 - Italien erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg
Rom - Konstantinopel * Italien erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg.
5. 9 1915 - Zar Nikolaus II. übernimmt den Oberbefehl
Mogilew * Zar Nikolaus II. übernimmt den Oberbefehl über die russischen Streitkräfte aufgrund
- der militärischen Niederlagen,
- der Versorgungsnot im Reich,
- der Arbeiteraufstände und
- der Meutereien der Soldaten.
6. 9 1915 - Franz Josef Strauß wird in München geboren
München * Franz Josef Strauß, der spätere Bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, wird in München geboren.
6. 9 1915 - Bulgarien verbündet sich mit den Mittelmächten
Sofia * Bulgarien verbündet sich mit den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn. Der bulgarische König Ferdinand I. erhofft sich dadurch nach dem Krieg Gebietszuwächse.
11. 9 1915 - Deutsche Zeppelin-Luftschiffe bombardieren London
London * Deutsche Zeppelin-Luftschiffe bombardieren London.
14. 9 1915 - Das Osmanische Reich tritt den Mittelmächten bei
Konstantinopel - Berlin - Wien * Das Osmanische Reich tritt den Mittelmächten bei.
18. 9 1915 - Deutsche Truppen erobern die litauische Stadt Wilna
Wilna * Deutsche Truppen können die litauische Stadt Wilna erobern.
18. 9 1915 - Einschränkung des deutschen U-Boot-Handelskriegs
Atlantik * Einschränkung des deutschen U-Boot-Handelskriegs.
22. 9 1915 - Herbstoffensive der Entente in der Champagne
Champagne • Herbstoffensive der Entente in der Champagne, die nach sechs Wochen abgebrochen wird.
25. 9 1915 - Das Oktoberfest fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Eigentlich müsste das Oktoberfest beginnen. Es fällt diese Jahr aber erneut kriegsbedingt aus.
30. 9 1915 - Russland muss sich zurückziehen
Ostfront * Nach den im Frühsommer begonnenen deutsch-österreichischen Offensiven müssen sich die russischen Truppen aus Polen, Litauen und großen Teilen Kurlands zurückziehen.
Um ??? 10 1915 - Das „Deutsche Alpenkorps“ wird gebildet
Tirol * Um die österreichische Front in Tirol gegen Italien zu verstärken, wird aus dem „Bayerischen Leibregiment“, einem „Gebirgsjägerregiment“ und zwei „Jägerregimenter“ das „Deutsche Alpenkorps“ gebildet.
10 1915 - Unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln
München * Die schlechte Ernte verschärft die unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln.
8. 10 1915 - Die serbische Hauptstadt Belgrad wird erobert
Belgrad * Deutsche und österreichisch-ungarische Truppen erobern die serbische Hauptstadt Belgrad.
9. 10 1915 - Österreich-Ungarn erobert Belgrad zurück
Belgrad * Die österreichisch-ungarische Armee erobert die serbische Hauptstadt Belgrad zurück.
10. 10 1915 - Die Butterkrawalle in Chemnitz beginnen
Chemnitz * Mit den sogenannten Butterkrawallen beginnt in Chemnitz die erste größere Antikriegsbewegung.
23. 10 1915 - Ein britisches U-Boot versenkt die Prinz Adalbert
Libau * Ein britisches U-Boot versenkt das deutsche Kriegsschiff Prinz Adalbert mit 672 Mann Besatzung. Nur drei Überlebende werden gezählt.
11 1915 - Aktivitäten „pazifistischer Gruppen“ und der „Frauenbewegung“
München * Das „Bayerische Kriegsministerium“ macht die Regierung auf Aktivitäten „pazifistischer Gruppen“ und auf die „Frauenbewegung“ aufmerksam.
Ende 11 1915 - Ganz Serbien wird von den Truppen der Mittelstaaten erobert
Serbien * Deutsche, österreichisch-ungarische und bulgarische Truppen erobern ganz Serbien.
16. 11 1915 - Die Coca-Cola-Flasche wird patentiert
USA * Die Coca-Cola-Flasche wird patentiert.
25. 11 1915 - Albert Einstein trägt seine Relativitätstheorie vor
Berlin * Albert Einstein trägt in der Preußischen Akademie der Wissenschaften den Kern seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vor.
12 1915 - Das Michael-von-Faulhaber-Buch: „Der Krieg im Lichte des Evangeliums“
München-Kreuzviertel * Michael von Faulhaber schreibt ein Büchlein mit dem Titel „Der Krieg im Lichte des Evangeliums“. Darin vertritt er Thesen wie:
- „Der Krieg ist nicht das allergrößte Übel“ oder
- „Eisenpillen bringen Blutvermehrung“ oder
- „Das Thomaswort: ‚Lasst uns gehen und mit ihm sterben‘ bleibt der schönste Fahneneid“.
12 1915 - Mata Hari wird erstmals von den Briten festgehalten
Folkstone * „Mata Hari“ wird erstmals von den Briten festgehalten, als sie sich in Folkestone in Südengland nach Frankreich einschiffen will.
Bei den britischen Beamten hinterlässt sie einen „ungünstigen Eindruck“. Man traut dieser „schönen, verwegenen und modisch gekleideten“ Frau prinzipiell alles zu, weshalb sie der „Geheimdienst“ im Auge behält.
4. 12 1915 - Premiere der „Schau- & Sturzflüge im Zuschauerraum“
München-Ludwigsvorstadt * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Schau- & Sturzflüge im Zuschauerraum“ im Kabarett Wien-München im Hotel Wagner in der Sonnenstraße 23. Das Stück wird 98 mal aufgeführt.
Um den 5. 12 1915 - Projektionen von Karl Valentins „Komischen Lichtbildern“
München-Ludwigsvorstadt * Erste Projektionen von Karl Valentins „Komischen Lichtbildern“ im Frankfurter Hof, Schillerstraße 49.
21. 12 1915 - 18 SPD-Reichstagsabgeordnete votieren gegen weitere Kriegskredite
Berlin * 18 SPD-Reichstagsabgeordnete votieren im Reichstag - gemeinsam mit Karl Liebknecht und Otto Rühle und der SPD-Vorsitzende Hugo Haase - gegen weitere Kriegskredite und handeln damit erstmals gegen die restliche SPD-Fraktion. Weitere 22 Kriegsgegner verlassen vor der Abstimmung den Sitzungssaal.
Um den 24. 12 1915 - „Von Frauen an Frauen! - Wir wollen Frieden! Frieden für alle!“
München-Au - München-Giesing * In der Au und in Giesing tauchen anonyme Flugblätter mit folgendem Inhalt auf:
- „Von Frauen an Frauen!
Wir wollen nicht länger zusehen, wie man unsere Männer und Söhne hinschlachtet.
Wir wollen Frieden! Frieden für alle!“
30. 12 1915 - Ein deutsches U-Boot torpediert das britische Passagierschiff Persia
Kreta * Vor Kreta torpediert ein deutsches U-Boot das britische Passagierschiff Persia. Dabei sterben 343 Menschen.
1916 - Die Münchner können ihren Durst in 120 „Weinwirtschaften“ stillen
München * Die Münchner Weintrinker können ihren Durst in 120 „Weinwirtschaften“ stillen.
1916 - Die Firma „Münchner Möbelheim, vormals Falk & Fey“
München-Neuhausen * Umbenennung der „Firma Falk & Fey“ in „Münchner Möbelheim, vormals Falk & Fey“.
1916 - Joseph Schülein erwirbt die „Brauerei Kaltenberg“.
Kaltenberg * Joseph Schülein erwirbt die „Brauerei Kaltenberg“.
1916 - Ludwig und Rosa Rank wohnen in der Richard-Wagner-Straße 17
München-Maxvorstadt * Ludwig und Rosa Rank wohnen im 3. Stock der Richard-Wagner-Straße 17.
1916 - Emil Zeckendorf wird „Honorarkonsul“
München-Maxvorstadt * Emil Zeckendorf, Eigentümer der Richard-Wagner-Straße 11, wird „Honorarkonsul“.
1916 - Dr. Fritz Gerlich ist Mitbegründer der „U-Boot-Bewegung“
München * Dr. Fritz Gerlich ist Mitbegründer der sogenannten „U-Boot-Bewegung“.
1916 - Oskar Richard Moler übernimmt das „Gabriels Lichtspieltheater“
München-Au * Oskar Richard Moler übernimmt von Carl Gabriel das inzwischen in „Gabriels Lichtspieltheater“ umbenannte Kino an der Lilienstraße 2.
Ab 1916 - Lion Feuchtwanger arbeitet an dem Bühnenstück „Jud Süß“
München * Lion Feuchtwanger arbeitet an dem Bühnenstück „Jud Süß“.
1916 - An die Einwohner Münchens werden „Lebensmittelkarten“ ausgegeben
München * An die Einwohner Münchens werden „Milch-, Fleisch- und Zuckerkarten“ ausgegeben.
1916 - Die „Sommerzeit“ wird im gesamten „Deutschen Reich“ eingeführt
Berlin * Die „Sommerzeit“ wird im gesamten „Deutschen Reich“ eingeführt.
12. 1 1916 - Karl Liebknecht wird aus der SPD-Fraktion ausgeschlossen
Berlin * Der SPD-Abgeordnete und Kriegsgegner Karl Liebknecht wird aus der SPD-Fraktion ausgeschlossen. Karl Liebknecht hatte - ebenso wie Otto Rühle - am 20. März 1915 gegen die Kriegskredite gestimmt.
14. 1 1916 - Otto Rühle tritt aus der SPD-Fraktion aus
Berlin * Der SPD-Abgeordnete und Kriegsgegner Otto Rühle tritt aus Solidarität mit Karl Liebknecht - nach dessen Ausschluss - aus der SPD-Fraktion aus. Otto Rühle hatte ebenfalls am 20. März 1915 gegen die Kriegskredite gestimmt.
24. 1 1916 - Großbritannien führt die Wehrpflicht für ledige ein
London * Großbritannien führt die Wehrpflicht für ledige Männer zwischen 18 und 41 Jahren ein.
2 1916 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht wieder nach Charleville-Mézières
Pleß - Charleville-Mézières * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht vom Schloss Pleß in Oberschlesien wieder nach Charleville-Mézières.
4. 2 1916 - Brauverbot fürs „Starkbier“ das beliebte „Märzenbier“
München * Wegen der zunehmenden Rohstoffknappheit darf weder „Starkbier“ noch das beliebte „Märzenbier“ gebraut werden.
Bei Verstößen gegen das Verbot drohen Haftstrafen bis zu einem Jahr oder ersatzweise bis zu 10.000 Mark Geldstrafe.
Um das Randalieren der Soldaten auf Heimaturlaub zu unterbinden, appelliert das bayerische „Generalkommando“ an die Verwandten und Freunde der Fronturlauber, diese in Gastwirtschaften nicht mehr freizuhalten.
- Statt für „Freibier“ sollte das Geld sinnvoller verwendet werden, etwa für den Kauf von „Liebesgaben für die Front“.
- Das „Generalkommando“ behält sich sogar ein „allgemeines Alkoholverbot für Fronturlauber“ vor.
5. 2 1916 - Den Weg zu einer tschechoslowakischen Exilregierung ermöglicht
Paris * Mit Erlaubnis der französischen Regierung wird der Nationalrat der tschechischen Länder durch Exil-Slowaken in Zusammenarbeit mit Exil-Tschechen konstituiert. Damit ist der Weg zu einer Exilregierung frei.
18. 2 1916 - Rosa Luxemburg wird nach einem Jahr Haft entlassen
Berlin * Rosa Luxemburg wird nach einem Jahr aus dem Frauengefängnis in der Berliner Barnimstraße 10 entlassen.
21. 2 1916 - Ein monatelanger, zermürbender Stellungskrieg entwickelt sich
Verdun - Westfront * Acht bayerische Divisionen sind im Verbund mit der 5. Armee am Angriff auf die französische Festung Verdun beteiligt. Nach anfänglichen Erfolgen kommt der auf einer Breite von fast 20 Kilometern vorgetragene Angriff nur langsam voran. Es entwickelt sich ein monatelanger, zermürbender Stellungskrieg.
24. 2 1916 - Deutsche Truppen können das Panzerfort Douaumont einnehmen
Verdun - Westfront * Deutsche Truppen können das Panzerfort Douaumont kampflos einnehmen. Der französische Oberbefehlshaber Marschall Joseph Jacques Césaire Joffre verstärkt daraufhin innerhalb weniger Tage die Verteidigung Verduns von 150.000 auf 800.000 Mann und kann so die Festung halten. Wochenlang liegen sich deutsche und französische Soldaten im Artilleriefeuer gegenüber.
3 1916 - Ernst Toller verbringt qualvolle Wochen in den Schützengräben
Verdun - Westfront * Auch Ernst Toller verbringt als „Kriegsfreiwilliger“ qualvolle Wochen in den Schützengräben.
Im Jahr 1933 wird er seine Autobiographie „Eine Jugend in Deutschland“ veröffentlichen und darin die Grauen des Krieges und die Ansichten eines bayerischen Soldaten, der den „Saupreißn“ die Verantwortung dafür zuschiebt, beschreiben.
„Sebastian, der Bauernknecht aus Berchtesgaden, [...] ist fromm, und er begreift nicht, warum dieser Krieg tobt. Wenn sie ihm von zu Hause Schinken und Speck schicken, setzt er sich mit abgewandtem Rücken in einen Winkel und ißt und stiert und sinnt.
Vielleicht sind die Preußen ja ‚an der Gaudi‘ schuld, bestimmt sind sie schuld.
Die können ja nie das Maul halten, wegen ihnen hat König Ludwig II. daran glauben müssen, [...] der Bismarck hat die Bayern beschissen, [...] sein Großvater hat im Krieg 1866 ganz allein sechs Preußen gefangen genommen, ‚Ergebts euch!‘ hat er geschrien, ‚die Bayern san da‘, und jetzt saufen sie uns das Bier weg aus der Kantine.
Sebastian bleibt stehen, erblickt mich nackt und schließt vor Schreck die Augen. [...]
‚Jetzt woaß ma ja, warum der Krieg hat kemma müssn‘, brummt er. ‚Der Preiß wascht sich nackad‘.
Aus seinem Mundwinkel zischt ein Strahl Spucke“.
4. 3 1916 - Premiere: „Aus der guten alten Zeit - Unsere Bürgerwehr vor 100 Jahren“
München-Ludwigsvorstadt * Das Bühnenstück „Aus der guten alten Zeit - Unsere Bürgerwehr vor 100 Jahren“ von Karl Valentin und Alois Hönle hat im Kabarett Wien-München im Hotel Wagner in der Sonnenstraße Premiere. Die Regie führt Georg Rückert.
„Diese neue Idee von Karl Valentin soll nur bezwecken, das P.T. Publikum auf einige Stunden die jetzige schwere Zeit vergessen zu machen getreu dem alten Motto: ‚Lachen ist gesund‘.“
4. 3 1916 - Franz Marc stirbt bei Verdun
Verdun - Westfront * Franz Marc stirbt im Alter von 36 Jahren bei Verdun.
7. 3 1916 - Die Bayerischen Motorenwerke - BMW werden gegründet
München * Die Bayerischen Motorenwerke - BMW werden unter dem Namen Bayerische Flugzeugwerke gegründet.
24. 3 1916 - 18 SPD-ler aus der SPD-Fraktion ausgeschlossen
Berlin * In der SPD kommt es im Zusammenhang mit einem Nothaushalt zum offenen Bruch in der Frage der Unterstützung der deutschen Kriegspolitik. Hugo Haase hält im Reichstag eine Anti-Kriegs-Rede, in der er auch die durch die Regierung verschuldeten Zustände von Unterernährung und Hunger unter Teilen der Bevölkerung anklagt. Im Parlament kommt es zu einem Krawall.
Der im Rahmen dieser Parlamentssitzung von der Regierung vorgestellte Notetat wird von jenen 18 SPD-Reichstagsabgeordneten, die bereits am 21. Dezember 1915 gegen die Kriegskredite stimmten, ebenfalls abgelehnt. Die anderen SPD-Abgeordneten bewilligen den Regierungsvorschlag. Mit der Begründung von Disziplin- und Treubruch werden die 18 Abgeordneten in einer anschließenden SPD-Fraktionssitzung aus der Fraktion ausgeschlossen.
Die 18 Abweichler bilden daraufhin die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft - SAG als Fraktionsgemeinschaft. Sie betrachten sich weiterhin als Mitglieder der SPD. Aus der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft geht im April 1917 die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands - USPD hervor. Die USPD wird bei den revolutionären Ereignissen in Bayern die entscheidende Rolle spielen.
Karl Liebknecht und Otto Rühle lehnen den Anschluss an die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft - SAG ab.
4 1916 - Das „Astoria“ wird als zweites Haidhauser Kino eröffnet
München-Haidhausen * Das „Astoria“ in der Elsässer Straße wird als zweites Haidhauser Kino eröffnet.
Um 4 1916 - Die staatlich festgelegten Höchstpreise werden deutlich angehoben
München * Die staatlich festgelegten Höchstpreise für landwirtschaftliche Produkte werden in ganz Bayern deutlich angehoben.
Man möchte damit den Landwirten, die bislang ihre Vorräte gehortet haben, einen Anreiz bieten. Die Maßnahme führt jedoch zu massiver Verärgerung bei den Bauern, die ihre Waren im Herbst 1915 zu den niedrigen Preisen abgegeben hatten.
Damit wird der „ehrliche, rechtzeitig und uneigennützig abliefernde Landwirt zum Gespötte der Kriegswucherer gemacht“.
1. 4 1916 - Glocken für die evangelische Johanneskirche
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Schon am Tag vor der Einweihung der evangelischen Haidhauser Johanneskirche läuten schon deren Glocken. Sie tragen die Inschriften: <em>„Ehre sei Gott in der Höhe“, „Friede auf Erden“</em> und <em>„Den Menschen ein Wohlgefallen“</em>. </p> <p>Die Glocken waren ursprünglich für eine Gemeinde in Ostpreußen bestimmt, die durch die Kriegszerstörungen keine Kirche und keinen Turm mehr hatte. </p>
26. 4 1916 - Die „Muttergottes“ wird zur „Patronin des Königreichs Bayern“
München - Rom-Vatikan * Papst Benedikt XV. genehmigt dies durch ein Dekret der „Ritenkongregation“, dass die „Muttergottes“ zur „Patronin des Königreichs Bayern“ wird.
Das Königreich wird jedoch bald darauf in den revolutionären Wirren untergehen.
5 1916 - Mata Hari soll für den deutschen Geheimdienst arbeiten
Amsterdam * „Mata Hari“ begegnet dem „deutschen Konsul“ in Amsterdam, Carl H. Cramer, der auch für den Geheimdienst arbeitet.
Von Cramer erhält die Tänzerin 20.000 Francs als Vorschuss für Informationen, die „Mata Hari“ an die Deutschen weiterleiten soll. „H-21“ lautet ihr Agentenname.
1. 5 1916 - Karl Liebknecht wird bei einer Antikriegsdemonstration verhaftet
Berlin * Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Karl Liebknecht tritt als Führer einer Antikriegsdemonstration auf dem Potsdamer Platz in Berlin auf.
Er ergreift das Wort mit den Worten „Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!“
Danach wird er verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt.
11. 5 1916 - Der Komponist Max Reger stirbt an einem Herzinfarkt
Leipzig * Der Komponist Max Reger stirbt in einem Hotelzimmer in Leipzig im Alter von 43 Jahren an einem Herzinfarkt.
14. 5 1916 - Das Fest Maria - Patronin des Königreichs Bayern erstmals begangen
München * Das Fest „Maria - Patronin des Königreichs Bayern“ wird in München erstmals begangen, im Jahr darauf in allen bayerischen Diözesen.
31. 5 1916 - Im Skagerak tobt die größte Seeschlacht der Weltgeschichte
Skagerak - Ostfront * Bis 1. Juni tobt im Skagerak zwischen der deutschen und der britischen Flotte die größte Seeschlacht der Weltgeschichte. Sie endet unentschieden.
1. 6 1916 - Beginn der deutschen Großoffensive auf Fort Vaux
Fort Vaux - Verdun * Beginn der deutschen Großoffensive auf Fort Vaux.
4. 6 1916 - Die russische Armee beginnt ihre Offensive gegen Deutschland
Galizien * Beginn der Brussilow-Offensive an der Ostfront, in deren Verlauf russische Truppen große Geländegewinne erzielen können.
7. 6 1916 - Kapitulation der französischen Besatzung in Fort Vaux
Fort Vaux - Verdune * Kapitulation der französischen Besatzung in Fort Vaux.
16. 6 1916 - Die Nahrungsmittelknappheit treibt die Münchner auf die Straßen
München * Die Nahrungsmittelknappheit treibt die Münchner auf die Straßen. Bei diesen Hungerdemonstrationen kommt es zu Krawallen, da die Behörden unfähig sind, die Lebensmittelversorgung sinnvoll zu organisieren. Die dringend benötigten Nahrungsmittel erreichen häufig die Empfänger nicht, weil durch verzwickte bürokratische Regelungen häufig Brot, Fett und Fleisch oft tagelang kreuz und quer durchs Land gefahren werden - und verderben.
Jedem Münchner Bürger stehen täglich Nahrungsmittel zu, die einen Nährwert von 1.380,4 Kilokalorien entsprechen. Nach Ansicht des Ärztlichen Beirats der Stadt München für Lebensmittelangelegenheiten ist es „vollständig ausgeschlossen, dass ein gesunder Mensch bei diesen knappen Ernährungsmengen arbeitsfähig bleibt und [...] auf die Dauer eine Schädigung der Gesundheit vermieden wird“.
17. 6 1916 - Auf dem Marienplatz kommt es zu Hungerrevolten
München-Graggenau * Es kommt auf dem Marienplatz zu Hungerrevolten, bei denen von Frauen und Jugendlichen Fenster des Rathauses eingeworfen werden. Den erschrockenen Stadtvätern fällt dabei auf, dass neben den hauptsächlich randalierenden Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren sich auch Frauen und Soldaten angeschlossen haben.
17. 6 1916 - Erich Mühsam: Das Volk steht auf! - Auftakt der Revolution
München * Über diesen Tag vermerkt der Schriftsteller Erich Mühsam in seinem Tagebuch:
„Das Volk steht auf! Gestern erlebten wir den Auftakt der Revolution.
[...] In der Tat stand der Marienplatz voll von Leuten, die ich auf 10.000 Personen schätze.
Johlen und Pfeifen war zunächst das einzige Merkmal der Erregung. Allmählich hörte man aus den Gruppen heraus lautes Fluchen, Aufklärungen, Anklagen wegen der Not der Nahrungsmittelverteilung, der Massenmörderei.
[...] Da entdeckte ich plötzlich, dass die Dienerstraße entlang Militär anrücket mit aufgepflanztem Bajonett und sich an der Ostseite des Rathauses aufstellte. Eine maßlose Wut brach durch. alles schrie: ‚Pfui! Gemeinheit! - Sauhunde! Blaue Bohnen statt Brot‘.“
Benebelt von der Propaganda des Staates und der nationalen Presse hatten die Leute anfangs geglaubt, der Krieg werde bald zu Ende und die Soldaten bis Weihnachten siegreich heimgekehrt sein.
24. 6 1916 - Die Schlacht an der Somme beginnt
An der Somme * Mit gewaltigen Artillerieschlägen beginnt die Schlacht an der Somme.
28. 6 1916 - Karl Leibknecht erstinstanzlich verurteilt
Berlin * Karl Liebknecht wird unter Verlust seines Reichstagsmandats wegen Hochverrats zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Am ersten Prozesstag organisierten revolutionäre Obleute in den Betrieben in Berlin einen spontanen Solidaritätsstreik mit über 50.000 Beteiligten.
1. 7 1916 - Beginn des britischen Angriffs auf die deutschen Stellungen
An der Somme * Beginn des britischen Angriffs auf die deutschen Stellungen.
8. 7 1916 - Militärische Sicherheitshaft für Rosa Luxemburg
Berlin * Gegen Rosa Luxemburg wird eine militärische Sicherheitshaft verhängt.
10. 7 1916 - Rosa Luxemburg wird in Schutzhaft genommen
Berlin * Rosa Luxemburg wird nur wenige Monate nach ihrem Haftaufenthalt zur Abwendung einer Gefahr für die Sicherheit des Reichs in Sicherheitsverwahrung genommen.
Zuerst sitzt sie im Polizeigefängnis am Alexanderplatz, dann im Frauengefängnis in der Barnimstraße 10 ein. Sie wird zweimal verlegt, zuerst in die Festung Wronke in der Provinz Posen, dann nach Breslau. Ihre Schutzhaft dauert bis zum 8. November 1918.
8 1916 - Mata Hari arbeitet auch für den französischen Geheimdienst
Vittel - Paris * Der französische Geheimdienst ist von den Briten längst auf „Mata Hari“ aufmerksam gemacht worden, als sie beim Leiter der französischen „Spionageabwehr“, George Ladoux, eine Sondergenehmigung für eine Reise nach Vittel in der Nähe der Front beantragt. Sie will dort ihren jungen Geliebten Vadime de Massloff treffen.
Ladoux erteilt die „Sondergenehmigung“, nachdem ihm die Tänzerin die Zusage für Spionagetätigkeiten für den „französischen Geheimdienst“ gibt.
Bei einem weiteren Treffen in Paris verlangt „Mata Hari“ die absurde Summe von einer Million Francs.
8 1916 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht wieder nach Schloss Pleß
Charleville-Mézières - Pleß * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht von Charleville-Mézières wieder in das Schloss Pleß in Oberschlesien.
23. 8 1916 - Karl Liebknecht zu über vier Jahren Zuchthaus verurteilt
Berlin * Das Urteil gegen Karl Liebknecht lautet in der zweiten Instanz: „Der Angeklagte wird wegen versuchten Kriegsverrat in Tateinheit mit erschwertem Ungehorsam im Felde sowie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt mit vier Jahren und einem Monat Zuchthaus bestraft. Zugleich wird auf Entfernung aus dem Heere, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von sechs Jahren […] erkannt.“
Hugo Haase, der bis März 1916 immerhin SPD-Vorsitzender ist, setzt sich vergeblich für Liebknechts Freilassung ein.
27. 8 1916 - Rumänien tritt der Entente bei und erklärt Wien den Krieg
Bukarest - Wien * Rumänien tritt der Entente bei und erklärt Österreich-Ungarn den Krieg.
29. 8 1916 - Kaiser Wilhelm II. ernennt die dritte Oberste Heeresleitung - OHL
Berlin * Kaiser Wilhelm II. ernennt Paul von Hindenburg zum Chef des Generalstabs und Erich Ludendorff zum Generalquartiermeister. Dies ist die dritte Oberste Heeresleitung - OHL. Sie wird sich zu Deutschlands wirklicher Regierung - eine Militärdiktatur - entwickeln.
29. 8 1916 - Prinz Leopold wird Oberbefehlshaber Ost der deutschen Streitkräfte
Berlin * Prinz Leopold von Bayern tritt die Nachfolge Paul von Hindenburgs als Oberbefehlshaber Ost der deutschen Streitkräfte.
31. 8 1916 - Wer soll die Not der Bevölkerung lindern ?
München * In der Sitzung der Gemeindebevollmächtigten erinnert der Vorstand einen Referenten eindringlich an den Burgfrieden. Der Referent hat sich in seinen Ausführungen energisch gegen diejenigen gewandt, die den Krieg gewollt haben und die jetzt auch die Not der Bevölkerung zu lindern hätten.
2. 9 1916 - Deutsche Offensivbemühungen bei Verdun eingestellt
Verdun * Die deutschen Offensivbemühungen bei Verdun werden eingestellt.
9. 9 1916 - Erich Mühsam erwirbt die bayerische Staatsangehörigkeit
München * Erich Mühsam erwirbt die bayerische Staatsangehörigkeit.
15. 9 1916 - Die britische Armee setzt erstmals Panzer ein
Somme - Westfront * Die britische Armee setzt an der Somme in Frankreich erstmals Panzer ein.
23. 9 1916 - Das Oktoberfest fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese • Eigentlich müsste das Oktoberfest beginnen. Es fällt diese Jahr aber erneut kriegsbedingt aus.
10 1916 - Die SPD schließt die Zustimmungsverweigerer aus
Berlin * Die SPD schließt die Zustimmungsverweigerer zu den „Kriegskrediten“ aus der Fraktion aus.
Diese gründen daraufhin die „Fraktion der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft - SAG“.
24. 10 1916 - Rückeroberung von Fort Donaumont durch französische Truppen
Fort Donaumont - Verdun * Rückeroberung von Fort Donaumont durch französische Truppen.
26. 10 1916 - Rosa Luxemburg wird in die Festung Wronke verlegt
Berlin - Wronke * Rosa Luxemburg wird in die Festung Wronke zum abbüßen ihrer Schutzhaft verlegt.
11 1916 - „Mata Hari“ wird mit der deutschen „Spionin“ Clara Benedix verwechselt
Spanien - Holland * „Mata Hari“ wird auf der Schiffsreise von Spanien nach Holland mit der deutschen „Spionin“ Clara Benedix verwechselt.
Erneut wird sie vom „britischen Geheimdienst“ verhört und danach als verdächtige Person nach Spanien zurückgeschickt.
Offenbar reichen weder den Briten noch den Franzosen die Beweise für eine aktive Agententätigkeit von Mata Hari aus.
1. 11 1916 - Die Anordnung der Judenzählung im deutschen Heer
Berlin * Anordnung der Judenzählung im deutschen Heer. Obwohl das Kriegsministerium alle antisemitischen Absichten abstreitet, sind die dahinterstehenden Beweggründe dennoch deutlich erkennbar. Viele Redewendungen sind den Pamphleten des antijüdischen Reichshammerbundes entnommen.
2. 11 1916 - Räumung des Fort Vaux durch deutsche Truppen
Fort Vaux - Verdun * Räumung des Fort Vaux durch deutsche Truppen.
8. 11 1916 - Prinz Heinrich von Bayern fällt am Monte Sule
Arges/Rumänien * Prinz Heinrich von Bayern, Sohn des Prinzen Arnulf und dessen Ehefrau Therese, erliegt seinen Verletzungen, die er sich am Vortag zugezogen hat. Unterhalb des Gipfels des Monte Sule traf den hochdekorierten Offizier der Bayerischen Armee aus dem Geschlecht der Wittelsbacher eine Kugel im Bauchbereich.
9. 11 1916 - Ein Muster an Pflichterfüllung
Berlin * Die Berliner Norddeutsche Allgemeine Zeitung schreibt über den gefallenen Wittelsbacher Prinzen Heinrich von Bayern: „Der Gefallene war ein Muster jener hohen und unerschrockenen Pflichterfüllung, von der gerade die Angehörigen unserer regierenden deutschen Fürstengeschlechter während des Krieges so reichlich Zeugnis abgelegt haben.“
Bis Kriegsende wird sich die Zahl der fürstlichen Kriegstoten auf insgesamt 13 erhöhen. Von den kriegsverpflichteten Offiziere und Mannschaften fällt ein Viertel im Kampf.
11. 11 1916 - Fürstliches Blut für die Ehre des Vaterlandes
Berlin - München * Kaiser Wilhelm II. Beileidstelegramm zum Tode des wittelsbachischen Prinzen Heinrich zielt ausdrücklich auf das „fürstliche Blut“, das der Prinz „für den Ruhm des bayerischen Königshauses und für die Ehre des deutschenh Vaterlandes treulich zum Opfer gebracht“ hat.
14. 11 1916 - Den Heldentod des Prinzen Heinrich gewürdigt
Berlin * Die Berliner Kreuzzeitung widmet dem „Heldentod des Prinzen Heinrich“ gleich fünf Artikel.
17. 11 1916 - Ein französisches Flugzeug wirft sieben Bomben über München ab
München-Ludwigsvorstadt * Ein französisches Flugzeug wirft über München sieben Bomben ab, richtet aber nur wenig Sachschaden an, weil auch ein Blindgänger unter den Bomben ist. Das Ziel, den Münchner Hauptbahnhof zu zerstören, wird verfehlt.
18. 11 1916 - Einstellung der Kämpfe an der Somme
An der Somme * Einstellung der Kämpfe an der Somme ohne strategisch bedeutende Durchbrüche.
21. 11 1916 - Karl I. wird österreichischer Kaiser
Wien* Nach dem Tod von Franz Joseph I. wird Karl I. österreichischer Kaiser.
Seit 12 1916 - Die Münchner Kriegsgegner treffen sich jeden Montag im „Goldenen Anker“
München-Ludwigsvorstadt * Die Münchner Kriegsgegner treffen sich jeden Montag in der Wirtschaft „Goldener Anker“ in der Schillerstraße.
2. 12 1916 - Das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst verabschiedet
Berlin * Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst. Es verpflichtet alle männlichen Deutschen zwischen 17 und 60 Jahren zur Arbeit in kriegswichtigen Betrieben.
7. 12 1916 - Die USPD-Diskussionsabende im Goldenen Anker
München-Ludwigsvorstadt * Im Gasthaus Zum Goldenen Anker in der Schillerstraße beginnen jeweils am Montagabend die USPD-Diskussionsabende. An diesem ersten Abend beteiligen sich gerade einmal 25 Personen. Doch die Zahl der Anwesenden wird rasch auf 50 und sogar 100 anwachsen.
12. 12 1916 - Die Mittelmächte machen der USA ein Friedensangebot
Berlin - Washington * Die Mittelmächte wenden sich mit einem Friedensangebot an den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Die Entente weist das Angebot zurück.
15. 12 1916 - Valentin-Karlstadt beenden ihr Engagement im Kabarett Wien-München
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin und Liesl Karlstadt beenden ihr Engagement im Kabarett Wien-München im Hotel Wagner in der Sonnenstraße.
16. 12 1916 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im „Annenhof“ auf
München-Lehel * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im „Annenhof“, in der Liebigstraße 22 auf.
28. 12 1916 - Eduard Theodor von Grützner wird geadelt
München-Graggenau * König Ludwig III. erhebt Eduard Theodor von Grützner als Ritter des königlichen Verdienstordens der Bayerischen Krone in den persönlichen Adelsstand.
30. 12 1916 - Pater Rupert Mayer wird schwer verwundet
Sultatal - Ostfront * Pater Rupert Mayer wird im Sultatal in Rumänien schwer verwundet. Sein linkes Bein wird zum ersten Mal amputiert.
30. 12 1916 - Deutsche Friedensinitiative zurückgewiesen
Berlin * Die Entente weist die deutsche Friedensinitiative zurück.
30. 12 1916 - Rasputin wird von einem bezahlten Kommando ermordet
Petersburg * Grigori Jefimowitsch Rasputin wird von einem von der russischen Hocharistokratie angeheuerten Mordkommando umgebracht.
1917 - Faulhaber: „Die Königstreue - sie steht unter Gottes Geboten“
München * Michael von Faulhabers Buch „Das Schwert des Geistes“ erscheint. Darin finden sich so abenteuerliche Sätze wie: „Die Königstreue - sie steht unter Gottes Geboten“.
1917 - Das „Café Perzl“ bringt immer Neuigkeiten auf den Markt
München-Graggenau * Constantin Pfrang, genannt „Stanzl“, feiert zusammen mit Hans Blädel im „Café Perzl“ am Marienplatz [heute: „Kaufhaus Ludwig Beck am Rathauseck“] große Erfolge.
Das „Café Perzl“ bringt immer Neuigkeiten auf den Markt.
Von der ersten in München spielenden „Damenkapelle“ bis zu „Schleier- und Charaktertänzerinnen“ - jedoch immer unter Überwachung der Polizei.
1917 - Schon wieder neue Büroräume für die „Straßenbahn-Direktion“
München-Haidhausen * Die „Lagerräume“ im ersten Stock der „Straßenbahn-Direktion“ werden in „Büroräume“ umgebaut.
Das „Lager“ kommt in das Erdgeschoss und verkleinert dadurch die „Beiwagenhalle“ erneut.
2. 1 1917 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht wieder nach Bad Kreuznach
Pleß - Bad Kreuznach - Bad Münster - Bad Homburg * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL zieht vom Schloss Pleß in Oberschlesien in das Parkhotel Kurhaus in Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Kaiser Wilhelm II. residierte im Schloss Bad Homburg.
3. 1 1917 - Mata Hari darf mit dem Wissen der Behörden nach Paris einreisen
Paris * Mata Hari darf mit dem Wissen der Behörden nach Paris einreisen. Der französische Geheimdienst lässt sie nun dauerhaft observieren.
5. 1 1917 - Kaiser Wilhelm II. ruft die Truppen zu unvermindertem Kampf auf
Berlin * In seiner Neujahrsbotschaft ruft Kaiser Wilhelm II. die Truppen „zu unvermindertem Kampf gegen die Entente“ auf.
7. 1 1917 - Die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft lädt zur Reichskonferenz
Berlin * Der Vorstand der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft - SAG lädt zur ersten Reichskonferenz der sozialdemokratischen Opposition nach Berlin ein. 138 Delegierte und 19 Reichstagsabgeordnete nehmen daran teil.
Vor allem der Kreis um Karl Kautsky hatte der SAG-Führung zu diesem Schritt geraten und dabei die Absicht verfolgt, dem Einflussgewinn der radikalen Linken um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg durch die Organisation einer „verantwortlichen Opposition“ zu begegnen.
7. 1 1917 - Maßnahmen gegen den Hunger der Städter
München * Der Bayerische Bauernbund - BBB trifft sich zu einer Kriegstagung. Die Landwirte sollen ermuntert werden, „die entbehrlichen Lebensmittel abzuliefern, um der großstädtischen Bevölkerung das Durchhalten zu erleichtern“.
10. 1 1917 - Die Entente-Mächte geben ihre Kriegsziele bekannt
Paris - London - Moskau * Die Entente-Mächte geben ihre Kriegsziele bekannt:
- Frankreich will die Zerschlagung des Deutschen Reichs und die Rückgabe von Elsaß-Lothringen.
- Großbritannien fordert
- die Einschränkung der weltpolitischen Stellung des Deutschen Reichs,
- die Aufteilung der deutschen Kolonien,
- die Zerstörung der Flotte und
- die Begrenzung des Außenhandels.
- Zudem drängt Großbritannien auf die Wiederherstellung der Eigenständigkeit Belgiens, Serbiens und Montenegros.
- Russland fordert - neben der Räumung der besetzten Gebiete - die Wiedereingliederung Polens.
16. 1 1917 - Karl Valentin lädt Dr. Ludwig Ganghofer in den Annenhof ein
München-Lehel * Karl Valentin eine Einladung an seinen ehemaligen Mäzen Dr. Ludwig Ganghofer und lädt ihn in den Annenhof ein: „Eine große Ehre würden Sie mir erweisen, wenn ich Herrn Doktor samt Familie zu einer meiner täglichen Vorstellungen im Annenhof Liebigstraße 22 einladen dürfte, und würde ich nach telefonischer Benachrichtigung die schönsten Plätze reservieren.“
18. 1 1917 - Organisatorische Trennung der SPD beschlossen
Berlin * Der SPD-Vorstand hält an seinem Konfrontationskurs fest und schließt die SAG-Abgeordneten und die führenden Köpfe der Spartakusgruppe aus der SPD aus und fordert die lokalen Parteigliederungen auf, mit deren Anhängern vor Ort ebenso zu verfahren.
Obwohl die Führung der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft - SAG es bisher vermied, die Bildung einer neuen Partei zu propagieren, treten – zur Überraschung der SAG wie der SPD-Führung - ganze Ortsvereine aus der SPD aus.
18. 1 1917 - Rosa Luxemburg wird aus der SPD ausgeschlossen
Berlin * Die in der Festung Wronke in Schutzhaft sitzende Rosa Luxemburg wird aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - SPD ausgeschlossen.
22. 1 1917 - US-Präsident Wilson fordert einen Frieden ohne Sieger
Washington * In einer Rede vor dem amerikanischen Senat fordert Präsident Woodrow Wilson einen Frieden ohne Sieger.
23. 1 1917 - Rupert Mayers linkes Bein muss zum zweiten Mal amputiert werden
Ostfront * Pater Rupert Mayers linkes Bein muss zum zweiten Mal amputiert werden.
28. 1 1917 - Die deutsche Regierung lehnt Woodrow Wilsons Friedensbotschaft ab
Berlin * Die deutsche Regierung lehnt Woodrow Wilsons Friedensbotschaft „Frieden ohne Sieger“ ab.
31. 1 1917 - Deutschland verkündet den uneingeschränkten U-Boot-Krieg
Berlin * Das Deutsche Reich verkündet den uneingeschränkten U-Boot-Krieg.
1. 2 1917 - Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg geht weiter
Deutsches Reich * Die deutsche Kriegsmarine nimmt den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder auf.
3. 2 1917 - Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab
Washington * Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab.
3. 2 1917 - Städtische Badeanstalten wegen Kohlenmangel geschlossen
München * Wegen Kohlenmangel müssen drei städtische Badeanstalten vorübergehend ganz, vier weitere, darunter das Brause- und Wannenbad an der Schloss-/Kirchenstraße und das Volksbad zeitweilig geschlossen werden.
Die Anordnung wird erst rund sechs Wochen später wieder aufgehoben.
7. 2 1917 - Vier neue Volksküchen in München eröffnet
München * In München werden vier neue Volksküchen eröffnet.
Damit erhöht sich ihre Zahl auf 30.
8. 2 1917 - Zinndeckel-Bestandsaufnahme
<p><em><strong>München</strong></em> * Weil der Bedarf an Zinn für kriegswichtige Rüstungsprodukte sehr hoch ist, erlassen die Generalkommandos eine Bekanntmachung, die <em>„die Bestandserhebung, Beschlagnahme und Enteignung von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn und die freiwillige Ablieferung von anderen Zinn-Gegenständen“</em> beinhaltet. </p>
9. 2 1917 - Die SAG-Führung will die Opposition bündeln
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft - SAG ruft zur organisatorischen Sammlung der Opposition auf. </p>
13. 2 1917 - Mata Hari wird in Paris festgenommen
<p><em><strong>Paris</strong></em> * Die Tänzerin <em>„Mata Hari“</em> wird im Élysée Palace Hotel festgenommen und ins berüchtigte Frauengefängnis Saint-Lazare gebracht.</p>
14. 2 1917 - Insgesamt 64 Milliarden Mark für „Kriegskredite“ bewilligt
Berlin * Der „Reichstag“ hat seit 1914 insgesamt 64 Milliarden Mark für „Kriegskredite“ bewilligt.
17. 2 1917 - In Berlin wird ein Ministerium für Lebensmittelversorgung gebildet
Berlin * Wegen der anhaltenden Hungersnot im Deutschen Reich wird in Berlin ein Ministerium für Lebensmittelversorgung gebildet.
20. 2 1917 - Die Fünf-Pfennig-Münzen aus Kupfer werden für Kriegszwecke eingezogen
Berlin - Deutsches Reich * Die Fünf-Pfennig-Münzen aus Kupfer werden für Kriegszwecke eingezogen und durch solche aus Aluminium ersetzt.
23. 2 1917 - Die SPD-Mehrheitsfraktion stimmt den Kriegskrediten zu
Berlin * Die Mehrheitsfraktion der SPD stimmt im Reichstag der neuen Vorlage für Kriegskredite zu, „solange die Eroberungsziele der Feinde bestehen“.
25. 2 1917 - Dem Reichskanzler wird Schwäche in der Kriegführung vorgeworfen
Berlin - Deutsches Reich * Deutsche Großindustrielle werfen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg „Schwäche in der Kriegführung“ vor und fordern seinen Rücktritt.
26. 2 1917 - Ein deutsches U-Boot versenkt das Passagierschiff Laconia
Irland * Ein deutsches U-Boot versenkt vor der irischen Küste den schnellsten britischen Passagierdampfer, die Laconia. Da sich unter den zwölf Todesopfern zwei US-amerikanische Staatsbürger befinden, wird dies ein wichtiges Argument der USA zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg.
Ab 1. 3 1917 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im Serenissimus auf
München-Maxvorstadt * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten vom 1. März 1917 bis zum 1. Oktober 1919 im Serenissimus in der Akademiestraße auf.
2. 3 1917 - Presseaufruf: Keine „Jammerbriefe“ an die Front
Deutsches Reich * Um die deutschen Soldaten nicht zu demoralisieren, werden in der Presse Aufrufe veröffentlicht, keine „Jammerbriefe“ an die Front zu senden.
3. 3 1917 - Die Zeitschrift Die Wirklichkeit - Deutsche Zeitung für Ordnung und Recht
München * Die erste Ausgabe der Zeitschrift „Die Wirklichkeit - Deutsche Zeitung für Ordnung und Recht“ erscheint. Das Druckwerk, dessen Hauptschreiber Dr. Fritz Gerlich ist, sollte das Sprachrohr der „alldeutschen Kräfte“ werden. Die Zeitschrift wird jedoch schon im September wieder eingestellt.
3. 3 1917 - Bei den Petersburger Putilow-Werken bricht ein Streik aus
Petersburg * Bei den Putilow-Werken, einem Petrograder Rüstungsbetrieb, bricht ein Streik aus. Die Gründe sind in der wirtschaftlichen Zerrüttung und dem erfolglosen Kriegsverlauf zu suchen. Die Direktion des Werkes reagiert darauf mit der Aussperrung von 30.000 Beschäftigten, was umgehend zu einer Protestdemonstration gegen die katastrophale Versorgungslage führt.
8. 3 1917 - In Petrograd beginnt die eigentliche Revolution
Petersburg * In Petrograd beginnt die eigentliche Revolution. In den Putilow-Werken wird erneut gestreikt, die Streikenden demonstrieren für eine bessere Versorgung, vor allem mit Brot. Gegen 14 Uhr treten die Arbeiterinnen in der Fabrik Ayvas ebenfalls in den Ausstand. Sie demonstrieren gegen die Brotknappheit und für die Rückholung ihrer Männer von der Front. Den protestierenden Frauen schließen sich im Laufe des Tages rund 130.000 Arbeiter an.
Dabei schlagen die Kundgebungen ins Politische um: „Weg mit der Monarchie! Schluss mit dem Krieg!“ steht auf den Transparenten. Die Lage in Petrograd gerät immer mehr außer Kontrolle. Es kommt zu den ersten schweren Zusammenstößen zwischen streikenden Arbeitern und dem Militär.
Sehr schnell gibt es in den Betrieben Wahlen zu Arbeiterräten. Eine Form der Selbstorganisation, die die Arbeiter schon im Jahr 1905 entwickelt hatten. Daraus entstehen in der Folge Arbeiter- und Soldatenräte im ganzen Land.
9. 3 1917 - Die Petersburger Proteste münden in einen Generalstreik
Petersburg * In den folgenden Tagen münden die Proteste in einen Generalstreik, aber auch in Plünderungen und Ausschreitungen. Die Polizei ist nicht mehr Herr der Lage, da sich die herbeigerufenen Soldaten mit den Demonstranten verbrüdern.
Zar Nikolaus II. reagiert auf die Streiks, indem er dem Militär befiehlt, mit Waffengewalt gegen die aufbegehrende Menschenmenge vorzugehen. Am Nachmittag schießen Angehörige eines Garderegiments auf die „Aufrührer“. Sechzig Demonstranten sterben.
Das bewirkt jedoch genau das Gegenteil, da nun auch an anderen Orten die Proteste beginnen. Ganze Regimenter wechseln die Seiten. An anderen Orten dagegen gingen Soldaten gegen die Polizei vor.
10. 3 1917 - Die Streiks in Petrograd weiten sich zum Generalstreik aus
<p><em><strong>Petersburg</strong></em> * Die Streiks in Petrograd weiten sich zum Generalstreik aus. Zar Nikolaus II. befiehlt zum Kampf gegen die Demonstranten mit allen Mitteln. </p>
11. 3 1917 - Die Abgeordneten der russischen Duma verweigern ihre Auflösung
Petersburg * Die Abgeordneten der russischen Duma [= russisches Parlament] weigern sich, die von Zar Nikolaus II. verfügte Auflösung der Duma durchzuführen. Soldaten der Petrograder Garnison solidarisieren sich mit den streikenden Arbeitern. Damit beginnt die sogenannte Februarrevolution.
12. 3 1917 - In Berlin sind 135 Personen an Pocken erkrankt
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * In Berlin sind nach offiziellen Berichten 135 Personen an Pocken erkrankt. Zudem gibt es zahlreiche Fälle von Hungertyphus. </p>
12. 3 1917 - Das Parlament übernimmt die Regierungsgeschäfte und die Staatsmacht
<p><em><strong>Petersburg</strong></em> * Der Ältestenrat der Duma konstituiert ein Provisorisches Komitee zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und eröffnet das Parlament wieder. Dieses übernimmt die Regierungsgeschäfte und die Staatsmacht. Das ist - staatsrechtlich betrachtet - der entscheidende revolutionäre Akt. </p>
13. 3 1917 - In Moskau bricht der Aufstand los
<p><em><strong>Moskau</strong></em> * In Moskau bricht der Aufstand los. Er nimmt einen ähnlichen Verlauf wie in Petrograd. Eine Niederschlagung der Erhebung scheint aussichtslos. Die Generäle zwingen Zar Nikolaus II. dazu, einer neuen <em>„Regierung des gesellschaftlichen Vertrauens“</em> zuzustimmen.</p> <p>Dies genügte aber den neuen Machthabern in Petrograd aber lange nicht, sie fordern den Thronverzicht des Zaren, einige sogar seinen Tod.</p>
14. 3 1917 - In den wichtigsten russischen Städten Arbeiter- und Soldatenräte
<p><em><strong>Russland</strong></em> * Zwischen dem 14. und dem 16. März 1917 bilden sich in den wichtigsten russischen Städten Arbeiter- und Soldatenräte. </p>
15. 3 1917 - Russlands Zar Nikolaus II. muss abdanken
<p><em><strong>Petersburg</strong></em> * Zar Nikolaus II. muss als Folge der Februarrevolution abdanken. Er tut dies zugunsten seines jüngeren Bruders Großfürst Michail Alexandrowitsch Romanow. Da Nikolaus II. vergisst, seinem Bruder die formelle Thronfolge in einem Telegramm mitzuteilen, ist Michail einer Letzten, der davon erfährt.</p> <p>Die russische Duma proklamiert die Bildung einer bürgerlichen Regierung unter Georgi J. Fürst Lwow. Diese beschließt, dass der Großfürst zum Thronverzicht überredet werden soll. Sollte er sich weigern, will die provisorische Regierung ihren Rücktritt erklären. </p>
16. 3 1917 - Die Machtbefugnisse gehen an die provisorische Regierung über
<p><strong><em>Petersburg</em></strong> * Zar Michail II. erklärt in einem Schreiben an das russische Volk, dass die Machtbefugnisse zunächst an die provisorische Regierung übergehen. Er selbst erklärt sich bereit, die Thronfolge dann anzutreten, wenn ihn das Volk zu einem späteren Zeitpunkt in geheimen Wahlen wählen würde. Michail hofft mit diesem Schritt die Monarchie in Russland erhalten zu können. Mit dem Thronverzicht Michails endet die über 300-jährige Herrschaft der Romanow-Dynastie. </p> <p>Georgij Jewgenjewitsch Fürst Lwow übernimmt nach der Februarrevolution in der bürgerlichen provisorischen Regierung, in der Zeit vom 16. März bis 21. Juli 1917, das Amt des russischen Ministerpräsidenten und Innenministers. </p>
16. 3 1917 - Wladimir Iljitsch Lenin trifft in Russland ein
Petersburg * Wladimir Iljitsch Lenin trifft in Russland ein, nachdem er mit Hilfe der deutschen Führung aus dem Schweizer Exil per Zug durch Deutschland und Schweden geschleust worden ist.
21. 3 1917 - Der Ex-Zar Nikolaus II. und seine Familie werden verhaftet
Petersburg * Die provisorische russische Regierung lässt den Ex-Zaren Nikolaus II. und seine Familie verhaften. Sie werden im Alexander-Palast unter Hausarrest gestellt. Die Romanows müssen zunächst kaum Einschränkungen hinnehmen und können sich ihrem Familienleben widmen.
22. 3 1917 - Die neue russische Regierung wird von den „Entente-Mächten“ anerkannt
Petersburg * Nachdem die neue russische Regierung die Fortführung des Kriegs versprochen hat, wird sie von den „Entente-Mächten“ offiziell anerkannt.
23. 3 1917 - 25 Jahre Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Die orthodoxe Ohel-Jakob-Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße begeht sein 25. Jubiläum. </p>
27. 3 1917 - Gefälschte Brotmarken
<p><em><strong>München</strong></em> * In München tauchen gefälschte Brotmarken auf. Die Polizei ermittelt, dass der 25-jährige Buchdrucker Hermann Wolleben die Brotmarken in einem Rückgebäude in der Schellingstraße die Zinkplatten hergestellt hatte. Gedruckt wurden die Marken in der Buchdruckerei Dammerhuber. Die gefälschten Lebensmittelmarken wurden im Mathäserbräu stückweise um 30 Pfennig verkauft.</p>
30. 3 1917 - Die Namensänderung des Oskar Maria Graf
<p><em><strong>München</strong></em> * Auf Vorschlag des namensgleichen Kriegsmalers Oskar Graf nennt sich der Schriftsteller nun Oskar Maria Graf. Es ist eine Reminiszenz an den von ihm hoch verehrten Rainer Maria Rilke. An diesem Tag erscheint ein Artikel von Graf in den Münchner Neuesten Nachrichten unter diesem Namen. </p>
31. 3 1917 - Bayerische SPD gegen die drohende Parteispaltung
<p><em><strong>Nürnberg</strong></em> * Auf ihrer Landeskonferenz in Nürnberg votiert die bayerische SPD gegen die Gründung von Sonderorganisationen, um den drohenden Bruch der Partei zu verhindern.</p> <p><em>„Wird der Kampf in der bisherigen Weise weitergeführt, so werden sich die Kräfte der Arbeiterschaft aufreiben, die Feinde der Arbeiterklassen werden freie Bahn bekommen und Steuern und Industrieorganisationen, Arbeitergesetzgebungen und politische Einrichtungen ihren Wünschen vollkommen anpassen.“</em> </p>
1. 4 1917 - Die Brot- und Kartoffelrationen werden gekürzt
Deutsches Reich * Die Brotrationen werden auf 170 g pro Tag und die Kartoffelrationen auf 2.500 g pro Woche gekürzt.
2. 4 1917 - Kreuzzug der freien und selbstbestimmten Völker
<p><strong><em>USA</em></strong> * Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson ruft vor dem US-Kongress zum Kreuzzug der <em>„wirklich freien und selbstbestimmten Völker der Welt“</em> auf.</p>
6. 4 1917 - Amerika tritt in die Kriegshandlungen ein
<p><em><strong>USA</strong></em> * Amerika erklärt dem Deutschen Reich den Krieg und tritt in die Kriegshandlungen ein.</p>
6. 4 1917 - Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei in Gotha
<p><em><strong>Gotha</strong></em> * Die in Gotha bis zum 8. April stattfindende zweite Reichskonferenz der sozialdemokratischen Opposition wird zum Gründungsparteitag der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - USPD. </p> <p>In der neuen Partei finden sich Sozialdemokraten verschiedenster Couleur wieder:</p> <ul> <li>Revolutionäre Marxisten wie die Gruppe Internationale, die im Krieg die prognostizierte Krise des Kapitalismus sieht und auf revolutionäre Aktionen drängt;</li> <li>pazifistisch gesinnte Sozialdemokraten, die im Weltkrieg einen Angriffskrieg Deutschlands sehen und sich diesem aus ethischen und moralischen Gründen verweigern;</li> <li>daneben Revisionisten,</li> <li>aber auch führende Vertreter des marxistischen Zentrums. </li> </ul> <p>Die USPD ist also keine straffe, einige revolutionäre Linkspartei. Sie zeigt sich nur einig in dem gemeinsamen Ziel: Die Beendigung des Krieges ohne Annexionen. Sie steht demzufolge für die Gegnerschaft zum Krieg, in dem sie längst keinen Verteidigungskrieg, sondern einen imperialistischen Eroberungskrieg sieht.</p> <p>Die USPD ist also in erster Linie der Block der sozialdemokratischen Gegner des Burgfriedens, der gegen die Kriegskredite ist. Sonst herrschen innerhalb der USPD in der Beurteilung der Arbeiterbewegung und ihrer Taktik große Meinungsverschiedenheiten. </p> <p>Zu Vorsitzenden der neuen Partei werden Wilhelm Dittmann und Hugo Haase gewählt.</p> <p>Auch Kurt Eisner ist in Gotha anwesend, obwohl er immer gegen die Spaltung der Partei war. Die Unzufriedenheit mit der SPD hat auch in Bayern zugenommen.</p> <p>Für die SPD sind die USPD-ler <em>„Vaterlandsverräter“</em>, für die USPD sind die SPD-ler <em>„Verräter am Sozialismus und an der Arbeiterschaft“</em>. </p>
6. 4 1917 - Beginn der französischen Offensive an der Aisne
<p><em><strong>Aisne</strong></em> * Beginn der französischen Offensive an der Aisne. Bis zur Einstellung der Offensive Ende Mai kann kein entscheidender Durchbruch erzielt werden. </p>
7. 4 1917 - Kaiser Wilhelm II. verspricht die Aufhebung des Dreiklassenwahlrechts
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Kaiser Wilhelm II. verspricht in seiner „<em>Osterbotschaft“</em> die Aufhebung des preußischen Dreiklassenwahlrechts nach dem Krieg. </p>
9. 4 1917 - Die deutsche Regierung forciert dei Rückkehr Lenins nach Russland
<p><strong><em>Schweiz - Deutsches Reich - Russland</em></strong> * Mit Einverständnis und Unterstützung der deutschen Regierung durchquert Wladimir I. Lenin zusammen mit 30 <em>„Revolutionären“</em> aus der Schweiz kommend im Zug das Deutsche Reich. Deutschland verspricht sich von Lenins Rückkehr eine Verschärfung der innenpolitischen Unruhen in Russland. </p>
10. 4 1917 - Wladimir Illjitsch Uljanow, genannt Lenin, reist nach Petrograd
<p><strong><em>Berlin - Petersburg</em></strong> * Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt <em>„Lenin“</em>, kehrt auf deutscher Veranlassung hin aus seinem Schweizer Asyl nach Petrograd zurück.</p>
13. 4 1917 - Kurt Eisner wird von seiner Ehefrau Lisbeth geschieden
Nürnberg * Kurt Eisner wird von seiner Ehefrau Lisbeth Eisner, geb. Hendrich, geschieden.
16. 4 1917 - Beginn der Rückverlagerung deutscher Truppen
Nordfrankreich * Beginn der Rückverlagerung deutscher Truppen in das ab 1916 ausgebaute Verteidigungssystem der Siegfriedstellung.
16. 4 1917 - 319 Betriebe der deutschen Rüstungsindustrie treten in den Streik
Berlin * In Berlin treten 319 Betriebe der deutschen Rüstungsindustrie mit 300.000 Arbeitern in den Streik. Es geht um die mangelhafte Lebensmittelversorgung. Der Streik wird von den revolutionären Obleuten, oppositionellen Gewerkschaftsfunktionären, deren Kern die Metallarbeiter bilden, gegen den Willen der Gewerkschaften organisiert.
17. 4 1917 - Michael von Faulhaber soll Münchner Erzbischof werden
Speyer - München * Michael von Faulhaber, der Bischof von Speyer, wird einen Tag nach den Beisetzungsfeierlichkeiten des verstorbenen Erzbischofs von München und Freising, Franziskus von Bettinger, in das Kultusministerium gebeten.
Dort eröffnet ihm Kultusminister Eugen von Knilling, dass er ihn dem König als Nachfolger vorschlagen wird.
17. 4 1917 - Lenin fordert eine sozialistische Revolution
Petersburg * In seinen „Aprilthesen“ fordert Wladimir I. Lenin in Petrograd eine sozialistische Revolution zur Ablösung der bürgerlichen Regierung.
17. 4 1917 - Zusätzliche Lebensmittelrationen versprochen
Berlin * Am zweiten Tag der Streiks beschließt die Vertreterkonferenz der Gewerkschaften, die Arbeit wieder aufzunehmen, nachdem die Regierungs- und Militärbehörden zusätzliche Lebensmittelrationen versprochen und die Zusage gegeben haben, dass niemand wegen der Teilnahme am Streik zum Militärdienst eingezogen werde.
Es wird vereinbart, dass Vertreter der Arbeiter künftig bei der Verteilung der Nahrungsmittel mitwirken sollen.
Ein Teil der Betriebe streikt weiter und wird daraufhin unter militärische Leitung gestellt.
Ab 18. 4 1917 - Eine Verhaftungswelle beendet den Streik
<p><em><strong>Berlin - Leipzig</strong></em> * Eine Verhaftungswelle beendet den Streik. Zahlreiche Streikende werden zum Militärdienst eingezogen. </p>
19. 4 1917 - Die „Jesuitengesetze“ werden in Deutschland endgültig aufgehoben
Deutschland * Die „Jesuitengesetze“ werden in Deutschland endgültig aufgehoben.
20. 4 1917 - Eugenio Pacelli zum Nuntius in München ernannt
<p><strong><em>Vatikan - München</em></strong> * Papst Benedikt XV. ernennt Eugenio Pacelli zum Nuntius in München. </p>
20. 4 1917 - Christliche Gewerkschaften gegen Streik
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * In einem Aufruf wendet sich der Vorstand der christlichen Gewerkschaften gegen jede Arbeitsniederlegung. </p>
23. 4 1917 - „Reichskanzler“ Bethmann Hollweg gegen die „Oberste Heeresleitung“
Kreuznach * Bei der Konferenz in Kreuznach zur erneuten Festlegung der Kriegsziele spricht sich „Reichskanzler“ Theobald von Bethmann Hollweg gegen die Pläne der „Obersten Heeresleitung - OHL“ aus, die eine weitgehende „Annexionen“ in Russland, Belgien und Frankreich vorsehen.
28. 4 1917 - Den Kampftag für Frieden, Freiheit und Brot verhindern
Berlin * Die Generalkommission und der SPD-Parteivorstand sprechen sich gegen jede Arbeitsruhe am 1. Mai aus, nachdem die Gruppe Internationale zu einem Kampftag für Frieden, Freiheit und Brot aufgerufen hat.
30. 4 1917 - Lion und Marta Feuchtwanger ziehen in die Georgenstraße 24
München-Schwabing * Lion und Marta Feuchtwanger beziehen ihre Eigentumswohnung in der Georgenstraße 24.
1. 5 1917 - Der USPD-Mitgliedsausweis von Kurt Eisner
München * Kurt Eisners Mitgliedsausweis bei der Münchner USPD - mit der Nummer sieben - wird am 1. Mai 1917 ausgestellt.
11. 5 1917 - Kinder werden zur besseren Ernährung aufs Land geschickt
München * Die ersten 1.000 von rund 6.000 Kinder werden mit Sonderzügen aufs Land gebracht, wo die Versorgungs- und Ernährungslage wesentlich besser ist als in der Stadt.
15. 5 1917 - Reichskanzler Bethmann Hollweg zur aktuellen Kriegspolitik
Berlin * Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hält eine programmatische Rede zur gegenwärtigen Kriegspolitik, ohne jedoch auf die Frage der Kriegsziele einzugehen.
15. 5 1917 - Sonderstrafbestimmungen gegen Kriegslügen
München * Das Kriegsministerium erlässt „Sonderstrafbestimmungen gegen die Verbreitung unwahrer Kriegsnachrichten“.
16. 5 1917 - Die Münchner USPD wird gegründet
München * Der Verein Unabhängige Sozialdemokratie Stadt und Land wird bei der Polizeidirektion vereinsrechtlich angemeldet. Der Zweck der Neugründung wird beschrieben als „die Bestrebungen der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu unterstützen, die nach ihren Organisationsgrundlinien in grundsätzlicher Opposition zum herrschenden Regierungssystem und zur Kriegspolitik der Reichsregierung steht“.
- Der Vorsitzende der Münchner USPD heißt Albert Winter sen..
- Die neue Partei wird sofort von der Polizei überwacht.
- Die Münchner USPD hat am Anfang etwa 35 Mitglieder.
- Im Vergleich: Die MSPD zählt in München zum gleichen Zeitpunkt rund 15.000 Mitglieder.
18. 5 1917 - In den USA beginnt die Wehrerfassung
USA * In den USA beginnt die Wehrerfassung aller Männer zwischen 21 und 30 Jahren. Drei Millionen Männer werden einberufen.
18. 5 1917 - Eine neue russische Regierung mit Beteiligung von Sozialdemokraten
Petersburg * In Absprache mit den Arbeiter- und Soldatenräten wird eine neue russische Regierung mit Beteiligung von Sozialdemokraten gebildet. Der Sozialrevolutionär Alexander F. Kerenski wird Kriegsminister.
25. 5 1917 - Nuntius Eugenio Pacelli nimmt seine Tätigkeit in München auf
München * Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli nimmt seine Tätigkeit in München auf.
26. 5 1917 - Die Kandidatur Michael von Faulhabers wird öffentlich verkündet
München * Die Ernennung Michael von Faulhabers zum Kandidaten für das Amt des Erzbischofs von München und Freising wird amtlich verkündet.
27. 5 1917 - Die französische Offensive an der Aisne wird verlustreich beendet
Aisne * Die am 6. April 1917 begonnene französische Offensive an der Aisne und in der Champagne wird nach großen Verlusten wieder eingestellt.
30. 5 1917 - Mary Stuck heiratet Konsul Albert Heilmann
München * Franz von Stucks Tochter Mary heiratet den Konsul Albert Heilmann. Er ist der Sohn des Bauunternehmers Jakob Heilmann.
2. 6 1917 - In Stockholm tagt der Internationale Sozialistenkongress
Stockholm - Paris * In Stockholm tagt vom 2. bis 19. Juni 1917 der Internationale Sozialistenkongress. Er sucht nach Möglichkeiten für einen Friedensschluss der verfeindeten und kriegsführenden Länder. Der französische Ministerpräsident Alexandre Ribot verweigert den Sozialisten seines Landes die Ausreise nach Stockholm.
2. 6 1917 - König Ludwig III. macht erneut seine Annexions-Absichten deutlich
München - Königreich Bayern * König Ludwig III. macht erneut seine Annexions-Absichten deutlich: „Bayern hat um so mehr Anspruch auf eine Vergrößerung, als es bei den letzten Friedensschlüssen immer schlecht abgeschnitten hat.“
3. 6 1917 - Die deutsche sozialistische Delegation trifft in Stockholm ein
Stockholm * Die deutsche Delegation trifft unter Führung von Philipp Scheidemann in Stockholm ein.
5. 6 1917 - 700 Zentner Mehl ergaunert
München * Das Lebensmittelamt deckt einen umfangreichen Betrug auf: „Die 17 Jahre alte Bäckermeistertochter Margarethe Krug hatte längere Zeit durch geschickte Fälschung von Zwischenscheinen für eingelieferte Brotmarken sich eine Mehrzuweisung von fast 700 Zentnern Mehl verschafft. Dasselbe wurde im väterlichen Geschäft verarbeitet und z.T. um Wucherpreise ohne Marken weiterverkauft.“ Die Schwindlerin kann festgenommen werden.
6. 6 1917 - Die SPD-Reichsfrauenkonferenz fordert das Wahlrecht für Frauen
Berlin * Die Reichsfrauenkonferenz der Sozialdemokraten fordert in Berlin das Wahlrecht für Frauen.
13. 6 1917 - Gold für unsere Helden!
München * In der SPD-Zeitung Münchener Post findet sich die Anzeige: „Deutsche Frauen tilgt Eure Ehrenschuld an unsere Helden und bringt Euren Goldschmuck der Goldankaufsstelle!“
15. 6 1917 - Der US-Kongress beschließt ein Anti-Spionage-Gesetz
USA * Der amerikanische Kongress beschließt ein Anti-Spionage-Gesetz, das schwerste Strafen für Kriegsbehinderung vorsieht und gegen die kriegsfeindlichen Sozialisten gerichtet ist.
16. 6 1917 - Der erste gesamtrussische Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte
Petersburg * Der erste gesamtrussische Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte findet in Petrograd statt. Wladimir I. Lenin unterstreicht den Führungsanspruch seiner Partei.
17. 6 1917 - Die Züge der Lebensmittel-Hamster
Ansbach - München * Der Regierungspräsident von Mittelfranken berichtet in einem persönlichen Brief an Innenminister Dr. Friedrich Ritter von Brettreich über seine Erfahrungen mit den Lebensmittel-Hamstern:
„Die Züge der Hamster zählten oft hunderte von Personen“. Sie traten noch in den entlegensten Weilern „mit äußerster Rücksichtslosigkeit“ auf. Er selbst war „wiederholt mitten in solchen schreienden, schwitzenden und schleppenden Haufen gewesen“, der Versuch des Eingreifens hätte „sichere Lebensgefahr“ bedeutet.
19. 6 1917 - In Großbritannien wird das Wahlrecht für Frauen eingeführt
Großbritannien * In Großbritannien wird das Wahlrecht für Frauen ab 30 Jahren eingeführt.
20. 6 1917 - Die Kaiser-Glocke des Kölner Doms wird eingeschmolzen
Köln * Die Kaiser-Glocke des Kölner Doms wird zur Metallverwertung eingeschmolzen. Sie ist mit 543 Zentnern eine der schwersten Glocken der Welt.
26. 6 1917 - Die erste US-Division landet bei St.-Nazaire in der Nähe von Nantes
Saint Nazaire * Die erste US-Division landet bei St.-Nazaire in der Nähe von Nantes (Bretagne).
27. 6 1917 - Griechenland tritt der Entente bei
Athen * Griechenland tritt auf Seiten der Alliierten in den Krieg ein.
2. 7 1917 - Rassenunruhen in St. Louis
<p><strong><em>St. Louis, Missouri</em></strong> * Josephine McDonald erlebt in St. Louis Rassenunruhen. Wegen rassenbedingter Gewalt durch weiße Amerikaner kommt es zu einem mehrtägigen Massaker, das als <em>„schlimmster Fall arbeitsbedingter Gewalt in der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts“</em> und als eines der schlimmsten rassistischen Massaker in der Geschichte der USA beschrieben wird.</p> <p>Das ist ein so prägendes Erlebnis, dass Josephine Baker später zu einer engagierten Kämpferin gegen Rassismus werden wird. </p>
6. 7 1917 - Matthias Erzberger fordert einen annexionslosen Frieden
Berlin * Der Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger fordert in er Aufsehen erregenden Rede vor dem Hauptausschuss des Reichstags einen annexionslosen Frieden, da keine Aussicht auf einen Sieg mehr besteht.
- Er will eine Friedensinitiative des Parlaments und fordert zugleich
- den Rücktritt des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg.
6. 7 1917 - Der Interfraktionelle Ausschuss wird gegründet
Berlin * Der Interfraktionelle Ausschuss wird gegründet. Es ist ein inoffizielles Gremium, das die Arbeit der Reichstagsfraktionen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - SPD, der Zentrumspartei und der Fortschrittlichen Volkspartei - FVP koordiniert. Bis Januar 1918 beteiligen sich auch Abgeordnete der Nationalliberalen Partei - NLP an den Beratungen im Interfraktionellen Ausschuss.
Diese Parteien stellen seit der Reichstagswahl vom 12. Januar 1912 die Mehrheit im Reichstag, weshalb auch von der Reichstagsmehrheit gesprochen wird.
Der Interfraktionelle Ausschuss bildet den Auftakt zur Parlamentarisierung des Deutschen Kaiserreiches.
7. 7 1917 - Die deutsche Luftwaffe greift London an
London * Die deutsche Luftwaffe greift London an. Der bis dahin größte Luftangriff fordert 54 Tote und 190 Verwundete.
11. 7 1917 - Entlassung von Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg gefordert
Berlin * Die Oberste Heeresleitung - OHL, bestehend aus Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Generalquartiermeister Erich Ludendorff, fordern die Entlassung von Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg wegen dessen Kriegszielpolitik.
11. 7 1917 - Planungen für die Änderung des preußischen Dreiklassenwahlrechts
Berlin * Das Preußische Staatsministerium erhält den Auftrag, eine Vorlage zur Änderung des preußischen Dreiklassenwahlrechts für die Zeit nach dem Krieg vorzubereiten.
Um 12. 7 1917 - Zwei-Mark-Scheine mit Revolutionsparolen
München - Königreich Bayern * Die ersten Zwei-Mark-Scheine tauchen auf, auf denen mit Tintenstift - und damit unentfernbar - Nachrichten geschrieben sind:
Keinen Frieden ohne Revolution, Hoch die Revolution! Nieder mit dem Krieg! oder Macht es wie in Russland, dann haben wir Frieden!.
Da eine Anzeige bei der Polizei zum Einzug des Zahlungsmittels führt, wird er möglichst schnell weitergegeben.
13. 7 1917 - Der Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg wird gestürzt
Berlin * Die Oberste Heeresleitung - OHL und die Reichsstagsmehrheit, bestehend aus SPD, Fortschrittspartei und Zentrum, stürzen den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg.
13. 7 1917 - Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg tritt zurück
Berlin * Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg reicht seinen Rücktritt ein. Sein Nachfolger wird Georg Michaelis.
13. 7 1917 - Kronprinz Rupprecht: Ludendorff soll politisch gebändigt werden
Lille - München * Kronprinz Rupprecht berichtet seinem Vater, König Ludwig III., es sei „wahrhaft unglaublich, wie es in Berlin zugeht - der Kanzler ist wohl unhaltbar. Ludendorff muss aber unbedingt auf sein militärisches Fach beschränkt werden und darf sich nicht in alle Fragen der inneren und äußeren Politik mengen“.
Er bittet seinen Vater zum Kaiser nach Berlin zu fahren, denn es steht „viel auf dem Spiel, um nicht zu sagen Alles!“.
Kronprinz Rupprecht fürchtet die Einführung des Parlamentarismus auf Reichsebene am meisten, da das das Ende der Einzelstaaten bedeuten würde.
14. 7 1917 - Die Reichstagsmehrheit verabschiedet eine Friedensresolution
Berlin * Die Reichstagsmehrheit bestehend aus SPD, Zentrum und Fortschrittliche Volkspartei - FVP verabschiedet im Reichstag die vom Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger am 6. Juli 1917 geforderte Friedensresolution.
- In dieser treten sie für „einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker“ ein,
- mit dem „erzwungene Gebietserwerbungen und politische, wirtschaftliche und finanzielle Vergewaltigungen unvereinbar“ sind.
14. 7 1917 - Antimonarchische Stimmung durch Kaiser Wilhelm II.
Lille * Kronprinz Rupprecht bedauert in seinem Tagebuch die sich in weiten Teilen des Deutschen Reiches um sich greifende antimonarchische Stimmung. Die Schuld daran gibt er Kaiser Wilhelm II..
„Durch seine fortgesetzten Missgriffe und seine Untätigkeit ist der Kaiser um alles Ansehen gekommen und die Verstimmung geht so weit, dass manche monarchisch gesinnte und ernsthaft denkende Leute bezweifeln, ob die Dynastie der Hohenzollern den Krieg überdauern wird“.
16. 7 1917 - Massenaufstand gegen die Provisorische Regierung niedergeschlagen
Petersburg * Ein vom 16. bis 18. Juli 1917 andauernder bewaffneter Massenaufstand in Petrograd gegen die Provisorische Regierung wird niedergeschlagen. Die bolschewistischen Zeitungen werden verboten.
17. 7 1917 - König Georg V. ändert den Namen seines Hauses in Windsor
London * Der britische König Georg V. ändert den Namen seines Hauses von Sachsen-Coburg-Gotha in Windsor.
19. 7 1917 - Antrittsrede des neuen Reichskanzlers Georg Michaelis
Berlin * Der neu ernannte Reichskanzler Georg Michaelis kündigt in seiner Antrittsrede eine bessere Zusammenarbeit zwischen Regierung und Reichstag an.
Die am 14. Juli von der Reichstagsmehrheit verabschiedete Friedensresolution nimmt er nur so zur Kenntnis, „wie ich sie auffasse“. Das heißt, dass Macht- und Kriegszielpolitisch alles beim Alten bleibt.
20. 7 1917 - Georgij Fürst Lwow tritt zurück
Petersburg * Ministerpräsident Georgij Fürst Lwow tritt zurück. Sein Nachfolger als Ministerpräsident der russischen Provisorischen Regierung wird Alexander F. Kerenski, der seit Mai 1917 im Kabinett Lwow Kriegs- und Marineminister ist.
21. 7 1917 - Georgi J. Fürst Lwow tritt als russischer Ministerpräsident zurück
Petersburg * Der russische Kriegs- und Marineminister Alexander F. Kerenski wird Ministerpräsident der russischen Provisorischen Regierung, nachdem am Tag zuvor Georgi J. Fürst Lwow zurückgetreten ist.
22. 7 1917 - Rosa Luxemburg wird in das Breslauer Gefängnis überführt
Wronke - Breslau * Rosa Luxemburg wird von der Festung Wronke in das Breslauer Gefängnis überführt.
24. 7 1917 - Michael von Faulhaber wird 8. Erzbischof von München und Freising
Vatikan * Der Bischof von Speyer, Michael von Faulhaber, wird durch Papst Benedikt XV. zum 8. Erzbischof von München und Freising ernannt. Zuvor hat Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., die Eignung und Würdigkeit des Kandidaten festgestellt.
24. 7 1917 - Im Pariser Justizpalast beginnt der Prozess gegen Mata Hari
Paris * Im Pariser Justizpalast beginnt der Prozess vor dem Militärgericht gegen Mata Hari.
In der Presse kursiert das Gerücht, Mata Hari habe den Deutschen geheime Informationen über den Bau der neuartigen Panzer zugespielt, mit denen die Alliierten dem Krieg eine entscheidende Wende geben wollen. Eine absurde Behauptung, die sogar die seriöse New York Times aufgreift.
Mata Hari, wird deshalb beschuldigt, als Doppelagentin wichtige Informationen an die Deutschen verraten und damit das Leben von 50.000 französischen Soldaten im Ersten Weltkrieg aufs Spiel gesetzt zu haben.
24. 7 1917 - Wladimir I. Lenin flieht nach Finnland
Petersburg * Nach der Niederschlagung des Putschversuchs in Petrograd gegen die Provisorische Regierung flieht Wladimir I. Lenin nach Finnland.
25. 7 1917 - Mata Hari wird wegen Spionage und Hochverrat zum Tode verurteilt
Paris * Das Militärgericht in Paris fällt nach nur zwei Verhandlungstagen das Urteil gegen Margaretha Geertruida MacLeod, alias Mata Hari. Sie wird wegen Doppelspionage und Hochverrats zum Tode verurteilt.
28. 7 1917 - Offene Propaganda gegen die Glaubensbrüder der verfeindeten Nationen
München - Berlin * Der Feldprobst der bayerischen Armee, der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber, schreibt an Kaiser Wilhelm II., dass „auch die Seelsorge mit dem Schwert des Geistes, das ist mit dem Wort Gottes, das heilige Recht unseres treuen Vaterlandes zu verteidigen und die Seelen zum höchsten Kraftaufgebot zu wecken bemüht war“.
Der deutsche Klerus hat sich damit in die Kriegsrhetorik eingefügt und betreibt offen Propaganda gegen die Glaubensbrüder der verfeindeten Nationen. Faulhaber predigt den bayerischen Truppen. Und diese Rhetorik geht so: „Ein Mann nach dem Herzen Gottes handelt nach dem Willen Gottes. Hat man einmal klar erkannt: ‚Das ist Gottes Wille, das ist meine Pflicht, bei dieser Fahne ist mein Platz‘, dann bleibt‘s dabei, heute und morgen und übermorgen.“
29. 7 1917 - Kurt Eisner heiratet Else Belli in Großhadern
Großhadern * Kurt Eisner heiratet Else Belli in Großhadern.
31. 7 1917 - Winston Churchill wird britischer Rüstungsminister
London * Winston Churchill wird britischer Rüstungsminister.
31. 7 1917 - Die dritte Flandernschlacht beginnt
Ypern * Die dritte Flandernschlacht, auch dritte Ypernschlacht genannt, beginnt. Sie endet am 6. November 1917 mit enormen Verlusten an Soldaten und Kriegsmaterial, weswegen die Flandernoffensive für die „Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges“ steht.
31. 7 1917 - 400 Matrosen für einen Frieden ohne Annexionen
??? * Auf dem Kriegsschiff König Albert unterzeichnen 400 Matrosen eine Erklärung für einen Frieden ohne Annexionen. Gleichzeitig geben sie ihren Eintritt in die USPD bekannt.
1. 8 1917 - Papst Benedikt XV. fordert einen Frieden ohne Annexionen
Vatikan * Papst Benedikt XV. richtet einen Friedensappell an die kriegführenden Mächte: „Soll denn die zivilisierte Welt nur noch ein Leichenfeld sein?“, fragt der Papst in seiner Friedensnote. „Soll das ruhmreiche und blühende Europa, wie von einem allgemeinen Wahnsinn fortgerissen, in den Abgrund rennen und Hand an sich selbst anlegen zum Selbstmord?“
Er ruft in seiner Friedensbotschaft zu einem Frieden ohne Annexionen auf, so „wie es jenem ziemt, der als der gemeinsame Vater alle seine Kinder mit der gleichen Liebe umgibt“.
Doch sowohl die Entente wie auch die Mittelmächte glauben an ein Komplott und diffamieren Benedikt XV. als „Papst der Gegner“. Für die Franzosen wird er zum „pape boche“; der deutsche Generalquartiermeister Erich Ludendorff spricht dagegen nur noch vom „Franzosenpapst“.
Wohl am enttäuschendsten sind für Papst Benedikt XV. aber die Reaktionen der Bischöfe in den kriegführenden Ländern. Die meisten haben sich schon 1914 dem allgemeinen Hurrapatriotismus angeschlossen. Statt sich nun hinter ihr übernationales Oberhaupt der katholischen Kirche zu versammeln, geben sie sich nationalistisch.
Nur im kriegsmüden Italien findet der Vorschlag große Zustimmung.
2. 8 1917 - 400 Matrosen demonstrieren in Wilhelmshaven für den Frieden
Wilhelmshaven * 400 Matrosen demonstrieren in Wilhelmshaven für den Frieden.
5. 8 1917 - Es kommt zu Meutereien in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven * Auf Grund mangelhafter Versorgung sowie durch schlechte und teilweise schikanöse Menschenführung kommt es zu Meutereien in der deutschen Hochseeflotte.
Heizer des Schlachtschiffes SMS Prinzregent Luitpold und dem Schwesterschiff Friedrich der Große treten daraufhin in den „Hungerstreik“.
Die Anführer des Matrosenaufstands werden nach der Niederschlagung der Gehorsamsverweigerungen und Meutereien verhaftet und teilweise zum Tode verurteilt.
23. 8 1917 - Michael von Faulhaber verlässt Speyer
Speyer - München * Der designierte Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber verlässt Speyer und kommt am 30. August in München an.
25. 8 1917 - Fünf Anführer des Matrosenaufstandes werden zum Tode verurteilt
Wilhelmshaven * Fünf Anführer des Matrosenaufstandes vom 5. August 1917 werden zum Tode verurteilt. Drei Todesurteile werden in Haftstrafen umgewandelt. Der Oberbefehlshaber der deutschen Flotte, Admiral Reinhard Scheer, besteht jedoch auf der Erschießung der beiden Heizer Max Reichpietsch und Albin Köbis, die als Hauptredner bei den Protestversammlungen aufgetreten waren.
30. 8 1917 - Michael von Faulhaber trifft in München ein
München * Der designierte Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber trifft - von Speyer kommend - in München ein.
2. 9 1917 - Die Deutsche Vaterlandspartei - DVLP wird gegründet
Königsberg * Am Tag des Friedens bei Sedan wird die erzkonservative, nationalistische, völkische und antisemitische Deutsche Vaterlandspartei - DVLP von ultrarechten Kräften, darunter Großadmiral Alfred von Tirpitz und dem ostpreußischen Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp, gegründet.
Innenpolitisch kündigt die Vaterlandspartei den Burgfrieden von rechts auf. Sie plädiert für einen unterdrückenden und autoritären Kurs gegenüber der Arbeiterbewegung und greift auch bürgerliche Politiker heftig an, die sich – wie beispielsweise den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger - für eine Reform des politischen Systems unter Einbeziehung der SPD aussprechen.
Die Parteiführung verfolgt den Plan, mit Hilfe eines „starken Mannes“ einen autoritären Staatsumbau einzuleiten und dabei den Reichstag und die Linksparteien auszuschalten. Im äußersten Fall sollte auch der „zu weiche Kaiser“ Wilhelm II. bei einer sich bietenden Gelegenheit für „regierungsunfähig“ erklärt und der weit rechts stehende Kronprinz von Preußen zum Regenten ernannt werden.
Außenpolitisch tritt die Vaterlandspartei für einen deutschen Siegfrieden und ein umfassendes Programm direkter und indirekter Expansion ein.
Mit ihren Kampagnen gegen einen Verzichtfrieden - oder Judenfrieden genannten Verständigungsfrieden - und gegen Schlappheit und Verrat an der Heimatfront legt die Deutsche Vaterlandspartei - DVLP den Grundstein für den Nachkriegsdiskurs über die Novemberverbrecher und die Dolchstoß-Legende.
3. 9 1917 - Michael von Faulhaber besetzt den Münchner Erzbischofsstuhl
München-Kreuzviertel * Die Inthronisation des neuen Erzbischofs von München-Freising, also die liturgische Einführung in sein Amt und die rechtliche Besitzergreifung seiner Diözese, erfolgt. Angesichts des Krieges verzichtet Michael von Faulhaber auf die sonst üblichen großen Feierlichkeiten sowie den Festzug durch die Stadt. Stattdessen fährt er direkt vom Palais Holnstein zum Dom. Äußeres Zeichen für die Besitzergreifung der Erzdiözese durch den Oberhirten ist die Übernahme der Kathetra und des Bischofsstabes.
Als Faulhaber seinen Münchner Bischofsstuhl besetzt, ist er 48 Jahre alt. Dreieinhalb turbulente Jahrzehnte übt er das Amt des Erzbischofs von München und Freising aus. Sie bringen das Ende der Monarchie durch eine unblutige Revolution und führen von der Räterepublik über die Weimarer Republik zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und schließlich zum mühsamen Wiederaufbau nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg.
7. 9 1917 - Der französische Ministerpräsident Alexandre Ribot tritt zurück
Paris * Nach dem Austritt der Sozialisten aus seiner Regierung erklärt der französische Ministerpräsident Alexandre Ribot seinen Rücktritt. Neuer französischer Ministerpräsident wird der bisherige Kriegsminister Paul Painlevé.
14. 9 1917 - Ludwig Thoma wird Gründungsmitglied der Deutschen Vaterlandspartei
Tegernsee * Ludwig Thoma wird Gründungsmitglied in der scharf nationalistischen Deutschen Vaterlandspartei - DVLP.
14. 9 1917 - Der russische Ministerpräsident Kerenski proklamiert die Republik
Petersburg * Der russische Ministerpräsident Alexander F. Kerenski proklamiert die Republik und beruft eine neue Regierung.
18. 9 1917 - Die SPD bringt den Antrag Auer-Süßheim ein
München-Kreuzviertel * Ein von der SPD in der Bayerischen Abgeordnetenkammer eingebrachter Reformantrag, genannt „Antrag Auer-Süßheim“, fordert:
- Ersetzung des Zweikammersystems durch das Einkammersystem.
- Aufhebung der Kammer der Reichsräte.
- Einführung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts zum Landtag für alle volljährigen Staatsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts nach den Grundsätzen der Verhältniswahl.
- Ausbau der Gesetzesinitiative des Landtags.
- Beseitigung des königlichen Sanktionsrechts.
- Ernennung der Minister und Bundesratsmitglieder nach Vorschlag des Landtags.
- Selbstbestimmungsrecht des Landtags in Bezug auf Zusammentritt und Vertagung.
- Einjähriger Staatshaushalt.
- Beseitigung aller Vorrechte der Geburt und des Standes, Aufhebung der bisherigen Privilegien der Standesherren, Abschaffung des Adels.
- Verbot der Bildung neuer und der Vergrößerung bisheriger Fideikommisse. Auflösung der bestehenden Fideikommisse.
- Aufhebung der bisherigen Privilegien des Königs und der Mitglieder der königlichen Familie, insbesondere der Steuer- und Portofreiheit, der Unverantwortlichkeit und des besonderen Gerichtsstandes.
- Trennung der Kirche vom Staat, Aufhebung der Privilegien der anerkannten Religionsgemeinschaften. Vollkommene Durchführung der Gewissens-, Religions- und Kultusfreiheit.
21. 9 1917 - Leo D. Trotzki leitet das bolschewistische Präsidium
Petersburg • Der Petrograder Arbeiter- und Soldatenrat wählt ein bolschewistisches Präsidium unter Leitung von Leo D. Trotzki.
22. 9 1917 - Das Oktoberfest fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese • Eigentlich müsste das Oktoberfest beginnen. Es fällt diese Jahr aber erneut kriegsbedingt aus.
24. 9 1917 - Die Deutsche Vaterlandspartei fordert einen unbedingten Siegfrieden
Berlin * Ludwig Thoma tritt bei der Gründungsversammlung der Deutschen Vaterlandspartei - DVLP in der Berliner Philharmonie als Redner auf, wofür ihm der Parteivorsitzende, der ehemalige Großadmiral Alfred von Tirpitz, persönlich dankt.
Die neugegründete Deutsche Vaterlandspartei - DVLP fordert auf ihrer ersten Großkundgebung in Berlin einen „unbedingten Siegfrieden“.
2. 10 1917 - Fritz Gerlich ist Mitbegründer der Vaterlandspartei in Bayern
München * Dr. Fritz Gerlich beteiligt sich an der Gründung der Deutschen Vaterlandspartei - DVLP in Bayern.
2. 10 1917 - Die Deutsche Vaterlandspartei formiert sich in München
München * Als Ableger der am 2. September in Königsberg gegründeten Deutschen Vaterlandspartei - DVLP formiert sich in München der Landesverein Bayern. Prominenteste Fürsprecher des Landesvereins sind Cosima Wagner und Ludwig Thoma. Die bürgerliche Sammelbewegung tritt mit dem Ziel einer Stärkung des Durchhaltewillens bis zum Siegfrieden an.
6. 10 1917 - Schwere Auseinandersetzungen über vaterländische Propaganda
Berlin * Im Reichstag kommt es zu schweren Auseinandersetzungen über die vaterländische Propaganda des Alldeutschen Verbands und der Deutschen Vaterlandspartei - DVLP.
Um den 15. 10 1917 - Der Vorwärts ruft zur Zeichnung von Kriegskrediten auf
Berlin * Das sozialdemokratische Parteiorgan Vorwärts ruft zur Zeichnung von Kriegskrediten auf: „Rede nicht! Frage nicht! Zeichne! [...] Dem Feind gezeigt, dass unsere Alten zu Hause genau so gut zu fechten verstehen wie unsere herrliche Jugend draußen!“
15. 10 1917 - Mata Hari wird im Festungsgraben von Schloss Vincennes hingerichtet
Schloss Vincennes * Margaretha Geertruida MacLeod, alias Mata Hari, wird im Festungsgraben von Schloss Vincennes als Doppelspionin hingerichtet. Sie lehnt es ab, bei der Hinrichtung eine Augenbinde zu tragen, berichtet die Presse.
19. 10 1917 - Das russische Parlament wird aufgelöst
Petersburg * Das russische Parlament wird aufgelöst. Das neue republikanische Vorparlament wird von den Bolschewiken boykottiert. Wladimir I. Lenin beschließt in der ZK-Sitzung der Bolschewiken den bewaffneten Aufstand gegen die Regierung Alexander Kerenski.
19. 10 1917 - Der Bayerische Beamten- und Lehrerbund wird gegründet
München * Der Bayerische Beamten- und Lehrerbund wird gegründet. Sein Zweck wird in der Satzung festgesetzt: „Die Förderung der rechtlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Angelegenheiten der öffentlichen Beamten und Lehrer Bayerns."
22. 10 1917 - Reichskanzler Georg Michaelis wird das Vertrauen entzogen
Berlin * Die Mehrheitsparteien im Reichstag (Sozialdemokraten, Linksliberale und katholisches Zentrum) entziehen Reichskanzler Georg Michaelis das Vertrauen wegen
- seiner eigenwilligen Interpretation der Friedensresolution,
- seines scharfen Vorgehens gegen die USPD sowie wegen
- seiner Ablehnung einer Reform des Dreiklassenwahlrechts.
Ab dem 24. 10 1917 - Die Offensive der Mittelmächte am Isonzo
Isonzo * Die Offensive der Mittelmächte am Isonzo führt zum Zusammenbruch der italienischen Front und zur Eroberung der Provinz Friaul-Julisch-Venetien. Große Teile der italienischen Armee werden gefangengenommen oder lösen sich auf. Großbritannien und Frankreich raten zum Kriegsaustritt Italiens.
25. 10 1917 - Die Frauen fordern das Wahlrecht
Berlin * In einem Brief an Reichskanzler Georg Michaelis fordern Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Marie Juchacz, Helene Lange und andere:
- „Jetzt ist die Stunde da, in der wir Frauen nach unseren Staatsbürgerrechten laut verlangen müssen. Sollen wir keinen Teil haben an dem was jetzt wird? Haben wir Frauen nicht auch im vollsten Maße unsere schweren Pflichten erfüllt?
- Es ist bitter, immer wieder vom neuen aufzählen zu müssen, warum auch wir uns zur vollbewussten Teilnahme am Leben des Volkes berechtigt fühlen.
- Wir sind Staatsbürgerinnen und wollen als solche behandelt sein;
- Gebt uns Frauen daher das Wahlrecht!“
26. 10 1917 - „Ein nach außen nicht unbedenkliches Vorgehen“
München * Finanzminister Georg Ritter von Breunig gibt die erste Stellungnahme der Regierung zur Gründung des Bayerischen Beamten- und Lehrerbundes vor der Abgeordnetenkammer ab. Er nennt sie „eine Erscheinung, die zu unserer Väter Zeiten für unmöglich erachtet worden wäre“. In Hinblick auf die Kriegssituation bezeichnet er dies als „ein nach außen nicht unbedenkliches Vorgehen“.
29. 10 1917 - Handball erhält ein Regelwerk
Berlin * Erstmals wird Handball in ein verbindliches Regelwerk gegossen.
31. 10 1917 - Reichskanzler Georg Michaelis tritt zurück
Berlin * Reichskanzler Georg Michaelis tritt zurück, nachdem ihm am 22. Oktober 1917 die Mehrheitsparteien (Sozialdemokraten, Linksliberale und katholisches Zentrum) das Vertrauen entzogen hatten.
1. 11 1917 - Georg Freiherr von Hertling wird zum Reichskanzler ernannt
Berlin * Kaiser Wilhelm II. ernennt den bisherigen bayerischen Ministerpräsidenten Georg Freiherr von Hertling zum Reichskanzler. Er wird Nachfolger von Georg Michaelis, der das Amt nur dreieinhalb Monate inne hatte.
1. 11 1917 - Ein Hirtenbrief warnt vor einem Frieden
Deutsches Reich * Der deutsche Episkopat warnte in Hinblick auf den Friedensappell von Papst Benedikt XV. vom 1. August 1917 in einem Hirtenbrief vor einem Frieden „als Judaslohn für Treubruch und Verrat am Kaiser“.
2. 11 1917 - Die Verordnung über die Zusammenfassung von Brauereibetrieben
München * Die Verordnung über die Zusammenfassung von Brauereibetrieben leitet einen Konzentrationsprozess ein.
2. 11 1917 - England verspricht den Juden ein „national home“ in Palästina
London - Berlin * Der britische Außenminister Arthur James Earl of Balfour verspricht den Juden ein „national home“ in Palästina. Die Balfour-Deklaration wird in Deutschland von rechtsgerichteten Kreisen als Bündnis Großbritanniens mit den Zionisten zu antisemitischer Agitation genutzt.
5. 11 1917 - Die deutsch-österreichische Kriegsziel-Konferenz tagt in Berlin
Berlin * Die in Berlin tagende deutsch-österreichische Kriegsziel-Konferenz beschließt
- die Angliederung von Litauen und Kurland an das Deutsche Reich“ und
- die Vereinigung des russischen Teils von Polen und Galizien mit dem Königreich Polen.
5. 11 1917 - Die russische Regierung lässt bolschewistische Zeitungsbüros besetzen
Petersburg * Die russische Regierung befiehlt die Besetzung bolschewistischer Zeitungsbüros. Sie löst damit den bewaffneten Aufstand der Bolschewiken aus.
6. 11 1917 - Die dritte Flandernschlacht endet mit hohen Menschenverlusten
Ypern * Die dritte Flandernschlacht, auch dritte Ypernschlacht genannt, endet trotz der enormen Verluste an Soldaten und Kriegsmaterial ohne nennenswerte Durchbrüche. Die Frontlinie hat sich nur minimal verschoben.
Die britische Armee muss mehr als 250.000 Tote beklagen, auf deutscher Seite sterben über 40.000 Soldaten. Die Flandernoffensive steht schon deshalb für die „Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges“.
7. 11 1917 - Wladimir I. Lenin stürzt die provisorische russische Regierung
Petersburg * Die Bolschewiki unter Führung von Wladimir I. Lenin stürzen in einem bewaffneten Aufstand in Petrograd die provisorischen Regierung unter Alexander F. Kerenski. Die Roten Garden der Bolschewiken besetzen strategisch wichtige Punkte in Petrograd und belagern den Winterpalast, den Sitz der provisorischen Regierung.
Damit beginnt in Russland die Revolution. Lenin schafft eine Sowjetrepublik, die sich auf Räte [russisch: Sowjets] stützt.
Da diese Auseinandersetzungen nach dem alten russischen Kalender auf den 25. Oktober fallen, erhalten diese systemumwerfenden Vorgänge den Namen Oktober-Revolution. Erst nach dieser - für die Bolschewiki erfolgreichen - Revolution wird der russische Kalender von der julianischen Zeitrechnung auf die gregorianische umgestellt.
7. 11 1917 - Kraft- und Pferdedroschkenbesitzer gründen eine Einkaufsgenossenschaft
München * Die Münchner Kraft- und Pferdedroschkenbesitzer gründen eine Einkaufsgenossenschaft, um die durch den Ersten Weltkrieg entstandene Mangelsituation an Kraftstoff, Reifen, Öle und Pferdefutter zu begegnen. Aus dieser Einkaufsgenossenschaft entwickelte sich die heutige Münchner Taxi eG.
8. 11 1917 - Bolschewistische Truppen stürmen den Winterpalast
Petersburg * Bolschewistische Truppen stürmen den Winterpalast und verhaften die Regierungsmitglieder. Ministerpräsident Alexander F. Kerenski flieht zu den Truppen an der Nordfront. Der allrussische Rätekongress billigt die bolschewistische Machtübernahme.
9. 11 1917 - Regierung der Volkskommissare unter dem Vorsitz von Wladimir I. Lenin
Petersburg * Die siegreichen Revolutionäre in Russland bilden eine Regierung der Volkskommissare unter dem Vorsitz von Wladimir I. Lenin. Sie erlassen ein Dekret über einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen.
11. 11 1917 - Otto von Dandl wird Bayerischer Ministerpräsident
München-Kreuzviertel * Otto von Dandl wird Bayerischer Ministerpräsident und Außenminister als Nachfolger von Georg Freiherr von Hertling.
11. 11 1917 - Parolen für den Frieden in Wien
Wien * Bei einer Friedensversammlung in Wien wird die Parole „Gebt uns den Frieden wieder oder wir legen die Arbeit nieder“ ausgegeben.
13. 11 1917 - Armee von Alexander F. Kerenski vernichtend geschlagen
Zarskoje Selo * Die Rote Garde der Bolschewiken schlägt bei Zarskoje Selo die Armee des abgesetzten Ministerpräsidenten Alexander F. Kerenski vernichtend.
13. 11 1917 - Der französische Ministerpräsident Paul Painlevé tritt zurück
Paris * Weil er keine Akzeptanz im Parlament findet, tritt der französische Ministerpräsident Paul Painlevé zurück.
17. 11 1917 - Georges Clemencau wird neuer französischer Ministerpräsident
Paris * Nach dem Rücktritt von Paul Painlevé am 13. November wird Georges Clemencau neuer französischer Ministerpräsident.
20. 11 1917 - Die Briten setzen bei Cambrai ihre Panzer ein
Cambrai * Die Briten setzen bei Cambrai erfolgreich und in großer Menge ihre Tanks [= Panzer] ein.
25. 11 1917 - Der schnellste und sicherste Weg zum Frieden
München-Isarvorstadt * Kurt Eisner spricht auf einer USPD-Versammlung in den Kolosseum-Bierhallen vor rund 200 Anwesenden über seine Vorstellung der raschen Beendigung des Krieges.
Obwohl die Veranstaltung von der Polizei überwacht wird, ruft er zum Sturz der bestehenden Regierungen auf. Der schnellste und sicherste Weg zum Frieden ist nach seiner Auffassung die Übernahme der Macht durch das Proletariat. Nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch in den generischen Ländern.
28. 11 1917 - Die russische Regierung will einen Waffenstillstand
Petersburg * Die russische Räteregierung schlägt allen kriegführenden Parteien einen Waffenstillstand vor. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn stimmen diesem Vorschlag zu, weil damit ein Teil der Soldaten von der Ostfront abgezogen und zusätzlich an der Westfront eingesetzt werden könnte. Die Alliierten lehnen einen Separatfrieden Russlands mit den Mittelmächten ab.
28. 11 1917 - Die Amtszeit des Münchner Magistrats wird verlängert
München * Ohne Wahl wird die Amtszeit des am 13. Dezember 1914 gewählten Münchner Magistrats um zwei Jahre verlängert.
An Stelle von Dr. Otto Merkt, dessen Wiederwahl die Sozialdemokraten und die Liberalen verweigern, wird Hofrat Dr. Hans Küfner zum II. rechtskundigen Bürgermeister gewählt.
2. 12 1917 - Die ersten Handball-Spiele finden in Berlin statt
Berlin * Die ersten Handball-Spiele finden in Berlin statt.
4. 12 1917 - Finnland erklärt seine Unabhängigkeit von Russland
Helsinki * Finnland erklärt seine Unabhängigkeit von Russland. Die russische Oktoberrevolution vom 7. November ermöglichte Finnland die Loslösung. Das Land war von 1808 bis 1917 als ein autonomes Großherzogtum Teil des russischen Reiches.
5. 12 1917 - In Brest-Litowsk ein zehntägiger Waffenstillstand vereinbart
Brest-Litowsk * Zwischen dem Deutschen Reich und Russland wird in Brest-Litowsk ein zehntägiger Waffenstillstand vereinbart.
7. 12 1917 - Die USA erklären Österreich-Ungarn den Krieg
Washington - Wien * Der amerikanische Kongress beschließt einstimmig die Kriegserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika an Österreich-Ungarn.
9. 12 1917 - Britische Soldaten marschieren in Jerusalem ein
Jerusalem * Britische Soldaten marschieren in Jerusalem ein und beenden damit die 673 Jahre währende osmanische Herrschaft.
9. 12 1917 - Die Kolonie Deutsch-Ostafrika wird von britischen Truppen besetzt
Deutsch-Ostafrika [= heute Tansania] * Die deutsche Kolonie Deutsch-Ostafrika wird von den britischen Truppen vollständig besetzt.
9. 12 1917 - Rumänien und die Mittelmächte vereinbaren einen Waffenstillstand
Focsani - Sofia - Berlin - Wien * Das Königreich Rumänien und die Mittelmächte vereinbaren in Focsani einen Waffenstillstand, der die Einstellung der Kampfhandlungen an der rumänischen Front zum Inhalt hat.
11. 12 1917 - Kriegserklärung der USA an Österreich-Ungarn verkündet
Washington - Wien * Die Kriegserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika an Österreich-Ungarn wird offiziell verkündet. Im k.u.k. Ministerium des Äußern kann die amerikanische Kriegerklärung jedoch erst am 18. Dezember 1917 in Empfang genommen werden.
12. 12 1917 - Der Normenausschuss der Deutschen Industrie wird in Berlin gegründet
Berlin * Der Normenausschuss der Deutschen Industrie wird in Berlin gegründet. Er setzt die Deutsche Industrie Norm - DIN fest.
Um den 13. 12 1917 - Gespräche in Berlin über den Massenstreik
München - Berlin * Kurt Eisner fährt für mehrere Tage in die Reichshauptstadt Berlin, um dort persönliche Angelegenheiten zu regeln. Er nutzt die Gelegenheit, um mit USPD-Abgeordneten Gespräche über die aktuelle politische Lage und über den Massenstreik zu führen.
Doch die Berliner USPD-Funktionäre zögern und stellen ihm dar, dass die Massen für einen allgemeinen Streik nicht zu haben sind, weil sich trotz der erkennbaren Erregung über die Lebensbedingungen eine Erschöpfung eingestellt hat.
Nach der Aufnahme der Gespräche über Waffenstillstandsvereinbarungen in Brest-Litowsk am 5. Dezember 1917 hofft die Bevölkerung nun auf Frieden, für den unter diesen Voraussetzungen keine besondere Anstrengung zur Herbeiführung mehr notwendig ist.
Kurt Eisner widerspricht dieser Darstellung vehement und unterstellt den Parteifunktionären, dass ihnen selbst zu einer derartigen Aktion das notwendige Vertrauen fehle. Er sieht sehr wohl bei den Massen das lebhafte Bedürfnis nach einer „idealistischen Aktion“.
15. 12 1917 - Waffenstillstand mit Russland verlängert
Brest-Litowsk * Der Waffenstillstand zwischen Russland und dem Deutschen Reich wird bis zum 14. Januar 1918 verlängert.
Um den 17. 12 1917 - Einschränkungen bei der Versorgung
Königreich Bayern * Die anhaltende Kälte führt vor allem in den bayerischen Großstädten zu Einschränkungen in der Brennstoff- und Lebensmittelversorgung.
18. 12 1917 - In Berlin wird die Universum Film AG - Ufa gegründet
Berlin * In Berlin wird die Universum Film AG - Ufa als Propaganda-Instrument der Obersten Heeresleitung - OHL gegründet.
18. 12 1917 - Der US-Senat schlägt die Einführung der Prohibition vor
Washington * In den USA schlägt der Senat unter dem erheblichen Druck der Enthaltsamkeitsbewegung die Einführung der Prohibition vor. Herstellung, Verkauf und Transport alkoholischer Getränke sollen dadurch verboten werden. Die Bestimmung wird am 16. Januar 1919 ratifiziert und tritt am 19. Januar 1920 in Kraft.
18. 12 1917 - US-Kriegserklärung von Österreich-Ungarn entgegengenommen
Wien - Washington * Das k.u.k. Ministerium des Äußern nimmt die amerikanische Kriegerklärung vom 11. Dezember 1917 gegen Österreich-Ungarn entgegen.
18. 12 1917 - Kann Kurt Eisner die USPD überzeugen?
Berlin - München * Kurt Eisner schreibt seiner Frau Else aus Berlin folgende Zeilen:
„Es scheint mir nun doch gelungen, die schlafenden Seelen ein wenig aufzurütteln. Man hat meine Kritik anerkannt und meine Vorschläge angenommen.
Alles kommt darauf an, ob sich die Persönlichkeiten finden, die für die Arbeit notwendig sind.
Man hat mich selbst gebeten, die Tätigkeit hier zu übernehmen“.
19. 12 1917 - Alle SPD-Forderungen werden abgeschmettert
München-Kreuzviertel * Der SPD-Reformantrag vom 18. September 1917 wird im Plenum der Abgeordnetenkammer behandelt. Der Führer der Zentrumsfraktion, Heinrich Held, lehnte die SPD-Vorschläge rundweg ab, denn:
„Der Antrag bezielt [...] eine fundamentale Einschränkung der Königsrechte und geht in seinen letzten Wirkungen auf die tatsächliche Abschaffung der konstitutionellen Monarchie, auf die Einführung der parlamentarischen Regierungsform und schließlich auf die Republikanisierung unseres Staatswesens hinaus.“
Alle elf Vorschläge werden in der Abstimmung per Handaufheben von der ihren Besitzstand verteidigenden Zentrumsmehrheit im Bündnis mit den Liberalen abgelehnt. Damit ist die Reformbewegung zumindest für die Dauer des Krieges zum Stillstand gebracht worden.
Um den 21. 12 1917 - Kurt Eisners idealistische Aktion ist nicht durchsetzbar
Berlin - Leipzig * Kurt Eisner sendet von Berlin aus seinen Text „Notwendigkeiten“ an die Leipziger Volkszeitung, den diese auch veröffentlicht. Sein Besuch in Leipzig, bei dem er die ansässigen Arbeiterführer für seine Friedensaktion gewinnen will, scheitert. Ein Massenstreik ist unter der gegebenen Situation und zu diesem Zeitpunkt aussichtslos.
22. 12 1917 - In Brest-Litowsk beginnen Friedensverhandlungen
Brest-Litowsk * In Brest-Litowsk beginnen die Friedensverhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und der sowjetrussischen Regierung.
22. 12 1917 - Annemarie Fischer, Karl Valentins spätere Bühnenpartnerin, kommt zur Welt
München-Schwabing * Annemarie Fischer, Karl Valentins spätere zweite Bühnenpartnerin, kommt zur Welt. Die Familie wohnte in der Elisabethstraße 43.
27. 12 1917 - Die Deutschen verhandeln für einen Annexionsfrieden
Brest-Litowsk * Aus den Erklärungen des deutschen Unterhändlers wird deutlich, dass die Deutschen in den Verhandlungen in Brest-Litowsk keinen Verständigungsfrieden wollen, sondern gezielt auf einen separaten Annexionsfrieden hinarbeiten.
28. 12 1917 - Die US-Eisenbahngesellschaften werden verstaatlicht
Washington * Die amerikanische Regierung verstaatlicht zur Sicherung der Nachschublieferungen für den Krieg die amerikanischen Eisenbahngesellschaften.
31. 12 1917 - 9.979.252 Essen ausgegeben
München * In den Münchner Volksküchen werden 1917 insgesamt 9.979.252 Essen ausgegeben.
1918 - Das Bayerische Kriegsministerium in der Ludwig-/Schönfeldstraße
München-Maxvorstadt * In den Räumen des heutigen Bayerischen Hauptstaatsarchiv an der Ludwigstraße 14 sowie Schönfeldstraße 3 und 5 ist bis 1919 das Bayerische Kriegsministerium untergebracht.
1918 - Die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“
München * Der in der Zeit des Ersten Weltkriegs von Anita Augspurg und anderen Frauen gegründete „Internationale Ausschuß für einen dauernden Frieden“ wird in „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“ umbenannt.
Anno 1918 - Josef Bernbacher zieht mit seiner Bäckerei in die Rablstraße 38 um
München-Au * Als in der Quellenstraße die alten Herbergen abgebrochen werden, zieht Josef Bernbacher mit seiner Bäckerei in die Rablstraße 38 um.
1918 - Schon bald ist der Betriebshof wieder zu klein
München-Haidhausen * Durch zwei weitere Verbindungsgänge in der Straßenbahn-Direktion kann man in jeden Gebäudeteil gelangen, ohne den ersten Stock verlassen zu müssen.
Doch schon bald ist der Betriebshof, der inzwischen die Nummer „2“ erhalten hat, wieder zu klein und den technischen Anforderungen nicht mehr gewachsen.
1918 - Eine tödliche Erkrankung der Seidenraupen
Deutsches Reich * Mit dem Auftreten einer tödlichen Raupenerkrankung ist das Abenteuer Seidenbau schon wieder vorbei.
1. 1 1918 - Die 600 Mitglieder der Münchner USPD
München * Die Münchner USPD weist nach polizeilichen Erhebungen gerade einmal eine Mitgliederstärke von maximal 600 Personen auf.
Ab 3. 1 1918 - Die sogenannten Jännerstreiks beginnen
Österreich-Ungarn * In Österreich-Ungarn beginnen vereinzelt und noch in kleinem Ausmaß die sogenannten Jännerstreiks. Zunächst geht es den Streikenden um eine bessere Lebensmittelversorgung, doch spätestens am 15. Jänner werden auch werden Forderungen nach Beendigung des Krieges laut.
8. 1 1918 - Präsident Woodrow Wilsons 14-Punkte-Programm
Washington - Berlin * Der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson schlägt ein 14-Punkte-Programm vor. Es sieht Folgendes vor:
- „Offene, öffentlich abgeschlossene Friedensverträge. Danach sollen keinerlei geheime internationale Abmachungen mehr bestehen, sondern die Diplomatie soll immer aufrichtig und vor aller Welt getrieben werden“.
- „Uneingeschränkte Freiheit der Schifffahrt auf den Meeren, außerhalb der Territorialgewässer, im Frieden sowohl wie im Kriege, […]“.
- „Möglichste Beseitigung aller wirtschaftlichen Schranken und Herstellung einer Gleichheit der Handelsbedingungen für alle Nationen, […]“.
- „Entsprechende gegenseitige Bürgschaften für die Beschränkung der Rüstungen der Nationen auf das niedrigste, mit der Sicherheit im Innern vereinbare Maß“.
- „Freier, unbefangener und völlig unparteiischer Ausgleich aller kolonialen Ansprüche, […]“.
- „Räumung des ganzen russischen Gebietes und ein Einvernehmen über alle auf Russland bezüglichen Fragen, […]“.
- „Belgien muss […] geräumt und wiederhergestellt werden, […]“.
- „Das ganze französische Gebiet muss geräumt und die besetzten Teile wiederhergestellt werden. […]“.
- „Berichtigung der Grenzen Italiens nach den genau erkennbaren Abgrenzungen der Volksangehörigkeit“.
- „Den Völkern Österreich-Ungarns […] sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden“.
- „Rumänien, Serbien und Montenegro sollten geräumt, die besetzten Gebiete zurückgegeben werden. […]“.
- „Den türkischen Teilen des Osmanischen Reiches sollte eine unbedingte Selbstständigkeit gewährleistet werden. Den übrigen Nationalitäten dagegen, die zurzeit unter türkischer Herrschaft stehen, sollte eine zuverlässige Sicherheit des Lebens und eine völlig ungestörte Gelegenheit zur selbstständigen Entwicklung gegeben werden. […]“.
- „Ein unabhängiger polnischer Staat sollte errichtet werden, der alle Gebiete einzubegreifen hätte, die von unbestritten polnischer Bevölkerung bewohnt sind; […]“.
- „Ein allgemeiner Verband der Nationen muss gegründet werden mit besonderen Verträgen zum Zweck gegenseitiger Bürgschaften für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverletzbarkeit der kleinen sowohl wie der großen Staaten“.
Mit Woodrow Wilsons 14-Punkte-Programm sollen die deutsch-russischen Friedensverhandlungen unterlaufen werden. Schon deshalb lehnt das Deutsche Reich das Programm ab.
9. 1 1918 - Kurt Eisner fährt nach Berlin. Er will den Massenstreik!
München - Berlin * Kurt Eisner hält sich vom 9. bis 19. Januar 1918 in Berlin auf, um auch dort zum Massenstreik zu drängen.
9. 1 1918 - Die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk werden fortgesetzt
Brest-Litowsk * Die Friedensverhandlungen zwischen den Mittelmächten und Sowjetrussland werden in Brest-Litowsk fortgesetzt. Die großen Hoffnungen, die man in die Friedensverhandlungen gesetzt hatte, werden bitter enttäuscht. Die harten Bedingungen, die das Deutsche Reich hinsichtlich der Gebietsabtretungen stellt, machen deutlich, dass die deutsche Regierung an einem Verständigungsfrieden nicht interessiert ist.
Die Generalität will den Frieden mit Russland nur, um mit den dort frei werdenden Truppen und gestützt auf die Getreide- und Kohlelieferungen aus den besetzten russischen und ukrainischen Gebieten eine neue Offensive im Westen starten zu können. Für das Deutsche Kaiserreich gibt es nur Sieg oder Niederlage, dazwischen gibt es nichts. So rückt der Frieden in immer weitere Ferne.
10. 1 1918 - USPD-Kritik an den Annexionsplänen
Berlin * Die USPD-Reichstagsfraktion kritisiert in einem Aufruf die Annexionspläne des deutschen Imperialismus im Osten scharf.
10. 1 1918 - Das USPD-Flugblatt „Männer und Frauen des werktätigen Volkes!“
Berlin * Der USPD-Parteivorstand in Berlin veröffentlicht das Flugblatt „Männer und Frauen des werktätigen Volkes!“. Er ruft darin nur zu einem zeitlich befristeten, dreitägigen Demonstrationsstreik auf. Zu einem unbefristeten Massenstreik, wie ihn Kurt Eisner will, kann er sich nicht durchringen.
10. 1 1918 - Das bayerische Kriegswucheramt und die Schmalznudeln
München * Das Bayerische Kriegswucheramt berichtet dem Innenminsterium, dass in Niederbayern mehr Schmalznudeln als in früheren Zeiten „aus weißem Mehl unter Verwendung von großen Mengen Schmalz und Butter“ gegessen werden.
Um 11. 1 1918 - Wilsons 14-Punkte-Programm wird zensiert veröffentlicht
Berlin - Deutsches Reich * Das vom US-Präsidenten Woodrow Wilson vorgeschlagene 14-Punkte-Programm wird bei ihrer erstmaligen Veröffentlichung nur in einer zensierten Fassung zugänglich gemacht. Für die in den umstrittenen Grenzprovinzen lebenden Deutschen hört sich die Friedenslösung à la Wilson eher katastrophal an, da sie die Eingliederung in neue Nationalstaaten befürchten.
12. 1 1918 - Ausgekämmte Frauenhaare für Treibriemen
Starnberg * Eine Kampagne des Roten Kreuzes lautet: „Sammelt ausgekämmtes Frauenhaar.“ Der Grund: Die Industrie braucht dieses für Treibriemen.
14. 1 1918 - Ein Streik wegen Kürzung der täglichen Brotration
Wien * In den Daimler-Motorenwerken in Wiener-Neustadt beginnt ein Streik wegen der Verkürzung der eh schon geringen täglichen Brotration von 200 auf 165 Gramm.
Ab 15. 1 1918 - In Wien beginnen Rüstungsarbeiter einen Streik
Wien * Der in den Wiener-Neustädter Daimler-Motorenwerken am Tag zuvor begonnene Streik weitet sich zur politischen Massenstreikbewegung in fast allen Industriegebieten des Habsburger Reich bis nach Prag und Budapest aus. Bis zum 25. Jänner 1918 werden über 700.000 Arbeiter in den Ausstand treten. Es kommt zur größten Streikaktion in der Geschichte des Landes. Die Streikenden fordern nicht mehr nur
- eine bessere Lebensmittelversorgung, sondern auch
- ein demokratisches Wahlrecht,
- die sofortige Beendigung des Krieges und
- einen raschen Friedensschluss ohne Annexionen in Brest-Litowsk.
In Massenveranstaltungen werden Arbeiterräte - nach dem Vorbild der russischen Revolution - als ein konkretes Gegenmodell politischer Interessenvertretung gewählt. Noch am ersten Tag des Wiener Streiks formuliert der sozialdemokratische Parteivorstand Forderungen an die Regierung, die vom Arbeiterrat akzeptiert werden.
16. 1 1918 - Die Wiener Streikbewegung weitet sich aus
Wien - Österreich-Ungarn * Die Belegschaften der Wiener Rüstungsbetriebe verweigern die Arbeit. Ausgehend von den Floridsdorfer Fiat-Werken greift die Bewegung auf 120 Wiener Betriebe über und erfasst danach die steirische, schließlich die ungarische Arbeiterschaft.
18. 1 1918 - Der Höhepunkt der österreichisch-ungarischen Jännerstreiks
Wien - Österreich-Ungarn * Der Höhepunkt der österreichisch-ungarischen Streikbewegung ist erreicht. In Wien befinden sich 110.000, insgesamt 350.000 bis 370.000 Menschen im Ausstand.
19. 1 1918 - Kurt Eisner und der Massenstreik
Berlin - München * Kurt Eisner kehrt von seinen Gesprächen in Berlin zum Massenstreik nach München zurück.
19. 1 1918 - Weitreichende Zusagen an den Wiener Arbeiterrat
Wien * Angesehene österreichische Sozialdemokraten wie Viktor Adler rufen die Streikenden zur Mäßigung auf und verhandeln mit der Regierung in Wien Verbesserungen aus. Der k.u.k.-Ministers des Äußern, Graf Ottokar Czernin von und zu Chudenitz, überreicht einer Abordnung des Arbeiterrates eine Erklärung, in der er sich verpflichtet, die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk keinesfalls an territorialen Forderungen scheitern zu lassen.
Ministerpräsident Ernst von Feuchtenegg sagt Reformen
- des Kriegsleistungsgesetzes und
- des Ernährungsdienstes sowie
- eine Demokratisierung des Gemeindewahlrechtes zu.
20. 1 1918 - Die Jännerstreiks werden beendet
Wien * Der sozialdemokratische Parteivorstand Österreichs veranlasst eine Regierungserklärung, die zahlreiche Zugeständnisse an die Streikenden enthält. Darunter die Zusicherung,
- die katastrophale Lebensmittelversorgung zu verbessern und
- sich um Friedensverhandlungen zu bemühen.
Er setzt damit den Beschluss zum Abbruch des Streiks durch. Die Beendigung des Streiks verärgert die radikale Linke, die sich von den Versprechungen nicht beeindrucken lassen will. Die Militärs hätten allerdings nicht davor zurückgeschreckt, mit militärischer Gewalt gegen den Streik und die Streikenden vorzugehen.
20. 1 1918 - Ernst Toller kommt nach München
München * Ernst Toller trifft von Heidelberg kommend in München ein. Der gute Redner wird sich später an den Münchner Januarstreiks aktiv beteiligen.
20. 1 1918 - Christliche Gewerkschafter wollen Streik unterbinden
München-Isarvorstadt * Den Gewerkschaftssekretär Wilhelm Bosbach vom Christlichen Metallarbeiterverband, der im Leo-Haus, Hauptstelle katholisch-sozialer Vereine in der Pestalozzistraße 1 sein Büro hat, erhält aus den Betrieben die Nachricht von Flugblättern und einem bevorstehenden Streik.
Der christliche Gewerkschafter weist seine Vertrauensleute an, „dass diesen Bestrebungen entgegen getreten werden solle“.
Ab 21. 1 1918 - Streikführer und Aktivisten werden verhaftet
Österreich-Ungarn * Nach dem Ende der Jännerstreiks werden die Streikführer und auch zahlreiche Aktivisten verhaftet oder zur Armee eingezogen.
21. 1 1918 - Die Unruhen greifen auf die k.u.k.-Armee über
Österreich-Ungarn * Nun greifen die Unruhen auf die Armee über.
- Es kommt zu Soldatenmeutereien unter Truppen südslawischer Herkunft in Judenburg und Pécs,
- bei Truppen mit tschechischen Soldaten im böhmischen Rumburg und
- unter ungarischen Regimentern in Budapest.
21. 1 1918 - 150 Teilnehmer am USPD-Diskussions-Stammtisch
München-Ludwigsvorstadt * Im Anschluss an die Vorstandssitzung findet der USPD-Diskussionsabend im Wirtshaus Zum Goldenen Anker in der Schillerstraße statt. Dort treffen - nach Polizeiberichten - rund 150 Personen zusammen, darunter 20 Frauen und 30 Soldaten. Damit erreicht der Diskussions-Stammtisch seine größte Breitenwirkung.
Kurt Eisner verteilt aus Frankreich stammende Flugblätter, die sich mit dem Thema „Ist in Deutschland eine Revolution möglich?“ befassen. Er deutet an, dass ein Ausstand vorbereitet werde. Das Endziel des Streiks ist „die Monarchie zu stürzen und nicht nur den preußischen, sondern den gesamten Militarismus niederzuzwingen. Dazu gibt es nur ein Mittel: Die heiß ersehnte, unausbleibliche und bald zu erwartende Revolution.“
21. 1 1918 - Aufruf zum Brennnesseln sammeln
München * Mit Plakaten wird aufgefordert, Brennnesseln zu sammeln. Die Pflanze, so heißt es, kommt der Baumwolle am nächsten, deren Zufuhr aufgrund der Kriegserklärung Amerikas abgeschnitten ist. „Wir Deutschen müssen unseren Stolz dareinsetzen, genügend Nesselfasermengen herbeizuschaffen, denn, genau so wenig uns der Engländer auszuhungern vermochte, darf uns der Amerikaner mit Gespinstfasern kaltstellen.“
21. 1 1918 - Sitzung des Münchner USPD-Vorstands
München-Ludwigsvorstadt * Der Münchner USPD-Vorstand tritt zu einer Sitzung zusammen. Der Vorsitzende, Schreinermeister Albert Winter sen., berichtet über die Mitglieder-Entwicklung der noch jungen Partei. Die Münchner USPD hat zu diesem Zeitpunkt circa 600 Mitglieder. Vier Münchner MSPD-Sektionen wollen zur USPD wechseln, sodass die Münchner USPD jetzt in die vier Sektionen Giesing, Haidhausen, Schwabing und Innenstadt aufgeteilt werden kann.
Kurt Eisner berichtet von seinen Gesprächen in Berlin und davon, dass es dort auch Stimmen gibt, die - entgegen der Auffassung der Mehrheit der Berliner USPD-Führung - mehr als nur einen dreitägigen Demonstrationsstreik wollen. Auch ihr Ziel ist der Sturz der Regierenden.
22. 1 1918 - Arbeiter und Soldaten treten in Pola in den Streik
Pola * Die Arsenalarbeiter im Kriegshafen Pola treten in den Streik. Ihnen schließen sich die Matrosen der im Hafen liegenden Schiffe der k.u.k.-Kriegsmarine an.
22. 1 1918 - Erhard Auer warnt vor den unorganisierten Arbeiterinnen
München * In einem Gespräch mit dem Münchner Polizeipräsidenten versichert der Landessekretär der Bayerischen SPD, Erhard Auer, dass „die Unabhängigen in Bayern, besonders in München, nicht viel Boden“ haben. Bei den organisierten Arbeitern besteht somit keine Streikgefahr. Anders ist die Sache „bei den vielfach noch nicht organisierten weiblichen Arbeiterinnen“.
24. 1 1918 - Der österreichisch-ungarische Präsident für einen Verständigungsfrieden
Wien * Für den österreichisch-ungarischen Ministerpräsidenten Ottokar Graf von Czernin und zu Chucenitz ist ein Verständigungsfrieden auf der Grundlage der 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson akzeptabel. Er erklärt dies in Hinblick auf die innenpolitische und militärische Lage seines Landes.
26. 1 1918 - Spendenaufruf für Soldatenheime an der Front
Berlin * Die SPD-Parteizeitung Vorwärts veröffentlicht eine Anzeige: „An Kaisers Geburtstag spendet für die Deutschen Soldatenheime an der Front.“
27. 1 1918 - USPD-Versammlung zu den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk
<p><em><strong>München-Isarvorstadt</strong></em> * Die Münchner Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands - USPD führt in den Kolosseum-Bierhallen eine Versammlung zum Thema <em>„Die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk und das harrende Volk“</em> durch.<br /> Etwa 250 bis 300 Personen sind der Einladung gefolgt. Auch die Polizeibehörde hat zwei Vertreter zur Überwachung geschickt, weil sie die Versammlung als öffentlich ansieht.</p> <p>Unter dem Applaus der Zuhörer hält Kurt Eisner einen kämpferischen Vortrag und nimmt dabei keinerlei Rücksicht auf die anwesenden Polizeispitzel. Die Versuche der Polizeibeamten, den Redner einzuschüchtern, werden von der erregten Menge unterbunden.</p> <p>Er führt u.a. aus, die Zeit ist gekommen, <em>„nicht den Willen kundzutun, sondern ihn durchzusetzen“</em>. Kurt Eisner bezeichnet den Massenstreik als das Mittel, <em>„die Macht für die deutsche Demokratie zu erobern“</em> und <em>„dem Wüten der verblendeten Herrschenden ein Ende</em> [zu] <em>bereiten“</em>. </p> <p>Felix Fechenbach bemerkte dazu: Kurt Eisner sprach in Gegenwart der Polizei <em>„trotzdem, oder gerade deshalb, ohne jede Zurückhaltung, weil er stets die Meinung vertrat, dass das Aussprechen der Wahrheit der erste Schritt zur Revolution ist“</em>. </p>
27. 1 1918 - Kurt Eisner soll auf der Krupp-Betriebsversammlung sprechen
München-Isarvorstadt * An der USPD-Versammlung in den Kolosseumbierhallen nehmen einige Vertrauensleute der Krupparbeiter der Bayerischen Geschützwerke teil. Sie fordern Kurt Eisner, Sarah Sonja Lerch und Albert Winter sen. auf, am nächsten Tag in der von den Gewerkschaften und den Mehrheitssozialdemokraten einberufenen Betriebsversammlung zu sprechen.
Bis dahin gibt es keine Verbindung zwischen der Münchner USPD und den Betrieben. Erst dadurch - und nicht durch die Organisation der USPD - kommt der Kontakt zu den Arbeitern der Münchner Rüstungsbetriebe zustande.
27. 1 1918 - Albert Winter beantragt eine öffentliche Veranstaltung der USPD
München * Der Schreinermeister und Münchner USPD-Vorsitzende Albert Winter sen. beantragt bei der Kgl. Polizeidirektion für den 5. Februar 1918 die Genehmigung zur Abhaltung einer öffentlichen Versammlung der USPD.
27. 1 1918 - Kaiser Wilhelm II. feiert seinen Geburtstag mit kirchlichem Segen
Berlin - Deutsches Reich * Kaiser Wilhelm II. feiert an einem Sonntag bei Kaiserwetter seinen 59. Geburtstag. Von vielen Kanzeln wird gepredigt: „Möge ihn der Herr segnen wie er auch uns segnet.“
Dabei werden die lauteren Absichten des „Friedensfürsten“ herausgestellt, „der seine Friedenshand immer wieder gereicht, die [aber] vom Feinde so schmählich zurückgewiesen“ wurde. Der Kaiser, der „auch in Zukunft allen Stürmen, mögen sie noch so verheerend toben, unerschrocken entgegen sehe“.
27. 1 1918 - Das Innenministerium erfährt von den vorbereiteten Streiks
München-Kreuzviertel * In der Nacht trifft beim bayerischen Innenministerium die Nachricht ein, dass am darauffolgenden Tag
- ein dreitägiger Generalstreik beginnen und
- der Streik innerhalb von drei Tagen in ganz Deutschland zum Durchbruch kommen soll.
- Kuriere reisen von Berlin mit der Eisenbahn in alle größeren Städte des Deutschen Reichs, um Flugblätter zu verteilen und mündliche Nachrichten zu überbringen.
- Vertrauensleute sollen in Kriegswirtschaftsbetrieben, insbesondere in Munitionsfabriken zur Arbeitsniederlegung auffordern.
- Demonstrationszüge mit Ansprachen sind geplant.
In einer kurzfristig anberaumten Besprechung wird vereinbart, dass
- keine Gewalt gegen Arbeitseinstellungen angewandt werden soll,
- die Polizei soll Menschenansammlungen lediglich zerstreuen,
- bei „Zusammenstößen mit streikenden Arbeitern [muss] nach dreimaliger Aufforderung, auseinanderzugehen, scharf geschossen werden“.
Ab 27. 1 1918 - Kurt Eisners Massenversammlungs-Marathon
München * Kurt Eisner trat in der Zeit vom 27. bis zum 31. Januar 1918 in sieben Massenversammlungen auf und hielt dort jeweils eine Rede. Er wird dadurch zum „geistigen Leiter und Organisator der Aufstandsbewegung in München“. So jedenfalls formuliert es der Staatsanwalt nach Eisners Verhaftung.
27. 1 1918 - Die Berliner revolutionären Vertrauensleute beschließen den Generalstreik
Berlin * Eine Versammlung der der USPD nahestehenden Vertrauensleute aller Berliner Großbetriebe, die sogenannten revolutionären Obleute, beschließt einstimmig, am nächsten Morgen den Generalstreik zu beginnen.
Nach Wiener Vorbild wird ein aus 414 Personen bestehender Arbeiterrat gebildet, der einen elfköpfigen Aktionsausschuss aus dem Kreis der revolutionären Obleute wählt. Der Aktionsausschuss fungiert als Streikleitung und wird von Richard Müller angeführt. Die USPD und die MSPD entsenden zusätzlich noch je drei Vertreter. Als Vertreter der Arbeiterparteien werden
- die USPD-Reichstagsabgeordneten Hugo Haase, Georg Ledebour und Wilhelm Dittmann sowie
- die SPD-Vorstandsmitglieder Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Braun hinzugezogen.
28. 1 1918 - Hunderttausend Arbeiter treten in Berlin in den Streik
Berlin * Am ersten Tag des Ausstands folgen rund 100.000 Berliner Arbeiterinnen und Arbeiter dem Aufruf der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei - USPD zum Streik. Das Motto heißt: „Frieden und Brot!“. Ihre Hauptforderungen lauten:
- Den sofortigen allgemeinen Frieden ohne Annexion und Kontributionen,
- das vollständige Presse- und Koalitionsrecht, sowie Versammlungsfreiheit,
- die Aufhebung des Belagerungszustandes,
- die Entmilitarisierung der Betriebe und Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes,
- die Freilassung und Aufhebung des Zuchthausurteils gegen Karl Liebknecht, sowie die Freilassung sämtlicher politischen Gefangenen und Verurteilten.
Für Deutschland fordern die von den Streikenden gebildeten Berliner Arbeiterräte eine „durchgreifende Demokratisierung der gesamten Staatseinrichtungen“. Das Vorbild der österreichischen Kolleginnen und Kollegen hat auch die deutsche Arbeiterschaft ermutigt.
Die Versammelten rufen die Arbeiterschaft der Kriegsgegner auf, es ihnen gleichzutun und ebenfalls in einen Massenstreik einzutreten, „denn erst der gemeinsame, internationale Klassenkampf schafft Arbeit und Brot“. Zur Umsetzung dieser Forderung sollte es allerdings nicht kommen.
Dafür gelingt es den revolutionären Obleuten - zwar widerstrebend, aber strategisch sehr geschickt, - auch die Mehrheits-SPD in den Kampf zu integrieren. Das ist ein beachtenswerter Versuch der Wiederannäherung.
Ab 28. 1 1918 - Revolutionäre Obleute organisieren in Russland Massenstreiks
Russland * Revolutionäre Obleute organisieren in Russland Massenstreiks gegen die annexionistische Verhandlungsführung der Mittelmächte in Brest-Litowsk. Die Streiks dauern bis 4. Februar 1918 an.
28. 1 1918 - Noch keine Streikfront in München
München * Kurt Eisner und seiner USPD gelingt es aufgrund der fehlenden Kontakte zu den Rüstungsarbeitern noch nicht, die Münchner Arbeiterschaft auf die Straße zu bringen. Erst am 31. Januar 1918 treten die Rüstungsarbeiter in den Streik ein.
28. 1 1918 - Kurt Eisner kann vor den Krupp-Arbeitern sprechen
München-Schwabing * In der Schwabinger Brauerei findet am Abend eine von der MSPD und der Gewerkschaften einberufene Veranstaltung zum Thema „Die Übergangswirtschaft vom Krieg zum Frieden“ statt. Sie wird von etwa 800 Personen besucht. Hauptredner ist der stellvertretende Landesvorsitzende Franz Schmitt. Der Vortrag endet mit der Warnung, sich - in Hinblick auf die Berliner Streikmaßnahmen - zu keinen unüberlegten Handlungen hinreißen zu lassen, nachdem die Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk ins Stocken geraten sind.
Die Veranstalter wollen Kurt Eisner nicht zu Wort kommen lassen. Doch nach einer „heftigen Geschäftsordnungsdebatte“ und gegen den erbitterten Willen des Veranstaltungsleiters und Gewerkschaftsfunktionärs Joseph Kurt kann Kurt Eisner das Rederecht erringen und das neue Thema „Die gegenwärtige Krisis und ihre Lösung durch den Massenstreik“ auf die Tagesordnung setzen. Immer wenn Eisner den Streik nur erwähnt, „jubelt alles“.
Noch bevor über die Teilnahme der Krupparbeiter am Streik abgestimmt werden kann, gelingt es den Vertretern der MSPD und der Gewerkschaften, die Versammlung wegen Überschreiten der Polizeistunde aufzulösen.
In seinem Gefängnistagebuch urteilt Kurt Eisner später über die den Streik ablehnenden Mehrheitssozialdemokraten, indem er sie als eine „Camorra“ bezeichnet, „die vor keinem Mittel zurückschreckt, um sich selbst in ihrer verworfenen Stellung zu behaupten“ und stellt sie als eine „lächerliche Karikatur des preußischen Kasernenstaates“ dar. Konkret wirft er der bayerischen SPD-Parteiführung eine „riesige unpolitische, ohnmächtige, öde, geistlose und verlogene Vereinsmeierei“ vor.
28. 1 1918 - Gemeinsamer Streikaufruf der MSPD und der USPD in Nürnberg
Nürnberg * In der Nacht vom 28. zum 29. Januar 1918 beschließt die Ortsgruppe der Nürnberger Mehrheitssozialdemokraten, sich dem Streikaufruf der USPD anzuschließen. Der fränkische Streikaufruf ist auch als Seitenhieb auf den Opportunismus der Münchner Sozialdemokraten gedacht.
In Nürnberg beteiligen sich weit über 40.000 Arbeiterinnen und Arbeiter an den Streikaktionen und Demonstrationen.
29. 1 1918 - Streik jetzt auch in Mährisch-Ostrau
Mährisch-Ostrau * In Mährisch-Ostrau streiken die Arbeiter.
29. 1 1918 - Die USPD trifft sich mit den Krupp-Vertrauensleuten
München * Im Ingolstädter Hof treffen sich Kurt Eisner, Sarah Sonja Lerch und Albert Winter sen. mit den Vertrauensleuten der Krupp-Arbeiter in den Bayerischen Geschützwerken. Es wird eine Empfehlung an die Arbeiter beschlossen, dass sie am Donnerstag, 31. Januar 1918 mit dem Streik beginnen sollen.
Kurt Eisner hält sich während der Diskussion vollkommen zurück und beantwortet lediglich Fragen, die an ihn gerichtet werden. Er sieht hier sein Ideal von der Arbeiterschaft erfüllt:
- Sie soll sich selbst führen,
- soll sich von niemand vertreten lassen,
- sollen nur „Sachverständige, zu deren Charakter, Wissen, Intelligenz, Mut sie Vertrauen haben, als Berater hinzuziehen“.
Eisner kann sich schon deshalb zurücknehmen, denn - so schreibt er später - „es bedurfte auch gar nicht mehr meiner Einwirkung“.
29. 1 1918 - 250.000 Streikende im ganzen Reich
Deutsches Reich * Reichsweit beteiligen sich mindestens 250.000 Arbeiterinnen und Arbeiter am Streik.
29. 1 1918 - Berhördliche Maßnahmen gegen den Streik
Berlin * In Berlin werden alle Versammlungen verboten. Die Polizei besetzt das Gewerkschaftshaus.
30. 1 1918 - Streik-Aktivitäten der USPD verurteilt
München * Die Delegierten des Münchner Gewerkschaftsvereins beschließen eine Resolution, in der sie die Aktivitäten der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei - USPD zum Streik verurteilen.
Der Gewerkschaftsvorsitzende Johannes Timm verständigt sich mit dem MSPD-Parteisekretär Erhard Auer, an der für den nächsten Tag angesetzten Versammlung der Münchner kriegswichtigen Betriebe teilzunehmen. Sie wollen durch ihre Präsenz
- Gegenmaßnahmen einleiten,
- die Bewegung in geordnete Bahnen lenken und
- den Streik so bald als möglich beenden.
30. 1 1918 - Kriegsminister Hellingrath verbietet die geplante USPD-Veranstaltung
München * Kriegsminister Philipp von Hellingrath verbietet die von Albert Winter sen. am 27. Januar beantragte öffentliche Versammlung der USPD am 5. Februar.
30. 1 1918 - Die MSPD will eine Eskalation der Ereignisse verhindern
Berlin * Der Parteiausschuss der Mehrheits-SPD stimmt der Mitarbeit der drei Reichstagsabgeordneten Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Braun im Aktionsausschuss zu, um - wie es Scheidemann ausdrückt, ein „nicht zu billigendes, aber verständliches Unternehmen nicht nur in ruhige Bahnen zu lenken, sondern auch durch Verhandlungen mit der Regierung schnellstens zum Ende zu bringen“.
Die MSPD versteht sich als die einzige Kraft, die eine Eskalation der Ereignisse verhindern kann.
30. 1 1918 - Den Streikenden wird mit Bestrafung gedroht
Berlin * Auch hier schlägt - wie zuvor schon in Wien - das Imperium zurück.
Am Nachmittag lässt der für Berlin zuständige Befehlshaber, Generaloberst Gustav von Kessel, alle Versammlungen und Streikkomitees verbieten und verlautbaren: Wer sich den Befehlen nicht fügt, setzt „sich schwerster Bestrafung nach den Vorschriften des Belagerungszustandes aus; die Wehrpflichtigen unter ihnen werden außerdem militärisch eingezogen werden.“
Der Arbeiterrat gibt nicht nach. Die Arbeitskampfmaßnahmen werden erfolgreich weitergeführt.
31. 1 1918 - Die Münchner Krupp-Belegschaft tritt in den Streik ein
München * Die Münchner Kruppianer der Bayerischen Geschützwerke treten an diesem Donnerstag in den Streik ein. Am frühen Morgen marschieren sie - vorbei an verschiedenen Großbetrieben im Norden Münchens, die sie zum Anschließen auffordern - zum Schwabinger Bräu, wo Kurt Eisner zu ihnen spricht.
Die Krupp-Arbeiterschaft nimmt eine von Kurt Eisner verfasste Resolution einstimmig an. Darin erklären sich „die streikenden Arbeiter Münchens mit den Arbeitern der feindlichen Nationen einig in dem feierlichen Entschlusse, den Krieg des Wahnsinns und der Wahnsinnigen sofort ein Ende zu setzen“.
31. 1 1918 - Die revolutionärste Revolution, das war doch die vom 31. Januar
München * Kurt Eisner schreibt später: „Die revolutionärste Revolution, das war doch die vom 31. Januar.
Damals stand Deutschland auf dem Gipfel seiner militärischen Macht, und wenn es uns damals gelungen wäre, die Massen aufzuregen und aufzurütteln zu jener Volksbewegung, wie sie uns damals schon vorschwebte, dann hätten wir noch einen Frieden haben können, in dem wir nicht auf Gnade und Ungnade dem Gegner ausgeliefert gewesen wären.“
31. 1 1918 - Tausende schließen sich der Demonstration der Kruppianer an
München * Die rund 2.000 Streikenden ziehen gemeinsam von der Schwabinger Brauerei zu anderen Rüstungsbetrieben im Münchner Norden und schließlich in die Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof. Der inzwischen auf 6.000 Menschen angewachsene Zug will in den Mathäserbräu, in dem aber bereits BMW-Arbeiter eine Versammlung abhalten.
Ihr Demonstrationszug endet schließlich im Hotel Wagner an der Sonnenstraße. Hier sprechen neben Fritz Schröder auch Sarah Sonja Lerch und Hans Unterleitner.
31. 1 1918 - Die Betriebsversammlung der Bayerischen Flugzeugwerke
München-Ludwigsvorstadt * Am Abend findet im Mathäserbräusaal eine Versammlung der Arbeiterinnen und Arbeiter der Bayerischen Flugzeugwerke AG statt, bei der der SPD-Abgeordnete Erhard Auer spricht und wilde Streiks als „zwecklos und sinnwidrig“ bezeichnet.
Als die Versammelten Kurt Eisner zur Stellungnahme ermunterten, blieb dieser still. Die MSPD und die Gewerkschaften können durchsetzen, dass die Arbeit erst dann niedergelegt wird, wenn sich die Parteileitung in Berlin dafür ausgesprochen hat. Die Versammlung nimmt einen erregten Verlauf und muss wegen des „großen Lärms“ vorzeitig beendet werden.
31. 1 1918 - Kurt Eisner wird verhaftet
München-Isarvorstadt * Am späten Abend treffen sich Kurt Eisner, Sarah Sonja Lerch und weitere USPD-Genossen zu einer Besprechung im Restaurant Müllerbad. Kurt Eisner sowie Vater und Sohn Albert Winter werden dort verhaftet.
31. 1 1918 - Den verschärften Belagerungszustand über Berlin verhängt
Berlin * Das Militär verhängt den verschärften Belagerungszustand über Berlin.
- Die Behörden lösen den Arbeiterrat auf und untersagen die Bildung einer neuen Streikleitung.
- Die SPD-Parteizeitung Vorwärts wird verboten, weil er über die Sympathiestreiks in Budapest und Wien berichtet hat.
31. 1 1918 - Die Betriebsversammlung der Bayerischen Motorenwerke
München-Ludwigsvorstadt * Im Festsaal der Mathäserbrauerei finden kurz hintereinander die Betriebsversammlungen der Bayerischen Motorenwerke und der Bayerischen Flugzeugwerke statt. Am frühen Nachmittag versammelt sich die Arbeiterschaft des im Jahr 1917 von Rapp-Motorenwerke in Bayerische Motorenwerke - BMW umbenannten Betriebs. Anders als in den Krupp-Werken sind die BMW-Arbeitsausschüsse fest in der Hand der Gewerkschaften und der MSPD.
Auch Kurt Eisner ergreift das Wort und erkennt, dass die Mehrheit der Anwesenden den Streik will. Nach seinen Ausführungen stimmen die Teilnehmer für die Arbeitskampfmaßnahme.
Ob es bei den Bayerischen Motorenwerken - BMW tatsächlich zum Streik kommen wird, ist fraglich, denn die Versammlung war gegen den Willen der Betriebsvertrauensleute einberufen worden. Und schon deshalb könnten diese dem Streikbeschluss die Anerkennung versagen.
31. 1 1918 - Kurt Eisner gewinnt auch die Arbeiter der Flugzeugwerke
München-Ludwigsvorstadt * Der taktische Winkelzug der USPD geht auf. Felix Fechenbach von den Unabhängigen Sozialdemokraten bemächtigt sich des Vorstandstisches im Festsaal des Mathäserbräu und beruft umgehend eine öffentliche Volksversammlung ein, die er sogleich eröffnet.
Als Redner treten Kurt Eisner und Sara Sonja Lerch auf. Diese erzeugen einen Sinneswandel bei den Anwesenden, die sich jetzt ebenfalls für den Streik aussprechen.
Am Schluss wird auch die bereits am Vormittag von den Kruppianern in der Schwabinger Brauerei beschlossene Resolution zur sofortigen Beendigung des Krieges „des Wahnsinns und der Wahnsinnigen“ angenommen.
31. 1 1918 - Szenen wie im Bürgerkrieg
Berlin * In Berlin spielen sich Szenen wie in einem Bürgerkrieg ab. Polizei und Militär durchbrechen Straßensperren, Schüsse fallen. Militante Arbeiter werfen Steine und bewaffnen sich mit Stöcken und Knüppeln. Sie werfen Straßenbahnen um und bauen Barrikaden. Es gibt viele Verletzte und mehrere Tote.
31. 1 1918 - Polizei-Attacken gegen die streikenden Arbeiter
Berlin * Am Humboldtshain im Stadtviertel Gesundbrunnen wächst die Zahl der demonstrierenden Menschen immer stärker an. Dem Großaufgebot der berittenen Gendarmerie stellt sich eine Menschenmenge entgegen und ruft: „Schluss mit dem Völkermorden!“
Da ziehen die Polizisten ihren Säbel und sprengen nach Art einer Kavallerie-Attacke in die Menge hinein. „Gellende Schreie und Protestrufe wurden laut. Stöhnend sank ein Arbeiter zu Boden. Daraufhin wurden die Berittenen umringt. Ein Reiter stürzte, andere wurden vom Pferd gerissen“, schreibt ein Augenzeuge.
31. 1 1918 - Bayern gegen preußische Vergrößerungspläne
München * Nach einem Besuch des Großherzogs von Oldenburg, Friedrich August, bei König Ludwig III. erklärt dieser dem Vertrauten des Reichskanzlers, Victor Naumann, zu den preußischen Vergrößerungsplänen, dass „gegen irgendeine Bindung an Preußen […] die gewichtigsten Gründe“ sprechen. Es geht um einen Zugewinn für das Deutsche Reich im Ostseeraum.
2 1918 - Im „Fleischer-Palast“ sollen 110 Kleinwohnungen untergebracht werden
München-Bogenhausen * Die Baufirma Heilmann & Littmann will in den Fleischer-Palast 110 Kleinwohnungen unterbringen.
Ein weiterer Plan war, das Gebäude abzureißen und das Gelände in 30 Villenbauplätze aufzuteilen.
1. 2 1918 - Weitere USPD-Streik-Agitatoren werden verhaftet
München * Am frühen Morgen dieses Freitags werden Sarah Sonja Lerch, Carl Kröpelin, Hans Unterleitner sowie die Schwestern Betty und Emilie Landauer verhaftet.
1. 2 1918 - Der Matrosenaufstand von Cattaro
Kotor * Auf den in der Bucht von Kotor vor Anker liegenden 40 Schiffe der k.u.k.-U-Bootflotte kommt es zum Matrosenaufstand von Cattaro. 6.000 Matrosen hissen die roten Fahnen und verlangen den sofortigen Friedensschluss.
1. 2 1918 - Die MSPD-Führung gewinnt wieder Einfluss auf die Streikenden
München-Maxvorstadt * Nach der Verhaftung von Kurt Eisner und anderen USPD-Streikführern gewinnt die MSPD-Führung wieder Einfluss auf die Streikenden. In einer Versammlung der Bayerischen Flugzeugwerke im Löwenbräukeller fordert Erhard Auer zur „Mäßigung und zur Beendigung des Streiks“ auf.
1. 2 1918 - Protestmarsch der Streikenden zum Polizeipräsidium
München-Schwabing * Am Vormittag treffen sich die streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter der Bayerischen Geschützwerke, Teile der Belegschaft der Lokomotivfabrik Maffei sowie die Arbeiterinnen und Arbeiter der Lederfabrik Gebrüder Hesselberger und des BMW-Werkes zur Auftaktveranstaltung in der Schwabinger Brauerei. Im Anschluss ziehen sie in einem Protestmarsch zum Polizeipräsidium in der Ettstraße.
Stand bisher die Friedensfrage im Mittelpunkt, so wird nach der Verhaftungsaktion die Freilassung der Gefangenen zur Hauptaufgabe. Zu diesem Zweck hat die Versammlung eine vierköpfige Kommission gewählt, die beim Polizeipräsidenten die Freilassung der Inhaftierten erwirken soll.
Da - nach Aussage des Polizeipräsidenten - die Polizei keine Einflussmöglichkeiten auf die gerichtlichen Entscheidungen hat, muss die Kommission ohne Ergebnis wieder abziehen.
1. 2 1918 - Die Streikbewegung geht weiter
München-Ludwigsvorstadt * Die streikende BMW-Arbeiterschaft hält ihre Versammlung im Mathäserbräu ab.Um die Mittagszeit marschiert sie zu den Präzisionswerken Deckel.
1. 2 1918 - Marsch zur Maffei-Maschinenfabrik
München-Schwabing * Die Streikenden der Bayerischen Geschützwerke beenden ihren Protestmarsch zu einer Kundgebung in der Schwabinger Brauerei. Im Anschluss ziehen sie weiter zur Maffei-Maschinenfabrik.
1. 2 1918 - Weitere Versammlungen der streikwilligen Belegschaften
München * Am Nachmittag und Abend dieses Tages finden noch weitere Versammlungen der Belegschaften verschiedener Betriebe statt.
1. 2 1918 - Otto von Dandl bedankt sich bei den Mehrheitssozialdemokraten
München * Ministerpräsident Otto von Dandl dankt den bayerischen Mehrheitssozialdemokraten im Landtag dafür, dass sie die Führung der Streikbewegung übernommen haben und bringt seiner Hoffnung auf baldige Beruhigung der Lage Ausdruck.
2. 2 1918 - Die Beendigung der Streikmaßnahmen wird beschlossen
München-Isarvorstadt * Am Abend finden im Gewerkschaftshaus in der Pestalozzistraße 40/42 Einigungsverhandlungen zwischen den von der USPD geführten Streikenden und der MSPD statt. Sie führen zu keinem Erfolg.
- Die Streikleitung erklärt sich allerdings mit der MSPD einverstanden, die die Forderungen der Arbeiter der Reichsregierung unterbreiten will.
- Ebenso ist sie mit der Wiederaufnahme der Arbeit am Montag, dem 4. Februar einverstanden.
Letztlich ist es den Behörden - in Zusammenarbeit mit der SPD und den Gewerkschaften - gelungen, die Streiks zu beenden.
2. 2 1918 - Streik-Versammlung der Flugzeugwerke im Löwenbräukeller
München-Maxvorstadt * Die streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter der Bayerischen Flugzeugwerke versammeln sich im Löwenbräukeller.
2. 2 1918 - Fast 10.000 Münchner befinden sich im Streik
München * Am Nachmittag dieses Samstags finden in den nachstehenden Betrieben Streikmaßnahmen statt:
- Bei den Bayerischen Flugzeugwerken beteiligen sich 3.000 Männer und Frauen,
- bei den Bayerischen Geschützwerken wird von 2.000 Männern und Frauen bestreikt,
- die Bayerischen Motorenwerke bestreiken 1.500 Männer und Frauen,
- bei den Präzisionswerken Deckel befinden sich hauptsächlich 1.100 Frauen im Streik.
- In den Ottowerke-Maschinen- und Flugzeugfabrik haben etwa 1.000 Männer und Frauen die Arbeit niedergelegt,
- in der Zigarettenfabrik Austria tun dies 500 Frauen,
- bei der Zigarettenfabrik Philipps Carl Witwe sind 300 Frauen im Streik,
- in der Möbelfabrik Deutsche Werkstätten streiken 180 Männer und Frauen,
- bei der Lederfabrik Gebrüder Hesselberger haben 150 Frauen die Arbeit niedergelegt.
- Hinzu kommen noch viele, vor allem streikende Frauen aus weiteren kleinen Betrieben.
Fazit: Am Höhepunkt der Januarstreiks haben sich in München weit über 9.000 Menschen, vorwiegend aus den Münchner Rüstungsbetrieben, beteiligt. Der Streik wurde zu einem erheblichen Teil von Frauen getragen.
2. 2 1918 - Die Verhaftung der USPD-Streikführer erfolgte wegen Landesverrat
München * Ein weiterer Versuch durch eine Kommission der streikenden Arbeiter zur Freilassung von Kurt Eisner und den anderen verhafteten USPD-Funktionären ist erneut erfolglos. Die Abordnung erfährt nur, dass die Verhaftungen wegen Landesverrats erfolgt sind.
2. 2 1918 - Die Streikenden erarbeiten einen Forderungskatalog
München-Theresienwiese * Im Anschluss ziehen die Versammelten zur Theresienwiese, wo sich insgesamt 6.000 Streikende aus verschiedenen Betrieben einfinden.
Ein Forderungskatalog wird erarbeitet, der dem der Berliner Arbeiter entspricht:
- Neben der Freilassung der inhaftierten Streikführer sind das
- die Umwandlung des politischen Systems in ein demokratisches,
- die Wiederherstellung der Koalitions-, der Presse- und der Versammlungsfreiheit,
- die Aufhebung des Belagerungszustands und
- die gleichmäßige Verteilung der Lebensmittel.
2. 2 1918 - Dr. Eugen Lerch hat die Scheidung eingereicht
München * Die Münchener Post berichtet, dass sich Dr. Eugen Lerch öffentlich von den politischen Aktivitäten seiner Ehefrau Sarah Sonja distanziert und er die Scheidung eingereicht hat.
2. 2 1918 - Eisner wird als geistiger Leiter der Aufstandsbewegung benannt
München * Von den Behörden wird Kurt Eisner für München als „geistiger Leiter und Organisator der Aufstandsbewegung“ bezeichnet, dessen Einfluss auf die Arbeiterinnen und Arbeiter ausschließlich seiner „leidenschaftlichen Redegewandtheit“ zugeschrieben wird.
Dabei ignorieren sie, dass das unbestrittene rhetorische Talent Eisners seine Wirkung nur deshalb entfalten kann, weil die Stimmungslage in der Arbeiterschaft in den verzweifelt schlechten Lebensbedingungen begründet liegt.
3. 2 1918 - Die letzte Streik-Versammlung auf der Theresienwiese
München-Theresienwiese * Um 10 Uhr treffen sich 2.500 bis 3.000 Streikende zur letzten Streik-Kundgebung unter freiem Himmel auf der Theresienwiese.
Eine Deputation wird gewählt, die die Forderungen vom 2. Februar 1918 bei der Regierung vortragen soll. Der der USPD angehörende Handlungsgehilfe Fritz Schröder erklärt, dass die gegenwärtige Bewegung ein Kinderspiel sei, gegen das, was noch kommen wird, wenn die Forderungen der Arbeiter abgelehnt werden würden.
Der anschließende Demonstrationszug wächst noch einmal auf 5.000 Menschen an.
3. 2 1918 - Ernst Toller wird verhaftet
München * Ernst Toller wird wegen seiner Beteiligung an den Januarstreiks verhaftet.
4. 2 1918 - Die „Streiks“ sind beendet, der Anlass bleibt
München * Die „Streiks“ sind beendet.
In den Fabriken wird wieder gearbeitet, doch der Anlass der „Streiks“ ist geblieben.
Die „Christlichen Gewerkschaften“ lehnen in einer Stellungnahme grundsätzlich jeden „politischen Streik“ ab.
4. 2 1918 - 75.000 bayerische Arbeiter beteiligten sich am Januarstreik
Königreich Bayern * In den großen bayerischen „Industriestädten“ München, Nürnberg, Fürth, Schweinfurt und Ludwigshafen haben sich zusammen etwa 75.000 Beschäftigte in den Rüstungsbetrieben an den „Januarstreiks“ beteiligt.
4. 2 1918 - Lorenz Winkler wird verhaftet
München * Am Nachmittag wird Lorenz Winkler wegen seiner Beteiligung an den Münchner Januarstreiks verhaftet.
4. 2 1918 - Wilhelm Dittmann zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt
Berlin * Das Außerordentliche Kriegsgericht in Berlin verurteilt Wilhelm Dittmann wegen seiner Beteiligung am Berliner Munitionsarbeiterstreik und des versuchten Landesverrats zu fünf Jahren Festungshaft.
4. 2 1918 - Betrübte Stimmung beim USPD-Stammtisch
München-Ludwigsvorstadt * Turnusgemäß findet im Wirtshaus Zum Goldenen Anker die USPD-Gesprächsrunde statt.
Alfred Gärtner hat kommissarisch den Vorsitz übernommen.
Die Stimmung ist sehr gedrückt.
4. 2 1918 - Standrecht gegen Generalstreik
München * König Ludwig III. ermächtigt den Kriegsminister Philipp von Hellingrath für den Fall des Generalstreiks „das Standrecht je nach Lage der Verhältnisse für Bayern rechts des Rheines oder für Teile des Königreiches öffentlich zu verkünden“.
4. 2 1918 - Gegen Militärdiktatur und Regierungssozialisten
München-Au * Kurt Eisner beschreibt beschreibt die Situation der Januar-Streiks in seinem Gefängnis-Tagebuch:
„Wir hatten nicht nur die Militärdiktatur gegen uns, sondern auch die Regierungssozialisten, die die gesamte politische und gewerkschaftliche Organisation fest in Händen hielten, eine Camorra, die vor keinem Mittel zurückschreckten, um sich selbst in ihrer verworfenen Stellung zu behaupten.
Wir waren nur ein kleines Häuflein, ohne die Autorität von Ämtern und Würden, ohne Geld, ohne Presse, ohne die Möglichkeit schriftlicher Propaganda“.
Nach 5. 2 1918 - Nach den Januarstreiks sinkt die USPD-Mitgliederzahl
München * Nach dem Ende der Januarstreiks sinkt die Zahl der Münchner USPD sofort um ein Drittel ab und pendelt sich bei etwa 400 Anhänger ein.
8. 2 1918 - Eine neue Verhandlungskommission wird gebildet
<p><em><strong>München</strong></em> * Die am 3. Februar gewählte Deputation, die die Forderungen vom 2. Februar der Regierung vortragen soll, wird durch eine neue Kommission ersetzt. Dazu wird eine Sitzung der Arbeiterausschüsse von 34 Münchner Betrieben einberufen. Diese wählen eine Kommission, die aus elf Betriebsvertretern und zwei MSPD-Landtagsabgeordneten besteht. Diese sollen mit der Regierung verhandeln.</p> <p>Erhard Auer übernimmt die Aufgabe des Sprechers. </p>
9. 2 1918 - Die Ukraine unterzeichnet mit den Mittelmächten einen Separatfrieden
<p><em><strong>Brest-Litowsk</strong></em> * Zwischen der weitgehend von Bolschewisten besetzten Ukraine und den Mittelmächten wird in Brest-Litowsk ein Separatfrieden unterzeichnet.</p> <p>Dieser Brotfriede soll die Lebensmittelversorgung der Mittelmächte sichern. Zugleich wird die Ukraine wirtschaftlich eng an das Deutsche Reich gebunden. </p>
10. 2 1918 - Leo D. Trotzki beendet die Verhandlungen mit den Mittelmächten
Brest-Litowsk * Der russische Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, Leo D. Trotzki, beendet in Brest-Litowsk die Verhandlungen mit den Mittelmächten aus Verärgerung über den am Tag zuvor abgeschlossenen Separatfrieden mit der Ukraine.
14. 2 1918 - In Russland wird der „gregorianische Kalender“ eingeführt
Russland * In Russland wird der gregorianische Kalender eingeführt.
Die Datierung rückt um 13 Tage vor.
Damit folgt auf den 1. Februar der 14. Februar.
16. 2 1918 - Freundlich empfangen - nichts erreicht
München-Kreuzviertel * Die am 8. Februar gewählte Kommission wird von Ministerpräsident Otto von Dandl, Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich und Kriegsminister Philipp von Hellingrath empfangen. Der Sprecher der Kommission, der MSPD-Landtagsabgeordnete Erhard Auer, trägt die Wünsche der Arbeiterausschüsse vor. Die Forderung nach Freilassung der verhafteten Streikführer ist auf der Liste nicht mehr enthalten.
Die Minister beziehen freundlich zu den Forderungen und Anregungen Stellung, Zugeständnisse machen sie jedoch keine. Der Empfang der Kommission wirkt sich dennoch beruhigend auf die Arbeiterschaft aus.
18. 2 1918 - Dr. Hans Küfner wird II. rechtskundiger Bürgermeister
München * Der am 28. November 1917 zum II. rechtskundigen Bürgermeister gewählte Hofrat Dr. Hans Küfner tritt sein Amt an.
18. 2 1918 - Die Mittelmächte nehmen die Kampfhandlungen wieder auf
Brest-Litowsk * Die Mittelmächte nehmen nach dem einseitigen Abbruch der Friedensverhandlungen durch Leo D. Trotzki am 10. Februar die Kampfhandlungen im Rahmen der „Operation Faustschlag“ wieder auf. Generalquartiermeister Erich Ludendorff arbeitet auf die Abtrennung der gesamten baltischen Küste und Finnlands von Russland hin.
20. 2 1918 - Das Ex-Königspaar feiert Goldene Hochzeit
München * Mit dem Goldenen Hochzeitsjubiläum von Ex-König Ludwig III. und Ex-Königin Marie Therese wird das letzte große Fest der bayerischen Monarchie gefeiert. Die äußeren Feierlichkeiten beschränken sich auf das Kirchliche.
„Das Königspaar steht in seinem ernsten Fühlen dem Gedanken ferne, mit rauschendem Gepränge, wie es dem Ansehen des monarchischen Gedankens im tiefen Frieden und der Freude des Volkes entsprechen würde, in die durch den Krieg tausendfach verursachte Trauer einzufallen. Auch das Kriegsleid will das bayerische Herrscherhaus ganz und gar mit dem Bayernvolke teilen.“
22. 2 1918 - Die Behörden loben die Mehrheitssozialdemokraten
München * Die bayerischen Behörden würdigen ausdrücklich das Verhalten der Mehrheitssozialdemokratie, die den Streik „aufgenommen und in ruhige Bahnen gelenkt“ hat.
22. 2 1918 - Das Kriegsministerium kategorisiert die Streikleitungen
München * Das bayerische Kriegsministerium unterscheidet in seiner Analyse die Streikleitungen in
- „Führer, die den unabhängigen Sozialdemokraten angehörend, in unmittelbarer Verbindung mit Norddeutschland, vielleicht auch mit dem Ausland stehen und revolutionäre Umtriebe ins Land hereinbringen.
- „Den einheimischen Führern der gemäßigten Sozialdemokratie. […] Sie haben die Bewegung bisher vielfach in besonnene Bahnen gelenkt, vertreten aber natürlich aus parteitaktischen Gründen den Demonstrationsstreik als ein zuverlässiges politisches Mittel.
- „Der Masse der beteiligten Arbeiterschaft, die unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen jeder verhetzenden Einwirkung besonders zugänglich ist.“
Und weiter schlägt das Kriegsministerium vor:
„Führer der unter 1) bezeichneten Art sind, wenn irgend möglich, aus ihrer Umgebung zu entfernen und zwar solche, die sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig oder dringend verdächtig gemacht haben durch polizeiliche vorläufige Festnahme und Erwirkung eines richterlichen Haftbefehls – Wehrpflichtige durch Einberufung, Versetzung, Abstellung ins Feld -, Nichtbayern durch Aufenthaltsverbot auf Grund Art. 42 des Kriegszustandsgesetzes.“
23. 2 1918 - Veranstaltungsverbot für Josef Sontheimer
München * Josef Sontheimer wird von den Behörden jede Beteiligung an politischen Veranstaltungen verboten.
26. 2 1918 - Russland kehrt wieder an den Verhandlungstisch zurück
Brest-Litowsk * Nach dem schnellen Vormarsch der Mittelmächte kehren die russischen Beauftragten für die Friedensverhandlungen wieder an den Verhandlungstisch in Brest-Litowsk zurück.
26. 2 1918 - Mit den Forderungen des Beamten- und Lehrerbundes beschäftigt
München * Der Ministerrat beschäftigt sich mit den Forderungen des Beamten- und Lehrerbundes.
27. 2 1918 - Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz gemeinsam regiert
Strelitz - Schwerin * Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin übernimmt die Regierungsgewalt und fungierte bis zum Ende der Monarchie als Reichsverweser von Mecklenburg-Strelitz.
28. 2 1918 - Sarah Sonja Lerchs Leidenszeit beginnt
München-Au * Sarah Sonja Lerch bekommt im Gerichtsgefängnis Neudeck Zahnschmerzen, weshalb sie dies dem Untersuchungsrichter mitteilt und um einen Zahnarztbesuch bittet. Es wird bis zum 19. März dauern, bis Frau Lerch einer Zahnbehandlung zugeführt wird.
28. 2 1918 - Eisner: „Die deutsche Regierung beschuldigt uns einer Käuflichkeit“
München-Au * Kurt Eisner schreibt in sein Gefängnistagebuch:
„Ausländische Einflüsse, ausländisches Geld soll in der Streikbewegung wirksam gewesen sein. Die deutsche Regierung beschuldigt uns einer Käuflichkeit, die sie selbst mit Hunderten von Millionen in der ganzen Welt organisiert hat“.
1. 3 1918 - Deutsche Truppen setzen in Kiew eine antibolschewistische Regierung ein
Kiew * Deutsche Truppen besetzen Kiew und setzen eine antibolschewistische Regierung ein.
1. 3 1918 - Das deutsche Heer besteht aus 5,1 Millionen einsatzfähigen Soldaten
Deutsches Reich * Das deutsche Heer besteht aus 5,1 Millionen einsatzfähigen Soldaten.
1. 3 1918 - Streikende auf den richtigen Weg zurückführen
München * Die bayerischen Behördenvertreter unterscheiden zwischen
- den „hetzerischen Führern“, die lediglich ihre eigensüchtigen Ziele verfolgen, und
- den eigentlich „unpolitischen“ beziehungsweise „gutmütigen“ Anhängern, die es gilt, wieder auf den „rechten Weg“ zurückzuführen.
Diese Theorie kann später ohne Probleme in die Dolchstoßlegende und die sie umgebenden Verschwörungstheorien integriert werden.
2. 3 1918 - 100 Jahre Bayerische Verfassung
München * König Ludwig III. erinnert an das am 26. Mai bevorstehende hundertjährige Bestehen der Bayerischen Verfassung.
3. 3 1918 - Paraphierung des Friedensvertrages von Brest-Litkowsk
Brest-Litowsk * Der Friedensvertrag von Brest-Litkowsk zwischen der Sowjetregierung und den Mittelmächten wird durch die Verhandlungsführer paraphiert.
- Russland verliert über 25 Prozent seiner Bevölkerung,
- 27 Prozent seines wirtschaftlich nutzbaren Bodens und
- muss die Unabhängigkeit von Finnland, Estland, Livland, Kurland, Litauen, Polen, Georgien, der Ukraine und von Teilen Armeniens anerkennen.
4. 3 1918 - Erstmals taucht der Begriff Reinheitsgebot auf
München-Kreuzviertel * Erstmals taucht der Begriff Reinheitsgebot während einer Debatte im Bayerischen Landtag auf. Es ist der niederbayerische Abgeordnete Hans Rauch, Akademielehrer und Leiter der Buchstelle bei der Akademie für Landwirtschaft und Brauerei Weihenstephan, der sagt: „Wir halten fest am Reinheitsgebote, weil wir der Tradition treu bleiben.“
4. 3 1918 - Die Spanische Grippe tritt erstmals auf
Camp Funston - Kansas * Der erste offizielle Fall der sogenannten Spanischen Grippe wird gemeldet. Die Grippe wird bis März 1929 weltweit 50 bis 100 Millionen töten. Das sind 2,5 bis 5 Prozent der Weltbevölkerung.
7. 3 1918 - Freier Arbeiterausschuss für einen guten Frieden
München * Der in der Reichsbahnhauptwerkstätte München als Werkzeugschlosser beschäftigte Anton Drexler ruft den Freien Arbeiterausschuss für einen guten Frieden ins Leben. Die Gründung erfolgte in Anlehnung an eine fast gleichnamige und gleiche Ziele verfolgende Organisation in Bremen. Aus dem Freien Arbeiterausschuss für einen guten Frieden wird später die Deutsche Arbeiterpartei - DAP hervorgehen. .
Es ist eine antisemitische und antimarxistische Gruppierung, die nie mehr als vierzig Mitglieder zählt und der es um eine Versöhnung der Arbeiterschaft mit der nationalen Rechten geht. Die bürgerlichen Parteien haben in ihren Augen versagt und der Marxismus erscheint ihnen für ihre nationalistischen Ziele ungeeignet.
7. 3 1918 - Freundschaftsvertrag Deutschland - Finnland
Berlin - Helsinki * Zwischen dem Deutschen Reich und der bürgerlichen Regierung Finnlands wird ein Friedens- und Freundschaftsvertrag geschlossen.
8. 3 1918 - Das Große Hauptquartier der OHL zieht ins belgische Spa
Bad Kreuznach - Spa * Das Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL wird von Bad Kreuznach in das Hotel Britannique ins belgische Spa verlegt. Dort bleibt es bis zum Kriegsende.
9. 3 1918 - Der Schriftsteller Frank Wedekind stirbt
München * Der Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler Frank Wedekind stirbt in München an den Nachwirkungen einer Blinddarmoperation. Seine Beisetzung am Waldfriedhof wird zum Skandal, da neben vielen Künstlern auch zahlreiche Prostituierte teilnehmen. Die Trauerrede hält Ludwig Ganghofer.
10. 3 1918 - Aufhebung der Sonntagsarbeit in den Rüstungsbetrieben
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Sonntagsarbeit in den Rüstungsbetrieben wird aufgehoben.</p>
10. 3 1918 - Moskau wird zur russischen Hauptstadt erklärt
<p><em><strong>Petersburg - Moskau</strong></em> * Die sowjetrussische Regierung verlegt ihren Sitz aus strategischen Gründen nach Moskau. Moskau wird deshalb zur Hauptstadt erklärt. </p>
10. 3 1918 - Kaiser Wilhelm II. will den Feinden einen Siegfrieden aufzwingen
<p><em><strong>München</strong></em> * In der Münchener Allgemeinen Zeitung bekennt sich Kaiser Wilhelm II. zu einem <em>„Siegfrieden“</em>, der den Feinden <em>„aufgezwungen“</em> werden muss. <em>„Völkerbeglückende Weltbürgerschaftsgedanken finden darin keinen Platz. Nur das nackte eigene Interesse und die Garantie eigener Sicherheit und Größe dürfen maßgebend sein“</em>. </p>
14. 3 1918 - Richard Kämpfer wird in Dresden verhaftet
<p><em><strong>Dresden</strong></em> * Richard Kämpfer wird wegen seiner Beteiligung an den Münchner Januarstreiks in Dresden verhaftet. </p>
14. 3 1918 - Kurt Eisner analysiert den Januarstreik
<p><em><strong>München-Au</strong></em> * Kurt Eisner erklärt bei einer Angeschuldigten-Vernehmung im Gerichtsgefängnis Neudeck die durch seine Verhaftung erfolgte Wendung in den Januarstreiks:</p> <ul> <li><em>„Ich bin […] der Überzeugung, dass in zwei weiteren Tagen die gesamte Münchner Arbeiterschaft gestreikt haben würde, wenn wir freie Betätigung gehabt hätten und wenn uns nicht im eigenen sozialistischen Lager in der Mehrheitspartei ein Gegner in den Rücken gefallen wäre. </em></li> <li><em>Wenn die Bewegung noch kurze Zeit gedauert hätte, wären die Mehrheitsführer, die ohnehin in jeder öffentlichen Versammlung, in der ich und meine Gesinnungsgenossen sprachen, eine glatte Niederlage erlitten, sicher völlig aus dem Feld geschlagen worden.“ </em></li> </ul>
15. 3 1918 - Anna Niedermeier, Franz Xaver Müller und Karl Mettler werden verhaftet
<p><em><strong>München</strong></em> * Anna Niedermeier, Franz Xaver Müller und Karl Mettler werden wegen ihrer Beteiligung an den Münchner Januarstreiks verhaftet. Die Arbeiterin Anna Niedermeier wird noch am gleichen Tag wieder freigelassen.</p>
15. 3 1918 - Sarah Sonja Lerch wird ins Gefängnis Stadelheim überstellt
<p><em><strong>München-Au - München-Stadelheim</strong></em> * Die noch immer an Zahnschmerzen leidende Sarah Sonja Lerch wird aufgrund der <em>„Steigerung ihrer seelischen Erregungszustände“</em> vom Gerichtsgefängnis Neudeck in Gefängnis Stadelheim gebracht. </p>
18. 3 1918 - Die achte Kriegsanleihe wird aufgelegt
Berlin * Beginn der Zeichnungsfrist für die achte Kriegsanleihe.
19. 3 1918 - Nach drei Wochen endlich zum Zahnarzt
<p><em><strong>München-Stadelheim</strong></em> * Die seit Ende Februar an Zahnschmerzen leidende Sarah Sonja Lerch wird im Gefängnis Stadelheim vom Zahnarzt behandelt. Drei Wochen hat das Warten gedauert, was von der Behörde auf den komplizierten Verwaltungsweg zurückgeführt wird. Aber eigentlich ist das Folter. </p>
Ab 21. 3 1918 - Die Große deutsche Frühjahrsoffensive beginnt
Bapaume - Nordfrankreich * Mit einem mehrstündigen, für die Gegenseite in seiner Massivheit vollkommen unerwarteten „Sturm aus Feuer und Stahl“, wie man ihn bis dahin noch nicht erlebt hat, beginnen die deutschen Truppen die „Operation Michael“. Es ist die erste von fünf Schlachten der deutschen Frühjahrsoffensive, die zugleich der letzte Versuch des Deutschen Kaiserreichs ist, an der Westfront einen für die Mittelmächte günstigen Kriegsausgang zu erreichen.
Was die Briten in der Flandernschlacht in zwei Wochen verschossen hatten, verbrauchen die Deutschen in nur wenigen Stunden. Es werden nicht nur Sprenggranaten, sondern auch Giftgas-Granaten verschossen. Schon am ersten Tag des Unternehmens kann die Verteidigung des Gegners durchbrochen werden. In den Folgetagen dringen die deutschen Truppen auf einer Breite von 80 Kilometern etwa 65 Kilometer tief in französisches Territorium ein.
Die Entente soll zurückgeschlagen werden, ehe die US-Amerikaner in Europa landen. Dies würde, so die Überlegung Erich von Ludendorffs, das Deutschen Reich in eine gute Ausgangsposition bei den Friedensverhandlungen setzen.
- Die Offensive wird nur am Anfang erfolgreich sein, aber kein Triumphlauf werden.
- Die Übermacht der alliierten Streitkräfte,
- erhebliche Versorgungsprobleme und
- große Verluste sind Ursachen für den Untergang der deutschen Truppen.
- Am ersten Tag der „Michael-Offensive“ werden auf deutscher Seite von 39.929 Mann 10.851 getötet, 28.778 verwundet und 300 Mann gefangen genommen.
- Von den eingesetzten 38.512 Briten fallen 7.512, etwa 10.000 werden verwundet und 21.000 gehen in Gefangenschaft.
22. 3 1918 - Veranstaltungsverbot für Erich Mühsam
München * Die Behörden untersagen Erich Mühsam jede Beteiligung an politischen Veranstaltungen.
22. 3 1918 - Der Reichstag stimmt der Kriegskreditvorlage zu
Berlin * Der Reichstag stimmt - gegen die Stimmen der USPD - der Kriegskreditvorlage zu.
22. 3 1918 - Streikleitungen als Schädlinge
München * Kriegsminister Philipp von Hellingrath äußert sich zu den Führern der Januarstreiks:
- „Das arbeitsscheue und verbrecherische Gesindel, das besonders die Großstädte als Schlupfwinkel für sein lichtscheues Treiben wählt, bildet in Zeiten politischer Hochspannung oder wirtschaftlichen Kämpfe eine gesteigerte Gefahr für die Sicherheit des Reiches, denn diese Elemente beteiligen sich erfahrungsgemäß in erster Linie an Unruhen und aufrührerischen Umtrieben.
- Die Säuberung der Großstädte und Industriebezirke von derartigen ordnungsfeindlichen Elementen gewinnt daher für die Bekämpfung künftiger Unruhen besondere Bedeutung“.
Von hier aus ist es nicht mehr weit zur unseligen Rhetorik der „Schädlingsbekämpfung“.
23. 3 1918 - Im Reichstag wird der Friedensvertrag von Brest-Litowsk ratifiziert
<p><em><strong>Berlin </strong></em>* Im Berliner Reichstag wird der Friedensvertrag von Brest-Litowsk ratifiziert.,Bei der vorausgegangenen Abstimmung stimmen</p> <ul> <li>die Abgeordneten der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - USPD dagegen,</li> <li>die der Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD enthalten sich der Stimme. </li> </ul>
23. 3 1918 - Schulfrei für Siegesfeiern
<p><em><strong>Deutsches Reich</strong></em> * Kaiser Wilhelm II. gibt den Schulkindern für Siegesfeiern schulfrei. </p>
25. 3 1918 - Immer weniger Beteiligung am USPD-Stammtisch
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Nur mehr 30 Personen besuchen den USPD-Diskussions-Stammtisch im Wirtshaus Zum Goldenen Anker. Theobald Michler erklärt: <em>„Der Krieg ist nicht vom Volke, denn das Volk will den Frieden. Der Großkapitalismus aller Völker hat den Krieg heraufbeschworen und dieser wird von einigen unverantwortlichen Elementen, wie Ludendorff und Hindenburg, geführt“</em>. </p> <p>Wenig später wird Michler festgenommen und bleibt bis Oktober in Untersuchungshaft. </p>
25. 3 1918 - Der Kriegsminister und der Umgang mit den Sozis
München * Kriegsminister Philipp von Hellingrath formuliert in einem internen Schreiben seine Meinung, welche Taktik gegenüber den beiden sozialdemokratischen Parteien einzuschlagen ist:
„Nach den seitherigen Erfahrungen bildet die unabhängige Sozialdemokratie eine schwere Gefahr für den Fortbestand des Reiches. Ihren Bestrebungen muß auf jedem möglichen Wege entgegengetreten werden.
Da sie ihren Zuwachs vornehmlich aus den Reihen der rechtsstehenden Sozialdemokratie erhält, liegt die wirksamste Abwehr gegen ihre weitere Ausbreitung in Maßnahmen, durch welche die sozialdemokratische Mehrheitspartei die Flucht ihrer bisherigen Anhänger in das Lager der Unabhängigen zu verhindern sucht.
In dieser Beziehung erblicke ich ein wirksames Mittel in der Versammlungstätigkeit der alten sozialdemokratischen Partei. Durch mündliche Aufklärung vermag sie am ehesten ihre Mitglieder sich zu erhalten und gegen die unterirdische Wühlarbeit der Radikalsozialisten widerstandsfähig zu machen.
Das Bestreben der militärischen Zensurstellen wird daher dahin gehen müssen, den Veranstaltungen der Mehrheitssozialisten so wenig wie möglich Schwierigkeiten zu bereiten.
Gelegentliche Entgleisungen in den Versammlungen werden in der Regel weit weniger nachteilige Folgen haben als verbitternd wirkende Verbote und Anordnungen“.
26. 3 1918 - Ferdinand Foch wird französischer Oberkommandierender
<p><em><strong>Paris</strong></em> * Ferdinand Foch wird zum Oberkommandierenden sämtlicher alliierten Streitkräfte in Frankreich ernannt. </p>
26. 3 1918 - Hugo Haase sucht Kurt Eisner im Gefängnis auf
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Rechtsanwalt und USPD-Reichstagsabgeordnete Hugo Haase trifft in München ein, um dort seinen Mandanten Kurt Eisner im Gerichtsgefängnis Neudeck zu besuchen. </p>
27. 3 1918 - Der USPD-Reichstagsabgeordnete Hugo Haase spricht im Lamplgarten
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Rechtsanwalt und USPD-Reichstagsabgeordnete Hugo Haase spricht bei der USPD-Versammlung im Lamplgarten vor 46 Anwesenden. Kurz darauf wird die Versammlung von der Polizei gestürmt und die Personalien der Anwesenden erfasst. </p>
31. 3 1918 - Monatlich treffen 250.000 amerikanische Soldaten ein
<p><em><strong>USA - Frankreich</strong></em> * Seit März 1918 treffen monatlich 250.000 US-Soldaten zur Verstärkung ein. Bis Kriegsende werden es rund zwei Millionen sein. Sie sind mit den besten Waffen und der modernsten Technologie ausgerüstet. Außerdem sind sie tüchtig und tatendurstig. Mit den amerikanischen Truppen wird auch die sogenannte Spanische Grippe in die Schützengräben der Westfront gebracht. </p>
31. 3 1918 - Hedwig Kämpfer und Selma Schroeder werden ausgewiesen
<p><em><strong>München</strong></em> * Hedwig Kämpfer und Selma Schroeder betreiben die von Kurt Eisner begonnene Agitation für einen Massenausstand der Rüstungsarbeiter weiter. Die beiden Frauen werden deshalb - völlig mittellos - nach Preußen ausgewiesen. </p>
1. 4 1918 - Sarah Sonja Lerch wird beerdigt
<p><em><strong>München</strong></em> * Dr. phil. Sarah Sonja Lerch, geborene Rabinowitz, eine der Anführerinnen der Januarstreiks, wird am Ostermontag auf dem Neuen Israelitischen Friedhof an der Garchinger Straße beerdigt. Ein Vertreter der USPD legt einen Kranz am Grab ab und erklärt, dass die Polizei einen Nachruf verboten hat. Josef Sontheimer ergreift daraufhin das Wort, wird aber sofort verhaftet und mit Handschellen gefesselt abgeführt.</p> <p>Frau Lerch war gemeinsam mit Kurt Eisner, Albert Winkler, Hans Unterleitner, Emilie und Babette Landauer und anderen wegen Landesverrats verhaftet worden. Die 35-jährige Sarah Sonja Lerch hat sich am 29. März 1918 im Gefängnis Stadelheim erhängt. Sie wird nicht die letzte Sozialdemokratin sein, die im Freitod die Erlösung aus offenbar nicht zu verändernden Verhältnissen sucht. </p>
2. 4 1918 - Der Vorwärts berichtet über den Freitod der Sarah Sonja Lerch
<p><em><strong>München</strong></em> * Die SPD-Parteizeitung Vorwärts berichtet in ihrer Ausgabe über das Ableben der Sarah Sonja Lerch: <em>„Im Untersuchungsgefängnis Stadelheim erhängte sich nachmittags die beim letzten Streik bekanntgewordene Frau Sara Sonja Lerch, gegen die zusammen mit dem Schriftsteller Kurt Eisner ein Landesverratsverfahren eingeleitet war. - </em></p> <p><em>Die Umstände, unter denen die bedauernswerte Frau zu ihrer Verzweiflungstat getrieben wurde, bedürfen der Aufklärung. Soviel wir wissen, handelt es sich im Falle der Frau Lerch, einer geborenen Russin, um eine reine Idealistin, die mit ihrer Streikpropaganda der Sache der Menschheit einen Dienst zu erweisen glaubte. </em></p> <p><em>Die Strafe, mit der sie zu rechnen hatte, war nicht so erschreckend, dass sie den freiwilligen Tod ihr vorziehen konnte. Es bleibt also unklar, was diese Frau zu ihrem Selbstmord getrieben hat. […].“ </em></p>
5. 4 1918 - Ludendorff bricht die Operation Michael wegen Erfolglosigkeit ab
<p><em><strong>Spa - Nordfrankreich</strong></em> * Generalquartiermeister Erich Ludendorff lässt die <em>„Operation Michael“</em> wegen Erfolglosigkeit abbrechen. </p> <ul> <li>Die deutschen Truppen können nicht zum Meer durchdringen,</li> <li>das britische Heer ist nicht zusammen gebrochen,</li> <li>es bleibt bei einem bloßen Raumgewinn.</li> <li>Nach der Anzahl der Gefallenen (35.163 auf deutscher Seite) ist die <em>„Michael-Offensive“</em> die blutigste Schlacht des ganzen Ersten Weltkrieges. </li> <li>Ludendorff führt den Misserfolg auf den <em>„nachlassenden Angriffsgeist der Truppe“</em> zurück. </li> </ul>
8. 4 1918 - Die USPD-Diskussionsabende werden eingestellt
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Nachdem sich nur mehr acht Personen am USPD-Diskussionsabend im Gasthaus Zum Goldenen Anker in der Schillerstraße beteiligen, stellt man dieses Bildungsangebot wieder ein. Durch die Verhaftung der Vordenker der Partei sind ihr</p> <ul> <li>die Integrationsfiguren weggebrochen,</li> <li>nennenswerte Aktionen finden nicht mehr statt.</li> <li>Die Münchner USPD versinkt in der Bedeutungslosigkeit. </li> </ul>
9. 4 1918 - Betty und Emilie Landauer werden entlassen
<p><em><strong>München-Au</strong></em> * Die am 1. Februar 1918 wegen ihrer Beteiligung am Münchner Januarstreik verhafteten Buchhalterinnen Betty und Emilie Landauer werden aus der Untersuchungshaft entlassen. </p>
Ab 9. 4 1918 - Die zweite Frühjahrsoffensive beginnt nahe Lille
<p><em><strong>Armentières - Nordfrankreich</strong></em> * Nach dem Festlaufen der <em>„Operation Michael“</em> Anfang April führt man die ursprünglich <em>„Georg“</em> genannte Vierte Flandernschlacht in reduziertem Umfang durch. Generalquartiermeister Erich Ludendorff nennt die Vierte Schlacht um Ypern deshalb <em>„Georgette“</em>.</p> <p>Diese <em>Zweite Frühjahrsoffensiv</em>e beginnt rund 15 Kilometer von Lille entfernt nach dem Muster der <em>„Operation Michael“ </em>mit schlagartigem Artilleriefeuer. </p>
Um 10. 4 1918 - Die Spanische Grippe weitet sich in den USA aus
<p><em><strong>USA</strong></em> * Im Mittleren Westen und in den Städten der Ostküste der USA grassiert die sogenannte Spanische Grippe. </p>
11. 4 1918 - Der Tagesbefehl des britischen Oberkommandierenden
<p><em><strong>Armentières - Nordfrankreich</strong></em> * Der britische Oberkommandierende Douglas Haig gibt den Tagesbefehl: <em>„Jede Stellung muss bis zum letzten Mann gehalten werden. Es darf keinen Rückzug geben. Mit dem Rücken zur Wand und an die Gerechtigkeit unserer Sache glaubend, muss jeder von uns bis zum Ende kämpfen.“ </em></p>
Um 15. 4 1918 - Die Spanische Grippe erreicht die Westfront
<p><em><strong>Frankreich - Westfront</strong></em> * Ziemlich genau ein Jahr nach dem Kriegseintritt der USA erreicht die Spanische Grippe die Schürzengräben der Westfront. </p>
16. 4 1918 - Fritz Schröder wird in Düsseldorf verhaftet
Düsseldorf * Fritz Schröder wird wegen seiner Beteiligung an den Münchner Januarstreiks in Düsseldorf verhaftet.
16. 4 1918 - Theobald Michler wird verhaftet
München * Theobald Michler wird wegen seiner Beteiligung an den Münchner Januarstreiks verhaftet.
16. 4 1918 - Das Verhältniswahlsystem gefordert
München-Kreuzviertel * Die Sozialdemokraten bringen gemeinsam mit den Liberalen einen Antrag ein, nach dem die Abgeordnetenkammer in allgemeinen Wahlen nach dem Verhältniswahlsystem gewählt werden soll.
19. 4 1918 - Karl Mettler wird aus der Untersuchungshaft entlassen
<p><em><strong>München-Au</strong></em> * Der am 1. Februar 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Eisengießer Karl Mettler wird aus der Untersuchungshaft entlassen. </p>
19. 4 1918 - Zwangsaufenthalt für Josef Sontheimer
<p><em><strong>München - Traunstein</strong></em> * Das Stellvertretende Generalkommando untersagt Josef Sontheimer den Aufenthalt in München. Für ihn wird ein Zwangsaufenthalt in Traunstein unter militärischer Kontrolle angeordnet. </p>
23. 4 1918 - Erneut eine Reform zur Verhältniswahl abgelehnt
München-Kreuzviertel * Der Antrag der Sozialdemokraten und der Liberalen, die Kammer der Abgeordneten nach dem Verhältniswahlsystem wählen zu lassen, kommt für die bayerische Regierung zur Unzeit.
Heinrich Held, der Führer der Zentrumsfraktion, lehnt den Vorschlag ab, da das Verhältniswahlrecht zwei Nachteile habe:
- Es zerstört die Beziehungen zwischen den verschiedenen Ständen und ihren parlamentarischen Vertretern und
- das System wäre darauf ausgerichtet, dass die parlamentarische Kontrolle in den Händen professioneller Parteipolitiker zu liegen käme.
Die Zentrumspartei will die Verhältniswahl nur in einigen großen Städten Bayerns, und nur auf der Grundlage der Volkszählung von 1910 zulassen. Auf 42.000 Einwohner sollte ein Abgeordneter gewählt werden.
Die MSPD lehnt den Zentrums-Vorschlag als unzulänglich ab und will die Regelung auf das gesamte Staatsgebiet ausdehnen. Sie fordert eine durchgreifende Neueinteilung der Wahlkreise, um so das fehlende Gleichgewicht zwischen Stadt und Land herzustellen.
Die bayerische Regierung stellt sich auf die Seite des Zentrums, weshalb die Wahlrechtsreform erneut abgelehnt wird.
27. 4 1918 - Für Erich Mühsam wird ein Zwangsaufenthalt in Traunstein angeordnet
München - Traunstein * Da der bayerische Staatsangehörige Erich Mühsam nicht ausgewiesen werden kann, wird für ihn ein Zwangsaufenthalt in Traunstein angeordnet.
Er soll bei der Traunsteiner Handelsbank für 3 Mark täglich Arbeiten eines Lehrlings ausführen.
28. 4 1918 - Der Attentäter von Sarajevo stirbt in der Haft
Theresienstadt * Gavrilo Princip, der Attentäter von Sarajevo, stirbt in der Haft.
28. 4 1918 - Die ausschließliche Vergrößerung Preußens muss vermieden werden
München * In einem Brief an seinen Sohn Kronprinz Ruppert schreibt König Ludwig III., dass eine „ausschließliche Vergrößerung Preußens als Folge des Krieges vermieden werden“ muss. „Bayern hat auf einen möglichst großen Landzuwachs Anspruch und zwar in der Art, dass Bayern in diesen Landesteilen allein zu gebieten hat.“
29. 4 1918 - Ludendorff lässt die Operation Georgette abbrechen
Spa - Nordfrankreich * Generalquartiermeister Erich Ludendorff lässt auch die am 9. April 1918 begonnene „Operation Georgette“, die auch als Vierte Flandernschlacht bezeichnet wird, abbrechen.
Die Verluste betragen - einschließlich der Gefangenen - auf deutscher Seite 109.300 Mann, bei den Briten 76.300 und bei den Franzosen 35.000 Mann.
2. 5 1918 - Die Münchner USP als Sammelbecken der Revolutionäre
München * Das bayerische Innenministerium schreibt an die Kgl. Regierungen:
Die Münchner USPD bildet „das Sammelbecken für alle revolutionär gesinnten Kreise“.
16. 5 1918 - Die tägliche Brotration wird auf 150 Gramm gekürzt
Berlin - Deutsches Reich * Das Kriegsernährungsamt kürzt die tägliche Brotration auf 150 Gramm pro Person.
18. 5 1918 - Lorenz Winkler tritt in den Hungerstreik
München-Stadelheim * Lorenz Winkler, Aktivist beim Münchner Januarstreik, beginnt einen Hungerstreik. Er wird daraufhin psychiatrisch untersucht.
26. 5 1918 - 100 Jahre Bayerische Verfassung
München - Königreich Bayern * Der einhundertste Geburtstag der Bayerischen Verfassung werden unter Einbeziehung der Bevölkerung in „schlichter Einfachheit“ begangen. Diese ist nach der Konstitution vom 1. Mai 1808 die zweite Verfassung, die seinerzeit König Max I. Joseph einseitig aus seiner Machtvollkommenheit für Bayern erlassen hat. Die mehrfach geänderte Verfassung gilt im Kern bis zum Ende der Monarchie, also kein halbes Jahr mehr.
Ab 27. 5 1918 - Die Operation Blücher-Yorck beginnt
Soissons - Nordfrankreich * Gemäß seiner „Hammerschlag-Direktive“ lässt Generalquartiermeister Erich Ludendorff die deutschen Truppen im Raum Soissons als dritte Frühjahrsoffensive als „Operation Blücher-Yorck“ in Kriegshandlungen eintreten. Die Deutschen können schließlich die Marne erreichen, weshalb die Franzosen von der „Zweiten Marneschlacht“ sprechen.
Die Deutschen rücken bis auf 92 Kilometer an Paris heran und beschießen die französische Hauptstadt mit dem „Paris-Geschütz“. Das hat zwar keinen militärischen Nutzen, löst aber eine Panik in der Zivilbevölkerung aus. 256 Zivilisten sterben. Die deutschen Geländegewinne sind zwar bedeutungslos, dennoch glauben viele an der Heimatfront, dass der entscheidende Sieg jetzt unmittelbar bevor steht.
29. 5 1918 - Lorenz Winkler kommt in die Psychiatrie
München * Lorenz Winkler, Aktivist beim Münchner Januarstreik, wird bis 23. Juli 1918 in die Psychiatrie eingeliefert.
3. 6 1918 - London erkennt den Nationalrat der Tschechen und Slowaken an
London * Großbritannien erkennt den Nationalrat der Tschechen und Slowaken an.
6. 6 1918 - Ludendorff beendet die Operation Blücher-Yorck
Soissons - Nordfrankreich * Die Operation Blücher-Yorck wird durch den Generalquartiermeister Erich Ludendorff beendet.
6. 6 1918 - Die USPD bleibt im Parlament völlig isoliert
Berlin * Die USPD kann unter den herrschenden Ausnahmegesetzen fast nur noch den Reichstag oder die einzelnen Landtage als Tribüne nutzen, um ihre Kritik an der Obersten Heeresleitung - OHL in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie bleibt mit ihrer Einsicht in die verheerenden Folgen der deutschen Politik auch im Parlament völlig isoliert (sie stimmt als einzige Fraktion gegen den Friedensvertrag von Brest-Litowsk).
Der USPD-Vorsitzende Hugo Haase gibt sich jedenfalls diesbezüglich keinerlei Illusionen hin. In seiner Rede im Reichstag sagt er: „Wer etwa glaubte, daß durch Reden, und seien es die schärfsten Reden, die Regierung in eine andere Richtung gebracht werden könnte, irrt sich. Die Erfahrungen von fast vier Jahren müssten in dieser Beziehung aufklärend wirken. […] Das Volk muss eingreifen, der Reichstag hat versagt und wird weiter versagen.“
Nach dem 7. 6 1918 - Kurt Eisner wird von Neudeck nach Stadelheim verlegt
München-Au - München-Stadelheim * Ohne Mitteilung über eine Änderung in seinem Status als Untersuchungsgefangener wird Kurt Eisner - laut seinem Gefängnis-Tagebuch - zwischen dem 6. und 15. Juni 1918 vom Gerichtsgefängnis Neudeck in die staatliche Strafanstalt in Stadelheim verlegt.
Er wird in Stadelheim in der Zelle 70 untergebracht. In dieser Zelle sollte später auch der Eisner-Mörder Anton Graf von Arco auf Valley, ab 1923 der Putschist Adolf Hitler einsitzen. Der SA-Führer Ernst Röhm wird in der Nacht vom 30. Juni 1934 in der Zelle 70 erschossen.
Ab 8. 6 1918 - Die Operation Gneisenau beginnt in Nordfrankreich
Nordfrankreich * Als vierte Frühjahrsoffensive lässt Generalquartiermeister Erich Ludendorff die deutschen Truppen als „Operation Gneisenau“ gegen Frankreich kämpfen. Da sich die Franzosen inzwischen auf die deutsche Taktik eingestellt haben, werden die deutschen Geländegewinne immer geringer, die Verluste dagegen immer höher.
11. 6 1918 - Die Operation Gneisenau wird gestoppt
Nordfrankreich * Die Operation Gneisenau der deutschen Truppen wird von einem französischen Gegenangriff gestoppt.
14. 6 1918 - Nicht den Eindruck der Zusammenarbeit erwecken
München - Nürnberg * Der SPD-Abgeordnete Erhard Auer macht sein Eingreifen bei drohenden Streiks in Nürnberg davon abhängig, dass ihn dabei keine amtliche Stelle bei seinen Bemühungen unterstützt. Denn „es würde unter der Arbeiterschaft sofort die Meinung Platz greifen, dass es sich um eine zwischen ihm und der Regierung abgekartete Sache handle“.
15. 6 1918 - Beginn der letzten deutschen Offensive an der Marne
Marne * Beginn der letzten deutschen Offensive an der Marne und in der Champagne. Sie dauert bis 17. Juni und wird scheitern.
17. 6 1918 - Interner Widerstand gegen die MSPD-Reichstagspolitik
Bayreuth * Der Gautag der nordbayerischen MSPD zeigt, wie sehr die dortigen Organisationen den bisherigen Kurs des Parteivorstandes kritisch oder gar direkt ablehnend bewerten. Erhard Auer stößt mit seiner Taktik der nahezu bedingungslosen Unterstützung der Regierung ohne erkennbare Gegenleistung in seiner eigenen Partei auf zunehmenden Widerstand. In der verabschiedeten Resolution zur politischen Lage heißt es:
„Wir verlangen daher, dass die Reichstagsfraktion in Übereinstimmung mit dem Willen der Wählerschaft und mit den Forderungen unseres Programms zur Durchsetzung der berechtigten Forderungen des arbeitenden Volkes nunmehr von der bloßen Kritik dazu übergeht, von den schärfsten parlamentarischen Machtmitteln Gebrauch zu machen und durch ihre Abstimmungen die Mitverantwortung für die Politik der Reaktion und des Landraubes abzulehnen.“
18. 6 1918 - Soldaten lassen sich nicht mehr alles gefallen
München * Die Zentralpolizeistelle meldet einen militärischen Vorfall. Ein ungeordneter Haufen zieht von der Kaserne zum Hauptbahnhof. Als ein Major einen Soldaten zur Ordnung ruft, schreit dieser ihn an: „Was wollt Ihr Himmel-Herrgottsakramenter, ist‘s nicht genug, dass wir für Euch ins Feld gehen, schikanieren wollt ihr einen auch noch, anpacken tu ich dich, bei der Fotze nehm ich dich, du Blindgänger.“ Die übrigen Soldaten zollen ihm daraufhin Beifall.
20. 6 1918 - Carl Kröpelin wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Au * Der am 1. Februar 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Schlosser und Werkzeugdreher Carl Kröpelin wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
21. 6 1918 - Der Landtag beschließt Bau des Walchensee-Kraftwerkes
München-Kreuzviertel * Der Landtag beschließt die von Oskar von Miller angestrebte landesweite staatliche Stromversorgung und den Bau des Walchenseewerkes.
24. 6 1918 - Staatssekretär Kühlmann fordert einen Vergleichsfrieden
Berlin * Noch vor dem französischen Gegenangriff von Villers-Cotterêts betont der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Richard von Kühlmann, dass es an der Zeit sei, den Gegnern die Hand zu einem Vergleichsfrieden zu reichen.
„Bei der ungeheueren Größe dieses Koalitionskrieges und der Zahl der in ihm begriffenen auch überseeischen Mächte [wird] durch rein militärische Entscheidungen allein ohne alle diplomatischen Verhandlungen ein absolutes Ende kaum erwartet werden können.“
25. 6 1918 - Die OHL ist aufs peinlichste überrascht
Spa - Berlin * Die Oberste Heeresleitung - OHL gibt eine Pressekonferenz, auf der sie erklären lässt, dass sie sich mit den Ausführungen des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes Richard von Kühlmann vom Vortag nicht identifiziert und diese nicht „der Auffassung der OHL“ entspreche. Im Gegenteil: „Die OHL ist aufs peinlichste überrascht.“
25. 6 1918 - Hindenburg beschwert sich über Richard von Kühlmann
Spa - Berlin * In einem Telegramm der Obersten Heeresleitung - OHL an den Reichskanzler Georg Friedrich Graf von Hertling erklärt Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, dass „für die weiteren schweren Folgen, die aus dem gestrigen Vorgang für die siegreiche Beendigung des Krieges entstehen werden, der Staatssekretär von Kühlmann verantwortlich“ sei.
Das ist der erste Schritt für die spätere Dolchstoßlegende.
26. 6 1918 - Das machtpolitische Versagen der Reichstagsmehrheit
Berlin * Der Interfraktionelle Ausschuss trifft sich im Reichstag und beschließt, auf eine politische Initiative zur Unterstützung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes, Richard von Kühlmann, zu verzichten.
Der Interfraktionelle Ausschuss ist ein inoffizielles Gremium, das die Arbeit der Reichstagsfraktionen der Sozialdemokratischen Partei - SPD, der Fortschrittlichen Volkspartei - FVP und der Zentrumspartei koordiniert. Die drei Parteien bilden seit der Reichstagswahl von 1912 die Mehrheit im Reichstag.
Die Situation zeigt aber auch das machtpolitische Versagen der Reichstagsmehrheit.
26. 6 1918 - USPD-Mitgliederversammlung im Senefelder Hof
München * Bei der USPD-Mitgliederversammlung im Senefelder Hof in der Senefelderstraße 14 treten etwa 70 Mitglieder zusammen.
29. 6 1918 - Paris erkennt den Nationalrat der Tschechen und Slowaken an
Paris * Nach England [3. Juni 1918] erkennt nun auch Frankreich den Nationalrat der Tschechen und Slowaken als vorläufige Regierung an. Die Tschechen und Slowaken gehören zum Habsburger-Reich.
Um 30. 6 1918 - Der Mitgliederstand der USPD hat sich bei 400 eingependelt
München * Die Münchner USPD hat noch ungefähr 400 Mitglieder.
30. 6 1918 - Tschechen und Slowaken wollen einen gemeinsamen Staat gründen
Pittsburg * Die in den USA lebenden Exilgruppen der Tschechen und Slowaken verständigen sich im Vertrag von Pittsburg über den Aufbau eines zukünftigen gemeinsamen Staates.
1. 7 1918 - Nur noch 4,2 Millionen einsatzfähige Soldaten
Deutsches Reich * Das deutsche Heer besteht nur noch aus 4,2 Millionen einsatzfähigen Soldaten. Das ist seit März 1918 ein Rückgang von 900.000 Soldaten.
Um 2. 7 1918 - Ludendorff fordert den Rücktritt des Staatssekretärs Kühlmann
Spa - Berlin * Generalquartiermeister Erich Ludendorff fordert Reichskanzler Georg Friedrich Graf von Hertling auf, den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Richard von Kühlmann, zu entlassen, anderenfalls werde er selbst zurücktreten.
Unterstützung durch den schwachen Reichskanzler Hertling wird Kühlmann nicht erfahren.
6. 7 1918 - Eine hilf- und planlose MSPD
Berlin * Im Interfraktionellen Ausschuss erklärt Friedrich Ebert: „Wir haben nicht die Absicht, diese Regierung zu stürzen. Wir wollen ihr Gewissen schärfen, sie antreiben“. Diese Aussage offenbart die ganze Hilf- und Planlosigkeit seiner MSPD.
Philipp Scheidemann stellt in der selben Sitzung zur Lage an der Westfront fest: „Die Amerikaner kommen nicht mehr, sondern sie sind da“.
Er zieht daraus die einzig richtige Folgerung: „Je schneller wir Schluss machen, um so besser für uns“.
7. 7 1918 - König Ludwig III. hält an den Kriegszielen fest
München * König Ludwig III. hält unerschütterlich an seinen Kriegszielen fest und ist überzeugt, „dass nach Abschluss aller Kämpfe nicht nur Preußen allein einen Gebietszuwachs erhalten darf, sondern auch Bayern entsprechend bedacht werden muss“.
8. 7 1918 - Staatssekretär Kühlmann wird vom Kaiser entlassen
Berlin * Kaiser Wilhelm II. versetzt den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Richard von Kühlmann, in den einstweiligen Ruhestand.
- Damit hat die Politik gegenüber den Militärs erneut klein beigegeben.
- Ein Konflikt mit der Obersten Heeresleitung - OHL wird nicht eingegangen.
- Die Militärs brauchen die Reichstagsmehrheit nicht zu fürchten.
10. 7 1918 - Der Reichsgesundheitsrat unterschätzt die Spanische Grippe
Berlin * Der Reichsgesundheitsrat beschäftigt sich mit der Spanischen Grippe, der Influenza.
Er hält die durch das Reichsseuchengesetz von 1900 geschaffenen Bekämpfungsmöglichkeiten für ausreichend und ein koordiniertes Vorgehen in Abstimmung mit den Bundesstaaten für möglich. Die Krankheit wird als abklingend eingeschätzt und würde mit der warmen Sommerwitterung eh bald verschwinden.
11. 7 1918 - Entlassung der Januarstreik-Inhaftierten gefordert
München - Leipzig * Kurt Eisners Rechtsanwalt, Dr. Benedikt Bernheim, beantragt die Entlassung seines Mandanten sowie der am Januarstreik Beteiligten und Inhaftierten Albert Winter sen., Albert Winter jun. und Carl Kröpelin.
- Rechtsanwalt Albert Nussbaum fordert das Gleiche für Ernst Toller, Fritz Schröder, Hans Unterleitner, Franz Xaver Müller, Karl Mettler und Theobald Michler.
- Der Verteidiger von Emilie und Betty Landauer, Dr. Maximilian Bernstein, erhebt die gleichlautende Forderung für seine Mandantinnen.
12. 7 1918 - Graf Hertling verteidigt den Krieg
Berlin * Reichskanzler Georg Friedrich Graf von Hertling erklärt im Reichstag, Deutschland habe den Krieg nur geführt „als Verteidigungskrieg […], weil uns von Anfang an jede imperialistische, jede auf Weltherrschaft gerichtete Tendenz ferngelegen hat“.
13. 7 1918 - Die MSPD stimmt dem Etat zu
Berlin * Die MSPD-Fraktion stimmt im Reichstag erneut dem Etat zu, obwohl in allen innenpolitischen Fragen, vor allem bei der preußischen Wahlrechtsreform, jeglicher Fortschritt fehlt.
Zur Entscheidung der MSPD-Fraktion für die neuen Kredite erklärt Friedrich Ebert in seiner Rede, dass Deutschland niemals „auf entehrende, seine politische, wirtschaftliche und kulturelle Zukunft vernichtende oder herabdrückende Bedingungen“ eingehen wird, weshalb man „die Mittel bewilligen [muss], die zur weiteren Verteidigung der Lebensinteressen unseres Volkes und zur Erreichung des Friedens erforderlich sind“.
Das Parlament geht danach in die Sommerpause.
15. 7 1918 - Die Operation Marneschutz-Reims beginnt
Nordfrankreich - Reims * Die fünfte deutsche Frühjahrsoffensive beginnt als „Operation Marneschutz-Reims“. Sie dauert bis zum 6. August und ist eine der entscheidenden Schlachten des Ersten Weltkriegs.
Die Verluste auf beiden Seiten sind enorm. Auf deutscher Seite betragen sie im Verlauf der Schlacht 168.000 Mann, davon 29.000 Gefangene. Bei den Alliierten belaufen sie sich auf 95.000 Franzosen, 16.500 Briten, 12.000 Amerikaner und 10.700 Italiener.
16. 7 1918 - Frauen-Demo vor der Lebensmittelkartenverteilstelle
München-Obergiesing * Hunderte Frauen aus den östlichen und südlichen Stadtvierteln Münchens versammeln sich vor der Lebensmittelkartenverteilstelle in der Silberhornstraße in Giesing, um gegen die unzureichende Lebensmittelversorgung zu protestieren.
Sie ziehen weiter zum Lebensmittelamt in der Thalkirchner Straße und von dort zum Rathaus, wo sie „laute Rufe um Brot“ erheben. Der Ausschuss für Lebensmittelversorgung bewilligt daraufhin die „Abgabe von verbilligtem Gemüse und ein Pfund Frühkartoffeln für den Kopf und die Woche“.
17. 7 1918 - Zar Nikolaus II. und seine Familie werden von den Bolschewiki ermordet
Jekaterinburg * Zar Nikolaus II. und seine Familie werden mit Billigung der bolschewistischen Partei- und Staatsführung von den zur Bewachung abgestellten Soldaten in der Villa Ipatjew in Jekaterinburg ermordet.
18. 7 1918 - Gegenoffensive der englisch-französischen Truppen
Nordfrankreich - Villers-Cotterêts * Die Gegenoffensive englisch-französischer Truppen an der Marne beginnt. Die Franzosen setzen 400 leichte, schnelle und bewegliche Renault-Panzer mit einem drehbaren Turm ein. Inzwischen stehen auch 19 US-Divisionen in Frankreich.
Die Deutschen werden bei Villers-Cotterêts zum Rückzug hinter die Aisne gezwungen. Das ist die eigentliche Wende des Ersten Weltkriegs.
18. 7 1918 - Staatschef Swerdlow rechtfertigt die Bluttat an der Zarenfamilie
Moskau - Jekaterinburg * Staatschef Jakow Michailowitsch Swerdlow teilt dem Präsidium des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees - GZEK mit, dass sich am Tag zuvor konterrevolutionäre Truppen auf den Weg nach Jekaterinburg begeben hatten und zu befürchten war, dass sie die dort gefangen gehaltene Ex-Kaiserfamilie befreien wollten. Deshalb wurde der Befehl zur Erschießung der Zarenfamilie erteilt.
19. 7 1918 - Kurt Eisner beklagt sich bei Karl Kautsky
München-Stadelheim - Berlin * Kurt Eisner schreibt an den USPD-Mitbegründer Karl Kautsky und beschwert sich darin: „Jetzt sitze ich bald ein halbes Jahr. […] Die Voruntersuchung ist sachlich, aber noch nicht formell abgeschlossen“. Kurt Eisner beginnt merklich zu altern und leidet unter Anfällen von Depressionen.
22. 7 1918 - Die Münchener Post schlägt angeblich versöhnlichere Töne an
Nürnberg - München * Die Nürnberger Volkszeitung, eine Zeitung des konservativen Zentrums, stellt fest:
Die „Münchener Post […] ist in den alten Ton gefallen und führt häufig eine schärfere Sprache als früher. Man kann sich nicht des Eindruckes erwehren, dass sie es bewußt tut, um die ‚Unabhängigen‘ versöhnlicher zu stimmen und dem Vorwurf des ‚Regierungssozialismus‘ zu begegnen. Denn die ‚Unabhängigen‘ machen in Bayern den Mehrheitssozialisten viel zu schaffen“.
26. 7 1918 - Gesetz zur Errichtung des Reichsfinanzhofs in Kraft
Berlin - München-Bogenhausen * Das Gesetz zur Errichtung des Reichsfinanzhofs - RHF wird verabschiedet. Gleichzeitig fällt die Entscheidung, dass München der Standort für das höchste Gericht im Finanzwesen wird. Der Reichsfinanzhof wird später im Rohbau der Künstlerresidenz des Panoramenmalers Ernst Philipp Fleischer in der Ismaninger Straße in Bogenhausen untergebracht.
26. 7 1918 - Valentin-Karlstadt bei der 100. Lazarett- und Verwundeten-Vorstellung
München * Bei der 100. Lazarett- und Verwundeten-Vorstellung treten Karl Valentin und Liesl Karlstadt neben anderen Künstlern „Im Dienste des Roten Kreuzes“ im Vereinslazarett der Münchener Rück-Versicherungs-Gesellschaft auf.
26. 7 1918 - Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet das deutsche Branntweinmonopol
Berlin - Deutsches Reich * Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet das deutsche Branntweinmonopol. Es wird ein Jahr später in Kraft treten und verpflichtet den Staat, kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Brennereien den Alkohol zu einem fixierten Preis abzunehmen, ihn zu reinigen und zu vermarkten.
27. 7 1918 - Das Reichssteuerbiergesetz und das Reinheitsgebot
Berlin * Das Reichssteuerbiergesetz nimmt das Bayerische Reinheitsgebot auf. Dort heißt es:
- „Zur Bereitung von untergärigem Bier darf [...] nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser verwendet werden.“
Der Begriff Reinheitsgebot war erstmals während einer Debatte im Bayerischen Landtag am 4. März 1918 aufgetaucht. Es ist schon erstaunlich, mit welchen Problemen man sich nach vier Jahren Krieg beschäftigt.
27. 7 1918 - Keine Haftentlassung wegen Fluchtgefahr
Leipzig - München * Die Entlassungsanträge für die Mandantinnen und Mandanten der Rechtsanwälte
- Dr. Benedikt Bernheim [für Kurt Eisner, Albert Winter sen., Albert Winter jun. und Carl Kröpelin],
- Albert Nussbaum [für Ernst Toller, Fritz Schröder, Hans Unterleitner, Franz Xaver Müller, Karl Mettler und Theobald Michler] und
- Dr. Maximilian Bernstein [für Emilie und Betty Landauer]
werden von den Leipziger Richtern abgelehnt. Die Begründung lautet: „Fluchtgefahr“.
28. 7 1918 - König Ludwig III.: „Volle Zuversicht erfüllt mich beim Blick in die Zukunft“
München * König Ludwig III. verkündet in einem Aufruf: „Kein Deutscher denkt an einen schimpflichen Frieden. […] Volle Zuversicht erfüllt mich beim Blick in die Zukunft“.
28. 7 1918 - König Ludwig III. und die Weihe der Pasinger Maria-Schutz-Pfarrkirche
Pasing * König Ludwig III. nimmt mitten im Krieg als Schirmherr an der Weihe der Pasinger Pfarrkirche Maria Schutz teil. Geweiht wird der Pasinger Dom, eine neuromanische Basilika, durch den Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber.
Der Patrona Bavariae konnte die Kirche aber erst gewidmet werden, nachdem Papst Benedikt XV. am 26. April 1916 die besondere Beziehung zwischen dem Königreich Bayern und der Muttergottes auf König Ludwigs III. Bitten hin offiziell anerkannte und Maria zur „Patronin des Königreichs Bayern“ erhob. Bekanntlich half dies dem wenig beliebten Bayernkönig nur sehr wenig.
30. 7 1918 - SPD und Gewerkschaften wollen kein Regierungslob
München * Der SPD-Abgeordnete Erhard Auer bittet das Innenministerium, „von der Verleihung von Anerkennungsurkunden für Kriegsarbeit an die sozialdemokratische Presse und Gewerkschaften abzusehen“.
31. 7 1918 - Deutsche Soldaten an der Spanischen Grippe erkrankt
Deutsches Reich * Im Juli 1918 ist eine halbe Million deutscher Soldaten an der Spanischen Grippe erkrankt.
1. 8 1918 - Straubinger Frauen wollen keinen Königsbesuch
Straubing - Regensburg - München * Ein Regensburger Bürger hatte Ende Juli im Zug ein Gespräch von etwa 25 Straubinger Frauen über das 700-jährige Stadtjubiläum von Straubing mit angehört und berichtet am 1. August darüber an das Garnisonskommando Regensburg:
„Jetzt kommt der König zu uns - den brauch ma a no - der soll mit seine Trudln daheim bleiben - Unser Bürgermeister, der Depp is extra nach München g‘fahren und hat‘n eing‘laden - da schreins immer von den Schulden - de Dekration wird wieder a Geld kosten - a Festfressen wollns a gebn -
Der soll nur kema - mir habens scho ausgmacht - mit de fauln Kartoffeln wird er empfanga. De moana, wenns a Militär hinstelln, dös hilft eana was - die Soldaten helfa alle zu uns - de ham von dem Schwindel a gnua!“.
2. 8 1918 - Generalquartiermeister Ludendorffs streng geheime Anordnung
Spa - Nordfrankreich * In einer streng geheimen Anordnung an alle Stabschefs der deutschen Armeen in Frankreich schreibt Generalquartiermeister Erich Ludendorff, dass man sich künftig mit kleinen Angriffen „an schmalen Fronten“ begnügen wird. „Alle Angriffe sind nur als Abwehrmaßnahmen vorzubereiten. Von Angriffen ist nicht zu sprechen“.
2. 8 1918 - Durchhalteparolen von Kriegsminister Philipp von Hellingrath
München-Kreuzviertel * In einer Rede vor der Kammer der Reichsräte erklärt Kriegsminister Philipp von Hellingrath: „Die schweren Kämpfe zwischen Aisne und Marne beweisen, daß der Kampf- und Siegeswille der Entente noch nicht gebrochen ist, dass wir ihm die Überlegenheit des härteren und stärkeren Willens entgegensetzen müssen, wenn wir die Friedensbereitschaft unserer Feinde erzwingen wollen.
Diesen einheitlichen unbeirrbaren Willen im ganzen deutschen Volk zu wecken und zu festigen, das ist die vornehmste Aufgabe, vor die das fünfte Kriegsjahr die Heimat stellt“.
2. 8 1918 - König Ludwig III. will dem Reich die Treue beweisen
München-Maxvorstadt * Ludwig III. erklärt auf dem Balkon des Wittelsbacher-Palais: „Niemand soll je sagen dürfen, Bayerns König habe auch nur einen Augenblick gezaudert, die Treue zum Reich durch die Tat zu beweisen“.
4. 8 1918 - König Ludwig III. rudert zurück
München * Obwohl König Ludwig III. noch wenige Tage zuvor (28. Juli) „Voller Zuversicht“ in die Zukunft geschaut hatte, gesteht er am 4. August seinem Sohn Kronprinz Ruppert, dass er bisher zu optimistisch gewesen sei.
Deshalb „werden wir unsere militärischen und politischen Ziele erheblich begrenzen müssen, wenn wir, was auch nach meiner Ansicht dringend anzustreben ist, in nicht zu ferner Zeit zu einem annehmbaren Frieden kommen wollen“.
7. 8 1918 - Eine Frauendelegation im Innenministerium
München * Eine Frauendelegation erscheint im Innenministerium. Am Nachmittag demonstrieren sie vor dem Rathaus. Daraufhin beschließt das Innenministerium, die angekündigte Reduzierung der Fleischration für München außer Kraft zu setzen.
8. 8 1918 - Liesl Karlstadt tritt erstmals als Kapellmeister auf
München * Liesl Karlstadt spielt erstmals den Kapellmeister in dem Valentin-Karlstadt-Bühnenstück „Theater in der Vorstadt“.
8. 8 1918 - Die deutsche Westfront bricht zusammen
Amiens - Berlin * Spätestens als mit der Panzerschlacht bei Amiens die Schlussoffensive der Alliierten beginnt, ist der Krieg für Deutschland verloren. Über 70 Prozent der deutschen Verluste besteht aus Gefangenen.
Die Westfront bricht zusammen. Die Verluste nähern sich wieder den Höchstwerten der ersten Kriegsmonate von 1914.
8. 8 1918 - Ludendorff verschweigt die deutsche Niederlage
Spa * Obwohl Generalquartiermeister Erich Ludendorff aufgrund der Panzerschlacht bei Amiens die Überzeugung gewonnen hat, dass der Krieg verloren ist, lässt er sich bis Ende September 1918 Zeit, das auch laut zu formulieren.
Doch bis dahin wird sich die militärische Lage dramatisch zum Nachteil Deutschlands verändern.
11. 8 1918 - Die Tschechen dürfen an den Verhandlungen der Alliierten teilnehmen
Washington * Die USA erlauben die Teilnahme der Tschechen als kriegsteilnehmende Macht an den Verhandlungen der Alliierten.
12. 8 1918 - Über 400 Frauen demonstrieren gegen den Hunger
München-Graggenau * Über 400 Frauen demonstrieren auf dem Marienplatz gegen die „ungünstigen Ernährungsverhältnisse“.
12. 8 1918 - Den Krieg durch Aushungern beenden
München * Eine Münchner Hausfrau berichtet über ihre Fahrten aufs Land. Sie schildert die meisten Bauern als „unverständig, hartherzig und wenig vaterländisch gesinnt“.
Nach ihren Beobachtungen sind die Bauern der Meinung, dass sie die „Stadterer“ und „Großkopferten“ zur Beendigung des Krieges zwingen könnten, indem sie diese aushungern.
14. 8 1918 - Die OHL erklärt die Fortführung des Krieges für aussichtslos
Spa * Die Oberste Heeresleitung - OHL erklärt nach der Schlacht von Amiens - im Beisein von Kaiser Wilhelm II. und dem österreichischen Kaiser Karl I. - erstmals die Fortführung des Krieges für „aussichtslos“.
- Die Übermacht der alliierten Truppen,
- erhebliche Versorgungsprobleme und
- große Verluste
sind die Ursachen für den Untergang der deutschen Truppen. Der 14. August 1918 wird deshalb auch als „Schwarzer Tag des deutschen Heeres“ bezeichnet.
14. 8 1918 - Wieder Demonstrationen wegen der Lebensmittelversorgung
München * Arbeiterinnen, Hausfrauen und Soldaten demonstrieren. Wieder stehen Kriegsinvaliden in den ersten Reihen. Auch das erschwert der Polizei einen massiveren Einsatz. Auf Kriegsinvaliden und Frauen mit Kindern im Arm kann man nicht so ohne Weiteres einprügeln.
14. 8 1918 - Januarstreiks wollten Westoffensive verhindern
München * Die Zentralpolizeistelle für Bayern stellt in einem Bericht fest, dass die Januarstreiks nur darauf angelegt waren, „die Offensive im Westen zu verhindern“.
Um 15. 8 1918 - Ludwig III. befürwortet einen möglichst schnellen Friedensschluss
München * Bayernkönig Ludwig III. bevollmächtigt Ministerpräsident Otto von Dandl zu Verhandlungen mit den deutschen Bundesfürsten über ein gemeinsames Vorgehen bei der Reichsregierung. Ludwig III. befürwortet nach der verheerenden Niederlage der deutschen Militärs bei Amiens einen möglichst schnellen Friedensschluss.
15. 8 1918 - Ludendorff täuscht Staatssekretär Paul von Hintze
Spa - Berlin * Besseres Wissen zum Trotz erklärt Generalquartiermeister Erich Ludendorff dem neuen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Paul von Hintze: „Wir sind durch eine strategische Defensive in der Lage, den Kriegswillen des Feindes zu lähmen, und ihn so mählich zum Frieden zu zwingen“. Das war natürlich eine grobe Täuschung, da Ludendorff längst wusste, dass auf die deutschen Soldaten kein Verlass mehr ist.
15. 8 1918 - Erneute Haftentlassung für Eisner & Co gefordert
München - Leipzig * Dr. Benedikt Bernheim beantragt beim Reichsgericht in Leipzig erneut die Entlassung von Kurt Eisner, Albert Winter sen., Albert Winter jun. und Carl Kröpelin.
15. 8 1918 - Die bayerische Regierung spricht von der Beendigung des Krieges
München * Kronprinz Rupprecht berichtet in seinem Tagebuch von einer Besprechung mit Ministerpräsident Otto von Dandl und dem Kriegsminister Philipp von Hellingrath, in der diese die Überzeugung äußern, „dass es höchste Zeit ist, den Krieg zu beenden, um noch einen einigermaßen leidlichen Frieden zu erlangen“. Kronprinz Rupprecht unterstützte diese Auffassung.
17. 8 1918 - Einweihung der Germanenloge im Hotel Vier Jahreszeiten
München-Graggenau * Am 17./18. August 1918 findet die Einweihung der Germanenloge im noblen Hotel Vier Jahreszeiten an der Maximilianstraße statt. Auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft war die Thule-Gesellschaft auf die gerade freigewordenen Sitzungszimmer des ehemaligen Marine-Offiziers-Club aufmerksam geworden. Die anvisierten Räumlichkeiten bieten Platz für 300 Personen und haben eine für die Zwecke des Geheimordens gediegene Ausstrahlung.
Nachdem die Bewerbung von der Hotelleitung akzeptiert wurde, konnten die gepflegten und herrschaftlich wirkenden Sitzungssäle mit den dazugehörenden Büros mit Hakenkreuzfahnen sowie Kranz und Schwertern dekoriert werden.
Das Hakenkreuz, das auch den Briefkopf des Ordens ziert, symbolisiert den „Siegeszug des Ariers“ und steht für das Motto der Loge: „Denke daran, daß du ein Deutscher bist! Halte dein Blut rein!“. Mitglieder und Gäste begrüßen sich mit „Heil und Sieg“, aus dem wenig später das berüchtigte „Sieg Heil !“ wird.
18. 8 1918 - Demonstrierende Verwundete, Kriegsinvaliden und Kriegsurlauber
München * In einem Schreiben des Innenministers Dr. Friedrich Ritter von Brettreich an den Kriegsminister Philipp von Hellingrath hebt dieser hervor: „Es ist wohl ohne weiteres klar, dass schon die bloße Anwesenheit Verwundeter das Einschreiten der Polizei [bei Aufläufen] erschwert und unter Umständen hindert. Ich brauche nur an den Fall zu denken, welche Folgen es haben könnte, wenn etwa ein Verwundeter überritten oder eine Beschädigung erleiden würde“.
Der Kriegsminister hat jedoch keine Überwachungsmöglichkeiten. Verwundete, Kriegsinvaliden und Kriegsurlauber nehmen meist in Uniform an den zahlreichen Demonstrationen teil. Sie sind nicht kaserniert und so dem disziplinären Zugriff der Militärbehörden entzogen.
20. 8 1918 - Rückzug des deutschen Heeres
<p><strong><em>Westfront</em></strong> * Das deutsche Heer wird zum langsamen Rückzug gezwungen. </p>
21. 8 1918 - Die Ängste der Gewerkschaftsführer
München - Nürnberg - Fürth * Innenminister Dr. Friedrich Ritter von Brettreich berichtet seinen Ministerkollegen in einem Geheimschreiben über ein Gespräch mit sozialdemokratischen Arbeiterführern aus Nürnberg-Fürth. Diese sagten ihm, dass sie die Zuversicht nicht mehr teilen, „dass wir den Krieg wirtschaftlich durchhalten könnten“. Die Entbehrungen der Bevölkerung haben einen Grad erreicht, dass mit dem baldigen Zusammenbruch gerechnet werden muss.
Das Vertrauen der Arbeiterschaft gegenüber den Gewerkschaften geht verloren, wenn sie weiter zu einer Regierung halten, „die ihre Versprechungen auf Besserung der Lage nicht einlösen vermocht und statt dessen immer nur neue Opfer und Entbehrungen verlangt und dadurch das Vertrauen des Volkes verloren habe. Sie würden für diese Enttäuschung mitverantwortlich gemacht, weil sie durch ihre Mitarbeit keine Besserung erreicht hätten, und sie stünden daher vor der Gefahr, ihren Einfluss auf die Arbeiterschaft zu verlieren“.
22. 8 1918 - Schlechte Stimmung im Mittelstand
München - Königreich Bayern * Innenminister Dr. Friedrich Ritter von Brettreich stellt fest: „Der Mittelstand zeigt zurzeit eine schlechtere Stimmung wie alle übrigen Kreise“.
25. 8 1918 - Der Rückhalt im Volk für König Ludwig III. schwindet immer mehr
München * Kronprinz Rupprecht befindet sich zur Feier des königlichen Namenstages in München. Er schreibt in sein Tagebuch:
„Die Verstimmung gegen meinen Vater macht sich durch die gegen sonst geringe Beflaggung der Häuser erkenntlich sowie die geringe Beteiligung an der abendlichen Serenade, bei der gewissermaßen demonstrativ nach dem Hoch auf meinen Vater auch ein Hoch auf mich ausgebracht wurde, was mir um so peinlicher war, als im Volke allgemein davon gesprochen wird, dass mein Vater nach dem Kriege zu meinen Gunsten abdanken müsse.“
26. 8 1918 - Die Entlassungsanträge für Eisner & Co werden abgewiesen
Leipzig - München * Die Entlassungsanträge für Kurt Eisner, Albert Winter sen., Albert Winter jun. und Carl Kröpelin werden von dem in Leipzig sitzenden Reichsgericht, dem obersten Gerichtshof im Deutschen Reich, erneut abgewiesen.
27. 8 1918 - Das 700-jährige Stadtjubiläum wird abgesagt
Straubing - München * Die Feierlichkeiten anlässlich des 700-jährigen Stadtjubiläums von Straubing werden nach den königskritischen Äußerungen einiger Straubinger Bürger [siehe 1. August 1918] „angesichts der Zeitläufe aufgegeben“.
27. 8 1918 - Max von Baden und seine programmatischen Vorstellungen
Karlsruhe - Lille * In einem privaten Brief an Kronprinz Rupprecht von Bayern legt Prinz Max von Baden sein politisches Motiv für eine eventuelle Kanzlerkandidatur offen. Er will die Demokratisierung des Reiches verhindern und fürchtet am meisten den Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger, der - unterstützt durch die Reichstagsmehrheit - dem Kanzler „neue Majoritätsfesseln“ anlegen möchte. Um dies zu verhindern will der Prinz die politische Mehrheit im Reichstag „wieder in ihre wohlverdiente Ohnmacht zurück treiben“.
27. 8 1918 - Die Seekriegsleitung - SKL wird gegründet
Berlin * Auf Vorschlag des vormaligen Flottenchefs und neuen Admiralstabschefs, Admiral Reinhard Scheer, wird die Seekriegsleitung - SKL als Kommandoabteilung des Admiralstabs gegründet. Die Seekriegsleitung ist die Marine-Kommandobehörde, die die Planung und Durchführung des Seekriegs leitet und die Verteilung der Seestreitkräfte lenkt.
28. 8 1918 - Die deutschen Truppen werden zurückgezogen
Nordfrankreich - Saint Quentin * Die deutschen Truppen werden in die Siegfriedstellung, von den Alliierten auch Hindenburglinie genannt, zurückverlegt.
28. 8 1918 - Österreichs Kaiser Karl sieht den Krieg verloren
München * Der österreichisch-ungarische Kaiser Karl besucht König Ludwig III. und schildert diesem „die verzweifelte Lage unserer Mächtegruppe“, was der König mit den Worten „Also haben wir den Krieg verloren“ bestätigt. Der habsburgische Kaiser bittet den König „inständig, in seiner Eigenschaft als ältester und mächtigster deutscher Bundesfürst, Kaiser Wilhelm die Lage klipp und klar zu schildern und kategorisch auf einen möglichst baldigen Friedensschluss zu drängen“. Bayerns König Ludwig III. erklärt sich damit einverstanden.
Um den 29. 8 1918 - Georg von Vollmar legt seine Mandate nieder
München - Berlin * Der SPD-Abgeordnete Georg von Vollmar legt aus gesundheitlichen Gründen sein Reichstags- und sein Landtags-Mandat für die Wahlkreise München II und XII nieder. Die Kriegsverletzung hat er sich im Deutsch-französischen Krieg von 1870/71 zugezogen.
30. 8 1918 - Prinz Max von Baden will das Vaterland retten
Karlsruhe - Berlin * Prinz Max von Baden bringt in einem Brief an Kaiser Wilhelm II. zum Ausdruck, dass er „in eine die Reichsleitung bestimmende Stellung“ gebracht werden möchte, um aus dieser Position heraus „das Vaterland zu retten“.
31. 8 1918 - Präsident Wilson bezeichnet Deutschland als verbrecherische Macht
Washington * Der US-Präsident Woodrow Wilson bezeichnet das Deutsche Reich als „verbrecherische Macht“, weil es ein Anschlag auf das Recht freier Männer zur Gestaltung des eigenen Schicksals ist. „Es ist ein Krieg, die Nationen und Völker der Welt gegen jede solche Macht, wie die heutige deutsche Autokratie sie darstellt, zu sichern, es ist ein Bekenntniskrieg, und ehe er gewonnen ist, können die Menschen nirgends frei von Furcht leben.“
1. 9 1918 - In Bayern herrscht Unzufriedenheit mit der Regierung und dem König
München - Berlin * Karl Georg von Treutler, der preußische Gesandte in Bayern, der als Vertrauter Kaiser Wilhelms II. auch „Die graue Exzellenz“ genannt wird, berichtet an den aus Bayern stammenden Reichskanzler Georg Graf von Hertling.
In seinem Schreiben bringt er zum Ausdruck, dass hier eine „ganz ausgesprochene Unzufriedenheit nicht nur mit der Bayerischen Regierung, sondern besonders auch mit der Person Seiner Majestät des Königs“ herrscht. Man macht dem König zwar nicht zum Vorwurf, dass er den Krieg und damit die Katastrophe herbei geführt hat. Dennoch wirft man ihm Machtlosigkeit vor, um das Unheil abzuwenden.
Es ist deshalb höchste Zeit, die Form des bayerischen Regierungssystems den Realitäten anzupassen und einem parlamentarischen System volle Entscheidungsgewalt zu gewähren.
2. 9 1918 - Reichskanzler Georg Graf von Hertling soll abgelöst werden
Berlin * Die deutschen Bundesfürsten drängen auf der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundesrat für die Ablösung des aus Bayern stammenden Reichskanzlers Georg Graf von Hertling. Auch der bayerische Kronprinz Rupprecht hält Hertling für zu alt und „so gut wie willenlos“. Außerdem fordern sie sofortige Waffenstillstands-Verhandlungen.
2. 9 1918 - König Ludwig III. fordert eine Revolution von oben
München * König Ludwig III. fordert gesetzliche Maßnahmen
- zur Sicherung der Monarchie und
- zur Stabilisierung des Systems.
Ein neues Kabinett soll gebildet werden, dem sowohl das Zentrum wie die Sozialdemokratie angehören soll.
Da diese Revolution von oben hauptsächlich dem Machterhalt des bestehenden Systems dient, wird sie nur vom konservativen Teil der Bevölkerung unterstützt.
Es wird aber noch bis zum 16. Oktober dauern, bis in Bayern die Frage der Verfassungsreform grundsätzlich erörtert wird.
2. 9 1918 - Der „Sedantag“ wird zum letzten Mal gefeiert
Deutsches Reich * Der „Sedantag“ wird zum letzten Mal gefeiert, da er am 27. August 1919 abgeschafft wird. Der nationalistisch aufgeladene Gedenkrag war nie oder nur kaum ein Festtag der Arbeiterschaft.
3. 9 1918 - Die USA erkennen den Nationalrat der Tschechen und Slowaken an
Washington * Nach Großbritannien [3. Juni 1918] und Frankreich [29. Juni 1918] erkennen nun auch die USA den Nationalrat der Tschechen und Slowaken als rechtmäßige Vertreter ihrer Nation an.
9. 9 1918 - Kartoffeln statt Fleich
München * Die fleischlosen Wochen beginnen. Als Ersatz für das ausfallende Fleisch werden 3 Pfund Kartoffeln pro Kopf der versorgungsberechtigten Bevölkerung gewährt.
10. 9 1918 - Das Ordinariat erlässt einen Aufruf zum Kauf der 9. Kriegsanleihe
München * Das Ordinariat des Erzbistums München und Freising erlässt im Amtsblatt einen Aufruf in dem es den Seelsorgeklerus zur kräftigen Werbetätigkeit für die 9. Kriegsanleihe auffordert. Sie selbst sollen aus Pfründen- und Stiftungsmitteln zeichnen.
10. 9 1918 - Kaiser Wilhelm II. spricht in einer Krupp-Werkshalle
Essen * Kaiser Wilhelm II. hält in einer Werkshalle der Firma Krupp in Essen vor einem handverlesenem Publikum ein Propaganda-Rede in der er die weitere bedingungslose Gefolgschaft fordert: „Werdet stark wie Stahl. […] Wir wollen kämpfen und durchhalten bis zum Letzten.“
12. 9 1918 - 75 Prozent der deutschen Verluste sind Gefangene
Nordfrankreich - bei Verdun * Amerikanische und französische Verbände beginnen einen Vorstoß. Als sie den Frontvorsprung von Saint-Mihiel bei Verdun erobern, bestehen 75 Prozent der deutschen Verluste aus Gefangenen.
12. 9 1918 - Der Interfraktionelle Ausschuss will eine Regierungsneubildung
Berlin * Der Interfraktionelle Ausschuss, das gemeinsame Gremium von MSPD, Zentrum und Linksliberalen, loten erstmals seit den Januarstreiks aus, welche Gemeinsamkeiten ihnen geblieben sind. In der Sitzung suchen die Mehrheitsparteien gemeinsam nach einem Ausweg, zu dem auf jeden Fall eine Regierungsneubildung gehören muss.
Man ist sich einig über die Unglaubwürdigkeit unserer Regierung im Ausland. Mit dem Kaiser, der Obersten Heeresleitung und der Regierung Hertling wird es keinen Verständigungsfrieden geben können. Es wird deutlich, was die Spitze der Mehrheitssozialdemokratie will: keine Revolution, keinen Bürgerkrieg, dafür eine rasche Demokratisierung einschließlich einer gleichberechtigten Arbeiterschaft.
13. 9 1918 - Deutschland und seine Verbündeten brechen zusammen
Westfront * Die Alliierten gehen an der Westfront zur Offensive über. Auch wenn es die offiziellen Heeresberichte noch nicht in aller Deutlichkeit ausdrücken, so brechen Deutschlands Heere und die Armeen seiner Verbündeten an allen Fronten zusammen.
14. 9 1918 - Zum 2. Mal werden Glocken zum Einschmelzen abgenommen
München * Zum zweiten Mal werden aus Münchner Kirchtürmen Glocken zum Einschmelzen abgenommen.
14. 9 1918 - Kurt Eisner wird zum USPD-Kandidaten zur Reichstagswahl nominiert
München * Auf einer Geheimversammlung der Münchner USPD wird der inhaftierte Kurt Eisner zum Kandidaten zur Reichstagsersatzwahl am 17. November nominiert.
Der ebenfalls in Haft befindliche Albert Winter senior wird als Kandidat zur Landtagsersatzwahl aufgestellt.
14. 9 1918 - Käthe Bierbaumer wird Eigentümer des Verlags Franz Eher Nachfolger
München * Käthe Bierbaumer, die Freundin von Rudolf von Sebottendorf [= Thule-Gesellschaft], wird als Eigentümerin des Verlags Franz Eher Nachfolger ins Handelsregister eingetragen.
14. 9 1918 - Kaiser Karl möchte einen Frieden unter Erhaltung der Monarchie
Wien * Der österreichisch-ungarische Kaiser Karl bietet den Entente-Mächten nach vier Kriegsjahren und über einer Million Toten Friedensverhandlungen unter Erhaltung der Monarchie an.
„Die österreichisch-ungarische Regierung hat beschlossen, allen Kriegführenden, Freund und Feind, einen von ihr für gangbar gehaltenen Weg zu weisen und ihnen vorzuschlagen, im freien Gedankenaustausch gemeinsam zu untersuchen, ob jene Voraussetzungen gegeben sind, welche die baldige Einleitung von Friedensverhandlungen als aussichtsvoll erscheinen lassen. Zu diesem Behufe hat die k. und k. Regierung die Regierungen aller kriegführenden Staaten zu einer vertraulichen und unverbindlichen Aussprache an einem Orte des neutralen Auslandes eingeladen und an sie eine in diesem Sinne verfaßte Note gerichtet.“
Ab dem 15. 9 1918 - Die Alliierten durchbrechen die Mazedonienfront
Saloniki * In den Bergen in der Grenzregion Griechenlands und Mazedoniens beginnt am Morgen die lange vorbereitete Entscheidungsoffensive der alliierten Orientarmee. Der Widerstand der bulgarischen Armee bricht nach einem Durchbruch der Alliierten an der Salonikifront komplett zusammen.
15. 9 1918 - Der amerikanisch-französische Vorstoß ist beendet
Nordfrankreich - Saint-Mihiel bei Verdun * Der amerikanisch-französische Vorstoß gegen die deutschen Truppen ist beendet. Die Angreifer haben die deutsche Front auf mehr als 20 Kilometer „eingedrückt“.
15. 9 1918 - Prinz Max von Baden für eine autonome Staatspolitik
Karlsruhe - Lille * Prinz Max von Baden informiert Kronprinz Rupprecht, dass er für eine autonome Staatspolitik eintritt, deren Initiative mehr denn je dem freien Entschluss des Fürsten zufällt. Denn: „Wir stehen unmittelbar vor dem parlamentarischen Staatsstreich“.
Um den 16. 9 1918 - Der Alldeutsche Verband hetzt gegen Kurt Eisner
München * In einem Flugblatt des Alldeutschen Verbandes anlässlich der Nominierung Kurt Eisners für den bevorstehenden Reichstagswahlkampf heißt es:
„Ein russischer Jude als Reichstagskandidat. […] Eisner wird ja nicht gewählt werden, aber dass eine Partei es überhaupt wagen darf, einen russischen Juden, der wegen Landesverrat verurteilt wurde [was nicht stimmt], aufzustellen, müsste dem Arbeiter die Schamröte ins Gesicht jagen!“
17. 9 1918 - Ablehnung des österreichisch-ungarischen Vorschlages
Washington - Wien * US-Präsident Woodrow Wilson lehnt eine halbe Stunde nach Erhalt der Note den österreichisch-ungarischen Vorschlag vom 14. September für eine inoffizielle Konferenz ab.
In der Begründung heißt es: „Wir haben wiederholt und in vollkommener Klarheit die Bedingungen bekanntgegeben, unter denen die Vereinigten Staaten wegen eines Friedens verhandeln wollen, und wir können und wollen keinen Vorschlag in Erwägung ziehen für eine Konferenz über eine Angelegenheit, in der die Vereinigten Staaten ihre Stellung und Absichten bereits klar bekanntgegeben haben.“
19. 9 1918 - Die Gründe, warum Kurt Eisner als Kandidat aufgestellt wurde
München * Die Zentralpolizeistelle Bayern berichtet dem Kriegsministerium:
„Die Gründe, warum Eisner als Kandidat aufgestellt werden soll, sind folgende:
1.) Man will erreichen, dass Eisner für die Zeit des Wahlkampfes, nachdem er noch nicht verurteilt ist, freigesprochen werde. Die Wahlversammlungen könnten nach Ansicht der Vereinsmitglieder [der USPD] vom Generalkommando nicht verboten werden.
Man werde Veranlassung nehmen, den Massen die Ziele der Unabhängigen klarzulegen; zu dem Zweck kämen als Redner von Berlin Leute, gegen welche die Polizei sich nicht vorzugehen traue, wie Haase, [Adolph] Hoffmann, Ledebour, von Nürnberg der Gauvorsitzende Baier.
2.) Man will gegen die Mehrheitssozialisten opponieren. Diesbezüglich sei eine Weisung aus Berlin da.“
19. 9 1918 - Palästina wird von den Briten befreit
Megiddo * Mit dem Durchbruch der gegnerischen Front in der entscheidenden Schlacht bei Megiddo kann der britische Sieg in Palästina herbeigeführt werden.
20. 9 1918 - Skeptisch beim Kauf von Kriegsanleihen
Königreich Bayern * Von der Landbevölkerung wird „allenthalben die Sicherheit der Kriegsanleihen wie allen Geldes überhaupt stark in Zweifel gezogen“. Deshalb rät man sich gegenseitig von der Zeichnung ab. Schon länger glaubt man, „im Misslingen der Kriegsanleihe das beste Mittel zur baldigen Beendigung des Krieges zu sehen“.
21. 9 1918 - Das Oktoberfest fällt zum zehnten Mal aus
München-Theresienwiese • Eigentlich müsste das Oktoberfest beginnen. Es fällt dieses Jahr aber erneut kriegsbedingt - zum fünften Mal hintereinander und zum insgesamt zehnten Mal - aus.
22. 9 1918 - Flugblätter zur Steigerung des Preußenhasses
München • Innenminister Dr. Friedrich Ritter von Brettreich berichtet über Flugblätter, die die Überschrift „Preußenherzen hoch“ tragen. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um „überaus gefährliche Fälschungen“ handelt, die äußerst geschickt den in Bayern neu auflebenden Preußenhass in neue Höhen steigern und so die Geschlossenheit des deutschen Volkes sprengen soll. Hier einige Auszüge aus dem Flugblatt, das nur in Altbayern mit der Post verbreitet wird. Der Poststempel stammt aus Berlin:
„In tiefernster Stunde wenden wir uns an alle echten Preußen mit dem dringenden Mahnruf: Helft Preußen, helft Deutschland retten! […] Vielmehr von innen als von außen droht unserem vielgeliebten Preußenlande toternste Gefahr. […] Ein Süddeutscher Reichskanzler, ein Süddeutscher Vizekanzler, ein Süddeutscher Reichstagspräsident […], alle wichtigen Ämter in der Hand von Bayern! Ist es da ein Wunder, wenn die Politik auf eine völlige Lahmlegung Preußens, der Kaiserkrone und der Heeresleitung gerichtet ist, und […] Preußen und Deutschland an den Abgrund geführt hat ?
[…] Aus bayerisch-partikularistischem Hasse will man Preußens Macht zerstören um selbst in Preußen zu herrschen. […] Auch die Heeresfront ist durch Bayern zerrissen worden. Die Disziplinlosigkeit im bayerischen Heere hat seit einem Jahr den größten Umfang angenommen. […] Durch diese Handlungen haben preußische und andere Regimenter die größten Verluste erlitten. […] Jetzt, wo das Vaterland wieder in der größten Gefahr schwebt, sind es wieder die Bayern, die versagen und die Gefahr vergrößern. […].“
23. 9 1918 - Zeichnungsbeginn für die 9. Kriegsanleihe
Berlin • Die Zeichnungsfrist für die 9. Kriegsanleihe beginnt offiziell. Es wird die Letzte in diesem Krieg sein.
23. 9 1918 - MSPD für eine Koalitionsregierung mit den Bürgerlichen
Berlin • Die MSPD-Reichstagsfraktion und der Parteiausschuss der MSPD beschließen in einer gemeinsamen Sitzung mit einer deutlichen Mehrheit von 80 : 21 Stimmen, sich an einer Koalitionsregierung mit den bürgerlichen Parteien zu beteiligen, falls sich die Möglichkeit dazu bietet. Die Bedenkenträger bleiben in der Minderheit. Dies auch deshalb, weil noch immer keine Klarheit über die militärische Lage herrscht.
Der Regierungseintritt wird an die Erfüllung eines Forderungskatalogs geknüpft, der die Parlamentarisierung verlangt und auf die Friedensresolution vom 19. Juli 1917 Bezug nimmt, in der sie für „einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der Völker“ eintritt.
Die Partei entsendet Philipp Scheidemann als Staatssekretär ohne Portefeuille, Gustav Bauer soll das Reichsarbeitsamt übernehmen. Otto Wels warnt Friedrich Ebert: „Bist du von Gott verlassen, lass doch zum Teufel den Frieden diejenigen schließen, die den Krieg geführt und Verantwortung getragen und den Waffenstillstand gefordert haben“.
Im MSPD-Parteiausschuss gibt Erhard Auer zu bedenken: „Mit dem Eintritt in die Regierung werden wir gewissermaßen eine Mittelpartei, und die Unabhängigen, die heute nichts sind, werden dann scheinbar die einzige Oppositionspartei sein.“
24. 9 1918 - Bulgariens Waffenstillstandsgesuch an die Alliierten
Skopje * Die bulgarische Regierung richtet ein Waffenstillstandsgesuch an den alliierten Oberbefehlshaber.
24. 9 1918 - Die britische Armee besetzt Amman in Palästina
Amman * Die britische Armee besetzt Amman in Palästina, woraufhin sich die Türken über Dar‘a nach Damaskus zurückziehen müssen.
24. 9 1918 - Das Minimalprogramm der MSPD für eine Regierungsbeteiligung
Berlin * Im Vorwärts wird das Minimalprogramm der MSPD für eine Regierungsbeteiligung veröffentlicht. Die Mehrheitssozialdemokraten verlangen:
- Den Beitritt Deutschlands zu einem Völkerbund, der Streitfälle friedlich regelt.
- Ein klares Eingehen auf das 14-Punkte-Programm des US-Präsidenten.
- Die Aufhebung der Diktatfrieden mit Rumänien und Russland und den Abzug der dort eingesetzten deutschen Besatzungstruppen.
- Belgien, Montenegro und Serbien sollen geräumt werden.
- Freie, allgemeine und gleiche Wahlen in den Ländern des Deutschen Reichs, was vor allem Preußen mit seinem Dreiklassen-Wahlrecht meint.
- Keine Nebenregierungen, womit die Oberste Heeresleitung - OHL gemeint ist.
- Die Berufung der Regierungsmitglieder aus der Reichstagsmehrheit, also MSPD, Linksliberale und Zentrum.
- Versammlungs- und Pressefreiheit, und damit die Beendigung des Belagerungszustandes.
- Die Beseitigung aller militärischen militärischen Institutionen, die der politischen Beeinflussung dienen.
Die bürgerlichen Parteien sind die Bündnispartner der Mehrheitssozialdemokraten, nicht die USPD.
25. 9 1918 - Die Alliierten beginnen eine weitere Großoffensive
Nordfrankreich * In der Nacht vom 25. zum 26. September 1918 beginnen die Alliierten eine weitere Großoffensive gegen die „Siegfriedlinie“, die stärkste deutsche Verteidigungslinie an der Westfront.
25. 9 1918 - Bulgarien bittet um einen Waffenstillstand
Sofia * Erste alliierte Einheiten überschreiten die bulgarische Grenze. Die bulgarische Regierung bittet daraufhin die Alliierten um einen Waffenstillstand.
25. 9 1918 - Hindenburg über die militärische Kraft der Feinde
Spa * Der Chef der Obersten Heeresleitung - OHL, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, äußert sich gegenüber seinen Armeeführern: „Die militärische Kraft der Feinde nimmt derzeit dramatisch ab.“
27. 9 1918 - Bulgarien kapituliert
Sofia * Bulgarien kapituliert.
27. 9 1918 - Die deutsche Armee steht kurz vor der Niederlage
Nordfrankreich - Spa * Die französischen, britischen und amerikanischen Truppen durchbrechen die sogenannte „Siegfriedlinie“ oder „Hindenburglinie“, Deutschlands letzte ausgebaute Verteidigungslinie. Die Alliierten können damit eine der erfolgreichsten Offensiven des gesamten Krieges verzeichnen. Die Niederlage der deutschen Armee wird unausweichlich.
Generalquartiermeister Erich Ludendorff lässt im Heeresbericht verkünden: „Der Feind konnte somit an einzelnen Stellen unsere Infanterie- und vorderen Artillerielinien erreichen“. Sie sind aber letztlich „an der Zähigkeit unserer Truppen gescheitert“.
Er klärt die Reichsregierung über die Vorgänge nicht auf. Lediglich einige jüngere Offiziere der Obersten Heeresleitung - OHL setzen in einem nahezu konspirativen Akt den Vertreter des Auswärtigen Amtes in Spa über die drohende militärische Katastrophe in Kenntnis.
27. 9 1918 - Ludendorff plant die Handhabung der militärischen Niederlage
Berlin * Generalquartiermeister Ernst Ludendorff beginnt die Handhabung der Niederlage zu planen:
- Die Armee muss gerettet werden - ihre Existenz und Ehre.
- Ein Waffenstillstandsgesuch muss von der Regierung ausgehen, nicht von der Obersten Heeresleitung.
- Es muss politisch motiviert sein, nicht militärisch.
- Das Waffenstillstandsgesuch sollte von jenen politischen Kräften ausgehen, die schon immer für einen Verständigungsfrieden eingetreten sind - die Parteien der Reichstagsmehrheit (SPD, Fortschrittspartei und Zentrum).
- Diese Parteien müssten entweder in die Regierung aufgenommen werden oder selbst die Regierung bilden.
- Als Anreiz für diese unattraktive Aufgabe der Regierungsverantwortung müsste diesen Parteien der Übergang zur parlamentarischen Regierungsform angeboten werden.
- Das würde gleichzeitig die Chancen des Waffenstillstandsgesuchs verbessern.
27. 9 1918 - Der militärische Zusammenbruch Bulgariens
Berlin * Staatssekretär Paul von Hintze gibt im Hauptausschuss des Reichstags den militärischen Zusammenbruch Bulgariens bekannt.
Die Truppen der Entente können nun die rumänischen Ölfelder besetzen und dadurch die deutsche Armee von der Ölversorgung abschneiden. Ohne das Öl aus Rumänien kann das deutsche Heer höchstens noch zwei Monate kämpfen.
28. 9 1918 - General Ernst Ludendorff will ein Waffenstillstandsgesuch
Spa * Als immer mehr schlechte Nachrichten auf Generalquartiermeister Erich Ludendorff zukommen, kann er sich länger nicht mehr einer realistischen Lagebeurteilung verweigern. Schnell und entschlossen handelt er. Am Vormittag lässt er Reichskanzler Georg Friedrich Graf von Hertling mitteilen, „dass eine Umbildung der Regierung oder ein Ausbau derselben auf breiterer Basis“ nötig ist.
Am Abend weiht er den Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg in seine Planungen für ein Waffenstillstandsgesuch ein. Dieser stimmt den Vorschlägen - wie üblich - zu.
Um 28. 9 1918 - Durchhalteparolen sozialdemokratischer Zeitungen
Deutsches Reich * In verschiedenen Tageszeitungen äußern deutsche Sozialdemokraten die Überzeugung, dass Deutschland nur noch einige Wochen mit dem „Mut der Verzweiflung“ kämpfen müsse, um einen „besseren Frieden“ sichern zu können.
28. 9 1918 - Das herrschende System kracht in allen Fugen
Berlin * Der USPD-Vorsitzende Hugo Haase schreibt: „Das herrschende System kracht in allen Fugen. […] Im Bürgertum, in Zirkeln, die monarchisch bis auf die Knochen sind, wird offen davon gesprochen, dass die Hohenzollern weichen müssen, wenn anders der Friede nicht zu erlangen ist.“
29. 9 1918 - Ludendorff erhält die Zustimmung für sein Waffenstillstandsgesuch
Spa - Berlin * Staatssekretär Paul von Hintze verhandelt am Vormittag mit Generalquartiermeister Ernst Ludendorff über das weitere Vorgehen. Ludendorffs Forderung nach einem Waffenstillstandsersuchen binnen 24 Stunden, das unter die Verantwortung der Reichstagsmehrheit gestellt wird, wird - bei aller Gefahr für Heer, Volk, Reich und Monarchie - von Hintze befürwortet. Ludendorff begründet es damit, dass er nicht mehr dafür garantieren kann, eine militärische Katastrophe an der Westfront zu verhindern.
Staatssekretär Paul von Hintze will eine „Revolution von oben“ und damit einen vollständigen Systemwechsel vornehmen. Eine Umbildung der jetzigen Regierung lediglich durch Hinzuziehen einiger Parteienvertreter hält er nicht für ausreichend. Der Gedanke gefällt Ludendorff, da ein radikaler Bruch mit der bisherigen Regierung die Glaubwürdigkeit gegenüber den Kriegsgegnern erhöhen würde.
Der Generalquartiermeister erhält die Zustimmung für das weitere Vorgehen vom Staatssekretär Paul von Hintze und vom greisen Reichskanzler Georg Friedrich Graf von Hertling.
Anschließend informiert Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg gemeinsam mit Staatssekretär Hintze, aber ohne den Reichskanzler, Kaiser Wilhelm II.. Dieser ist sowohl mit der Regierungsumbildung als auch mit dem Waffenstillstandsgesuch einverstanden.
29. 9 1918 - Die bulgarische Regierung unterzeichnet einen Waffenstillstand
Skopje - Thessaloniki * Eine französische Kavalleriebrigade zieht in die mazedonische Hauptstadt Skopje ein. In der Nacht unterzeichnen die bevollmächtigten Abgesandten der bulgarischen Regierung in Thessaloniki den Waffenstillstandsvertrag. Der Vertrag tritt am 30. September Mittags in Kraft. Bulgariens Kapitulation bedeutet für das Deutsche Reich
- den Stopp der enorm wichtigen Lebensmittellieferungen nach Deutschland.
- Für die Alliierten ist jetzt der Weg zur Donau frei.
- Die bulgarischen Streitkräfte verzeichnen im Ersten Weltkrieg über 100.000 Tote und über 140.000 Verwundete, bei einer Vorkriegsbevölkerung von rund 4,5 Millionen und einer Gesamtzahl von 1,2 Millionen Mobilisierten.
29. 9 1918 - Ranghohe Offiziere werden über die Kriegsaussichten informiert
Spa * Anschließend werden ranghohe Offiziere von der Obersten Heeresleitung - OHL über den Stand des Krieges informiert. Generalquartiermeister Erich Ludendorff führt hierzu aus,
- dass die OHL und das Deutsche Reich am Ende sind,
- der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist,
- die endgültige Niederlage nicht mehr zu vermeiden ist,
- Bulgarien abgefallen ist,
- Österreich und die Türkei am Ende ihrer Kräfte sind und bald folgen werden,
- die deutsche Armee schwer verseucht durch das Gift spartakistisch-sozialistischer Ideen und
- auf die deutschen Truppen kein Verlass mehr ist.
29. 9 1918 - Max von Baden wird als künftiger Reichskanzler vorgeschlagen
Spa * Graf Siegfried von Roedern schlägt dem Kaiser Prinz Max von Baden als künftigen Reichskanzler vor. Wilhelm II. findet dagegen „seinen Vetter als einen Mann von weichem, schwankendem Charakter […], der weder militärisch noch sonst im Leben etwas geleistet“ habe.
30. 9 1918 - Glocken zur Verwendung als Kriegsmaterial
München * Die zur Verwendung als Kriegsmaterial bestimmten zehn Glocken der sechs protestantischen Kirchen ist abgeschlossen.
30. 9 1918 - Kaiser Wilhelm II. entlässt Reichskanzler Georg Graf von Hertling
Spa * Da der amtierende Reichskanzler der vom Kaiser angekündigten Parlamentarisierung nun im Weg steht, bleibt Georg Graf von Hertling nur noch der Rücktritt, den er umgehend einreicht.
Im Entlassungsschreiben macht Kaiser Wilhelm II. deutlich: „Ich wünsche, daß das deutsche Volk wirksamer als bisher an der Bestimmung der Geschicke des Vaterlandes mitarbeitet. Es ist daher mein Wille, daß Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind, in weitem Umfange teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung.“
30. 9 1918 - Die deutsche Wehrkraft ist auf die Hälfte gesunken
Deutsches Reich * Die Iststärke der deutschen Bataillone ist auf die Hälfte ihres Sollstandes gesunken. 22 Divisionen werden ganz aufgelöst.
30. 9 1918 - Wilhelm II. verkündet die Errichtung einer parlamentarischen Regierung
Spa * Mit dem sogenannten Parlamentarisierungserlass verkündet Kaiser Wilhelm II. die Errichtung einer parlamentarischen Regierung im Deutschen Reich. Die Regierung soll künftig nicht mehr vom Monarchen, sondern von den Mehrheiten im Reichstag bestimmt werden. Diese Revolution von oben ist allerdings der entscheidende Geburtsfehler.
1. 10 1918 - Die militärische Niederlage Deutschlands ist unvermeidlich
Spa * Im engsten Kreis leistet Generalquartiermeister Erich Ludendorff seinen Offenbarungseid und beginnt gleichzeitig seine Flucht aus der Verantwortung. Nach den Aufzeichnungen von Oberst i.G. Albrecht von Thaer gesteht er:
- „Die OHL und das deutsche Heer ist am Ende; der Krieg ist nicht nur nicht mehr zu gewinnen, vielmehr steht die endgültige Niederlage wohl unvermeidlich bevor. […]
- Unsere eigene Armee ist leider schon schwer verseucht durch das Gift spartakistisch-sozialistischer Ideen. Auf die Truppen ist kein Verlaß mehr. […]
- Ich habe S. M. gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben, dass wir so weit gekommen sind. Wir werden also diese Herren jetzt in die Ministerien einziehen sehen.
- Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muss.
Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben!“
1. 10 1918 - Die Eierzuteilung wird auf 2 Stück in 3 Wochen verringert
München * Die Eierzuteilung wird auf 2 Stück in 3 Wochen verringert. Gleichzeitig tritt die Erhöhung des Milchpreises in Kraft.
1. 10 1918 - Der Reichsfinanzhof nimmt seine Tätigkeit auf
München-Bogenhausen * Der Reichsfinanzhof nimmt seine Tätigkeit auf.
1. 10 1918 - Der künftige Reichskanzler trifft in Berlin ein
Berlin * Bereits am Nachmittag trifft der designierte Reichskanzler Max von Baden in Berlin ein, wo ihm Kaiser Wilhelm II. erklärt, was er von ihm erwartet.
1. 10 1918 - Damaskus wird durch die Araber eingenommen
Damaskus * Das von den Türken verteidigte Damaskus wird durch die Araber eingenommen.
Das stellt den Schlusspunkt der Kämpfe in Palästina dar.
1. 10 1918 - Durchhaltparolen in der Zentrumspresse
Nürnberg * Die zur Zentrumspresse gehörende Nürnberger Volkszeitung, gibt realitätsblinde Durchhalteparolen aus:
„Fürwahr: wir können uns die Größe der Gefahr, in welcher wir schweben, wenn wir in unserer Kampfkraft nachlassen, gar nicht kraß genug vorstellen, um daraus den felsenfesten, entschlossenen Willen zu schöpfen, jede Faser unseres Willens und Herzens anzuspannen, damit wir uns kräftigen in dem Entschlusse, lieber unser Letztes herzugeben, als zu so schimpflichem Dasein verurteilt zu sein. […]
Unsere Feinde wollen uns vernichten, sie würden auch einen noch so weitgehenden Frieden, den wir zu genießen bereit wären, abweisen, weil sie uns ‚ausrotten‘ und unser Land zu einer Wüstenei machen wollen. Kann es da ein deutsches Herz geben, welches dem Vaterlande in dieser großen Not und Bedrängnis nicht zur Seite stehen wollte?
Jetzt ist die Stunde, in der wir die nationale Verteidigung organisieren müssen! Jetzt gibt es kein Besinnen mehr, der letzte entscheidende Gang hat begonnen!“
Ab dem 1. 10 1918 - Die Münchnener Post steigert ihre Auflage um 15.000 Exemplare
München - Königreich Bayern * Die SPD-Zeitung Münchener Post wird auf der ersten Seite Artikel unter der Überschrift „Fort mit dem Militarismus!“, „Ein Systemwechsel notwendig!“, „Eine neue Politik“ oder „Für ein neues freies Vaterland“ abdrucken. Alleine zwischen dem 1. und 15. Oktober 1918 kann die Zeitschrift damit ihre Auflage um 15.000 Exemplare steigern.
1. 10 1918 - Die OHL setzt Max von Baden als Reichskanzler durch
Spa - Berlin - Karlsruhe * Die Oberste Heeresleitung - OHL übernimmt wieder einmal die politische Führung und setzt bei Kaiser Wilhelm II. - der dagegen „schärfsten Widerspruch“ einlegt - Prinz Max von Baden als Kanzlerkandidat der Krone durch.
Umgehend wird der Marschbefehl für den badischen Monarchen zur sofortigen Reise nach Berlin erstellt. Vorsorglich reist Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg gleich mit.
2. 10 1918 - Erste Veranstaltung des Arbeiterausschusses für einen guten Frieden
München * Gast der ersten öffentlichen Veranstaltung des „Freien Arbeiterausschusses für einen guten Frieden“ ist Karl Harrer, ein Mitglied der Thule-Gesellschaft und Sportjournalist bei der national-liberal orientierten München-Augsburger Abendzeitung.
2. 10 1918 - Das OHL informiert die Vorsitzenden der Reichstagsfraktionen
Berlin * Der Emissär der Obersten Heeresleitung - OHL und Abgesandter des Generalquartiermeisters Erich Ludendorffs, Major Erich von dem Bussche-Ippenburg, informiert die Vorsitzenden der Reichstagsfraktionen, dass „nach menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr besteht, dem Feinde den Frieden aufzuzwingen“.
„Die Oberste Heeresleitung sieht sich veranlasst, Seiner Majestät vorzuschlagen, zu versuchen, den Kampf abzubrechen, die Fortsetzung des Krieges als aussichtslos aufzugeben. Jede vierundzwanzig Stunden können die Lage verschlechtern und den Feind unsere eigentliche Schwäche erkennen zu lassen.“
Bei den bürgerlichen Parteien herrscht ebenso wie bei den Sozialdemokraten blankes Entsetzen und Niedergeschlagenheit. Doch kein Sozialdemokrat, kein Zentrumsmann, kein Liberaler reißt das Angebot des politischen Handelns an sich. Deshalb geht die Kanzlerschaft an einen adeligen, badischen Prinzen.
2. 10 1918 - Ludendorff will keinesfalls Verantwortung übernehmen
Berlin * Um nicht selbst die Verantwortung für den verlorenen Krieg übernehmen zu müssen, drängt Generalquartiermeister Erich Ludendorff auf die Bildung einer parlamentarisch getragenen Regierung. Im Kreis des Generalstabs erklärt Generalquartiermeister Erich Ludendorff, dass er Kaiser Wilhelm II. gebeten habe, „jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben, dass wir so weit gekommen sind. Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muss. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben!“
Ludendorff geht es nur um das Abwälzen der Verantwortung für die sich abzeichnende Niederlage, auf der sich später die „Dolchstoßlegende“ aufbauen wird.
2. 10 1918 - Deutschland kann sehr wohl weiterkämpfen
Berlin * Der jüdische Industrielle Walther Rathenau erklärt in einem Zeitungsartikel, dass Deutschland sehr wohl in der Lage ist weiterzukämpfen. „Zu kämpfen um das was Not tut: den Frieden in Ehren.“
2. 10 1918 - Die MSPD-Spitze ist von Max von Baden begeistert
Berlin * Der MSPD-Vorsitzende Friedrich Ebert berichtet dem Fraktionsvorstand über sein erstes Treffen mit Prinz Max von Baden. Er verspricht sich von dem Kanzlerkandidaten viel für die sozialdemokratische Sache. Auch Philipp Scheidemann bezeichnet den designierten Kanzler als „sehr weit entgegen kommend“, insbesondere was die „entschiedene Demokratisierung“ des Reiches anbelangt.
Philipp Scheidemann soll als Minister ohne Portefeuille in das neu zu bildende Kabinett Max von Baden aufgenommen werden.
3. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. ernennt Prinz Max von Baden zum Reichskanzler
Berlin * Kaiser Wilhelm II. ernennt Prinz Max von Baden, zum Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs. Dieser nimmt Staatssekretäre des Zentrums, der Liberalen und der Sozialdemokraten in seine Regierung auf.
3. 10 1918 - Friedrich Ebert will in die Regierung - Philipp Scheidemann nicht
Berlin * Philipp Scheidemann, der Außenpolitische Sprecher der SPD im Reichstag und zweiter Mann in der SPD-Reichstagsfraktion plädiert gegen den Eintritt in ein „bankrottes Unternehmen“.
Friedrich Ebert argumentiert in der Fraktionssitzung für die Beteiligung an der Regierung. Denn die Partei darf sich nicht dem Vorwurf aussetzen, dass sie in einem Augenblick ihre Mitwirkung versagt hat, in dem man sie dringend von allen Seiten darum bat. „Wir müssen uns im Gegenteil in die Bresche werfen“. Friedrich Ebert wird sich mit dieser Argumentation durchsetzen.
Damit kann eine parlamentarisch verantwortliche Regierung unter Reichskanzler Prinz Max von Baden gebildet werden. Gemeinsam mit den Sozialdemokraten, den Liberalen und dem Zentrum verfügt der Reichskanzler über eine solide parlamentarische Mehrheit.
3. 10 1918 - Die erste deutsche Friedensnote an die US-Regierung
Berlin - Washington * Die neue Regierung unter Reichskanzler Max von Baden unterbreitet dem US-Präsidenten Woodrow Wilson umgehend Vorschläge für einen sofortigen Waffenstillstand. Diese erste deutsche Friedensnote wird der US-Regierung über Schweizer Kanäle zugeleitet. Die Verhandlungen sollen auf der Basis der Friedensbedingungen aus Wilsons 14-Punkte-Programm vom 8. Januar 1918 geführt werden.
3. 10 1918 - Die Rechte der Einzelstaaten sollen garantiert werden
Berlin * Der Bundesrat tagt. Auf der Versammlung der fürstlichen Bevollmächtigten wird den verbündeten Regierungen erstmals reiner Wein über die politische und militärische Lage eingeschenkt. Die Anwesenden sind zwar über die „schrecklichen“ Tatsachen entsetzt. Aktiv in die Reichspolitik wollen sie sich aber nicht einbringen. Allerdings sollen die Rechte der Einzelstaaten vom Reichskanzler Max von Baden garantiert werden.
3. 10 1918 - Wilhelm Solf wird Leiter des Auswärtigen Amtes
Berlin - Deutsches Reich * Der derzeitige Staatssekretär im Reichskolonialamt, Wilhelm Solf, wird zum Leiter des Auswärtigen Amtes ernannt.
4. 10 1918 - Reichskanzler Max von Baden bildet eine parlamentarische Regierung
Berlin * Reichskanzler Prinz Max von Baden bildet eine parlamentarische Regierung, die die revolutionäre Bewegung in Deutschland aufhalten soll. Die meisten Staatssekretäre aus der Regierung Hertling bleiben im Amt. Aus den Reihen der Reichstagsmehrheit übernimmt der Zentrums-Abgeordnete Karl Trimborn das Reichsamt des Inneren, der MSPD-Abgeordnete Gustav Bauer übernimmt das Reichsarbeitsamt. Vier weitere Parteienvertreter (Philipp Scheidemann, MSPD; Matthias Erzberger, Zentrum; Adolf Gröber, Zentrum, und Conrad Haußmann von der Fortschrittlichen Volkspartei - FVP) werden zu Staatssekretären ohne Portefeuille.
Dem 16-köpfigen Kabinett Baden gehören neun Parteilose, zwei Fortschrittliche Liberale, ein Nationalliberaler, drei Zentrums-Abgeordnete und zwei Vertreter der größten Reichstagsfraktion, den Sozialdemokraten, an.
Die halbherzige Zusammenstellung der neuen Regierung unter Reichskanzler Max von Baden ist gewiss kein Systemwechsel und Neuanfang. Sie beteiligt halt zusätzlich ein paar Parteienvertreter, die das Image der Reichsregierung aufpolieren sollen.
4. 10 1918 - Die Deutsche Zeitung kämpft gegen den Reichskanzler
Berlin * Die Deutsche Zeitung beschreibt Prinz Max von Baden als sich doch „offen als Vertrauensmann des sozialistisch-freisinnig-zentrümlichen Volksteils“ zu bekennen. Und weiter: „Wir fragen die deutschen Bundesfürsten, mit deren Rechten eine wildgewordene Reichstagsmehrheit heute Fangball spielt, ob sie diese Entwürdigung ihres hohen Berufes ruhig hinnehmen können?“
5. 10 1918 - Die neue Regierung unterbreitet Vorschläge für einen Waffenstillstand
Berlin * Reichskanzler Prinz Max von Baden gibt in seiner Jungfernrede im Reichstag den Inhalt seiner Friedensnote bekannt, in der er im Namen der deutschen Regierung den Präsidenten der USA, Woodrow Wilson, um die Vermittlung von Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen bittet.
Er spricht aber nicht nur über deutsche Friedensangebote, sondern gibt auch zu bedenken, dass es nur dann zu einem Friedensschluss kommen kann, wenn man Deutschland Friedensbedingungen zugesteht, die sich auch mit seiner Ehre vertragen. Sollten die Feinde des Reiches aber Deutschland diesen Frieden nicht zugestehen, wird der Krieg weitergehen. Er unterstreicht die These mit der Aussage, dass das Deutsche Reich - wenn nötig - zu einem „Endkampf auf Leben und Tod“ bereit ist.
„Kein Zagen befällt mich bei dem Gedanken, dass dieses zweite Ergebnis eintreten könnte; denn ich kenne die Größe der gewaltigen Kräfte, die auch jetzt noch in unserem Volke vorhanden sind, und ich weiß, dass die unwiderlegliche Überzeugung, um unser Leben als Nation zu kämpfen, diese Kräfte verdoppeln würde.“
In dieser Antrittsrede bekennt sich Reichskanzler Max von Baden aber auch ausdrücklich
- zur parlamentarischen Demokratie im Reich und in den Einzelstaaten,
- befürwortet die Friedensresolution des Reichstags vom 14. Juli 1917 und
- nimmt das Friedensprogramm des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson vorbehaltlos an.
Diese Aussagen stehen allerdings seinem ursprünglichen politischen Programm vollkommen entgegen.
5. 10 1918 - Der Krieg ist verloren - jedes weitere Opfer ist vergeblich
Deutsches Reich - Berlin * Durch Zeitungsartikel erfährt die deutsche Öffentlichkeit, dass es eine neue Regierung mit Beteiligung der Sozialdemokraten, des Zentrums und der Fortschrittspartei gibt.
Auch, dass diese Regierung als erste Amtshandlung ein Waffenstillstandsgesuch an den US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson geschickt hat. Damit herrscht im Volk Gewissheit, dass der Krieg verloren und jedes weitere Opfer vergeblich ist.
Was verschleiert wird ist das Versagen der Obersten Heeresleitung - OHL, die das Deutsche Reich mit seiner Kriegspolitik ins Verderben geführt hat, jetzt aber nicht mehr als Verantwortlicher und Hauptakteur, sondern als Zuschauer erscheint.
5. 10 1918 - Das vorläufige Mindestprogramm der USPD-Parteiführung
Berlin * Die USPD-Parteiführung hat konkrete Vorstellungen, welche Maßnahmen in der gegebenen, reichlich verfahrenen Lage ergriffen werden sollen.
Außenpolitisch fordert sie
- die Räumung der von deutschen Truppen besetzten Gebiete und
- die Abänderung der Diktatfriedensschlüsse im Osten.
Innenpolitisch will sie die
- Amnestierung der politischen Gefangenen,
- Aufhebung des Belagerungszustandes,
- bürgerliche Freiheitsrechte,
- Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes,
- demokratisches Wahlrecht in allen Bundesstaaten und
- die durchgreifende Parlamentarisierung der Verfassung.
Diese Punkte werden dabei als vorläufiges Mindestprogramm verstanden.
5. 10 1918 - Beamte fordern eine gründliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
München - Königreich Bayern * Von den Bayerischen Verkehrsblättern, dem Organ des Bayerischen Beamten- und Lehrerbundes, wird eine gründliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Beamten als Voraussetzung zum „Durchhalten- und Aushalten-Können“ gefordert.
Das Blatt warnt: „Kommt diese innere Front, durch Mangel an Erhaltungsmöglichkeiten, zum Wanken, dann wird aus der wirtschaftlichen Krisis der Beamten auch eine Krisis - des Staates.“
5. 10 1918 - Der Reichskanzler sichert den Einzelstaaten ihre Rechte zu
Berlin * Reichskanzler Max von Baden sichert den Bevollmächtigten der Bundesfürsten die Rechte der Einzelstaaten zu, indem er sich als den berufenen Garanten für die Wahrung der Bundesstaatlichkeit des Reiches bezeichnet.
5. 10 1918 - Bitte des Reichskanzlers an Wilson um Friedensvermittlung
Rosenheim * Der Rosenheimer Anzeiger bringt unter der Überschrift „Dem Frieden entgegen - Bitte des Reichskanzlers an Wilson um Friedensvermittlung“ ein Extra-Blatt zur Rede des Reichskanzlers Prinz Max von Baden im Reichstag heraus:
- „Im Verlauf seiner vielfach vom Beifall der Linken und des Zentrums unterbrochenen Reichstagsrede erstattete Reichskanzler Prinz Max von Baden unter lebhafter Spannung des Hauses folgende Mitteilung:
- ‚Dank des unvergleichlichen Heldentums unseres Heeres ist die Front im Westen ungebrochen. Dieses stolze Bewusstsein lässt uns mit Zuversicht in die Zukunft sehen.
- Gerade deshalb ist es aber auch unsere Pflicht, Gewissheit darüber herbeiführen, ob das opfervolle, blutige Ringen nicht einen einzigen Tag über den Zeitpunkt hinaus geführt wird, wo uns ein Abschluss des Krieges möglich erscheint, der unsere Ehre nicht berührt.
- Gestützt auf das Einverständnis aller dazu berufenen Stellen im Reiche und auf die Zustimmung der gemeinsam mit uns handelnden Bundesgenossen habe ich in der Nacht zum 5. Oktober 1918 durch die Vermittlung der Schweiz an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika eine Note gerichtet, in der ich ihn bitte, die Herbeiführung des Friedens in die Hand zu nehmen und hierzu mit allen kriegsführenden Staaten in Verbindung zu treten‘.
- Die Note trifft schon heute oder morgen in Washington ein. Sie richtet sich an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, weil dieser in seiner Kongressbotschaft vom 8. Januar 1918 und in seinen späteren Kundgebungen, besonders auch noch in seiner New-Yorker Rede vom 27. September ein Programm für den allgemeinen Frieden aufgestellt hat, das wir als Grundlage für die Verhandlungen annehmen können. (Am Schluss der Rede des Reichskanzlers ertönte wiederholter Beifall).“
6. 10 1918 - König Ludwig III. ermutigt das bayerische Heer zum weiteren Kampf
München * König Ludwig III. ermutigt das Bayerische Heer zum weiteren Kampf. In den katholischen Kirchen der Stadt werden außerordentliche Kriegsandachten für einen „baldigen und ehrenvollen Frieden“ abgehalten.
6. 10 1918 - Der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben konstituiert sich
Zagreb * In Zagreb konstituiert sich der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben und erklärt sich zur Vertretung aller Südslawen der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Er baut eigene Strukturen auf, um für den sich abzeichnenden Zusammenbruch Österreich-Ungarns gerüstet zu sein und nimmt keine Weisungen aus Budapest mehr entgegen.
Der Staates der Slowenen, Kroaten und Serben ist ein nur kurzlebiges Gebilde und verwaltete die Gebiete bis zur endgültigen Vereinigung mit dem Königreich Serbien, die am 1. Dezember 1918 erfolgt.
6. 10 1918 - Wenig Ängste vor der Abdankung des Kaisers
Berlin - München * Der bayerische Gesandte am Kaiserhof, Hugo Graf von Lerchenfeld, berichtet in einem Brief an den Ministerpräsidenten Otto von Dandl:
„Wenn etwa der Frieden von der Abdikation [= Abdankung] abhängig gemacht werden sollte, so würde der Kaiser ohne Zweifel in den Schritt einwilligen. Selbst in den königstreuesten Kreisen der Hauptstadt wird die Abdikation als ein unter Umständen nicht abwendbarer Schritt besprochen.“
6. 10 1918 - Die Kaiserkrone im Volk verankern
Berlin * Reichskanzler Max von Baden erklärt im Kabinett: „Wir müssen alles tun, um die Krone im Volk zu verankern.”
6. 10 1918 - Deutschland ist sowohl friedensbereit als auch kampfentschlossen
Berlin * Das Berliner Tageblatt, die auflagenstärkste Tageszeitung im Deutschen Kaiserreich mit linksliberaler Ausrichtung, stellt unter der Überschrift „Des Kanzlers Friedensschritt“ fest, dass die Rede des Reichskanzlers Max von Baden vom Vortag signalisiere, Deutschland ist sowohl „friedensbereit“ als auch „kampfentschlossen“.
6. 10 1918 - Neue Pläne zur Fortführung des Krieges
Berlin * Die Aussage des Reichskanzlers Max von Baden vom Vortag lädt die nicht gerade geringe Zahl der Gegner eines Friedens à la Woodrow Wilson ein, neue Pläne zur Fortführung des Krieges zu schmieden.
Mit seiner Feststellung, entweder einen ehrenhaften, für Deutschland annehmbaren Frieden oder den Endkampf auf Leben und Tod, schürt er auch die Hoffnung bei Bewohnern von Danzig, die dem Deutschen Reich verloren gehen könnten, wenn Wilsons Politik des Selbstbestimmungsrechts der Völker in die Tat umgesetzt werden würde.
6. 10 1918 - Bis zum letzten Blutstropfen
Berlin * Die konservative Zeitung Berliner Lokal-Anzeiger schreibt ein mit „Bis zum letzten Blutstropfen“ überschriebenen Kommentar, in dem es heißt:
„[…] wird das ganze deutsche Volk gegen diejenigen kämpfen, die ihm einen demütigenden Frieden diktieren wollen. Ungebrochen steht unsere Front noch in Feindesland. Gegen den Angriff der Verbündeten durch bulgarisches Gebiet werden wir uns leichter verteidigen können als gegen die Millionenheere Russlands, die uns drei Jahre lang vergebens bedrohten.“
6. 10 1918 - Beitrag der Unterwasserfloote zum bevorstehenden Endkampf
Berlin * Der in Berlin stationierte Marineoffizier, Kapitän William Michaelis, stellt in einem Schreiben dar, wie die deutsche Unterwasserflotte ihren Beitrag zum bevorstehenden Endkampf leisten könnte.
Wenn die Marine zu einem heroischen Endkampf antrete, werde das die deutsche Bevölkerung aufrütteln und einen „positiven Stimmungswandel“ herbei führen. Im Zeichen dieses Umschwungs werde das deutsche Volk dem Austausch diplomatischer Friedensnoten eine Absage erteilen und sich dafür entscheiden, den Kampf so lange weiterzuführen, wie es nötig sei.
Ab 6. 10 1918 - Der Zusammenbruch Österreich-Ungarns beginnt
Wien * Der Zerfall Österreich-Ungarns beginnt mit dem militärischen Zusammenbruch und den Niederlagen der k.u.k.-Armee.
- Kroaten, Serben und Slowenen erklären am 6. Oktober ihre Unabhängigkeit,
- die Polen folgen ihnen am 7. Oktober,
- die Tschechen am 28. Oktober.
- Ungarn erklärt am 24. Oktober die Realunion mit Österreich zum Monatsende für aufgelöst.
7. 10 1918 - In der Schwabinger Ursulakirche werden drei große Glocken abgenommen
München-Schwabing * In der Schwabinger Ursulakirche werden drei große Glocken zur Verwendung als Kriegsmaterial abgenommen.
7. 10 1918 - Die Haftentlassung für Kurt Eisner wird beantragt
München - Leipzig * Kurt Eisners Rechtsanwalt, Dr. Benedikt Bernheim, beantragt dessen Haftentlassung. Obwohl der Oberreichsanwalt in Leipzig diesem Begehren widerspricht, entscheidet der 1. Strafsenat des Reichsgerichts für die Freilassung.
7. 10 1918 - Walther Rathenau verlangt eine allgemeine Volkserhebung
Berlin - Spa * Der jüdische Industrielle Walther Rathenau gibt ein einem Artikel im Berliner Tageblatt zu bedenken, dass die mit Woodrow Wilson auszuhandelnde Waffenstillstands- und Friedensabkommen für die Deutschen bedeuten:
- eine Zahlung von bis zu 50 Milliarden Mark für den Wiederaufbau von Belgien und Nordfrankreich und
- den möglichen Verlust von Elsass, Lothringen und Danzig.
Er fordert deshalb
- eine allgemeine Volkserhebung, um die unausweichlichen Waffenstillstandsverhandlungen aus einer Position der Stärke heraus zu führen.
- Er fordert die Oberste Heeresleitung - OHL dazu auf, die deutschen Armeen hinter die nationalen Grenzen zurückzuziehen, um sie hier für einen neu motivierenden Verteidigungskrieg aufzustellen.
Generalquartiermeister Erich Ludendorff und die Oberste Heeresleitung lehnen die Vorschläge als vollkommen unakzeptabel ab, da durch die Unzuverlässigkeit der Soldaten in der Heimat die Gefahr eines revolutionären Umsturzes nur noch vergrößert werden würde.
Walther Rathenaus Thesen stoßen im Volk auf eine breite Resonanz. Er wird zum Wortführer derer, die die Meinung vertreten: Deutschland ist nicht besiegt und braucht deshalb keinen sofortigen Waffenstillstand. Der ultranationalistische und antisemitische Reichsbote und die alldeutsche Deutsche Zeitung vergessen kurzzeitig ihre traditionelle Abneigung gegen Juden und stellen sich hinter Rathenaus Argumentation.
7. 10 1918 - Den unabhängigen polnischen Staat proklamiert
Warschau * Der Regentschaftsrat in Warschau ruft den „unabhängigen polnischen Staat“ aus und reklamiert das Territorium des historischen polnischen Königreiches vor den Teilungen von 1772 bis 1795 als Staatsgebiet.
7. 10 1918 - Die türkische Regierung tritt zurück
Konstantinopel * Die türkische Regierung unter Großwesir Talât Pascha tritt zurück.
7. 10 1918 - Die Abdankung des Kaisers keinesfalls zulassen
Berlin * Kabinettschef Friedrich von Berg erklärt Reichskanzler Max von Baden im Garten der Reichskanzlei, er dürfe „unter keinen Umständen über die Abdankung des Kaisers auch nur mit sich reden lassen“.
Um den 7. 10 1918 - Die Briefaffäre des Reichskanzlers Max von Baden
Berlin * Durch eine gezielte Indiskretion wird ein Privatbrief des Prinzen Max von Baden von Anfang Oktober 1918 bekannt, in dem er die Friedensresolution des Reichstags vom 14. Juli 1917 als eine „Dummheit“ und „Gemeinheit“ bezeichnet und das Konzept einer Parlamentarisierung und Demokratisierung des politischen Systems verunglimpft.
Der Inhalt des Briefes entlarvt seine Reichstagsrede vom 5. Oktober als Heuchelei. Durch die Briefaffäre ist der Reichskanzler angezählt.
8. 10 1918 - US-Präsident Wilson stellt erste Bedingungen
Washington - Berlin * US-Präsident Woodrow Wilson antwortet auf das erste Waffenstillstandsersuchen der deutschen Regierung. Nur zögernd und misstrauisch übermittelt er seine Vorbedingungen.
In seiner ersten Note fordert er den deutschen Rückzug aus den besetzten Gebieten. Weitere Forderungen werden folgen. Er wirft aber auch die Frage auf, „ob der Kanzler nur für diejenigen Gewalten des Reiches spricht, die bisher den Krieg geführt haben“.
8. 10 1918 - Die MSPD lässt den Reichskanzler nicht fallen
Berlin * Der MSPD-Vorsitzende Friedrich Ebert hat in der „Briefaffäre“ des Reichskanzlers Max von Baden erkannt: „Wenn die Arbeiter von dem Brief Kenntnis erhalten, so verliert die Regierung ihren ganzen Einfluss.“
Dennoch wird der Reichskanzler von der MSPD gehalten. Dankbar stellt dieser fest, „dass ich in den Sozialdemokraten Männer auf meiner Seite habe, auf deren Loyalität ich mich vollkommen verlassen kann.“
9. 10 1918 - Eine revolutionäre USPD-Versammlung
München-Isarvorstadt * Die USPD-Mitgliederversammlung wird im Restaurant Müllerbad in der Hans-Sachs-Straße von über 200 Personen besucht. Die Polizei berichtet darüber: „Die Stimmung der Versammlung muss als durchaus revolutionär bezeichnet werden und erinnerte im allgemeinen an die Zeit kurz vor Ausbruch des letzten Massenstreiks.“
Die im Reich inzwischen eingeleitete formale Parlamentarisierung beeindruckt bei den Unabhängigen niemanden mehr. Alfred Gärtner stellte fest: „Unsere ehemaligen Führer Scheidemann und Genossen sind in die bankerotte Firma eingetreten. […]
Es wird eine Zeit kommen, und die ist nicht mehr ferne, wo Männer wie Scheidemann ganz von der Bildfläche verschwinden müssen. Sie werden dann dort Unterschlupf finden, wohin sie gehören, nämlich in der bürgerlichen Partei, der sie die ganze Arbeiterschaft ausgeliefert haben. […]
Aber es wird nicht mehr lange dauern und die Kerker werden sich öffnen und alle unsere lieben Kämpfer werden wir dann in unseren Reihen begrüssen können.“
Um 10. 10 1918 - Karl Harrer ruft einen nationalistischen Arbeiter-Ring ins Leben
München * Karl Harrer wird von der Thule-Gesellschaft beauftragt, Arbeiter für die völkische Politik zu gewinnen. Zu diesem Zweck ruft er einen Arbeiter-Ring ins Leben. Noch vor dem Sturz der Monarchie in Bayern - gründen Harrer und Anton Drexler gemeinsam den Politischen Arbeiterzirkel, der sich - laut seiner erst am 24. März 1919 festgelegten Satzung - als „eine Vereinigung ausgewählter Persönlichkeiten zwecks Besprechung und Studium politischer Angelegenheiten“ versteht.
Die vom Vorstand zu Mitgliedern des Zirkels ernannten Personen werden zum Stillschweigen über die Tätigkeit und die personelle Zusammensetzung der Gruppe verpflichtet, woraus alleine schon der Einfluss der exklusiven und elitären Thule-Gesellschaft erkennbar ist.
Die dominierende Figur und der geistige Führer dieses Politischen Arbeiterzirkels, dem zum größten Teil Arbeitskollegen Drexlers angehören, ist demzufolge auch nicht Drexler, sondern Karl Harrer, der vor diesem zwar vorwiegend, aber nicht ausschließlich im Hotel Vier Jahreszeiten tagenden kleinen Kreis - besonders im Winter 1918/19 - auch ständig Vorträge zu verschiedenen aktuellen Themen hält.
Um den 10. 10 1918 - Pläne zum deutschen Endkampf der Marine auf der See
Berlin * Eine Gruppe von Seekriegsplanern beginnt mit der Ausarbeitung geheimer Operationspläne, um die Vision der Seekriegsleitung - SKL zum deutschen Endkampf auf See in die Tat umzusetzen.
11. 10 1918 - Forderung nach einem gerechten Wahlrecht
München * Der fortschrittliche Volksverein Münchens fordert die „Schaffung eines gerechten, die wahren Kräfteverhältnisse wiedergebenden Wahlrechts als unerlässliche Voraussetzung für die Bildung einer wahren Volksregierung“.
11. 10 1918 - Vor Dublin ein Passagierschiff von einem deutschen U-Boot versenkt
Dublin * Ein deutsches U-Boot versenkt in der Bucht von Dublin ein Passagierschiff. 450 Menschen kommen dabei ums Leben, darunter 135 Frauen und Kinder.
11. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. will wieder mitregieren
Berlin * Kaiser Wilhelm II. will wieder mitregieren. Vom 11. bis 13. Oktober erscheint er täglich in der Reichskanzlei zur Unterredung mit Reichskanzler Max von Baden.
12. 10 1918 - Enteignung der Türklinken und Fenstergriffe aus Buntmetall
München * Der Verbandstag der Bayerischen Haus- und Grundbesitzer beschäftigt sich mit den Ausführungsbestimmungen der bevorstehenden Enteignung der Türklinken und Fenstergriffe aus Buntmetall zur Verwendung als Kriegsmaterial.
12. 10 1918 - Die deutsche Reichsregierung will Wilsons Forderungen nachkommen
Berlin - Washington * Die deutsche Reichsregierung erklärt sich in ihrer Antwort auf das amerikanische Schreiben bereit, die 14 Punkte des US-Präsidenten Woodrow Wilson anzunehmen. Darunter befindet sich auch die Räumung der besetzten Gebiete.
Besonders stellt die neue amtierende Regierung heraus, dass sie „durch Verhandlungen und in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit des Reichstags“ gebildet worden ist. „In jeder seiner Handlungen, gestützt auf den Willen dieser Mehrheit, spricht der Reichskanzler im Namen der deutschen Regierung und des deutschen Volkes.“
12. 10 1918 - Erhard Auer zum SPD-Landesvorsitzenden gewählt
München-Au * Der Landesparteitag der MSPD beginnt im Franziskaner-Keller an der Hochstraße. Er dauert bis zum 13. Oktober. Der Parteitag wählt Erhard Auer als Nachfolger für Georg von Vollmar zum Landesvorsitzenden. Auer interprediert die innenpolitischen Vorgänge der vorangegangenen Tage, die Bildung einer Reichsregierung unter Beteiligung der MSPD, wie folgt:
„Wir erleben die größte Revolution, die es je gegeben hat. Nur die Form ist heute eine andere, deswegen eine andere, weil durch die Disziplinierung der Arbeiterschaft – und das ist das Verdienst der Arbeiterbewegung – andere Formen möglich sind, weil es möglich ist, auf legalem Wege zu erreichen, wofür wir seit Jahrhunderten stritten.“
12. 10 1918 - USPD-Kritik an der Regierung mit MSPD-Beteiligung
Berlin * Ein Erlass legt die Amnestie der politischen Gefangenen in die Hand der einzelnen Landesfürsten. Diese Entscheidung stößt bei der USPD und in Teilen der MSPD auf starke Kritik. Auch an den geltenden Zensurbestimmungen ändert sich zunächst ebenfalls wenig.
Als der USPD-Parteivorsitzende Hugo Haase daraufhin in einer öffentlichen Veranstaltung erklärt, dass noch immer „der alte reaktionäre Wind“ weht, wird die Versammlung aufgelöst. Auf die Vorwürfe, dass von einer Neuorientierung in der Innenpolitik noch nichts spürbar sei, reagierte die Regierung nicht.
12. 10 1918 - Die erste öffentliche Rücktrittsforderung an den Kaiser
Berlin * Die rechtsorientierte Deutsche Zeitung aus Berlin distanziert sich als erste Zeitung von Kaiser Wilhelm II.: „Wer sich das Zepter aus der Hand winden lässt, der kann es nicht führen. Für uns gibt es nur die Frage, was wird aus unserem Reich?“
Die übrigen Zeitungen halten sich noch bis Ende Oktober an das Verbot, nichts über Rücktrittsforderungen an den Kaiser zu berichten.
12. 10 1918 - Im Zustande einer latenten Revolution
Berlin * Ministerpräsident Otto von Dandl trifft sich mit seinen Kollegen aus Sachsen, Württemberg, Baden und Mecklenburg in Berlin zu einem Gedankenaustausch. Die Anwesenden betrachten die politische Entwicklung „mit großer Sorge“. Man befinde sich sogar schon „im Zustande einer ‚latenten Revolution‘“.
- Es gibt Staatsstreichgelüste auf der extremen Rechten,
- als „noch gefährlicher“ wird eingeschätzt, das die Unabhängige Sozialdemokratische Partei - USPD zurzeit „außerordentliche Fortschritte“ macht.
Die anwesenden Ministerpräsidenten erwarten allerdings die Lösung der Probleme nicht vom eigentlich zuständigen Reichskanzler Max von Baden, sondern setzen ihre Hoffnungen auf die Führer der Mehrheitssozialdemokratie.
12. 10 1918 - Hindenburg droht dem Reichskanzler mit Rücktritt
Spa - Berlin * Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg kündigt (droht) gegenüber dem Reichskanzler Max von Baden in einem Fernschreiben seinen Rücktritt an, falls der Generalquartiermeister Ernst Ludendorff entlassen werden sollte.
13. 10 1918 - Weitreichende Forderungen der bayerischen SPD
München-Au * Auf dem Münchner Parteitag der SPD im Franziskaner-Keller an der Hochstraße forderte der Chefredakteur der Fränkischen Tagespost, Adolf Braun, die Abdankung des Kaisers. Unterstützung erhält er von dem Nürnberger SPD-Landtagsabgeordneten Ernst Schneppenhorst, der gleichzeitig auch den Rücktritt des bayerischen Königs Ludwig III. fordert. Erhard Auer versucht dagegen seine Parteigenossen zu beschwichtigen und plädiert zum Abwarten, bis die Zeit reif ist für einen Regierungswechsel auf legalem Weg.
Abschließend beschließt der Parteitag
- die Abschaffung der Monarchie,
- die Einführung des Acht-Stunden-Tages,
- das Wahlrecht für beiderlei Geschlecht und
- die Einführung einer Arbeitslosenversicherung.
Der SPD-Landesparteitag fordert aber auch
- die Überführung Deutschlands in einen Volksstaat mit vollkommener Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Volkes in Reich, Staat und Gemeinde.
13. 10 1918 - Der Mann kann getrieben werden
Berlin * Auf der gemeinsamen Sitzung des Partei- und Fraktionsvorstands der MSPD stellt Otto Braun in Hinblick auf die „Briefaffäre“ des Reichskanzlers Max von Baden fest: „Nachdem der Mann uns diese Schwäche gezeigt hat, stärkt er unsere Position. Der Mann kann getrieben werden.“
14. 10 1918 - Kurt Eisner wird aus der Haft entlassen
München-Obergiesing * Abends, um 20:30 Uhr, kann Kurt Eisner die Haftanstalt Stadelheim verlassen. Er wird auf Entscheidung des 1. Senats des Reichsgerichts Leipzig entlassen, damit er an der am 17. November stattfindenden Reichstagswahl teilnehmen kann. Und das, obwohl sich der Oberreichsanwalt gegen die Entlassung ausgesprochen hatte.
In der Begründung zu diesem Gerichtsbeschluss wird aufgeführt, dass eine Fluchtgefahr ausgeschlossen sei und eine Verdunkelungsgefahr nicht besteht.
14. 10 1918 - US-Präsident Wilson fordert die Einstellung des U-Boot-Krieges
Washington - Berlin * US-Präsident Woodrow Wilson fordert auf das deutsche Waffenstillstandsersuchen in seiner zweiten Note unter anderem die Einstellung des U-Boot-Krieges, nachdem am 11. Oktober in der Bucht von Dublin ein Passagierschiff von einem deutschen U-Boot versenkt worden ist. 450 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter 135 Frauen und Kinder.
14. 10 1918 - Ludendorff will den Kampf bis zum letzten Mann
Spa - Berlin * Generalquartiermeister Ernst Ludendorff, der am 29. September einen Waffenstillstand binnen 24 Stunden gefordert hatte, plädiert nach dem Schreiben des US-Präsidenten Woodrow Wilson jetzt dafür, das deutsche Volk soll doch „um seine Ehre nicht nur in Worten, sondern tatsächlich bis zum letzten Mann kämpfen und sich damit die Möglichkeit des Wiedererstehens sichern“.
Kaum hat die neue parlamentarische Regierung die Verantwortung übernommen, spielt Ludendorff den entschlossenen Feldherrn, der sich gegen eine Politik wehrt, die ihn zur Beendigung des Kampfes zwingen will. Wieder ein Baustein zur Dolchstoßlegende.
Um den 14. 10 1918 - Aus Bronzefiguren soll Kriegsmaterial werden
München * In zwei Listen werden Bronzefiguren aufgeführt, die den Metallbedarf der Rüstungsbetriebe geopfert werden sollen. Die erste Liste beinhaltet Werke, auf die man ersatzlos und für immer verzichten will. Dazu gehört unter anderem die Schwind-Büste auf der Praterinsel, das Senefelder-Denkmal, ein Germaniabrunnen und das Brunnenbuberl, das sich seinerzeit noch in der Anlage in der Sonnenstraße befindet.
Auf der zweiten Liste stehen Werke die nach dem Krieg wieder rekonstruiert werden sollen. Dazu zählt unter anderem das Maxmonument, Standbilder von Schiller und Goethe und der Wolfsbrunnen am Kosttor. Die nur wenig verbleibende Zeit bis zur Revolution rettet die Bronzeplastiken und macht sie zu den Gewinnern der Revolution und der neu entstandenen Demokratie.
15. 10 1918 - Die Liberale Fraktion stellt ihre Forderungen vor
München * Die Liberale Fraktion der Bayerischen Abgeordnetenkammer fordert
- die Abschaffung des bisherigen Beamtenministeriums,
- die Bildung einer Volksregierung auf parlamentarischer Grundlage unter Beschränkung der königlichen Gewalt und Beiziehung der Sozialdemokraten.
- Die sofortige Beschlussfassung über die nötigen verfassungsrechtlichen Umgestaltungen und Verwaltungsreformen, insbesondere auch
- die Einführung des Verhältniswahlrechts.
15. 10 1918 - Wilhelm Dittmann wird aus der Festungshaft entlassen
Berlin * Wilhelm Dittmann, Gründungsmitglied der Unabhängigen Sozialdemokraten - USPD und Aktivist beim Berliner Munitionsarbeiterstreik im Januar 1918, wird aus der Festungshaft entlassen.
Wilhelm Dittmann war am 4. Februar 1918 vom Außerordentlichen Kriegsgericht wegen des versuchten Landesverrats zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt worden.
16. 10 1918 - Österreichs Kaiser Karl I. erlässt das Kaisermanifest
Wien * Der österreich-ungarische Kaiser Karl I. erlässt das sogenannte Kaisermanifest, das die Umwandlung der österreichischen Reichshälfte in einen Bundesstaat, einer Konföderation freier Völker, vorsieht. Dazu werden die einzelnen Nationalitäten Österreichs aufgerufen, eigene Nationalräte zu bilden.
16. 10 1918 - Die Oberste Heeresleitung instruiert die Presse
Spa - Berlin * Der Sprecher der Obersten Heeresleitung - OHL, Major Würz, instruiert die Presse: „Unter allen Umständen muß der Eindruck vermieden werden, als gehe unser Friedensschritt von militärischer Seite aus. Reichskanzler und Regierung haben es auf sich genommen, den Schritt von sich ausgehen zu lassen.
Diesen Eindruck darf die Presse nicht zerstören. Sie muß immer wieder betonen, dass die Regierung es ist, die getreu ihren wiederholt geäußerten Prinzipien sich zum Friedensschritt entschloss“. Diese Direktive wird weitestgehend beachtet.
16. 10 1918 - Keine Hindernisse für eine fortschrittliche bayerische Verfassung
München-Kreuzviertel * Ministerpräsident Otto von Dandl legt in der Abgeordnetenkammer in seiner Programmrede dar, dass die Regierung und der König einer fortschrittlichen Entwicklung der bayerischen Verfassung keine Hindernisse in den Weg legen wollen. Der Fraktionsvorsitzende des Zentrums, Heinrich Held, unterstützt die Reformen, wenn sie die Monarchie erhalten und stärken. Auf die Anliegen der Beamtenschaft vom 5. Oktober geht der Ministerpräsident mit keinem Wort ein.
16. 10 1918 - Der Reichsgesundheitsrat tritt erneut zusammen
Berlin * Auf Initiative des selbst erkrankten Reichskanzlers Max von Baden tritt der Reichsgesundheitsrat erneut zusammen. Den mehrstündigen Beratungen folgen aber keine konkreten Vorschläge. Die zweite, jetzt häufig von Lungenentzündungen begleitete Variante der Spanischen Grippe ist seit Oktober aufgetreten und liefert in ihren Auswirkungen Anlass zur Besorgnis.
17. 10 1918 - Die Spanische Grippe breitet sich in München rasch aus
München * Die Spanische Grippe breitet sich in München rasch aus. Etwa 20.000 Erwachsene und über 5.300 Schulkinder sind daran erkrankt. Circa 30 Tote müssen beklagt werden.
17. 10 1918 - Ein städtisches Kriegsnotgeld wird ausgegeben
München * Ein städtisches Kriegsnotgeld im Wert von 10 Millionen Mark wird zu Scheinen zu 5 und 10 Mark ausgegeben.
17. 10 1918 - Drohungen und Drohbriefe an die königliche Familie
München * Prinzessin Wiltrud sieht der politischen Realität ganz bewusst ins Auge, als sie schreibt: „Die politische und militärische Lage ist seit einigen Wochen sehr beunruhigend für uns. […] Unsere Truppen sollen nicht mehr recht kämpfen mögen. Wenn der Geist von 1914 noch in ihnen wäre, würden sie dem Feind besser standhalten können. Die 18-jährigen halten eben viel weniger aus als die Männer von dazumal. […]
Man muss jetzt mit allem rechnen,
- dass der Kaiser und der Kronprinz abdanken müssen,
- dass vielleicht Papa und der Kaiser Karl abdanken müssen,
- dass es Revolution gibt,
- dass die gekrönten Häupter nur eine Rolle der Repräsentation spielen dürfen wie König Georg von England. […]
Die Ungerechtigkeit wird diesmal wohl siegen. […] Deutschland wird sich demokratisieren, Österreich im besten Falle Staatenbund werden. […] Vielleicht ist die Demütigung Deutschlands zum Heil des Volkes, und wenn sich dies in dieser ernsten Zeit fängt, dann kann aus der Rückkehr zur Einfachheit viel Gutes entstehen.“
Vorausgegangen war eine erlebte Situation. Als sie mit ihrem Vater durch die Maximilianstraße fährt, schreit ein Arbeiter: „Dank ab!“. Eine neben ihm stehende Frau hält dem Rufer den Mund zu, um weitere Gefühlsausbrüche zu unterbinden.
17. 10 1918 - Ludendorff lehnt die Friedensbedingungen der USA ab
Spa * Für Generalquartiermeister Erich Ludendorff sind die von den Amerikanern angebotenen Friedensbedingungen das Schlimmste, das Deutschland passieren konnte.
17. 10 1918 - Für Nuntius Eugenio Pacelli kommt die Revolution nicht überraschend
München - Vatikan * Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli berichtet an den Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri mit großer Sorge über „sozialistische Propaganda und Wühlarbeit“ in Deutschland und bei den Frontsoldaten. Die folgende Revolution ist für Pacelli deshalb nicht überraschend.
Um 18. 10 1918 - Fritz Gerlich warnt vor dem Ausbruch einer Revolution
München * Dr. Fritz Gerlich warnt vor dem Ausbruch einer Revolution in Deutschland.
Um 18. 10 1918 - Sterben und Hungern an der Front und an der Heimatfront
Berlin - Deutsches Reich - Westfront * An der Westfront wird weiter gestorben - an der Heimatfront wird weiterhin gehungert. Neue Gestellungsbefehle sehen unter anderem die Einziehung von Siebzehnjährigen zum Militär vor.
18. 10 1918 - Die Magyaren kündigen die Realunion mit Österreich
Budapest * Die Magyaren kündigen die Auflösung der seit 1867 bestehenden Realunion und damit jede politische Verbindung mit Österreich an. Die Nationalitätenfragen Österreichs lassen sich jedoch nicht von denen Ungarns trennen:
- Die Kroaten im österreichischen Dalmatien wollen einen südslawischen Staat mit den Kroaten des ungarischen Kroatien gründen,
- die österreichischen Tschechen die Tschechoslowakei mit den ungarischen Slowaken.
18. 10 1918 - Ein als Bettelbrief getarnter Schmähbrief
München * Ein als Bettelbrief getarnter Schmähbrief ist an „Prinzessin Wiltrud oder Prinzessin Trudl“ adressiert. Wer auch immer den Brief verfasst hat, will der Prinzessin endlich einmal die Wahrheit sagen über ihren Vater König Ludwig III., „den alten Wucherer. Nicht das Land lebt von Euch, sondern ihr lebt vom Land. Gehängt gehört die alte Bande. Geht zu den Preißn […], da gehört ihr hin oder nach Ungarn, Mausefallen verkaufen.“
Prinzessin Wiltrud ist „erschüttert“.
19. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. könnte nie fahnenflüchtig werden
Berlin * Bei einer Unterredung zwischen Reichskanzler Max von Baden und Kaiser Wilhelm II. äußert dieser, „dass er nie daran denken könne, fahnenflüchtig zu werden. Er wisse auch, dass wenn für ihn als Kaiser und König von Preußen Gefahr drohe, sein Volk und seine Armee sich um ihn scharen würden“.
Der mit anwesende bayerische Gesandte am Kaiserhof, Hugo Graf von Lerchenfeld, bringt den Mut auf und weist den König darauf hin, „dass es noch andere Elemente im Reich“ gibt.
19. 10 1918 - Die Juden als Blitzableiter für alles Unrecht benutzen
Berlin * Der Vorsitzende des Alldeutschen Verbands - ADV, Heinrich Claß, äußert sich auf der Sitzung der Führungsspitze: „Die Bundesfürsten haben sich ebenso behandeln lassen [wie der Kaiser]. Sollen wir die Monarchie noch verteidigen, nachdem sie sich selbst überall aufgegeben?“
In der selben Sitzung verabschiedet der Vorstand einen Aufruf, in dem sich der Verband erstmals öffentlich zum Antisemitismus bekennt.
- Es gelte „die Juden als Blitzableiter für alles Unrecht zu benutzen, Furcht und Schrecken […] in der Judenschaft [zu verbreiten]. […]
- Ich werde […] vor keinem Mittel zurückschrecken und mich in dieser Hinsicht an den Ausspruch Heinrich von Kleist’s, der auf die Franzosen gemünzt war, halten: Schlagt sie tot, das Weltgericht fragt Euch nach Gründen nicht!“
20. 10 1918 - Passagierschiffe werden nicht mehr durch deutsche U-Boote torpediert
Berlin - Washington * Reichskanzler Prinz Max von Baden stimmt in einer versöhnlich gestimmten Note den amerikanischen Forderungen zu. Die von Woodrow Wilson geforderte Einstellung des U-Boot-Krieges wird von der Reichsregierung befohlen. Die deutsche Regierung sichert dem US-Präsidenten Wilson zu, dass Passagierschiffe durch deutsche U-Boote nicht mehr torpediert werden.
20. 10 1918 - Reichskanzler Max von Baden will die Dynastie retten
Berlin * Reichskanzler Max von Baden: „Nur deshalb bin ich Reichskanzler geworden, um die Dynastie zu retten. Ich sehe deshalb auch meine vornehmste Aufgabe darin, die Abdankung des Kaisers zu verhindern.“
21. 10 1918 - Der Sozialdemokratische Verein für die Wahlkreise München I und II fordert
München * Der Sozialdemokratische Verein für die Wahlkreise München I und II fasst in seiner außerordentlichen Generalversammlung den einstimmigen Beschluss
- zur sofortigen Parlamentarisierung und Demokratisierung der bayerischen Staatsverfassung unter Aufhebung der Reichskammer,
- für ein Wahlrecht für beide Geschlechter, dem die Verhältniswahl zugrunde liegt,
- sowie für die Umgestaltung der Verwaltung.
21. 10 1918 - Die Spanische Grippe weitet sich weiter aus
München * Die Spanische Grippe weitet sich weiter aus. Die Zahl der Toten beträgt rund 100.
21. 10 1918 - Gründung der Provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich
Wien * Die deutschen Abgeordneten des österreichisch-ungarischen Reichsrates bilden unter Bezugnahme auf das Kaisermanifest die Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich.
21. 10 1918 - Lieber ein Kapitulationsfriede als den Zusammenbruch
München - Königreich Bayern * Das Kriegsministerium erhält anonyme „Stimmen aus dem Mittelstande Bayerns“ zugeschickt. Darin wird unter der Berufung auf die allgemeine Volksmeinung gefordert: „Der Friede muss sobald als möglich herbei geführt werden, gleich ob günstig oder ungünstig.“ Ein Kapitulationsfriede sei immer noch besser als der unausweichliche Zusammenbruch.
Ab dem 21. 10 1918 - Fluchtpläne für die königliche Familie werden erarbeitet
München * Fluchtpläne für die königliche Familie werden erarbeitet. Der Zufluchtsort für die königliche Familie soll Würzburg sein. Dorthin will sie sich begeben, falls die bayerische Haupt- und Residenzstadt München beschossen oder gar von Feinden besetzt werden sollte. Alle beweglichen Kostbarkeiten aus der Schatzkammer und der Reichen Kapelle der Residenz werden zum Abtransport verpackt.
Bei einer Revolution könnte nach Einschätzung von Prinzessin Wiltrud alles verloren sein. Dann „sind wir sehr, sehr arm, denn Barvermögen ist wenig da“.
22. 10 1918 - Theobald Michler wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Au * Der am 16. April 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Schriftsetzer Theobald Michler wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
22. 10 1918 - Franz Xaver Müller wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Au * Der am 15. März 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Eisendreher Franz Xaver Müller wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
22. 10 1918 - Hans Unterleitner wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Au * Der am 1. Februar 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Schlosser und spätere Minister für soziale Fürsorge, Hans Unterleitner, wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
22. 10 1918 - Albert Winter sen. wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Au * Der am 31. Januar 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Schreinermeister und Vorsitzende der Münchner USPD, Albert Winter sen., wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Seine Freilassung erfolgt aufgrund seiner Kandidatur für die USPD für die Landtagsersatzwahl.
22. 10 1918 - Albert Winter jun. wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Au * Der am 31. Januar 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Infanterist Albert Winter jun. wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
22. 10 1918 - Vermehrte Befehlsverweigerungen - Die Soldaten wollen heim
Österreich-Ungarn * Es kommt verstärkt zu Befehlsverweigerungen ungarischer und kroatischer Einheiten, zu denen sich bald Tschechen und Bosniaken gesellen. Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn befindet sich in Auflösung. Weder die Regierung in Wien noch die in Budapest verfügt noch über Autorität in den Landesteilen, deren Bevölkerung einen eigenen Staat gründen will.
Das führt dazu, dass viele Soldaten dieser Nationalitäten keinen Sinn im weiteren Kampf sehen und so rasch wie möglich nach Hause zurückkehren wollen.
22. 10 1918 - Lobeshymnen zum 60. Geburtstag der Kaiserin
Potsdam * Kaiserin Auguste Viktoria feiert im Neuen Palais im engsten Kreise ihrer Familie ihren 60. Geburtstag. Eine größere Feierlichkeit vermeidet man aus Angst vor Gegendemonstrationen oder gar öffentlicher Herabsetzung. Das hält den Hofprediger Ernst von Dryander dennoch nicht ab, sie in seiner Predigt zur „Herrin des deutschen Volkes“ hochzustilisieren.
22. 10 1918 - Der Reichstag tritt für Verfassungsänderungen zusammen
Berlin * Der Reichstag tritt erstmals nach der Antrittsrede des neuen Reichskanzlers Max von Baden wieder zusammen. Er soll die notwendigen Verfassungsänderungen beschließen, die das Deutsche Reich zu einer parlamentarischen Monarchie machen.
23. 10 1918 - Kurt Eisner hält im Schwabinger-Bräu seine erste Wahlkampfrede
München-Schwabing * Kurt Eisner hält im Schwabinger Bräu seine erste Wahlkampfrede seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Nur neun Tage nach seiner Haftentlassung lockt er bereits 2.000 Zuhörer in seine Versammlung. Er referiert über das Thema „Regierungssozialisten oder Sozialistenregierung“ und wirft darin dem Flügel um Erhard Auer vor, nicht das Interesse des Volkes, sondern nur das der Regierung im Auge zu haben. In der weiteren Rede fordert Kurt Eisner
- die Abdankung des Kaisers und
- einen Frieden ohne Annexion.
- Kurt Eisner verspricht sich nicht viel vom jetzigen demokratischen System und tritt ein
- für die Beseitigung aller bestehender Gewalten durch Umsturz und Revolution ein.
Am Schluss verlangt er
- „eine große deutsche Republik mit Einschluss Deutsch-Österreichs“ und
- die „Rückkehr zu den Idealen der Revolution von 1848“.
„Bissig, heiser und mit einem fanatischen Elan rechnete er mit seinen Gegnern ab. Alles um ihn war dicht besetzt. Kopf an Kopf. Er stand auf dem Podium inmitten der hockenden Leute und gestikulierte mitunter wild. Langes Haar, das fast bis auf seine Schultern herabwallte, einen noch zerzausteren Bart hatte er jetzt. Wie ein Apostel sah er aus, nur dass er einen Kneifer trug“, schreibt Oskar Maria Graf über Kurt Eisner.
23. 10 1918 - US-Präsident Wilson will ein republikanisches Deutschland
Washington - Berlin * US-Präsident Woodrow Wilson erklärt sich in seiner Antwort auf das Schreiben vom 20. Oktober nur zur Aufnahme von Waffenstillstandsgesprächen gemeinsam mit den Regierungen der Alliierten bereit, wenn der deutsche Verhandlungspartner eine vom Volk gewählte Regierung ist.
Die amerikanische Regierung will „mit keinen anderen als wahrhaften Vertretern des deutschen Volkes verhandeln“. Aus ihrer Sicht gibt es bislang aber keinen Hinweis dafür, dass „die Grundsätze einer dem deutschen Volk verantwortlichen Regierung jetzt bereits vollständig angenommen sind“ und die Systemänderung im Deutschen Reich auf Dauer sein wird. Die Amerikaner geben deutlich zu erkennen, dass sie gegenüber einem republikanischen Deutschland oder zumindest einem Deutschland ohne Kaiser mehr Nachsicht üben würden.
Sie setzen offenbar aber auch darauf, dass jeder zusätzliche Kriegstag die Position des Deutschen Reichs und seiner Verbündeten weiter schwächen und die Friedensbedingungen für die USA positiver gestalten würden.
23. 10 1918 - Die USPD fordert die neue Staatsform der Republik
Berlin * In der Frage der Staatsform erklärt der USPD-Vorsitzende Hugo Haase in der Reichstagssitzung: „Die Kronen rollen auf das Pflaster. […] Rings um uns werden Republiken sich auftun, und da soll Deutschland allein […] noch einen Kronenträger haben oder Träger vieler Kronen und Krönlein!“ Schließlich: „Es muss zur Republik kommen! […].
Die Götzendämmerung für das alte System ist hereingebrochen. Schon zeigt sich die Morgenröte einer neuen Zeit. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wird aufhören; nur Freie und Gleiche wird es dann geben.
Von der Kühnheit und Entschlossenheit der Arbeiter […] wird es abhängen, ob diese die Menschheit befreiende Umwälzung bald erfolgt, oder ob wir noch schwere Zeiten bis dahin durchzumachen haben. Wir haben Vertrauen zu den Arbeitern, wir sind überzeugt, daß aus all dem Elend am letzten Ende doch hervorgehen wird die volle Befreiung der Menschheit.“
23. 10 1918 - Karl Liebknecht wird aus der Haft entlassen
Luckau * Karl Liebknecht wird im brandenburgischen Luckau aus der Haft entlassen.
23. 10 1918 - Der Kaiser ist über den US-Präsidenten verärgert
Berlin * Kaiser Wilhelm II. ärgert sich über das Schreiben des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson in dem er die „Abdikation [= Abdankung] bisheriger Machthaber“ fordert mit den Worten: „Nun hat er die Maske fallen lassen. […] Da soll er was erleben.“
24. 10 1918 - Der Grippe-Epidemie sind bereits 117 Personen erlegen
München * Der grassierenden Grippe-Epidemie sind in München bereits 117 Personen erlegen.
24. 10 1918 - Heeresbefehl zur Entscheidungsschlacht gegen England
Spa * Die Operationsplaner der Marine haben ihr Konzept für den Beitrag der Seestreitkräfte zum Endsieg fertiggestellt. Admiral Reinhard Scheer erteilt - trotz der von der Reichsregierung befohlenen Einstellung des U-Boot-Krieges - der Hochseeflotte den Befehl, gegen die Kanalküste und die Themsemündung vorzustoßen und die Entscheidungsschlacht gegen Großbritannien zu suchen. Die Seekriegsleitung - SKL zieht eine „ehrenvolle Niederlage“ einer drohenden Übergabe der Flotte uneingeschränkt vor. Es geht wieder einmal um die „Ehre der kaiserlichen Flotte“.
24. 10 1918 - Wehrfreudige Artikel im Vorwärts
Berlin * Bei seiner Rede im Reichstag führt Friedrich Ebert aus, dass die Sozialdemokraten auch dann ihr Land nicht im Stich lassen, wenn der ersehnte Friede nicht zustande käme. Selbst der sozialdemokratische Vorwärts druckt wehrfreudige Artikel und erklärt, dass es besser ist weiterzukämpfen, als einen „demütigenden Frieden“ hinzunehmen.
24. 10 1918 - Schwere Vorwürfe Kurt Eisners gegen die MSPD
München * Kurt Eisner und seine USPD gehen in ihrer Werbung für die Wahl am 17. November mit der MSPD ins Gericht:
„Diese Wahl soll und muss die große Abrechnung der Massen mit denen sein, die das Volk alle die Kriegsjahre hindurch getäuscht und verraten haben. In erster Linie mitverantwortlich für alles, was sich in diesen Zeiten Furchtbares ereignet hat, sind die Regierungssozialisten, die sich jetzt überbieten in schreiendem Radikalismus, um die Aufmerksamkeit von der eigenen Schuld und Mitschuld abzulenken. […]
Einer der belastetsten und gefährlichsten Regierungssozialisten, Herr Erhard Auer, der bereits ungezählte Ämter fest in der Hand hält, wagt es, trotz seiner Belastung mit der Schuld an der verwüstenden Kriegspolitik der herrschenden Klassen sich unter dem angemaßten Namen eines Sozialdemokraten um den Reichstagssitz in München zu bewerben.“
24. 10 1918 - Hindenburg fordert die Armee zum äußersten Widerstand auf
Spa * Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Generalquartiermeister Erich Ludendorff erlassen ohne Rücksprache mit dem Reichskanzler einen Heeresbefehl, in dem sie die Forderungen des US-Präsidenten Woodrow Wilson vom 23. Oktober 1918
- als unannehmbar bezeichnen und
- den Abbruch der diplomatischen Beziehungen fordern.
„Die Antwort Wilsons fordert die militärische Kapitulation. Sie ist deshalb für uns Soldaten unannehmbar. Sie ist der Beweis, dass der Vernichtungswille unserer Feinde, der 1914 den Krieg entfesselte, unvermindert fortbesteht. Wilsons Antwort kann daher für uns Soldaten nur die Aufforderung sein, den Widerstand zu mit äußersten Kräften fortzusetzen.“
Die totale Niederlage vor Augen, vollzieht die militärische Führung nochmal eine Kehrtwende und flüchtet sich in die Wahnvorstellung eines immer noch möglichen Widerstandes, der einen ehrenvollen Frieden erzwingen soll. Das taktisch ungeschickte, aber wohl so beabsichtigte Vorgehen der Obersten Heeresleitung - OHL raubt der deutschen Regierung auch noch den allerletzten Verhandlungsspielraum.
24. 10 1918 - Der Kaiser merkt nichts von der Wut und Verachtung gegen ihn
Bern * Der Diplomat Harry Graf von Kessler, der von Bern aus die Vorgänge im Deutschen Reich beobachtet, notiert: „Dass der Kaiser fort muss, wird jetzt so gut wie allgemein anerkannt; nur er selbst tut noch immer so, als ob er Nichts merkte. Vielleicht merkt er in der Tat Nichts von der Wut und Verachtung, die gegen ihn emporsteigen.“
24. 10 1918 - Ungarn kündigt die Realunion mit Österreich auf
Budapest - Wien * Die ungarische Regierung kündigt - mit Zustimmung König Karls IV. - die Realunion mit Österreich zum Monatsende auf. Sie verlangt die sofortige Rückführung der ungarischen Regimenter von der italienischen Front.
24. 10 1918 - Hindenburg und Ludendorff wollen den Kaiser überzeugen
Spa - Berlin * Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Generalquartiermeister Erich Ludendorff verlassen entgegen der Anweisung des Reichskanzlers Max von Baden das Hauptquartier in Spa. Sie wollen Kaiser Wilhelm II. von ihrem Vorhaben überzeugen.
25. 10 1918 - Erhard Auer wettert gegen den preußischen Militarismus
München * Bei der Wählerversammmlung zur Reichstagswahl wettert der SPD-Kandidat Erhard Auer gegen den preußischen Militarismus, der mit aller Gründlichkeit abgeschafft werden müsse. Er warnt jedoch vor jeder Form der Gewaltanwendung zur Veränderung des politischen Systems.
25. 10 1918 - Die bürgerlichen Parteien wollen den SPD-Forderungen nicht nachgeben
München-Kreuzviertel * Die sozialdemokratische Landtagsfraktion nimmt nicht mehr an den Verhandlungen über die Änderungen der Bayerischen Verfassung teil, weil die bürgerlichen Parteien den SPD-Forderungen nicht nachgeben wollen.
Um 25. 10 1918 - Die Worte Kaiserfrage und Revolution beschäftigen das Volk
Deutsches Reich * Spätestens seit der dritten Note des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson vom 23. Oktober sind die Worte „Kaiserfrage“ und „Revolution“ in aller Munde. Viele Männer in verantwortlichen Positionen, einschließlich des Reichskanzlers Max von Baden und des Vorsitzenden der MSPD-Reichstagsfraktion Friedrich Ebert, sehen in dem Thronverzicht des Kaisers das einzige Mittel zur „Rettung der Monarchie“.
Vizekanzler Friedrich von Payer berichtet: „Die allerwildesten Kaiserstürzler sind die rechts stehenden Leute. Die Herren der Hochfinanz und der Großindustrie, ja bis hoch in die Offizierskreise hinein kann man mit einer erstaunlichen Offenheit sagen hören: Der Kaiser muss sofort zurücktreten. […] Je länger die Hetzte fortdauert, desto stärker wird die Forderung hervortreten, dass man überhaupt keine Monarchie mehr brauchte, sondern eine Republik errichten sollte.“
25. 10 1918 - Die letzte Zahlung für die Zivilliste
München-Kreuzviertel * Die Staatskasse weist die Novemberrate für die Zivilliste an. Es wird die letzte derartige Zahlungsanweisung sein.
25. 10 1918 - OHL: Die diplomatischen Beziehungen sollen beendet werden
Berlin * Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Generalquartiermeister Erich Ludendorff drängen Wilhelm II. dazu, die diplomatischen Beziehungen und den Notenwechsel mit dem US-Präsidenten Woodrow Wilson sofort zu beenden. Der Kaiser, der vom Staatssekretär des Äußeren, Paul von Hintze, vom Gegenteil überzeugt und eingeschworen worden war, geht auf die Forderungen nicht ein.
Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bieten die beiden Offiziere ihren Rücktritt an. Doch auch der bettlägerige Reichskanzler Max von Baden droht am selben Abend seinen Rücktritt an, falls „ein Wechsel in der Obersten Heeresleitung nicht möglich ist“.
Der Kaiser ist inzwischen auch darüber informiert worden, dass Ludendorff seit Frühjahr und Sommer 1918 von einem Großteil der Heerführer als überaus negativ angesehen wird.
25. 10 1918 - Eine Ehren- und Existenzfrage der Marine
Spa * Admiral Adolf Lebrecht von Throtha, der Chef des Marinekabinetts, schreibt zum Befehl an die Hochseeflotte zur Entscheidungsschlacht gegen Großbritannien: „Wenn auch nicht zu erwarten ist, dass hierdurch der Lauf der Dinge eine entscheidende Wendung erfährt, so ist es doch aus moralischen Gesichtspunkten Ehren- und Existenzfrage der Marine, im letzten Kampf ihr Äußersten getan zu haben.“
26. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. kontert Ernst Ludendorffs Rücktrittsdrohung
Berlin * Kaiser Wilhelm II. entlässt den Generalquartiermeister Ernst Ludendorff im Schloss Bellevue nach dessen Rücktrittsdrohung mit den Worten: „Na, wenn Sie durchaus gehen wollen, dann meinetwegen“. Dies geschieht auch aufgrund seiner Verärgerung über Ludendorffs
- politisches Manöver gegen den Reichskanzler Max von Baden und
- seinem eigenmächtigen Armeebefehl vom 24. Oktober.
Das Rücktrittsgesuch des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg ignoriert Kaiser Wilhelm II. und bittet ihn sogar in der Obersten Heeresleitung - OHL im Amt zu bleiben. Sein Rückhalt in der Bevölkerung ist noch so groß, dass man seine Entlassung fürchtet. Hindenburg entspricht dem Wunsch des Kaisers und lässt Ernst Ludendorff fallen wie die berühmte heiße Kartoffel. Der geschasste Generalquartiermeister fühlt sich derart verletzt und hintergangen, dass er sich sogar weigert, gemeinsam mit Hindenburg im Auto nach Spa zu fahren.
Mit dem Rausschmiss Ludendorffs will der Kaiser aber auch gegenüber den USA glaubhaft machen, dass im Deutschen Reich neue Männer das Ruder übernommen haben.
26. 10 1918 - Liesl Karlstadt erhält das König-Ludwig-Kreuz
München * Für ihre „ersprießliche Tätigkeit im Dienste des Roten Kreuzes“ erhält „Frl. Elise Wellano, gen. Liesl Karlstadt, Humoristin“ das König-Ludwig-Kreuz verliehen. Karl Valentin und Liesl Karlstadt waren zuvor bei zahllosen Weihnachts- und Vereinsfeiern, Wohltätigkeits-, Lazarett-, Kriegsfürsorge- und Heimkehrervorstellungen aufgetreten.
26. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. verkündet den Übergang zur parlamentarischen Monarchie
Berlin * Kaiser Wilhelm II. verkündet den Übergang zur parlamentarischen Monarchie. Die Kommandogewalt geht nun vom Kaiser auf den Reichskanzler als Chef der Regierung über, der künftig seinerseits der Kontrolle durch den Reichstag unterworfen ist. Eine Gewerkschaftszeitung schreibt: „Herrlich, es ist das eingetreten, was unsere Alten verheißen haben!“
26. 10 1918 - Der Deutsche Reichstag verabschiedet die Oktoberreform
Berlin * Der Deutsche Reichstag verabschiedet die Oktoberreform im Eilverfahren. Damit ist das Deutsche Reich - zumindest auf dem Papier - eine parlamentarische Monarchie. Die Regierung ist damit dem Parlament und nicht mehr dem Monarchen verantwortlich. Entsprechende Veränderungen sollen in den Bundesstaaten folgen. Das Dreiklassenwahlrecht in Preußen ist damit jedoch noch nicht abgeschafft. Das Vorhaben ist lediglich angekündigt.
27. 10 1918 - Die deutsche Reichsregierung ist für einen Waffenstillstand bereit
Berlin * Die deutsche Reichsregierung steht in einem Schreiben an den US-Präsidenten Woodrow Wilson für einen Waffenstillstand bereit.
27. 10 1918 - Österreich-Ungarn will Sonderfriedensverhandlungen
Wien - Washington * Österreich-Ungarn erklärt sich in einem Schreiben an den US-Präsidenten Woodrow Wilson zu Sonderfriedensverhandlungen bereit.
27. 10 1918 - Der Vorwärts ruft zur Zeichnung der 9. Kriegsanleihe auf
Berlin - Deutsches Reich * Der Vorwärts ruft zur Zeichnung der 9. Kriegsanleihe auf, obwohl er eine Woche zuvor erkannt hatte: „Diesen Krieg werden wir nicht gewinnen.“
Um den 27. 10 1918 - Die Monarchie mit Waffengewalt vor Übergriffen schützen
Potsdam * General Max von Gallwitz wird von den Kreisen um die Kaiserin Auguste Viktoria von der Westfront nach Berlin zitiert. Er soll die Monarchie notfalls mit Waffengewalt vor etwaigen Übergriffen schützen und eine offene Diktatur errichten.
28. 10 1918 - Die Proklamation an die bayerischen Bauern
München-Ludwigsvorstadt * Der Führer des Bayerischen Bauernbundes, Karl Gandorfer, spricht in einer Versammlung im Mathäserbräu und fordert die politische Mitbestimmung der Bevölkerung. In einer Proklamation an die bayerischen Bauern verlangt er
- eine Volksregierung in Bayern und
- die gänzliche Beseitigung der Reichsratskammer.
Auf der Versammlung ist auch Kurt Eisner anwesend.
28. 10 1918 - Gesetzentwurf zur Änderung der Reichsverfassung unterzeichnet
Berlin - Deutsches Reich * Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet den Gesetzentwurf zur Änderung der Reichsverfassung, der am 4. November veröffentlicht wird. Damit tritt die Änderung der Verfassung von 1871 in Kraft. Die wesentlichste Bestimmung lautet: „Der Reichskanzler bedarf zu seiner Amtsführung des Vertrauens des Reichstags“. Damit ist das Deutsche Reich eine Parlamentarische Monarchie.
Außerdem sagt der Kaiser seine loyale Zusammenarbeit mit der Volksvertretung und der von dieser gestellten Regierung an. Auf Rücktrittsforderungen geht er mit keinem Wort ein.
28. 10 1918 - US-Präsident Woodrow Wilson verlangt die Abdankung des Kaisers
Washington - Berlin * Der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson verlangt die Abdankung des Kaisers als Voraussetzung für Friedensverhandlungen. Kaiser Wilhelm II. denkt aber nicht im geringsten an Rücktritt.
28. 10 1918 - Die Tschechoslowakische Republik wird ausgerufen
Prag * Der Nationalrat der Tschechen und Slowaken ruft die Tschechoslowakische Republik aus. Die Tschechoslowakei wird als freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat nach westlichem Vorbild proklamiert.
28. 10 1918 - Neue politische Verhältnisse und der alte Kaiser
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten betonen in einem mit „Der Kaiser und die neue Zeit“ überschriebenen Leitartikel, dass die neuen politischen Verhältnisse „alle Grundlagen seiner Auffassung vom Herrscherberuf über den Haufen“ geworfen hätten. Daraus sollte jetzt die Folgerung gezogen werden. Sonst entsteht ein innerlich unwahrer Zustand, der über kurz oder lang zu Konflikten führen müsse.
Das ist zwar noch eine sehr verklausulierte und versteckte politische Kritik an Wilhelm II., aber damit wird das sich selbst auferlegte Verbot, den Kaiser nicht anzugreifen oder zu demontieren, immer öfter durchbrochen.
28. 10 1918 - General Max von Gallwitz soll Diktator werden
Potsdam * Prinz August Wilhelm bittet seinen Vater, Kaiser Wilhelm II., den General Max von Gallwitz „zum Diktator zu machen“.
29. 10 1918 - Die Aussprache über die politische Lage wird abgesetzt
München-Kreuzviertel * Im letzten Augenblick wird in der Bayerischen Abgeordnetenkammer die Aussprache über die politische Lage und die Rede des Ministerpräsidenten Otto von Dandl von der Tagesordnung abgesetzt und auf die folgende Woche verschoben.
Man erwartet, dass König Ludwig III. das bisherige Ministerium auflösen wird, um so die Volksvertretung unmittelbar an der Regierung beteiligen zu können.
29. 10 1918 - Es kommt zu Meutereien, die in einem Aufstand gipfeln
Berlin - Kiel - Wilhelmshaven * Die deutsche Admiralität befiehlt in einem „Himmelfahrtskommando“ das Auslaufen der Flotte gegen die Royal Navy. Obwohl es in Marinekreisen heißt, dass man die Landtruppen in Flandern entlasten will, ist der Befehl nicht mit der Obersten Heeresleitung - OHL abgestimmt.
Unter den Mannschaften der betroffenen Geschwader in Kiel und Wilhelmshaven verbreitet sich das Gerücht, wonach die Marineleitung einen heroischen Untergang plant. Der Kommandant der „Thüringen“ wird mit folgender Aussage zitiert: „Wir verfeuern unsere letzten 2.000 Schuss und wollen mit wehenden Fahnen untergehen.“ Daraufhin verweigern Einheiten der deutschen Hochseeflotte in Wilhelmshaven den Befehl. Es kommt zu Meutereien, die schließlich in einem Aufstand gipfeln.
29. 10 1918 - Eine Militärpatrouille erschießt neun Matrosen
Kiel - Wilhelmshaven * Die Bewegung radikalisiert sich erst, nachdem die meuternden Matrosen verhaftet und mit Kriegsgericht und Erschießung bedroht werden.
Jetzt beginnen Tausende in Kiel für die Befreiung ihrer Kameraden zu demonstrieren. Erst nachdem eine Militärpatrouille neun Menschen erschießt, wollen die Matrosen die Macht. Die Matrosen wählen den ersten Soldatenrat in Deutschland und entwaffnen ihre Offiziere. Der Aufstand ist nicht gewalttätig und erschöpft sich im Hissen von roten Fahnen.
29. 10 1918 - Der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben wird proklamiert
Zagreb * Die Gründung des Staates der Slowenen, Kroaten und Serben - SHS-Staat wird ausgerufen. Er besteht aus Territorien der kollabierenden Habsburgermonarchie.
29. 10 1918 - Wilhelm Groener wird Ludendorffs Nachfolger
Spa * Nach der Entlassung Erich Ludendorffs wird Generalleutnant Wilhelm Groener neuer Generalquartiermeister der Obersten Heeresleitung - OHL. Es geht jetzt nicht mehr um strategische Planungen, sondern um
- die Aufrechterhaltung der Kampfkraft bis zum Waffenstillstand und
- die Rückführung der Truppen in die Heimat.
29. 10 1918 - Entscheidungen verlangen höchste Verantwortung
München * In einem Brief an seinen Bruder Leopold schreibt König Ludwig III.: „Wir erleben die schwersten Zeiten und die bevorstehenden Entscheidungen verlangen das höchste Maß von Verantwortung.“
29. 10 1918 - Soll das Kaisertum überhaupt gerettet werden ?
München * Im Falle einer Thronentsagung des Kaisers wollen die Wittelsbacher den neuen Regenten im Königreich Preußen nicht automatisch als Verweser des Reiches anerkennen.
Ministerpräsident Otto von Dandl informiert den bayerischen Gesandten am Kaiserhof, Hugo Graf von Lerchenfeld, von Überlegungen, „ob das Kaisertum überhaupt gerettet werden soll”, da ein „preußischer Prinz, der eine geeignete Persönlichkeit zur Führung der Regentschaft im Reiche wäre, nicht vorhanden ist”. Wenn, dann müsste „ein Regent präsentiert werden, der dem ganzen deutschen Volk, auch außerhalb Preußens sympathisch“ ist.
29. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. macht dem Reichskanzler Vorwürfe
Berlin * Kaiser Wilhelm II. nimmt dem Reichskanzler Max von Baden übel, dass er den Generalquartiermeister Erich Ludendorff entlassen musste. Wilhelm II. schreibt ihm: „Ludendorff hat, um Dir die Situation zu erleichtern, gehen müssen.“ Und weiter: „Sein Fortgehen ist militärisch ein schwerer Verlust fürs Heer.“
30. 10 1918 - Das Osmanische Reich kapituliert
Lemnos * Das Osmanische Reich kapituliert. Die neue Regierung unter Ahmed Izzet Pascha schließt den Waffenstillstand von Moudros zwischen der Türkei und der Entente. Der Vertrag sieht nicht nur eine alliierte Besetzung der bisherigen arabischen Provinzen, sondern auch der Meerengen und großer Teile Anatoliens vor. Der Krieg im Nahen Osten ist damit beendet.
30. 10 1918 - Kurt Eisner spricht auf einer Wahlversammlung im Löwenbräukeller
München-Maxvorstadt * Kurt Eisner spricht auf einer Wahlversammlung im Löwenbräukeller zum Thema „Deutschland - eine soziale Republik“ und fordert
- eine politische Reinigung des Parlaments und
- die Beseitigung aller Monarchien.
30. 10 1918 - Schiffsbesatzungen verweigern die Ausfahrt
Wilhelmshaven * Auf der Schilling-Reede vor Wilhelmshaven kommt es zu einer dramatischen Kraftprobe zwischen Matrosen und Seeoffizieren. Die Besatzungen der „Thüringen“ und der „Helgoland“ verweigern die Ausfahrt. Plötzlich stehen sich meuternde und nicht-meuternde Schiffe in nächster Nähe gegenüber und richten die riesigen Kanonen gegeneinander. Die Meuterer geben auf - die Offiziere haben gesiegt.
Die Meuterer siegen jedoch insofern, als die Admirale den Flottenvorstoß gegen Großbritannien abblasen, da mit einer derart „unzuverlässigen Mannschaft“ so ein Unternehmen nicht mehr geschlagen werden kann. Die bei Wilhelmshaven versammelte Flotte wird aufgeteilt und in verschiedene Häfen geschickt. Das Dritte Geschwader bringt die rund eintausend verhafteten aufständischen Matrosen nach Kiel ins Militärgefängnis.
30. 10 1918 - Der österreichische Staatsrat wird gebildet
Wien * Die Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich gibt seinem 20-köpfigen Vollzugsausschuss den Namen Staatsrat. Er beruft die 14 Ressortchefs umfassende Staatsregierung.
30. 10 1918 - Reichskanzler Max von Baden will jetzt auch, dass der Kaiser abdankt
Berlin * Auch Reichskanzler Max von Baden hält nun endlich die Abdankung des Kaisers für notwendig und will in diesem Sinne auf Wilhelm II. einwirken.
30. 10 1918 - Kaiser Wilhelm II. flieht vor der Abdankungsdebatte
Potsdam - Spa * Kaiser Wilhelm II. verlässt unabgemeldet und überstürzt seine Hauptstadt und begibt sich ins Große Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL nach Spa, wo er von seinen ihm treu ergebenen Militärs umgeben ist.
Er entzieht sich damit den als taktlos empfundenen Abdankungsdebatten in der Hauptstadt. Aber erst, nachdem man sich darüber Gewissheit verschafft hatte, dass die OHL alles tun werde, um einer Abdankung des Kaisers entgegenzuwirken.
31. 10 1918 - Einigung über parlamentarische Reformen
München-Kreuzviertel * In interfraktionellen Verhandlungen zwischen der bayerischen Volksvertretung und der Regierung einigt man sich auf die Einführung der Verhältniswahl und der Reform der Reichsrätekammer.
31. 10 1918 - Die ungarische Regierung kündigt die Realunion mit Österreich auf
Budapest - Wien * Die Realunion Ungarns mit Österreich ist erloschen.
31. 10 1918 - Zwangsaufenthalt für Erich Mühsam und Josef Sontheimer aufgehoben
Berlin - München * Auf Anordnung aus Berlin hebt die Militärverwaltung den Zwangsaufenthalt für Erich Mühsam und Josef Sontheimer in Traunstein auf.
31. 10 1918 - Die Thronentsagung kann und darf nur eine freiwillige sein
Berlin * Im Kabinett erklärt Reichskanzler Max von Baden, er wird den Kaiser über die Frage der Abdankung fortwährend in geeigneter Form aufklären, muss sich aber dafür Handlungsfreiheit ausbedingen. Die Thronentsagung kann und darf „nur eine freiwillige sein“.
31. 10 1918 - Keiner will dem Kaiser die Abdankungs-Nachricht überbringen
Berlin * Statt endlich den Pflichten seines Amtes als Reichskanzler nachzukommen und den Kaiser über den Ernst der Lage genau und umfassend zu informieren, versucht Prinz Max von Baden diese Aufgabe zu delegieren. Er selbst will es dem Kaiser keinesfalls sagen, da er sich als badischer Thronfolger und deutscher Fürst nicht dazu berufen fühlt. Viel lieber möchte der Reichskanzler dazu Großherzog Ernst Ludwig von Hessen gemeinsam mit Hugo Graf von Lerchenfeld, der mit einem Mandat des bayerischen Königs Ludwig III. ausgestattet werden soll, in das OHL-Hauptquartier nach Spa zu Kaiser Wilhelm II. schicken.
Doch sowohl der Großherzog als auch der bayerische Gesandte am Kaiserhof erteilen dem Reichskanzler eine Abfuhr. Bei Großherzog Ernst Ludwig sind es nicht überlieferte persönliche Gründe. Graf Lerchenfeld wird dagegen vom Ministerpräsident Otto von Dandl zurückgepfiffen, weil
- „Rücksichten auf monarchische Empfindungen“ gegen diese Aktion sprechen und
- es im Falle einer Ablehnung des königlichen Rates zu „bedenklichen Folgen“ für die künftigen Beziehungen der beiden Länder kommen könnte.
- Im Übrigen ist aus bayerischer Sicht allein der Reichskanzler zu dieser Aufgabe berufen und sogar verpflichtet, „die Initiative zu ergreifen“.
Reichskanzler Max von Baden nimmt daraufhin den preußischen Innenminister Bill Drews in die Pflicht als Beamter und schickt ihn als Vorbote nach Spa. Auch Prinz August Wilhelm von Preußen und Prinz Friedrich Karl von Hessen-Kassel lassen den Reichskanzler im Regen stehen, sodass das ganze Unternehmen kläglich scheitern wird.
31. 10 1918 - Die Stellung des Kaisers ist eine ganz unhaltbare geworden
Lille * Der bayerische Kronprinz Rupprecht legt seine Gedanken zur möglichen Abdankung des Kaisers in seinem Tagebuch nieder:
„So bedauerlich es hinsichtlich des monarchischen Ansehens ist, wenn ein Fürst zur Abdankung genötigt wird, scheint mir die Stellung des Kaisers eine ganz unhaltbare geworden zu sein, da er beim Volke jedes Vertrauen und Ansehen verloren hat und täglich heftigere Angriffe in der Presse - nicht bloß in der sozialistischen - gegen ihn erfolgen.“
Und an anderer Stelle: „Ich fürchte aber, es wird nur beraten und nicht gehandelt, indes die Gefahr der Revolution immer drohender empor wächst. Sogar in dem sonst so ruhigen Bayern gärt es bedenklich.“
31. 10 1918 - Egon Schiele stirbt an der Spanischen Grippe
Wien * Der 28-jährige Kunstmaler Egon Schiele stirbt drei Tage nach seiner im sechsten Monat schwangeren Ehefrau Edith in Wien an der Spanischen Grippe.
1. 11 1918 - Bisher 450 Tote durch die Spanische Grippe
München * Bis zum 1. November 1918 hat die Spanische Grippe in München 450 Todesopfer gefordert.
1. 11 1918 - Prinzessin Wiltrud von Bayerns Angst vor der USPD
München-Graggenau * Prinzessin Wiltrud von Bayern schreibt in ihr Tagebuch: „Wenn die unabhängigen Sozialdemokraten noch mehr Zuwachs und Macht bekommen, dann kann auch Bayern die Republik drohen.“
1. 11 1918 - Kronprinz Rupprecht warnt vor der Gefahr einer Revolution
Lille * Kronprinz Rupprecht warnt aus seinem Standort Lille an der Westfront
- vor dem außerordentlichen Ernst der Lage und
- sieht ein Übergreifen der revolutionären Bewegungen, die in Norddeutschland sich vorbereiten, auch auf das Königreich Bayern.
Er bittet seinen Vater König Ludwig III. inständig: „Könntest Du nicht den Kaiser aufsuchen und ihn zu einem Beschlusse bewegen oder ihm doch wenigstens Deine Auffassung der Lange brieflich mitteilen“. Obwohl der greise König gegen die Abdankung des ungeliebten Kaisers keine Einwände erhebt, bleibt er dennoch passiv und untätig.
1. 11 1918 - Tausend aufständische Matrosen kommen ins Militärgefängnis in Kiel
Kiel * Die rund eintausend verhafteten aufständischen Matrosen werden in Kiel an Land und ins Militärgefängnis gebracht, wo das Kriegsgericht und die Erschießungskommandos auf sie warten.
1. 11 1918 - Die Freilassung der Meuterer von Wilhelmshaven gefordert
Kiel * Die Matrosen des Dritten Geschwaders schicken eine Abordnung zum Ortskommandanten und verlangen die Freilassung der aufgrund der Meuterei von Wilhelmshaven eingesperrten Matrosen.
Ihnen ist klar geworden, dass nur die Besatzungen der „Thüringen“ und der „Helgoland“ gemeutert hatten, aber fast alle anderen knapp davor waren. Ihre Kollegen haben ihnen mit dieser Aktion das Leben gerettet und sollen jetzt dafür hingerichtet werden. Das Ansinnen wird vom Ortskommandanten abgelehnt.
1. 11 1918 - Der Kaiser kanzelt Innenminister Bill Drews ab
Spa * Zwischen 14 und 16 Uhr findet das Gespräch zwischen Kaiser Wilhelm II. und dem preußischen Innenminister Bill Drews statt. Reichskanzler Max von Baden hat den Innenminister zu diesem Gespräch verpflichtet. Die zur weiteren Unterstützung avisierten Hochadeligen haben alle ihre Teilnahme abgesagt.
Aus einer Niederschrift vom 3. November geht hervor, dass der Kaiser den „preußischen Beamten und Untertan“ ziemlich abgekanzelt hat. „Wie denken Sie sich die Sache, was wird? Meine Söhne haben mir in die Hand versprochen, dass keiner von ihnen meine Stelle annimmt. Also mit mir tritt das ganze Haus Hohenzollern zurück.“
1. 11 1918 - Der Reichskanzler ist auf allen Gebieten politisch gescheitert
Spa - Berlin * Die nächste Gardinenpredigt erteilt Kaiser Wilhelm II. dem Reichskanzler Max von Baden per Telefon. Das Gespräch nimmt den badischen Prinzen so mit, „dass er in einen Zustand krankhafter Erregung geriet“. Der Reichskanzler ist auf allen Gebieten politisch gescheitert.
1. 11 1918 - Diskussion über die Kaiserfrage im Kabinett
Berlin * Erstmals wird in einer Kabinettssitzung die Kaiserfrage erörtert.
1. 11 1918 - Stimmen gegen einen Rücktritt des Kaisers
Spa - Berlin * Generalquartiermeister Wilhelm Groener schreibt an den Vizekanzler Friedrich von Payer zu den Rücktrittsforderungen gegenüber Kaiser Wilhelm II.: „Das Rückgrat der Armee ist gebrochen, wenn diesen Männern […] ihr oberster Dienstherr, dem sie Treue geschworen haben, genommen wird und sie dadurch in ihren innersten Gefühlen verletzt werden.“
2. 11 1918 - Ein bayerisches Abkommen über parlamentarische Reformen
München-Kreuzviertel * Unter dem Eindruck der revolutionären Unruhen im Deutschen Reich schließt die bayerische Regierung mit Delegierten der im Landtag vertretenen Parteien ein Abkommen über parlamentarische Reformen, in der wesentliche Forderungen der SPD erfüllt werden. Sie beinhaltet:
- Die Einführung der Verhältniswahl zur Kammer der Abgeordneten.
- Eine ergiebige Verstärkung der Kammer der Reichsräte durch Vertreter der Gemeinden, der Hochschulen und der wichtigsten Berufs- und Erwerbsstände.
- Von den Prinzen des Königlichen Hauses gehören nur noch der Kronprinz und fünf weitere der Reichsrätekammer an.
- Keine weitere Ernennung erblicher Reichsräte.
- Ein Veto der Reichsrätekammer gegen ein Gesetz kann durch dreimalige Abstimmung der Abgeordnetenkammer überstimmt werden.
- Die Einjährige Finanzperiode.
- Als Minister können nur Personen berufen werden, die das Vertrauen der Kammern des Landtags besitzen.
- Ein Ministerium für Soziale Fürsorge wird neu gebildet und mit einem Sozialdemokraten besetzt.
- Ferner sollen vier Abgeordnete als Minister ohne Portefeuille [= Ressort, Ministerium] berufen werden, einer davon aus den Reihen der sozialdemokratischen Fraktion.
Die notwendige Kabinettsumbildung ist für den 8. November angekündigt.
Die Verhältniswahl zur Abgeordnetenkammer ist eine alte sozialdemokratische Forderung und die Vereinbarungen über die Kammer der Reichsräte laufen auf eine Demokratisierung der Kammer der Adeligen und des hohen Klerus hinaus. Dadurch hätte die Bayerische Verfassung zugleich parlamentarisiert werden sollen. Auch die Vorschrift aus dem Wahlgesetz von 1896, wonach kein Abgeordneter zum Minister berufen werden darf, würde durch diese Gesetzesvorlage abgeschafft werden.
Über den Königlichen Erlass über die Parlamentarisierung Bayerns soll am 6. November 1918 die Abgeordnetenkammer abstimmen und sich am 8. November die Kammer der Reichsräte mit dieser Vorlage befassen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Obwohl die sozialdemokratische Münchener Post die Vereinbarung als „Beginn der Demokratisierung Bayerns“ feiert, stehen viele Sozis dieser Demokratisierung von oben sehr skeptisch gegenüber.
2. 11 1918 - Der Auftakt der Revolution
München * Auf einer vom Liberalen Verein Frei München veranstalteten Volksversammlung ruft Kurt Eisner: „Es kommt nicht zur Reichstagswahl, vor dem 17. November kommt die Revolution.“ Der „struppige Prophet“ wird zwar wegen seines Aussehens belächelt, trotzdem gilt diese Versammlung als der Auftakt der Revolution.
Kurt Eisner hat bereits vor seiner Haftentlassung die Strategie der Obersten Heeresleitung - OHL durchschaut, die mit der vorgeschobenen Parlamentarisierung lediglich die Verantwortung für den Ausgang des Krieges und den ungünstigen Friedensschluss auf das Parlament abwälzen wollte.
Aus Eisners Sicht sollte nicht nur das verhasste System restlos verschwinden, sondern gleichzeitig mit ihm auch seine Repräsentanten. Gemeint sind jene, die für das vier Jahre dauernde sinnlose Morden die Verantwortung trugen. Schließlich befand sich die Mehrheit der führenden Militärs und Spitzenbeamten in Reich und Länder ebenso in Amt und Würden wie der deutsche Kaiser und die Landesfürsten. Sie aber waren die Symbole einer expansiven Außen- und einer undemokratischen Innenpolitik.
2. 11 1918 - Die Bayerische Regierung legt ihre Ämter nieder
München-Kreuzviertel * Die bayerischen Minister der Staatskrone legen ihre Ämter nieder, nachdem ihnen König Ludwig III. die Auflösung der Regierung Dandl nahe gelegt hatte.
Ex-Ministerpräsident Otto von Dandl wird mit der Neubildung der Regierung unter Einbeziehung des Landtags beauftragt. Die zurückgetretenen Minister führen ihre Ämter bis zur geplanten Neubildung der Regierung kommissarisch aus.
2. 11 1918 - Ratlose Matrosen und Dockarbeiter
Kiel * Matrosen und Dockarbeiter diskutieren im Kieler Gewerkschaftshaus wie es weitergehen soll. Sie kommen zu keinem Entschluss und vertagen sich auf den nächsten Tag.
3. 11 1918 - Erste Friedensdemonstration der USPD seit den Januarstreiks
München-Theresienwiese * Um 10 Uhr Vormittag findet auf der Theresienwiese, an der Freitreppe unterhalb der Bavaria, die erste Friedensdemonstration der USPD seit den Januarstreiks statt. Lediglich 800 bis 1.000 Personen nehmen daran teil. Das liegt daran, dass das Generalkommando den Anschlag von Plakaten verboten hatte. Da die finanziellen Mittel zum Druck von Flugblättern fehlten, konnte die Einladungen zu dieser Kundgebung mit hektographierten Handzetteln erfolgen.
Hans Unterleitner erklärt am Versammlungsbeginn, dass die Veranstaltung nur unter folgenden Bedingungen des Polizeipräsidiums genehmigt worden ist:
- Keine Entschließung zu fassen, dass die heutige Regierung durch eine Volksregierung ersetzt werden müsse,
- keine Aufforderung an die Soldaten ergehen zu lassen, die Waffen niederzulegen,
- keine Demonstrationszüge zu veranstalten beziehungsweise hiezu aufzufordern.
Kurt Eisner betont in seiner Rede den Friedenswillen des deutschen Volkes und sagt: „Von der eingerosteten deutschen Regierung in Berlin sind Taten zur Herbeiführung des Friedens nicht zu erwarten, deshalb muss eine Volksregierung in Bayern sofort Frieden schließen“ und fordert auf zum „Sturz der Monarchie“ und zur „politischen Revolution“. Das Abkommen über parlamentarische Reformen vom Vortag bezeichnet er als „unaufrichtig und unzureichend“.
In Hinblick auf die am 30. Oktober in Wien gebildete Staatsregierung der Provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich sagt Eisner: „Wir grüßen über die Grenze die neue österreichische Republik und fordern, dass eine vom Volk einzusetzende bayerische Regierung mit den deutschen Republikanern Österreichs gemeinsam den Frieden im Namen Deutschlands verkündet, sofern in Berlin nicht der Wille oder die Macht vorhanden ist, den Frieden sofort zu erreichen“.
Aufgrund des Demonstrationsverbots wird im Anschluss an die Versammlung ein Spaziergang nach Stadelheim angetreten.
3. 11 1918 - Waffenstillstand zwischen Österreich-Ungarn und Italien
Padua * In der am südwestlichen Stadtrand von Padua gelegenen Landsitz Villa Giusti del Giardino wird der Waffenstillstand von Villa Giusti unterzeichnet. Er beendet den Ersten Weltkrieg speziell an der italienisch–österreichischen Front, gilt aber auch für alle anderen Fronten, an denen k.u.k. Militär im Einsatz gewesen ist.
Der Waffenstillstandsvertrag gesteht den Entente-Mächten das Durchmarschrecht durch österreichisches Staatsgebiet zu. Damit liegt ein Einmarsch der Alliiierten in Bayern im Bereich des Möglichen.
3. 11 1918 - Prinzessin Wiltrud: „Vielleicht sind wir auch in einiger Zeit abgesetzt“
München-Graggenau * Die bayerische Prinzessin Wiltrud schreibt nach der Veranstaltung der USPD auf der Theresienwiese in ihr Tagebuch: „Was noch alles werden wird, vielleicht sind wir auch in einiger Zeit abgesetzt.“
Sehr gut hat sie beobachtet, dass bei dieser Massenveranstaltung für einen sofortigen Frieden aus der Forderung nach Abdankung eine solche nach Absetzung des deutschen Kaisers geworden ist.
3. 11 1918 - Lorenz Winkler wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Obergiesing * Der am 4. Februar 1918 als Streikführer bei den Bayerischen Motorenwerken - BMW beim Januarstreik verhaftete Schreiner und Werkzeugschlosser Lorenz Winkler wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
3. 11 1918 - Richard Kämpfer wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Obergiesing * Der am 14. März 1918 in Dresden wegen seiner Beteiligung am Januarstreik verhaftete Handlungsgehilfe Richard Kämpfer wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
3. 11 1918 - Fritz Schröder wird aus der Untersuchungshaft entlassen
München-Obergiesing * Der am 16. April 1918 wegen seiner Beteiligung am Januarstreik in Düsseldorf verhaftete Geschäftsführer der Zentralstelle des Deutschen Handlungshilfen-Verbandes Fritz Schröder wird aus der Untersuchungshaft entlassen.
3. 11 1918 - Die Freilassung der Januarstreik-Gefangenen gefordert
München-Stadelheim - Leipzig * Um 13 Uhr verlangt eine Abordnung vor dem Gefängnis Stadelheim die Freilassung der wegen der Januarstreiks noch immer Inhaftierten.
Am Abend trifft ein Telegramm des Oberreichsanwalts aus Leipzig in, in dem die Haftbefehle aufgehoben werden.
3. 11 1918 - Neun Tote und 29 Verletzte nach einer Schießerei auf Demonstranten
Kiel * Als die Matrosen am Sonntag im Kieler Gewerkschaftshaus weiter diskutieren wollen, finden sie dieses verschlossen und von bewaffneten Posten bewacht. Die Matrosen versammeln sich deshalb auf einem Exerzierplatz. Tausende Arbeiter schließen sich ihnen an. Sie hören Reden und diskutieren miteinander. Dann formiert sich ein großer Demonstrationszug.
An einer Straßenkreuzung wird der Demonstrationszug von einer Patrouille untere Leitung eines Leutnant Steinhäuser aufgehalten und zum „Auseinandergehen!“ aufgefordert. Als das die Demonstranten nicht befolgen, kommt der Befehl „Feuer!“. Das Resultat sind neun Tote und 29 Verletzte. Ein bewaffneter Matrose stürzt auf Leutnant Steinhäuser und erschießt ihn.
Nun gibt es kein Zurück. Das ist der Startschuss für die deutsche Revolution.
3. 11 1918 - Wilhelm II. denkt nicht an Abdanken
Spa * In einer Niederschrift über das von Reichskanzler Max von Baden beauftragte Abdankungs-Ansinnen an Kaiser Wilhelm II. versichert dieser, dass er auf seinem Posten bleiben will.
„Ich denke gar nicht daran abzudanken. Der König von Preußen darf Deutschland nicht untreu werden und in dieser Stunde am allerwenigsten; ich habe auch meinen Eid geschworen und den werd‘ ich halten. Ich denke gar nicht daran, den Thron zu verlassen wegen der paar Hundert Juden und der tausend Arbeiter.“
3. 11 1918 - Antimonarchische Parolen vor dem Wittelsbacher Palais
München-Maxvorstadt * Auch vor dem Wittelsbacher Palais, dem eigentlichen Münchner Wohnsitz der königlichen Familie, brüllen Menschen antimonarchische Parolen.
König Ludwigs III. Familie wohnt zwar zum Zeitpunkt der Protestaktion nicht in seinem Lieblingswohnsitz an der Brienner Straße, sondern in der Residenz. Doch seit dem Umsturz von 1848 hat es keine derartige direkte und ungehinderte Provakation gegen einen regierenden Monarchen in Deutschland mehr gegeben.
3. 11 1918 - Kurt Eisner und der Bauernführer Ludwig Gandorfer
München - Pfaffenberg * Nach der Kundgebung eilt Kurt Eisner zum Bahnhof, um nach Pfaffenberg zu fahren, wo er sich mit dem Bauernführer Ludwig Gandorfer trifft. Eisner will sich die Unterstützung durch Gandorfer und seinem Kreis sichern. Er ist sich bewusst, dass ohne die ihm zugesicherten Lebensmittellieferungen die Revolution keine Chance hat.
3. 11 1918 - 1.000 Matrosen auf der Durchreise nach Kiel und Wilhelmshaven
Pula - München * Etwa 1.000 Matrosen befinden sich auf der Durchreise von der bisherigen deutschen Werft in dem damals habsburgischen Adria-Hafen Pula in Istrien nach Kiel und Wilhelmshaven. Sie sind von der Kriegseinstellung ihres Verbündeten Österreichs überrascht und nach Kiel in Marsch gesetzt worden, wo ihre Kameraden seit Tagen meuterten, da sie nicht zu einer letzten Seeschlacht gegen England auslaufen wollten.
Die Matrosen werden vorübergehend in München in Massenquartieren untergebracht. Die Mannschaften, die ein wärmeres Klima gewohnt sind, beschweren sich über die kalte, ungemütliche Unterkunft und die schlechte Verpflegung. Die Klagen führen jedoch zu keinem Erfolg. Dadurch schafft man ein zusätzliches revolutionäres Potenzial in München.
4. 11 1918 - Versammlung der Vertrauensleute der SPD und der Gewerkschaften
München-Ludwigsvorstadt * Im Mathäserbräu findet eine gemeinsame Versammlung der Vertrauensleute der SPD und der Gewerkschaften statt. Sie fassen den einstimmigen Beschluss:
„Da unter dem Streit zwischen Sozialdemokraten und Unabhängigen die Arbeiterinteressen Schaden leiden, appellieren die Obleute an die Leitung beider Parteien, den Bruderkrieg einzustellen und die ganze Kraft des Proletariats zum Kämpfe gegen den gemeinsamen Feind, Kapitalismus und Reaktion, zu vereinigen.“
4. 11 1918 - Der Königliche Staatsrat kommt zu seiner letzten Sitzung zusammen
München-Graggenau * Der Königliche Staatsrat kommt zusammen, um über den Fortgang der Verfassungsreform zu beraten. König Ludwig III. ist - wie seine Berater - der Auffassung, dass den demokratischen Parteien Zugeständnisse gemacht werden müssen, weil alleine damit in dieser Situation dem Staatswohl und der Monarchie gedient werden könne.
- Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich will etwaige Bedenken gegen die Notwendigkeit einer Parlamentarisierung „unter der Wucht der Ereignisse“ zurückgestellt wissen, da die Wellen einer revolutionären Bewegung jetzt auch auf Bayern übergegriffen hätten.
- Ministerpräsident Otto von Dandl will den demokratischen Parteien so weitgehende Zugeständnisse machen, weil in dieser Situation nur so dem Staatswohl und der Monarchie geholfen werden kann.
Vordringlich sei es jetzt,
- dass unter dem Volk kein Zwiespalt herrsche und
- die öffentliche Ruhe aufrecht erhalten werde.
In der letzten von König Ludwig III. geleiteten Staatsratssitzung zieht der Monarch ein denkwürdiges politisches Resümee:
„Wenn der Krieg ein so schlechtes Ende genommen hat, so können wir in Bayern unseren Schild hochhalten; er ist fleckenlos. Bayerns Heer hat sich ruhmreich geschlagen, Bayern trägt keine Schuld. Schuld trägt die unglückselige Politik, die schon vor dem Krieg seitens der Reichsleitung geführt worden ist, und noch mehr die Oberste Heeresleitung, die keinen Maßstab hatte für die Grenzen der eigenen Kräfte. […]
Nach mehr als vierjährigen unerhörten Leistungen und Opfern stehen wir vor einer Niederlage Deutschlands, die es seit Napoleon nicht mehr erlebt hat. Wir müssen Frieden schließen und zwar unter schlechten Bedingungen.“
4. 11 1918 - Die USPD will die Herbeiführung des sofortigen Friedens
Berlin * Die deutsche USPD fordert in einem Aufruf „An das deutsche Volk“ die „Herbeiführung des sofortigen Friedens“. Die Arbeiterschaft und das ganze werktätige Volk soll sich zum Eingreifen bereit halten.
4. 11 1918 - Deutschland will ein Volksstaat werden
Berlin * Die deutsche Regierung unter Reichskanzler Prinz Max von Baden betont ihren Entschluss, Deutschland in einen Volksstaat umzuwandeln und kündigt den Wiederaufbau der Volkswirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg an.
4. 11 1918 - Aufständische Matrosen übernehmen in Kiel die politische Macht
Kiel * Am Nachmittag treffen in Kiel Soldaten vom Generalkommando Altona ein, die den Matrosenaufstand niederschlagen sollen. Die Matrosen, die Heeressoldaten und die Marinesoldaten verbrüdern sich. Der Kommandant der Marinestation muss - aller Machtmittel entledigt - kapitulieren. Die Dockarbeiter treten in einen Streik. pDie aufständischen Matrosen haben in Kiel die politische Macht übernommen.
4. 11 1918 - Die aufständischen Matrosen bewaffnen sich und wählen Soldatenräte
Kiel * Alle Matrosen des Dritten Geschwaders wählen Soldatenräte, entwaffnen die Offiziere, bewaffnen sich selbst und hissen auf ihren Schiffen die rote Fahne. Ein einziges Schiff, die „Schlesien“, flieht auf die hohe See. Der Kapitän der „König“ verteidigt den Flaggenmast und wird erschossen.
4. 11 1918 - Bewaffnete Matrosen befreien ihre Kameraden
Kiel * Bewaffnete Matrosen besetzen, unter dem Kommando der Soldatenräte, ohne Widerstand die Militärgefängnisse und befreien ihre Kameraden. Andere besetzen öffentliche Gebäude wie den Bahnhof und das Telegraphenamt.
4. 11 1918 - Österreichs Waffenstillstand entspricht einer Bedingungslosen Kapitulation
Padua * Der Waffenstillstand zwischen Österreich-Ungarn und den Alliierten wird in der Villa Giusti in der Nähe von Padua unterzeichnet. Er tritt um 15 Uhr in Kraft und kommt nahezu einer Bedingungslosen Kapitulation gleich.
4. 11 1918 - Die Vertreter der Berliner Reichsregierung werden freundlich begrüßt
Berlin - Kiel * Als am Abend zwei Abgesandte der Berliner Reichsregierung eintreffen, ist Kiel bereits fest in der Hand von 40.000 aufständischen Matrosen und Marinesoldaten. Der SPD-Abgeordnete Gustav Noske und der Staatssekretär ohne Geschäftsbereich Conrad Haußmann von der Fortschrittlichen Volkspartei - FVP werden jubelnd begrüßt. Noske wird von den Aufständischen sofort zum Gouverneur gewählt.
Dabei hat Noske nicht den „Eindruck, dass eine große Revolution begonnen hat“. Noch am gleichen Abend übernimmt er, „unter brausender Zustimmung“ der Arbeiter und Matrosen, den Vorsitz des Obersten Soldatenrates. Die meuternden Soldaten und revoltierende Arbeiter aus Kiel vertrauen dem prominenten Genossen aus Berlin.
4. 11 1918 - Die Hoffnung auf einen baldigen Frieden
München - Königreich Bayern * Selbst von militärischer Seite wird festgestellt: „Die Stimmung der Bevölkerung ist kriegsmüder, niedergeschlagener und verdrossener denn je. Nur die Hoffnung auf baldigen Friedensschluss hebt die Gemüter.“
4. 11 1918 - Eine düstere Wut auf die Sau-Preußen
München-Graggenau * König Ludwigs III. Sohn Prinz Franz hält sich in München auf. Prinzessin Wiltrud notiert in ihr Tagebuch: „Franz hatte eine Wut eine düstere auf die ‚Sau-Preußen‘, ‚das populärste wäre jetzt ein Krieg gegen die Preußen‘ - natürlich das darf man nicht, fügte er bei.“
Und weiter vertraut sie ihrem Tagebuch an: „Die Lage ist zum Verzweifeln, geschieht nicht bald etwas, ein Druck von Bayern auf Berlin, so haben wir die Revolution.“
Selbst gegen den Vorwurf der Preußenfreundlichkeit des bayerischen Königshauses bezieht Ludwig III. keine Stellung. Wieder Wiltrud: „Tag um Tag schien es uns dringlicher, dass Papa etwas öffentlich sagen sollte, dass er zu den Preußen nicht so gut stehe wie man dummerweise in München meint.“
4. 11 1918 - Kaiser Wilhelm II. verweigert Kronprinz Rupprecht den Oberbefehl
Lille * Kaiser Wilhelm II. besucht die 4. Armee und lehnt einen Rücktritt und Amtsverzicht ab.
Die Bitte des bayerischen Kronprinzen Rupprecht, um Übertragung des Oberbefehls an der Tiroler Grenze, um Bayern vor dem Vordringen der Italiener zu schützen, lehnt der Kaiser ab.
4. 11 1918 - Kurt Eisner scharrt Unterstützer um sich
München * Nachdem sich Kurt Eisner am Vortag der Unterstützung der Bauern versichert hatte, beginnt er nun eine Reihe von Gesprächen mit einflussreichen Persönlichkeiten, darunter
- Professoren der Münchner Universität, aber auch
- Münchner Arbeiterführer, die ihn bei den Januarstreiks unterstützt hatten, und
- Militaristen, die in wichtigen strategischen Positionen eingesetzt sind.
5. 11 1918 - Der Kieler Matrosenaufstand ist das Hauptgesprächsthema
München * Der Kieler Matrosenaufstand ist das Hauptgesprächsthema. Zu ihm ist es gekommen, nachdem die deutsche Admiralität am 29. Oktober in einem Himmelfahrtskommando das Auslaufen der Flotte gegen die Royal Navy befohlen hatte.Es kommt zu Meutereien, die schließlich in einem Aufstand gipfeln. Der Funke der Revolution hatte gezündet.
5. 11 1918 - Die USPD will im Hackerkeller eine Wahlversammlung abhalten
München-Theresienwiese * Die USPD will im Hackerkeller eine Wahlversammlung abhalten. Der Andrang ist aber so groß, dass der Saal viel zu klein ist und die Versammlung - im Dunkeln - auf der Theresienwiese durchgeführt werden muss. Das geschieht, ohne dass eine Erlaubnis dafür eingeholt worden war. Kundgebungen unter freiem Himmel sind während des Kriegszustands generell verboten. Die Polizei lässt zwar Ausnahmen zu, doch diesmal werden die Vorschriften einfach ignoriert - und die Behörden schreiten nicht ein.
Als der Redner Kurt Eisner in den Versammlungssaal kommt, findet er nur noch leere Gläser vor. Er muss seine Wählerversammlung suchen und findet eine große dunkle Masse bei der Bavaria. Es sollen 20.000 Menschen gekommen sein. Kurt Eisner mahnt zur Geduld und warnt vor einem sofortigen Aufbruch, da Münchens Erhebung am lichten Tage erfolgen wird. „Nur noch kurze Zeit. Aber ich setze meinen Kopf zum Pfande, ehe 48 Stunden verstreichen, steht München auf!“
5. 11 1918 - Die Revolution breitet sich von Kiel auf Lübeck und Brunsbüttel aus
Lübeck * Die Revolution breitet sich derweil von Kiel auf Lübeck und Brunsbüttel aus.
5. 11 1918 - Bereitschaft der Alliierten zu Waffenstillstandsverhandlungen
Washington - Berlin * US-Präsident Woodrow Wilson teilt der deutschen Regierung die Bereitschaft der Alliierten zu Waffenstillstandsverhandlungen mit. Der französische Marschall Ferdinand Foch wird ermächtigt, die deutsche Regierung zu empfangen.
5. 11 1918 - Noske will die Revolution im Keime ersticken
Kiel - Berlin * Den Mann, den die aufständischen Matrosen am Tag zuvor noch als ihren Richtigen erkannt und sogar zu ihrem Gouverneur ernannt haben, der MSPD-Abgeordnete Gustav Noske, telefoniert an diesem Abend nach Berlin und erklärt, dass er „nur eine Hoffnung hat: Die freiwillige Rückkehr zur Ordnung unter sozialdemokratischer Führung; dann wird die Rebellion in sich zusammen sinken“.
Reichskanzler Max von Baden setzt noch am selben Tag den Beschluss durch: „Freie Hand für Noske bei dem Versuch, den lokalen Ausbruch zu ersticken.“
5. 11 1918 - Dem Vorbild der revolutionären Kieler Matrosen folgen
Hamburg * Der eben aus der Haft entlassene und wegen seiner Beteiligung am Berliner Munitionsarbeiterstreik und des versuchten Landesverrats zu fünf Jahren Festungshaft verurteilte Wilhelm Dittmann fordert vor einer großen Menschenmenge in Hamburg, dem Vorbild der revolutionären Kieler Matrosen zu folgen.
Er verkündet: „Wir stehen vor entscheidenden Wendungen. Der Krieg hat zur Reife gebracht, was sonst noch Jahrzehnte erfordert hätte. Das Alte stürzt, und das Proletariat sieht sich über Nacht vor die Aufgabe gestellt, die politische Macht zu ergreifen. Alle Kleingeisterei und Angst vor der eigenen Unreife gilt es abzulegen.“
5. 11 1918 - 34 Münchner Grippetote an einem Tag
München * An diesem Tag zählt man alleine in München 34 Tote der Spanischen Grippe.
5. 11 1918 - König Ludwig III. lernte die Volkstimmung kennen
München - Karlsruhe * Der badische Gesandte in München berichtet nach Karlsruhe: Der bayerische König würde gerade „die Stimmung des Volkes kennenlernen“.
6. 11 1918 - Bayerns Parlamentarisierung in der Abgeordnetenkammer beschlossen
München-Kreuzviertel * Die Kammer der Abgeordneten stimmt dem „Königlichen Erlass über die Parlamentarisierung Bayerns“ vom 2. November im Landtag zu. Damit soll auch das Königsreich Bayern eine parlamentarische Monarchie werden.
Die Kammer der Reichsräte soll sich am 8. November 1918 mit dieser Vorlage beschäftigen.
6. 11 1918 - Der bayerische Innenminister von Brettreich beruhigt die Bevölkerung
München * Der bayerische Innenminister von Brettreich beruhigt die Bevölkerung, „dass sie gegen jegliche Willkür und Gewalttätigkeit den ausreichenden Schutz finden wird, den das ganze Volk von seiner Regierung erwartet“. Der Aufruf wird allerdings erst am 8. November veröffentlicht werden.
6. 11 1918 - Erhard Auer spricht zum Thema: Was wollen wir Sozialdemokraten?
München-Au * Im Franziskanerkeller spricht der SPD-Reichstagskandidat Erhard Auer zum Thema „Was wollen wir Sozialdemokraten“ und fordert
- die Abdankung des Kaisers und des deutschen Kronprinzen,
- die Ausschaltung aller reaktionären Elemente aus der politischen Verwaltung,
- die Änderung des Mannschaftsbeschwerdegesetzes,
- eine Arbeitslosenversicherung und
- den Achtstundentag.
Die Anwendung von Gewalt lehnt er ab.
6. 11 1918 - USPD und MSPD rufen gemeinsam zu einer Massenversammlung auf
München * Kurt Eisner [USPD] und Erhard Auer [MSPD] rufen auf großen Plakaten für den nächsten Tag zu einer gemeinsamen Massenversammlung auf der Theresienwiese auf. Obgleich Erhard Auer anfangs Bedenken hatte, gab er seine Zustimmung. Er hat erkannt, dass man der Friedenssehnsucht der Einwohner Münchens ein Ventil geben muss.
Es kommt auch deshalb zur ersten öffentlichen Zusammenarbeit der beiden sozialistischen Gruppierungen in Bayern seit der Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - USPD, weil Auers MSPD nicht gemeinsame Sache mit denen machen kann, die für die nationale Verteidigung eintreten und die Waffenstillstandsbemühungen bekämpfen. Über das damit verbundene Risiko ist sich Erhard Auer und die bayerische Regierung bewusst.
6. 11 1918 - Matthias Erzberger reist zu Waffenstillstandsverhandlungen
Washington - Berlin - Spa * Am Vormittag trifft in Berlin die Nachricht des US-Präsidenten Woodrow Wilson ein, dass der Oberkommandierende der Alliierten Streitkräfte, Marschall Ferdinand Foch, bereit sei, eine deutsche Waffenstillstandsdelegation in Compiégne zu empfangen.
Nachdem die Reichsregierung das Ansinnen der Obersten Heeresleitung - OHL, einen militärischen Vertreter zum Verhandlungsleiter zu ernennen, ablehnt, wird noch am selben Tag der Staatssekretär Matthias Erzberger - gegen seinen Willen - mit der Aufgabe betraut und an der Spitze der Abordnung auf den Weg geschickt. Weitere Mitglieder der deutschen Verhandlungs-Abordnung sind der Leiter für Heeresangelegenheiten General Detlof von Winterfeldt, der Kapitän zur See Ernst Vanselow und als Vertreter des Auswärtigen Amtes Alfred von Oberndorff.
Er muss jedoch sich zuvor im Großen Hauptquartier der Obersten Heeresleitung -OHL noch Instruktionen abholen. Der Reichsregierung ist es wichtig gegenüber den Alliierten das politisch erneuerte Deutschland zu demonstrieren. Dazu eignet sich ein ziviler Politiker an der Spitze der Waffenstillstands-Kommission ganz besonders. Die Deutschen hoffen auf einen „milden Frieden“ auf der Grundlage des 14-Punkte-Programms, das der US-Präsident Woodrow Wilson am 8. Januar 1918 verkündet hatte.
6. 11 1918 - Weitere revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte bilden sich
Hamburg - Bremen - Wilhelmshaven * In Altona, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Flensburg, Hamburg, Neumünster, Oldenburg, Rendsburg, Rostock und Wilhelmshaven erheben sich revolutionäre Arbeiter und Soldaten und bilden Arbeiter- und Soldatenräte.
6. 11 1918 - Die Münchner Erdbebenwarte verzeichnet zwei starke Erdstöße
München * Die Münchner Erdbebenwarte verzeichnet und 8:22 Uhr und um 8:48 Uhr zwei starke Erdstöße.
6. 11 1918 - Kriegsminister Hellingrath und Erhard Auer beruhigen die Minister
München-Kreuzviertel * Am Nachmittag trifft sich das ausscheidende Kabinett mit dem neuen Reform-Kabinett unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Otto von Dandl. Das eine Kabinett ist nicht mehr handlungsfähig, das andere wird seine Aufgabe erst am 8. November übernehmen. Sorgenvoll blicken sie auf die Massenkundgebung von USPD und MSPD auf der Theresienwiese am nächsten Tag. Man überlegt sogar, Kurt Eisner vorsorglich verhaften zu lassen.
Kriegsminister Philipp von Hellingrath erklärt: „Es gibt unruhige und unzuverlässige Elemente auch in der bayerischen Armee, aber, meine Herren, Sie können ganz beruhigt sein. Die Armee als Ganzes ist noch fest in unserer Hand. Es wird nichts passieren.“
Der Vorsitzende der bayerischen Mehrheitssozialdemokraten, Erhard Auer, erklärt: „Reden Sie doch nicht immer von Eisner. Eisner ist erledigt. Sie dürfen sich darauf verlassen. Wir haben unsere Leute in der Hand. Ich gehe selbst mit im Zug. Es geschieht gar nichts.“
Dennoch trifft die Regierung Vorkehrungen für den Fall von Gewaltanwendung. Die stationierten Truppen werden in Alarmbereitschaft versetzt und mit Gewehren und Tränengas bewaffnet.
6. 11 1918 - Prinzessin Wiltrud: „Jetzt wird‘s ernst!“
München-Graggenau * Prinzessin Wiltrud schreibt in ihr Tagebuch: „Jetzt wird‘s ernst!“, nachdem in der weitläufigen Residenz berittene Gendarmen und andere Schutzleute sowie Soldaten zusammen gezogen wurden.
6. 11 1918 - Ebert: Die letzte Gelegenheit zur Rettung der Monarchie
Berlin * Der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert erscheint in der Reichskanzlei, wo sich auch Generalquartiermeister Wilhelm Groener befindet. Ebert, der die Monarchie als solche noch immer retten will, fordert ultimativ die Abdankung des Kaisers, „wenn man den Übergang der Massen in das Lager der Revolutionäre verhindern will“. Das, so Ebert weiter, ist „die letzte Gelegenheit zur Rettung der Monarchie“.
Als Groener den Vorschlag als indiskutabel ablehnt, erklärt Ebert: „Wir danken Ihnen, Exzellenz, für die offene Aussprache und werden uns stets gern der Zusammenarbeit mit Ihnen während des Krieges erinnern. Von nun an trennen sich unsere Wege. Wer weiß, wo wir uns je wieder sehen werden.“
6. 11 1918 - Ohne Bauern keine Revolution
München * Kurt Eisner erklärt: „Wenn die Bauern nicht mittun, ist die Revolution unmöglich.“
6. 11 1918 - Radikale und unbelehrbare Angestellte
München * Das Kriegsministerium berichtet über Berichte von Vertrauensleuten, wonach sich „die Arbeiter weit ruhiger als die Angestellten“ verhalten. Die Angestellten sind „weit radikaler und unbelehrbarer, ja fast ausnahmslos Anhänger der USPD“.
Tatsächlich zeigen die wenigen Teilnehmerlisten von USPD-Versammlungen ein eindeutiges Übergewicht von Angestellten und Handwerkern gegenüber der Arbeiterschaft. „Die USPD ist eine Partei von Angehörigen des Mittelstands, die die revolutionäre Potenz der Arbeiterschaft für ihre Revolution verwenden“ will.
6. 11 1918 - Einen gefährlichen Brand in seinem Beginne löschen
München - Königreich Bayern * Der Bayerische Kurier, eine führende Zeitung des Zentrums, ruft nach der Kieler Matrosenrevolte unter der Überschrift „Bedenkliche Vorkommen in Kiel“ alle „staatstreuen Kräfte des Volkes“ auf, Hand anzulegen, „um einen gefährlichen Brand in seinem Beginne zu löschen“.
Verwundert stellt die Zeitung fest, dass die Anhänger einer staatlichen Ordnung wie von Winde verweht scheinen und fragt, „ob denn die Männer, welche ihre Stimme zu erheben berufen sind, in die Ecken verkrochen sind“.
6. 11 1918 - Das Militär ist von der neuen Regierung völlig unbeeindruckt
Berlin * Da sich das Militär völlig unbeeindruckt von der neuen Regierung zeigt und die deutschen Wehrbehörden auch weiterhin junge Männer zum Wehrdienst einziehen, als sei nichts geschehen, protestieren die Unabhängigen Sozialdemokraten gegen die Fortsetzung des Krieges und rufen die Arbeiterschaft auf, sich bereitzuhalten.
Denn „die Geschicke des deutschen Volkes werden durch dunkle Mächte gelenkt, die bereit sind, das Verderben des Volkes zu vollenden“. Sie zählen zu den „Mächten der Finsternis“ offenbar auch die „Regierungssozialisten“ mit ihren Aufrufen, die Ruhe zu bewahren: „Jede selbstständige freie Betätigung der Massen soll unterdrückt werden.“
6. 11 1918 - Informationen, dass die USPD einen großen Schlag plant
München * Die Polizeidirektion informiert das Innenministerium, dass ihre Überwachungsmaßnahmen „mit Sicherheit“ festgestellt haben, dass die Münchner USPD nach der großen Friedenskundgebung am 7. November einen „großen Schlag plane“. Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich weist daraufhin die Polizeidirektion an, „jede zulässige Maßnahme zur Unterbindung einer solchen Aktion vorzubereiten“. Gleichzeitig wird das Kriegsministerium informiert.
Kriegsminister Philipp von Hellingrath versichert, dass in München genügend zuverlässige Truppen sind, die eventuelle Unruhen unterdrücken werden. Den Schutz der Haupt- und Residenzstadt sollen die in München stationierten Truppen übernehmen. Die Polizei wird mit uniformierten Schutzleuten die Residenz, die Preußische Gesandtschaft und die Polizeigebäude schützen. Die übrigen Polizisten sollen in Zivil die Stimmung in der Stadt erkunden.
6. 11 1918 - Ein Aufruf zur Friedenskundgebung am 7. November 1918
München * Die sozialdemokratische Münchener Post veröffentlicht auf der Titelseite im Auftrag der Leitung der sozialdemokratischen Partei Münchens einen Aufruf „An die Bevölkerung Münchens!“. Darin heißt es:
- „Die sozialdemokratische Partei ruft die Bevölkerung Münchens mit Ausnahme der beim Transport und Verkehr beschäftigten Personen auf, am Donnerstagnachmittags 3 Uhr auf der Theresienwiese zu erscheinen.
- Es gilt, im Geiste der Freiheit und Verantwortung Stellung zu nehmen zu den großen Tagesfragen, die in der letzten Vertrauensmännerversammlung der gesamten Münchener Arbeiterschaft erörtert worden sind.
- Die Vertrauensleute der Partei und Gewerkschaften werden aufgefordert, dabei mitzuwirken, daß die Demonstration einen der organisierten Arbeiterschaft würdigen Verlauf nimmt“.
7. 11 1918 - Das Teilnahmeverbot der Soldaten wird zurückgenommen
München-Theresienwiese * Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei - USPD hat zu einer Kundgebung auf die Theresienwiese eingeladen. Um die Kontrolle über die Münchner Arbeiterschaft nicht ganz zu verlieren, haben sich die Gewerkschaften und die MSPD dieser Einladung angeschlossen.
Soldaten ist zunächst die Teilnahme an der Versammlung von der Stadtkommandatur verboten worden. Zwei MSPD-Abgeordnete, darunter Erhard Auer, veranlassen, dass die Anordnung durch Kriegsminister Philipp von Hellingrath aufgehoben wird. Soldaten, die keinen Dienst haben, wird erlaubt, die Kaserne zu verlassen. Ein Teil der Soldaten wird als Bereitschaft zurück behalten.
7. 11 1918 - Die Waffenstillstandsverhandlungen haben begonnen
München * Bayerns Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich gibt in einem Aufruf bekannt: „Die Waffenstillstandsverhandlungen sind im Gang, sie werden baldigst zum Abschluss kommen.“ Und dann: „Jetzt gilt es erst recht, Ruhe und Ordnung zu wahren. Innere Unruhen anstiften, hieße den Krieg noch mal beginnen.“ Eine Variation des alten und sattsam bekannten Spruchs: „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht!“
Dahinter verbirgt sich sicherlich auch die Angst vor eventuellen Ausschreitungen und Unruhen, denn für den Nachmittag des selben Tages haben die Mehrheitssozialdemokraten und die Unabhängigen zu einer gemeinsamen Versammlung auf der Theresienwiese eingeladen.
7. 11 1918 - Der Königliche Staatsrat drängt den König zur Flucht
München-Maxvorstadt * Um 19 Uhr erklärt Kriegsminister Philipp von Hellingrath, er sei machtlos, da ihm in der Stadt keine Truppen mehr zur Verfügung stehen. Er will noch versuchen, mit Truppen außerhalb Münchens in Verbindung zu treten.
Ihr Fazit lautet: „Da nach den vorliegenden polizeilichen Meldungen damit gerechnet werden muss, dass die Revolutionäre in der Nacht außer den Ministerien auch die Residenz besetzen und den König sowie die kranke Königin behelligen und versuchen werden, den ersteren zur Abdankung zu zwingen, sind alle Minister der Ansicht, dass der König mit seiner nächsten Familie vorerst bis zur Klärung der Lage München verlasse.“
Ministerpräsident Otto von Dandl und Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich überbringen den Rat an König Ludwig III.. Dieser erklärt sich damit „ohne Weiteres einverstanden“.
7. 11 1918 - Thomas Mann beschimpft die Revolutionäre als albernes Pack
München-Bogenhausen * Thomas Mann beschimpft die Revolutionäre als „albernes Pack“.
7. 11 1918 - SPD-Forderungen an Reichskanzler Max von Baden
Berlin * Die SPD-Reichstagsfraktion und der SPD-Vorstand stellen eine Reihe von Forderungen an den Reichskanzler Max von Baden. Die Wichtigste beinhaltet
- den Rücktritt des Deutschen Kaisers und
- den Thronverzicht des Kronprinzen bis zum Mittag des nächsten Tages.
Bei Nichterfüllung der Forderungen will die SPD aus der Regierung austreten.
7. 11 1918 - Weitere Arbeiter- und Soldatenräte werden gebildet
Braunschweig - Frankfurt am Main - Hannover - Lüneburg - Schwerin * Unter anderem in Braunschweig, Frankfurt am Main, Hannover, Lüneburg und Schwerin haben sich revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte gebildet.
7. 11 1918 - Auch die Residenzwache verlässt ihren Posten
München-Graggenau * Um 19 Uhr verlässt die Residenzwache ihren Posten und folgt damit dem Beispiel der anderen Münchner Truppen. Selbst die Hartschiere, deren Motto lautet: „Nur über unsere Leichen zum Thron“, rühren keinen Finger für den Erhalt der bayerischen Monarchie.
7. 11 1918 - Kein Soldat, kein Polizist hält auch nur einen einzigen Revolutionär zurück
München * Während der Bayerische Landtag über die Sicherung der Kartoffelversorgung in den Stadten berät, hält kein Soldat oder Polizist auch nur einen einzigen Revolutionär zurück. Eisners Revolution hätte wohl auch dann niemand aufgehalten, wenn er in der Residenz einmarschiert wäre. Selbst das Militär steht zuletzt auf Seiten der Rebellen.
7. 11 1918 - Um 15 Uhr beginnt die Kundgebung auf der Theresienwiese
München-Theresienwiese * Um 15 Uhr beginnt die politischen Veranstaltung auf der Theresienwiese, an der sich etwa 40.000 Menschen beteiligen. Andere Quellen sprechen von über 100.000, sogar von 200.000 Teilnehmern.
7. 11 1918 - Die Revolutionäre besetzen den Bayerischen Landtag
München-Kreuzviertel * Gegen 22 Uhr nehmen die Revolutionäre dem völlig fassungslosen Pförtner des Bayerischen Landtags die Gebäudeschlüssel ab. Da nun auch die Bauernräte hinzustoßen, wird ein Provisorischer Nationalrat konstituiert, der bis zur Wahl eines Landtages bestehen bleiben soll.
7. 11 1918 - Die wichtigsten Institutionen sind in den Händen der Aufständischen
München * Um 22 Uhr sind der Hauptbahnhof und kurz darauf die Post sowie das Telegraphenamt ebenso wie alle Ministerien, das Polizeipräsidium und die wichtigsten Zeitungsverlage kampflos in die Hände der Aufständischen gefallen.
7. 11 1918 - Die Arbeiter- und Soldatenräte wählen Kurt Eisner zu ihrem Vorsitzenden
München-Au - München-Ludwigsvorstadt * Kurt Eisner zieht sich nach der Einnahme der Guldein-Schule in den Franziskaner-Keller an der Hochstraße zurück. Sicher auch, um einer eventuellen Verhaftung zu entgehen. Als er erfährt, dass der Hauptteil der Soldaten und der Arbeiter zum Mathäserbräu ziehen, begibt er sich auch dort hin.
Im Erdgeschoss wird er von den anwesenden Arbeitern zum Ersten Vorsitzenden des Arbeiterrats gewählt. Sein Stellvertreter wird Hans Unterleitner. Anschließend begeben sich er und weitere Mitglieder des Arbeiterrats in das Obergeschoss, in dem er sich mit den Führern des Soldatenrats zur gemeinsamen Sitzung zusammentrifft. Damit ist der Arbeiter- und Soldatenrat gegründet.
7. 11 1918 - Sämtliche Kasernen sind in der Hand der Revolutionäre
München * Um 21 Uhr sind alle Kasernen in der Hand der Revolutionäre. Der Umsturz ist damit im Wesentlichen vollzogen. Der erste Schritt der Revolution besteht damit aus einer Soldatenmeuterei.
Oskar Maria Graf schreibt: „Die meisten Kasernen übergaben sich kampflos. Es kam auch schon ein wenig System in dieses Erobern: Eine Abordnung stürmte hinein, die Masse wartete. In wenigen Minuten hing bei irgend einem Fenster eine rote Fahne heraus, und ein mächtiger Jubel erscholl, wenn die Abordnung zurück kam.“
Im Gegensatz zum Januarstreik wird der Umsturz von Soldaten dominiert. Die im Januar so aktiven Krupp-Arbeiter werden in keinem Bericht erwähnt.
7. 11 1918 - Die Winzerer-Fähndl Armbrustschützengilde verpasst die Revolution
München * Die Mitglieder der Winzerer-Fähndl Armbrustschützengilde halten ihre Ordentliche Hauptversammlung ab. Der 1. Schützenmeister gibt darin einen kurzen Kommentar zur allgemeinen Lage wieder, der vom „deutschen Ersuchen um Waffenstillstandsverhandlungen“ gezeichnet ist. Als die 17 Winzerer auseinander gehen, ist König Ludwig III. bereits aus der Residenz geflohen.
7. 11 1918 - Die meisten Belegschaften erhalten für die Kundgebung frei
München * Für die Dauer der Massendemonstration hat der Stadtmagistrat die Schließung der städtischen Büros verfügt und den Arbeiterinnen und Arbeitern den Nachmittag unter Fortzahlung des Lohnes arbeitsfrei gegeben. Die meisten gewerblichen Betriebe und Geschäfte sind bereits ab Mittag geschlossen.
7. 11 1918 - Eine Revolution ohne Blutvergießen
München * München ist kampflos und ohne Blutvergießen gefallen. Der schnelle und unblutige Sieg der Revolution ist jedoch nur deshalb möglich, da fast alle Bevölkerungsschichten kein Vertrauen mehr in die alten Herrschaftsträger haben und das Regime dem Umsturz nichts entgegensetzen kann.
Dabei hätte doch nur „ein einziges zuverlässiges Bataillon genügt, dem Revolutionsspuk ein Ende zu machen“. Doch ein solches Bataillon gibt es nicht mehr!
7. 11 1918 - Gemeinsame Forderungen von SPD und USPD formuliert
München * Am Vormittag treffen sich die Veranstalter der Kundgebung, USPD und SPD, im Gewerkschaftshaus zur Abstimmung des Ablaufs der Massendemonstration. Sie einigen sich auf einen gemeinsamen, acht Punkte umfassenden Forderungskatalog. Er beinhaltet:
- Den sofortigen Abgang des Kaisers und den Verzicht seines Thronfolgers.
- Die Vereidigung des deutschen Heeres auf die Verfassung.
- Die Beseitigung aller Verfassungsbestimmungen, die der Freiheit des gesamten deutschen Volkes entgegenstehen und den Ausbau Deutschlands zu einem demokratischen Staatswesen hemmen.
- Ausschaltung aller reaktionären Elemente aus der politischen Verwaltung und völlige Demokratisierung der Verwaltungsorganisation.
- Annahme der Waffenstillstandsbedingungen; grundsätzliche Ablehnung des von den Alldeutschen propagierten Gedankens der nationalen Verteidigung.
- Sofortige Ergreifung aller Maßregeln, welche die Ordnung, Sicherheit und Ruhe bei Abrüstung und Heimbeförderung der Truppen verbürgen.
- Schaffung wirksamster Garantien für das Beschwerderecht der Soldaten.
- Umfassende soziale Fürsorgemaßnahmen für die Notleidenden; Arbeitslosenversicherung; achtstündiger Arbeitstag.
Bei der Besprechung hat Kurt Eisner „darauf aufmerksam gemacht, dass die Massen doch vielleicht etwas anderes wollen als eine Art feierlichen Spaziergangs“.
7. 11 1918 - Die Revolutionäre fordern die Soldaten zum Mitmachen auf
München * Unter der Führung von Kurt Eisner, Ludwig Gandorfer, Felix Fechenbach, Hans Unterleitner und weiteren 2.000 Arbeitern und Soldaten ziehen sie zu den Kasernen und überreden die kriegsmüden Soldaten zum mitmachen. Zuerst eine Kraftwagenkolonne in der Kazmairstraße, dann eine Landsturm-Kompanie in der Gudeinschule.
Im weiteren Verlauf schließen sich auch die Truppen in der Marsfeld-Kaserne, Türkenkaserne und der Max-II-Kaserne den Demonstranten an. Unterwegs befreien sie die Kameraden, die wegen irgendeiner Aufsässigkeit im Militärgefängnis einsitzen. Aus Versehen befreien sie die Bewacher gleich mit, die sich beim Herannahen der revolutionären Arbeiter selbst in die Zellen eingesperrt haben.
7. 11 1918 - Die Revolutionäre richten im Mathäserbräu ihr Standquartier ein
München * Kurt Eisner und seine Unabhängigen ist es trotz ihrer kleinen Zahl gelungen, die Mehrheitssozialdemokraten auszumanövrieren. Auf dem Weg schließen sich ihnen weitere Arbeiterinnen und Arbeiter, Zivilisten, Männer und Frauen aber auch Kinder an. Auf einmal sind es Zehntausende. Im Mathäser-Bräu richten sie das Standquartier der Arbeiter- und Soldatenräte ein.
Oskar Maria Graf schreibt: „Der Marsch hatte begonnen und war unaufhaltsam. Keine Gegenwehr kam. Alle Schutzleute waren wie verschwunden. Aus den vielen offenen Fenstern schauten neugierig Menschen auf uns herunter. Überall gesellten sich neue Trupps zu uns, nun auch schon einige Bewaffnete. Die meisten Menschen lachten und schwatzten, als ging‘s zu einem Fest. […] Die ganze Stadt schien zu marschieren.“
7. 11 1918 - Eine aufgebrachte und wütende Menschenmasse vor der Residenz
München-Graggenau * Vor der Residenz fordert eine aufgebrachte Menschenmenge „Runter mit dem Millibauern, runter mit der Topfenresl!“
7. 11 1918 - Eine Versammlung nach den Vorstellungen Erhard Auers
München-Theresienwiese * Die Versammlung verläuft zunächst ganz nach den Vorstellungen Erhard Auers. Die Mehrheitssozialdemokraten und die Gewerkschafter marschieren geschlossen an. Um 15:15 Uhr beginnen die Ansprachen, dafür sind 15 Minuten vorgesehen. Der MSPD-Führer und weitere Funktionäre halten ihre Reden an der Bavaria, in der sie hervorheben, dass die Sozialdemokratische Partei
- weder zum Streik noch zur Revolution auffordert, sondern
- die Entwicklung zum Volksstaat auf parlamentarischen Wegen erreichen möchte.
Um 15.45 Uhr lassen sie dann über eine Resolution abstimmen, danach löst sich die Versammlung auf. Nun formieren sich die Teilnehmer zur großen Friedensdemonstration. Mit einem Musikkorps an der Spitze marschiert der größte Teil der Massendemonstration unter Führung von Erhard Auer in vollkommener Disziplin über die Landwehrstraße, Sonnenstraße, Karlsplatz, Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Brienner Straße, Residenzstraße, Maximilianstraße und schließlich längs der Isar entlang bis zum Friedensengel. Hier löst sich der Protestmarsch nach einer kurzen Schlussansprache des MSPD-Reichstags- und Landtagsabgeordneten Franz Schmitt auf.
7. 11 1918 - Die revolutionären Vorgänge sind in Kiel bereits beendet
Kiel - München * Als in München die revolutionären Vorgänge beginnen, sind sie in Kiel bereits beendet. Der Einfluss von Gustav Noske war so groß, dass er die Revolution in Kiel im Sinne der Obersten Heeresleitung - OHL, der Reichsregierung und der Sozialdemokratischen Partei - SPD „ersticken“ und „zurückrollen“ kann.
7. 11 1918 - Abdankung oder Revolution
Berlin * Reichskanzler Prinz Max von Baden bittet Friedrich Ebert zu einem Vieraugengespräch in die Reichskanzlei. Max von Baden will Kaiser Wilhelm II. im Hauptquartier der Obersten Heeresleitung - OHL in Spa zum Thronverzicht auffordern. Er will von Ebert wissen: „Habe ich Sie dann auf meiner Seite im Kampf gegen die soziale Revolution?“. Ebert antwortet ganz unzweideutig: „Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde.“
Die Reise findet nicht mehr statt. Die Revolution ist schneller.
7. 11 1918 - Wenn Versammlungsverbot - dann Revolution
Berlin * Die Unabhängige Sozialdemoktatische Partei - USPD hat für den Abend 26 Versammlungen angesetzt. Die Regierung will diese verbieten.
Friedrich Ebert und die SPD sind davon überzeugt, dass ein Versammlungsverbot umgehend die Revolution auslösen würde. Deshalb fordert Ebert vom Reichskanzler Prinz Max von Baden: „Heute abend müssen wir das Ultimatum von jeder Tribüne verkünden, sonst läuft uns die ganze Gesellschaft zu den Unabhängigen. Der Kaiser muss sofort abdanken, sonst haben wir die Revolution.“
7. 11 1918 - Lorenz Winkler wird Mitglied des Revolutionären Arbeiterrats
München * Lorenz Winkler, der bereits als Aktivist beim Münchner Januarstreik in Erscheinung getreten ist, wird Mitglied des Revolutionären Arbeiterrats.
7. 11 1918 - Die Beamten haben dem Volkswohl zu dienen
München - Königreich Bayern * Der Bayerische Verkehrsbeamtenverein schreibt in Hinblick auf die Kieler Matrosenaufstände und der Anspielung des Bayerischen Kuriers auf die Beamten vom Vortag: „Die Beamten haben unbekümmert um die politischen Vorgänge dem Volkswohl zu dienen; sie haben durch rastlose, ununterbrochene Arbeit Handel und Wandel aufrechtzuerhalten und insbesondere alles zu vermeiden, was einer regelmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel, Brennmaterial usw. hinderlich wäre.
Die Wandlung, die sich im Staate vollzieht, muss der Beamte über sich ergehen lassen. Nur dann dient er seinem Volke. Der werdende Volksstaat braucht unbeeinflusste Diener und die wird er in der derzeitigen Beamtenschaft finden“.
7. 11 1918 - Geinsames Flugblatt zum Umsturz entworfen
München * Vertreter der Interessengemeinschaft des Bayerischen Verkehrsbeamtenvereins, des Bayerischen Eisenbahnerverbandes und des Verbandes des bayerischen Post- und Telegraphenpersonals entwerfen ein gemeinsames Flugblatt, das zu einem möglichen Umsturz Stellung nehmen soll.
7. 11 1918 - Noch ist in der Residenz alles ruhig
München-Graggenau * In der Residenz läuft noch alles seinen gewohnten Gang. Die Töchter des Hauses besuchen am Vormittag die heilige Messe, während König Ludwig III. Audienz hält.
Gegen Mittag verlassen die Bayern-Prinzessinnen Helmtrud und Wiltrud gemeinsam mit der Hofdame Bertha von Wulffen die Residenz, um im Englischen Garten spazieren zu gehen. Als sie sich bereits auf dem Rückweg befinden, treffen sie den König in Begleitung des Barons Bodmann. Ein aufgeregter Radfahrer kommt ihnen entgegen, der die Damen auffordert, wegen der vermehrt aufziehenden Demonstranten möglichst schnell zur Residenz zurückzukehren.
Der als Radfahrer verkleidete Polizist will zudem wissen, wo sich der König in etwa aufhält. Es ist wohl dieser Polizist, der den König zur Rückkehr in die Residenz auffordert und nicht wie oft dargestellt, dass Arbeiter den König zum heimgehen aufgefordern, „weil Revolution is“. So, als ob in Bayern so etwas wie eine Revolution an der Tagesordnung und der Beginn genau so vorgegeben ist wie der Einzug der Wiesnwirte aufs Oktoberfest.
7. 11 1918 - Die Stimmung beim Abendessen ist eher gedrückt
München-Graggenau * Die vom Spaziergang heimkehrenden Prinzessinnen werden mit Parolen wie: „Der Kaiser soll abdanken! Nieder mit Wilhelm! Nieder mit dem Haus Wittelsbach! Nieder mit der Dynastie! Nieder mit dem Haus Habsburg! Die Republik soll leben!“ konfrontiert. Auch „Vom Millibauern, Papas Spitznamen, schrien sie etwas.“ Diese und weitere Wahlsprüche vermerkte Prinzessin Wiltrud jedenfalls in ihrem Tagebuch.
Die Stimmung beim Abendessen ist eher gedrückt. Es gibt Hirschkalbsbraten, Kartoffelnudeln und Erbsen. Prinzessin Wiltrud greift beherzt zu: „Ich nahm zwei Stücke, denkend es ist gut, wenn man bei Kräften ist, wer weiß, wann wir wieder ein solches Essen bekommen.“
7. 11 1918 - Das Beratungsergebnis des Ministerrats wird dem König mitgeteilt
München-Graggenau * Ministerpräsident Otto von Dandl und Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich überbringen das Ergebnis der Beratungen des Ministerrats an König Ludwig III., der sich damit „ohne Weiteres einverstanden“ erklärt. „Wir müssen fort - und zwar gleich“, sagt der König zu seiner anwesenden Familie. Für Dandl heißt das freilich, dass sich lediglich die königliche Familie auf den Weg ins vorläufige Exil machen darf. Die „Damen“ und „Jungfrauen“ müssen bleiben.
Als sich die erste Hektik gelegt hat, zaudert der König mit seinem Schicksal. Hat man ihm doch nach der Rückkehr vom Englischen Garten in die Residenz noch versichert, dass man die Lage voll im Griff habe. Als aber die ersten Demonstranten vor der Residenz aufziehen, sagt man dem König, man kann für seine Sicherheit nicht mehr garantieren; es empfehle sich, die Stadt möglichst schnell und unauffällig zu verlassen.
„Dass man mich gar nicht über die Lage unterrichtet hat!“, klagt er, „hab‘ ich denn niemand, der sich um mich hätte annehmen können?“.
7. 11 1918 - Hände rein halten von Geld und von Blut
München * Der Journalist Victor Klemperer, nicht gerade ein enger Vertrauter Kurt Eisners, der der USPD eher distanziert gegenüber steht, schreibt am 22. Februar 1919 in einem Nachruf auf Kurt Eisner in den Leipziger Neuesten Nachrichten nachstehende Zeilen:
„Keiner zweifelte an Eisners völlig reinen Absichten. Er wollte nichts für seine Person, er war, obwohl ihn die Plötzlichkeit seines Aufstiegs natürlich mit Selbstbewusstsein erfüllt hatte. […] Er wollte seine Hände rein halten von Geld und von Blut. Er hatte immer den besten Willen, und er setzte bei anderen Menschen […] die gleiche Seelenunschuld voraus.“
7. 11 1918 - Eine vollkommen hilflose geschäftsführende bayerische Regierung
München-Maxvorstadt * Im Kriegsministerium trifft sich der Königliche Staatsrat zur Lagebesprechung. Um 17 Uhr muss Kriegsminister Philipp von Hellingrath eingestehen, dass er keinen Rat mehr weiß, die Unruhe und den Aufstand mit militärischen Mitteln zu unterdrücken.
In München stellen nur noch die Gewerkschaften eine durchorganisierte Macht dar. Doch deren Mitglieder sind nun nicht mehr bereit, eine Dynastie zu retten, die sich seit Jahrhunderten auf ihre Klassenprivilegien stützte und erst weniger als eine Woche zuvor den parlamentarisch-demokratischen Reformen ihre Zustimmung gab.
7. 11 1918 - Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt - die bayerische Republik gegründet
München-Kreuzviertel * Gegen 22:30 Uhr steht Kurt Eisner am Präsidentenpodium und erklärt im Namen des Arbeiter- und Soldatenrats die Dynastie Wittelsbach für abgesetzt und die bayerische Republik für gegründet.
Er fährt fort: „Jetzt müssen wir zur Bildung einer Regierung fortschreiten. […] Der, der in diesem Augenblick zu Ihnen spricht, setzt Ihr Einverständnis voraus, dass er als provisorischer Ministerpräsident fungiert.“
Der anschließend einsetzende begeisterte Applaus bestätigt ihm die Annahme. Kurt Eisner ist damit bayerischer Ministerpräsident.
7. 11 1918 - Das erste gedruckte Dokument der Revolution erscheint
München * Ein gelbes Flugblatt, datiert vom Donnerstag, 7. Nov. 1918, nachts 11 Uhr, ist das erste gedruckte Dokument der Revolution. Es schließt mit der Parole: „Es lebe der Frieden! Nieder mit der Dynastie! Der Arbeiter- und Soldatenrat.“ Der Name Kurt Eisner taucht noch nicht auf.
7. 11 1918 - Soldaten sprechen den Arbeitern Mut zu
München * Polizeibeamte in Zivil, die die Stimmung in der Stadt beobachten sollen, melden schon am Vormittag, dass Truppenteile, besonders Mannschaften an den Maschinengewehren, „unzuverlässig“ sein sollen. Vorübergehenden Arbeitern rufen die Soldaten zu, sie sollen ohne Sorge sein, da sie Schießbefehle verweigern würden.
7. 11 1918 - Eine erste Initiative zur Bildung von Räten
München * Um 15 Uhr wird eine erste Initiative zur Bildung von Räten beobachtet. Eine kleine Gruppe von Soldaten findet sich „unter der Parole: Schaffung von Soldatenräte“ zusammen. Nach einem Bericht der Münchener Post fordert ein USPD-Redner die „sofortige Einsetzung eines Arbeiter- und Soldatenrats“ bereits als die Mehrheitssozialdemokraten und Gewerkschafter zur Demonstration aufbrechen.
7. 11 1918 - Im Auftrag des Soldatenrats
München-Maxvorstadt * Um 20:12 Uhr ergreift ein Unteroffizier „im Auftrag des Soldatenrats“ vom Hauptbahnhof Besitz. Demnach gibt es zu diesem Zeitpunkt wohl offiziell einen Soldatenrat.
7. 11 1918 - Räte besetzen die Druckerei der Münchner Neuesten Nachrichten
München * Um 23 Uhr besetzen die Räte die Druckerei der Münchner Neuesten Nachrichten. Dadurch kann am nächsten Morgen die Proklamation Kurt Eisners in die Öffentlichkeit getragen werden.
7. 11 1918 - Die Räte sollen den Ablauf des Umsturzes organisieren
München-Ludwigsvorstadt * Der Mathäserbräu wird aufgrund seiner zentralen Lage zwischen Hauptbahnhof, Wittelsbacher Palais, Landtagsgebäude, Außenministerium, Residenz und Polizeipräsidium als Hauptquartier der Revolutionsbewegung ausgewählt. Die Funktion der spontan entstandenen revolutionären Arbeiter- und Soldatenräte besteht zunächst darin, den Ablauf des Umsturzes zu organisieren und seinen Erfolg sicherzustellen.
Die Räte fungieren als Organe der Revolution. Sie leiten umgehend Maßnahmen ein:
- Bewaffnete Soldaten patrouillieren auf Lastkraftwagen die Nacht hindurch und sollen - wenn nötig - die Ordnung aufrecht erhalten.
- Vor den wichtigen öffentlichen Gebäuden werden Wachen aufgestellt.
- Die Verkehrs- und Nachrichtenzentren werden übernommen.
- Die wichtigen Zeitungsredaktionen und Verlagshäuser werden besetzt, um Bekanntmachungen zu drucken und die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen.
7. 11 1918 - Wie Bischof Faulhaber die Umsturznacht erlebt
München-Kreuzviertel * Erzbischof Michael von Faulhaber notiert in der Umsturznacht in sein Tagebuch: „Nachmittag, 15:00 Uhr, auf der Theresienwiese Versammlung. Von den Sozialdemokraten gedacht als Exploron, um das Volk zufrieden zu stellen, wollten den Unabhängigen den Wind aus den Segeln nehmen. Im Zug wohl einige Tafeln: Nieder die Dynastie, (eine andere: Das Weib keine Gebärmaschine) sonst aber ruhig und viele Harmlose dabei. […] Dabei schwenkte unter der Roten Fahne eine Soldatengruppe ab, ‚zu den Kasernen‘ und diese Soldaten haben die Revolution gemacht. […]
Nachts, 23:00 Ihr, beginnt der Lärm auf der Straße. Militär, bewaffnet, erst zu Fuß, allmählich mit Lastautos, die fortwährend mit furchtbarem Lärm herumrasen, mit Maschinengewehr ausgerüstet und die Bevölkerung bestürzen sollen. Die schrecklichste Nacht meines Lebens“.
8. 11 1918 - Erste Sitzung der Revolutionäre im Landtagsgebäude
München-Kreuzviertel * Kurz nach Mitternacht hält der neu gebildete Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat im Sitzungssaal der Abgeordnetenkammer im Landtagsgebäude an der Prannerstraße - unter der Leitung Kurt Eisners - seine erste Sitzung ab.
Kurt Eisner proklamiert die demokratische und soziale Republik Bayern, den Freistaat Bayern. Die Monarchie ist damit gestürzt, die Republik geboren. In seiner Rede bemerkt Eisner: „Die bayerische Revolution hat gesiegt. Sie hat den alten Plunder der Wittelsbacher Könige hinweggefegt.“
„Bayern ist fortan ein Freistaat“ lautet der dritte Satz eines Aufrufs, der am Morgen des 8. November 1918 auf der ersten Seite der Münchener Neuesten Nachrichten veröffentlicht wird. Mit dem Begriff Freistaat nimmt Kurt Eisner eine Definition auf, die schon 150 Jahre zuvor für Republik gebraucht wurde.
Mit dieser Wortwahl will er aber nicht nur den Unterschied zur Monarchie, sondern auch die Eigenständigkeit Bayerns innerhalb eines deutschen Staatenbundes, der „Vereinigten Staaten von Deutschland“, herausstellen. „Der Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern“ hat diesen Aufruf „An die Bevölkerung Münchens“ gerichtet.
Noch deutlicher ist ein knallrotes Plakat, das bereits in den Straßen Münchens hängt. Ihm können die interessierten Bürger entnehmen: „Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Hoch die Republik!“
8. 11 1918 - Polizeipräsident Rudolf von Beckh unterwirft sich der Revolution
München-Kreuzviertel * Der Münchner Polizeipräsident Rudolf von Beckh gibt um 1:25 Uhr die Erklärung ab, dass er sich verpflichtet, „bei der Ausübung des Sicherheitsdienstes den Anordnungen des Arbeiter- und Soldatenrates München Folge zu leisten. [...].“
8. 11 1918 - Der Provisorische Nationalrat des Volksstaats Bayern konstituiert sich
München-Kreuzviertel * Noch in der Nacht konstituiert sich der Provisorische Nationalrat des Volksstaats Bayern. Er löst die 163 gewählten Abgeordneten des Bayerischen Landtags ab.
Voraussetzung ist, dass, entsprechend der Machtverhältnisse und im Interesse der Einigung des Proletariats, die Mehrheitssozialdemokraten beteiligt werden müssen, obwohl sie die Revolution mit allen Mitteln verhindern wollten und sich Erhard Auer mit der „gewaltsamen Niederschlagung der Aufständischen“ noch in der Nacht vom 7. zum 8. November einverstanden erklärt hat. Aber gegen die MSPD kann nicht regiert werden.
Deshalb zieht Eisner zur ersten öffentlichen Sitzung des provisorischen Nationalrates am 8. November 1918 - neben den Delegierten des Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrats sowie Vertretern der Gewerkschaften und Berufsverbände - die sozialdemokratische Fraktion des alten Landtags, die Fraktion des Bauernbundes und drei liberale Abgeordnete - Ludwig Quidde, Hübsch und Kohl - hinzu.
8. 11 1918 - Kurt Eisner stellt das neue Kabinett zusammen
München-Kreuzviertel * Nun macht sich der Unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner an die Zusammenstellung des Kabinetts.
8. 11 1918 - Eine Provisorische Bayerische Regierung wird gebildet
München-Kreuzviertel * Um 15:38 Uhr tritt der Provisorische Nationalrat des Volksstaatse Bayern zu seiner zweiten Sitzung zusammen, um eine Provisorische Bayerische Regierung zu wählen.
Eisner schlägt folgende Zusammensetzung der Regierung vor:
- Das Ministerium des Äußeren und damit das Präsidium übernimmt Kurt Eisner selbst.
- Vizepräsident und Kultusminister wird der Mehrheitssozialdemokrat Johannes Hoffmann.
- Ebenfalls MSPD sind der Minister für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter,
- und der Justizminister Johannes Timm.
- Das Innenministerium erhält der Vorsitzende der bayerischen Mehrheitssozialdemokraten, Erhard Auer.
- Das Verkehrsministerium überträgt Eisner einem bürgerlichen Fachmann: Heinrich von Frauendorfer.
- Das Ministerium der Finanzen vertraut Eisner dem Professor für Staatswissenschaften, Edgar Jaffé an, der den Unabhängigen nahe steht.
- Das neu geschaffene Ministerium für soziale Angelegenheiten leitet der Unabhängige Sozialdemokrat Hans Unterleitner.
Die Benennung Erhard Auers zum Innenminister ruft neben Beifall auch Unmutsäußerungen hervor. Bei der Abstimmung erhält Auer eine überwiegende Mehrheit.
Eisner will mit Auers Ernennung seinen schärfsten Gegner unter Kontrolle bringen. Daneben ist ihm bewusst, dass die MSPD die Nichtbesetzung des Innenministeriums mit ihrem Vorsitzenden als Affront empfunden und sich möglicherweise mit der Bourgeoisie gegen die Revolutionsregierung verbünden würde. Auer dagegen kann der MSPD dadurch den Einfluss auf die kommenden Ereignisse sichern.
Das Landwirtschaftsministerium wollte Eisner ursprünglich mit einem revolutionären Bauernbündler besetzen. Doch das kann Erhard Auer verhindern. Es wird nicht gebildet, da der MSPD-ler darin eine Beschneidung seines Ressorts sieht und er dem Eisner-nahen Bayerischen Bauernbund - BBB kein zusätzliches Machtinstrument an die Hand geben will.
8. 11 1918 - Kurt Eisner kürzt als erstes sein hohes Gehalt
München-Kreuzviertel * Der Unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner, der das Amt des Ministerpräsidenten der Republik Bayern übernommen hat, wird er dieses Amt 105 Tage ausüben. In seiner ersten Amtshandlung kürzt der neu ernannte Bayerische Ministerpräsident sein „hohes“ Gehalt.
8. 11 1918 - Die Revolution als Mittel zur Beendigung des Krieges
München * Die Stimmung in München und in Bayern ist sehr gut, da die Revolution vor allem als ein Mittel zur Beendigung des Krieges begriffen wird und schon deshalb die Menschen in ihrer Friedenssehnsucht begeistert. Obwohl die meisten Münchner die Revolution verschlafen haben, hat sich die Bevölkerung sehr schnell den neuen Gegebenheiten angepasst.
- Ob bei den Hoflieferanten, der Post oder der Bayerischen Staatszeitung wird der Zusatz Kgl. umgehend gestrichen oder überklebt.
- Von den Türmen der Frauenkirche weht die rote Fahne.
- Der Arbeiter- und Soldatenrat hat die maximale Fahrgeschwindigkeit der Straßenbahn von 25 km/h auf 12 km/h festgesetzt.
- Der gesamte Telephon- und Telegraphenverkehr in andere Städte ist gesperrt.
- Der Arbeiter- und Soldatenrat übernimmt den Schutz der städtischen Anstalten und Betriebe und besetzt die Residenzwache.
Kurt Eisner verfasst in der Zwischenzeit Aufrufe an die Bevölkerung: „An die Bevölkerung Münchens“, „An die ländliche Bevölkerung Bayerns“, „An die Arbeiter Münchens“ und „An die Soldaten“.
8. 11 1918 - Die Flucht der königlichen Familie geht weiter
Wildenwart - Hintersee - Gschwend - Hüttenkirchen * Die Ruhe auf Schloss Wildenwart ist nicht von langer Dauer. Nach einer kurzen Ruhepause bricht man erneut auf. Dabei trennt sich die Familie, immer auf der Flucht vor tatsächlichen und eingebildeten Gefahren.
Ex-König Ludwig III. und die kranke Ex-Königin Marie Therese wollen in einem Jagdhaus in Hintersee in der Ramsau Unterschlupf finden. Dazu nehmen sie die nervenstarke und besonnene Prinzessin Helmtrud mit. Die restlichen Königsmadln marschieren nach Gschwend am Fuß der Kampenwand zur Familie Baumeister. Dann ziehen sie sich geliehene Bauernkleider an.
Erbprinz Albrecht wird nach Hüttenkirchen zum Grafen Rudi Moragna-Redwitz gebracht. Von dort aus geht es ein paar Tage später zum Maler Bohnenberger, mit dessen Sohn Prinz Albrecht befreundet ist.
8. 11 1918 - Das Kabinett des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin entlassen
Schwerin * Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin entlässt auf Druck der Arbeiter- und Soldatenräte das Staatsministerium. Eine Regierung aus zwei Schweriner Ratsvertretern und zwei bürgerlichen Reichstagsabgeordneten wird gebildet.
8. 11 1918 - Die Waffenstillstandsverhandlungen im Wald von Compiègne
Compiègne * Die Deutsche Abordnung zum Abschluss des Waffenstillstandes und zur Aufnahme der Friedensverhandlungen mit dem Staatssekretär Matthias Erzberger an seiner Spitze, reist zu Verhandlungen mit Marschall Ferdinand Foch. Als Verhandlungsort hat die französische Seite einen Eisenbahnwaggon in einem Waldstück der Gemeinde Rethondes bei Compiègne ausgewählt, wo sich bis März 1918 der Sitz des Alliierten Oberkommandos befunden hatte.
Die Delegation wird von Marschall Foch mit den Worten „Was führt die Herren hierher? Was wünschen Sie von mir?“ begrüßt. Auf die Erwiderung, man wünsche Vorschläge über einen Waffenstillstand entgegen zu nehmen, antwortete Foch: „Ich habe keine Vorschläge zu machen.“
Er legt dafür eine fertige Liste mit Waffenstillstands-Bedingungen, verbunden mit einem 72-stündigen Ultimatum zur Annahme oder Ablehnung vor. Vor allem die Franzosen, auf deren Boden der Krieg vier Jahre gewütet und gewaltige Zerstörungen hinterlassen hatte, fordern eine drakonische Bestrafung des Deutschen Reiches.
8. 11 1918 - Erhard Auer: Die SPD hat den Umsturz nicht vorbereitet!
München * Der SPD-Führer Erhard Auer macht noch einmal deutlich, dass die Sozialdemokraten den Umsturz nicht vorbereitet haben. In seiner Erklärung sagt er:
„Unter dem Druck der fürchterlichen Drangsale des deutschen Vaterlandes hat sich die gestrige Kundgebung ohne unser Zutun zu einem Willensakte gesteigert, mit dem alle Teile der Bevölkerung rechnen müssen.“
8. 11 1918 - Das Volk wird zu Arbeit sowie Ruhe und Ordnung angemahnt
München-Kreuzviertel * Die provisorische Regierung lässt verlautbaren, dass die Revolution beendet ist. Das Volk wird gleichzeitig zur Arbeit sowie zur Ruhe und Ordnung ermahnt.
8. 11 1918 - Die Polizei ist unzureichend und das Militär hat versagt
München * Zwischen Mitternacht und ein Uhr bittet Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich den Führer der Mehrheitssozialdemokraten, Erhard Auer, zu sich. Auer macht deutlich, dass er und seine Partei die „gewaltsame Niederschlagung der Revolution“ und die „Festnahme der Revolutionäre“ noch in der Umsturznacht dulden werden. Danach können sie nur mehr versuchen - auf der Grundlage der neu geschaffenen Verhältnisse - an der Stabilisierung der inneren Ordnung mitzuwirken.
Auf Auers Frage nach einer aus 500 Mann bestehenden zuverlässigen Truppe, erwidert von Brettreich, dass ihm keine ausreichenden Machtmittel zur Verfügung stehen, um den Umsturz niederzuwerfen. Die Polizei ist unzureichend und das Militär hat gänzlich versagt.
8. 11 1918 - Für die Niederschlagung der Revolution ist es zu spät
München * Gegen Mittag ruft Innenminister Dr. Friedrich von Brettreich die den Ministerpräsidenten Otto von Dandl und den Kultusminister Dr. Eugen Ritter von Knilling sowie den bayerischen MSPD-Vorsitzenden Erhard Auer zu sich.
Bei der Besprechung setzt Auer die Herren von den bevorstehenden Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung für den Freien Volksstaat Bayern, die vermutlich zum Ziele führen werden. Für die Niederschlagung der Revolution durch die derzeitige Regierung ist es zu spät.
8. 11 1918 - Die Vereinigten Verbände des bayerischen Verkehrspersonals
München * Auf Initiative des Verkehrsbeamtenvereins bildet sich am Vormittag ein Ausschuss der Vereinigten Verbände des bayerischen Verkehrspersonals. Neben den Mitgliedern der Interessengemeinschaft treten der Bayerische Lokführerverein und der Christliche Verkehrs- und Transportarbeiterverband ein.
Denn um sich die entsprechende Geltung gegenüber den neuen Regierungsgewalten zu verschaffen, so die Überzeugung, ist ein geschlossenes Vorgehen Voraussetzung.
8. 11 1918 - Auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung rechnend
München - Freistaat Bayern * In dem von Kurt Eisner verfassten „Aufruf an die Bevölkerung Münchens“ heißt es:
- Wir rechnen auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung.
- Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen!
- Alle Beamten bleiben in ihren Stellungen.
- Grundlegende soziale und politische Reformen werden unverzüglich ins Werk gesetzt.
8. 11 1918 - Eine verspätete aber richtige Nachricht
München - Freistaat Bayern * Die Bayerische Staatszeitung bringt auf der ersten Seite noch des Aufruf des inzwischen abgesetzten Innenministers Dr. Friedrich Ritter von von Brettreich vom 6. November. Darin heißt es: „[…] Die Bevölkerung darf überzeugt sein, dass sie gegen jegliche Willkür und Gewalttätigkeit den ausreichenden Schutz finden wird, den das ganze Volk von seiner Regierung erwartet.“
8. 11 1918 - In Bayern hat sich ein Wechsel vollzogen
München - Freistaat Bayern * Der Bayerische Kurier charakterisiert den Umschwung treffend mit dem Satz: „Über Nacht, wenn auch für viele - ausgenommen vielleicht die frühere Regierung - nicht unerwartet, hat sich in Bayern ein Wechsel vollzogen, der die kühnsten Hoffnungen wohl sogar seiner Urheber übersteigt.“
8. 11 1918 - Eisner spricht mit den Vereinigten Verkehrsverbänden
München-Kreuzviertel * Unmittelbar bevor Kurt Eisner zur Konstituierenden Sitzung des Provisorischen Nationalrats des Volksstaates Bayern kommt, führt er Gespräche mit Vertretern der Vereinigten Verbände des bayerischen Verkehrspersonals.
Bei diesen Vertretern ist nichts von einer „Lähmung“ zu spüren, die die Spitzen der bayerischen Verwaltung befallen hat. Sie sind sich sofort nach dem Umsturz im Klaren, was sie zu tun haben. Denn beteits nach der Kieler Matrosenrevolte haben sie den weiteren Gang der Dinge „geahnt“.
8. 11 1918 - Die freudige, vielleicht erlösten Mitwirkung der Beamten erwartet
München-Kreuzviertel * Als Kurt Eisner am Nachmittag dem Provisorischen Nationalrat des Volksstaates Bayern sein Kabinett zur Wahl vorschlägt, begründet er die Beibehaltung der bisherigen Ministerialeinteilung damit, dass man es den Beamten nicht erschweren will, sich in die neuen Verhältnisse hineinzufinden.
Er rechnet mit der „freudigen, vielleicht erlösten Mitwirkung“ der Beamten und stellt ihnen mit der Demokratie ein Los in Aussicht, das ganz anders sein wird als ihr bisheriges.
8. 11 1918 - Erste Erfolge bei der Beamtenschaft
München - Freistaat Bayern * Die Gespräche und ersten Kontakte Kurt Eisners mit den Vertretern der organisierten Beamtenschaft und die Aufforderung zur Mitarbeit zeigen Erfolge.
Der Ausschuss der Vereinigten Verbände des bayerischen Verkehrspersonals richtete an das gesamte Verkehrspersonal einen Aufruf, in dem es aufgefordert wird, „den für die gesamte Volkswirtschaft, insbesondere für die Lebensmittelversorgung, wichtigen Verkehrsdienst nach wie vor gewissenhaft auszuführen.“
8. 11 1918 - Die Flucht der königlichen Familie endet auf Schloss Wildenwart
Schloss Wildenwart * Um 4:30 Uhr früh kommt Ex-König Ludwig III. und Ex-Königin Marie Therese samt Ex-Prinzessin Helmtrud, Flügeladjutant Ludwig Graf von Holnstein und einen Kriminalwachtmeister auf Schloss Wildenwart an.
Die den dritten Wagen benutzende Baronin Elisabeth Keßling, der Baron Johann Bodmann und die Kammerfrau Franziska Scheidl sind schon gut eine Stunde zuvor eingetroffen.
Die Königsmadln Gundelinde, Wiltrud und Hildegard sowie Baron Oskar von Redwitz und er 13-jährige Ex-Erbprinz Albrecht, der Sohn vom Kronprinzen Rupprecht, aus dem verunglückten und feststeckenden Auto, marschierten bei Nacht und Nebel zum Schloss Maxlrain, wo sie um drei Uhr früh des 8. November ankommen. Mit einem Ersatzwagen erreichen auch sie gegen ein Uhr Mittag Schloss Wildenwart und sind wieder mit dem Rest der königlichen Familie vereint.
8. 11 1918 - In Nürnberg werden Arbeiter- und Soldatenräte gegründet
Nürnberg * Am Mittag trifft ein Zug mit Soldaten aus München in Nürnberg ein. Sie verbünden sich mit den in Nürnberg stationierten Einheiten und besetzen alle Kasernen und öffentlichen Gebäude.
Der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Ernst Schneppenhorst verständigt sich mit der Nürnberger USPD auf ein gemeinsames Vorgehen. Sie können die Soldaten beruhigen und lassen einen Arbeiter- und Soldatenrat wählen.
8. 11 1918 - Thomas Mann und die Revolutionäre
München-Bogenhausen * Thomas Mann hatte sich während des Krieges als kaisertreuer Anhänger einer elitären, nicht auf demokratischen, sondern oligarchischen Prinzipien [= Herrschaft von Wenigen] beruhenden Gesellschaftsordnung bekannt und zudem die deutsche Kriegspolitik verteidigt. Er schreibt in sein Tagebuch:
„München, wie Bayern, regiert von jüdischen Literaten. Wie lange wird es sich das gefallen lassen? […] Bei uns ist Mitregent ein schmieriger Literaturschieber wie Herzog, der sich durch Jahre von einer Kino-Diva aushalten ließ, ein Geldmacher und Geschäftsmann im Geist, von der großstädtischen Scheißeleganz des Judenbengels, der nur in der Odeonbar zu Mittag aß, aber Ceoni‘s [Zahnarzt auch der Familie Mann] Rechnungen für die teilweise Ausbesserung seines Kloakengebisses nicht bezahlte. Das ist die Revolution! Es handelt sich so gut wie ausschließlich um Juden.“
8. 11 1918 - Augsburg wählt einen Arbeiter- und Soldatenrat
Augsburg * Der Redakteur der sozialdemokratischen Schwäbischen Volkszeitung, Ernst Niekisch, informiert in aller Frühe die Führer der örtlichen Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften über die Vorgänge in München.
Da sich keiner der Angesprochenen traut in die Kasernen zu gehen und sich an die Spitze der Revolution zu stellen, begibt sich Niekisch zum Augsburger Divisionskommandeur. Die Ausweglosigkeit seiner Situation erkennend, lässt er Niekisch einen Provisorischen Soldatenrat wählen.
Und weil die Augsburger Mehrheitssozialdemokraten inzwischen von der Standfestigkeit der neuen Regierung überzeugen konnten, berufen sie eine Massenveranstaltung der Arbeiter ein, auf der Ernst Niekisch zum Vorsitzenden des Arbeiter- und Soldatenrats gewählt wird.
8. 11 1918 - Die MSPD setzt in Regensburg einen Arbeiterrat ein
Regensburg * Meuternde Soldaten lösen in Regensburg die Revolution in aus. Ein durch die örtliche MSPD gegründeter Arbeiterrat setzte sich an die Spitze der revolutionären Bewegung und verhindert, dass es zu Ausschreitungen kommt. Der Arbeiter- und Soldatenrat ordnet sich der Stadtverwaltung unter, um die prekäre Versorgungslage nicht zu gefährden.
8. 11 1918 - Thronverzicht des Herzogs Ernst-August von Braunschweig
Braunschweig * Am Nachmittag fordert eine Abordnung Herzog Ernst-August zur Abdankung auf. Nach kurzer Bedenkzeit und nach Beratung mit seinen Ministern unterzeichnet dieser die Urkunde. Anschließend veranlasst Ex-Herzog Ernst-August seine Minister zum Rücktritt und zur Übergabe der Amtsgeschäfte an den Arbeiter- und Soldatenrat.
8. 11 1918 - Frauenwahlrecht als Bestandteil eines demokratischen Beginns
München - Hamburg * Nachdem Kurt Eisner in München den Freistaat Bayern ausgerufen und das Frauenstimmrecht als Bestandteil eines demokratischen Beginns nannte, schreibt Anita Augsburg ihrer sich in Hamburg aufhaltenden Lebensgefährtin Lida Gustava Heymann:
„Nun begann ein neues Leben! Zurückdenkend erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum, so wunderbar herrlich waren sie. […] Endlich konnten Frauen aus dem vollen Schaffen. Frauenmitarbeit war auf allen politischen und sozialen Gebieten erwünscht.“
8. 11 1918 - Rosa Luxemburg wird aus der Breslauer Haft entlassen
Breslau * Rosa Luxemburg wird aus der Breslauer Haft entlassen. Sie trifft am 10. November in Berlin ein. Karl Liebknecht hat bis dahin den Spartakusbund reorganisiert.
8. 11 1918 - Der Bauerndoktor Georg Heim bietet Kurt Eisner seine Unterstützung an
München-Kreuzviertel * Der Bauerndoktor genannte Dr. Georg Heim, der Vorsitzende des Christlichen Bauernvereins und spätere Mitbegründer der Bayerischen Volkspartei - BVP, bietet Kurt Eisner noch am Morgen des 8. November seine Unterstützung an.
8. 11 1918 - Die Proklamtion des Freistaats Bayern in den MNN
München - Freistaat Bayern * Nur die Münchener Neuesten Nachrichten - MNN können ihre normale Morgenausgabe der Tageszeitung drucken. Auf der ersten Seite ist die Proklamation des Freistaates Bayern abgedruckt:
An die Bevölkerung Münchens!
- Das furchtbare Schicksal, das über das deutsche Volk hereingebrochen, hat zu einer elementaren Bewegung der Arbeiter und Soldaten geführt. Ein provisorischer Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat hat sich in der Nacht zum 8. November im Landtag konstituiert.
- Bayern ist fortan ein Freistaat.
- Eine Volksregierung, die von dem Vertrauen der Massen getragen wird, soll unverzüglich eingesetzt werden.
- Eine konstituierende Nationalversammlung, zu der alle mündigen Männer und Frauen das Wahlrecht haben, wird so schnell wie möglich einberufen werden.
- Eine neue Zeit hebt an! Bayern will Deutschland für den Völkerbund rüsten.
- Die demokratische und soziale Republik Bayern hat die moralische Kraft, für Deutschland einen Frieden zu erwirken, der es vor dem Schlimmsten bewahrt. Die jetzige Umwälzung war notwendig, um im letzten Augenblick durch die Selbstregierung des Volkes die Entwicklung der Zustände ohne allzu schwere Erschütterung zu ermöglichen, bevor die feindlichen Heere die Grenzen überfluten oder nach dem Waffenstillstand die demobilisierten Truppen das Chaos herbei führen.
- Der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat wird strengste Ordnung sichern. Ausschreitungen werden rücksichtslos unterdrückt. Die Sicherheit der Person und des Eigentums wird verbürgt.
- Die Soldaten in den Kasernen werden durch Soldatenräte sich selbst regieren und Disziplin aufrecht erhalten. Offiziere, die sich den Forderungen der veränderten Zeit nicht widersetzen, sollen unangetastet ihren Dienst versehen.
- Wir rechnen auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen! Alle Beamte bleiben in ihren Stellungen. Grundlegende soziale und politische Reformen werden unverzüglich ins Werk gesetzt.
- Die Bauern verbürgen sich für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Der alte Gegensatz zwischen Land und Stadt wird verschwinden. Der Austausch der Lebensmittel wird rationell organisiert werden.
- Arbeiter, Bürger Münchens! Vertraut dem Großen und Gewaltigen, das in diesen schicksalschweren Tagen sich vorbereitet!
- Helft alle mit, dass sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht.
- In dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein.
- Bewahrt die Ruhe und wirkt mit an dem Aufbau der neuen Welt!
- Der Bruderkrieg der Sozialisten ist für Bayern beendet. Auf der revolutionären Grundlage, die jetzt gegeben ist, werden die Arbeitermassen zur Einheit zurückgeführt.
- Es lebe die bayerische Republik!
- Es lebe der Frieden!
- Es lebe die schaffende Arbeit aller Werktätigen!
München, Landtag, in der Nacht zum 8. November 1918.
Der Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern:
Der erste Vorsitzende: Kurt Eisner.
8. 11 1918 - Der Vorwärts rechnet mit Kurt Eisner ab
Berlin - München * Friedrich Stampfer, Chefredakteur beim Vorwärts in Berlin, rechnet mit seinem ehemaligen Kollegen ab und schreibt am 1. Dezember 1918 mit arroganter Überheblichkeit in der SPD-Zeitung Vorwärts einen Leitartikel über Kurt Eisner und die „Revolution in Bayern“.
Darin heißt es: „Als am 8. November 1918 die Kunde kam, dass Eisner bayerischer Ministerpräsident geworden sei, erfüllte Heiterkeit die Redaktionsstuben, sie pflanzte sich fort in die Setzer- und Maschinensäle. Es war keiner unter uns, der Eisner von der alten Zeit her nicht liebte, keiner, der ihm übel wollte oder ihn missachtete. Dennoch: Heiterkeit überall, wohlwollende Heiterkeit. […]
Wozu wären wir ein befreites Volk, wenn es nicht erlaubt wäre, einem alten Freund offen und öffentlich zu sagen: Du hast in Deinem Leben schon viele Böcke geschossen, aber dass Du Dich von Deinen revolutionären Schwabinger Literaturfreunden zum Ministerpräsidenten machen ließest, das war Dein größter Bock. […]
Du lebst in einer Welt des holden Wahnsinns, wenn Du glaubst, Du eingewandeter Berliner Literat, der im öffentlichen Leben noch nie eine Rolle gespielt hat und den man in Bayern bis vor drei Wochen kaum kannte, Du könntest Dich auf das Vertrauen des bayerischen Volkes stützen. […]
Diese Ministerpräsidentschaft […] steht zum Ernst unserer Zeit in erschütterndem Gegensatz. Kasperlekomödie des Lebens, frei nach Frank Wedekind, von Kurt Eisner, mit dem Dichter in der Titelrolle. München - Schwabinger Naturtheater. In fünf Minuten geht der Vorhang herunter und dann ist Schluss.“
Die preußische Sozialdemokratie fühlt sich Kurt Eisner gegenüber weit überlegen. Sie verhöhnt und verlacht ihn und sieht in ihm einen unqualifizierten Abenteurer und absoluten Dilettant, der offensichtlich nichts von Politik versteht und den Ernst der Lage völlig verkennt.
8. 11 1918 - Ein MSPD-Aufruf an die organisierte Arbeiterschaft Münchens
München * Die Münchener Post spricht in einem Aufruf an die organisierte Arbeiterschaft Münchens die MSPD von der Schuld am Umsturz frei, bittet und wirbt aber gleichzeitig um „treue Mitarbeit“, vor allem damit die Ernährung der Schwachen gesichert und so gezeigt wird, „dass die herauf kommende neue Zeit die wahre Wohlfahrt und den Frieden der Menschheit bedeutet. An die Arbeit, Genossen! An den Aufbau!“
8. 11 1918 - Ein Aufruf an die ländliche Bevölkerung Bayerns
München - Freistaat Bayern * In den Münchner Neuesten Nachrichten veröffentlichen Ministerpräsident Kurt Eisner und der Bauernführer Ludwig Gandorfer einen Aufruf An die ländliche Bevölkerung Bayerns, in dem sie die Notwendigkeit der Revolution darstellen und die Friedensbemühungen der Regierung Eisner schildern.
„Der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat betrachtet es als die erste und größte Aufgabe, dem Volke den heiß ersehnten Frieden zu bringen und ist zum Zwecke der Einleitung von Friedensverhandlungen mit den Ententemächten in Verbindung getreten.“
Zugleich verspricht man den militärischen Schutz der Grenzen Bayerns und eine geordnete Demobilisierung, „damit Zustände wie in Österreich und Tirol, wo heimkehrende Soldaten plündern und Kulturwerke zerstören, unmöglich werden!“ Daneben werden sie zu reger Lebensmittelablieferung für die Städte aufgefordert.
8. 11 1918 - Zuverlässige Truppen zur Niederschlagung der Revolution in Pasing
Pasing * Am Vormittag werden vermeintlich zuverlässige Truppenteile zur Niederschlagung der Revolution nach Pasing gebracht. Schon bei der ersten Begegnung mit ihren revolutionären Kameraden legen sie ihre Waffen nieder.
8. 11 1918 - 85 Verordnungen in 105 Tagen
München - Freistaat Bayern * Die Regierung Eisner wird in der ersten Phase nach dem Umsturz, das ist der Zeitraum vom 8. November 1918 bis zur Ermordung Kurt Eisners am 21. Februar 1919, insgesamt 85 Verordnungen, Bekanntmachungen, Entschließungen, Ministerialbekanntmachungen, Ministerialentschließungen und Ausführungsbestimmungen erlassen.
Darunter befinden sich Verordnungen, die mit dem Zusatz „mit Gesetzeskraft“ versehen sind. Zum Beispiel: die Verordnung betreffend die Bayerische Notenbank vom 20. November oder die Verordnung betreffend Beaufsichtigung und Leitung der Volksschulen vom 16. Dezember 1918.
8. 11 1918 - Ein Kasernenrat ist zu bilden
München * Der Soldatenrat erlässt die Weisung, dass in jedem militärischen Standort in München ein aus zehn Soldaten bestehender Kasernenrat zu wählen ist: „Dieser übernimmt die Leitung der Kaserne. Seinen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten.“
8. 11 1918 - Kurt Eisner und die Aufgabe der Arbeiterräte
München-Kreuzviertel * In der Eröffnungsrede in der ersten öffentlichen Sitzung des provisorischen Nationalrates des Volksstaates Bayern erklärt Ministerpräsident Kurt Eisner: „Die Arbeiterräte sollen die Parlamente der körperlichen und geistigen Arbeiter sein, und, wenn man demgegenüber erklärt, dass die Nationalversammlung, der Landtag diese Arbeiterräte entbehrlich machen werde, so behaupte ich: Umgekehrt.
Denn wenn die Nationalversammlung nicht wieder ausmünden soll in jenen leeren, hohlen Parlamentarismus, dann muss die lebendige Kraft der Arbeiterräte sich entfalten. Sie sind gleichsam die Organisation der Wähler. Diese Wähler […] sollen nicht ihren Parlamentariern überlassen, was Kluges oder Törichtes zu tun sie für gut befinden.“
Nach dem 9. 11 1918 - Die Schack-Galerie wird beschlagnahmtes preußisches Kronvermögen
Berlin - München-Lehel * Mit der Revolution und der damit verbundenen Beendigung der Monarchie und des Kaisertums fällt die Schack-Galerie in der Münchner Prinzregentenstraße unter das beschlagnahmte Kronvermögen und wird künftig von der Krongutverwaltung des Berliner Finanzministeriums betreut.
9. 11 1918 - Der fingierte Thronverzicht
Berlin * Während in den meisten großen deutschen Städten rote Fahnen über den Regierungsgebäuden und Residenzen wehen, beginnen in Berlin die Auseinandersetzungen erst. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als die Revolutionären Obleute für diesen Tag große Demonstrationen angekündigt haben. Die Bewegung droht der Regierung und den Mehrheitssozialdemokraten endgültig zu entgleiten.
Reichskanzler Max von Baden befürchtet, dass die Demonstranten siegen und ihrerseits die Absetzung des Kaisers ausrufen könnten. Deshalb veröffentlicht er mittags um 12 Uhr völlig eigenmächtig eine Erklärung, in der darstellt, dass sich der Kaiser des Deutsches Reichs und zugleich König von Preußen entschlossen hat, dem Thron zu entsagen.
Gleichzeitig überträgt der Prinz von Baden an den sozialdemokratischen Parteiführer Friedrich Ebert das Amt des Reichskanzlers, um die Staatsführung vor dem revolutionären Zugriff zu bewahren.
Nach dem 9. 11 1918 - Das Professoren-Kollegium wird verunglimpft
München-Maxvorstadt * Nach der Revolution vom November 1918 wird das Professoren-Kollegium an der Akademie der Bildenden Künste als „Konzilium verschwitzter Schiffshüte“ verunglimpft.
9. 11 1918 - 176 Grippetote alleine in München
München * In der ersten Novemberwoche sind 176 Personen in München der Grippeepidemie erlegen.
9. 11 1918 - Die Thule-Gesellschaft bekämpft die Revolution
München-Graggenau * Nur einen Tag nach der Konstituierung des Provisorischen Nationalrats unter Ministerpräsident Kurt Eisner lädt Freiherr Rudolf von Sebottendorff zu einem konspirativen Treff der Thule-Gesellschaft ins Hotel Vier Jahreszeiten.
Das Interesse ist so groß, dass alle wichtigen Vertreter völkischer und antisemitischer Gruppierungen aus München und der näheren Umgebung der Einladung folgen. Nun war man unter sich - und Sebottendorff konnte Klartext reden:
- „Uns hasst der Feind mit dem grenzenlosen Hasse der jüdischen Rasse, es geht jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn! Unser Orden ist ein Germanenorden, germanisch ist die Treue. [...].
- Die gestrige Revolution, gemacht von Niederrassigen, um den Germanen zu verderben, ist der Beginn der Läuterung.
- Nun wollen wir reden vom Deutschen Reich, jetzt wollen wir sagen, daß der Jude unser Todfeind ist, von heute ab werden wir handeln.“
- Ohne Umschweife fordert er den „kompromisslosen bewaffneten Kampf gegen die neue Regierung“, da sie für ihn nur die „Herrschaft der Niederrassigen unter der Führung von Juda“ ist.
Und da gibt es für ihn kein Zurückhalten: „Jetzt heißt es kämpfen [...] bis das Hakenkreuz siegreich aufsteigt.“
9. 11 1918 - Überhaupt sehe ich den Ereignissen mit Heiterkeit und Sympathie zu
München-Bogenhausen * Thomas Mann, der die Revolutionäre am 7. November noch als „albernes Pack“ beschimpft hatte, notiert jetzt: „Überhaupt sehe ich den Ereignissen mit ziemlicher Heiterkeit und Sympathie zu. Die Bereinigung und Erfrischung der politischen Atmosphäre ist schließlich gut und wohltätig.“
9. 11 1918 - Die Residenz wird vor möglichen Plünderungen geschützt
München-Graggenau * Der neue Ministerrat unter Kurt Eisner lässt die Residenz vor möglichen Plünderungen durch Wachen sichern.
9. 11 1918 - Großherzog Ernst-Ludwig von Hessen wird abgesetzt
Darmstadt * Nachdem sich Großherzog Ernst-Ludwig von Hessen weigert, freiwillig zurückzutreten, wird er von einem gewählten Arbeiter- und Soldatenrat mit Zustimmung des Vorsitzenden der MSPD-Landtagsfraktion, Carl Ulrich, formell abgesetzt.
9. 11 1918 - „In wenigen Tagen wird alles seinen geregelten Gang gehen“
München-Kreuzviertel * In einer Verlautbarung erachtet es Ministerpräsident Kurt Eisner für notwendig, die Ungültigkeit möglicher Machtansprüche konkurrierender Gewalten zu betonen. Gleichzeitig ruft er zu geregelter Arbeit auf und ermahnt insbesondere die Soldaten, sich bei Unzufriedenheit an das zuständige Ministerium und damit an die institutionellen und administrativen Stellen zu wenden.
Der Aufruf schließt mit den optimistischen Worten: „In wenigen Tagen wird alles seinen geregelten Gang gehen.“
9. 11 1918 - Der Vatikan wird aus erster Hand informiert
München - Vatikan * Seit der Revolution berichtet der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli täglich an den Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri über die Ereignisse.
9. 11 1918 - Die Gemeindebeamten stellen ihre Forderungen
München * Vertreter des Zentralverbandes der Gemeindebeamten verhandeln mit Innenminister Erhard Auer und fordern:
- die Aufrechterhaltung der Beamtenrechte,
- den Schutz vor Übergriffen,
- ein neues Beamtenrecht,
- die Errichtung von Beamtenausschüssen,
- die Heranziehung der Organisation bei der Regelung der Belange der Beamten.
9. 11 1918 - Die Vereinigten Verkehrsverbände laden zur Versammlung ein
München - Freistaat Bayern * Der Ausschuss der Vereinigten Verkehrsverbände ruft per Kreistelegramm und in Zeitungsannoncen seine Mitglieder zu einer Massenveranstaltung in den Münchner Bavariakeller an der Theresienwiese ein.
Die Einladung beginnt mit den Worten: „Die Stunde der Erlösung aus tiefster wirtschaftlicher Not ist auch für Euch angebrochen. Jetzt oder nie gilt es, Euch im Rahmen der jetzigen Regierungsgewalt die politische und soziale Machtstellung zu erkämpfen, auf die Ihr auf Grund Eurer Massen und Eurer für das deutsche Wirtschaftsleben ausschlaggebenden wichtigen Berufsarbeit Anspruch habt“.
9. 11 1918 - Schwieriger Machtwechsel in Würzburg
Würzburg * In Würzburg sind der Generalkommandeur Ludwig von Gebsattel und der Regierungspräsident von Unterfranken, Julius von Henle, zum Widerstand bereit. Sie schrecken auch nicht vor der Anwendung von Gewalt zurück.
Der Intervention des Oberbürgermeisters Andreas Grieser, ein liberaler Zentrumsmann, verhindert Schlimmeres. Gebsattel gibt nach und lässt die zuvor in den Kasernen eingesperrten Soldaten frei.
9. 11 1918 - Gründung eines Arbeiter- und Soldatenrats in Burglengenfeld
Burglengenfeld * In Burglengenfeld, am Standort der Maxhütte wird ein Arbeiter- und Soldatenrat gegründet. Vorsitzender wird Joseph Schmid von der USPD.
Burglengenfeld wird zu einem Musterbeispiel der „Räteherrschaft in der Provinz“ im Eisner‘schen Sinn. Kein Wunder, dass Kurt Eisner seinen Antrittsbesuch in der Oberpfalz nicht in Regensburg, sondern in Burglengenfeld abhält.
9. 11 1918 - Eine sozialistische Regierung in Stuttgart
Stuttgart * Am Nachmittag, erst nachdem bekannt geworden war, dass Philipp Scheidemann in Berlin die Republik proklamiert hat, wird im württembergischen Landtag eine provisorische sozialistische württembergische Regierung aus Mitgliedern der MSPD und USPD gebildet.
9. 11 1918 - Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach dankt ab
Weimar * Der Soldatenrat unter Führung des Sozialdemokraten August Baudert zwingt den Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach zur Abdankung.
9. 11 1918 - In Dessau wird ein Arbeiter und Soldatenrat gebildet
Dessau * Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Fritz Hesse wird in Dessau ein Arbeiter- und Soldatenrat gebildet. Erst am 12. November wird die Herzogsfamilie von Anhalt auf den Thron verzichten.
9. 11 1918 - Ex-Herzog Ernst-August flieht aus Braunschweig
Braunschweig - Gmunden * Ex-Herzog Ernst-August verlässt Braunschweig zusammen mit seiner Familie nach Gmunden ins österreichische Exil.
9. 11 1918 - Die Waffenstillstandsbedingungen der Alliierten
Compiègne * Die Alliierten geben im Wald von Compiègne ihre Bedingungen für einen Waffenstillstand bekannt:
- Die Abtretung sämtlicher deutscher Gebiete links des Rheins,
- die sofortige Bereitstellung von 5.000 Lokomotiven, 150.000 Waggons und 5.000 Lastkraftwagen.
- Die Blockade der deutschen Seehäfen bis zur Unterzeichnung des endgültigen Friedensvertrags.
9. 11 1918 - Ein Tanzvergnügen am Totensonntag
Konstanz * In den Konstanzer Nachrichten erscheint ein Artikel, in dem es um ein Tanzvergnügen am gerade zurückliegenden Totensonntag in der Industriestadt Singen geht:
„Im Nebenzimmer einer hiesigen Wirtschaft wurde am Sonntagabend ein Tanzvergnügen (!) durch die Schutzmannschaft gestört; etwa 40–50 Personen, unter ihnen halbwüchsige Burschen, Mädchen und sogar Kriegerfrauen, deren Männer im Felde stehen, tanzten nach den Weisen einer Ziehharmonika trotz dem Ernste der Zeit, trotz Krieg, Elend, Epidemie und was heute sonst noch die Menschheit heimsucht. Auch der Seelensonntag störte die saubere Gesellschaft nicht.“
9. 11 1918 - Amtsübergabe an die neuen Minister
München - Freistaat Bayern * Die alten monarchischen Minister weisen die Neuen in ihre Ämter ein. Anschließend erklären sich die Ministerialbeamten zur Weiterarbeit mit den neuen Ministern bereit.
9. 11 1918 - Philipp Scheidemann ruft die Deutsche Republik aus
Berlin * Während der designierte Reichskanzler und Vorsitzende der Mehrheitssozialdemokraten, Friedrich Ebert, noch mit den Unabhängigen verhandelt, ruft Philipp Scheidemann gegen 14 Uhr vom Balkon des Reichstagsgebäudes unter brausendem Beifall die „Deutsche Republik“ aus:
„Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die Deutsche Republik!“
9. 11 1918 - Karl Liebknecht proklamiert die Freie Sozialistische Republik
Berlin * Wenig später proklamiert der Linkssozialist Karl Liebknecht vom Balkon des Berliner Stadtschlosses die „Freie Sozialistische Republik Deutschland“ nach dem Vorbild der russischen Brüder.
9. 11 1918 - Der Kaiser ist über den Verrat empört
Spa * Als Kaiser Wilhelm II. im Hauptquartier der Obersten Heeresleitung von den Vorgängen in Berlin erfährt, ist er empört über den „Verrat“ des Prinzen Max von Baden.
Auf den dringenden Rat des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg sucht der Kaiser um politisches Asyl in den Niederlanden nach.
9. 11 1918 - Innenminister Auer gegen Einmischungsversuche der Räte
München * In einer Bekanntmachung des Innenministers Erhard Auer wird erläutert, dass „bis auf weiteres die sämtlichen Stellen, die bisher mit der Versorgung der Bevölkerung sowie mit der Überwachung und Regelung des Verkehrs mit Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs betraut waren, weiter arbeiten“.
Nur diese offiziellen Stellen dürfen entsprechende Anordnungen erlassen und durchführen. „Unberechtigte Einmischung Dritter wird nicht geduldet werden.“ Das richtet sich eindeutig gegen Einwirkungsversuche der Räte.
9. 11 1918 - Eine 140 Mann starke Militärpolizei gebildet
München * Eine 140 Mann starke Militärpolizei, gestützt auf vorhandene Polizeikräfte, auf die Soldatenräte und die von diesen repräsentierten Truppenteile, wird zusammen gestellt.
Nach dem 10. 11 1918 - Die Berliner Regierung beschließt die Einführung von Volksgerichten
Berlin * Die demokratische Regierung nach der November-Revolution beschließt die Einführung von Volksgerichten. Die Aburteilung von Mördern unterliegt seither diesen Gerichten, die Vollstreckung erfolgt grundsätzlich durch Erschießen.
10. 11 1918 - Josef Staimer ist neuer Polizeipräsident
München * Der Gauleiter des Fabrikarbeiterverbandes Nürnberg, Josef Staimer, wird an Stelle des Polizeipräsidenten Rudolf von Beckh mit der Führung der Münchner Polizei beauftragt.
10. 11 1918 - Stadtkommandant Arnold wird abgesetzt
München * Der Minister für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter, informiert die Bevölkerung von der Absetzung des bisherigen Stadtkommandanten Arnold und lässt dessen Anordnungen für ungültig erklären.
10. 11 1918 - Hindenburg will den terroristischen Bolschewismus verhindern
Berlin * Der Chef der Obersten Heeresleitung, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, erklärt, er bleibt auf seinem Posten bleiben, bis sich alles geklärt hätte.
Er fordert alle Offiziere und die Mannschaften auf, angesichts des drohenden Bolschewismus „unvermindert ihre Pflicht zu tun zur Rettung der deutschen Lande aus größter Gefahr“. Er selbst und die Oberste Heeresleitung - OHL wollen „mit dem Reichskanzler zusammengehen“, um „die Ausweitung des terroristischen Bolschewismus in Deutschland zu verhindern“.
10. 11 1918 - Bauernführer Ludwig Gandorfer verunglückt tödlich
Schleißheim * Der blinde Bauernführer Ludwig Gandorfer wird von Kurt Eisner beauftragt nach Niederbayern zu fahren, um die Ablieferung und den Transport der Lebensmittel nach München zu organisieren. Die Fahrt wird in einem vom Soldatenrat beschlagnahmten Auto erfolgen. Es ist der Fiat des Prinzen Joachim Albrecht von Preußen, ein Verwandter Kaiser Wilhelms II..
In der Nähe von Schleißheim kommt das mit sieben Personen besetzte Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und stürzt die Böschung hinab. Ludwig Gandorfer, der mit zwei Begleitern auf der Rückbank sitzt, wird aus dem Automobil geschleudert und stirbt am Unfallort an einem Schädelbruch.
Der Unfall wird in der Bevölkerung als rätselhaft empfunden: Da ist
- die Streckenführung nach Niederbayern vom Landtag über Schleißheim,
- das Unfallauto verschwindet spurlos und taucht nie mehr auf,
- weder das Unfallprotokoll noch die Aussagen der Überlebenden sind auffindbar.
- Es gibt Gerüchte, wonach die Leichenfrau auf Gandorfers Stirn einen Einschuss gesehen haben will.
Sein Nachfolger als Vorsitzender des Bayerischen Bauernbundes - BBB wird sein Bruder Karl Gandorfer.
10. 11 1918 - Kronprinz Rupprecht kämpft mit allen Mitteln um seine Krone
Lille - München-Kreuzviertel * Ex-Kronprinz Rupprecht legt in einem forschem Telegramm bei der bayerischen Regierung
- „Verwahrung ein gegen die politische Umwälzung, die ohne Mitwirkung der gesetzgebenden Gewalten und der Gesamtheit der bayerischen Staatsbürger in Heer und Heimat von einer Minderheit ins Werk gesetzt wurde.
- Das bayerische Volk und das seit Hunderten von Jahren mit ihm verbundene Fürstenhaus haben das Recht zu verlangen, dass über die Staatsform durch eine verfassungsgebende Nationalversammlung entschieden wird, die aus freien und allgemeinen Wahlen hervor geht.
- Dass den heimkehrenden Soldaten die Möglichkeit eröffnet wird, ihre Stimme abzugeben, ist eine selbstverständliche Forderung.
- Die bayerischen Soldaten werden dann im Einvernehmen mit den bayerischen Staatsbürgern in der Heimat zu entscheiden haben, wie sie sich zur Frage weiterer Zusammenarbeit mit ihrem Fürstenhause stellen wollen.“
Der Ministerrat des Volksstaates Bayern ignoriert diese papierene Ermahnung übrigens vollkommen zu Recht. Hier spielt der Monarch von Gottes Gnaden plötzlich den Vorbild-Demokraten.
Denn dass sich Rupprecht auf eine noch ausstehende Entscheidung der frei gewählten Vertretung des souveränen Volkes beruft, ist frech. Bis dahin hätte schließlich die Dynastie Wittelsbach nicht im Traum daran gedacht, die Staatsform zum Gegenstand der Entscheidung einer Volksvertretung zu machen.
10. 11 1918 - Im Großherzogtum Baden entsteht eine Volksregierung
Karlsruhe * Auf Initiative des Karlsruher Oberbürgermeisters Karl Siegrist gründet sich ein sogenannter Wohlfahrtsausschuss, der mit den Soldatenräten eine provisorische Volksregierung im Großherzogtum Baden bildet.
10. 11 1918 - Kaiser Wilhelm II. in Holland angekommen
Berlin * Ex-Kaiser Wilhelm II. ist nach seiner Flucht in Holland angekommen.
10. 11 1918 - Die Suche nach dem geflüchteten König
München - Schloss Wildenwart * Ex-Ministerpräsident Otto von Dandl verlässt gemeinsam mit dem Ex-Staatsrat für militärische Angelegenheiten, Maximilian von Speidel, und einer vierköpfigen Eskorte der Revolutionsregierung die Landeshauptstadt. Sie sollen mit dem abgesetzten König Ludwig III. über die Lösung des Beamten- und Offiziersdiensteides verhandeln.
In der vorbereiteten Erklärung, die der König unterschreiben soll, heißt es: „Die neuen Zeiten veranlassen mich, für meine Person und alle Familienmitglieder des Hauses Wittelsbach dem Throne und allen dynastischen Ansprüchen zu entsagen. Ich verpflichte mich, in meinem und meiner Familie Namen, nichts zu unternehmen, was die friedliche und gedeihliche Entwicklung des jungen Volksstaates stören könnte.“
Die Delegation trifft den Ex-König aber nicht mehr an, da er Schloss Wildenwart bereits in Richtung Anif bei Salzburg verlassen hat.
10. 11 1918 - Die Thule-Gesellschaft gründet einen Kampfbund
München-Graggenau * Mitglieder der Thule-Gesellschaft gründen einen Kampfbund, der die Zerschlagung der Räterepublik mit Waffengewalt zum Ziel hat. Die Leitung übernimmt Freiherr Rudolf von Sebottendorff selbst.
Diese Nationalisten, Antisemiten und Deutschnationalen entwickeln eine Doppelstrategie, die maßgeblichen Anteil an der Zerschlagung der späteren Räteherrschaft hat. Die Thule-Gesellschaft wird zum Organisationszentrum der Münchner Gegenrevolution und Aktionsgemeinschaften organisieren
- den Aufbau eines umfangreichen Informations- und Spitzelsystems in allen revolutionären und kommunistischen Gruppierungen,
die Kontaktaufnahme mit gesprächsbereiten Sozialdemokraten aus der Provisorischen Regierung und der Parteispitze sowie die Errichtung eines illegalen Werbebüros zur Unterstützung bereits existierender nationaler Militärverbände und zum Aufbau einer eigenen militärischen Organisation.
10. 11 1918 - Kronprinz Rupprecht ersucht um Asyl
Lille - Brüssel * Kronprinz Rupprecht legt seine Armee-Kommandos nieder und begibt sich nach Brüssel. Dort eilt er sich in die Spanische Botschaft und ersucht um Asyl.
10. 11 1918 - General Wilhelm Groener gibt eine Loyalitätserklärung ab
Spa - Berlin * Der Generalquartiermeister in der Obersten Heeresleitung - OHL, Wilhelm Groener, gibt eine Loyalitätserklärung gegenüber gegenüber Reichskanzler Friedrich Ebert ab und bietet ihm die Unterstützung der Reichswehr an. Im Gegenzug verlangt er von der Regierung
- die Bekämpfung des Bolschewismus und
- die Ausschaltung der Soldatenräte.
Ebert lässt sich auf diesen Bündnisvorschlag ein,
- da er damit die Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin in Schach halten
- und das Offizierskorps ohne Reibungsverluste vom Kaiserreich in die neue Demokratie hinüber retten kann.
10. 11 1918 - Der Rat der Volksbeauftragten als provisorische Regierung
Berlin * Bildung des Rats der Volksbeauftragten als Provisorische Regierung beim Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik.
Das Gremium besteht aus je drei Vertretern der Mehrheitssozialdemokraten - MSPD und der Unabhängigen Sozialdemokraten - USPD. Die MSPD entsendet: Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg, die USPD: Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth. Ebert und Haase sind gleichberechtigte Vorsitzende.
Der Rat der Volksbeauftragten beaufsichtigt das Regierungskabinett, das weiterhin im Amt ist.
10. 11 1918 - Kein Eid vor der Entbindung vom Treueid auf den König
München * Der Vorstand des Bayerischen Beamten- und Lehrerverbandes beschäftigt sich mit der Frage der Vereidigung. Ohne zu übersehen, welche Folgen eine Verweigerung der Eidesleistung nach sich ziehen würde, beschließt man einstimmig, „vor einer Entbindung vom Treueid durch den König keinen Eid zu leisten“.
Gleichwohl gibt man der Bereitschaft zum Wohle des Vaterlandes zu arbeiten Ausdruck.
10. 11 1918 - Die Beamtenorganisationen fordern das Recht auf Mitbestimmung
München - Freistaat Bayern * Die Beamtenorganisationen dringen unmittelbar nach der Revolution darauf, ihre schon lange vertretene Forderung nach Mitbestimmung der Beamtenschaft zu verwirklichen.
Vom neuen Volksstaat, der allen seinen Bürgern das „Recht auf Mitwirkung“ zugestehen will, erwartet man wie selbstverständlich, dass auch den Beamten ein weitgehendes „Recht auf Mitbestimmung“ zugestanden wird.
10. 11 1918 - Großveranstaltung der Beamten im Bavariakeller
München-Ludwigsvorstadt * 15.000 bis 18.000 folgen der Einladung des Ausschusses der Vereinigten Verkehrsverbände zur Kundgebung in den Münchner Bavariakeller. Dieser kann die Massen nicht aufnehmen, sodass gleichzeitig drei Kundgebungen abgehalten werden müssen: Eine im Bavariakeller, zwei im anschließenden Garten.
Dem Forderungskatalog voraus steht das Bekenntnis: „Die bayerischen Verkehrsangehörigen fügen sich der bestehenden Regierungsgewalt ein. Sie betrachten das Volkswohl als ihr oberstes Gesetz und geloben, ihm ihre volle Kraft zu widmen“.
Gefordert wird:
- „Bildung eines Rates der Verkehrsangehörigen durch die Vereinigten Verbände, der dem Verkehrsministerium beizuordnen ist,
- Besetzung der oberen leitenden Beamtenstellen der Verkehrsverwaltung nur im Einvernehmen und mit Zustimmung dieses Rates,
- alle sozialen und volkswirtschaftlichen für das Personal sind nur gemeinsam mit dem Rate zu treffen,
- sofortige Aufnahme von Vertrauensmännern des Personals in den Arbeiter- und Soldatenrat,
- achtstündiger Arbeitstag und sechstägige Arbeitswoche.“
Die Entschließung wird sofort dem Arbeiter- und Soldatenrat zugeleitet.
10. 11 1918 - In Regensburg wird ein Bauernrat gebildet
Regensburg * In Regensburg wird neben dem bestehenden Arbeiter- und Soldatenrat auch ein Bauernrat gebildet. Den Vorsitz übernehmen Georg Heim und Sebastian Schlittenbauer vom Zentrum, die am 12. November die Bayerische Volkspartei - BVP gründen werden.
10. 11 1918 - König Friedrich August III. von Sachsen für abgesetzt erklärt
Dresden * Der neugebildete Vereinigte Revolutionäre Arbeiter- und Soldatenrat erklärt König Friedrich August III. von Sachsen für abgesetzt und die Monarchie für beseitigt. Im Zirkus Sarrasani ruft Herrmann Fleißner von der MSPD die Republik aus.
10. 11 1918 - Das Großherzogtum Hessen wird zur Republik
Darmstadt * Nachdem am Tag zuvor der hessische Großherzog Ernst-Ludwig formell abgesetzt worden war, wird Hessen am Nachmittag als Republik proklamiert.
10. 11 1918 - Herzog Bernhard III. von Sachsen-Meiningen verzichtet auf den Thron
Meiningen * Herzog Bernhard III. von Sachsen-Meiningen verzichtet infolge des Druckes der Novemberrevolution auf den Thron.
Sein Sohn, Prinz Ernst, verweigert sich zunächst noch. Er wird erst am 12. November seinen Verzicht erklären.
10. 11 1918 - Fürst Heinrich XXVII. von Reuß verzichtet auf den Thron
Gera - Greiz * Fürst Heinrich XXVII. von Reuß jüngere Linie verzichtet auf den Thron. Seit 1908 regiert Heinrich XXVII. auch das Fürstentum Reuß ältere Linie in Personalunion.
10. 11 1918 - Schritte zur Demokratisierung der Armee
München * Die Regierung des Volksstaates Bayern fordert die Offiziere auf, sich der Regierung zur Verfügung zu stellen, um so die Demokratisierung der Armee einzuleiten.
10. 11 1918 - Keinerlei Verfügungen haben mehr Rechtskraft
München - Freistaat Bayern * Die provisorische Regierung verkündet, dass die „Vollzugsgewalt durch die Beschlüsse der provisorischen Versammlung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte in die Hände des Ministeriums des bayerischen Volksstaats übergegangen“ ist. „Keinerlei Verfügungen haben mehr Rechtskraft, die nicht vom Ministerium“ ausgehen.
10. 11 1918 - In Berlin herrscht gelöste Feierstimmung
Berlin * Die Revolutionären Obleute stellen fest, dass sich die Stimmung in den Betrieben über Nacht verändert hat. Es herrscht gelöste Feierstimmung, man ist versöhnlich und dankbar dafür, dass die Revolution so wenig Opfer gefordert hat. Die meisten Zeitgenossen sind vom vollständigen Sieg der Revolution überzeugt. Einen nachhaltigen reaktionären Rückschlag halten sie für unvorstellbar.
Und tatsächlich ist der größte Teil der politisch und gesellschaftlich einflussreichen Kreise wie gelähmt. Das gilt auch für das vermögende und gebildete Bürgertum.
10. 11 1918 - Schadet die MSPD der Revolution ?
Berlin * Die Revolutionären Obleute versuchen auf Versammlungen die Arbeiterschaft davon zu überzeugen, dass eine gemeinsame Regierung der USPD mit der MSPD-Spitze der Revolution schaden würde.
Doch die Arbeiter wollen ein Zusammengehen der beiden Parteien. Die neue Regierung soll paritätisch aus MSPD- und USPD-Mitgliedern zusammengesetzt sein.
10. 11 1918 - Kurt Eisner warnt vor Max Levien
München-Kreuzviertel * In der Ministerratssitzung warnt Kurt Eisner vor Max Levien. Er, so Eisner, „müsse ausgeschaltet werden“.
10. 11 1918 - Mehr Katzenjammer als Rausch
München-Kreuzviertel * Erzbischof Michael von Faulhaber notiert in sein Tagebuch: „Schon am dritten Tag ist die Stimmung mehr Katzenjammer als Rausch. In den Trambahnen schimpfen sie bereits, wie mir von Ohrenzeugen versichert wird, ebenso über die neue Regierung wie vor acht Tagen über die alte. […]
Man hört, in der ersten Nacht in Geheimsitzung habe Eisner gefordert, sofort mit aller Schärfe gegen die Pfaffen, Auer aber habe sehr energisch gesprochen, jetzt alles beim Alten zu lassen (und besonders von den Feldgeistlichen gesprochen. […]
Ich sage es heute wiederholt […]: Es sei ja gar nicht damit zu rechnen, dass eine Gegenrevolution komme, die nicht mehr das Königshaus zurück brächte, sondern nur eine größere Verwirrung stifte, und namentlich noch viel Blut koste. Jetzt muss alles zusammen helfen, um Ruhe und Ordnung zu halten.“
11. 11 1918 - Matthias Erzberger unterzeichnet das Waffenstillstandsabkommen
Compiégne * Staatssekretär Matthias Erzberger, ein liberaler Politiker der katholischen Zentrumspartei, unterzeichnet für das Deutsche Reich das Waffenstillstandsabkommen im französischen Compiègne.
Einen großen Verhandlungsspielraum ließ die von Marschall Ferdinand Foch vorgelegte Liste mit den Waffenstillstands-Bedingungen, verbunden mit einem 72-stündigen Ultimatum zur Annahme oder Ablehnung, nicht zu.
Da der deutschen Delegation die Bedingungen als sehr hart erscheinen, sucht Erzberger Rücksprache mit dem neuen Reichskanzler Friedrich Ebert. Dieser weist den Leiter der Verhandlungskommission nach Rücksprache mit dem Chef der Obersten Heeresleitung - OHL, Paul von Hindenburg, an, den „Waffenstillstand zu jedweden Bedingungen“ anzunehmen.
Der Vertrag wird am 11. November zwischen 5:12 Uhr und 5:20 Uhr französischer Zeit unterzeichnet. Um 11 Uhr enden damit die kriegerischen Auseinandersetzungen.
188.000 bayerische Soldaten sind im Ersten Weltkrieg gefallen, mehrere Hunderttausend wurden verwundet.
11. 11 1918 - Das Zentrum fügt sich den gegebenen Verhältnissen
München * In den Zeitungen erscheint folgender Artikel:
„Niemand wird von den Anhängern der Zentrumspartei verlangen können, dass sie die Prinzipien ihrer Weltanschauung und die Grundsätze der Partei ändern. Wohl aber fügen wir uns den gegebenen Verhältnissen.“
11. 11 1918 - Gründung des Spartakusbundes in Berlin
Berlin * In Berlin wird der Spartakusbund als Propagandavereinigung gegründet. Er ist vorerst noch keine Partei. Seine Mitglieder gehören der USPD an.
11. 11 1918 - Achtstundentag bei der Bayerischen Verkehrsverwaltung
München - Bayern * Bei allen Betrieben der Bayerischen Verkehrsverwaltung erfolgt
- die Einführung des Achtstundentages und
- die Abschaffung der Stücklohn- und Prämienarbeit.
11. 11 1918 - Generalmajor von Kunzmann wird Stadtkommandant
München * Generalmajor von Kunzmann übernimmt die Aufgaben des am Tag zuvor enthobenen Stadtkommandanten Arnold.
11. 11 1918 - Österreichs Kaiser Karl I. tritt zurück
Wien * Karl I., der schon eine Woche vorher von einzelnen Medien als „der ehemalige Kaiser“ bezeichnet worden war, wird von den republikanisch gesinnten deutsch-österreichischen Spitzenpolitikern und seiner letzten k.u.k. Regierung dazu bewogen, auf „jeden Anteil an den Staatsgeschäften“ zu verzichten.
Die förmliche Abdankung hatte er zuvor abgelehnt. Am selben Tag entlässt der Ex-Kaiser die funktionslos gewordene k.u.k. Regierung.
11. 11 1918 - Die Königliche Zivilliste wird Staatseigentum
München-Kreuzviertel * Der Ministerrat erklärt die Königliche Zivilliste als Staatseigentum. Sie wird umbenannt in Verwaltung des ehemaligen Kronguts.
11. 11 1918 - Erzbischof Faulhaber rät dem Nutius zur Flucht aus der Stadt
München * Erzbischof Michael von Faulhaber rät dem päpstlichen Nuntius Eugenio Pacelli die Stadt umgehend zu verlassen, da seine Person gefährdet sei.
11. 11 1918 - Gründung von weiteren Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten
Freistaat Bayern * Die Münchener Post meldet die friedliche Bildung von Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten in Ingolstadt, Regensburg, Straubing, Augsburg, Kaufbeuren, Lindau, Bamberg, Landshut, Nürnberg und Würzburg.
11. 11 1918 - Großherzog Friedrich August von Oldenburg erklärt seinen Thronverzicht
Oldenburg * Großherzog Friedrich August von Oldenburg erklärt seinen Thronverzicht. Aus dem Großherzogtum Oldenburg wird ein republikanisch verfasstes Land, das als parlamentarische Demokratie regiert wird.
11. 11 1918 - Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha tritt ab
Coburg * Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha tritt von der Regierung zurück.
11. 11 1918 - Die Regierung des Fürstentums Reuß jüngere Linie tritt zurück
Gera - Greiz * Der Arbeiter- und Soldatenrat zwingt die Regierung des Fürstentums Reuß jüngere Linie zum Rücktritt.
11. 11 1918 - Kurt Eisner startet eine unabhängige bayerische Außenpolitik
München - Bern * Nach der Bekanntgabe der harten Waffenstillstandsbedingungen startet Ministerpräsident Kurt Eisner in der Nacht zum 11. November eine eigenständige, vom Reich völlig unabhängige bayerische Außenpolitik. Über den Schweizer Bundesrat in Bern schickt er einen Appell der neuen bayerischen Regierung an die Regierungen der Siegermächte. Er ist zugleich ein Aufruf an die Proletarier aller Länder:
„Das bayerische Volk hat zuerst in Deutschland unter Führung von Männern, die seit Beginn des Krieges den leidenschaftlichsten Kampf gegen die frevelhafte Politik der deutschen Regierungen und Fürsten geführt haben, in einer stürmischen und vom endgültigen Erfolg gekrönten Erhebung alles und alles beseitigt, was schuldig und mitschuldig an dem Weltkrieg war. […]
In diesem Augenblicke stürzt auf die junge Republik Bayern die Veröffentlichung der Waffenstillstandsbedingungen der alliierten Mächte herein. Alle Hoffnungen, die wir durch den Erfolg der Revolution hegen durften, sind damit zerstört. Die neue Republik wird, wenn diese entsetzlichen Bedingungen unabänderlich sein sollten, in kurzer Zeit Wüste und Chaos sein. […]
Jetzt ist die Stunde gekommen, wo durch einen Akt weitausblickender Großmut die Versöhnung der Völker herbeigeführt werden kann. Vergesst in der Schöpfung der neuen Welt den Hass, der in der alten erzeugt worden ist.“
11. 11 1918 - Die Regierung ist der Nationalversammlung nicht verantwortlich
München-Kreuzviertel * In der Ministerrats-Sitzung erklärt Ministerpräsident Kurt Eisner, dass die „Revolutionsregierung dem jetzigen improvisierten Parlament nicht verantwortlich sein“ kann.
11. 11 1918 - Bisherige Staatssekretäre mit der Weiterführung der Geschäfte beauftragt
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten teilt in einem Erlass mit, dass die Staatssekretäre und die Leiter der Reichsbehörden von der Reichsregierung mit der vorläufigen Weiterführung der Geschäfte beauftragt worden sind.
11. 11 1918 - Die Oberste Heeresleitung soll die Disziplin aufrecht erhalten
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten ermächtigt die Oberste Heeresleitung - OHL, Anordnungen zu treffen, mit denen die notwendige Disziplin aufrecht erhalten werden soll.
Dagegen gibt es heftige Proteste der Soldatenräte, was die Regierung zur Präzisierung seiner Anordnung zwingt. Die Ermächtigung soll nur für die Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen gelten.
11. 11 1918 - Frankreich fordert die sofortige Rückgabe von Elsass-Lothringen
Compiégne • Teil der Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich in Compiégne ist die sofortige Rückgabe von Elsass-Lothringen.
12. 11 1918 - Auflösung des Zentrums und Gründung der Bayerischen Volkspartei
Regensburg - Freistaat Bayern * Die Mitglieder des Zentrums lösen ihre Partei auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, in dem man guten Gewissens alte Positionen aufgeben kann. Georg Heim und Sebastian Schlittenbauer, Politiker des konservativen und katholischen Lagers, gründen in Regensburg die Bayerische Volkspartei - BVP und erklären:
„Fürs erste weht über Deutschland und Bayern die rote Fahne, das musste wohl so kommen und so Gott will, wird es unserem engeren und weiteren Vaterlande am Ende doch zum Guten gereichen.“
12. 11 1918 - Die alten Machtinsignien verschwinden
München * Das Staatsministerium der Justiz gibt den Wegfall der Formel „Im Namen Seiner Majestät des Königs“, sowie die Bezeichnung „Königlich“ auf sämtlichen Formblättern, Papieren, Briefumschlägen, Siegeln und Stempeln bekannt.
12. 11 1918 - Einführung des Acht-Stunden-Tages in den städtischen Betrieben
München * Der Stadtmagistrat beschließt die Einführung des Acht-Stunden-Tages in allen städtischen Betrieben.
12. 11 1918 - Ein Erzbischöflicher Hirtenbrief an die Landbevölkerung
München * In einem Hirtenbrief an die Landgemeinden vertritt der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber folgende Auffassung:
„Ohne unsere Grundsätze zu verleugnen, ohne ein politisches Neubekenntnis abzulegen, fühlen wir uns doch im Gewissen verpflichtet, auf dem Boden der gegebenen Tatsachen an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und an der Sicherstellung der Volksernährung mitzuarbeiten, um noch größere Übel von unserem Volke fernzuhalten.“
12. 11 1918 - Pressefreiheit und Telefonverkehr
München-Kreuzviertel * Die Bayerische Regierung gibt die „vollständige Pressefreiheit“ und den „ungehinderten telegraphischen und telephonischen Verkehr“ bekannt.
12. 11 1918 - Eine Amnestie für die am Januarstreik Beteiligten
München * Eine Amnestie wird erlassen. Durch sie werden die Verfahren gegen die am Januarstreik Beteiligten eingestellt.
Um den 12. 11 1918 - „Tuast‘n runter, dein Preiselbeerorden!“
München * Liesl Karlstadt hatte am 26. Oktober 1918 für ihre „ersprießliche Tätigkeit im Dienste des Roten Kreuzes“ das König-Ludwig-Kreuz erhalten.
„An dem Orden hab‘ i mi net lang freu‘n können. In der Revolution sagen so a paar Strizzi zu mir: ‚Tuast‘n runter, dein Preiselbeerorden, sonst miassat ma‘n kassier‘n!‘ Da hab i‘n halt runtertan!“
12. 11 1918 - Kronprinz Rupprecht flieht nach Amsterdam
Brüssel - Amsterdam * In der Nacht zum 13. November flieht Kronprinz Rupprecht mit dem Auto des spanischen Gesandten nach Amsterdam, wo er bei einem Schweizer Arzt für einige Wochen unterkommt.
12. 11 1918 - Eine Rücktrittserklärung ohne das Wort Abdankung
Schloss Anif * In der Nacht vom 12. zum 13. November treffen sich der ehemalige Ministerpräsident Otto von Dandl und der Noch-Monarch Ludwig III. in Schloss Anif.
- Sie erarbeiten eine Rücktrittserklärung, bei der das Wort Abdankung vermieden wird, aber der König dennoch auf die Herrschergewalt in Bayern verzichtet.
- Andererseits wird weder der Anspruch des Hauses Wittelsbach auf die Krone aufrecht erhalten, noch die Beibehaltung der monarchischen Staatsform reklamiert.
Mit dieser Erklärung können beide Seiten letztlich sehr gut leben.
12. 11 1918 - In Wien wird die Republik proklamiert
Wien * In Wien findet die letzte Reichsratssitzung der Provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich statt. Noch am selben Tag ruft sie die Republik aus.
12. 11 1918 - Das aktive und passive Wahlrecht für Frauen wird eingeführt
Berlin - Deutsches Reich * Der aus Mitgliedern der SPD und der USPD bestehende Rat der Volksbeauftragten in Berlin verkündet in einem Aufruf an das Deutsche Volk mit Gesetzeskraft unter anderem die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland.
- Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen.
- Der Belagerungszustand wird aufgehoben.
- Das Vereins- und Versammlungsrecht unterliegt keiner Beschränkung, auch nicht für Beamte und Staatsarbeiter.
- Eine Zensur findet nicht statt, die Theaterzensur wird aufgehoben.
- Meinungsäußerung in Wort und Schrift ist frei.
- Die Freiheit der Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf zu einer religiösen Handlung gezwungen werden.
- Für alle politischen Straftaten wird Amnestie gewährt. Die wegen solcher Straftaten anhängigen Verfahren werden niedergeschlagen.
- Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst wird aufgehoben, mit Ausnahme der sich auf die Schlichtung von Streitigkeiten beziehenden Bestimmungen.
- Die Gesindeordnungen werden außer Kraft gesetzt, ebenso die Ausnahmegesetze gegen die Landarbeiter.
- Die bei Beginn des Krieges aufgehobenen Arbeitsschutzbestimmungen werden wieder in Kraft gesetzt.
12. 11 1918 - Die Hofbeamten sollen in den Staatsdienst übernommen werden
München-Kreuzviertel * In einer Versammlung werden die Hofbeamten zum Übertritt in den Staatsdienst aufgefordert. Die Entbindung der Beamten von ihrem Treueid durch Ex-König Ludwig III. am 13. November 1918 macht den Weg für die Übernahme frei. Ansonsten hätten mit der Einstellung der Zahlung an die Zivilliste die Gehälter des Hofes nicht mehr bezahlt werden können.
Um den 12. 11 1918 - Umfangreiche Forderungen des Bayerischen Volksschullehrervereins
München * Eine Abordnung des Bayerischen Volksschullehrervereins fordert bei Ministerpräsident Kurt Eisner und Kultusminister Johannes Hoffmann
- ein freiheitliches Lehrergesetz,
- die Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht,
- die Errichtung eines Lehrerrates und
- die Durchführung eines demokratischen Schulprogramms.
Um den 12. 11 1918 - Die königlichen Titel sind abgeschafft
München - Freistaat Bayern * In den Zeitungen ist nicht mehr die Rede von König und Kronprinz. Die ehemaligen Regenten heißen nunmehr Ludwig Wittelsbach und Rupprecht Wittelsbach.
Um den 12. 11 1918 - Ein zitternder Herzog von Braunschweig und Lüneburg
Augsburg * Ernst August III. Herzog zu Braunschweig und Lüneburg und Prinz von Hannover hat es nach seiner Abdankung am 8. November 1918 mit seiner Familie nach Augsburg verschlagen. Er lebt in materieller Not in einem Hinterhof.
Da er als Ortsfremder keine Lebensmittelkarten erhält, bekommt er auf seine vorsichtige Anfrage vom Arbeiter- und Soldatenrat die Auskunft, dass er sich wie jeder andere Bürger bei der Behörde anmelden und seine Lebensmittelkarte persönlich abholen kann.
Herzog Ernst August III. spricht daraufhin persönlich beim Vorsitzenden des Augsburger Arbeiter- und Soldatenrats, Ernst Niekisch, vor: „Er zitterte am ganzen Körper, im buchstäblichen Sinn des Wortes klapperte er mit den Zähnen. Ich beruhigte ihn, niemand wolle ihm oder seiner Familie etwas zuleide tun. Ich händigte ihm die Lebensmittelkarten aus.“
12. 11 1918 - Prinzregent Aribert von Anhalt verzichtet auf den Thron
Dessau * Prinzregent Aribert von Anhalt verzichtet im Namen des noch minderjährigen Herzogs Joachim Ernst von Anhalt und der gesamten anhaltischen Fürstenfamilie auf den Thron. Aus dem Herzogtum Anhalt wird eine Republik.
12. 11 1918 - Fürst Leopold IV. zur Lippe dankt ab
Detmold * Fürst Leopold IV. zur Lippe will „die Frage der zukünftigen Staatsform […] Entschließung des neuen, auf freier Grundlage gewählten Landtages überlassen“, weil er sich „nicht einseitig für befugt“ hält, „abzudanken, dies vielmehr eine Landesangelegenheit sei“. Er verzichtet auf den Thron, nachdem ihm der Volks- und Soldatenrat ein Ultimatum setzen.
12. 11 1918 - Prinz Ernst von Sachsen-Meiningen verzichtet auf den Thron
Meiningen * Prinz Ernst von Sachsen-Meiningen verzichtet mit zwei Tagen Verzögerung auf den Thron.
12. 11 1918 - Bitte um Milderung der Waffenstillstandsbedingungen an die USA
München - Bern - Washington * Professor Dr. Friedrich Wilhelm Foerster wird von Ministerpräsident Kurt Eisner zum bayerischen Gesandten in Bern berufen.
Der international anerkannte Pazifist nimmt umgehend Kontakt zum amerikanischen Pazifisten George D. Herron auf. Dieser leitet Eisners Bitte um Milderung der Waffenstillstandsbedingungen umgehend an den US-Präsidenten Woodrow Wilson weiter.
12. 11 1918 - Preußens Regierung will Ordnung und Sicherheit
Berlin * Die preußische Regierung fordert die Beamten und Behörden auf, ihre amtliche Tätigkeit fortzusetzen und so zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit beizutragen.
12. 11 1918 - Keine Sozialisierung, dafür eine umfassende Eigentumsgarantie
Berlin * Der Aufruf der Volksbeauftragten an das Deutsche Volk spricht von der Verwirklichung des sozialistischen Programms, klammert aber die Frage der Sozialisierung vollkommen aus und gibt zugleich eine umfassende Eigentumsgarantie ab.
12. 11 1918 - Der Vollzugsrat will eine Rote Garde bilden
Berlin * Der Vollzugsrat ruft zur Bildung einer Roten Garde von 2.000 Mann auf, die den „Schutz der Revolution“ übernehmen und dem Vollzugsrat zur Verfügung stehen soll.
12. 11 1918 - Vorkehrungen zum Schutz von Leben und Eigentum der Bürger
München * Innenminister Erhard Auer weist die Bezirksämter und Gemeindeverwaltungen an, selbst Vorkehrungen zum Schutze von Leben und Eigentum der Bürger zu treffen.
12. 11 1918 - Georg Heim und die Bauernbündler
Regensburg - München * Der Bauerndoktor genannte Georg Heim schreibt an Kurt Eisner:
„Sie haben jetzt ein Vorparlament, Soldatenrat, organisierte Arbeiter und Bauern. Von organisierten Bauern kann ich nicht sprechen, denn zunächst sind nur Bauernbündler im Bauernrat und einige willkürlich geladene Bauern. Unsere Arbeit wird ein anderes Gewicht haben, wenn wir als Standesorganisation vollwertig dem Vorparlament angehören.“
13. 11 1918 - Ludwig III. dankt als bayerischer König ab
Anif * König Ludwig III. dankt mit den Worten ab:
Zeit meines Lebens habe ich mit dem Volk für das Volk gearbeitet. Die Sorge für das Wohl meines geliebten Bayerns war stets mein höchstes Streben.
Nachdem ich infolge der Ereignisse der letzten Tage nicht mehr in der Lage bin, die Regierung weiterzuführen, stelle ich allen Beamten, Offizieren und Soldaten die Weiterarbeit unter den gegebenen Verhältnissen frei und entbinde sie des mir geleisteten Treueeides.
Anif den 13. November 1918. Ludwig.
Das ist zwar nicht die vom Ministerrat des Volksstaates Bayern gewünschte „bedingungslose Abdankung“. Dennoch wird von Ludwig III.
- weder der Anspruch seines Hauses auf die Krone aufrecht erhalten,
- noch die Beibehaltung der monarchischen Staatsform reklamiert.
13. 11 1918 - Der Republikanische Bürgerrat München wird geründet
München * In München wird der Republikanische Bürgerrat auf demokratisch-nichtsozialistisch-republikanischer Grundlage gegründet.
13. 11 1918 - Annullierung des Friedensvertrags von Brest-Litowsk
Moskau * Die Sowjetregierung annulliert den Friedensvertrag von Brest-Litowsk vom 3. März 1918.
13. 11 1918 - Forderungen zu freiwilliger Zucht und Unterordnung
München * Ministerpräsident Kurt Eisner, der Minister für militärische Angelegenheiten Albert Roßhaupter und der Arbeiter- und Soldatenrat Sauber fordern die Soldaten zu freiwilliger Zucht und Unterordnung auf.
Im ganzen Land werden Übergriffe und Eingriffe der Arbeiter- und Soldatenräte in das öffentliche Rechtsleben und die Verwaltung beklagt.
13. 11 1918 - Den Thronverzicht zur Kenntnis genommen
München * Der Thronverzicht Ludwigs III. wird vom Ministerrat (gez. Eisner) „zur Kenntnis genommen“. Er sichert ihm und seinen Angehörigen das Aufenthaltsrecht und die volle Bewegungsfreiheit in Bayern zu, sofern sie nichts gegen den Bestand des Volksstaates Bayern unternehmen würden.
13. 11 1918 - Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg dankt ab
Altenburg * Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg dankt ab.
13. 11 1918 - König Friedrich August III. von Sachsen verzichtet auf den Thron
Schloss Guteborn - Dresden * Während der Revolution ist Schloss Guteborn Zufluchtsort für den sächsischen König Friedrich August III.. Dort dankt er am 13. November ab, um sich anschließend auf seinen schlesischen Privatbesitz Schloss Sibyllenort zurückzuziehen.
13. 11 1918 - Fürst Friedrich von Waldeck-Pyrmont wird für abgesetzt erklärt
Arolsen * Fürst Friedrich von Waldeck-Pyrmont wird durch eigens aus Kassel angereiste Vertreter des dortigen Arbeiter- und Soldatenrats für abgesetzt erklärt. Das Fürstentum wird dadurch ein Freistaat.
13. 11 1918 - König Karl IV. von Ungarn dankt ab
Wien - Budapest * König Karl IV. von Ungarn verzichtet - zwei Tage nach dem selben Vorgang in Österreich - „auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften“.
13. 11 1918 - Der Bauernführer Ludwig Gandorfer wird in Pfaffenberg beigesetzt
Pfaffenberg * Der Bauernführer Ludwig Gandorfer wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in seiner Heimatgemeinde Pfaffenberg beigesetzt. An seinem Grab wird die Marseillaise gespielt.
13. 11 1918 - Verfahrensweise für alle Veröffentlichungen
München * Nach einem Aufruf des Münchner Soldatenrats betont die Regierung, „dass alle Veröffentlichungen, die von den frei gewählten Körperschaften [ausgehen], einstweilen vom Ministerpräsidenten oder einem der Fachminister unterzeichnet sein“ müssen. Ohne diese Zeichnung sind sie unzulässig und werden unterdrückt. Die Regierung will von den Räten unabhängig sein und lässt eine Konkurrenz der Räte bei der Ausübung der Staatsgewalt nicht zu.
13. 11 1918 - Planungen für eine Rote Garde eingestellt
Berlin * Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Rat der Volksbeauftragten und dem Vollzugsrat wird dessen Aufruf zur Bildung einer Roten Garde vom Vortag vorläufig eingestellt. Aus Sicht der Volksbeauftragten hat der Vollzugsrat seine Kompetenzen weit überschritten.
13. 11 1918 - Ein Rat geistiger Arbeiter wird gegründet
München * Unter dem Vorsitz des Nationalökonomen Lujo Brentanowird ein Rat geistiger Arbeiter gegründet. Diesem gehören Künstler, Lehrer, Wissenschaftler, Ärzte und Juristen an.
In einem am nächsten Tag veröffentlichten Aufruf heißt es: „Der Volksstaat kann der Mitwirkung der geistigen Arbeiter nicht entbehren. Ihr Zusammenschluß ist daher dringend notwendig. Um ihn herbeizuführen, hat sich heute ein Rat geistiger Arbeiter gebildet. Unser Ziel ist: zum Wohle des ganzen Volkes den Einfluß der geistigen Arbeit geltend zu machen und in diesem Rahmen deren Daseinsbedingung zu sichern.“
13. 11 1918 - Eine organisatorische Anordung für die Soldatenräte
München - Freistaat Bayern * Eine Anordnung, unterzeichnet von Ministerpräsident Kurt Eisner, dem Minister für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter, und dem Vorsitzenden des Vollzugsausschusses, Fritz Sauber, für die Soldatenräte in ganz Bayern bestimmt,
- dass neben den Kasernenräten auch Lazaretträte als Vertretungen der Verwundeten zu wählen sind,
- dass Vertrauensmänner auf Divisionsebene gewählt werden sollen. (Sie werden später Garnisionsräte genannt.),
- dass die Gesamtheit der Soldatenräte ihre Zusammenfassung in einem Vollzugsausschuss findet,
- dass der Vollzugsausschuss seinerseits zwei Bevollmächtigte abordnen soll, die mit dem Minister für militärische Angelegenheiten „in innigster Fühlung zusammenarbeiten“ werden.
14. 11 1918 - Ministerpräsident Kurt Eisner will ein neues Beamtenrecht
München-Kreuzviertel * Ministerpräsident Kurt Eisner fordert die Schaffung eines neuen Beamtenrechts und macht sich für die Möglichkeit der Entlassung unfähiger und unwilliger Beamter stark.
14. 11 1918 - Errichtung eines Ministeriums für soziale Fürsorge
München-Kreuzviertel * Die Regierung des Freistaats Bayern gibt
- die Errichtung eines Ministeriums für soziale Fürsorge und
- die Ausgabe eines staatlich genehmigten Notgeldes bekannt.
14. 11 1918 - Die deutsche Streitmacht ergibt sich in Nord-Rhodesien
Nord-Rhodesien * Die deutsche Streitmacht in Nord-Rhodesien ergibt sich.
14. 11 1918 - Großherzog Friedrich II. von Baden erklärt seinen Thronverzicht
Karlsruhe * Der badische Großherzog Friedrich II. erklärt seinen vorläufigen Thronverzicht, indem er mitteilen lässt, dass er auf die Ausübung seiner Regierungsgewalt verzichtet.
14. 11 1918 - Die erste Sitzung des Arbeitsausschusses
München-Graggenau * Der aus 23 Mitgliedern bestehende Arbeitsausschuss hält seine erste Sitzung ab.
- Er tritt neben dem Magistrat und dem Kollegium der Gemeindebevollmächtigten als beschlussfassendes Organ an.
- Später wird er als Arbeits- und Demobilmachungsausschuss auftreten.
14. 11 1918 - Der Thronverzicht von König Ludwig III. wird veröffentlicht
München - Freistaat Bayern * Der Ministerrat des Freistaats Bayern veröffentlicht die Rücktrittserklärung von König Ludwig III.. Alle Regierungsmitglieder mussten zuvor den Rücktritt durch ihre Unterschrift quittieren.
In der Veröffentlichung heißt es: Der Ministerrat nimmt „den Thronverzicht Ludwigs III. zur Kenntnis“. Und weiter: „Es steht dem ehemaligen König und seiner Familie nichts im Wege, sich wie jeder andere Staatsbürger frei und unangetastet in Bayern zu bewegen, sofern er und seine Angehörigen sich verbürgen, nichts gegen den Bestand des Volksstaates Bayern zu unternehmen.“
14. 11 1918 - Das Privatvermögen der Wittelsbacher soll nicht angetastet werden
München-Kreuzviertel * Wie aus den Ministerratsprotokollen vom 14., 15. und 20. November 1918 hervorgeht, mahnt Ministerpräsident Kurt Eisner ausdrücklich an, dass das Privatvermögen der Wittelsbacher nicht anzurühren und auf „keine unvornehme Art“ vorzugehen ist.
14. 11 1918 - Die Hofbeamten werden Staatsbeamte
München-Kreuzviertel * Die Hofbeamten werden in das Finanzministerium übernommen.
14. 11 1918 - Wie passen Beamtentum und Volksstaat zusammen ?
München - Freistaat Bayern * Der vom Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, Dr. Franz Xaver Schweyer, verfasste Leitartikel der Bayerischen Staatszeitung beschäftigt sich mit der Frage „Beamtentum und Volksstaat“.
Dr. Schweyer schreibt: „Während der einfache Straatsbürger seine Stellung zu der neuen Regierung sich einstweilen vorbehalten und die Entwicklung der Dinge abwarten kann, war der Beamte, vor allem der Staatsbeamte, in die bittere Notwendigkeit versetzt, binnen weniger Stunden sich zu entscheiden, ob er der neuen Regierung seine Arbeitskräfte zur Verfügung stellen und seine Amtsgeschäfte fortführen kann und darf oder ob er, ohne Rücksicht auf weitgehende wirtschaftliche Folgen für sich und seine Familie seine Tätigkeit einstellen soll.”
14. 11 1918 - Die Bayerische Mittelpartei wird in Nürnberg gegründet
Nürnberg * In Nürnberg wird die Bayerische Mittelpartei - BMP gegründet. Die Anhängerschaft der Partei rekrutiert sich aus protestantischen Kreisen des Bildungsbürgertums und der Beamtenschaft sowie des protestantischen fränkischen Mittelstands, des Kleinbauerntums und der Deutschnationalen.
Sie lehnt - wie die Deutschnationale Volkspartei - DNVP, die sie sich im März 1920 als bayerischer Landesverband anschließen wird, - die Staatsform der Republik ab.
14. 11 1918 - Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin dankt ab
Schwerin * Fünf Tage nach Kaiser Wilhelm II. muss auch Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin abdanken.
14. 11 1918 - Die Regierung entgegnet Gerüchten
München - Freistaat Bayern * In einem Plakat wird von der bayerischen Regierung Gerüchten entgegengetreten, wonach Bank- und Sparkassenkonten beschlagnahmt werden sollten.
Auch die Gehaltsansprüche der im öffentlichen Dienst beschäftigten und die Pensionen der Beamten bleiben unberührt.
14. 11 1918 - Die Staatssekretäre werden im Amt bestätigt
Berlin * Die meisten Staatssekretäre werden ohne weiteren Kommentar in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich die Leitung des Kriegsernährungsamtes wird von dem USPD-ler Emanuel Wurm übernommen.
14. 11 1918 - Das neue Hauptquartier der OHL in Kassel
Kassel * Die Oberste Heeresleitung - OHL schlägt ihr neues Hauptquartier in Schloss Wilhelmshöhe in Kassel auf. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wird vom sozialdemokratischen Oberbürgermeister ziemlich devot begrüßt. Die Mitglieder des Arbeiter- und Soldatenrats nehmen ihre rote Armbinden ab.
14. 11 1918 - Die Revolutionäre werden zur Minderheit
München * Der am ersten Revolutionstag (7. November) in München entstandene Zentralarbeiterrat hat sich aus dem im Mathäserbräu gewählten Arbeiterrat entwickelt. Er ist gleichbedeutend mit dem Revolutionären Arbeiterrat, der umgehend die Organisation von Betriebsräten in München ergreift.
Die Münchner Betriebsräte gaben sich eine Geschäftsordnung und wählten ihren eigenen Münchner Arbeiterrat. Dieser wird von Gewerkschaftsführern geleitet. Er beansprucht für sich die legitime Vertretung des Münchner Proletariats zu sein.
An diesem 14. November zwingt der Münchner Arbeiterrat den Revolutionären Arbeiterrat zur Annahme der nachstehenden Forderungen:
- Die Mitgliederzahl des Revolutionären Arbeiterrats ist auf fünfzig zu beschränken.
- Der Revolutionäre Arbeiterrat wird sich mit den 550 Vertretern des Münchner Arbeiterrats zusammenschließen.
- Diese vereinigte Körperschaft wird dann einen neuen Zentralarbeiterrat wählen; von dessen fünfzig Mitgliedern darf der Revolutionäre Arbeiterrat zehn bestimmen.
Innerhalb der Arbeiterräte in München bilden die Revolutionäre nunmehr eine Minderheit.
14. 11 1918 - Der Politische Rat geistiger Arbeiter wird ins Leben gerufen
München * Anhänger Kurt Eisners gründen den Politischen Rat geistiger Arbeiter. Vorsitzender wird der Schriftsteller Heinrich Mann.
Der Politische Rat geistiger Arbeiter wird als Gegenstück zum Rat geistiger Arbeiter gebildet. Dessen Vorsitzender Lujo Brentano war Eisner gegenüber sehr kritisch eingestellt und hatte diesen - noch vor der Revolution - in einem Presseartikel wegen „Verunglimpfung der deutschen Wissenschaft“ massiv angegriffen.
14. 11 1918 - Kurt Eisner lädt Gustav Landauer zur Mitarbeit ein
München - Krumbach * Eine Woche nach Ausrufung des Freistaats Bayern, schreibt Ministerpräsident Kurt Eisner an Gustav Landauer in Krumbach: „Kommen Sie, sobald es Ihre Zeit erlaubt. Was ich von Ihnen möchte, dass Sie durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitwirken.“
Um 15. 11 1918 - Dr. Fritz Gerlich will Eisner-Protegés verhindern
München * Dr. Fritz Gerlich gründet den Verband der Beamten der wissenschaftlichen Anstalten und Kunstsammlungen Bayerns. Er will damit das Eindringen von Eisner-Protegés verhindern.
15. 11 1918 - Die Bayerische Volkspartei akzeptiert die revolutionären Ereignisse
München * Die Bayerische Volkspartei - BVP betrachtet „den gegenwärtigen staatspolitischen Zustand Bayerns, wie er durch die Ereignisse in der Nacht vom 7. zum 8. November in München geschaffen wurde, als eine gegebene geschichtliche Tatsache“.
15. 11 1918 - Kurt Eisner hält seine erste Regierungserklärung
München-Kreuzviertel * Kurt Eisner hält vor dem Provisorischen Nationalrat seine erste Regierungserklärung, in der er darstellt,
- dass noch niemals eine Regierung in schwierigeren Zeiten ihr Amt übernommen hat,
- dass wir verhängnisvoll belastet sind mit einem fluchwürdigen Erbe,
- das mit dem Zusammenbruch des verfallenen Systems nicht zugleich ausgetilgt ist.
15. 11 1918 - Beratung über Gründung eines Studentenausschusses
München-Maxvorstadt * Um die sozialen und wirtschaftlichen Belange der Münchner Studentenschaft besser vertreten zu können, wird an der Universität über die Gründung eines Allgemeinen Studentenausschusses beraten.
15. 11 1918 - Die Republik Deutsch-Österreich wird proklamiert
Wien * Die Republik Deutsch-Österreich wird durch die provisorische Nationalversammlung proklamiert.
15. 11 1918 - Adolf II. Fürst zu Schaumburg-Lippe dankt ab
Schloss Bückeburg * Adolf II. Fürst zu Schaumburg-Lippe verzichtet auf den Thron.
15. 11 1918 - Kurt Eisners Regierungsprogramm
München * Die von der Regierung des Volksstaates Bayern veröffentlichte Kundgebung trägt unverkennbar die schwärmerisch-idealistische Handschrift von Kurt Eisner.
Der Aufruf „An das bayerische Volk“ mit seinen konkreten Hinweisen wird von den Zeitgenossen „wegen der realistischen Zustandsbeschreibung und der Ausgewogenheit der darin angekündigten Maßnahmen“ als offizielles Regierungsprogramm verstanden und findet selbst bei der bürgerlichen Presse positive Aufnahme.
Darin wird einerseits
- die volle Freiheit der Religionsgesellschaften und die Ausübung ihres Kultus gewährleistet.
- Andererseits fordert Eisner die gleiche Freiheit für die Schule wie für die Kirche.
- Ein neues Volksschulgesetz mit fachmännischer Schulaufsicht wird darin angekündigt.
- Das bedeutet die Beseitigung der geistlichen Schulaufsicht und damit die Ausschaltung des bisherigen starken kirchlichen Einflusses auf das Schulwesen.
Neu stellen sich auch die Fragen
- der staatlichen Alimentierung,
- der steuerlichen Behandlung und
- dem öffentlich-rechtlichen Charakter der Kirche sowie
- der Besetzung der Bischofsstühle und der Pfarreien.
15. 11 1918 - Die Einführung von Angestelltenräten gefordert
München - Freistaat Bayern * Die Vereinigten Verbände des bayerischen Verkehrspersonals und der Bayerische Beamten- und Lehrerbund fordern von der Regierung, dass bei allen Ministerien Angestelltenbeiräte errichtet werden.
15. 11 1918 - Nuntius Pacelli berichtet dem Vatikan zu den revolutionären Vorgängen
München - Vatikan * Nuntius Eugenio Pacelli verfasst zwei von drei analytisch-zusammenfassende Berichte an den Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri. Die Ursache der Revolution sieht Pacelli in
- der militärischen Lage mit dem Kriegseintritt der USA,
- dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn,
- die Kampfmüdigkeit der deutschen Soldaten, sodass die als unüberwindlich geltende Hindenburg-Linie ins Wanken geriet,
- und dass die Generäle die päpstliche Friedensvermittlung vom 1. August 1917 zurückgewiesen haben, die Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg befürwortet hatte.
Über Ministerpräsident Kurt Eisner äußert sich Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII, folgendermaßen: Eisner ist „Atheist, Radikalsozialist, unversöhnlicher Propagandist, Busenfreund russischer Nihilisten und noch dazu galizischer Jude. […] Unmittelbar nach den Ereignissen hat sich das bayerische Diplomatische Corps in der Nuntiatur zusammengefunden und beschlossen, jegliche Anerkennung der neuen Regierung zu vermeiden.“
15. 11 1918 - Die formale Übernahme der bisherigen königliche Rechte
München - Freistaat Bayern * Die provisorische Regierung schafft die Rechtsgrundlage für die formale Übernahme der bisherigen königliche Rechte. Sie erlässt eine Verordnung, nach der die „bisher durch Verfassung, Gesetze und Verordnungen dem König persönlich vorbehaltenen Entscheidungen und Verfügungen […] von den Ministern innerhalb ihrer Geschäftsbereiche erlassen“ werden.
15. 11 1918 - Der Ministerrat lehnt die Überwachung der Minister durch Räte ab
München-Kreuzviertel * Der Ministerrat lehnt die „einzelnen Versuche von Vertretern des Soldaten- und Arbeiterrates, die laufende Tätigkeit der Minister zu überwachen, […] als unzulässig und undurchführbar“ ab. Er begründet dies mit dem Argument, dass es „unmöglich“ sei, „einen Gendarm neben sich zu haben“.
Dagegen wird eine „fortlaufende Informierung der Räte über wichtige Angelegenheiten“ durchaus als zweckmäßig und anstrebenswert erachtet.
15. 11 1918 - Räte als Grundlage der neuen Demokratie
München-Kreuzviertel * Ministerpräsident Kurt Eisner sieht in den Räten die Grundlage für sein Konzept einer neuen Demokratie. In seiner Regierungserklärung erklärt er, dass die Demokratisierung des öffentlichen Geistes wie der öffentlichen Einrichtung noch vor der Einberufung einer konstituierenden Nationalversammlung erreicht werden soll.
Kurt Eisner will die Demokratisierung über eine Art Nebenparlament herbei führen, mit dem er auch bürgerliche Kreise zur Mitwirkung am Aufbau des neuen Staates gewinnen wollte. Dieses Nebenparlament sollte ihre Interessen sowohl gegenüber dem provisorischen Zentralparlament als auch gegenüber der Regierung einbringen können.
„Ich habe vom ersten Tag der Revolution an in dem System der Räte die große Schule der Demokratie und des Sozialismus gesehen und glaube nicht, dass wir in Deutschland weiterkommen können, wenn wir nicht dieses System der Räte entwickeln […] und dadurch das Volk mündig machen zur Entscheidung über sein Schicksal.
Nicht die Politik des Wahlzettels tut es allein. […] Das hindert nicht, dass auch die Politik des Wahlzettels notwendig ist, aber das Rätesystem […] soll den Wähler lesen, denken und entscheiden lehren, nicht in acht Tagen vor der Wahl, sondern tagaus, tagein.“
15. 11 1918 - Innenminister Auer: Kein Handlungssspielraum für die Räte
München - Freistaat Bayern * Innenminister Erhard Auer informiert die nachgeordneten Regierungsstellen und Behörden auch über die Zusammenarbeit mit den Räten. Er empfiehlt „dringend, die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, die sich allerorten gebildet haben, […] tunlichst zu benutzen, einerseits, um dadurch das etwa mangelnde Personal so weit notwendig zu ersetzen, andererseits aber auch diese Räte zu beschäftigen und dadurch das Verantwortungsgefühl in der Bevölkerung wieder zu wecken“.
Auer macht aber auch deutlich aufmerksam, dass die Räte den Behörden untergeordnet sein sollen. „Ein eigenständiger Handlungsraum soll ihnen nicht zugestanden werden“.
15. 11 1918 - Hugo Preuß soll die Verfassung der Republik erarbeiten
Berlin * Das Kabinett beruft den liberalen Staatsrechtler Hugo Reuß zum Staatssekretär des Reichsamtes des Inneren. Reuß soll die neue Verfassung der Republik ausarbeiten. Ein Liberaler und kein Sozialdemokrat wird diese wichtige zentrale Aufgabe anvertraut.
15. 11 1918 - Abkommen zwischen Gewerkschaft und Unternehmerverband
Berlin * Die Gewerkschaften sehen die Chance, endlich als Interessenvertretung der Arbeiterschaft in wirtschaftlichen Fragen anerkannt zu werden. In Zukunft sollen die Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge geregelt werden, die zwischen den Unternehmerverbänden und den Gewerkschaften abgeschlossen werden.
Die beiden Verhandlungsführer Hugo Stinnes, mächtiger Schwerindustrieller sowie Verhandlungsführer der Unternehmerseite, und Carl Legien, der Vorsitzende der Generalkommission der Freien Gewerkschaften, unterzeichnen ein weitreichendes, die genannten Punkte beinhaltendes Abkommen.
15. 11 1918 - Ministerpräsident Kurt Eisner und der Föderalimus
München * In dem von Ministerpräsident Kurt Eisner ausgearbeiteten Regierungsprogramm findet sich die föderalistische Forderung, „dass die Selbstbestimmung Bayerns innerhalb des Ganzen erhalten und gesichert werden muss“. Er will damit erreichen:
- die Bildung einer Staatenvereinigung [die Vereinigten Staaten von Deutschland], der auch Deutsch-Österreich angehören soll.
- Unabdingbar ist dafür die Neugliederung des Deutschen Reichs, damit die Vorherrschaft eines einzelnen Staates ausgeschlossen wird.
- Die Freiheit und die Selbstständigkeit Bayerns dürfen dabei nicht angetastet werden.
15. 11 1918 - Thomas Mann empört sich über seinen Bruder Heinrich
München-Bogenhausen * Thomas Mann notiert in sein Tagebuch das Missfallen über seinen Bruder Heinrich, der kurz zuvor zum Vorsitzenden des Politischen Rates geistiger Arbeit gewählt worden war:
„Heut im Morgenblatt Kundgebungen zweier verschiedener ‚Räte der geistigen Arbeiter‘, die eine, sehr vorläufig und allgemein gehalten, von einer Gruppe um Brentano, die andere, empörend hochnäsig, fanatisch-politisch und ketzerrichterisch, von einer Gruppe um Heinrich und - [dem Münchner Journalisten] Friedenthal. Die Publikation regte mich sehr auf […]. Würdelosigkeit und selbstverräterisches Elend im ganzen Lande.“
15. 11 1918 - Kurt Eisner und die Sozialisierung
München * In seinem Programm der Bayerischen Republik bringt Ministerpräsident Kurt Eisner seine Position zur Sozialisierung zum Ausdruck: „Man kann nicht sozialisieren, wenn kaum etwas da ist, was zu sozialisieren ist“. Seine Hauptsorge ist die Wiederherstellung der Ordnung und die Gewinnung des Vertrauens seiner Regierung.
15. 11 1918 - Kurt Eisner und die Demokratisierung Bayerns
München * In seinem Regierungsprogramm der Regierung des Volksstaates Bayern spricht Ministerpräsident Kurt Eisner auch das Thema Demokratisierung an:
„In der inneren Politik Bayers streben wir die rascheste Durchführung einer nicht nur formellen, sondern lebendig tätigen Demokratie an. Bevor noch die konstituierende Nationalversammlung, die so schnell wie möglich nach Erledigung der notwendigen Vorarbeiten einberufen werden soll, zusammentritt, muss diese Demokratisierung des öffentlichen Geistes wie der der öffentlichen Einrichtungen erreicht werden können. Wir suchen auch hier auf neuen Wegen zusammen vorwärts zu kommen.“
16. 11 1918 - Die erste Kolonne von der Westfront trifft in München ein
München * Die erste Kolonne von der Westfront trifft in München ein.
16. 11 1918 - Die Grippe-Epidemie lässt nach
München * Die Grippewelle ebbt ab. Es sterben aber immer noch 127 Menschen an der Epidemie.
16. 11 1918 - König Wilhelm II. von Württemberg entbindet die Beamten vom Treueid
Stuttgart * Der Kabinettschef der königlichen Regierung entbindet im Auftrag König Wilhelm II. mit einem Schreiben an die provisorische Regierung alle Staatsdiener von ihrem Diensteid gegenüber dem König.
16. 11 1918 - Das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz wird Republik
Strelitz * Da Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin seit dem 27. Februar 1918 auch die Regierungsgewalt im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz als Reichsverweser ausübt, wird dieses Land nach seinem Rückritt zur Republik.
16. 11 1918 - Professor Foerster hält die Aufklärung der Deutschen für notwendig
Bern - München * Professor Dr. Friedrich Wilhelm Foerster hält die Aufklärung des deutschen Volkes im großen Maßstab für notwendig, da „dessen Bildungsschichten ja in der Tat noch keine Ahnung von den wahren Ursachendes Krieges und der Kriegsverlängerung haben“.
16. 11 1918 - Die Deutsche Volkspartei in Bayern wird gegründet
München * Die Deutsche Volkspartei - DVP in Bayern wird gegründet. Die Partei bekennt sich zur Republik und versteht sich ausdrücklich als bürgerlich. Der linksliberale Flügel ist in der Partei dominierend. Der Münchner Arzt Dr. Georg Hohmann wird zum Vorsitzenden gewählt.
Die DVP in Bayern entspricht der Deutschen Demokratischen Partei - DDP im übrigen Reichsgebiet. 1920 wird die DVP in Bayern deren Namen übernehmen.
16. 11 1918 - Eine Kommission für eine Soldatenräte-Verordnung
München * Eine Versammlung der Münchner Kasernenräte ernennt eine sechsköpfige Kommission, die gemeinsam mit dem Ministerium für militärische Angelegenheiten einen Entwurf für eine Vorläufige Verordnung für die Soldatenräte erarbeiten soll.
16. 11 1918 - Kompetenzabgrenzung zwischen Volksbeauftragte und Vollzugsausschuss
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten und der Vollzugsrat beschäftigt sich in einer gemeinsamen Sitzung am 16. und 18. November mit Kompetenzfragen. Ein Ausschuss wird gebildet, der möglichst schnell eine Regelung über das künftige Verfahren erarbeiten soll.
Um den 16. 11 1918 - Pläne der Obersten Heeresleitung zur Gegenrevolution
Kassel - Berlin * Oberst Hans von Haeften unterbreitet in der Berliner Reichskanzlei dem Ministerialdirektor Walter Simons die Vorschläge der Obersten Heeresleitung - OHL zur Niederschlagung der Revolution. Haeften soll vorfühlen, ob mit Reichskanzler Friedrich Ebert eine Gegenrevolution durchführbar wäre.
17. 11 1918 - Die Revolutionsfeier im Nationaltheater
München-Graggenau * Im Nationaltheater wird eine Revolutionsfeier abgehalten. „Keine festliche Auffahrt, keine rauschenden Toiletten, keine blinkenden Ordenssterne und Diademe. Die Karten waren durch das Los verteilt worden, so dass das äußerliche Bild ganz anders war als bei den Festaufführungen der Vergangenheit.“
Kurt Eisner spricht erstmals seit der Revolution wieder in der Öffentlichkeit. Zum Abschluss singen die Zuhörer Kurt Eisners „Hymne an die Revolution“ und bringen danach Hochrufe auf die „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, auf Eisner und die soziale Republik“ aus.
Kurt Eisner ist mit einem schwarzen Gehrock gekleidet. Seine Haare sind ordentlich geschnitten und frisiert. Er spricht von der Revolution wie von einer heiligen Reliquie. Für ihn war es die Revolution, die „die Idee, das Ideal und die Wirklichkeit vereint. „Da wir eine neue Form der Demokratie suchen“, müssen die Fehler und die Schuld der Vergangenheit zugegeben werden. „Vergessen wir, was war, und vertrauen wir dem, was wird.“
17. 11 1918 - Die Deutsche Volkspartei in Bayern wird gegründet
München * Die Deutsche Volkspartei in Bayern wird von Vertretern der früheren Fortschrittlichen Volkspartei gegründet. Die Partei bekennt sich „freudig zum neuen freien Volksstaat; sie lehnt jeden Versuch, das Alte wiederherzustellen, ab, verlangt aber, dass der jetzige, auf Gewalt beruhende Zustand alsbald in einen geordneten Rechtszustand überführt werden“ muss.
17. 11 1918 - Die Vertrauenswürdigkeit der bayerischen Regierung herausgestellt
Washington - München * Der amerikanische Pazifist George D. Herron berichtet Kurt Eisner: „Ich habe mein möglichstes getan, um den Präsidenten Wilson und die Entenre-Regierungen zu überzeugen, dass Ihre Regierung vertrauenswürdig ist“.
Herron drängt Eisner zu einem „vollen und offenen Bekenntnis der Schuld und Untaten der deutschen Regierung am Anfang des Krieges und an den Grausamkeiten der Kriegsführung. […] Die moralische Wirkung einer solchen Handlung wäre gewaltig und entscheidend.“
17. 11 1918 - Revolution als Aufbruch in die Freiheit und zur sozialen Gerechtigkeit
Frankfurt am Main * Die Deutsche Friedensgesellschaft feiert gemeinsam mit dem Deutschen Frauenausschuss und den Frankfurter MSPD-Frauen in der Frankfurter Paulskirche die Revolution als „Aufbruch in die Freiheit und zur sozialen Gerechtigkeit“.
17. 11 1918 - Groener und Hindenburg wollen Reichskanzler Ebert schützen
Berlin * Generalquartiermeister Wilhelm Groener schreibt an seine Frau: „Der Feldmarschall und ich wollen Ebert, den ich als geraden, ehrlichen und anständigen Charakter persönlich schätze, schützen, so lange es irgend geht, damit der Karren nicht noch weiter nach links rutscht.“
17. 11 1918 - Der Politische Rat geistiger Arbeiter soll in den Nationalrat
München * Ministerpräsident Kurt Eisner sagt dem Politischen Rat geistiger Arbeiter eine Vertretung im Provisorischen Nationalrat des Volksstaates Bayern zu.
18. 11 1918 - Die Süddeutsche Freiheit. Münchner Montags-Zeitung erscheint
München * Erstmals gibt Erich Mühsam die Süddeutsche Freiheit. Münchner Montags-Zeitung heraus.
18. 11 1918 - Eine bayerische Kommission will verursachte Kriegsschäden untersuchen
München - Bern * Ministerpräsident Kurt Eisner bittet den bayerischen Gesandten in Bern, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Foerster, der Entente ein Schreiben zukommen zu lassen, das einer bayerischen Kommission erlaubt, die in Belgien und Nordfrankreich durch deutsche Truppen verursachten Kriegsschäden zu untersuchen.
18. 11 1918 - Fleischversorgung für München
München * 25.000 Rinder werden über die Reichsfleischstelle zur Schlachtung in München zugeteilt. Durch Einpökeln soll damit eine Fleischreserve für den Winter geschaffen werden.
18. 11 1918 - Annullierung des Friedensvertrags von Brest-Litowsk abgelehnt
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten lehnt in Berlin die Annullierung des Friedensvertrags von Brest-Litowsk durch die Sowjet-Regierung ab.
18. 11 1918 - Rosa Luxemburg will die Konzentration der Macht bei den Räten
Berlin * Rosa Luxemburg fordert die Konzentration der Macht in den Händen der Arbeiter- und Soldatenräte.
18. 11 1918 - Aufruf zum Inneren Widerstand gegen die neue Staatsform
München-Kreuzviertel * Michael von Faulhaber schreibt an den bayerischen Episkopat, womit die Gesamtheit der bayerischen Bischöfe gemeint ist, die Anregung für einen gemeinsamen Hirtenbrief.
In dem Schreiben gibt er zu bedenken, „daß ein gemeinsames Hirtenschreiben in dieser Stunde unserem Volk die Dankesschuld gegen das Haus Wittelsbach und König Ludwig III. in offener Sprache ohne Entschuldigung bei der neuen Regierung kundgeben [...] müßte.
[...] Der gestrige Thronverzicht war ein unverantwortlicher Mißgriff der alten Regierung.“
Ohne dies klar zu äußern, fordert der Münchner Bischof seinen Klerus zum Inneren Widerstand gegen die neue Staatsform auf. Und als ihm immer klarer wird, dass er mit seinen Überzeugungen nicht die allgemeine Meinung vertritt, verlegt er sich zum offenen Kampf mit der Regierung des Freistaats Bayern, ohne seine eigenen ultrakonservativen Anschauungen infrage zu stellen.
18. 11 1918 - Im Wagnersaal findet die erste Frauenversammlung statt
München-Ludwigsvorstadt * Im Wagnersaal in der Sonnenstraße findet die erste Frauenversammlung statt. Lida Gustava Heymann fordert die Gründung eines eigenen Frauenrates. Er soll
- politisch noch unorientierte Frauen unterrichten und
- dafür Sorge tragen, dass Frauen Zugang zu allen Berufen und allen entscheidenden Positionen in Staat und Verwaltung erhalten können sowie
- gewährleisten, dass auf den Wahllisten der Parteien zur Nationalversammlung und zum Landtag eine entsprechende Anzahl von Frauen vertreten sind.
18. 11 1918 - Die Rumänen Siebenbürgens wollen zum Königreich Rumänien
Karlsburg * Die Rumänen Siebenbürgens sprechen sich in den Karlsburger Beschlüssen vom 18. November 1918 für die Vereinigung mit dem Königreich Rumänien aus. Rumänische Truppen besetzten daraufhin die Bukowina.
18. 11 1918 - Josef Hofmiller über das alte Regime
München * Josef Hofmiller schreibt in sein Tagebuch über das „alte Regime”:
„Es war kernfaul und fiel, weil es fallen musste. Es wurde nicht gestürzt, sondern über Nacht umgeblasen. Es hatte jede Herrschaft über die Seelen verloren.
Sobald man aufhörte es zu fürchten, war es erledigt. Wie heißt’s doch bei Goethe? ‚Wären’s Könige gewesen, sie stünden noch alle Unversehrt!’”
18. 11 1918 - Die königliche Familie ist in Wildenwart wieder vereint
Schloss Anif - Schloss Wildenwart * Da es im Schloss Anif bei Salzburg, dem neogotischen Wasserschloss des Grafen Ernst von Moy, nicht ausreichend zu Essen gibt, kehrt das Ex-Königspaar bald zurück nach Schloss Wildenwart. Am 18. November sind sie wieder alle vereint.
18. 11 1918 - Die Bayerische un die Französische Revolution
München-Bogenhausen * Klaus Mann wird 12 Jahre alt. Er denkt damals noch ähnlich wie sein Vater Thomas, trotzdem schreibt er: „Kurt Eisner ist Präsident - zu lächerlich. Und trotzdem schmeichelt es einem zu denken, in hundert Jahren redet man von der Bayerischen wie von der Französischen Revolution.“
18. 11 1918 - Verhandlungen für eine Vorläufige Verordnung für Soldatenräte
München * Im Ministerium für militärische Angelegenheiten finden zwischen dem 18. und 22. November 1918 die Verhandlungen für eine Vorläufige Verordnung für die Soldatenräte statt.
18. 11 1918 - Richtlinien für die Räte werden erarbeitet
München * Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte werden erarbeitet. Dabei treten die gegensätzlichen Vorstellungen des Ministerpräsidenten Kurt Eisner und des Innenministers Erhard Auer deutlich zu Tage.
Im Entwurf des MSPD-Politikers Erhard Auer vom 18. November 1918 ist
- die Bildung von Soldaten-, Arbeiter- und Bauernräte nur im Bedarfsfalle vorgesehen.
- Die Räte sollen dann für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sorgen.
- Eine Vollzugsgewalt steht ihnen nicht zu.
- Der Vollzug der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften soll den seitherigen Stellen und Behörden vorbehalten bleiben.
Für Erhard Auer sind die Arbeiter- und Bauernräte hauptsächlich Hilfseinrichtungen und sind damit der Verwaltung eindeutig untergeordnet.
18. 11 1918 - Der linke Flügel der USPD will die Sozialisierung der Betriebe
Berlin * Der linke Flügel der USPD will die Sozialisierung der Betriebe. Hugo Haase bringt im Kabinett den Antrag ein, dass Betriebe, die reif für die Sozialisierung sind, sofort sozialisiert werden müssen.
18. 11 1918 - Ebert wird über die geplante Gegenrevolution informiert
Berlin * Ministerialdirektor Walter Simons informiert Reichskanzler Friedrich Ebert über die Planungen der Obersten Heeresleitung - OHL zur Gegenrevolution. Sie will
- fünfzehn gut disziplinierte Divisionen in Berlin einmarschieren lassen,
- die Arbeiter- und Soldatenräte auflösen,
- Friedrich Ebert zum vorläufigen Reichspräsidenten mit diktatorischer Gewalt proklamieren,
- den Reichstag sofort einberufen und
- eine provisorische Reichsverfassung schaffen.
Ebert reagiert zurückhaltend, was von der OHL gedeutet wird, dass er bei einem Erfolg der Aktion mitmachen, aber nicht die Initiative ergreifen würde.
18. 11 1918 - Rudolf Buttmann lässt sich die Gründung einer Bürgerwehr genehmigen
München * Rudolf Buttmann, Bibliothekar im Bayerischen Landtag, lässt sich vom Referenten für Sicherheitsfragen im Innenministerium, Major Paul von Jahreiß, die Gründung einer Bürgerwehr genehmigen. Zur Beschaffung der Waffen wird Buttmann an das Ministerium für militärische Angelegenheiten verwiesen.
18. 11 1918 - Hedwig Kämpfer fordert frauenrechtliche Schulungen
München * Hedwig Kämpfer von der USPD fordert auf einer großen Frauen-Versammlung „die frauenrechtlerische Schulung der proletarischen Frauen, besonders der Frauen innerhalb der sozialistischen Parteien und Gewerkschaften“.
Diese Forderung wird in Bayern bald verwirklicht. Frauen der radikalen Frauenbewegung und der politisch linksgerichteten schließen sich schon bald zum „Bund sozialistischer Frauen“ zusammen.
19. 11 1918 - 5 Millionen Mark Notgeld werden in Umlauf gebracht
München * Die ersten 5.000.000 Mark Münchner Notgeld werden in Umlauf gebracht.
19. 11 1918 - Angestelltenräte in den Ministerien einrichten
München - Freistaat Bayern * Die Vereinigten Verbände des bayerischen Verkehrspersonals fordern ihre angeschlossenen Organisationen dazu auf, bei den einzelnen Ministerien sofort Angestelltenräte zu errichten und legen dafür Richtlinien vor.
19. 11 1918 - Maßnahmen zur Belebung des revolutionären Geistes
Berlin - München * Der bayerische Gesandte in Berlin, Friedrich Muckle, berichtet an den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner von einem Gespräch mit dem Publizisten und Journalisten Maximilian Harden über die Belebung des revolutionären Geistes. Sie fordern
- die Säuberung der Reichsregierung von allen unfähigen Elementen,
- die sofortige Veröffentlichung der Geheimakten,
- die Verhaftung der Schuldigen und
- die Einführung eines Staatsgerichtshofs zu deren Aburteilung.
Wenn die Berliner Reichsregierung auf diese Forderungen nicht eingeht, so sollte der „Abfall des Südens“ zumindest angedroht werden. Denn: „Preußen hat uns in das Unglück des Krieges gestürzt, es soll uns nicht noch tiefer in den Abgrund, aus dem wir herauszuarbeiten suchen, hinab drücken.“
19. 11 1918 - Die Auflösung des Landtags tritt nie in Kraft
München * Der Entwurf einer Bekanntmachung des Innenministers Erhard Auer, in der die Regierung den Landtag für aufgelöst erklärt, wird nie in Kraft gesetzt.
19. 11 1918 - Vorauseilende Vorschriften für die Räte
München * Obwohl über die Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte erst am 26. November 1918 abschließend beraten werden wird, macht Innenminister Erhard Auer in einem Schreiben deutlich:
„Den Arbeiterräten steht keinerlei Vollzugsgewalt zu. Die bisherigen Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften bleiben in Kraft und werden von den gesetzlich berufenen Behörden, Stellen und Körperschaften vollzogen.
Die Arbeiterräte haben lediglich im Benehmen mit den zuständigen staatlichen und gemeindlichen Stellen und im Rahmen einer hierüber getroffenen Vereinbarung für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zu sorgen und allenfalls die Durchführung weiterer Aufgaben dieser Stellen zu unterstützen.“
19. 11 1918 - Der Revolutionäre Arbeiterrat fordert Rechte
München * Der Revolutionäre Arbeiterrat hat ebenfalls einen Entwurf für die Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte erarbeitet. Er befasst sich hauptsächlich mit der Arbeit und der Stellung der Spitzengremien der bayerischen Räte.
Der Zentralarbeiterrat soll gemeinsam mit den Bauern- und Soldatenräten die revolutionäre Macht darstellen, aber - und das ist abgestimmt mit Innenminister Erhard Auer - keine Vollziehungsgewalt haben.
Dafür fordert der Zentralarbeiterrat aber eine dauernde Kontrolle über die Tätigkeit der Minister und der Ministerien, indem er in jedes Ministerium einen Volkskommissar entsendet. Dieser soll mit umfassenden Beteiligungs- und Initiativrechten ausgestattet werden.
19. 11 1918 - Ein offenes Bekenntnis der Schuld übernehmen
Bern - München * Bayerns Ministerpräsident Kurt Eisner erhält von dem amerikanischen Pazifisten George Davis Herron ein Telegramm, in dem es heißt:
„Ich habe mein möglichstes getan, um den Präsidenten und die Entente-Regierungen zu überzeugen, dass ihre Regierung vertrauenswürdig ist.[…] Vor allem rate ich Ihnen dringend, möglichst viele deutsche Staaten zu überzeugen, Ihrer Führung zu folgen, zweitens die ersten Schritte zu einem vollen und offenen Bekenntnis der Schuld und Untaten der deutschen Regierung am Anfang des Krieges und an den Grausamkeiten der Kriegsführung zu unternehmen. Die moralische Wirkung einer solchen Handlung wäre gewaltig und entscheidend. […] Ich bitte Sie, kühn, offen und unverzüglich zu handeln, nicht nur Deutschlands, sondern der Zivilisation und der Menschheit wegen.“
Diese Ratschläge entsprechen Eisners eigenen Erfahrungen und Intentionen bis ins Detail. Doch welche Handlungsmöglichkeiten stehen ihm konkret offen, da der Rat der Volksbeauftragten in Berlin, der aus je drei SPD- und USPD-Männern besteht, wobei die Letztgenannten über eine Statistenrolle nicht hinauskommen, kaum eigene Schritte zu Friedensverhandlungen unternehmen wird.
19. 11 1918 - Aus dem Kriegsernährungsamt wird das Reichsernährungsamt
Berlin * Das Kriegsernährungsamt wird in Reichsernährungsamt umbenannt.
19. 11 1918 - Die Einstellung der Rüstungsproduktion
München-Kreuzviertel * Die Frage der Entschädigung für zu entlassende Beschäftigte in der Rüstungsindustrie wird im Kabinett besprochen.
Das Waffenstillstandsabkommen sieht die Einstellung der Rüstungsproduktion vor. Doch Munitionsfabriken und Werke für Metallerzeugnisse bilden in Bayern die während der Kriegszeit aufgebauten Hauptindustrien. Eine Umstellung auf Friedensproduktion verlangt in den Fabriken neue Maschinen und die Umschulung der Arbeiter.
19. 11 1918 - Die französische Armee zieht in Metz ein
Metz • Die französische Armee zieht in Metz ein.
20. 11 1918 - Planungen für die Rückkehr von 60.000 bayerischen Soldaten
München * Ein aus Künstler- und Bürgerkreisen gebildeter Ausschuss berät im Künstlerhaus über die Empfangsfeierlichkeiten zu Ehren der nach München zurückkehrenden 60.000 bayerischen Soldaten. Die Stadt stellt dafür 50.000 Mark zur Verfügung. Damit sollen der Bahnhof und Ehrenpforten ausgeschmückt werden.
20. 11 1918 - 600 Matrosen verlassen München
München * 600 Matrosen verlassen nach Aufforderung der Matrosenräte in München, Kiel und Wilhelmshaven die Stadt, um sich an der Bergung der Minen in der Nordsee zu beteiligen.
20. 11 1918 - Die Verwaltung des ehemaligen Kronguts entsteht
München * Der Königliche Obersthofmeisterstab wird in die Verwaltung des ehemaligen Kronguts umgewandelt. Aus dieser wird 1932 die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
20. 11 1918 - Kurt Eisner lädt Nuntius Eugenio Pacelli zum Gespräch
München * Sigmund Ritter und Edler von Lössl bittet den päpstlichen Nuntius Eugenio Pacelli um einen Besuch beim bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, der zugleich das Amt des Außenministers bekleidet.
Pacelli verweigert den Kontakt mit der neuen bayerischen Regierung, bei dem es Kurt Eisner hauptsächlich um Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, also um die Legitimitätsfrage, gegenüber der Regierung geht.
20. 11 1918 - Pacelli begründet seine Ablehnung der Regierung Eisner
München - Vatikan * Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., berichtet in seinem dritten analytisch-zusammenfassenden Bericht ausführlich an den Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri zur Deutung und Auswirkung der Revolution nach Rom. In diesem Brief begründet Nuntius Pacelli auch, warum er den Kontakt zur neuen bayerischen Regierung unter Kurt Eisner ablehnt:
- Die Entscheidung zum Kulturkampf statt zum pragmatischen Kompromiss.
- Das Entgegenkommen der neuen Regierung ist nur taktisch bis zur nächsten Wahl, danach beginnt die offene Kirchenfeindschaft.
- Ein diplomatischer Kontakt wird die Katholiken nur verwirren und demobilisieren, anstatt sie auf den Gegner einzuschwören.
- Die Regierung Eisner besteht aus Juden, Atheisten und Protestanten, alles Sozialisten. Mit solchen Leuten sind keine anständigen Beziehungen möglich.
- Eisner ist ein ostgalizischer Jude, der wegen politischer Verbrechen mehrfach bereits eingesperrt war.
20. 11 1918 - Alles über die Revolution sammeln
München - Freistaat Bayern * Die Bayerische Staatszeitung appelliert in einem Aufruf an alle Bürger, alles über die Revolution zu sammeln und in einem extra für diesen Zweck hergerichteten Zimmer des Landtagsgebäudes für kommende Generationen aufzubewahren.
20. 11 1918 - Gründungsversammlung der bayerischen Rechtsanwälte
München * Die Gründungsversammlung des Landesverbandes der bayerischen Rechtsanwälte findet in München statt.
20. 11 1918 - Kurt Eisners Vorschlag für die Räte-Richtlinie
München * Zwei Tage nach Innenminister Erhard Auer legt auch Ministerpräsident Kurt Eisner seinen Entwurf für die Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte vor. Im Entwurf des USPD-Politikers Eisner nehmen die Arbeiterräte - zumindest für eine Übergangszeit - eine zentrale Position im neugegründeten Staat ein. Gemeinsam mit den Soldaten- und Bauernräten sollen sie bis zur endgültige Regelung durch die zu wählende Nationalversammlung die „revolutionäre Grundlage des neuen Regierungssystems“.
Eisner und die USPD wollen die Räte und das Parlament als gleichberechtigte Partner in einem demokratischen System. Sie dienen der politischen Willens- und Bewusstseinsbildung und schaffen die Voraussetzungen für die Tätigkeit des Parlaments:
„Die Räte sollen die Schulen der Demokratie werden; daraus dann sollen die Persönlichkeiten emporsteigen zu politischer und wirtschaftlicher Arbeit. […] Die Räte sind die Grundmauer der Demokratie, die Nationalversammlung, der Landtag ist die Krönung des Gebäudes. Aber diese Krone würde genauso zusammen stürzen wie die monarchistischen Kronen, wenn sie sich nicht stützen auf die Kraft und den Willen jener Arbeiterräte.“
Die Arbeiterräte sollen „die Massen des Proletariats unmittelbar zur politischen Mitarbeit heranziehen“ und so dazu beitragen, dass „der neue demokratische und sozialistische Geist in Staat und Gesellschaft so tief Wurzeln fasst, dass die kommenden Wahlen die provisorische Ordnung der Dinge bestätigen und befestigen werden“.
Im Falle, die Zentralregierung würde den Revolutionszustand ausrufen, sollten die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte umgehend alle notwendigen Maßnahmen einleiten, die zur Erhaltung und Sicherung der revolutionären Regierung erforderlich wären.
Der Entwurf Kurt Eisners sieht für die Räte großzügige Kompetenzzuweisungen vor. Von Kontroll-, Vorschlags-, Beratungs- und Auskunftsrechten bis hin zur Fragen der Entlassung und Einstellung von Beamten.
20. 11 1918 - Die Deutsche Demokratische Partei - DDP wird gegründet
Berlin * Die Deutsche Demokratische Partei - DDP wird gegründet. Sie bekennt sich zu einer demokratischen und sozialen Republik.
21. 11 1918 - Arbeitszeitreduzierung in den Rüstungsbetrieben
München * Aufgrund des Kohlenmangels wird die Arbeitszeit in den Rüstungsbetrieben auf 34 Stunden reduziert.
21. 11 1918 - Einen Unterhalt für die Wittelsbacher beantragt
München-Kreuzviertel * Das Finanzministerium legt eine Denkschrift über die „Bezüge des früheren Königs und der Mitglieder seines Hauses aus der Staatskasse“ vor. Darin wird
- der ersatzlose Einzug der Zivilliste in Aussicht gestellt und
- aus Billigkeitsgründen ein Unterhalt der Wittelsbacher beantragt.
21. 11 1918 - Eisner fordert die sofortige Veröffentlichung der Kriegsakten
München - Berlin * In einem Telegramm fordert Kurt Eisner den bayerischen Gesandten in Berlin, Dr. Friedrich Muckle, auf, von der Reichsregierung die sofortige Veröffentlichung der Urkunden über den Ursprung des Krieges zu verlangen. Außerdem erhebt der bayerische Ministerpräsident Anspruch auf Beteiligung Bayerns in der Waffenstillstands-Kommission.
Kurt Eisner ist bestrebt, den Alliierten den Beweis zu erbringen, dass mit der deutschen Revolution nicht nur die alten Herrschaftsträger beseitigt wurden, sondern dass auch ein politischer Umdenkungsprozess eingesetzt hat.
21. 11 1918 - Die Entente betrachtet Berlin mit größtem Misstrauen
München * Friedrich Wilhelm Foerster, der Professor der Pädagogik an der Münchner Universität, schreibt Kurt Eisner: „Es ist augenblicklich von hoher politischer Bedeutung, der Entente, gerade weil sie Berlin mit größtem Misstrauen betrachtet, die Perspektive zu eröffnen, dass Bayern die Klärung der politischen Entwicklung in Deutschland entscheidend bestimmen will.“
21. 11 1918 - Keine Vollzugsgewalt für die Räte
München * In einem seiner vielen Briefe und Telegramme an die Behörden und Bezirksämter schreibt Innenminister Erhard Auer unter dem Betreff: Befugnisse der Soldaten-, Arbeiter- und Bauernräte folgende Zeilen:
„Den Soldaten-, Arbeiter- und Bauernräten steht keinerlei Vollzugsgewalt zu. Sie haben daher jeden Eingriff in die staatliche und gemeindliche Verwaltungstätigkeit zu vermeiden. Der Vollzug der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften wird grundsätzlich nach wie vor von den seitherigen Stellen und Behörden wahrgenommen.“
21. 11 1918 - Eduard Schmid fordert Reformen im Rathaus
München-Graggenau * Der Mehrheitssozialist Eduard Schmid fordert in der Magistratssitzung im Münchner Rathaus in einem Antrag
- eine Vereinfachung der Stadtverwaltung,
- eine schrittweise Reform, die der neuen politischen Lage angepasst ist,
- die sofortige Herstellung der „notwendigen Fühlung […] mit den zuständigen Stellen des Volksstaates“.
- „Die Kommunalverbände sollen zunächst durch das Wirken des Arbeiter- und Soldatenrates nicht beeinflusst werden.“
22. 11 1918 - Gründung der Deutschnationalen Volkspartei - DNVP
Berlin * Die Deutschnationale Volkspartei -DNVP wird durch einen Zusammenschluss der Deutschkonservativen Partei, der Freikonservativen Partei, der Christlich-sozialen Partei und der Deutschen Vaterlandspartei - DVLP gegründet.
Die neue Partei sieht sich als Vertreter der vaterländischen Verbände, tritt für die Wiederherstellung der deutschen Monarchie ein und fordert Wahlen zur Nationalversammlung.
22. 11 1918 - Eine Republikanische Schutztruppe wird gegründet
München-Kreuzviertel * Zur persönlichen Sicherheit der Regierungsmitglieder wird von Alfred Seyffertitz die Republikanische Schutztruppe gegründet und Albert Roßhaupter, dem Minister für militärische Angelegenheiten unterstellt.
22. 11 1918 - Nuntius Eugenio Pacelli flieht nach Rorschach in der Schweiz
München - Rorschach * Auf Anraten von Erzbischof Michael von Faulhaber siedelt Nuntius Eugenio Pacelli wegen der revolutionären Vorgänge in München in das Institut Stella Maris nach Rorschach in der Schweiz am Bodensee über.
Pacelli will mit allen Mitteln der Kontaktaufnahme der bayerischen Regierungsvertreter entgehen, da sonst der Eindruck entstehen könnte, dass der Heilige Stuhl die Revolutionsregierung anerkannt habe. Als offiziellen Grund gibt er allerdings gesundheitliche Probleme an, die er auskurieren wolle. Es ist aber wohl eher die Flucht vor der Auseinandersetzung mit der neuen bayerischen Regierung um Ministerpräsident Kurt Eisner. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Nuntiatur und der bayerischen Regierung sind damit auf Eis gelegt.
Die Berichterstattung über die revolutionären Vorgänge an Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri werden von Eugenio Pacellis Uditore [= rechte Hand des Nuntius] Lorenzo Schioppa übernommen. Freilich in dem durch Pacelli vorgegebenen Rahmen.
22. 11 1918 - Großherzog Friedrich II. von Baden unterschreibt seinen Thronverzicht
Schloss Langenstein * Großherzog Friedrich II. von Baden unterschreibt auf Schloss Langenstein im Hegau die Urkunde, mit der er auf den badischen Thron verzichtet.
22. 11 1918 - Die Vorläufige Verordnung für die Soldatenräte unterzeichnet
München * Der Minister für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter, und Fritz Sauber vom provisorischen Landessoldatenrat unterzeichnen die Vorläufige Verordnung für die Soldatenräte. Sie beinhaltet
- die Gehorsamspflicht der Soldatenräte und
- die ausschließliche Befehlsgewalt der militärischen Führer während des militärischen Dienstes.
- Die Soldatenräte sind zu „Eingriffen in nichtmilitärische Gebiete, z.B. in die Zivilverwaltung […] nicht befugt“.
22. 11 1918 - Der Rat der Volksbeauftragten setzt seinen Machtanspruch durch
Berlin * Der von Mitgliedern des Rats der Volksbeauftragten und des Vollzugsrats gebildete Ausschuss zur Erarbeitung der Kompetenzabgrenzung zwischen den beiden Gremien legt sein Ergebnis vor.
Der Rat der Volksbeauftragten setzt seinen Machtanspruch weitgehend durch. Man vereinbart die Einberufung einer Reichsversammlung von Delegierten der Arbeiter- und Soldatenräte.
22. 11 1918 - Die französische Armee zieht in Straßburg ein
Straßburg • Die französische Armee zieht in Straßburg ein.
23. 11 1918 - Verhaltensmaßregelungen des Münchner Erzbischofs
München-Kreuzviertel * In einem von Erzbischof Michael von Faulhaber verfassten Grundsatzpapier fordert er seinen Klerus auf,
- jede positive Anerkennung der neuen Regierung in Bayern und
- jeden direkten Kontakt mit dem neuen Staatsminister für Unterricht und Kultus, Johannes Hoffmann, zu vermeiden.
- „Der geistliche Stand kann und darf nicht daran denken, der tatsächlich bestehenden öffentlichen Gewalt gewalttätigen Widerstand entgegenzusetzen.
- Den öffentlichen Dank und den Abschiedsgruß an das Jahrhundertelang mit dem Bayernvolk verwurzelte Haus Wittelsbach und an die ehrwürdige Gestalt des Königs Ludwig III. müssen wir einem späteren Zeitpunkt vorbehalten.“
23. 11 1918 - Die Nachtarbeit in Bäckereien wird verboten
Berlin - Deutsches Reich * Die Nachtarbeit in den Bäckereien wird verboten und die Gewerbeaufsicht ausgebaut.
23. 11 1918 - Fürst Günther Victor von Schwarzburg verzichtet auf den Thron
Rudolstadt - Sondershausen * Fürst Günther Victor von Schwarzburg-Rudolstadt, der seit 1909 auch das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen regiert, verzichtet auf seinen Thron.
23. 11 1918 - Kurt Eisner sucht Beweise für die deutsche Kriegsschuld
München - Berlin * Kurt Eisner und Felix Fechenbach reisen bereits zwei Tage vor der Ministerpräsidenten-Konferenz am 25. November mit dem Zug nach Berlin, um dort Aktenstudium zu Fragen der deutschen Kriegsschuld zu betreiben. In seinem Gepäck befindet sich eine Mappe mit offiziellen Dokumenten, den Berichten der bayerischen Gesandtschaft in Berlin während der Monate Juli und August 1914.
Nach Durchsicht der ihm zugänglichen diplomatischen Unterlagen glaubt Eisner die Beweise gefunden zu haben, dass die deutsche Regierung Österreich geradezu in den Krieg gegen Serbien hinein getrieben hat. Und zwar in der Absicht, einen europäischen Krieg zu entfachen.
Außerdem geht daraus beispielsweise hervor, dass deutsche und bayerische Beamte nach dem Attentat von Sarajevo bestens informiert waren, aber Ende Juli 1914 nichts gegen „Wiens gefährliches Spiel“ unternommen haben.
23. 11 1918 - Die Zeitschrift Die neue Zeit erscheint
München * Die Zeitschrift Die neue Zeit * Volkstümliche, parteilose Wochenschrift für Freiheit und Recht! erscheint erstmals. Ihr Herausgeber ist Wilhelm Craemer.
Die erste Ausgabe trägt die Überschrift „Könige auf der Flucht!“. Der Artikel beginnt so: „Den Krieg haben wir verloren, - und das ist traurig! Geld und Gut werden wir verlieren, - das ist tiefbetrübend! Und die Könige haben wir auch verloren! - Gott sei Dank! Dreimal Dank!
Hei! Wie sind sie gelaufen, als die rote Fahne sich entfaltete, gelaufen wie die Spitzbuben sind sie, jene Machthaber, die kalten Blutes Millionen von Menschen dem Hungertode nahe gebracht, die Millionen von Existenzen ruiniert haben!“
23. 11 1918 - In Bremen gründen sich die Internationalen Kommunisten Deutschlands
Bremen * Schon während des Krieges ist Bremen eine Hochburg der Linksradikalen. An diesem 23. November benennen sie sich als Internationale Kommunisten Deutschlands.
24. 11 1918 - Die BVP schließt die Wiederherstellung der Monarchie aus
München * Die Bayerische Volkspartei - BVP teilt mit: „Eine Wiederherstellung der Monarchie in der alten Form und Machtvollkommenheit erscheint ausgeschlossen.“
24. 11 1918 - Generalmajor von Kunzmann wird abgesetzt
München * Generalmajor von Kunzmann wird nach nicht einmal zwei Wochen als Stadtkommandant abgesetzt.
24. 11 1918 - Der Ex-König lässt seinem Ärger freien Lauf
Schloss Wildenwart * Ex-König Ludwig III. schreibt an seine Schwester Therese: Wir sind „der Übermacht unterlegen in Folge von Fehlern der Obersten Heeresleitung und der mangelnden Führung der äußeren Politik der Reichsleitung. Wir in Bayern müssen die Folgen mittragen, obwohl wir wahrlich nicht das Geringste dafür können. Die Revolution vom 7. November war zum mindesten sehr überflüssig, da es ein freieres Volk als das bayerische nicht gegeben hat.“
Sein eigenes Versagen als höchster Repräsentant des Königreichs Bayern schiebt er auf die Regierung, die nach seiner Auffassung „keinen Schuss Pulver wert“ gewesen sei. Die Regierung hat ihn „schmählich im Stich gelassen“. Und weil er schon mal ein Feindbild hat, schimpft er weiter über „die Hunde, mit der Gesellschaft habe ich gebrochen, von den Kerlen kommt mir keiner mehr, wenn ich zurück komme“.
24. 11 1918 - Das Berliner Tageblatt veröffentlicht Kriegsschuld-Dokumente
Berlin * Vier Dokumente, die nach Kurt Eisners Meinung die deutsche Schuld am Kriegsausbruch beweisen, werden im Berliner Tageblatt veröffentlicht.
24. 11 1918 - Die Deutschnationale Volkspartei - DNVP wird gegründet
Berlin * Die Deutschnationale Volkspartei - DNVP wird gegründet. Sie bekennt sich „zu der nach den letzten Ereignissen allein möglichen parlamentarischen Regierungsform“.
25. 11 1918 - Die Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz
Berlin * Die Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin, auch Reichskonferenz der deutschen Bundesstaaten genannt, stimmt letztlich nur
- der Einberufung der konstituierenden Nationalversammlung,
- der Aufrechterhaltung der Einheit Deutschlands und
- der schnellen Herbeiführung eines Präliminarfriedens [= Vorfrieden oder vorläufiger Frieden] mit großer Mehrheit zu.
- Bis die konstituierende Nationalversammlung zusammen tritt, werden die Arbeiter- und Soldatenräte als Repräsentanten des Volkswillens angesehen.
25. 11 1918 - Die deutsche Schutztruppe für Deutsch-Ostarika kapituliert
Abercorn-Nordrhodesien * Der Kommandeur der deutschen Schutztruppe für Deutsch-Ostarika, Paul von Lettow-Vorbeck, unterzeichnet in Abercorn [heute: Mbala] südlich des Tanganjika-Sees die Kapitulation. Er hatte erst am 13. November 1918 die Nachricht vom Waffenstillstand in Europa erhalten.
25. 11 1918 - Zahlungen an die Zivilliste endgültig eingestellt
München-Kreuzviertel * Die Zahlungen an die Königliche Zivilliste werden endgültig eingestellt.
25. 11 1918 - Der Stamm der alten Macht muss entwurzelt werden
Nürnberg * Der Chefredakteur der Fränkischen Tagespost, Adolf Braun, er ist ganz bestimmt kein Revoluzzer, schreibt:
„Der Stamm der alten Macht darf nicht nur gefällt werden, er muss entwurzelt sein. So ergibt sich die Diktatur des Proletariats nach dem revolutionären Sieg der Arbeiterklasse als eine Notwendigkeit, so vieles auch gegen die Diktatur vom Standpunkt der Demokratie aus eingewandt werden kann. Die Diktatur des Proletariats ist nicht Zweck, sie ist Mittel zur Erhaltung und Sicherung der Revolution.“
25. 11 1918 - Das Korrespondenzbüro Hoffmann veröffentlicht Kriegsschuld-Schriften
Berlin * Das Berliner Korrespondenzbüro Hoffmann macht die von Kurt Eisner ausgesuchten Schriftstücke zur deutschen Kriegsschuld als amtliche Publikation im ganzen Reichsgebiet allgemein zugänglich - auch in den Hauptstädten der Entente.
Die deutsche Öffentlichkeit ist vom Inhalt total überrascht. Umgehend dementiert die Reichsregierung, die mit einem solchen Alleingang nicht gerechnet hat, dass Deutschland den Krieg gewollt habe. Auf den Vorwurf, dass das Deutsche Reich der Habsburger-Monarchie Österreich-Ungarn einen Blankoscheck ausstellte und damit für die Verbündeten die Kriegsentscheidung gefallen war, geht die Reichsregierung nicht ein.
25. 11 1918 - Kurt Eisner wegen seiner Kriegsschuld-Veröffentlichungen angegriffen
Berlin * Auf der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin wird der bayerische Ministerpräsident von nahezu allen Seiten wegen seiner Kriegsschuld-Veröffentlichungen und dem daraus resultierenden eigenmächtigem Handeln massiv angegriffen.
Kurt Eisner verlangt daraufhin von Reichskanzler Friedrich Ebert die Entlassung des Leiters des Auswärtigen Amtes, Wilhelm Solf und den Vorsitzenden der Waffenstillstands-Kommission Matthias Erzberger. Die Genannten rechnet Eisner aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Äußerungen dem alten kriegsverherrlichenden und militaristischen System zu. Sie sollen durch unbescholtene USPD- und SPD-Politiker ersetzt werden.
Eisners konstruktive Begründung lautet: „Deutschland braucht ein provisorisches Präsidium, das an die Stelle des halb aufgelösten Bundesrats zu treten hat und aus neuen, unbelasteten Männern bestehen muss. Dieses Präsidium muss die Aufgabe haben, alle Verhandlungen mit der Entente zu führen.“
Der bayerische Ministerpräsident möchte,
- dass die neue deutsche internationale Politik von Personen präsentiert wird, die auch das neue deutsche politische System verkörpern und
- dass die Friedensgespräche nicht alleine von der Reichsregierung, sondern unter maßgeblicher Beteiligung der Länder geführt werden.
25. 11 1918 - Kurt Eisner will Karl Liebknecht von seiner Friedensinitiative überzeugen
Berlin * Unmittelbar vor der Ministerpräsidenten-Konferenz trifft sich Kurt Eisner mit dem Führer des Spartakusbundes, Karl Liebknecht, in Berlin, um ihn zur Unterstützung seiner Friedensinitiative gegenüber den Alliierten zu überzeugen.
Liebknecht lehnt das Ansinnen ab, da er weder im Inland noch im Ausland mit Kapitalisten verhandeln will. Für die Spartakisten kommt die Einführung des Sozialismus erst dann in Frage, wenn alle Strukturen des ehemaligen Obrigkeitsstaates restlos zerstört sind.
25. 11 1918 - Enttäuscht fährt Kurt Eisner nach München zurück
Berlin - München * Bayerns Ministerpräsident Kurt Eisner reist enttäuscht am Abend des 25. November zurück nach München. Er hat sich mit keiner seiner Forderungen durchsetzen können.
25. 11 1918 - Kurt Eisner bricht die diplomatischen Beziehungen zum Auswärtigen Amt ab
München - Berlin * Noch in der Nacht sendet Ministerpräsident Kurt Eisner ein Telegramm an den bayerischen Gesandten in Berlin, Dr. Friedrich Muckle, in dem er den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum Auswärtigen Amt bekannt gibt:
„Die neuerlichen Versuche, die alten Methoden des Auswärtigen Amtes fortzusetzen und das deutsche Volk erneut um die Erkenntnis der Wahrheit zu betrügen, veranlassen das Ministerium des Äußern des Volksstaates Bayern, jeden Verkehr mit den gegenwärtigen Vertretern des Auswärtigen Amtes abzulehnen.“
25. 11 1918 - Eisner Die Revolution ist keine Demokratie
Berlin * Kurt Eisner spricht im Berliner Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte:
„Die Revolution ist keine Demokratie. Sie will sie erst schaffen. Arbeiter- und Soldatenräte müssen überall die Grundlage der neuen Entwicklung bilden, und die Nationalversammlung kann und darf erst dann einberufen werden, wenn die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte sich so sehr entwickelt haben, daß alles von dem neuen Geist erfüllt ist, dann darf vielleicht an die Nationalversammlung gedacht werden, sie wird dann auch schon überflüssig sein, weil wir, die Arbeiter, Soldaten- und Bauernräte, schon die Nationalversammlung sind.“
26. 11 1918 - Die Arbeiten für das Walchensee-Kraftwerk beginnen
Kochel * In Kochel wird mit den Arbeiten für das Walchensee-Kraftwerk begonnen.
26. 11 1918 - Die ersten Soldaten kehren von der Front zurück
München * Um 23:30 Uhr trifft das Infanterie-Leibregiment aus Serbien in München ein. Die über 450 rückkehrenden Soldaten werden von einer ungeheueren Menschenmenge jubelnd begrüßt.
26. 11 1918 - Protest gegen Kurt Eisners Kriegsschuldfrage
Berlin - München * Das Auswärtige Amt in Berlin protestiert gegen die Veröffentlichungen von Kurt Eisner zur Kriegsschuldfrage.
Dr. Friedrich Wilhelm Muckle, der Bayerische Gesandte in Berlin, droht daraufhin dem Auswärtigen Amt mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch die Bayerische Regierung.
26. 11 1918 - Richtlinien für die Tätigkeit der Arbeiter- und Bauernräte
München - Freistaat Bayern * Der Ministerrat beschließt - in Abwesenheit von Kurt Eisner - nach Abstimmung mit den Vollzugsausschüssen der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte die Vorläufigen Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte.
Die Richtlinien stellen einen Kompromiss der gegensätzlichen Vorstellungen des bayerischen Ministerpräsidenten vom 20. November und seines Innenministers Erhard Auer vom 18. November dar. Das bedeutet jedoch, dass wesentliche Elemente aus beiden Entwürfen ebenso unberücksichtigt bleiben müssen, wie der Entwurf des Revolutionären Arbeiterrats vom 19. November 1918.
Die Räte erhalten zwar die von Eisner vorgeschlagene Stellung im Staat, doch werden sie nur mit den Kompetenzen ausgestattet, die ihnen Auer zugestehen will. Die Räte bilden demnach „bis zur endgültigen Regelung durch die Nationalversammlung die revolutionäre Grundlage des neuen Regierungssystems“, dennoch bleibt ihnen im Verhältnis zu den Behörden nur das Recht auf Auskunft und Gehör. Ein Kontrollrecht wird ihnen ebenso wenig zugestanden wie die Vollzugsgewalt. Damit haben sich Innenminister Erhard Auer und die Mehrheitssozialdemokraten mit ihren Vorstellungen im Wesentlichen durchgesetzt.
Die Richtlinie für die Bauernräte bleibt die rechtliche Grundlage für die Arbeit der Bauernräte, bis der Landtag am 21. Mai 1920 das Gesetz über die Aufhebung der Arbeiterräte beschließt.
26. 11 1918 - Die Vorläufige Verordnung für die Soldatenräte akzeptiert
München * Der Münchner Soldatenrat nimmt eine Vorläufige Verordnung für die Soldatenräte an.
26. 11 1918 - Notunterkünfte und Zwangseinquartierungen
München * Die bis Ende Januar andauernde Rückkehr der Truppen von der Front machen München zu einem großen Entlassungszentrum. Gleichzeitig wird es Anziehungspunkt für jene Ausgemusterten, die ohne Arbeit oder ohne Ziele sind.
Die städtischen Behörden beginnen - davon ausgehend, dass es sich um eine vorübergehende Erscheinung handle, - in Schulgebäuden, Hotels und Bräus Notunterkünfte einzurichten. Auch in großen Privatwohnungen werden Zwangseinquartierungen vorgenommen.
26. 11 1918 - Der Münchner Magistrat beschließt ein Arbeitslosenfürsorgeprogramm
München-Graggenau * Der Münchner Magistrat beschließt ein Arbeitslosenfürsorgeprogramm.
26. 11 1918 - Die Einstellung der Kriegsproduktion verzögern
Berlin - München * Ein Beauftragter des Berliner Vollzugsrats beim Demobilisierungsamt schreibt an den Münchner Arbeiter- und Soldatenrat: „Verlangt nicht um jeden Preis die sofortige Einstellung der Kriegsfabrikation. Ihr macht damit unzählige Kameraden brotlos.“
27. 11 1918 - Die Beseitigung der Reichsregierung Ebert-Scheidemann gefordert
München - Berlin * Der Vollzugsausschuss der Münchner Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte fordert die Beseitigung der Reichsregierung Ebert-Scheidemann.
27. 11 1918 - Kurt Eisners Vorschläge für ein provisorisches Reichspräsidium
München - Berlin * In einem Telegramm an den bayerischen Gesandten in Berlin, Dr. Friedrich Muckle, übermittelt Kurt Eisner seinen Besetzungsvorschlag für das von ihm auf der Ministerpräsidenten-Konferenz vorgeschlagene provisorische Reichspräsidium.
Darin schlägt er - neben sich selber - vor: die Mitglieder im Rat der Volksbeauftragten Hugo Haase, Wilhelm Dittmann, Karl Kautsky [alle USPD] und den parteilosen Diplomaten Johann Wilhelm Muehlon. Keiner der Vorgeschlagenen gehört der MSPD an. Der Sitz des Gremiums soll in München sein.
27. 11 1918 - Eisner: „Die Soldatenräte werden allmählich verschwinden“
München * In der Ministerratssitzung erklärt Ministerpräsident Kurt Eisner: „Die Soldatenräte werden allmählich verschwinden.“
28. 11 1918 - Kaiser Wilhelm II. dankt ab
Amirong * Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet seine Abdankungsurkunde.
„Ich verzichte hierdurch für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preußens und die damit verbundenen Rechte an der deutschen Kaiserkrone. Zugleich entbinde ich alle Beamten des Deutschen Reiches und Preußens, sowie alle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Marine, des preußischen Heeres und der Truppen der Bundeskontingente des Treueeides, den sie mir als ihrem Kaiser, König und obersten Befehlshaber geleistet haben.
Ich erwarte von ihnen, dass sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reiches den Inhabern der tatsächlichen Gewalt in Deutschland helfen, das deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schützen.
Urkundlich unter unser höchst eigenhändigen Unterschrift und beigedrücktem kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Amirong, den 28. November 1918. gez. Wilhelm“
28. 11 1918 - Das III. Bataillon trifft in München ein
München * Das III. Bataillon trifft mit 888 Soldaten und Offizieren unter der Leitung seine Kommandanten Oberst Franz Xaver Ritter von Epp in München ein.
28. 11 1918 - Das Bürgertum wird von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen
München * Ministerpräsident Kurt Eisner betont in der Versammlung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, dass „die Grundlage der politischen Macht bis zur endgültigen Nationalversammlung außer in der Regierung in den Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten" besteht.
Die anderen Bevölkerungskreise werden aufgrund ihrer fachlichen und sachlichen Voraussetzungen zwar gebraucht, aber politische Macht soll ihnen nicht eingeräumt werden. Das bedeutet, dass Eisner das Bürgertum - bis zur Neuwahl der Nationalversammlung - von der Mitbestimmung in der Politik ausschließen will.
28. 11 1918 - Die Vorherrschaft Preußens brechen
München * In der Versammlung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte erklärt Kurt Eisner seine Einstellung zur Hegemonie [= Vorherrschaft] Preußens, zur Selbstständigkeit der Länder und zum Föderalismus:
„In Berlin ist das Verbrechen ausgekocht worden, und deshalb der Hass gegen Berlin, und ich, der ich dringend wünsche, dass die Zersetzung Deutschlands nicht zu einer endgültigen Auflösung Deutschlands führe, sondern dass dass wir zusammen bleiben, ich bin der festen Überzeugung, dass zunächst einmal die Einzelstaaten sich ihrer eigenen Haut wehren müssen, so lange, bis wir wieder zusammen aktionsfähig werden.“
28. 11 1918 - Ministerpräsident Eisner will das alte System abschaffen
München * Gegenüber den Münchner Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten äußerte sich Kurt Eisner so: „Ich kam nach Berlin als Vertreter Bayerns und sah da zu meiner großen Überraschung, dass in Berlin die Konter-Revolution nicht droht, sondern dass sie ruhig regiert. Die Konter-Revolution regiert in Berlin ganz gemütlich, als ob nichts geschehen wäre. […]
Wir können nicht mit dem alten System weiterarbeiten. […] Was im Auswärtigen Amt sitzt, ob es nun alldeutsch ist, oder ob es […] für den Verständigungsfrieden gewirkt hat, das ist ganz gleich, diese Herren sind Vertreter des alten Systems und in ihren Händen ist noch der gesamte Apparat der öffentlichen Meinung, der Presse des In- und Auslandes. Der funktioniert noch genauso wie während des Krieges.“
28. 11 1918 - Kurt Eisner lobt den Bauernrat
München * Kurt Eisner äußert sich zu den Bauernräten wie folgt: „Ich lege ganz besonderen Wert auf den Bauernrat, der ist sehr wichtig, ist meine Lieblingsschöpfung, und die Revolution wäre ohne die Bauern hier in München nicht zustande gekommen.“
28. 11 1918 - Neue Schreibweise Baiern gefordert
Nürnberg * Der Fränkische Kurier fordert die Schreibweise „Baiern“ statt „Bayern“, da diese auf einer „Schrulle König Ludwigs I.“ beruht. Für den Autor S. Günther wäre das eine „revolutionäre Umwälzung, die wohl kaum auf Gegnerschaft stoßen dürfte“.
29. 11 1918 - Gas und Licht wird begrenzt
München * Aufgrund der Kohlennot wird die Gasverbrauchsmenge gekürzt. Die Straßenbeleuchtung wird statt wie bisher um 0:30 Uhr um 21 Uhr abgeschaltet.
29. 11 1918 - Das II. Bataillon zieht in München ein
München * Das II. Bataillon mit 846 Offizieren und Mannschaften ziehen durch das geschmückte Karlstor zum Bürgerbräukeller.
29. 11 1918 - Kurt Eisner äußert sich zu den Anfeindungen in der Presse
München * Unter der Überschrift Zur Kenntnisnahme veröffentlicht der Ministerpräsident des Volksstaates Bayern: Kurt Eisner nachstehende Erklärung:
- „Man bemüht sich von allen Seiten mich aufmerksam zu machen auf die albernen Artikel, die eine gewisse Presse gegen meine Person richtet.
- Ich erfahre daraus allerlei interessante Bereicherungen meiner Biographie. Man erweist mir darin auch die Ehre, mich mit einem Familien- und Erwerbssinn zu begaben, der mir nur in geringstem Maße bisher beschieden war. Schon habe ich meinen gesamten Familienanhang in gut bezahlten Stellungen untergebracht.
- Besorgte Leute verlangen von mir, daß ich gegen solche Äußerungen, die jedoch nur eine Fäulniserscheinung des zusammengebrochenen Systems sind, einzuschreiten. Ich wiederhole, daß die Presse in voller Freiheit soviel Dummes und Kluges, soviel Anständiges und Schmutziges produzieren soll, wie es ihrem geistigen und moralischen Vermögen entspricht.
- Ich habe in den 4 ½ Kriegsjahren soviel Verachtung gegen diese Presse aufgehäuft, daß sie genügt, um mich für den Rest meines Lebens gegen jede Neigung zu festigen, auch nur polemisch mich mit ihr zu befassen.“
29. 11 1918 - Der bayerische Staat ist zu Zahlungen an die Wittelsbacher bereit
München-Kreuzviertel * Der bayerische Staat ist bereit, einen Ausgleich für die Königliche Zivilliste und die Apanagen zu leisten, abzüglich des Anteils für die Repräsentationsaufwendungen.
29. 11 1918 - In Preußen wird das Schulgebet abgeschafft
Berlin * Das Preußische Kultusministerium
- schafft das Schulgebet vor und nach dem Unterricht ab und
- verbietet alle religiös geprägten Feiern.
- Schüler dürfen nicht mehr zur Teilnahme an Gottesdiensten oder am Religionsunterricht verpflichtet werden.
- Religionslehre ist kein Prüfungsfach mehr.
Dieser Erlass löst vor allem in den katholischen Reihen einen Sturm der Empörung aus.
29. 11 1918 - Minister Roßhaupter sagt Waffenlieferung an die Bürgerwehr zu
München * Der Staatsminister für militärische Angelegenheiten Albert Roßhaupter sagt dem Landtags-Bibliothekar Rudolf Buttmann in einem persönlichen Gespräch zu, der Bürgerwehr Waffen zur Verfügung zu stellen und rät ihm, auch die Gewerkschaften offiziell zu beteiligen.
29. 11 1918 - Von der Verletzung der Abrüstungsbestimmungen
München * Auf der Kabinettssitzung wird über die Verletzung der Abrüstungsbestimmungen des Waffenstillstandsabkommens beraten. Dabei stellt sich heraus, dass die Stilllegung der Munitionsindustrie in München 8.000 Arbeiter erwerbslos machen würde.
Es wird nichts unternommen, die Produktion wird noch bis Mitte Januar 1919 fortgesetzt. Die Räte protestieren nicht. Für Kurt Eisner ist es ein bedrückendes und moralisches Dilemma, denn es ist nicht nur ein Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen, sondern auch eine stillschweigende Verleugnung eines Ziels der Revolution.
30. 11 1918 - Revolutionsfeier für die Studenten und Schüler
München-Graggenau * Die Revolutionsfeier im Nationaltheater wird für die Studenten und Schüler nochmals aufgeführt.
30. 11 1918 - Das Reichswahlgesetz tritt in Kraft
Berlin - Deutsches Reich * In Deutschland tritt das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in Kraft.
30. 11 1918 - König Wilhelm II. von Württemberg verzichtet auf den Thron
Tübingen-Schloss Bebenhausen * In einer Bekanntmachung an das württembergische Volk legt König Wilhelm II. von Württemberg freiwillig die Krone nieder.
30. 11 1918 - Kurt Eisner distanziert sich vom Bolschewismus
München * Ministerpräsident Kurt Eisner distanziert sich sowohl im Ministerrat wie in der Öffentlichkeit mehrmals vom Bolschewismus. Vor den bayerischen Soldatenräten erläutert er, was ihn vom Bolschewismus unterscheidet:
- Die Ablehnung der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und
- die Einsetzung von Gewalt gegen politische Gegner.
30. 11 1918 - Den Wahltermin für die deutsche Nationalversammlung festgelegt
Berlin * Die Regierung Ebert erlässt die amtliche Ankündigung der Wahl zur deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919.
30. 11 1918 - Ministerpräsident Kurt Eisner: Gegen Zentralismus, für Föderalismus
München * Ministerpräsident Kurt Eisner äußert sich vor den Soldatenräten für einen föderalistischen Staatsaufbau:
„Meine Haltung hinsichtlich des Verhältnisses von Bayern zum Reiche ist ganz klar, nie geändert: Ich bin gegen den Zentralismus in der auswärtigen Politik, in der inneren Politik, in der Parteipolitik, so lange ich lebe. Ich will die innere Kraft der Glieder, ob es sich nun um ein Parteiwesen handelt oder ob es sich um einen Staat handelt, das ist das selbe.“
30. 11 1918 - Die freien Gewerkschaften lehnen die Bürgerwehr ab
München * Eine Besprechung zwischen dem Landtags-Bibliothekar Rudolf Buttmann und Vertretern der Christlichen Gewerkschaften und der Freien Gewerkschaften findet zum Thema Bürgerwehr statt.
Gustav Schiefer, der stellvertretende Vorsitzende der Freien Gewerkschaften in München, wehrt sich vehement gegen die Pläne. Auch der anwesende Stadtkommandant Oskar Dürr und der Polizeipräsident Josef Staimer raten von einer Zustimmung ab.
30. 11 1918 - Die Vereinigung Revolutionärer Internationalisten wird gegründet
München * Der Kreis um Erich Mühsam gründet die Vereinigung Revolutionärer Internationalisten - VRI. Sein Ziel ist, die Revolution siegreich zu Ende zu führen - auch gegen den Widerstand des zu wählenden Parlaments.
Erich Mühsam lehnt zudem die stark zentralistisch geprägten Positionen des am 11. November 1918 in Berlin ins Leben gerufenen Spartakusbundes strikt ab. Dennoch gehören viele VRI-Mitglieder zur später gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands - KPD. In einem Flugblatt fassen sie ihre Ziele zusammen:
„Revolutionäre, internationalistisch gesinnte, kommunistische Arbeiter und Soldaten! Männer und Frauen! Nicht alle Volksgenossen sind mit dem bisherigen Verlauf der Revolution einverstanden. [...] Wir verlangen die Verwirklichung des Sozialismus als Krönung der gegenwärtigen Volksbewegung. […] Wir blicken nicht auf den Weg, sonders aufs Ziel. Das Mittel der Revolution heißt Revolution. Das ist nicht Mord und Totschlag, sondern Aufbau und Verwirklichung“.
Geschäftsstelle ihrer neuen Vereinigung wird das Wirtshaus Braunauer Hof in der Frauenstraße. Erich Mühsam bezeichnet die Stunden hier als die „eigentlich beste Zeit der Revolution“.
Seit 1. 12 1918 - Parlamentstätigkeit im Deutschen Theater
München-Ludwigsvorstadt * Die Revolutionsregierung nutzt das Deutsche Theater bis zum 21. Februar 1919 als Sitz des Parlaments des Volksrates.
1. 12 1918 - Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen
Belgrad * Der Staates der Slowenen, Kroaten und Serben - SHS-Staat wird zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen vereinigt. Der neue Staat wird 1920 im Frieden von Trianon als Königreich Jugoslawien staatsrechtlich bestätigt.
1. 12 1918 - Die Union der Siebenbürger Rumänen mit ihren Volksgenossen in Rumänien
Karlsburg * Die Volksversammlung der Siebenbürgener verkündet die Union der Siebenbürger Rumänen mit ihren Volksgenossen in Rumänien.
1. 12 1918 - Der sofortigen Errichtung eines Rates des Verkehrspersonals zugestimmt
München * Verkehrsminister Heinrich Ritter von Frauendorfer stimmt der sofortigen Errichtung eines Rates des Verkehrspersonals zu.
1. 12 1918 - Der Vorwärts rechnet mit Kurt Eisner ab
Berlin - München * Friedrich Stampfer, Chefredakteur beim Vorwärts, rechnet mit einem ehemaligen Kollegen ab und schreibt mit arroganter Überheblichkeit in der SPD-Zeitung Vorwärts einen Leitartikel über Kurt Eisner und die Revolution in Bayern:
„Als am 8. November 1918 die Kunde kam, dass Eisner bayerischer Ministerpräsident geworden sei, erfüllte Heiterkeit die Redaktionsstuben, sie pflanzte sich fort in die Setzer- und Maschinensäle. Es war keiner unter uns, der Eisner von der alten Zeit her nicht liebte, keiner, der ihm übel wollte oder ihn missachtete. Dennoch: Heiterkeit überall, wohlwollende Heiterkeit. […]
Wozu wären wir ein befreites Volk, wenn es nicht erlaubt wäre, einem alten Freund offen und öffentlich zu sagen: Du hast in Deinem Leben schon viele Böcke geschossen, aber dass Du Dich von Deinen revolutionären Schwabinger Literaturfreunden zum Ministerpräsidenten machen ließest, das war Dein größter Bock. […]
Du lebst in einer Welt des holden Wahnsinns, wenn Du glaubst, Du eingewandeter Berliner Literat, der im öffentlichen Leben noch nie eine Rolle gespielt hat und den man in Bayern bis vor drei Wochen kaum kannte, Du könntest Dich auf das Vertrauen des bayerischen Volkes stützen. […]
Diese Ministerpräsidentschaft […] steht zum Ernst unserer Zeit in erschütterndem Gegensatz. Kasperlekomödie des Lebens, frei nach Frank Wedekind, von Kurt Eisner, mit dem Dichter in der Titelrolle. München - Schwabinger Naturtheater. In fünf Minuten geht der Vorhang herunter und dann ist Schluss.“
1. 12 1918 - Das Verkehrspersonal will die Nationalratswahl
München * Der Verband des bayerischen Verkehrspersonals gibt eine offizielle Erklärung heraus, in der er die weitere Zusammenarbeit mit der Regierung von der baldmöglichen Wahl zur Nationalversammlung abhängig macht. „Verzögerung […] bedeutet Unordnung und Zerfall, Anarchie und Bürgerkrieg.“
1. 12 1918 - Prof. Foerster fürchtet die bayerische Entwicklung
München * Der sich in München aufhaltende bayerischen Gesandte in Bern, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Foerster, veröffentlicht eine Erklärung mit der Überschrift „Die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen politischen Lage in Bayern“, in der er sich tief enttäuscht über die Entwicklung in München äußert. Er befürchtet eine Entwicklung zur Vorherrschaft durch die revolutionären Räte.
„Dass aber dadurch eine wahrhaft demokratische Vertretung der Interessen und Rechte aller Klassen noch nicht gesichert wird, ist ohne weiteres klar. Eisner will aber auch solche Gleichheit der Vertretung gar nicht. […] Er hat jeden Glauben an das Bürgertum verloren. Und darum kämpft er verzweifelt gegen die Nationalversammlung.“
1. 12 1918 - Die französische Besatzungsarmee marschiert in der Pfalz ein
Freistaat Bayern-Pfalz * Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen vom 11. November 1918 marschiert die französische Armee in die zum Freistaat Bayern gehörende Pfalz ein.
2. 12 1918 - Aus der Leibgarde wird die Staatliche Bewachungstruppe
München * Die ehemalige Leibgarde wird in Staatliche Bewachungstruppe umbenannt.
2. 12 1918 - Auer drängt auf die Festsetzung eines Wahltermins
München * Es kommt erstmals zur offenen Regierungskrise, nachdem Innenminister Erhard Auer auf die Festsetzung eines Termins zur Wahl der Bayerischen Nationalversammlung besteht. Die Minister Erhard Auer, Johannes Timm und Heinrich Ritter von Frauendorfer drohen mit ihrem Rücktritt.
Ministerpräsident Kurt Eisner stimmt daraufhin einem Kompromiss zu, den er auf der Sitzung der Soldatenräte darlegen wird.
2. 12 1918 - Eisner zur Wahl der Nationalversammlung vor den Soldatenräten
München * Auf der Sitzung der Soldatenräte gibt Ministerpräsident Kurt Eisner eine Regierungserklärung ab. In dieser verkündet er: „Die Volksregierung Bayern wird ihr Versprechen, die Nationalversammlung so rasch als möglich einzuberufen, einlösen.“ Die Aussage wird von den Anwesenden mit stürmischem Beifall aufgenommen.
2. 12 1918 - Innenminister Erhard Auer als Hemmschuh der Revolution
München * Für viele Münchner und Bayern ist der Innenminister Erhard Auer von der SPD der „Hemmschuh der Revolution“. Josef Hofmiller schreibt dazu in sein Tagebuch:
„Gegen Auer wird unglaublich gehetzt, in aller Öffentlichkeit. Die Gegensätze spitzen sich so zu, dass entweder Eisner zurücktreten oder Auer aus dem Kabinett austreten muss. Letzteres würde den Sieg des Bolschewismus bedeuten.“
3. 12 1918 - Der Straßenbahnbetrieb wird eingestellt
München * Wegen der Kohlenknappheit wird der Straßenbahnbetrieb eingestellt.
4. 12 1918 - Demonstration für die Einberufung der Bayerischen Nationalversammlung
München-Kreuzviertel * 500 Pioniere in Begleitung ihrer Offiziere demonstrieren vor dem Sitz des Ministerpräsidenten im Montgelas-Palais für die Einberufung der Bayerischen Nationalversammlung.
Ministerpräsident Kurt Eisner, Innenminister Erhard Auer und Militärminister Albert Roßhaupter sprechen mit den Versammelten und sichern ihnen die baldige Bekanntgabe des Einberufungstermins der Nationalversammlung zu.
4. 12 1918 - Die Demokratisch-sozialistische Bürgerpartei München wird gegründet
München-Ludwigsvorstadt * Im Mathäserbräu wird die Demokratisch-sozialistische Bürgerpartei München gegründet.
4. 12 1918 - Eine Kommission erstellt ein Sozialisierungskonzept
Berlin * Da der Rat der Volksbeauftragten kein Sozialisierungskonzept hat, wird eine Kommission gegründet, in der Karl Kautsky von der USPD und Ernst Francke, der Generalsekretär der Gesellschaft für soziale Reformen, den Vorsitz übernehmen. Vertreter der MSPD, der Gewerkschaften und der Unternehmer gehören dem Gremium zusätzlich an.
Aufgrund der Zusammensetzung ist kaum mit schnellen Entscheidungen und Einschnitten zu rechnen. Die Kommission dient mehr der Beruhigung in allen Richtungen.
4. 12 1918 - Landtagswahlen ohne Beteiligung der Frauen vorgeschlagen
München * Innenminister Erhard Auer schlägt auf der Ministerratssitzung vor, die Wahlen zum Landtag und zur verfassungsgebenden Nationalversammlung möglichst bald und deshalb ohne Frauen durchzuführen, da die Erstellung der Wählerlisten bei einer Einbeziehung der Frauen doppelt so lange dauern würde.
Zum Glück für die Frauen kann sich der bayerische SPD-Landesvorsitzende mit seinen Vorstellungen nicht durchsetzen.
5. 12 1918 - Termin für die Landtagswahl auf 12. Januar 1919 festgelegt
München-Kreuzviertel * Im Ministerrat kommt es zu heftigen Diskussionen über die Terminfestsetzung zur Nationalratswahl. Kurt Eisner sieht in einem frühen Termin keinen Vorteil. „Die Massen scheuen sich davor und fürchten die Preisgabe der Errungenschaften.“ Dagegen fordern die MSPD-Minister einen möglichst frühen Wahltermin. Jeder Tag früher stellt für sie einen „Gewinn gegenüber dem Zentrum“ dar. Erhard Auer dringt deshalb auf den 12. Januar 1919.
Innenminister Erhard Auer und Justizminister Johannes Timm geben unumwunden ihre Abneigung gegen die Räte zu und treten für die Umwandlung der Arbeiter- und Bauernräte in Arbeiter- und Landwirtschaftskammern ein und sprechen den Räten jede politische Funktion ab. Verkehrsminister Heinrich Ritter von Frauendorfer sieht in den Räten eine „nur notwendige Begleiterscheinung der Revolution“. Den Soldatenräten gibt man keine Zukunft.
Um 5. 12 1918 - Eine Kommission zur Fürstenabfindung tritt zusammen
München-Kreuzviertel * Eine Kommission zur Fürstenabfindung tritt erstmals zusammen.
5. 12 1918 - Max Weber an den Ausführungen gehindert
München-Ludwigvorstadt * In einer öffentlichen Versammlung im Wagnersaal hält der Soziologe und Gründungsmitglied der links-liberalen Deutschen Demokratischen Partei - DDP, Max Weber, eine Rede zugunsten der baldigen Wahl zur Nationalversammlung. Er wird aus der Versammlung heraus mehrmals unterbrochen, bis Weber seine Rede abbrechen muss.
5. 12 1918 - Der Wahlkampf in Bayern und im Reich beginnt
München - Freistaat Bayern - Deutsches Reich * Der Wahlkampf beginnt. Er wird mit der Wahl der Abgeordneten zur deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 enden. Diese Wahl findet eine Woche nach den Wahlen zum Bayerischen Landtag statt.
- Als die beiden stärksten Parteien werden in Bayern die Mehrheitssozialdemokraten - MSPD und die Bayerische Volkspartei - BVP eingeschätzt. Es ist nur die Frage, wie sich die Mehrheiten verteilen werden.
- Die USPD hat - trotz einer verbindlichen Absprache mit dem Bayerischen Bauernbund - BBB - keine Erfolgsaussichten. Sie hofft auf einen so großen Stimmenzuwachs, dass sie für eine Regierungskoalition unentbehrlich sein würde.
- Der Spartakusbund, der sich nach dem 31. Dezember 1918 Kommunistische Partei Deutschlands - KPD nennen wird, weigert sich, an der Wahl teilzunehmen.
5. 12 1918 - Mehrere Tausend Rüstungsarbeiter verlieren ihren Job
München * In den Rüstungsbetrieben der Bayerischen Geschützwerke in Freimann (Friedrich Krupp), den Artilleriewerkstätten, den Bayerischen Flugzeugwerken und den Präzisionswerkstätten Deckel in Sendling werden Arbeitseinstellungen und Entlassungen durchgeführt. Mehrere Tausend Arbeiter verlieren ihren Job.
6. 12 1918 - Erich Mühsam gegen Wahlen für eine bayerische Nationalversammlung
München * Erich Mühsam spricht sich im Kolosseum vor Soldaten und Zivilisten gegen Wahlen für eine Bayerische Nationalversammlung aus.
- Er setzt sich andererseits für die baldige „Verwirklichung eines weitgehenden Sozialismus im kommunistischen Sinn“ ein,
- warnt aber zugleich vor „Unordnung und Plünderung“.
6. 12 1918 - Der königliche Privatmobiliarbesitz wird abgeholt
München-Graggenau * Der Privatmobiliarbesitz der königlichen Familie wird mit Möbelwägen aus der Residenz gebracht.
6. 12 1918 - Demonstranten besetzen Münchner Zeitungsredaktionen
München * Im Schwabingerbräu, Mathäserbräu und im Odeon werden Versammlungen für Soldaten abgehalten. Die Versammlungsteilnehmer demonstrieren im Anschluss gegen die Münchner Presse.
Die Räume der Münchner Neuesten Nachrichten, des Bayerischen Kuriers, der München-Augsburger Abendzeitung und der Münchner Zeitung werden besetzt. Die Besetzer erlassen umfangreiche Zensurvorschriften, die beim Eintreffen der Republikanischen Schutztruppe und vor allen auf Kurt Eisners Zureden zurückgenommen werden. Die Demonstranten ziehen daraufhin zu Innenminister Erhard Auer, um ihn wegen
- seiner Haltung in den Januarstreiks und
- seines Eintretens für eine demokratische, nicht-sozialistische Republik
mit Gewalt zum Rücktritt von seinem Ministerposten zu zwingen.
6. 12 1918 - Mit Ex-Kronprinz Rupprecht die bayerische Monarchie restaurieren
München - Vatikan * Uditore Lorenzo Schioppa informiert den Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri durchaus hoffnungsfroh über die nicht aussichtslosen Bestrebungen, mit Ex-Kronprinz Rupprecht die Monarchie in Bayern wieder zu installieren.
6. 12 1918 - Die antisemitischen Tendenzen des Bayerischen Kuriers
München * Der Bayerische Kurier, das Organ der Bayerischen Volkspartei - BVP, zeigt ganz eindeutig antisemitische Tendenzen:
„Für die BVP spielt auch die Rassenzugehörigkeit keine Rolle. [Ihre Mitglieder] achten und ehren jeden ehrlichen Juden. […] Was aber bekämpft werden muss, das sind die zahlreichen atheistischen Elemente eines gewissen internationalen Judentums mit vorwiegend russischer Färbung“.
Die politischen Parolen der Bayerischen Volkspartei lauten: „Los von Berlin!“ und „Bayern den Bayern!“. Die letzte Aussage richtet sich nicht gegen Preußen, sondern vor allem gegen die Juden, die in der Regierung Eisner zahlreich vertreten sind.
6. 12 1918 - Erich Mühsam und seine Gefolgschaft stürmen den Bayerischen Kurier
München * Erich Mühsam und seine Anhänger stürmen am Abend das Verlagshaus des Bayerischen Kuriers, einer stramm konservativen Zeitung und Organ der Bayerischen Volkspartei - BVP.
Erich Mühsam übernimmt persönlich die Redaktion. Die Drucker verbünden sich mit den Besetzern, nachdem sie diesen eine Beteiligung an der Zeitung versprochen haben.
6. 12 1918 - Die Verhaftung des Vollzugsrats verhindert
Berlin * Zur selben Zeit wird der Versuch unternommen, den Vollzugsrat zu verhaften. Er ist neben dem Rat der Volksbeauftragten das wichtigste Organ der Revolution. Weil sich die Betroffenen gegen die Verhaftung wehren und protestieren, kommt der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn mit Kräften der Sicherheitswehr dem Vollzugsrat zu Hilfe. Die Verhaftung scheitert - die Putschisten müssen erfolglos abziehen.
6. 12 1918 - Matrosen und Soldaten für die Wahl zur Nationalversammlung
Berlin * Am späten Nachmittag versammeln sich vor der Reichskanzlei Matrosen und Soldaten. Ein Feldwebel Spiro, der Vorsitzende des Soldatenrats des Ersatz-Bataillons des Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiments Nr. 2, hält eine Ansprache, in der er darstellt, dass „Deutschland in dem unermesslichen Unglück einer vollen Katastrophe“ steht, „die nur durch bewusste Zusammenfassung aller Kräfte und durch freiwillige Unterordnung jedes Einzelnen unter das gemeinsame Wohl überwunden werden kann“.
Er fordert abschließend, dass die Nationalversammlung für den 20. Dezember einberufen wird. Danach ernennt er - „gestützt auf die bewaffnete Macht und im Bewusstsein für die ganze Nation zu sprechen“ - Friedrich Ebert zum Präsidenten Deutschlands.
Ebert antwortet mit „ruhiger, fester, durchdringender Stimme: Kameraden und Genossen! Der Ruf, der an mich ergangen ist, kann und will ich nicht annehmen, ohne vorher mit meinen Freunden in der Regierung gesprochen zu haben. Das ist eine hoch wichtige Angelegenheit, deren Entscheidung allein in den Händen des Rates der Volksbeauftragten liegt“.
Feldwebel Spiro zieht daraufhin mit seinen Truppen geschlossen ab. Das Ziel der Soldaten ist, die Revolution faktisch zu beenden und die Kräfte links des Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu entmachten.
6. 12 1918 - Bildung einer freiwilligen Volkswehr möglich
Berlin * Das Gesetz zur Bildung einer freiwilligen Volkswehr wird beschlossen.
6. 12 1918 - 14 Tote und über 30 Schwerverletzte
Berlin * Gegen 17:00 Uhr haben Ecke Invaliden- und Chausseestraße Soldaten mit Maschinengewehren Aufstellung genommen. Als ein Demonstrationszug der Spartakusgruppe vorbeizieht, eröffnen die Soldaten das Feuer. Der Polizeibericht vermerkt 14 Tote und über 30 mehr oder weniger schwer verletzte Demonstranten.
6. 12 1918 - Versammlungen und Demonstrationen der Berliner Spartakusgruppe
Berlin * Die Spartakusgruppe hat für den 6. Dezember drei Versammlungen mit anschließenden Demonstrationen beim Polizeipräsidium angemeldet. Die Protestveranstaltungen werden mit der Auflage genehmigt, dass keine Waffen mitgeführt werden. Die drei Versammlungen finden am späten Nachmittag in den Germania-, Sophien- und Andreas-Sälen statt. Die Redner üben harsche Kritik an der Regierung und protestieren gegen die Einberufung einer Nationalversammlung.
Während der Versammlungen verbreitet sich die Nachricht von der mutmaßlichen Verhaftung des Vollzugsrats und von Friedrich Eberts Ausrufung zum Präsidenten. Entsprechend erregt beginnen gegen 16:30 Uhr die Demonstrationen.
7. 12 1918 - Die Kasernenräte sprechen dem Soldatenrat das Misstrauen aus
München-Ludwigsvorstadt * Im Gewerkschaftshaus in der Pestalozzistraße tagen die Kasernenräte.
- Sie verurteilen die nächtliche Demonstration vom Vortag.
- Dem Soldatenrat sprechen sie ihr Misstrauen aus, weil von den 15 Mitgliedern, die der Soldatenrat in den Nationalrat entsendet, acht befinden, die nicht gewählt worden sind, sondern sich in der Revolutionsnacht selbst dazu ernannt haben. [Darunter: Felix Fechenbach, Fritz Schröder und Fritz Sauber].
In der Folge tritt der Soldatenrat zurück und leitet Neuwahlen ein.
7. 12 1918 - Die Spanische Grippe fordert 92 Tote
München * In der ersten Dezemberwoche sterben in München 35 männliche und 57 weibliche Personen an der Spanischen Grippe. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich damit auf insgesamt 946.
7. 12 1918 - BMW muss Arbeiter und Angestellte beurlauben
München-Milbertshofen * Die in Milbertshofen ansässigen Bayerischen Motorenwerke - BMW müssen wegen Betriebseinstellung 3.000 Arbeiter und 400 Angestellte beurlauben.
7. 12 1918 - Ministerpräsident Eisner erklärt Auers Rücktritt für nichtig
München * Der MSPD-Innenminister Erhard Auer wird kurz nach Mitternacht von ungefähr 300 Demonstranten in seiner Wohnung „überfallen“. Sie holen ihn aus dem Bett und erzwingen von ihm mit vorgehaltenem Gewehr seinen Rücktritt. Erhard Auer äußert sich daraufhin: „Der Gewalt weichend erkläre ich [..], dass ich das Amt des Ministers des Inneren niederlege.“
In der Zwischenzeit ist Ministerpräsident Kurt Eisner in Auers Wohnung geeilt. In seinem ehrlichen Bemühen, Gesetz und Ordnung des Freistaats aufrecht zu erhalten, weist er die Demonstranten auf das Falschsein ihrer Gewalthandlungen hin und wird dafür begeistert gefeiert. Er entgegnet den Angreifern: Ihr Handeln sei „sicherlich gut gemeint und […] sicherlich aus Liebe zu mir geschehen, aber es war nicht gut“.
Eisner und Auer sind sich einig, dass das Rücktrittsgesuch öffentlich widerrufen werden soll. Ministerpräsident Kurt Eisner nimmt Auers Rücktritt nicht an und erklärt die „erpresste Erklärung“ für nichtig. Gegen vier Uhr früh ist die Angelegenheit erledigt und die Ruhe in der Stadt wieder eingekehrt.
7. 12 1918 - Ein sozialistischer Aufruf im Bayerischen Kurier
München * Die Leser der stark konservativen Zeitung Bayerischer Kurier, die zugleich das Organ der Bayerischen Volkspartei - BVP darstellt, müssen lesen:
„Brüder!
Die Soldaten und Arbeiter Münchens haben heute nacht die Zeitungen besetzt. Sie haben der schändlichen Hetzpresse, die das Volk durch 51 Monate belogen und betrogen hat und eine ungeheuere Blutschuld an diesem Völkermord trägt, ihr Gift genommen.
Die Übernahme der Zeitungen geschah in größter Ruhe und Ordnung, und sie erscheinen von nun ab unter unserer Leitung. […] Es lebe die internationale sozialistische Weltrepublik!
Die revolutionären Internationalisten Bayerns“.
7. 12 1918 - Ein Verweis für die Krawallmacher
München-Kreuzviertel * In der Ministerratssitzung sprechen sich der Justizminister Johannes Timm und der Kultusminister Johannes Hoffmann für die Verhaftung von Erich Mühsam und anderen aus.
Eisner entgegnet: „Es ist gar nichts Ernstes hinter der Sache gestanden. Auch Mühsam war nicht dafür [gemeint ist der Vorfall in Erhard Auers Wohnung], das Ganze war mehr faschingsartig.“ Die Regierung Eisner erlässt lediglich einen Verweis an die Krawallmacher.
7. 12 1918 - Der Arbeiterrat tagt im Deutschen Theater
München * Die konstituierende Sitzung des Münchener Arbeiterrats findet im Deutschen Theater statt. Das Gremium setzt sich aus über 400 gewählten Arbeiterräten und den rund 50 Mitgliedern des Revolutionären Arbeiterrates zusammen. Die Mehrheit des Münchener Arbeiterrates besteht aus Mitgliedern der Mehrheitssozialdemokraten.
7. 12 1918 - Plakate sollen die Bevölkerung beruhigen und informieren
Berlin * Noch in der Nacht zum 7. Dezember lässt der Rat der Volksbeauftragten Plakate anschlagen. Sie sollen einerseits die Lage beruhigen und andererseits die Bevölkerung darüber informieren, dass die Vorfälle und die Todesfälle vom 6. Dezember mit strengster Härte verfolgt werden.
7. 12 1918 - Die USPD solidarisiert sich mit Spatakus
Berlin * Die undurchsichtigen Vorgänge und das Blutbad vom 6. Dezember steigert das Misstrauen der USPD gegenüber den Mehrheitssozialdemokraten. Die Freiheit, das Berliner Parteiorgan der USPD, solidarisiert sich mit dem Streikaufruf von Spartakus mit folgenden Zeilen:
„Wir verstehen die Empörung und teilen die Gefühle unserer Genossen. Wir begrüßen ihre Initiative. Der Streik soll ein Protest sein gegen das ruchlose Vorgehen in der Chausseestraße, gegen gegenrevolutionäre Umtriebe und eine Sympathiebezeigung für die armen Opfer!“
7. 12 1918 - Blutige Auseinandersetzung gerade noch verhindert
Berlin * Für den Nachmittag hat die Berliner Spartakusgruppe zu einer Demonstration aufgerufen. Unter den Linden droht die Demonstration in eine blutige Auseinandersetzung verwickelt zu werden. Dem Polizeipräsidenten Emil Eichhorn gelingt es, die aufgezogenen Truppen mit ihren Maschinengewehren zum Abzug zu überreden.
7. 12 1918 - Der Blutige Freitag im Spannungsfeld der Propagandisten
Berlin * Für die bürgerlichen Parteien sind die Schuldigen an den Vorgängen vom Vortag schnell gefunden: „Die blutigen Krawalle sind anscheinend durch Pläne und Unternehmungen der Spartacus-Leute und der mit ihnen verbündeten Elemente verursacht worden, deren Ziel der Sturz der Regierung Ebert-Haase war.“
Für die Linken erklärt Karl Liebknecht: „Es ist gar nicht mehr zu leugnen, dass der Putsch des gestrigen Tages von der Regierung inszeniert worden ist, denn es muss doch dem Harmlosesten auffallen, dass die Ereignisse des blutigen Freitags alle miteinander in Zusammenhang stehen.“
Es lässt sich weder ein Spartakusputsch noch eine Beteiligung oder Mitwisserschaft der MSPD-Spitze an einem Putschversuch nachweisen. Doch die Faktenlage stört in dieser aufgeheizten Stimmung die Propagandisten weder von Rechts noch von Links.
7. 12 1918 - Räte: Der Abschaum der Bevölkerung
München - Vatikan * Uditore [= die rechte Hand des Nuntius] Lorenzo Schioppa berichtet an den Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri: „Der Münchner Arbeiter- und Soldatenrat setzt sich aus dem Abschaum der Bevölkerung zusammen, aus vielen Nichtbayern aus der Marine, Juden, Einheimischen, die schon lange gegen Adel und Klerus aufbegehren, und kaum aus Bürgern und Soldaten, die wirklich an der Front waren“.
7. 12 1918 - Wahlrecht für die weiblichen Staatsangehörigen Bayerns eingeführt
München - Freistaat Bayern * Das Wahlrecht für die weiblichen Staatsangehörigen Bayerns wird eingeführt.
8. 12 1918 - Die politisch-satirische Zeitung Rote Hand wird verboten
München * Die politisch-satirische Zeitung „Rote Hand“, Untertitel: „Führendes Organ für national-anarchistische Gschaftlhuberei“, erscheint erstmalig im Straßenhandel. Polizeipräsident Josef Staimer lässt den Druck einstellen und das weitere Erscheinen verbieten. Er begründet die Maßnahme mit der „Übertretung der Sonntagsruhe“.
8. 12 1918 - Das 2. Infanterie-Regiment trifft in München ein
München * Um 15 Uhr trifft das I. Bataillon des 2. Infanterie-Regiments mit zwölf Offizieren und 400 Mann in München ein. Mit wehenden weißblauen Fahnen und vom versammelten Volk umjubelt ziehen sie zur Kaserne an der Infanteriestraße.
8. 12 1918 - Weitere Regimenter und Kompanien treffen in München ein
München * Um 17 Uhr trifft das III. Bataillon des 1. Infanterie-Regiments König in München ein. In der Nacht treffen noch drei weitere Kompanien ein.
8. 12 1918 - Ultimative Forderungen von Hindenburg
Kassel - Berlin * Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der Chef der Obersten Heeresleitung - OHL, fordert in einem Brief an den Reichskanzler Friedrich Ebert ultimativ
- die Stärkung der Macht der Reichsleitung,
- die sofortige Einberufung der Nationalversammlung noch im Dezember,
- die Beseitigung der Soldatenräte,
- die Ausschaltung der Arbeiterräte sowie
- aller Revolutionsorgane mit Ausnahme der Reichsleitung.
- Das Vorgesetztenverhältnis und alle damit zusammenhängenden Bestimmungen sind „restlos“ wiederherzustellen und die Soldatenräte aus der Truppe zu entfernen.
8. 12 1918 - Ebert verweigert sich dem Putschvorhaben der OHL
Berlin * Reichskanzler Friedrich Ebert verweigert sich dem Putschvorhaben der Obersten Heeresleitung - OHL. Mit dem preußischen Kriegsminister Schëuch und dem Vollzugsrat handelt Ebert die Modalitäten des Truppeneinzugs aus.
Der erzielte Kompromiss läuft den Putschplänen der Heeresleitung entgegen. Denn es sollen nur Berliner Truppenteile mit begrenzter Menge an Taschenmunition in der Hauptstadt einziehen. Außerdem sollen sie von Arbeiterabordnungen eskortiert werden.
8. 12 1918 - Die Oberste Heeresleitung lehnt den Kompromiss ab
Kassel * Die Oberste Heeresleitung - OHL lehnt den Kompromiss zwischen Reichskanzler Friedrich Ebert, dem preußischen Kriegsminister und dem Vollzugsrat zum Truppeneinzug in Berlin ab.
Der OHL-Plan war der Einzug von „zuverlässigen Divisionen“ bestehend aus 150.000 Mann, in voller Kriegsausrüstung mit schweren Waffen und Munition, die einen entsprechend erfolgreichen Putsch und die Niederschlagung der Revolution durchsetzen sollten.
9. 12 1918 - Die Delegierten der Arbeiterräte Bayerns treffen sich erstmalig
München-Kreuzviertel * Die Delegierten der Arbeiterräte Bayerns treffen sich am 9. und 10. Dezember 1918 erstmalig zu einer zweitägigen Tagung im Gebäude des Bayerischen Landtags. Sie beratschlagen über
- ihre Position zur politischen und wirtschaftlichen Lage Bayerns,
- die Aufgaben der Arbeiterräte-Organisation und
- wählen die 50 Vertreter der Arbeiterschaft zum provisorischen Nationalrat.
9. 12 1918 - Der Rat der Presse und des Schrifttums konstituiert sich
München * Der Rat der Presse und des Schrifttums konstituiert sich.
9. 12 1918 - Kurt Eisner erklärt die beabsichtigten Ziele der Januar-Streiks
München * Vor den bayerischen Arbeiterräten erklärt Ministerpräsident Kurt Eisner:
„Wir wollten die Revolution nicht erst machen in der Zeit des militärischen Zusammenbruchs, sondern im Gegenteil schon entfesseln, als Deutschland auf der Höhe seiner militärischen Macht stand. […] Das war der Sinn des Streiks.“
9. 12 1918 - Die Nationalversammlung ist entbehrlicher als die Arbeiterräte
München * Ministerpräsident Kurt Eisner erklärt auf der Sitzung der bayerischen Arbeiterräte:
„Die Arbeiterräte sollen die Parlamente der körperlichen und geistigen Arbeiter sein, und wenn man demgegenüber erklärt, dass die Nationalversammlung, der Landtag, diese Arbeiterräte entbehrlich machen würde, so behaupte ich: Umgekehrt, es wäre noch eher die Nationalversammlung entbehrlich als die Arbeiterräte.“
9. 12 1918 - Gustav Landauers positive Bilanz zu den Räteorganisationen
München * Gustav Landauer zieht eine positive Bilanz zur Tätigkeit der Räteorganisationen:
„Da handelt es sich vor allen Dingen um die Umstellung der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft. Zum Beispiel hat der Zentralarbeiterrat wesentlich dabei mitgewirkt, […]
- dass die Alliiertenwerkstätten sofort in Friedenswerkstätten, in Werkstätten zur Herstellung von Waggons und Lokomotivteilen umgewandelt werden.
- Es ist eine sofortige Einstellung der Rüstungsbetriebe durchgesetzt worden. Wir haben aber dafür gesorgt und daran mitgearbeitet, dass eine vierwöchige Kündigungsfrist mit voller Bezahlung der Arbeitslosenunterstützung inngehalten werden musste.
Wir haben […] mitgearbeitet
- an der Versorgung Bayerns mit Kohle,
- an der Verstaatlichung des Lastkraftwagenverkehrs, […]
- dass Wagen, Pferde, Vieh, Gerät aller Art bei uns im Lande bleibt und vor allen Dingen von unseren Produzenten und von unseren Bauern verwertet wird,
- an der Durchführung der 44-Stunden-Woche mit freiem Samstagnachmittag.“
9. 12 1918 - Es führt der Terror
Kassel - Berlin * Generalquartiermeister Wilhelm Groener wirft Reichskanzler Friedrich Ebert in einem Brief vor, „dass nicht die Regierung und der Kriegsminister führen, sondern der Terror“.
9. 12 1918 - Die OHL will ihren Putsch durchführen
Kassel - Berlin * Die Oberste Heeresleitung - OHL erteilt General Lequis die Anweisung, im Sinne Hindenburgs „selbstständig zu handeln, nötigenfalls alle entgegenstehenden Anweisungen von Regierungsorganen oder militärischen Stellen, auch des Kriegsministers, abzulehnen“.
Reichskanzler Friedrich Ebert wird anschließend von der Anweisung in Kenntnis gesetzt. Sie will den Putsch durchziehen - möglichst mit Ebert, notfalls aber auch ohne ihn.
9. 12 1918 - Ein Eid auf die Republik und die provisorische Regierung
Berlin * Bei Verhandlungen zwischen dem Rat der Volksbeauftragten und dem Vollzugsrat wird ein Kompromiss gefunden, der den am nächsten Tag einziehenden Frontsoldaten erlaubt, Munition mitzuführen, aber keine Maschinengewehre, keine schweren Waffen und keine Panzerfahrzeuge.
Die Truppen müssen sich verpflichten, „ihre ganze Kraft in den Dienst der jetzigen provisorischen Regierung zu stellen“. Reichskanzler Ebert vereidigt einige dieser Einheiten - symbolisch für das gesamte Offizierskorps - auf die Republik und die provisorische Regierung.
Um 10. 12 1918 - Die Bayerischen Volkspartei - BVP wehrt sich
München * In einer von der Bayerischen Volkspartei - BVP finanzierten Zeitungsannonce ist zu lesen: „Lügner und Verleumder! nennen wir jeden, der behauptet, die BVP spiele mit dem Gedanken der Wiedereinführung der Wittelsbacher.“
10. 12 1918 - Antisemitismus im Buchloer Anzeigenblatt
Buchloe - München * Im Buchloer Anzeigenblatt erscheint ein antisemitischer Artikel. Dem Redakteuer Cölestin Rabis schwebt sogar eine Endlösung vor.
„Der Jude Eisner spielt Diktator und beschwindelt das Volk wie vordem unsere Diplomaten. […] Politik ist und bleibt ein Geschäft, und Jude bleibt Jude. […] Die Judenfrage ist ein Problem für sich, welches das deutsche Volk endlich einmal mit gerechter Strenge zu lösen hat, aufgefasst als Rassenfrage und nicht als Religionsproblem.“
10. 12 1918 - Die Räte bilden eine Kommission zur Überprüfung der Richtlinie
München * Auf der Sitzung der bayerischen Arbeiterräte erklärt Innenminister Erhard Auer, dass er über 600 Telegramme herausgegeben hat, in denen Beschlüsse von Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten aufgehoben worden sind.
Die Sitzung ist aufgrund von Protesten gegen die Vorläufigen Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte der Räte aus der Provinz einberufen worden. Man beschließt eine Kommission zur Überprüfung der Richtlinie.
10. 12 1918 - Spontan, disziplinwidrig und unaufhaltsam löst sich die Truppe auf
Berlin * Die Garde-Kavallerie-Schützen-Division und das Bundesbataillon ziehen durch das Brandenburger Tor in Berlin ein.
Sebastian Haffner schreibt später darüber: „Die Truppe hatte sofort nach Eberts Begrüßungsansprache begonnen, sich aufzulösen - spontan, disziplinwidrig, unaufhaltsam. […] Der Krieg war zu Ende, alle waren froh, dass sie ihn lebend überstanden hatten, alle wollten nach Hause - und Weihnachten stand vor der Tür. Sie waren nicht mehr zu halten.“
10. 12 1918 - Der Putsch der OHL wird vertagt
Kassel * Die Oberste Heeresleitung - OHL schreckt vor einer militärischen Besetzung Berlins - ohne die Zustimmung oder gar gegen den Widerstand des Reichskanzlers Friedrich Ebert - in letzter Minute zurück. Der Putsch wird vertagt.
10. 12 1918 - Die Nachkriegs-Ausgabe des Kain erscheint
München * Die erste Nachkriegs-Ausgabe des Kain erscheint. Erich Mühsam stellt die Zeitung in den Dienst der Revolution.
11. 12 1918 - Erste Versammlung des Spartakusbundes München
München-Ludwigsvorstadt * Erstmals tritt der Spartakusbund mit einer Massendemonstration in München in Erscheinung. Im Wagnersaal referiert Max Levien, der Vorsitzende der bayerischen Sektion des Spartakusbundes, über das Thema „Die blutigen Vorgänge in Berlin und die Schuld der jetzigen Reichsregierung“. In seinem Referat stellt er eine Reihe radikaler Forderungen auf, darunter
- die Einrichtung von Revolutionstribunalen zur Bestrafung der Konterrevolutionäre und
- die Gründung einer Roten Armee.
Seinen Ausführungen stellen sich Kurt Eisner, Dr. Edgar Jaffé, Gustav Landauer, Erich Mühsam und Fritz Sauber entgegen.
- Ministerpräsident Eisner wendet sich gegen die Demonstrationslust,
- Gustav Landauer äußert sich gegen das „ewige Blutspucken“. Mit Rache macht man keine neue Welt.
- Erich Mühsam will die Revolution gegen ihre Feinde schützen, aber nicht mit blutigen Mitteln.
11. 12 1918 - Die rumänische Regierung erkennt die Karlsburger Beschlüsse an
Bukarest * Die rumänische Regierung unter König Ferdinand erkennt die Karlsburger Beschlüsse an.
11. 12 1918 - Max Levien gründet eine regionale Spartakusgruppe
München * In München wird durch Max Levien eine regionale Spartakusgruppe gegründet.
11. 12 1918 - Eisner: Die Nationalversammlung ist eine vollzogene Tatsache
München-Ludwigvorstadt * Ministerpräsident Kurt Eisner erklärt in einer Versammlung im Wagnerbräu, „die Nationalversammlung ist eine vollzogene Tatsache. Wenn heute das Proletariat die Nationalversammlung verhindert, so ist dies der Bankrott des Proletariats“.
11. 12 1918 - Die Deutsche-Jäger-Division und die 1.-Garde-Division in Berlin zurück
Berlin * Die Deutsche-Jäger-Division und die 1.-Garde-Division ziehen in Berlin ein.
12. 12 1918 - Die USPD hält ihre ersten zwei Wahlkampf-Versammlungen ab
München * Die USPD hält ihre ersten zwei Wahlkampf-Versammlungen ab. Kurt Eisner spricht im Mathäserbräu, Hans Unterleitner im Wagnersaal. Beide wollen den Kampf für den Sozialismus mit geistigen Waffen führen.
12. 12 1918 - Eisner: Der Mensch darf nicht mehr Sklave der Maschinen werden
München * In einer Wahlrede vor den Unabhängigen erklärt Kurt Eisner: „Die Revolution war ja schon geplant im Januar“. Und weiter:
„Sozialismus ist nur ein Wort und Sozialismus, das Wort, erfüllt man mit Leben, indem man es verwirklicht; wie auch Demokratie nicht dekretiert werden kann von oben, wie die Freiheit nur in sich selbst und aus sich selbst reift. Ein Volk, das nicht frei ist, kann niemals die Freiheit gebrauchen lernen; erst wenn es frei ist, lernt es, frei zu sein. Nur so können wir sozialistische Politik treiben.
Der Sozialismus wirkt, indem er sich verwirklicht. Er birgt ein Fülle schwerster Probleme. Aber das Ziel ist klar: wir müssen die menschliche Knechtschaft beseitigen. Wir müssen die Güter der Erde allen zuteil werden lassen. Es darf nicht mehr sozial Unterdrückte in der künftigen Gesellschaft geben. Wie immer die Gliederung und der Aufbau in der zukünftigen Gesellschaft sich vollziehen wird, welche wirtschaftlichen Formen wir finden werden, der Mensch darf nicht das Opfer seiner Verhältnisse werden, sondern der Mensch muß Herr über seine Verhältnisse werden.
Der Mensch darf nicht mehr Sklave der Maschinen werden, sondern Herr über die Technik. Der Mensch darf nicht mehr Objekt des Profits werden, sondern jeder, der arbeitet, muß mitbestimmen können an der Gestaltung dieser Arbeit. Wir haben es immer abgelehnt, einen Zukunftsstaat auszumalen. Einen Zukunftsstaat prophezeit man nicht, sondern man schafft ihn.“
12. 12 1918 - Einzug der 4.-Garde-Division in Berlin
Berlin * Einzug der 4.-Garde-Division in Berlin.
12. 12 1918 - Die Volksmarinedivision soll das Stadtschloss räumen
Berlin * Das Kriegsministerium und die Stadtkommandantur drängen darauf, dass die Volksmarinedivision das Stadtschloss räumt.
12. 12 1918 - Räte als Schule der Demokratie
München-Ludwigsvorstadt * In einer Wahlkampfrede im Mathäserbräu bringt Kurt Eisner seine inzwischen in allen Passagen durchdachte Einstellung zu den Räten zum Ausdruck:
„Die Räte sollen die Schulen der Demokratie werden, daraus dann sollen die Persönlichkeiten emporsteigen zu politischer und wirtschaftlicher Arbeit. Das ist der tiefste Sinn des Sozialismus: Selbstständigkeit der Gesamtheit.
Die ‚Vertreter‘ der ‚Masse‘ - sie mögen noch so tüchtig sein, noch so nützliche Arbeit leisten, aber das sind schon die Leute, die emporgekommen sind. In den Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten, in der Stadt und auf dem Lande, da kann jeder lernen, politisch und wirtschaftlich tätig zu sein. Darum, Parteigenossen, stehe und falle ich mit diesem Gedanken, dass die demokratische Organisation der Massen selbst künftig die Grundlage aller Entwicklung sein muss. Dort wirkt Idealismus, dort ist freie öffentliche Tätigkeit möglich. Dort gibt es keine Führer und keine Angeführten, sondern dort lebt die Masse selbst.“
13. 12 1918 - Der provisorische Nationalrat hält seine zweite Sitzung ab
München-Kreuzviertel * Der sich aus Delegierten der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte zusammensetzende provisorischen Nationalrat hält seine zweite Sitzung im Gebäude des Bayerischen Landtags in der Prannerstraße ab.
Die Regierung Eisner räumt dem Provisorischen Nationalrat lediglich eine beratende Funktion ein und verweigert ihm jede Mitwirkung an der Gesetzgebung.
13. 12 1918 - Die Fraktion der Deutschen Demokratischen Partei - DDP entsteht
München-Kreuzviertel * Im Provisorischen Nationalrat schließen sich 16 Abgeordnete zur Fraktion der Deutschen Demokratischen Partei - DDP zusammen. Vorsitzender wird der Kaufmann Karl Friedrich Julius Hübsch, seine Stellvertreter der Orthopäde Dr. Georg Hohmann und Frau Luise Kießelbach.
13. 12 1918 - Ministerpräsident Kurt Eisner, das Parlament und die Räte
München-Kreuzviertel * Ministerpräsident Kurt Eisner konkretisiert auf der zweiten Sitzung des Provisorischen Nationalrats sein Konzept über die Zusammenarbeit von Parlament und den Räten. Dabei stellt er heraus: „Jeder, der arbeitet, also auch jede Organisation von Arbeitenden, soll nicht nur die persönlichen und beruflich-wirtschaftlichen Interessen vertreten, nicht nur die Standes- und Gewerbsinteressen, sondern sie soll die gesamte Arbeit eines bestimmten Berufs in den Dienst der Demokratie stellen.“
Die „produktive Demokratie“ soll im Gegensatz zur „formalen staatsrechtlichen Demokratie“ nicht nur das „Recht gleicher Teilnahme“, sondern die „Pflicht gleicher Mitarbeit“, also die „lebendige Teilnahme aller Glieder des Volkes an der Gesamtheit der Nation“, beinhalten.
„Die Nationalversammlung muss die oberste, souveräne, gesetzgebende Körperschaft sein, sonst wäre sie ja kein Parlament, kein demokratisches Parlament. Die künftige Nationalversammlung ist die Gesetzgeberin, die souveräne Gesetzgeberin, aber in den Räten liegt die moralische Kraft der Massen. Von hier aus soll der lebendige Geist der Demokratie und des Sozialismus hinüber strömen in das Parlament der Abgeordneten.“
13. 12 1918 - Wilhelm Solf, der Leiters des Auswärtigen Amtes, tritt zurück
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten nimmt das Rücktrittsgesuch des Leiters des Auswärtigen Amtes, Wilhelm Solf, an. Als sein Nachfolger wird Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau berufen, der aber von Kurt Eisner ebenso „ungünstig“ beurteilt wird wie Solf.
13. 12 1918 - Die Arbeiter- und Soldatenräte als Störfaktor bezeichnet
Berlin * Dem Reichskanzler Friedrich Ebert geht der Einfluss der Arbeiter- und Soldatenräte zu weit: „So kann es nicht weitergehen, wir blamieren uns vor der Geschichte und der ganzen Welt. […] Das Herum- und Hineinregieren der Arbeiter- und Soldatenräte muss aufhören.“
Schon zuvor wurde von der Regierung heftige Kritik an den als Störfaktor angesehenen Arbeiter- und Soldatenräten geübt, bei denen sich um „die Organisationen der Unordnung“ handle.
13. 12 1918 - Die Volksmarinedivision ist zu Verhandlungen bereit
Berlin * Die Führung der Volksmarinedivision ist bereit, mit der Stadtkommandantur über die Reduzierung der Mannschaftsstärke auf 600 Matrosen und die Räumung des Stadtschlosses und des Marstall zu verhandeln. Die Vereinbarung wird zunächst nicht umgesetzt, weil die Matrosen die Zusage wollen, dass die Entlassenen in die Republikanische Schutztruppe übernommen werden.
13. 12 1918 - Das Gesinderecht wird abgeschafft
München * Auf massiven Druck der vielen Dienstmädchen wird das alte Gesinderecht aufgehoben und bessere Arbeitsbedingungen für Hausangestellte festgelegt.
14. 12 1918 - 600 Angehörige des 1. Infanterie-Regiments treffen in München ein
München * Rund 600 Angehörige des 1. Infanterie-Regiments treffen in München ein. Sie ziehen unter dem Jubel der Münchner zur Marsfeldkaserne.
14. 12 1918 - Der Politische Rat geistiger Arbeiter
München-Kreuzviertel * Der Politische Rat geistiger Arbeiter veranstaltet im Hotel Bayerischer Hof seine erste öffentliche Versammlung.
Um den 14. 12 1918 - Keine Kandidaten für einen bayerischen König
München - Vatikan * Uditore Lorenzo Schioppa informiert Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri, dass ihm zur Restauration des bayerischen Königtums die geeigneten Kandidaten fehlen:
- Ex-König Ludwig III. war in eine annexonistische Kriegspolitik verstrickt,
- Ex-Kronprinz Rupprecht kommt wegen seiner amourösen Galanterien mit belgischen Frauen an der Front nicht mehr in Frage.
- Alleine der Ex-Prinz Franz käme noch in Betracht.
14. 12 1918 - Einzug des 2.-Garde-Regiments und des 4.-Garde-Regiments
Berlin * Einzug des 2.-Garde-Regiments und des 4.-Garde-Regiments in Berlin. Mit den täglich sich vermehrenden Soldaten in der Reichshauptstadt hofft die Oberste Heeresleitung - OHL die Militärpräsenz in Berlin zu steigern und doch noch ihre Putschpläne umsetzen zu können.
15. 12 1918 - Reichskonferenz der Internationalen Kommunisten Deutschlands
Berlin * In Berlin wird die erste Reichskonferenz der Internationalen Kommunisten Deutschlands abgehalten. Sie dauert bis zum 17. Dezember. Ziel ihres Kampfes ist
- die unmittelbare Herbeiführung des Kommunismus,
- die über die Diktatur des Proletariats vorbereitet werden soll.
15. 12 1918 - Die 3.-Garde-Division zieht in Berlin ein
Berlin * Die 3.-Garde-Division zieht in Berlin ein. Weitere Divisionen werden in den kommenden Tagen folgen.
16. 12 1918 - In Berlin beginnt der Kongress der Arbeiter- und Soldaten-Räte
Berlin * Der Erste Allgemeine Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands beginnt im Preußischen Abgeordnetenhaus in Berlin. Der Reichsrätekongress dauert bis zum 20. Dezember.
Pro 200.000 Einwohner wird ein Arbeiterrat, pro 100.000 Soldaten ein Soldatenrat entsandt. Die SPD-Delegierten haben eine Zweidrittelmehrheit.
Nur zwei von 490 Delegierten sind Frauen. 298 Delegierte sind Mitglieder der MSPD, 101 Delegierte gehören der USPD an. 25 bezeichnen sich als Demokraten, 26 Soldatenräte und 49 Arbeiterräte machen keine Angaben zu ihrer politischen Orientierung.
16. 12 1918 - Die geistliche Schulaufsicht wird abgeschafft
München-Kreuzviertel * Der Ministerrat billigt die von Kultusminister Johannes Hoffmann vorgelegte „Verordnung, betreffend Beaufsichtigung der Volksschule“. Darin wird ab 1. Januar 1919 die geistliche Schulaufsicht abgeschafft und Übergangsregelungen für die Zeit bis dahin festgeschrieben.
- Die Ortsschulaufsicht geht vom Ortspfarrer auf den Bürgermeister über.
- Darüber hinaus wird ein freireligiöser Sittenunterricht eingeführt und
- der Zwang zur Teilnahme am Religionsunterricht abgeschafft.
Damit sind zentrale kulturpolitische Forderungen der Sozialdemokratie der letzten Jahrzehnte erfüllt.
16. 12 1918 - Gründungsziel: Ein Bund sozialistischer Frauen
München-Ludwigsvorstadt * Auf Einladung von Toni Pfülf und Nanette Katzenstein treffen sich Frauen, „die entweder schon auf dem Boden des Sozialismus stehen oder dieser Richtung zuneigen“.
Das Ziel ist ein Bund sozialistischer Frauen die feministisch denken und die Interesse an der Gestaltung einer Frauen- und Friedenspolitik haben. Es gibt keine Satzung und kein Programm. Geblieben sind zwei Plakate und die von Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann herausgegebene Zeitschrift „Die Frau im Staat“.
17. 12 1918 - Soldaten besetzen die Versammlung der Deutschen Volkspartei München
München-Ludwigsvorstadt * Eine Gruppe Soldaten besetzt die Versammlung der Deutschen Volkspartei München im Saal des Hotel Wagner. Die Eindringlinge stören den Ablauf derart, dass die Beratungen vorzeitig abgebrochen werden müssen.
Professor Ludwig Quidde erntet stürmischen Beifall der Versammelten, als er die Forderung formuliert: „Wir beanspruchen vom freien Volksstaat Bayern das, was der verfluchte Obrigkeitsstaat uns gewährt hat.“
17. 12 1918 - Rosa Luxemburg tritt für eine Räteregierung ein
Berlin * Rosa Luxemburg schreibt für die Rote Fahne den Artikel „Nationalversammlung oder Räteregierung?“ Darin tritt sie für eine Räteregierung ein.
17. 12 1918 - Neue Bestimmungen für die Arbeiterräte
München * Die Regierung erlässt Bestimmungen über Organisation und Befugnisse der Arbeiterräte. Sie lösen die Vorläufigen Richtlinien für die Arbeiter- und Bauernräte ab. Eine inhaltliche Verbesserung über die Befugnisse der Räte bringen die Bestimmungen nicht. Es bleibt bei der Vorrangstellung der Behörden.
Die Bestimmungen für die Arbeiterräte bleibt die rechtliche Grundlage für die Arbeit der Arbeiterräte, bis der Landtag am 21. Mai 1920 das Gesetz über die Aufhebung der Arbeiterräte beschließt.
Die Anordnung enthält drei wichtige Sonderbestimmungen, deren Auswirkungen sich auf den ersten Blick nicht gleich offenbaren.
- Soldatenräte sind von den Arbeiterräten völlig zu trennen. Ihre Bezahlung erfolgt ausschließlich durch den Militärhaushalt.
- Die Bauernräte sind mit den Arbeiterräten zusammenzuschließen.
- Nur Arbeiterräte haben das Recht auf staatliche Bezüge.
17. 12 1918 - Die Volksmarinedivision alarmiert den Räte-Kongress
Berlin * Protestierende Soldaten unter dem Führer der Volksmarinedivision, Heinrich Dorrenbach, erscheinen im Plenum des Ersten Allgemeinen Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands und alarmieren die anwesenden Delegierten. Sie fühlen sich durch die zurückgekehrten Fronttruppen, dem Kriegsministerium und der Stadtkommandantur bedroht.
Wo die Frontsoldaten auf die Räte treffen, kommt es zu Zusammenstößen. Versuche, die Soldatenräte zu behindern oder gleich ganz aufzulösen sowie die Embleme der Revolution zu beseitigen, sind keine Einzelfälle.
17. 12 1918 - Die Räte als Grundlage des Parlaments
München-Kreuzviertel * Auf der Sitzung des provisorischen Nationalrats antwortet Ministerpräsident Kurt Eisner auf den Liberalen Ludwig Quidde:
„Die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte müssen sich jetzt konsolidieren, sie müssen die Grundlage aller zukünftigen parlamentarischen Tätigkeit bilden: die Nationalversammlung kann nicht der Anfang sein, sie kann nur das Ende, das letzte Ergebnis der Tätigkeit der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte bilden.“
18. 12 1918 - Militante Demonstration vor dem Münchner Hauptbahnhof
München-Ludwigsvorstadt * Am frühen Morgen ziehen mehrere hundert Menschen zum Hauptbahnhof, um die Bahnhofswache und deren Kommandanten zu verhaften.
Die Bahnhofswache gibt einige Schreckschüsse ab und säubert, nach einem erneuten Ansturm der Menge, den Platz. Die Demonstration dauert etwa zwei Stunden. Dabei erhält ein Unbeteiligter zwei Schussverletzungen.
18. 12 1918 - Innenminister Erhard Auer erlaubt die Zulassung von Milizen
München * Innenminister Erhard Auer erlaubt ausdrücklich die Zulassung von Milizen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung.
18. 12 1918 - Termin für die Wahlen zur Nationalversammlung festgesetzt
Berlin * Auf dem Kongress der Arbeiter- und Soldaten-Räte Deutschlands in Berlin werden die Forderungen des Spartakusbundes und dem linken Flügel der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - USPD zur Übertragung der gesamten Macht an die Arbeiter- und Soldaten-Räte abgelehnt.
- Die Mehrheit stimmt für den Antrag der MSPD, „bis zur anderweitigen Regelung durch die Nationalversammlung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt“ dem Rat der Volksbeauftragten [= Regierung Ebert] zu übertragen.
- Die Mehrheit beschließt, die Wahlen zur Nationalversammlung auf den 19. Januar 1919 festzusetzen.
18. 12 1918 - Die Protesterklärung der Bayerischen Bischofskonferenz
München * Der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber reagiert auf die „Verordnung, betreffend Beaufsichtigung der Volksschule“ vom 16. Dezember 1918 überraschend pragmatisch und ist sogar bereit, die Schulaufsicht kampflos aufzugeben.
Auf der Bayerischen Bischofskonferenz erstellen die Bischöfe allerdings eine gemeinsame Protesterklärung gegen die schulpolitischen Maßnahmen der Revolutionsregierung. Die Bischöfe beklagen darin die einseitige Verletzung des im Konkordat anerkannten Rechts und betonen die langjährige und treue Mitarbeit der Kirche im Erziehungswesen.
18. 12 1918 - Der Räte-Kongress beschließt die Hamburger Punkte
Berlin * Im Ersten Allgemeinen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands kommt es zu einer Debatte über die von den protestierenden Soldaten der Volksmarinedivision vom Vortag vorgetragenen Punkte.
Durch die sogenannten Hamburger Punkte steht das deutsche Militär vor einem demokratischen Neubeginn wie noch nie vor diesem 18. Dezember. Die sieben Punkte werden nahezu einstimmig vom Kongress beschlossen:
- Die Kommandogewalt über Heer und Marine üben die Volksbeauftragten unter Kontrolle des Vollzugsrats aus.
- Als Symbol der Zertrümmerung des Militarismus und der Abschaffung des Kadavergehorsams wird die Entfernung aller Rangabzeichen und des außerdienstlichen Waffentragens angeordnet.
- Für die Zuverlässigkeit der Truppenteile und für die Aufrechterhaltung der Disziplin sind die Soldatenräte verantwortlich. Der Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte ist der Überzeugung, dass die unterstellten Truppen den selbstgewählten Soldatenräten und Vorgesetzten im Dienste den zur Durchführung der Ziele der sozialistischen Revolution unbedingt erforderlichen Gehorsam erweisen. Vorgesetzte außer Dienst gibt es nicht mehr.
- Entfernung der bisherigen Achselstücke usw. ist ausschließlich Angelegenheit der Soldatenräte und nicht einzelner Personen. Ausschreitungen schädigen das Ansehen der Revolution und sind zur Zeit der Heimkehr unserer Truppen unangebracht.
- Die Soldaten wählen ihre Führer selbst. Frühere Offiziere, die das Vertrauen ihrer Truppenteile genießen, dürfen wiedergewählt werden.
- Offiziere der militärischen Verwaltungsbehörden und Beamte im Offiziersrange sind im Interesse der Demobilisierung in ihren Stellungen zu belassen, wenn sie erklären, nichts gegen die Revolution zu unternehmen.
- Die Abschaffung des stehenden Heeres und die Errichtung der Volkswehr sind zu beschleunigen.
18. 12 1918 - Die Oberste Heeresleitung droht dem Rat der Volksbauftragten
Kassel * Die Oberste Heeresleitung - OHL reagiert scharf auf die vom Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands beschlossenen Hamburger Punkte. Reichskanzler Friedrich Ebert wird massiv unter Druck gesetzt, weil sie Chaos, Niedergang, Bolschewismus und Wehrlosigkeit befördern.
Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Generalquartiermeister Wilhelm Groener erklären gegenüber dem Rat der Volksbeauftragten ihren Rücktritt, falls die Hamburger Punkte angenommen und umgesetzt werden.
„Die Verantwortung für alle Folgen würde vor dem deutschen Volke und der gesamten Welt sowie vor der Geschichte denjenigen zufallen, die diese Resolution durchsetzen würden.“
19. 12 1918 - Der Spartakusbund München versammelt sich im Wagnersaal
München-Ludwigsvorstadt * Der Spartakusbund München hält im Wagnersaal eine Versammlung ab. Max Levien tritt für den Bolschewismus nach russischem Vorbild ein.
Kurt Eisner warnt vor dem „Spiel mit dem Feuer“ und verteidigt die Einberufung der Nationalversammlung. Seine Rede wird ständig durch Zwischenrufe gestört.
19. 12 1918 - Der erste Feierabend im Deutschen Theater
München-Ludwigsvorstadt * Am Abend veranstalten die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte den ersten Feierabend im Deutschen Theater. Die Veranstaltung soll der Bevölkerung „die Seele aufrütteln zu der Erkenntnis, dass wir Menschen sind, die wir in den Kriegsjahren nicht mehr waren“.
19. 12 1918 - Den Anspruch auf den Besitz der Staatsgewalt bestätigt
München * Das Bayerische Oberste Landesgericht bestätigt der provisorischen Regierung den Anspruch auf den Besitz der Staatsgewalt. In der Begründung zu einem Urteil über die Rechtsgültigkeit einer Verordnung heißt es:
„Die gesetzgebende Gewalt ist ein Ausfluss der Staatsgewalt. Sie steht dem zu, der die Staatsgewalt tatsächlich innehat, also zurzeit der Regierung des Volksstaates Bayern. Die Anordnungen der Regierung haben deshalb verbindliche Kraft.“
19. 12 1918 - Abschaffung des Rätesystems und ein Termin für die Wahl
Berlin * Auf dem Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands wird über die Frage Nationalversammlung oder Rätesystem beraten. Die Mehrheitssozialdemokraten wollen den Vollzugsrat, das Kontrollorgan des Rats der Volksbeauftragten auflösen. Max Cohen von der MSPD stellt deshalb den Antrag, künftig auf die Räte zu verzichten. Die USPD setzt sich für den Weiterbestand ein.
Schlussendlich stimmen die Delegierten mit mit 344 gegen 98 Stimmen
- für die Abschaffung des Rätesystems und
- legen den Termin für die Wahl zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung auf den 19. Januar 1919 fest.
19. 12 1918 - Der Zentralrat ohne Beteiligung der USPD
Berlin * Am Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands wird über den noch zu wählenden Zentralrat debattiert. Dem Rat der Volksbeauftragten wird die gesetzgeberische und die vollziehende Gewalt übertragen.
- Der Zentralrat soll das Recht zur Berufung und Abberufung der Volksbeauftragten des Deutschen Reiches und der Volksbeauftragten Preußens erhalten.
- Er muss bei der Berufung von Fachministern und Beigeordneten „gehört“ werden und
- soll das Kabinett „parlamentarisch überwachen“.
Der Kongress beschließt gegen die Stimmen der USPD die Vorlage. Die Unabhängigen erklären daraufhin, sich nicht am Zentralrat zu beteiligen.
19. 12 1918 - Der Kongress der Räte Deutschlands wählt den Zentralrat
Berlin * Der Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands wählt den Zentralrat, der nur aus Vertretern der MSPD und Soldaten besteht.
19. 12 1918 - Hindenburgs offener Ungehorsam
Kassel * Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und die Oberste Heeresleitung - OHL weigern sich, die vom Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands beschlossenen Hamburger Punkte anzuerkennen und weisen die Generalkommandos an, ebenso zu verfahren.
Das ist offener Ungehorsam. Man will sich keinesfalls der demokratischen Willensbildung beugen.
20. 12 1918 - Die Neue Zeitung erscheint erstmals
München * Die Neue Zeitung erscheint erstmals als unabhängiges Organ unter ständiger Mitarbeit von Kurt Eisner.
20. 12 1918 - Massiver Protest zur Abwehr der bolschewistischen Strömungen
München * Die Bayerische Volkspartei - BVP, die Deutsche Volkspartei - DVP und die Nationalliberale Partei - NLP wenden sich in einem außerordentlich scharfen Appell an die vorläufige bayerische Regierung und fordern die Abwehr der „bolschewistischen Strömungen“ und der „Übergriffe der Räte“.
20. 12 1918 - Den Vatikan über die Protesterklärung zur Schulaufsicht informiert
München - Vatikan * Uditore Lorenzo Schioppa informiert den Kardinalsstaatssekretär Pietro Gasparri über Protesterklärung des bayerischen Episkopats gegen die vom bayerischen Ministerrat erlassene „Verordnung, betreffend Beaufsichtigung der Volksschule“ vom 16. Dezember 1918.
20. 12 1918 - Ein tief enttäuschter Arbeiterrat Ernst Toller
Berlin - München * Ernst Toller hat für Südbayern als Delegierter am Berliner Reichsrätekongress teilgenommen. Tief enttäuscht fährt er nach München zurück:
„Der deutsche Rätekongress verzichtet freiwillig auf die Macht, das unverhoffte Geschenk der Revolution, die Räte danken ab, sie überlassen das Schicksal der Republik dem Zufallsergebnis fragwürdiger Wahlen des unaufgeklärten Volks. […] Die Republik hat sich selbst das Todesurteil gesprochen.“
20. 12 1918 - Mit Hirtenbriefen gegen Regierungserlasse
Berlin * Die Erzbischöfe und Bischöfe Preußens bezeichnen in einem Hirtenbrief den Erlass des preußischen Kultusministeriums zur Religionsausübung in den Schulen vom 29. November 1918 als „frevelhaftes Unrecht“ und fordern zum Widerstand auf.
20. 12 1918 - Die Hamburger Punkte werden abgeschwächt
Kassel - Berlin * Generalquartiermeister Wilhelm Groener reist nach Berlin, um über die Umsetzung der Hamburger Punkte mit dem Rat der Volksbeauftragten und dem Zentralrat zu verhandeln. Die Sache geht „dank Eberts geschickter Unterstützung, der wie wenige die Kunst des Abbiegens verstand, aus wie das Hornberger Schießen“, so Groeners Resümee.
Der Rat der Volksbeauftragten und der Zentralrat verständigen sich darauf, den Beschluss des Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands zunächst nicht in Kraft treten zu lassen. Die Hamburger Punkte sollen für das Feldheer keine Anwendung finden. Außerdem sollen Ausführungsbestimmungen erlassen werden.
Genau diese Vorgehensweise hat der Kongress zwei Tage vorher ausdrücklich abgelehnt.
21. 12 1918 - Am Viktualienmarkt werden 2.800 Gänse zum Verkauf angeboten
München-Angerviertel * Am Viktualienmarkt werden 2.800 Gänse zum Verkauf angeboten. Manche Hausfrauen stehen schon um Mitternacht vor den Verkaufsstellen.
21. 12 1918 - Ein umfangreicher Schleichhandel wird aufgedeckt
München * Bei Kontrollen am Hauptbahnhof und in der Innenstadt wird ein umfangreicher Schleichhandel mit Butter, Fleisch und Gemüse aufgedeckt.
21. 12 1918 - Die Schulaufsicht durch Geistliche wird abgeschafft
München-Kreuzviertel - Freistaat Bayern * Die Schulaufsicht durch Geistliche, die es bis dahin - außer in den Städten - in Bayern gilt, wird abgeschafft. An die Stelle der Pfarrer treten weltliche Fachleute, in der Regel Lehrer.
21. 12 1918 - Reichskanzler Ebert streicht der Volksmarinedivision den Lohn
Berlin * Weil aus Sicht der Regierung Ebert die Volksmarinedivision die Vereinbarung vom 13. Dezember zur Reduzierung der Mannschaftsstärke und der Räumung des Stadtschlosses und des Marstalls nicht nachgekommen ist, wird beschlossen, die an diesem Tag fällige Löhnung in Höhe von insgesamt 80.000 Mark „erst nach Räumung des Schlosses und der Herausgabe aller Schlüssel an die Stadtkommandantur“ zu zahlen.
21. 12 1918 - Beisetzung der am 6. Dezember Ermordeten
Berlin * Die am 6. Dezember Ecke Invaliden- und Chausseestraße von Soldaten ermordeten Demonstranten und Passanten werden in einem großen Trauerzug zu Grabe getragen.
22. 12 1918 - Die Bevölkerung Münchens begrüßt einziehende Kriegsheimkehrer
München * Stürmisch begrüßt die Bevölkerung Münchens das einziehende 7. Bayerische Feldartillerie-Regiment, bestehend aus 1.200 Mann, 900 Pferde, 120 Fahrzeuge und 30 Geschütze.
22. 12 1918 - Die DDP und der bayerische Wahlkampf
Nürnberg * Die Deutsche Demokratische Partei - DDP eröffnet ihren bayerischen Wahlkampf mit einer Massenversammlung in Nürnberg.
23. 12 1918 - Helmut Schmidt wird in Hamburg geboren
Hamburg * Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wird in Hamburg geboren.
23. 12 1918 - Reduzierung der Gasabgabe beschlossen
München * Der Gemeindliche Arbeitsausschuss beschließt, dass die Abgabe von Gas ab 1. Januar 1919 täglich zwischen 12:30 und 16:00 Uhr gesperrt wird.
23. 12 1918 - Die Matrosen wollen die Regierungsauflagen erfüllen
Berlin * Eine Abordnung der Volksmarinedivision kommt zum Rat der Volksbeauftragten und beklagt die Vorenthaltung ihres Lohnes. Nach einer Diskussion verpflichten sich die Matrosen, die Auflagen der Regierung umgehend zu erfüllen. Sie erhalten die Zusage, dass die zu kündigenden Matrosen möglichst in die Republikanische Schutztruppe eingegliedert werden sollen.
23. 12 1918 - De Schlüssel des Stadtschlosses werden in der Reichskanzlei abgegeben
Berlin * Um 16 Uhr werden die Schlüssel des Stadtschlosses von Matrosen der Volksmarinedivision beim Rat der Volksbeauftragten abgegeben. Der Stadtkommandant Otto Wels von der MSPD weigert sich aber nun, die Lohnzahlung durchzuführen, weil die Schlüssel nicht in der Stadtkommandantur abgegeben worden sind. Eine Farce.
Die Matrosen verlassen verärgert die Reichskanzlei. Auf ihrem Weg werden zwei Matrosen von rechtsstehenden Militärs getötet.
23. 12 1918 - Stadtkommandant Otto Wels wird gefangen genommen
Berlin * Eine spontane Demonstration entwickelt sich. Sie zieht zur Kommandantur. Die Matrosen werden erneut beschossen, dieses Mal aus einem Panzerauto. Ein Toter ist zu beklagen.
Obwohl den Abgesandten der Volksmarinedivision die Löhnung in der Stadtkommandantur ausgehängt wird, nehmen sie jetzt den Stadtkommandanten Otto Wels und zwei weitere Mitarbeiter gefangen und bringen sie in den Marstall.
23. 12 1918 - Die Reichskanzlei wird besetzt, Volksbeauftragte festgenommen
Berlin * Etwa zur selben Zeit erhalten die Matrosen, die am Reichskanzlerpalais Wache stehen, den Befehl,
- die Fernsprechzentrale der Reichskanzlei zu besetzen,
- die Ausgänge zu verriegeln und
- die Volksbeauftragten festzunehmen.
Rund drei Stunden später wird die Besetzung wieder aufgehoben.
23. 12 1918 - Missverständnisse ausgeräumt und Lösungen gefunden
Berlin * Als die Truppen des Generalkommandos gegen 22 Uhr eintreffen sind in Verhandlungen Missverständnisse ausgeräumt und Lösungen gefunden. Auch die Freilassung von Otto Wels und seinen mitgefangenen Mitarbeitern ist besprochen. Es herrscht Einigkeit. Aber die Truppen des Generalkommandos wollen den Kampf.
23. 12 1918 - Verhandlungen ohne die USPD-Volksbeauftragten
Berlin * Um 23 Uhr findet in der Reichskanzlei eine Besprechung zwischen dem Kriegsminister Heinrich Schëuch und den MSPD-Volksbeauftragten Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg statt. Der Koalitionspartner, die USPD-Volksbeauftragten Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth sind nicht anwesend und werden auch an den weiteren Vorbereitungen nicht beteiligt.
Immer wieder wird der Kontakt mit der Führung der Volksmarinedivision hergestellt, ob der Stadtkommandant Otto Wels und seine beiden mitgefangenen Mitarbeiter inzwischen freigelassen worden sind.
23. 12 1918 - Die Oberste Heeresleitung droht Reichskanzler Ebert
Kassel - Berlin * Als Generalquartiermeister Wilhelm Groener von der gütlichen Einigung erfährt, übt er heftige Kritik an dieser Vorgehensweise. In einem Telefonat mit dem Reichskanzler Friedrich Ebert erklärt er, dass es so nicht geht. „Wenn Sie gefangen gesetzt sind, und von der Truppe befreit werden, muss die Truppe auch die Möglichkeit haben, die Gegner […] nach Kriegs- und Standrecht zu behandeln. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, kann ich mit Ihnen nicht mehr weiter zusammengehen; denn dann verderben Sie uns die Truppe“.
Einen von Groener vorgeschlagenen Angriff am nächsten Tag auf die im Stadtschloss und im Marstall befindlichen Angehörigen der Volksmarinedivision stimmt Ebert zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu.
23. 12 1918 - Konrad von Preger wird zum Bayerischen Gesandten in Berlin bestellt
München - Berlin * Konrad Ritter von Preger wird zum Bayerischen Gesandten in Berlin bestellt. Er übernimmt damit ab 1. Januar 1919 die Funktion von Dr. Friedrich Muckle.
24. 12 1918 - Innenminister Auer feiert mit Graf Arco in der Türkenkaserne
München-Maxvorstadt * Innenminister Erhard Auer verbringt den Heiligabend auf Einladung von Anton Graf Arco-Valley, dem späteren Eisner-Mörder, in der Türkenkaserne.
„Auer war in fröhlichster Laune und hielt eine schmetternde Lobrede auf das Leibregiment […]. Die gräflichen Offiziere waren so gerührt, dass bei einem von ihnen eine Träne am Monokel haften blieb. Es fehlte nur noch die Königshymne.“
24. 12 1918 - Brot teurer - Pferdefleisch billiger
München * Der Brotpreis steigt um 4 Pfennig auf 59 Pfennig pro Pfund. Pferdefleisch ist billiger geworden und kostet jetzt 80 Pfennig bis 1,10 Mark das Pfund.
24. 12 1918 - Die Gründung einer Kommunistischen Partei wird beschlossen
Berlin * Die 2. Reichskonferenz der Internationalen Kommunisten Deutschlands beschließt
- die Vereinigung mit dem Spartakusbund und spricht sich für
- die Gründung einer Kommunistischen Partei aus.
24. 12 1918 - Das Tragen der schwarz-weiß-roten Konkarde verboten
München * Die Stadtkommandantur verbietet das Tragen der schwarz-weiß-roten Konkarde.
24. 12 1918 - Die Gerüchteküche kocht in München
München * In München verbreitet sich das Gerücht über einen geplanten Spartakisten-Putsch und dem Ausbruch von 16.000 Kriegsgefangenen aus dem Lager Lechfeld.
Der Patrouillen- und Postendienst wird in den Straßen der Stadt verstärkt. Christmetten werden militärisch und polizeilich gesichert. Die Michaelskirche sagt den mitternächtlichen Gottesdienst ganz ab.
24. 12 1918 - Reichskanzler Ebert gibt dem Kriegsminister eine Blankovollmacht
Berlin * Zwischen 0:30 und 1:00 Uhr erklärt Reichskanzler Friedrich Ebert sein Einverständnis zum Angriff auf das Stadtschloss und den Marstall. „Die Situation war sehr ernst, und wir haben dann den Kriegsminister gebeten, das Erforderliche zu veranlassen, um Wels zu befreien.“
24. 12 1918 - Die Reichskanzlei ist verlassen
Berlin * Der USPD-Vorsitzende Georg Ledebour kann gegen 3 Uhr die sofortige Freilassung des Stadtkommandanten Otto Wels und seiner Mitgefangenen erreichen. Mit einer Abordnung der Matrosen begibt er sich zur Reichskanzlei. Diese ist aber inzwischen geschlossen und verwaist.
24. 12 1918 - Das Stadtschloss wird mit Waffen gestürmt
Berlin * Die Garde-Kavallerie-Schützen-Division umstellt mit 900 Mann, sechs Geschützen und Maschinengewehren das Stadtschloss und den Marstall. Um 7:30 Uhr werden die Angehörigen der Volksmarinedivision aufgefordert, innerhalb von zehn Minuten
- den Stadtkommandanten Otto Wels samt seinen Mitgefangenen auszuliefern,
- die Waffen niederzulegen und
- die Gebäude zu verlassen.
Um 7:40 Uhr werden das Stadtschloss und der Marstall von den Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division beschossen.
Weitere zehn Minuten später wird das Schloss gestürmt und gegen 8:10 Uhr haben die Angreifer das Stadtschloss erobert. Beim Marstall dauert es etwas länger.
24. 12 1918 - Die Garde-Soldaten werden von der Bevölkerung abgedrängt
Berlin * Um 9:10 Uhr kapitulieren die Verteidiger des Stadtschlosses und des Marstalls. Sie zeigen die weißen Fahnen. Stadtkommandant Otto Wels wird sofort freigelassen.
Zur Entwaffnung kommt es nicht mehr, da die Matrosen der Volksmarinedivision während dieser Feuerpause Unterstützung durch die dem Polizeipräsidenten Emil Eichhorn von der USPD unterstellte Republikanische Sicherheitswehr erhalten.
Das Gerücht eines gegenrevolutionären Putsches macht die Runde. In kürzester Zeit ziehen tausende Arbeiter, Frauen und Kinder zum Stadtschloss. Die Lage dreht sich. Jetzt sind plötzlich die Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division die Bedrohten. Gefangene Matrosen werden befreit, die Garde-Soldaten von der Bevölkerung eingeschlossen und abgedrängt.
Reichskanzler Friedrich Ebert gibt den Befehl zur sofortigen Einstellung der Kämpfe. Die Garde-Kavallerie-Schützen-Division muss abziehen und in der Universität Schutz suchen. Begleitet werden sie von der ihnen wenig freundlich gesinnten Bevölkerung. Die Demonstration ist inzwischen auf 100.000 Menschen angewachsen.
Die Oberste Heeresleitung - OHL und Generalquartiermeister Wilhelm Groener haben eine fürchterliche Niederlage erlitten und sind grandios gescheitert.
24. 12 1918 - Ein gesichtswahrendes Verhandlungsergebnis
Berlin * Eine Besprechung wird in der Universität anberaumt, die die Bevollmächtigten der Regierung unter der Leitung des USPD-Vorsitzenden Georg Ledebour geführt wird. Es wird beschlossen:
- Die Truppen des Generalkommandos ziehen mit allen militärischen Ehren aus der Stadt.
- Die Matrosen bleiben bewaffnet.
- Die Volksmarinedivision räumt das Stadtschloss und den Marstall.
- Sie wird - wie bereits vorgesehen - von 1.500 auf 600 Mann reduziert.
- Die entlassenen Matrosen werden in die Republikanische Soldatenwehr integriert.
24. 12 1918 - Fazit: 56 tote Soldaten, 11 tote Matrosen
Berlin * Um 14 Uhr verlassen die Truppen des Generalkommandos die Reichshauptstadt Berlin. Die Angreifer müssen 56 tote Soldaten verzeichnen. Auf der Seite der Matrosen sind es elf Tote.
25. 12 1918 - Gründung des Verbands der Frontsoldaten - Stahlhelm
Magdeburg * In Magdeburg wird durch Franz Seldte der Verband der Frontsoldaten - Stahlhelm gegründet.
25. 12 1918 - Die MSPD-Parteizeitung Vorwärts wird von Demonstranten gestürmt
Berlin * Weil das MSPD-Parteiorgan Vorwärts Kritik am Verhalten der Volksmarinedivision äußert, endet eine Demonstration mit der Besetzung der Zeitung.
Die Besetzer richten einen provisorischen Redaktionsstab ein. Dieser lässt ein Flugblatt drucken, das dass „lügerische Reptil“ Vorwärts von nun an als „Roter Vorwärts“ erscheinen und der Bevölkerung „die heiß ersehnte Wahrheit verkünden“ wird.
26. 12 1918 - Die Zeitungsbesetzer geben den Vorwärts wieder frei
Berlin * Nach langwierigen Verhandlungen geben die Zeitungsbesetzer den Vorwärts wieder frei. Das allerdings unter der Auflage, dass in der nächsten Ausgabe eine Erklärung der Revolutionären Obleute abgedruckt werden muss.
27. 12 1918 - Erhard Auer und Johannes Timm wollen eine Bürgerwehr gründen
München * In einem Aufruf fordern Innenminister Erhard Auer [MSPD] und Justizminister Johannes Timm [MSPD] zusammen mit dem Landtags-Bibliothekar Rudolf Buttmann und dem Verleger Julius Lehmann sowie weiteren 21 namhaften, rechtsstehenden Bürgerlichen die Schaffung einer „freiwilligen Bürgerwehr“ als Organ der „ordnungsliebenden Kreise“.
27. 12 1918 - Neuanfang auf föderaler Grundlage
Stuttgart * In Stuttgart beginnt eine gemeinsame Sitzung der süddeutschen Staaten. An dem Stuttgarter Ländertreffen nehmen teil:
- Kurt Eisner, der Ministerpräsident von Bayern,
- Anton Geiß, der Ministerpräsident von Baden,
- Wilhelm Blos, der Ministerpräsident von Württemberg und
- Carl Ulrich, der Ministerpräsident von Hessen.
Die Initiative zu diesem Treffen ging vom badischen Ministerpräsidenten Anton Geiß aus, der als Ziel der Konferenz die Abstimmung über das weitere Vorgehen auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung sieht. Kurt Eisner lässt die aktuellen Verfassungsfragen und den künftigen Friedensschluss in die Tagesordnung aufnehmen, um auch hier eine gemeinsame Strategie und gemeinsame süddeutsche Interessen zu entwickeln.
Der bayerische Ministerpräsident legt dazu ein Papier zur Beschlussfassung vor: „Die […] Vertreter der revolutionären Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden und Hessen erklären es für ihre Überzeugung, dass die künftige Gestaltung der Einheit des Deutschen Reichs durch Vertrag der Einzelstaaten zustande kommen muss.
Um diese Neubildung zu erleichtern und zu fördern, beschließen die Vertreter der genannten süddeutschen Staaten, zunächst sich zur Wahrung ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen zu verbinden.“
Eisner schwebt ein Süddeutscher Bund unter Aufnahme von Deutsch-Österreich vor, der das Übergewicht Norddeutschlands aufheben würde, möglicherweise sogar die Führung bei der Neubildung des Deutschen Reiches beanspruchen könnte. Aus seiner Sicht ist das Deutsche Reich durch die Revolution untergegangen und muss daher völlig neu gegründet werden. Dazu muss ein neuer Staatsvertrag geschlossen werden.
- Bayerns Ministerpräsident will den preußischen Zentralismus vom Süden her - gegen Preußen und Berlin - reformieren.
- Er will einen Separatfrieden schließen zwischen dem Süddeutschen Bund - unter Einschluss Deutsch-Österreichs - und den Entente-Mächten, dem dann alle deutschen Einzelstaaten beitreten könnten.
Der Vorschlag Eisner, insbesondere die Infragestellung des Reichs, wird allgemein abgelehnt. Zu unterschiedlich sind die Interessen und Standpunkte. Das bayerische Positionspapier kommt nicht einmal zur Abstimmung.
Kurt Eisner, der den kompromisslosen Neuanfang wollte, ist damit gescheitert. Nicht einmal seine Begleiter, Innenminister Erhard Auer und Ministerialrat Josef von Graßmann, haben ihn unterstützt.
27. 12 1918 - Der Vorwärts druckt die Erklärung der Revolutionären Obleute
Berlin * Im SPD-Organ Vorwärts wird die Erklärung der Revolutionären Obleute abgedruckt. In dieser heißt es, dass die Zeitung „in der letzten Zeit in schamlosester Weise alle ehrlichen und entschiedenen revolutionären Kreise sowie die Volksmarinedivision beschimpft“ habe.
27. 12 1918 - Gustav Noske wird zur Krisensitzung geladen
Berlin * Reichskanzler Friedrich Ebert bittet den in Kiel - im Sinne der Reichsregierung - so erfolgreichen Gustav Noske zu einer Krisensitzung nach Berlin, um an den Beratungen über die künftige Entwicklung mitzuwirken.
Der MSPD-Mann Noske vertritt die Ansicht, dass geschossen werden muss, wenn „sich dies zur Wiederherstellung der Ordnung als notwendig erweisen sollte, und zwar auf jeden, der der Truppe vor die Flinte läuft“.
Das Ziel ist, die radikale Linke auszuschalten, was jedoch mit den Volksbeauftragten der USPD nicht machbar sein wird, weshalb diese schnellstens ihre Funktionen niederlegen sollten. Möglichst von sich aus.
28. 12 1918 - 17 Bürgerwehr-Gründer werden festgenommen
München-Graggenau * In ihrem Versammlungsraum im Hotel Vier Jahreszeiten werden 17 Mitglieder des Ausschusses zur Gründung einer Bürgerwehr, die auch Mitglieder der Thule-Gesellschaft sind, festgenommen. Darunter Freiherr Rudolf von Sebottendorf. Sie werden gegenrevolutionärer Umtriebe verdächtigt. Die meisten Verhafteten werden jedoch nach einem kurzen Verhör wieder entlassen.
28. 12 1918 - Kurt Eisner verlässt verärgert die Konferenz der süddeutschen Staaten
Stuttgart - München * Ministerpräsident Kurt Eisner reist am Morgen des 28. Dezember verärgert von der gemeinsamen Sitzung der süddeutschen Staaten in Stuttgart ab.
28. 12 1918 - Die USPD-Volksbeauftragten werden ausgebremst
Berlin * Das Kabinett Ebert [= Rat der Volksbeauftragten] tagt gemeinsam mit dem Zentralrat. Die USPD-Volksbeauftragten fordern vom Zentralrat die Beantwortung von acht Fragen im Zusammenhang mit den Vorgängen vom 23./24. Dezember und damit Konsequenzen gegenüber dem Koalitionspartner von der MSPD.
Der Zentralrat, dem kein Unabhängiger angehört, unterstützt natürlich die MSPD-Volksbeauftragten.
28. 12 1918 - Die Ziele der Konferenz der Süddeutschen Staaten
Stuttgart * Die noch anwesenden Ministerpräsidenten Anton Geiß aus Baden, Wilhelm Blos aus Württemberg und Carl Ulrich aus Hessen verhandeln mit den bayerischen Innenminister Erhard Auer weiter. Die Konferenz beschließt,
- dass das Deutsche Reich in seiner gegenwärtigen Form erhalten bleibt,
- dass separatistische Bestrebungen ausdrücklich abgelehnt werden,
- dass das Deutsche Reich auf föderalistischer Grundlage aufgebaut,
- dass eine aktionsfähige Regierung und Nationalversammlung gewählt und
- dass ein schneller Frieden angestrebt wird.
Zur Umsetzung der Ziele beschließt man
- die Bildung einer Süddeutschen Kommission,
- eine Blockbildung bei zukünftigen Ministerpräsidenten-Konferenzen und
- den gemeinsamen Einkauf von Lebensmitteln im Ausland.
Über den weiteren Umgang mit und über die künftige Rolle der Hegemonialmacht Preußen werden keine Positionen entwickelt. Man ist nur einig, dass Preußen in seiner bisherigen Form nicht weiter bestehen kann. Forderungen nach Zerschlagung Preußens werden nicht gestellt.
Die beschlossene Süddeutsche Konferenz wird nie zusammen treten.
28. 12 1918 - Erste Bewerber für die Bürgerwehr
München * An allen Anschlagtafeln Münchens findet sich ein Aufruf zur Schaffung einer Bürgerwehr, die die bestehende Staatsform „gegen jeden Angriff verteidigen“ will. Die Botschaft spricht sich schnell herum. Noch am selben Tag melden sich die ersten Bewerber im vorsorglich schon eingerichteten Büro der Bürgerwehr an der Salvatorstraße. Die Münchner Kasernenräte lehnen eine Bürgerwehr umgehend ab.
28. 12 1918 - Julius Lehmann wird verhaftet
München * Julius Lehmann, Mitglied der Thule-Gesellschaft, wird erstmals verhaftet. Bei einer Durchsuchung seines Verlags wird das inzwischen umfangreichste Waffenlager entdeckt. Da nützt ihm auch die gerade erteilte Bürgerwehr-Erlaubnis nichts.
Er wird ins Polizeipräsidium an der Ettstraße, anschließend ins Gefängnis Neudeck gebracht. Wie aus Briefen Lehmanns hervorgeht, vertreibt er sich hier die Zeit mit antisemitischer Literatur, die ihm von der Gefängnisleitung zur Verfügung gestellt wird.
29. 12 1918 - Der Landessoldatenrat lehnt die Bürgerwehr ab
München * Der Landessoldatenrat lehnt die Bildung einer Bürgerwehr ab. Kurt Eisners Sekretär, Felix Fechenbach, kündigt als Gegenmaßnahme die Gründung einer Roten Garde an.
29. 12 1918 - Gustav Noske und Rudolf Wissell zu Volksbeauftragte gewählt
Berlin * Um 9 Uhr treten die MSPD-Volksbeauftragten mit dem Zentralrat erneut zusammen, um endgültig über die Nachfolge der ausgeschiedenen Regierungsmitglieder zu beraten und noch am Nachmittag die neue Zusammensetzung auf Flugblättern zu veröffentlichen.
Der Zentralrat wählt einstimmig zwei Vertreter der Mehrheitssozialdemokraten - MSPD in den Rat der Volksbeauftragten. Es sind dies: Gustav Noske und Rudolf Wissell.
Alleiniger Vorsitzender ist nun Friedrich Ebert, der sich für eine Wahl zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung einsetzt. Das Deutsche Reich soll möglichst bald eine demokratisch legitimierte Regierung bekommen.
29. 12 1918 - Der Spartakusbund will eine eigenständige Partei werden
Berlin * Der Spartakusbund beschließt die Trennung von der USPD und die Gründung einer eigenen Partei, die Kommunistische Partei Deutschlands - KPD.
29. 12 1918 - Die USPD-Volksbeauftragten treten zurück
Berlin * Kurz nach Mitternacht erklären die Vertreter der Unabhängigen Sozialdemokraten - USPD (Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth) während der Sitzung der Volksbeauftragten und dem Zentralrat - sehr zur Freude der MSPD - ihren Rücktritt. Sie wollen Deutschland in Richtung eines Rätestaats verändern.
Bereits um 0:15 Uhr teilt Reichskanzler Friedrich Ebert den Austritt der USPD aus dem Rat der Volksbeauftragten der Presse mit.
30. 12 1918 - Demonstration zur Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung
München * Vor dem Ministerium für soziale Fürsorge demonstrieren Arbeitslose für die Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung.
30. 12 1918 - Diskussionen ohne geistige Schranken
München-Isarvorstadt * In den Kolosseums-Bierhallen haben sich einige Hundert Internationale Kommunisten versammelt. Sie diskutieren das Für und Wider
- einer Bewaffnung des revolutionären Proletariats,
- einer Sabotierung der Nationalversammlungswahlen,
- einer Lynchjustiz am Erzbischof von München und Freising, Michael von Faulhaber,
- einer Aburteilung von Erhard Auer und Johannes Timm durch einen Staatsgerichtshof und
- den Kampf mit den Waffen der Gewalt, nicht mit geistigen Waffen.
Es sind Diskussionen ohne geistige Schranken, keine Beschlüsse!
30. 12 1918 - Ministerpräsident Kurt Eisner lehnt die Bürgerwehr ab
München-Kreuzviertel * Ministerpräsident Kurt Eisner lehnt im Provisorischen Nationalrat die Bildung einer Bürgerwehr ab. Er drückt sein Bedauern darüber aus, dass Innenminister Erhard Auer [MSPD] und Justizminister Johannes Timm [MSPD] als Regierungsmitglieder „unter irrigen Voraussetzungen“ einen Aufruf zur Gründung einer solchen Einrichtung unterzeichnet haben.
Nachdem Innenminister Erhard Auer von Ernst Toller mit Vorwürfen zur Gründung einer Bürgerwehr konfrontiert wird, erklärt dieser, dass er weder über die Ziele noch über die Truppenstärke informiert war und nur die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl sicherstellen wollte. Unter den gegebenen Umständen ziehen er und Minister Johannes Timm ihre Unterschriften unter dem Aufruf zurück.
Auer bietet seinen Rücktritt vom Ministeramt an. Das lehnt Ministerpräsident Kurt Eisner ab. Einen Erhard Auer außerhalb der Regierung erscheint ihm noch gefährlicher als einen Minister Auer.
30. 12 1918 - Die Bedeutung des Wahlrechts für die Frauen in freien Berufen
München * In der gut besuchten Versammlung der Frauengruppe der Deutschen Volkspartei (Deutsche Demokratische Partei) sprechen die Referentinnen über
- die Bedeutung des Wahlrechts für die Frauen in freien Berufen und
- die Aufgabe der nun zur politischen Reife gelangten Lehrerin, die die „Jugend im staatsbürgerlichen Unterricht auf die Wichtigkeit des Wahlrechts vorbereiten soll“.
30. 12 1918 - Matrosenversammlung im Alten Hackerkeller
München-Ludwigsvorstadt * Im Alten Hackerkeller treffen sich Matrosen zu einer Versammlung. Der Präsident des Soldatenrats, Fritz Schröder, bezeichnet die derzeitige Lage als „einen Kampf auf Leben und Tod“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus.
Der Obermatrose Conrad Lotter warnt vor „kopflosen Handlungen“ und verteidigt Innenminister Erhard Auer und Justizminister Johannes Timm für Ihr Eintreten bei der Bildung einer Bürgerwehr. Heftiger Widerspruch ist die Folge.
30. 12 1918 - US-Bürger fordern Lebensmittel-Lieferungen für Deutschland
München-Maxvorstadt - Washington * Im Hotel Kaiserhof verfassen US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger eine Petition an den Präsidenten der USA, Woodrow Wilson, in der sie die baldige Einfuhr von Lebensmitteln nach Deutschland fordern.
Außerdem sprechen sie sich für den Abschluss eines Präliminarfriedens [= Vorfrieden oder vorläufiger Frieden] aus.
30. 12 1918 - Der Gründungsparteitag der KPD beginnt in Berlin
Berlin * Der radikale linke Flügel der USPD, der Spartakusbund, formiert sich auf einem Parteitag in Berlin zur Kommunistischen Partei Deutschlands - KPD. Der Parteitag dauert vom 30. Dezember 1918 bis 1. Januar 1919.
Obwohl Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht die Teilnahme an den Nationalwahlen empfehlen, lehnt dies der Parteitag ab.
30. 12 1918 - Gefährdung der Revolution durch die Politik der Mehrheitssozialisten
Berlin * Die aus dem Rat der Volksbeauftragten ausgeschiedenen USPD-Mitglieder Hugo Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth geben eine öffentliche Erklärung für den Grund ihres Ausscheidens ab: Darin erklären sie, dass sie diesen Schritt an dem Punkt unternahmen, „wo sie nicht mehr in der Lage waren, die Gefährdung der Revolution durch die Politik der Mehrheitssozialisten zu verhindern“.
30. 12 1918 - Verstaatlichung nur für Grundstoffindustrien und für Kraftwerke
München * Vor einer Versammlung von Rätedelegierten führt Kurt Eisner zum Thema Sozialisierung folgendes aus: „Sie wissen, ich bin der Meinung, dass wir heute die ganze Industrie auf einmal sozialisieren können. […] Man kann politische Gewalten stürzen, man kann aber keine wirtschaftliche Organisation durch Revolution aufbauen“.
Eisner schlägt deshalb eine Verstaatlichung nur für gewisse Grundstoffindustrien und für Kraftwerke vor.
30. 12 1918 - Frauen werden von der Kirche bedrägt
München * Der Soldatenrat Fritz Schröder berichtet im Provisorischen Nationalrat: „Noch heute wurde mir mitgeteilt, dass überall jetzt hier in München die Frauen bearbeitet werden, indem ihnen gesagt wird: ‚Die Kirche ist in Gefahr, Ihr müsst die Bayerische Volkspartei wählen, wenn ihr nicht die Seelen eurer Kinder verlieren wollt, wenn ihr euch nicht der Gefahr aussetzen wollt, dass ihr nicht in das Himmelreich kommt‘.“
31. 12 1918 - Regierung Eisner als Regierung von Jehovas Zorn bezeichnet
München-Kreuzviertel * In seiner Silvesterpredigt bezeichnet Erzbischof Michael von Faulhaber die Regierung Eisner als eine „Regierung von Jehovas Zorn“.
31. 12 1918 - 239 MünchnerInnen sterben im Dezember an der Spanischen Grippe
München * In München sind im Monat Dezember 100 männliche und 139 weibliche Personen an der Spanischen Grippe gestorben. Die Epidemie ist dennoch im Abklingen begriffen.
31. 12 1918 - Eine päpstliche Fleischspende für die Münchner Armen
München - Rom * Der Magistrat bedankt sich im Namen der Stadt bei Papst Benedikt XV. für die Spende von 5.000 Paketen Fleischkonservenbüchsen und Schokoladentafeln für die Münchner Armen.
1919 - Das Reichsvermögensamt kauft das Fleischer-Anwesen in Bogenhausen
München-Bogenhausen * Das Reichsvermögensamt kauft das Fleischer-Anwesen in Bogenhausen und stellt die nur provisorisch eingedeckte Bauruine bis zum Jahr 1923 fertig. Der Bau wird auf 78 Meter verkürzt.
1919 - Die Richard-Wagner-Straße 9 gehört Artur Klenner
München-Maxvorstadt * Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9 ist der Ingenieur Artur Klenner.
Um 1919 - Dr. Fritz Gerlich ist als Marxistentöter bekannt
München * Aus zahlreichen Aufsätzen in den Süddeutschen Monatsheften, der Liberalen Korrespondenz sowie den Historisch-politischen Blättern entsteht Dr. Fritz Gerlichs Buch Der Kommunismus als Lehre vom Tausendjährigen Reich. Außerdem kämpft er im Münchner Bürgerrat und im Bayerischen Heimatdienst sowie mit der Wochenzeitschrift Feurjo gegen den gesamten marxistischen Sozialismus.
Daneben beschafft er Geldmittel für die Gründung der Bayerischen Einwohnerwehr und für die Überwachung der Kommunistischen Partei. Dieses Engagement trägt zu seinem Ruf als „Marxistentöter“ bei.
1919 - Dr. Alfred Haas kauft ein Sommerhaus in Bernried am Starnberger See
Bernried * Der Arzt Dr. Alfred Haas kauft von Carl Riedl ein Sommerhaus an der Bahnhofstraße 14 in Bernried am Starnberger See.
1919 - Ein Revolutionsweg zur Maffei-Fabrik wird angelegt
München-Schwabing - Hirschau * Ein Revolutionsweg von der Martiusbrücke zur Maffei-Fabrik quer durch die Seewiese (= Werneck-Wiese) wird angelegt.
1919 - „Cirkus-Krone-Bau“ eröffnet
München-Maxvorstadt * Carl Krone eröffnet feierlich seinen 4.000 Menschen fassenden festen Zirkusbau an der Marsstraße.
1919 - Josef Durner gibt den Frankfurter Hof auf
München-Ludwigsvorstadt * Josef Durner gibt den Frankfurter Hof auf. Damit verliert es seine Bedeutung als Volkssänger-Lokal.
1919 - Die Planungen und Entwürfe für den Bugatti Royale Typ 41 beginnen
Molsheim * Die Planungen und Entwürfe für den Bugatti Royale Typ 41 beginnen. Ettore Bugatti will ein Luxusfahrzeug konstruieren, das, angetrieben von dem stärksten und laufruhigsten Motor seiner Zeit, der Konkurrenz von Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Maybach und Cadillac überlegen ist.
Als Kundschaft hat Ettore Bugatti die europäischen Königshäuser und die Reichen der Zeit im Blick. Es werden allerdings nur sechs Fahrzeuge gebaut werden.
1919 - Der Konsumverein von 1864 verkauft sein Holzhof-Grundstück
München-Berg am Laim * Der Konsumverein von 1864 verkauft sein Grundstück mit dem Holzhof an der Bergamlaimstraße 2 ½ mit Verlust.
1919 - Der Verein wird in Cowboy Club München Süd umbenannt
München * Nach dem Krieg wird das Lotteriespiel und die Beschränkung der Mitgliedszahl des Loos-Vereins Wild West auf 15 abgeschafft. Der Verein wird gleichzeitig in Cowboy Club München Süd umbenannt.
Jetzt erst wird das Erlernen der englischen Sprache und das Aneignen von Bräuchen und Sitten der Cowboys und Indianer sowie die Beschaffung eines eigenen Kostüms zur Pflicht.
1919 - Die 13-jährige Josephine heiratet
<p><strong><em>USA</em></strong> * Im Alter von 13 Jahren, heiratete Josephine McDonald den nur wenig älteren Willie Wells, um sich von ihrer Familie zu befreien. Nur wenige Monate später war diese Ehe schon wieder beendet. </p>
1. 1 1919 - Die Geistliche Schulaufsicht ist im Freistaat Bayern abgeschafft
München * Die „Verordnung, betreffend Beaufsichtigung der Volksschule“ tritt in Kraft. Darin wird die geistliche Schulaufsicht abgeschafft.
1. 1 1919 - Schießerei im Katholischen Gesellenhaus
München-Hackenviertel * Im Katholischen Gesellenhaus in der Brunnstraße kommt es in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen der aus Soldaten, Matrosen und Zivilpersonen bestehenden Tanzgesellschaft und dem Sicherheitsdienst.
Im Verlauf fallen Schüsse, die die Militärpolizei und die Republikanische Schutztruppe mit Handgranaten beantworten. Zahlreiche Personen werden verletzt, davon sieben schwer.
1. 1 1919 - Die Österreichische Gesandtschaft wird besetzt
München-Graggenau * Karl Mandel, der Vorsitzende des Bundes der Deutsch-Österreicher in München besetzt - unterstützt durch bayerische Polizei und Republikanische Schutztruppen - die Österreichische Gesandtschaft im Prinz-Carl-Palais und das Österreichische Generalkonsulat in der Schackstraße. Die Aktion des Redakteurs richtet sich gegen die angeblich „schlechte und säumige Behandlung österreichischer Staatsangehöriger“.
Ministerpräsident Kurt Eisner lässt noch in der Nacht die besetzten Gebäude räumen.
1. 1 1919 - Der achtstündige Maximalarbeitstag wird eingeführt
Berlin - Deutsches Reich * Der achtstündige Maximalarbeitstag wird in Kraft gesetzt.
1. 1 1919 - Konrad Ritter von Preger tritt sein Gesandten-Amt an
Berlin * Konrad Ritter von Preger, der Nachfolger von Dr. Friedrich Muckle, ist Bayerischer Gesandter in Berlin.
2. 1 1919 - Zeitungen kritisieren das zügellose Treiben in der Silvesternacht
München * In mehreren Münchner Zeitungen wird das „zügellose Treiben“ und die „unsinnige Schießerei mit scharfer Munition“ in der Silvesternacht kritisiert. Viele Waffen befänden sich in unverantwortlichen und unkontrollierten Händen.
2. 1 1919 - Verleger Julius Lehmann wird aus der Haft entlassen
München-Au * Der Verleger Julius Lehmann wird wieder aus dem Gerichtsgefängnis Neudeck entlassen. Das Mitglied der Thule-Gesellschaft war am 28. Dezember 1918 im Zusammenhang mit der Bürgerwehr-Affäre verhaftet worden.
3. 1 1919 - Berlins Polizeipräsident Emil Eichhorn hält an seinem Amt fest
Berlin * Die USPD-Mitglieder der preußischen Regierung erklären ihren Rücktritt. Damit bekleidet kein USPD-ler noch ein wichtiges Amt im Deutschen Reich beziehungsweise in Preußen. Die einzige Ausnahme ist der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn, der an seinem Amt festhalten will.
3. 1 1919 - Keine Weisungsberechtigung
Berlin * Der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn [USPD] erklärt dem preußischen Innenminister Paul Hirsch [MSPD], dass er ihn nicht als weisungsberechtigt anerkennt.
3. 1 1919 - Auf einen Haufen stellen und zusammenschießen
München-Kreuzviertel * In Erzbischof Michael von Faulhabers Tagebuch findet sich der Eintrag: „Auf dem Weg am Obelisk, eine alte Frau zur anderen: Die haben nicht mehr verdient, als dass man sie auf einen Haufen stellt und zusammenschießt.“ Wen sie da wohl meinen?
4. 1 1919 - Der gesetzgebende Provisorische Nationalrat tagt letztmals
München-Kreuzviertel * Der gesetzgebende Provisorische Nationalrat tagt zum letzten Mal.
4. 1 1919 - Das Vorläufige Staatsgrundgesetz der Republik Bayern wird beschlossen
<p><strong><em>München-Kreuzviertel - Freistaat Bayern</em></strong> * Das Vorläufige Staatsgrundgesetz der Republik Bayern wird beschlossen. Es bildet die Grundlage der Landtagswahlen am 12. Januar 1919. In der Präambel zur Republik heißt es:</p> <ul> <li><em>„In der Stunde höchster Not aber, raffte sich dieses ohnmächtige Volk auf, zertrat in gewaltiger revolutionärer Erhebung das schuldige System der Vergangenheit und riß die Macht an sich. </em></li> <li><em>Das politisch ohnmächtige Volk wurde durch die Revolution das freieste“</em>.</li> </ul> <p>Der Freistaat Bayern wird von einem Einkammersystem und einem Kabinett gemeinsam regiert. Dem Kabinett steht die oberste vollziehende Gewalt zu. Ihm bleibt außerdem das Recht vorbehalten, innerhalb von vier Wochen eine Volksabstimmung über jedes vom Parlament verabschiedete Gesetz zu verlangen. Im Artikel 7 des Staatsgrundgesetzes heißt es dazu: <em>„Entscheidet die Volksabstimmung gegen den Landtag, so ist er aufzulösen. Entscheidet sie gegen das Gesamtministerium, so hat es zurückzutreten.“</em> </p> <p>Im Staatsgrundgesetz wird auch festgelegt,</p> <ul> <li>dass das Unterrichtswesen in Bayern ab sofort eine staatliche Angelegenheit ist.<br /> Der Religionsunterricht ist damit nicht mehr eine allein den Glaubensgemeinschaften obliegende Angelegenheit,</li> <li>die Abschaffung der Adelstitel,</li> <li>die Einführung des Frauenwahlrechts.</li> </ul> <p>Dass die Räte im Vorläufigen Staatsgrundgesetz mit keinem Wort erwähnt werden, ist den Liberalen und dem rechten Flügel der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu verdanken. </p> <p>Der Artikel 17 bestimmt: <em>„Bis zur endgültigen Erledigung des Verfassungsentwurfs, der dem Landtag sofort nach seinem Zusammentritt vorgelegt werden muss, übt die revolutionäre Regierung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt aus.“</em> Dadurch kann die Eisner-Regierung auf legaler Grundlage die Herrschaft über Bayern auch noch nach der Wahl am 2. Februar 1919 in der Rheinpfalz ausüben. </p>
4. 1 1919 - Wahlkampf-Versammlungen der Parteien
München * Die Bayerische Volkspartei - BVP hält an diesem Tag elf, die USPD fünf und die Internationalen Interventionisten eine Wahlkampf-Versammlung ab.
4. 1 1919 - Berlins Polizeipräsident Emil Eichhorn wird abgesetzt
Berlin * Der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn von der USPD wird durch den Rat der Volksbeauftragten abgesetzt.
Eichhorn verweigerte am 24. Dezember 1918 den Befehl des Reichskanzlers Friedrich Ebert und der zwei anderen MSPD-Volksbeauftragten, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg, die im Berliner Stadtschloss und im Marstall einquartierte Volksmarinedivision mit der ihm unterstellten Republikanischen Sicherheitswehr zu bekämpfen, um den als Geisel genommenen Stadtkommandanten Otto Wels [MSPD] zu befreien. Für Ebert gilt Emil Eichhorn deshalb als unzuverlässig.
4. 1 1919 - USPD und Revolutionäre Obleute rufen zur Demonstration auf
Berlin * Der Vorstand der Berliner USPD beschließt zusammen mit den Revolutionären Obleuten für den folgenden Tag die Abhaltung einer Demonstration als Reaktion auf die Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn.
Die Revolutionären Obleute sind frei gewählte, von den Gewerkschaften unabhängige Betriebsräte, die sich während des Ersten Weltkriegs hauptsächlich in den Berliner Rüstungsbetrieben gebildet haben und sich aktiv an den Januarstreiks 1918 beteiligten.
Als Kriegsgegner sind sie in der überwiegenden Zahl in der USPD organisiert. Eine Mitgliedschaft in der gerade gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands - KPD lehnen sie ab.
5. 1 1919 - Die Deutsche Arbeiterpartei - DAP wird gegründet
München-Hackenviertel * Eine Woche vor der bayerischen Landtagswahl wird im Fürstenfelder Hof, in der Fürstenfelder Straße 14, die Deutsche Arbeiterpartei - DAP durch den Werkzeugschlosser Anton Drexler und den Sportjournalisten Karl Harrer sowie 22 weiteren Anwesenden gegründet.
Die Deutschen Arbeiterpartei - DAP geht aus dem Münchner Freien Arbeiterausschuss für einen guten Frieden hervor, der am 7. März 1918 ebenfalls von Drexler gegründet worden war. Als Vorsitzender der neuen Partei wird Anton Drexler gewählt.
Zu den ersten Mitgliedern der DAP zählen fast ausschließlich Arbeitskollegen Drexlers aus den Münchner Eisenbahnwerken. Die ersten Parteiversammlungen finden in Hinterzimmern kleiner Bierlokale statt. Der wenig begeisternde Redner Drexler hält zumeist kaum motivierende Reden, die oft in der Geräuschkulisse des Lokals untergehen.
Während der Politische Arbeiterzirkel eindeutig eine Schöpfung der Thule-Gesellschaft ist, soll die Deutsche Arbeiterpartei - aus taktischen Erwägungen - als Gründung Anton Drexlers erscheinen.
Vorbereitet wird die konstituierende Parteiversammlung von einem Dreier-Ausschuss, der sich aus Harrer, Drexler und Michael Lotter zusammengesetzt. An der eigentlichen Versammlung nimmt Harrer allerdings nicht teil.
Umgekehrt werden Drexler und Lotter keine Mitglieder der Thule-Gesellschaft, verkehren aber als ständige Gäste in den Logenräumen im Hotel Vier Jahreszeiten, wo sie bald auch Personen wie Dietrich Eckart und Gottfried Feder kennenlernen.
In den von der Gründungsversammlung angenommenen Richtlinien der Deutschen Arbeiterpartei heißt es, dass die DAP eine aus „allen geistig und körperlich schaffenden Volksgenossen zusammengesetzte sozialistische Organisation“ ist. Die Deutsche Arbeiterpartei will
- „die Adelung des deutschen Arbeiters. Die gelernten und ansässigen Arbeiter haben ein Recht, zum Mittelstand gerechnet zu werden. Zwischen Arbeiter und Proletarier soll ein scharfer Trennungsstrich gezogen werden. [...]
- Das Großkapital ist als Brot- und Arbeitgeber zu schützen, sofern nicht rücksichtsloseste Ausbeutung des Arbeiters diesem ein menschenwürdiges Dasein unmöglich macht.
- Die DAP sieht in der Sozialisierung des deutschen Wirtschaftslebens einen Zusammenbruch der deutschen Volkswirtschaft. [...] Darum darf es nicht Sozialisierung, sondern Gewinnbeteiligung für den deutschen Arbeiter heißen. [...].“
Hier zeichnete sich deutlich eine eigentlich mittelständische Orientierung dieser pseudosozialistischen und antisemitischen Organisation ab.
Die anfallende Parteiarbeit der zunächst auf München beschränkten winzigen Vereinigung wird im Wesentlichen von dem mit dem Politischen Arbeiterzirkel nicht identischen Arbeitsausschuss der DAP bewältigt, der in den Anfängen auch die Führung der Gesamtpartei inne hat und dem im Sommer 1919 neben Anton Drexler und Karl Harrer weitere vier Personen angehören. Anton Drexler, der Vorsitzende der Deutschen Arbeiter Partei - DAP, bleibt es bis zum Juni 1921.
5. 1 1919 - Vom Nordturm der Frauenkirche flattern anti-bolschewistische Flugblätter
München-Kreuzviertel * Vom nördlichen Turm der Frauenkirche flattern angeblich Flugblätter der Bayerischen Volkspartei - BVP, die einen Aufruf gegen den Bolschewismus enthalten.
Daraufhin stürmen etwa fünfzig Personen in die Frauenkirche, beschimpfen die Kirchgänger, stören den sonntäglichen Gottesdienst und randalieren in der Sakristei. Eine Durchsuchung der Türme bringt jedoch kein Ergebnis.
5. 1 1919 - Erstmals dürfen Frauen bei der Landtagswahl in Baden wählen
Baden * Bei den Landtagswahlen in Baden sind erstmals auf deutschem Staatsgebiet Frauen wahlberechtigt. Die Frauen dürfen wählen und gewählt werden.
- Stärkste Partei wird das katholische Zentrum mit 36,6 Prozent,
- zweitstärkste Kraft wird die SPD mit 32,1 Prozent,
- die Deutsche Demokratische Partei - DDP erhält 22,8 Prozent der Stimmen.
- Kein einziger Kandidat der USPD wird gewählt.
5. 1 1919 - Beginn des sogenannten Spartakusaufstands in Berlin
Berlin * Die von der Berliner USPD und den Revolutionären Obleuten organisierte Demonstration entwickelt sich zur größten und eindrucksvollsten, die Berlin seit dem 9. November 1918 gesehen hat. Im Verlauf der Demo wird die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts und weitere Verlagsgebäude und Druckereien im Zeitungsviertel von bewaffneten Demonstranten besetzt.
5. 1 1919 - Ein Revolutionsausschuss wird gegründet
Berlin * Die Zeitungsbesetzer werden von der USPD und der KPD unterstützt. Am Abend wird aus den Vertretern der Parteien und den Besetzern ein Revolutionsausschuss gebildet, dem 53 Personen angehören. Georg Ledebour [USPD], Karl Liebknecht [KPD] und Paul Scholze [Revolutionäre Obleute] werden gleichberechtigte Vorsitzende.
6. 1 1919 - Der Revolutionsausschuss ruft zum Regierungssturz auf
Berlin * Der von USPD, KPD und den Revolutionären Obleuten gebildete Revolutionsausschuss ruft auf
- zum Generalstreik und
- zum Sturz der Regierung Ebert.
6. 1 1919 - Den Rat der Volksbeauftragten mit Waffengewalt stürzen
Berlin * Der KPD-Führer Karl Liebknecht möchte - gegen den Rat von Rosa Luxemburg - den Rat der Volksbeauftragten mit Waffengewalt stürzen. Damit könnten die für den 19. Januar angesetzten Wahlen zur Nationalversammlung verhindert werden.
6. 1 1919 - Verhandlungsversuche mit Reichskanzler Friedrich Ebert
Berlin * Der Revolutionsausschuss verhandelt auf Vermittlung der USPD-Leitung mit Reichskanzler Friedrich Ebert. Die zwölfköpfige Verhandlungskommission besteht aus sechs Vertretern der USPD und der gleichen Zahl der Revolutionären Obleute. Die KPD will sich an den Verhandlungen nicht beteiligen.
6. 1 1919 - Lebende Schutzschilde vor Regierungsgebäuden
Berlin * Ein Teil der Berliner Bevölkerung stellt sich hinter die Regierung Ebert und sichert als lebende Schutzschilde die Regierungsgebäude.
7. 1 1919 - 3 Tote und 8 Verletzte nach einer Arbeitslosen-Demonstration
München-Kreuzviertel * Gegen 15:30 Uhr bewegt sich der Demonstrationszug zum Ministerium für Soziale Fürsorge am Promenadeplatz, wo eine Delegation Minister Hans Unterleitner ihre Forderung nach Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung vorträgt.
Als gegen 17 Uhr noch immer keine Zusagen vorliegen, überrennt die Menge die Wache und stürmt das Gebäude. Nun kann aber - trotz verschiedener Zusagen - die tobende Menge nicht mehr beruhigt werden.
Um 18 Uhr rückt die Militärische Sicherheitswache und die Republikanische Schutztruppe mit scharfer Munition gegen die Demonstranten vor. Drei Tote und acht Schwerverletzte bleiben zurück.
7. 1 1919 - Arbeitslosen-Demonstration auf der Theresienwiese
München-Theresienwiese * In der ersten Januarwoche ist die Zahl der Arbeitslosen dramatisch - auf 40.000 - angestiegen. Auf der Theresienwiese beginnt um 15 Uhr eine Arbeitslosen-Demonstration mit rund 4.000 Teilnehmern.
7. 1 1919 - Die Republikanische Schutztruppe zerstreut die Demonstration
München * Am Abend kommt es in der Innenstadt immer wieder zu Menschenansammlungen. Um 22 Uhr will die Menge in die Residenz eindringen, wo sie Eisner versteckt glaubt. Doch der bayerische Ministerpräsident hält sich an diesem Tag in Weiden auf und bekommt die Vorgänge überhaupt nicht mit.
Die Republikanische Schutztruppe kann die Demonstration zerstreuen. Gegen 23:30 Uhr verlangt eine rund 200 Mann starke Gruppe vor dem Polizeipräsidium die Freilassung verhafteter Soldaten und Matrosen. Die Menschenansammlung kann zum Abzug bewegt werden.
7. 1 1919 - Der Januaraufstand zeigt seine Macht
Berlin * Dem Aufruf des Revolutionsausschusses folgen etwa 500.000 Menschen. Die Menschenmenge zieht in die Innenstadt und versammelt sich auf einem der Berliner Plätze.
7. 1 1919 - Die Verhandlungen mit der Regierung werden vertagt
Berlin * Am Nachmittag sind die Verhandlungen zwischen dem Revolutionsausschuss und Reichskanzler Friedrich Ebert sowie dem Rat der Volksbeauftragten kurz vorm Scheitern. Man vertagt sich auf den nächsten Tag.
7. 1 1919 - Gustav Noske erhält den Oberbefehl über die Truppen in und um Berlin
Berlin * Der Volksbeauftragte für Heer und Marine, Gustav Noske [MSPD], erhält von Reichskanzler Friedrich Ebert den Oberbefehl über die Truppen in und um Berlin.
- Es ergehen Aufrufe zur Aufstellung weiterer Freikorps in Berlin.
- Außerdem befiehlt Noske die telefonische Überwachung aller Mitglieder des Revolutionsausschusses, um sie später festzunehmen. Dazu werden 50 ausgesuchte Offiziere in allen Berliner Postämtern eingesetzt.
7. 1 1919 - Das Vorläufige Staatsgrundgesetz für Bayern veröffentlicht
München - Freistaat Bayern * Das Vorläufige Staatsgrundgesetz für den Freistaat Bayern vom 4. Januar wird veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine oktroyierte [= aufgezwungene] Verfassung, die die elementaren Grundsätze der künftigen bayerischen Verfassung verbindlich festlegt.
7. 1 1919 - Keine Demonstrationen sondern Putschversuche
München-Kreuzviertel * Vom Stadtkommandanten Oskar Dürr erfährt das kurzfristig zusammengetretene Kabinett: „Es handelt sich nicht um reine Demonstrationen, sondern um reine Putschversuche. Wir können keine Gewähr mehr bieten für die Sicherheit der Stadt. Die Polizei reicht nicht mehr aus, […] die Truppen machen nicht mehr mit, wenn sie noch länger in solcher Spannung bleiben müssen.“
8. 1 1919 - Chance zur gewaltfreien Beilegung des Konflikts vertan
Berlin * Die Verhandlungen zwischen dem Revolutionsausschuss und dem Rat der Volksbeauftragten scheitern an der beiderseitigen Kompromissunfähigkeit. Damit ist die Chance zur gewaltfreien Beilegung des Konflikts vertan.
8. 1 1919 - Die Volksbeauftragten fordern zum Widerstand auf
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten fordert die Bevölkerung auf
- zum Widerstand gegen die Aufständischen
- und deren beabsichtigte Regierungsübernahme.
In einem Flugblatt mit dem Titel: „Die Stunde der Abrechnung naht!“ wird den Aufständischen mit physischer Vernichtung gedroht.
9. 1 1919 - Wieder Schule nach dem Abklingen der Grippe-Epidemie
München * Nach dem Abklingen der Grippe-Epidemie wird in den städtischen sowie staatlichen Volks- und Mittelschulen der Schulbetrieb wieder aufgenommen.
9. 1 1919 - Der Revolutionsausschuss ruft zum Kampf gegen die Judasse auf
Berlin * Die Revolutionären Obleute, der Zentralvorstand der Berliner USPD und der KPD rufen in einem gemeinsamen Aufruf den Kampf auf gegen „die Judasse in der Regierung. […] Sie gehören ins Zuchthaus, aufs Schafott. […] Gebraucht die Waffen gegen eure Todfeinde.“
Um den 10. 1 1919 - Dr. Fritz Gerlich gründet die Liga zur Bekämpfung des Bolschewismus
München * Dr. Fritz Gerlich gründet den bayerischen Zweig der Liga zur Bekämpfung des Bolschewismus.
10. 1 1919 - Schusswechsel zwischen Linksextremen und einer Militärstreife
München-Ludwigsvorstadt * Rund 200 Linksradikale treffen in der Bayerstraße auf eine Militärstreife, die diese zum Auseinandergehen auffordert. Erst nach einem Schusswechsel, bei dem niemand verletzt wird, zerstreut sich die Gruppe.
10. 1 1919 - Mehrere Tote nach Schießerei am Bahnhofsplatz
München-Ludwigsvorstadt * Die aus der Haft in Stadelheim entlassenen Erich Mühsam und Eugen Leviné sprechen im Festsaal des Mathäserbräu. Es kommt zu einer Schießerei, bei der ein Chauffeur getötet und ein 14-jähriger Lehrling verwundet wird.
Gegen 22:30 Uhr kommt es auf dem Bahnhofsplatz zu einer Schießerei zwischen den Demonstranten und der Bahnhofswache. Als die Demonstranten in den Südbau des Bahnhofs einzudringen versuchen, eröffnet die Bahnhofswache ein Maschinengewehrfeuer, in dem drei Frauen und zwei Männer getötet sowie 15 Personen schwer verwundet werden.
10. 1 1919 - Bremen wird Selbstständige Sozialistische Republik
Bremen * Die Hansestadt Bremen wird durch die Internationalen Kommunisten Deutschlands zur Selbstständigen Sozialistischen Republik, eine Räterepublik, erklärt. Die USPD ist zunächst bereit, gemeinsam mit den Kommunisten - unter Ausschluss der anderen politischen Kräfte - die Regierung zu übernehmen.
10. 1 1919 - Der Antibolschewistenfonds der deutschen Wirtschaft wird gegründet
Berlin * Der Antibolschewistenfonds der deutschen Wirtschaft wird in Berlin gegründet und einem 50-Millionen-Mark-Sofort-Bankkredit ausgestattet. Neben der Finanzierung
- der militärischen Zerschlagung der deutschen Räterepubliken
- fließen auch viele Gelder in die antibolschewistische-nationalistische Propaganda sowie
- in die Einwohnerwehren.
10. 1 1919 - Gefangenenbefreiung durch Demonstrationen
München-Kreuzviertel * Gegen 15 Uhr beginnen die entsetzten Versammelten einen Demonstrationszug zum Montgelas-Palais, in dem Ministerpräsident Kurt Eisner residiert, und fordert die Freilassung der Verhafteten. Eisner erklärt sich zum Empfang einer Abordnung am nächsten Tag bereit, wenn sie ruhig und ohne Massendemonstration käme. Die Demonstranten werden immer erregter.
Oskar Maria Graf berichtet: „Hin und her drängte sich alles. Hinter dem verschlossenen Tor, hieß es, stünden schussbereite Maschinengewehrschützen. Man ratschlagte einige Minuten. Auf einmal kletterte ein Matrose auf dem Kandelaber zum Balkon empor, schwang sich drüber und verschwand unter lautem Jubel in der Tür.
Kurz darauf erschien er mit Eisner, der fürchterregt auf uns herunter schrie: ‚So holt sie euch, in Gottes Namen! Sie sind enthaftet!‘“ Daraufhin ziehen sich die Demonstranten zurück.
10. 1 1919 - Demonstration auf der Theresienwiese
München-Ludwigsvorstadt * Gegen 13 Uhr versammeln sich über tausend Demonstranten auf der Theresienwiese. Durch die Redner erfahren sie von den Verhaftungen vom Vormittag.
10. 1 1919 - Das spartakistische Hauptquartier in Spandau wird überfallen
Spandau * Die Brigade Reinhard unter Leitung des Kommandanten von Berlin, Oberst Wilhelm Reinhard, überfällt das spartakistische Hauptquartier in Spandau.
10. 1 1919 - Im Ruhrgebiet beginnt ein Generalstreik
Ruhrgebiet * Im Ruhrgebiet beginnt ein Generalstreik, an dem sich 80.000 Arbeiter, in der Mehrzahl Bergarbeiter, beteiligen.
10. 1 1919 - Anführer der Linken werden verhaftet
München * Nahezu alle Anführer der Kommunisten und Spartakisten werden verhaftet, darunter Erich Mühsam, Josef Sontheimer, Eugen Leviné, Max Levien, Hildegard Elisabeth Cramer und weitere.
11. 1 1919 - Waffengebrauch wird durch Trommelwirbel angekündigt
München * Einen Tag vor den Wahlen zum Bayerischen Landtag werden aufgrund der am Tag zuvor erfolgten Vorgänge vom Polizeipräsidenten Josef Staimer und vom Stadtkommandanten Oskar Dürr der Einsatz von Waffen gegen Demonstranten und Ansammlungen angedroht: „Waffengebrauch wird, soweit möglich, durch Trommelwirbel angekündigt.“
In einer Matrosenversammlung sprechen sich Ministerpräsident Kurt Eisner und Stadtkommandant Oskar Dürr „gegen den Terror der Straße“ aus. Die Mehrzahl der für die Tumulte Verantwortlichen bezeichnen sie als „Verbrecher“. Die geplanten Versammlungen auf der Theresienwiese werden abgesagt.
11. 1 1919 - Ludwig Thoma zur Abdankung des bayerischen Königs
Tuften-Tegernsee - Berlin * Ludwig Thoma, der eigentlich stark konservative und königstreue bayerische Schriftsteller, schreibt seinem Freund Conrad Haussmann seine Einschätzung der revolutionären Tage und zur Abdankung König Ludwigs III.:
„Er [König Ludwig III.] verschwand, begleitet von verächtlichem Hohn, dem sich rein nichts an Mitleid, Achtung, Dank entgegenstellte. ‚Milliwucherer, Ochsensepp, Millibauer‘ aber von waren die offiziellen Titel; der Mann ist heute, mitten in seiner getreuen Provinz Oberbayern, nicht die Spur von Autorität und Mittelpunkt.
Ich glaubte zuerst, dass der Kronprinz Anhänger habe, bin aber von dem Glauben abgekommen. Auch bei unsern Bauern ist keine Spur von ‚angestammter Treue‘ zu merken. Ich gestehe Dir offen, dass der Vorgang im ganzen, wie in jeder Einzelheit mich völlig unvorbereitet traf, und doch glaubte ich, das Volk zu erkennen.“
11. 1 1919 - Gustav Noske gibt den Einsatzbefehl gegen die Besetzer
Berlin * Gustav Noske [MSPD], der Volksbeauftragte für Heer und Marine, gibt den Einsatzbefehl gegen die Besetzer des Vorwärts. Die Angreifer, das Freikorps Potsdam, erobert das Gebäude mit Flammenwerfern, Maschinengewehren, Mörsern und Artillerie. Nach etwa 70 Artillerieschüssen sind die Besetzer am Ende. Als die Regierungstruppen zum Sturm ansetzen, geben die Aufständischen auf.
11. 1 1919 - Eine Neunerkommission zur Sozialisierung wird gebildet
Essen * Der Essener Arbeiter- und Soldatenrat übernimmt die Streikinitiative im Ruhrgebiet und verkündet, er nimmt die Sozialisierung in die eigenen Hände. Dazu wird eine Neunerkommission, bestehend aus Vertretern der USPD, SPD und KPD, gebildet. Noch am selben Tag wird das Büro des Kohlensyndikats und das Gebäude des Bergbaulichen Vereins in Essen besetzt.
12. 1 1919 - Das Ergebnis der bayerischen Landtagswahl von 1919
<p><em><strong>Freistaat Bayern ohne Pfalz</strong></em> * Im Freistaat Bayern findet in sieben der acht Regierungsbezirke die erste demokratische Wahl zum Bayerischen Landtag statt. Lediglich in der Pfalz kann erst drei Wochen später, am 2. Februar, gewählt werden, weil die Wahlvorbereitungen von der französischen Besatzungsmacht behindert worden sind. Das ist der Hauptgrund, weshalb der Termin für die konstituierende Sitzung im Bayerischen Landtag erst knapp sechs Wochen nach der Wahl im Kerngebiet festgesetzt wird. </p> <p>Bei den ersten freien, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlen in Bayern sind erstmals auch Frauen wahlberechtigt. Frauen machen 54 Prozent der Wahlberechtigten aus. Anita Augspurg kandidiert auf der Liste der USPD, ohne der Partei anzugehören. Bei den Landtagswahlen in Bayern erhält </p> <ul> <li>die Bayerische Volkspartei - BVP 66 Sitze,</li> <li>die SPD 61 Mandate,</li> <li>die Deutsche Demokratische Partei - DDP 25 Abgeordnetenplätze,</li> <li>der Bayerische Bauernbund - BBB 16 Mandate,</li> <li>die rechtsliberale Mittelpartei erringt 9 Abgeordnetensitze. </li> <li>Die USPD erreicht in den 12 Münchner Landtagswahlkreisen immerhin noch 5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Landesweit sind es lediglich 2,5 Prozent. Damit sind sie mit 3 Mandaten im ersten Landtag des Freistaats Bayern vertreten. </li> </ul> <p>Bei der Wahl zur bayerischen Nationalversammlung haben dreizehn Parteien Kandidatenlisten aufgestellt. Die KPD hat sich nicht an den Wahlen beteiligt. </p>
12. 1 1919 - Stuttgarter Spartakisten wollen den Hauptbahnhof besetzen
Augsburg * Am Abend erfährt die Bahnhofskommandantur aus Augsburg, dass Spartakisten aus Stuttgart auf dem Weg sind, die den Münchner Hauptbahnhof erobern wollen. Umgehend werden umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, doch es bleibt ruhig in dieser Nacht.
12. 1 1919 - Landtagswahl in Württemberg
Württemberg * Auch bei den Landtagswahlen in Württemberg können Frauen erstmals ihr demokratisches Wahlrecht ausüben. Die Sitzverteilung für den württembergischen Landtag setzt sich wie folgt zusammen:
- die Sozialdemokratische Partei - SPD erhält 52 Sitze,
- die Deutsche Demokratische Partei - DDP bekommt 38 Abgeordnete,
- das katholische Zentrum kommt auf 31 Mandate,
- andere bürgerliche Parteien erringen insgesamt 25 Abgeordnetenplätze.
- Die USPD kann lediglich 4 Plätze für sich verzeichnen.
12. 1 1919 - Die besetzten Verlagsgebäude werden von Regierungstruppen erobert
Berlin * Alle im Berliner Zeitungsviertel besetzten Verlags- und Druckereigebäude sind von den Regierungstruppen erobert. Obwohl die Zeitungsbesetzer bewaffnet sind, kommt es nicht zu organisierten Schlachten. Die meisten Aufständischen ergeben sich freiwillig.
Dennoch erschießt das Militär über hundert Besetzer und unbeteiligte Zivilisten vor Ort. Insgesamt ermittelt ein Untersuchungsausschuss des Preußischen Landtags 156 Todesopfer. Auf Seiten der Angreifer werden 13 Gefallene und zwanzig Verwundete gezählt.
12. 1 1919 - Die Stimmung des Faschingsonntags, nur ohne Masken
München * Josef Hofmiller notiert über den Wahlsonntag in sein Tagebuch:
„Heute Wahl zum Bayerischen Landtag. Gutes, etwas frisches Wetter, heiter und klar, geeignet zu Demonstrationen, von denen aber bis jetzt nicht viel zu bemerken. […] Die Wahlbeteiligung war sehr stark, die Leute standen an wie um Butter, Zigaretten oder Pferdefleisch. Der Anblick der zahlreichen Frauen und Soldaten in und vor dem Wahllokal fiel auf. […]
Der Anblick der Maximilianstraße hatte etwa die Stimmung des Faschingsonntags (nicht Dienstags!), nur ganz ohne Masken, soweit nicht die ‚Soldaten‘ maskiert waren, die zahlreich herumlaufen und von denen ein großer Teil offenbar noch nie in einer Uniform gesteckt ist. Aber die vielen Plakate in allen möglichen Farben, sehr schreiend, erinnerten an diejenigen der karnevalistischen Unterhaltungen.
Die Parteien rückten vielfach mit einer Art Musik an, Trommel, auch dünnem Blechorchester, Knaben trugen Plakate an Stangen, dann kamen Soldaten mit roten Fahnen, dann Reiter auf roten Sätteln, hinterher eine Rotte ganz kleiner Jungen. Durchschnitt fünf bis sieben Jahre, genau wie an Fasnacht.“
13. 1 1919 - Razzia beim Soller und beim Metzgerbräu im Tal
München-Angerviertel * Beim Soller und im Metzgerbräu im Tal werden durch ein umfangreiches Polizeiaufgebot Razzien durchgeführt. 220 Personen werden verhaftet und ein Lastwagen mit aus Miltärbeständen stammendem Hehlergut beschlagnahmt.
13. 1 1919 - Freikorps-Truppen rücken in Berlin ein
Berlin * Die um Berlin stationierten Freikorps rücken in die Stadt ein, insgesamt etwa 3.000 Mann. Die größte Einheit ist die Garde-Kavallerie-Schützen-Division. Die Berliner Zeitungen begrüßen den Einzug als Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung. Der militärischen Besetzung folgen erhebliche Gewaltexzesse der rechtsgerichteten Truppen.
13. 1 1919 - Dank an die braven Truppen der Republik
Berlin * Der Rat der Volksbeauftragten [= Regierung Ebert] dankt „den braven Truppen der Republik“, denen es gelungen ist, „aus eigener Kraft und durch Unterstützung der Bevölkerung einen Aufstand niederzuwerfen, der alle freiheitlichen Errungenschaften der Revolution zu vernichten drohte“. Der Januaraufstand, der als Spartakusaufstand in die Geschichte einging, ist niedergeschlagen.
13. 1 1919 - Zivilisten müssen alle Schusswaffen abgegeben
Berlin * Die Regierung Ebert verordnet, dass
- die Zivilbevölkerung innerhalb von 24 Stunden alle Schusswaffen abgeben muss.
- Zuwiderhandlungen werden mit Geld- und Gefängnisstrafen geahndet.
13. 1 1919 - Beschlüsse zur Sozialisierung des Kohlebergbaus bekräftigt
Essen * Eine Konferenz aller Arbeiter- und Soldatenräte des rheinisch-westfälischen Industriegebiets bekräftigen die am Tag zuvor gefassten Beschlüsse zur Sozialisierung des Kohlebergbaus.
14. 1 1919 - Die am Januarstreik beteiligten werden amnestiert
München * Aufgrund der Amnestie vom 12. November 1918 stellt das Reichsgericht die Strafverfahren gegen die am Januarstreik Beteiligten ein. Amnestiert werden:
- der Schriftsteller Kurt Eisner [derzeit Bayerischer Ministerpräsident],
- der Schlosser Hans Unterleitner [derzeit bayerischer Sozialminister],
- der Schreinermeister Albert Winter,
- die Buchhalterin Emilie Landauer und
- die Buchhalterin Betty Landauer,
- der Mechaniker Lorenz Winkler,
- der Eisendreher Franz Xaver Mettler,
- der Student Ernst Toller,
- der Handlungsgehilfe Richard Kämpfer,
- der Schriftsetzer Theobald Michler,
- der Werkzeugmacher Georg Lang,
- der Geschäftsführer Fritz Schröder und
- der Soldat Carl Kröpelin.
- Die am 1. Februar 1918 als Rednerin verhaftete und in die Strafvollzugsanstalt Stadelheim gebrachte Privatdozentsgattin Sara Sonja Lerch hat sich dort am 30. März 1918 erhängt.
14. 1 1919 - Passzwang für alle Nicht-Bayern
München * Für alle Nicht-Bayern wird der Passzwang eingeführt.
14. 1 1919 - Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg schreiben ihre letzten Texte
Berlin * Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg schreiben ihre letzten Texte für „Die Rote Fahne“. Rosa Luxemburg beschwört die Kraft der Revolution mit den Worten: „Ich war, ich bin, ich werde sein.“ Karl Liebknechts Text endet mit den Worten: „Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird - leben wird unser Programm; es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen. Trotz alledem!“
14. 1 1919 - Der neue Tagungsort der Reichsregierung ist Weimar
Berlin - Weimar * Um dem Druck der starken linksgerichteten Arbeiterschaft auszuweichen, drängt Friedrich Ebert bereits im Dezember 1918 auf die Verlagerung der Regierung aus der Reichshauptstadt. Untersucht werden die vier Standorte Bayreuth, Nürnberg, Jena und Weimar. An diesem 14. Januar wird das Deutsche Nationaltheater in Weimar als künftiger Tagungsort bestimmt.
14. 1 1919 - Die Streikenden im Ruhrgebiet beenden den Arbeitskampf
Essen - Ruhrgebiet * Nach und nach nehmen die Streikenden nach den Beschlüssen des vergangenen Tages ihre Arbeit wieder auf.
15. 1 1919 - Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden brutal ermordet
Berlin * Die beiden Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden verhaftet und ins Hotel Eden gebracht, in dem die Garde-Kavallerie-Schützen-Division ihr Stabsquartier aufgeschlagen hat.
- Karl Liebknecht wird - nach schweren Misshandlungen - am Abend in den Tiergarten gefahren und von hinten erschossen.
- Rosa Luxemburg wird niedergeschlagen, in ein Auto gezerrt und während der Fahrt durch einen aufgesetzten Schläfenschuss getötet. Ihren Leichnam werfen die Mörder in den Landwehrkanal.
Der Hauptverantwortliche für die Ermordungen, Waldemar Papst, beruft sich später auf einen angeblichen „Schießbefehl“ des SPD-Innenministers Gustav Noske.
15. 1 1919 - Bei einer Razzia wird Hehlerware beschlagnahmt
München * Bei einer weiteren Razzia werden
- im Bavaria-Automat in der Bayerstraße,
- in den Gastwirtschaften Stadt Kempten und Zum Fischmarkt am Viktualienmarkt,
- einer Kaffeeschenke in der Westenriederstraße und
- im Gasthaus zum Schwane am Rosenheimer Berg
rund einhundert Personen verhaftet und umfangreiches Heeresgut, darunter Pferde, beschlagnahmt.
15. 1 1919 - Die politische Säuberung der Reichshauptstadt beginnt
Berlin * In Berlin marschieren Freikorps und Truppen der Obersten Heeresleitung ein, die sich bisher nicht an den Kämpfen beteiligt haben. Damit beginnt die „Säuberung“ der Reichshauptstadt.
15. 1 1919 - Die Münchner KPD-Zeitung Rote Fahne erscheint
München * Die Kommunistische Partei Deutschlands - KPD in München gibt unter der Leitung von Max Levien eine eigene Parteizeitung, die Münchner Rote Fahne, heraus.
16. 1 1919 - Hochschule für Arbeiter, Soldaten und Bauern geplant
München-Kreuzviertel * Die Regierung des Volksstaates Bayern plant die Gründung einer Hochschule für Arbeiter, Soldaten und Bauern. Die Idee geht vermutlich auf Kurt Eisner zurück.
16. 1 1919 - Die Bestimmungen zur Einführung der Prohibition in USA werden ratifiziert
USA * Die Bestimmungen zur Einführung der Prohibition in den USA werden ratifiziert und treten ein Jahr später in Kraft.
16. 1 1919 - Die Banken sperren der Bremer Räteregierung die Kredite
Bremen * Sämtliche Banken sperren der Räteregierung in Bremen die Kredite. Aus der Finanzkrise wird schnell eine Regierungskrise der gemeinsam regierenden Kommunisten mit der USPD.
16. 1 1919 - Erhard Auer erhebt den Anspruch aufs regieren
München * Der bayerische SPD-Vorsitzende Erhard Auer führt auf einer politischen Versammlung seiner Partei aus: „Eine Klasse kann herrschen, aber nicht regieren; regieren kann nur eine Organisation.“ Er meinte dabei wohl seine Partei.
16. 1 1919 - Scheidemann zur Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
Berlin * Philipp Scheidemann erklärte zum Tod von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht folgendes:
„Ich bedauere den Tod der beiden aufrichtig aus gutem Grunde. Sie haben Tag für Tag das Volk zu den Waffen gerufen und zum gewaltsamen Sturz der Regierung aufgefordert. Sie haben Spazierfahrten durch Berlin mit Maschinengewehren veranstaltet, die sie uns wiederholt vor die Reichskanzlei fuhren, sie haben Tag für Tag ihre Anhänger bis zur Siedehitze aufgepeitscht. Sie haben, nachdem durch ihre Schuld Arbeiter- und Soldatenblut in Strömen geflossen, uns als Mörder und Bluthunde Tag für Tag in ihren Zeitungen und in ihren Versammlungen beschimpft. So sind sie selbst Opfer ihrer eigenen blutigen Terrortaktik geworden.“
Und weiter meint er: „Bei Frau Luxemburg, einer hochbegabten Russin, ist mir der Fanatismus begreiflich, nicht aber bei Liebknecht, dem Sohn Wilhelm Liebknechts, den wir alle verehrten und noch verehren. Sein Sohn, der nunmehr tote Karl Liebknecht, hat sich leider vollkommen in die russisch-terroristische Taktik einspannen lassen.“
Zur Rechtfertigung seiner Person und seiner Regierung äußert er sich: „Wenn mein wahnsinniger Bruder die Flinte auf mich anlegt, so kann ich, wenn es [um] mich allein geht, mich erschießen lassen, um sein Blut zu schonen, aber wenn ich im Begriffe bin, mich in ein brennendes Haus zu stürzen, um Weib und Kind zu retten, und der wahnsinnige Bruder legt dann auf mich an, dann hilft nichts mehr, dann muss ich mich gegen ihn zur Wehr setzen, denn dann geht es nicht mehr um mich, sondern um viele andere.“
17. 1 1919 - Verbot eines religionslosen Moralunterrichts aufgehoben
München-Kreuzviertel * Kultusminister Johannes Hoffmann hebt das im Jahr 1914 erlassene Verbot der Erteilung eines öffentlich organisierten religionslosen Moralunterrichts auf.
17. 1 1919 - Das Freikorps Lützow wird in Berlin gegründet
Berlin * Das Freikorps Lützow wird in Berlin gegründet. Die Finanzierung der Freikorps findet aus den Mitteln des Antibolschewistenfonds der deutschen Wirtschaft statt, der am 10. Januar 1919 in Berlin mit 500 Millionen Reichsmark gegründet und einem 50-Millionen-Mark-Sofort-Bankkredit ausgestattet wurde.
Neben der Finanzierung der militärischen Zerschlagung der deutschen Räterepubliken fließen auch viele Gelder in die antibolschewistische-nationalistische Propaganda sowie in die Einwohnerwehren.
17. 1 1919 - Verhandlungen zur Sozialisierung des Kohlebergbaus
Essen - Berlin * Die Essener Neunerkommission führt in Berlin Verhandlungen zur Sozialisierung des Kohlebergbaus. Die Essener Sozialisierungsbestrebungen werden weder von der Reichsregierung noch von der zentralen Gewerkschaftsführung unterstützt. Die Erfolge der Neunerkommission sind überschaubar.
18. 1 1919 - Beginn der Friedenskonferenz in Paris
Paris * Beginn der Friedenskonferenz unter Ausschluss von Deutschland und seinen Verbündeten.
18. 1 1919 - Nuntius Pacelli soll noch nicht zurückkehren
München * Als Erzbischof Michael von Faulhaber von Lorenzo Schioppa, der rechten Hand des Nuntius Eugenio Pacelli, nach der Wahl der Nationalversammlung gefragt wird, ob der Nuntius aus der Schweiz wieder nach München zurückkehren könne, antwortet Faulhaber:
„Nach Lage der Dinge wird Ministerpräsident Eisner sofort wieder versuchen, eine amtliche Verbindung mit Monsignore Pacelli zu gewinnen, und die bayerischen Bischöfe werden in dieser Verbindung eine Legitimierung der Revolutionsregierung und ein Ärgernis für das ganze Land erblicken.
Die bayerischen Bischöfe haben sich nämlich damals geweigert, die früheren königlichen Konkordatsrechte (z.B. bei Besetzung der Pfarreien) ohne weiteres auf die neue Regierung zu übertragen, und haben deshalb die Verhandlungen mit der Regierung abgebrochen. Für die kirchenpolitische Lage in Bayern wäre es verhängnisvoll gewesen, wenn damals auch nur der Schein amtlicher Beziehungen zwischen dem auswärtigen Ministerium und der Nuntiatur entstanden wären.“
19. 1 1919 - Wahl zum neuen gesamtdeutschen Reichstag
Deutsches Reich * Die Wahlen zur Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung [= Reichstag] finden statt. Das deutschlandweite Ergebnis lautet:
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD: 37,9 Prozent = 163 Abgeordnete
- Christliche Volkspartei - Zentrum: 18,8 Prozent = 91 Abgeordnete
- Deutsche Demokratische Partei - DDP: 18,1 Prozent = 75 Abgeordnete
- Deutschnationale Volkspartei - DNVP: 8,6 Prozent = 44 Abgeordnete
- Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands - USPD: 7,6 Prozent = 22 Abgeordnete
- Deutsche Volkspartei - DVP: 4,4 Prozent = 19 Abgeordnete
- Übrige Parteien: 1,6 Prozent = 7 Abgeordnete
Der Wahlkreis Oberbayern und Schwaben erhält 15 Abgeordnetensitze. Davon fallen 6 Sitze auf die BVP, 6 Sitze auf die SPD, 2 Sitze auf den BBB und ein Sitz auf die Deutsche Volkspartei in Bayern - DVP. Von den 15 Abgeordneten gehört keiner der USPD an.
19. 1 1919 - Erstmals können Frauen reichsweit wählen und gewählt werden
Deutsches Reich * Erstmals können Frauen in Deutschland reichsweit wählen und gewählt werden. 82,3 Prozent der Frauen beteiligen sich an der Wahl.
- 300 Frauen kandidieren zur Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung. Unter den 423 Abgeordneten befinden sich 37 Frauen. Die meisten weiblichen Abgeordneten gehören der Sozialdemokratischen Partei - SPD an.
- Rechnet man die Nachrückerinnen dazu, erreicht die Frauenquote 9,6 Prozent. Ein Wert, der erst 1983 wieder erreicht werden wird.
19. 1 1919 - Ausführungsbestimmungen zu den Hamburger Punkten erlassen
Berlin * Die Reichsregierung erlässt Ausführungsbestimmungen zu den Hamburger Punkten, die der Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands am 18. Dezember 1918 beschlossen hatte. Die Bestimmungen gehen an den Beschlüssen des Rätekongresses vollkommen vorbei und stärken dafür die Interessen der alten Offizierskorps.
20. 1 1919 - Entwurf der Weimarer Verfassung wird der Öffentlichkeit vorgestellt
Weimar * Hugo Preuß stellt seinen Entwurf der Weimarer Verfassung der Öffentlichkeit vor.
- Darin sollen die Rechte der Einzelstaaten stark beschnitten werden.
- Bayern würde die Militärhoheit,
- sein eigenes Post- und Telegraphenwesen sowie
- das Recht, direkte Steuern zu erlassen, verlieren.
- Das würde auch das Ende der bayerischen Außenpolitik bedeuten.
- Aus einem souveränen Einzelstaat soll ein Teilstaat des Deutschen Reichs werden.
21. 1 1919 - Die USPD erreicht die Ausschreibung von Wahlen in Bremen
Bremen * Da die Bremer Kommunisten sich aus der Regierung - und damit aus der Verantwortung - zurückziehen wollen, gelingt es der USPD an diesem 21. Januar - mit Zustimmung des Arbeiter- und Soldatenrates sowie der Kommunisten -, dass Wahlen ausgeschrieben werden.
21. 1 1919 - Diskussion zur wirksamen Weiterführung des Rätesystems
München * In der Plenarsitzung der bayerischen Räte geht es um die wirksame Weiterführung des Rätesystems. Es werden zwei Richtungen diskutiert:
- Entweder treten die Räte an die Stelle der Beamtenschaft
- oder sie bilden eine souveräne gesetzgebende Körperschaft, die über die Natur der Gesetze zu entscheiden hat. Die Billigung der Gesetze durch den Landtag ist dann nur noch eine Formalie.
Beide Fälle gehen von der Voraussetzung aus, dass die Räte das beherrschende Element im Aufbau der Staatsregierung sind.
22. 1 1919 - Lujo Brentano wird Vorsitzender der Sozialisierungskommission
München * Obwohl sich Ministerpräsident Kurt Eisner im November 1918 gegen Sozialisierungsmaßnahmen aussprach, gründet er eine Sozialisierungskommission, um die Diskussion zu beruhigen. Sie nimmt am 22. Januar ihre Arbeit auf. Vorsitzender der Kommission ist der Nationalökonom Lujo Brentano.
24. 1 1919 - Diskussion um den Entwurf einer Reichsverfassung
München - Berlin * Der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner reist in Begleitung seines Finanzministers Dr. Edgar Jaffé nach Berlin, um dort über den Entwurf einer Reichsverfassung zu diskutieren und zu beraten.
24. 1 1919 - Der Verkehr der Frankfurt-Münchner-Nachtschnellzüge wird eingestellt
München - Frankfurt am Main * Der Verkehr der Frankfurt-Münchner-Nachtschnellzüge wird wegen Kohlemangel und der Abgabe der Lokomotiven an die Siegermächte eingestellt.
24. 1 1919 - Kundgebung für einen gerechten Frieden
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Im Deutschen Theater treffen sich Angehörige und Anhänger aller Parteien zu einer machtvollen Kundgebung. Es geht um den Völkerbund und einen gerechten Frieden.<br /> Es sprechen der Minister für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter [SPD], Joseph Graf von Pestalozza [BVP], Professor Dr. Moritz Julius Bonn, die Frauenrechtlerin Lida Gustava Heymann und Professor Dr. Lujo Brentano. </p>
25. 1 1919 - Der obligatorische Religionsunterricht wird abgeschafft
München-Kreuzviertel * Die bayerische Revolutions-Regierung beseitigt den obligatorischen Religionsunterricht.
- Kinder dürfen demnach nicht mehr gegen den Willen der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Religionsunterricht und am Gottesdienst angehalten werden.
- Zur Freistellung vom Religionsunterricht genügt eine einfache Willenserklärung der Eltern.
25. 1 1919 - Gründung des Völkerbundes in Paris
Paris * Gründung des Völkerbundes durch die Alliierten unter Ausschluss der ehemaligen Feindstaaten.
25. 1 1919 - Das Militär soll die Ordnung in Bremen herstellen
Weimar- Bremen * Reichswehrminister Gustav Noske beauftragt - vier Tage nachdem man sich in Bremen zur Ausschreibung von Wahlen verständigt hat - den Chef des Generalkommandos, Walter von Lüttwitz, mit der Herstellung der Ordnung in Bremen.
25. 1 1919 - Kurt Eisner als Anwalt des Föderalismus
München - Berlin * Ministerpräsident Kurt Eisner nimmt an der Zweiten Konferenz der deutschen Einzelstaaten teil und tritt erneut als Anwalt des Föderalismus auf.
- Er schlägt vor, die Nationalversammlung in Würzburg zusammentreten zu lassen und
- versucht, die süddeutschen Staaten zu einem gemeinsamen Widerstand gegen den Verfassungsentwurf von Hugo Preuß zu vereinen.
25. 1 1919 - Kurt Eisner geht den Staatsrechtler Hugo Preuß an
Berlin * Bei einer Besprechung mit dem Staatsrechtler und Liberalen Hugo Preuß zum Entwurf der Reichsverfassung äußert sich Bayerns Ministerpräsident Kurt Eisner: „Ich warne Sie. Wenn Sie mit diesem Verfassungsentwurf vor die Nationalversammlung kommen, erregen Sie Aufstandsstimmung.“
26. 1 1919 - Eine englische Kommission prüft die Versorgungslage
München * Eine Kommission aus England überprüft die Lebensmittelverhältnisse in München.
27. 1 1919 - Kasernenräte planen eine Massendemonstration gegen Offiziere
München * Die Kasernenräte planen eine Massendemonstration gegen die Offiziere der Münchner Garnison. In Verhandlungen kommt der Minister für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter, den Organisatoren so weit in ihren Forderungen entgegen, dass sie von weiteren Aktionen absehen.
27. 1 1919 - Anton Graf Arco will gegen Kurt Eisner plakatieren
München * Anton Graf Arco auf Valley, der spätere Eisner-Mörder, will mit einem Aufruf die Bevölkerung aufrütteln: „Wer ist Bayerns Vertreter im Reich? Wer greift dem Willen des Bayernvolkes, der durch den Landtag vertreten wird, durch Staatsgrundgesetz? [sic!] Wer macht unser so geachtetes Volk durch kinderhafte politische Manöver im Deutschen Reich und im Ausland lächerlich? Kurt Eisner Ministerpräsident.“
Die Plakatierung des etwas verworrenen Pamphlets wird vom Polizeipräsidenten Josef Staimer verboten.
28. 1 1919 - Die bayerischen Bischöfe drohen mit Exkommunikation
Freistaat Bayern * Die bayerischen Bischöfe veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung, in der die Erklärung des Religionsunterrichts zum Wahlfach als neue kulturkämpferische Gewalttat bezeichnet wird.
- Die Maßnahme werde „Familienstreitigkeiten, endlose Beunruhigung unseres Volkes und zunehmende sittliche Verwilderung der Jugend“ zur Folge haben.
- Eltern, die ihre Kinder vom Religionsunterricht abmelden, droht die Exkommunikation und der Ausschluss vom kirchlichen Begräbnis.
28. 1 1919 - Der Bayerische Gesandte soll den Verfassungsentwurf ablehnen
München - Berlin * Ministerpräsident Kurt Eisner beauftragt den Bayerischen Gesandten in Berlin, Konrad Ritter von Preger, den Entwurf zur Reichsverfassung von Hugo Preuß abzulehnen.
29. 1 1919 - Die Freisinger Erklärung der bayerischen Bischöfe
Freising * Für den Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber ist Kultusminister Johannes Hoffmann ein „ausgesprochener Kulturkämpfer und Kirchenhasser“. In ihrer Freisinger Erklärung fassen die Bischöfe ihren „flammenden Protest“ zusammen und prangern in einem Hirtenbrief die Maßnahme als „Fehdehandschuh gegen den Herrn selbst“ an.
Der Hirtenbrief beginnt so: „Herodes der Kindermörder ließ die unschuldigen Kinder von Bethlehem hinschlachten. Unbekümmert um das Weinen und Wehklagen der Mütter, unbekümmert um das Todeswimmern der sterbenden Kinder, ließ er an wehrlosen Kindern seine Wut aus, um mit ihnen den neugebornen König der Juden, den vermeintlichen Anwärter seines Thrones aus dem Weg zu schaffen.“
In einer extrem polemischen und ehrverletzenden Art geht es weiter: „Geliebte Erzdiözesanen!
Am letzten Montag ist im Volksstaate Bayern eine Verordnung ergangen, die vor dem Richterstuhl Gottes schwerer wiegt als der Blutbefehl des Herodes. Durch eine Verordnung des Unterrichtsministers wurde der Religionsunterricht in allen bayerischen Schulen als Pflichtfach abgesetzt und als Wahlfach der Willkür der Eltern und Vormünder ausgeliefert.“
31. 1 1919 - Nuntius Pacelli kehrt wieder nach München zurück
Rorschach - München * Nuntius Eugenio Pacelli kehrt von Rorschach wieder nach München zurück, nachdem er auf Anraten von Erzbischof Michael von Faulhaber am 22. November 1918 die bayerische Landeshauptstadt wegen der revolutionären Vorgänge verlassen hatte.
1. 2 1919 - Die Zahl der Arbeitslosen steigt auf 38.022
München * Die Zahl der Arbeitslosen ist im Verlauf der vergangenen Woche von 33.767 auf 38.022 gestiegen.
1. 2 1919 - Gespräche zur Regierungsbildung zwischen SPD und DDP
Berlin * Zwischen SPD und Deutscher Demokratischer Partei - DDP finden erste Gespräche zur Regierungsbildung statt.
2. 2 1919 - Wiltrud und Rupprecht treffen sich auf Schloss Wildenwart
Schloss Wildenwart * Ex-Prinzessin Wiltrud trifft ihren Bruder Rupprecht auf Schloss Wildenwart. Nach der Begegnung schreibt sie in ihr Tagebuch: „Rupprecht anzuschauen, seinen lederartigen Teint und die fast weißen Haare und den Ausdruck von Gram ist herzzerreißend.“
2. 2 1919 - Die bayerische Landtagswahl in der Pfalz
<p><em><strong>Freistaat Bayern-Pfalz</strong></em> * In der zum Freistaat Bayern gehörenden Pfalz wird erst drei Wochen später wie im Kernland gewählt, da die Wahlvorbereitungen von der französischen Besatzungsmacht in Regierungsbezirk Pfalz behindert worden sind. Das ist auch der Grund, weshalb der Termin für die konstituierende Sitzung im Bayerischen Landtag erst auf den 21. Februar festgesetzt wird. </p>
2. 2 1919 - Ein Hirtenbrief wird von Bayerns Kanzeln verlesen
München - Freistaat Bayern * Der am 29. Januar versandte Hirtenbrief wird von allen bayerischen - und damit auch pfälzischen - Kanzeln verlesen. Darin wird die Verordnung des Kultusministers Johannes Hoffmann, wonach „der Religionsunterricht in allen bayerischen Schulen als Pflichtfach abgesetzt und als Wahlfach der Willkür der Eltern und Vormünder ausgeliefert“ in einer sehr propagandistisch-verletzenden Art angeprangert.
3. 2 1919 - Ex-Königin Marie Therese stirbt auf Schloss Wildenwart
Schloss Wildenwart * Marie Therese, Erzherzogin von Österreich-Este, Prinzessin von Modena sowie Ehefrau von Ex-König Ludwig III. und damit die abgesetzte letzte bayerische Königin, stirbt auf Schloss Wildenwart im Chiemgau. Das Direktorium des Magistrats und der Vorstand der Gemeindebevollmächtigten sprechen dem Ex-König ihr Beileid zum Tod der Ex-Königin aus und übersenden eine „Blumenspende“.
3. 2 1919 - Die wöchentliche Fleischration wird auf 300 Gramm erhöht
München * Die wöchentliche Fleischration wird bayernweit auf 300 Gramm erhöht. Eine Anweisung des Innenministeriums ermöglicht dem Stadtmagistrat gegen „eigenmächtige Bierpreiserhöhungen mit aller Entschiedenheit“ vorzugehen.
3. 2 1919 - BVP-Proteste gegen den Religionsunterrichts-Erlass
München * Die Bayerische Volkspartei - BVP hält in allen Stadtteilen Protestversammlungen gegen den Religionsunterrichts-Erlass ab, der den Besuchszwang der Religionsstunden abgeschafft hat.
3. 2 1919 - Die Sozialiserungskommission kündigt ihren Rücktritt an
Berlin * Die am 4. Dezember 1918 gebildete Kommission zur Erarbeitung eines Sozialisierungskonzepts kündigt in einem Schreiben an die Regierung, dem noch amtierenden Rat der Volksbeauftragten, ihren Rücktritt an, da in der Öffentlichkeit „Zweifel an dem Ernst der Sozialisierungsabsichten der Regierung“ entstanden sind.
3. 2 1919 - Kurt Eisner fährt zur Konferenz der Sozialistischen Internationale
München - Bern * Ministerpräsident Kurt Eisner reist in Begleitung von Ernst Toller zur Konferenz der Sozialistischen Internationale nach Bern ins dortige Volkshaus. Die Konferenz dauert bis zum 10. Februar. Es wird Eisners letzter großer Auftritt werden, den er zur Abrechnung mit den Sozialdemokraten nutzt.
4. 2 1919 - Regierungstruppen befreien die Hansestadt Bremen
Bremen * In Bremen, das sich am 10. Januar 1919 zur Selbstständigen Sozialistischen Republik erklärt hat, rücken Freikorps ein.
Damit beginnt der Einsatz der meist aus rechtsextremen Offizieren und Mannschaften bestehenden Freikorps zur Niederschlagung von Unruhen und Streiks.
4. 2 1919 - Kurt Eisner spricht auf der Sozialisten-Konferenz in Bern
Bern * Ministerpräsident Kurt Eisner rechnet auf der Konferenz der Sozialistischen Internationale in Bern mit den Sozialdemokraten ab, nachdem der Vertreter der MSPD, Otto Wels, eine wehleidige Rede hält, in der er die Haltung seiner Partei vor und während des Krieges den Vertretern des sozialistischen Europas darlegen will.
Im Gegensatz zu Welsch bekennt sich Kurt Eisner ausdrücklich zur deutschen Schuld. Er erhält dafür am Kongress einen rauschenden Beifall, wird dafür aber in Deutschland bitter kritisiert.
Annette Kolb, die als Journalistin in Bern dabei ist, vermerkt: „Was nun verlautete, war ein Plädoyer für Deutschland, wie es niemals ergreifender formuliert wurde. Seine kalte Stimme beibehaltend, enthüllte er die ganze Tragik des unglücklichen Landes. ‚Die Stimme derer, welche im Kampf um die Ideen einer besseren Welt namenlos in den Kerkern verblichen‘, rief er schneidend den fremden Delegierten zu, ‚drangen nicht bis zu euch! Stumm verbluteten sie‘. Und im Namen jener neuen und besseren Welt verlangte er die Freigabe der zurückgehaltenen Kriegsgefangenen.
Man hielt den Atem an. Denn vor uns stand ein Entronnener aus eben jener Schar stummer Blutzeugen für die Idee der Gewaltlosigkeit, der Wahrheit und der Menschenliebe. Dies war ihr Los wie vor 2.000 Jahren. In Eisner hatte der Kongress wohl seine eindrücklichste Figur“.
4. 2 1919 - Der Rücktritt der Sozailisierungskommission kommt ungelegen
Berlin * Die Rücktrittsabsichten der Kommission zur Erarbeitung eines Sozialisierungskonzepts kommt der Regierung ungelegen, weshalb umgehend Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kommission eingeleitet werden.
4. 2 1919 - Anfrage zur Regierungsbeteiligung an die USPD
Berlin * Die SPD-Fraktion diskutiert über eine mögliche Regierungsbeteiligung der USPD.
Man beschließt eine Anfrage, ob die Unabhängigen „auf der Grundlage des Bekenntnisses zur parlamentarischen Demokratie, d.h. zu einer Staatsform, die in jeder Beziehung durch den Willen der Mehrheit des Volkes bestimmt wird, mithin unter Ausschaltung jeder Putschtaktik“ in die „Regierungsmehrheit“ eintreten will.
Das Amt des Reichspräsidenten will Friedrich Ebert übernehmen, Philipp Scheidemann soll Reichskanzler werden.
Um den 5. 2 1919 - Die reaktionäre Presse verdreht Eisners Aussagen
München - Bern * Felix Fechenbach berichtet später über die im Volkshaus in Bern stattfindende Konferenz der Sozialistischen Internationale:
„In der deutschen reaktionären Presse […] wurde Eisners Aktion in Bern in das Gegenteil umgelogen. Man behauptete, er habe dort verlangt, die deutschen Gefangenen müssten erst Nordfrankreich wieder aufbauen, ehe sie nach er Heimat zurückkehren dürften. Alle unwahren Behauptungen, die damals über Eisners Auftreten in Bern verbreitet wurden sind seit dem zum eisernen Bestand der deutsch-nationalen und völkischen Agitation geworden.“
6. 2 1919 - Trauerfeier für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
München-Maxvorstadt * Die USPD veranstaltet im großen Odeonssaal eine Trauerfeier für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Gustav Landauer hält die Gedächtnisrede.
6. 2 1919 - Die überhandnehmende Tanzwut kritisiert
München * Die Bayerische Staatszeitung bezieht gegen die „überhandnehmende Tanzwut“ Stellung. Vom 1. Dezember 1918 bis zum 18. Januar 1919 waren insgesamt 934 Tanzvergnügungen zur Lustbarkeitssteuer angemeldet worden.
6. 2 1919 - Die Mittelschüler machen mobil zum Schulstreik
München * Die Mittelschüler machen mobil. In einem Anschlag heißt es:
„Mittelschüler, werdet wach!
Auch unsere Stunde ist gekommen!
Befreiung von dem anmaßenden Stumpfsinn der Schule!
Macht Euch bereit zum Schulstreik!“
6. 2 1919 - Vereinigung Sozialdemokratischer Beamter in München gegründet
München * Die Vereinigung Sozialdemokratischer Beamter in München wird gegründet.
6. 2 1919 - Die verfassungsgebende Nationalversammlung tritt in Weimar zusammen
Weimar * Im Nationaltheater von Weimar tritt die Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung zur konstituierenden Sitzung zusammen. Sie wird hier bis zum 11. August 1919 tagen, um die Reichsverfassung zu verabschieden.
6. 2 1919 - Die USPD beteiligt sich nicht an der Reichsregierung
Berlin - Weimar * Die Unabhängigen Sozialdemokraten antworten auf das Angebot der SPD-Fraktion zum Eintritt in die Reichsregierung distanziert. Die USPD will sich nur dann beteiligen, wenn sämtliche Mitglieder der Regierung den entschlossenen Willen zeigen, „die demokratischen und sozialistischen Errungenschaften der Revolution gegen die Bourgeoisie und gegen die Militärautokratie sicherzustellen“.
6. 2 1919 - Friedrich Ebert hält die Eröffnungsrede der Nationalversammlung
Weimar * Friedrich Ebert hält die Eröffnungsrede der Nationalversammlung. In einer nüchtern vorgetragenen, von zahllosen Zwischenrufen von links und rechts unterbrochenen Rede erklärt er aller Welt sein Handeln seit dem 9. November und hält fest, was das Reich seither gewonnen hat:
„Das deutsche Volk ist frei, bleibt frei und regiert in aller Zukunft sich selbst.“ Und er ist froh, nun das Mandat, das die Revolution ihm aufzwang, zurückgeben zu können an den „höchsten und einzigen Souverän in Deutschland“. Nur auf dem „Weg der Gesetzmäßigkeit“ lassen sich in Deutschland die notwendigen Veränderungen voranbringen.
7. 2 1919 - Der Kommunistenführer Max Levien wird verhaftet
München * Der Kommunistenführer Max Levien wird wegen „umstürzlerischer Umtriebe“ verhaftet. Sein Geisteszustand wird untersucht.
7. 2 1919 - Weitere 67 Personen sind an der Spanischen Grippe gestorben
München * In der ersten Februarwoche sind 67 Personen in München an der Spanischen Grippe gestorben.
Die Epidemie ist weiter im Abklingen begriffen.
8. 2 1919 - Der Revolutionäre Arbeiterrat verlangt die Freilassung von Max Levien
<p><em><strong>München</strong></em> * Eine Abordnung des Revolutionären Arbeiterrats verlangt bei Justizminister Dr. Edgar Jaffé die Freilassung des am Tag zuvor verhafteten Kommunistenführers Max Levien. </p>
8. 2 1919 - Zahl der Arbeitslosen auf Rekordmarke gestiegen
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Zahl der Arbeitslosen ist in München um über 2.200 von 38.022 auf die Rekordmarke von 40.228 gestiegen. Gleichzeitig hat die ausbezahlte Unterstützung von 1.475.000 auf 1.310.000 Mark abgenommen. </p>
9. 2 1919 - Die Militärpolizei sorgt für die Einhaltung der Polizeistunde
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Militärpolizei sorgt für die Einhaltung der Polizeistunde, die durch die Tanzwut ständig übertreten wurde. </p>
9. 2 1919 - Den Rücktritt nochmal überdenken
<p><em><strong>Weimar - Berlin</strong></em> * Der Volksbeauftragte Rudolf Wissell bittet im Namen der Regierung die Mitglieder der Kommission zur Erarbeitung eines Sozialisierungskonzepts - in Anbetracht auf die <em>„Rückwirkung auf die Öffentlichkeit, die der Rücktritt der Sozialisierungskommission zur Folge haben wird“</em>, den gefassten Beschluss nochmal zu überdenken. </p>
10. 2 1919 - Die vorläufige Reichsverfassung wird verabschiedet
Weimar * Die Deutsche Nationalversammlung verabschiedet das Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt in dritter Lesung. Es ist eine vorläufige Verfassung, die so lange gültig ist, bis die endgültige Reichsverfassung erarbeitet und beschlossen wird.
10. 2 1919 - Vergesst nicht, das deutsche Volk hat eine Revolution gemacht!
<p><em><strong>Frankfurt - Weimar</strong></em> * Die liberale Frankfurter Zeitung schreibt zum Weimarer Parlament: <em>„Die deutsche Nationalversammlung in Weimar sollte sofort und dringend den Beschluss fassen, dass in allen Fraktionszimmern und überhaupt überall dort, wo sich Räder der Parteimaschinen drehen, ein großes Plakat angebracht werde, das in Flammenschrift die Worte trägt: ‚Vergesst nicht, das deutsche Volk hat eine Revolution gemacht!‘“</em> </p>
11. 2 1919 - Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten gewählt
Weimar * Friedrich Ebert von der SPD wird mit 277 von 379 Stimmen zum Reichspräsidenten des Deutschen Reiches gewählt. In seiner Antrittsrede sagt er: „Ich will und werde als Beauftragter des ganzen deutschen Volkes handeln, nicht als Vormann einer einzigen Partei.“
11. 2 1919 - Der Kommunistenführer Max Levien wird aus der Haft entlassen
München * Der Kommunistenführer Max Levien wird zwar aus der Haft entlassen, doch das Verfahren gegen ihn wird weiterverfolgt.
11. 2 1919 - Die Mitglieder des Generalsoldatenrats werden verhaftet
Münster * General Oskar Freiherr von Watters lässt im Bereich des VII. Armeekommandos in Münster den Generalsoldatenrat auflösen und seine Mitglieder verhaften.
11. 2 1919 - Ernst Toller reist zu Freunden in Engadin
Bern - Engadin * Nach dem Ende des Sozialistenkongresses in Bern reist Ernst Toller zu Freunden ins Engadin.
12. 2 1919 - Albert Roßhaupter ruft zum Eintritt in den Volksheimatschutz auf
München * Albert Roßhaupter, der Minister für militärische Angelegenheiten ruft die wehrfähigen Männer zum Eintritt in den Volksheimatschutz auf. Dieser soll „die Gefahr des drohenden Krieges im Lande, den der Bolschewismus entfesseln kann“, eindämmen.
12. 2 1919 - Reichspräsident Ebert ernennt die neue Reichsregierung
Weimar * Reichspräsident Friedrich Ebert setzt das neue Reichsministerium ein. Die Reichsregierung wird auch als Weimarer Koalition bezeichnet. Sie besteht aus SPD, Zentrum und Deutsche Demokratische Partei - DDP. Das Kabinett Scheidemann setzt sich zusammen aus:
- Philipp Scheidemann, Reichsministerpräsident, SPD;
- Otto Landsberg, Justizminister, SPD;
- Gustav Noske, Reichswehrminister, SPD;
- Rudolf Wissell, Wirtschaftsminister, SPD;
- Robert Schmidt, Reichsernährungsminister, SPD;
- Gustav Bauer, Reichsarbeitsminister, SPD;
- Eduard David, Minister ohne Geschäftsbereich, SPD;
- Eugen Schiffer, stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister, DDP;
- Hugo Preuß, Innenminister, DDP;
- Georg Gothein, Reichsschatzminister und Minister ohne Geschäftsbereich, DDP;
- Johannes Bell, Verkehrsminister und Reichsminister für Kolonien, Zentrum;
- Johannes Giesberts, Reichspostminister, Zentrum;
- Matthias Erzberger, Minister ohne Geschäftsbereich, Zentrum;
- Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau, Auswärtiges Amt, Parteilos.
Die Aufgabe des Rates der Volksbeauftragten ist damit erfüllt.
13. 2 1919 - In München wird ein Rätekongress abgehalten
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Vom 13. bis zum 20. Februar findet im Münchner Deutschen Theater ein Kongress der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte statt. </p> <p>Ministerpräsident Kurt Eisner berichtet über den in Bern stattgefundenen Internationalen Sozialistenkongress. Er beschimpft dabei die Pressevertreter als Pressegesindel, da sie Berichte gefälscht hätten. Daraufhin verlassen die Anwesenden Pressevertreter den Kongress und stellen die Berichterstattung ein. Sämtliche Münchner Blätter protestieren in einer Erklärung gegen diese Behandlung der Presse. </p> <p>Unabhängig davon wird der Kongress - allerdings ohne Erfolg - versuchen, die Existenz der Räte im künftigen parlamentarischen Bayern sicherzustellen. </p>
13. 2 1919 - Die Räte fordern den Rücktritt Albert Roßhaupters
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Ein Teil der Teilnehmer des Kongresses der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte sehen in dem Aufruf des Ministers für militärische Angelegenheiten, Albert Roßhaupter, die wehrfähigen Männer zum Eintritt in den <em>„Volksheimatschutz“</em> zu bewegen, die Absicht, eine <em>„Weiße Garde“</em> zu gründen. Sie fordern den Rücktritt des SPD-Staatsministers. </p>
13. 2 1919 - Eine Verordnung über Einschränkung der Tanzlustbarkeiten
<p><em><strong>München</strong></em> * Martin Segitz [SPD] erlässt in seiner Funktion als Staatskommissar für Demobilmachung eine <em>„Verordnung über Einschränkung der Tanzlustbarkeiten“</em>. </p>
13. 2 1919 - Reichskanzler Philipp Scheidemann stellt das Regierungsprogramm vor
<p><em><strong>Weimar</strong></em> * Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann stellt das Arbeitsprogramm der neuen Reichsregierung vor. Es beinhaltet: </p> <ul> <li>den sofortigen Friedensschluss,</li> <li>die Demokratisierung der Verwaltung,</li> <li>die Schaffung eines demokratischen Volksheeres,</li> <li>die öffentliche Kontrolle privatmonopolistischer Wirtschaftszweige,</li> <li>die Sozialisierung der Bergwerke und der Energiebetriebe,</li> <li>die verschärfte Erfassung der Kriegsgewinne und</li> <li>soziale Verbesserungen. </li> </ul>
13. 2 1919 - Verhandlungen zur Sozialisierung der Bergbaubetriebe
<p><em><strong>Weimar - Essen</strong></em> * In Weimar beginnen die Verhandlungen zwischen der Regierung und den Vertretern der Essener Neunerkommission, dem Bezirksbetriebsrat Halle, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber.</p> <p>Die Regierung weigert sich, den Betriebsräten außer sozialpolitischen Rechten weitere Funktionen im wirtschaftlichen und politischem Raum zuzugestehen. Der umfassende Kontrollanspruch der Arbeiterräte wird abgelehnt. </p>
13. 2 1919 - Eisner erhält von der Frankfurter Zeitung Unterstützung
<p><em><strong>Frankfurt am Main</strong></em> * Zu den wenigen bürgerlichen Zeitungen, die Eisners Wirksamkeit in Bern gerecht wird, gehört die <em>Frankfurter Zeitung</em>. Sie schreibt:<em> „Wer aber in so überaus gehässiger Weise die Arbeit Eisners in Bern entstellt, verdächtig und herabwürdigt, wie das neuerdings geschehen ist, der hat nicht verstanden, worauf es eigentlich beim Sozialistenkongress ankam. […] </em></p> <p><em>Herr Eisner hat sich […] in Bern um die deutsche Sache verdient gemacht; insbesondere ist die Annahme der sehr erfreulichen Resolution über die Gefangenen auf sein Wirken zurückzuführen.“ </em></p>
14. 2 1919 - Die sofortige Wiedereinsetzung des Generalsoldatenrates gefordert
Münster - Weimar * Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte fordern von der Reichsregierung die sofortige Wiedereinsetzung des Generalsoldatenrates in Münster und drohen ab 18. Februar mit einem Generalstreik.
Um den 15. 2 1919 - Die erste Versammlung der Liga zur Bekämpfung des Bolschewismus
München * Dr. Fritz Gerlich hält als erster Vorsitzender des bayerischen Zweigs der Liga zur Bekämpfung des Bolschewismus die erste öffentlichen Versammlung in München ab.
Um den 15. 2 1919 - Franz Ritter von Epp stellt ein Freikorps zusammen
Ohrdruf * Seit Mitte Februar stellt Franz Ritter von Epp im thüringischen Ohrdruf im Auftrag des Reichswehrministers Gustav Noske ein Freikorps zusammen. Offiziell soll es dem „Grenzschutz Ost“ dienen.
In Bayern befürchtet man von Anfang an, dass die Truppe für den Einsatz im Inneren bestimmt ist, weshalb Ernst Schneppenhorst (ab 18. März 1919 Minister für militärische Angelegenheiten) später die Zusammenarbeit mit dem Freikorps Epp ablehnen wird.
15. 2 1919 - Die Ministerkrise wird für beendet erklärt
München-Ludwigsvorstadt * Die Ministerkrise, die Albert Roßhaupter durch seinen Aufruf an die wehrfähigen Männer zum Eintritt in den „Volksheimatschutz“ ausgelöst hat, ist beendet.
Ministerpräsident Kurt Eisner gibt gegenüber dem Kongress der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte eine entsprechende Erklärung ab.
15. 2 1919 - Zeitungs-Aufrufe zur Bildung einer Freiwilligen Volkswehr
München * In den Tageszeitungen erscheinen Aufrufe zur Bildung einer „Freiwilligen Volkswehr“
- gegen das „Gespenst der Anarchie“ und
- das „Elend des Bolschewismus“.
Unterzeichnet sind diese Aufrufe von Kasernenräten und Kommandeuren einzelner Truppenteile.
15. 2 1919 - Die Zahl der Arbeitslosen ist erstmals gesunken
München * Die Zahl der Arbeitslosen ist in der abgelaufenen Woche von 40.228 auf 38.633 gesunken. Das sind 6,5 beziehungsweise 6,2 Prozent der Münchner Gesamtbevölkerung.
15. 2 1919 - Weitere Einschränkungen des Zugverkehrs
München * Aufgrund der Reparationsleistungen an die Siegermächte kommt es zu weiteren Einschränkungen des Zugverkehrs.
- Für den Streckenabschnitt München - Holzkirchen und deren Anschlussstrecken wird ein Nachweis der Dringlichkeit der Reise verlangt.
- Bei der Isartalbahn wird die Beförderung von Schneeschuhen und Rodelschlitten ausgeschlossen.
15. 2 1919 - USPD-Kritik am Regierungsprogramm
Weimar * In seiner Stellungnahme zum Programm der Regierung Scheidemann erklärt Hugo Haase [USPD]: „Was diesem Programm fehlt, das ist auch der kleinste Tropfen sozialistischen Öles“.
15. 2 1919 - Der vorläufige Bericht der Sozialisierungskommission des Reiches
Berlin - Weimar * Die Sozialisierungskommission des Reiches gibt einen vorläufigen Bericht ab.
16. 2 1919 - Kundgebung auf der Theresienwiese fordert Existenz der Räte
München-Theresienwiese * Die von Teilnehmern des Kongresses der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte organisierte und veranstaltete Kundgebung auf der Theresienwiese fordert die Sicherstellung der Existenz der Räte im künftigen parlamentarischen Bayern.
Ein Demonstrationszug - unter Beteiligung von Ministerpräsident Kurt Eisner und Felix Fechenbach - zieht ohne Zwischenfälle von der Theresienwiese über die Innenstadt zur Ludwigstraße und wieder zurück.
16. 2 1919 - Das Faschingstreiben wird verboten
München * In Hinblick auf den anstehenden Fasching [2. bis 4. März] verbietet die Polizeidirektion sowohl das Faschingstreiben als auch den öffentlichen Verkauf von Faschingsartikeln.
16. 2 1919 - Eine Befriedungsaktion des Freikorps Totschlag
Hervest-Dorsten * Auf Befehl des Generals Oskar Freiherr von Watters rückt in Hervest-Dorsten im Regierungsbezirk Münster das Freikorps Lichtschlag zu einer „Befriedungsaktion“ ein. Aufgrund der Exzesse erhält das Freikorps im Volk bald den Namen „Freikorps Totschlag“.
16. 2 1919 - Der Alldeutsche Verband tagt in Bamberg
Bamberg * Der rechtsextreme und antisemitische Alldeutsche Verband - ADV tagt in Bamberg. Der seit den 1890er-Jahren stark Einfluss auf die Politik nehmende Verband war in den letzten beiden Kriegsjahren in eine Art Winterschlaf gefallen. Jetzt erwacht er wieder zu alter Stärke. Bis Ende 1920 werden die Alldeutschen 110.000 Mitglieder haben, dreimal so viel wie vor dem Krieg.
16. 2 1919 - Nationalversammlungs-Wahlen in Deutschösterreich
Wien - Österreich * In Deutschösterreich finden erstmals freie und gleiche Wahlen statt. Die verfassungsgebende Nationalversammlung besteht aus
- 69 Sozialdemokraten,
- 63 Christsozialen und
- 24 Deutschnationalen.
16. 2 1919 - Der Waffenstillstand wird auf unbestimmte Zeit verlängert
Berlin - Paris - London * Der am 11. November 1918 abgeschlossene Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und den Entente-Staaten wird auf unbestimmte Zeit verlängert.
17. 2 1919 - Die bayerische Revolution nahm mir die letzte Hoffnung
Karlsruhe * Der ehemalige Reichskanzler Max von Baden schreibt an den Ex-Kronprinzen Rupprecht von Bayern folgende Zeilen: „Dein schönes Bayern, das ich so liebe, war mir eine furchtbare Enttäuschung. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass es seine Wittelsbacher verjagen würde. Die bayerische Revolution nahm mir die letzte Hoffnung, die Monarchie wenigstens südlich des Mains zu retten.“
17. 2 1919 - Der alte Geist in der Nationalversammlung
Weimar * Hugo Haase [USPD] schreibt an seine Cousine: „Sehe ich von der äußeren Umgebung ab, so fühle ich mich ganz in den alten Reichstag versetzt: die alten Gesichter und - was schlimmer ist - die alte Denkweise, als ob eine Revolution gar nicht gewesen wäre.“
Ab 17. 2 1919 - 180.000 Streikende im Münsterland
Münster * Noch vor Ablauf des Ultimatums gegenüber der Reichsregierung treten Bergarbeiter in den Streik. Es beteiligen sich 180.000 Arbeiterinnen und Arbeiter an den Arbeitskampfmaßnahmen.
17. 2 1919 - Auch in Mitteldeutschland wird gestreikt
Mitteldeutschland * Im mitteldeutschen Industriegebiet beginnt ein Generalstreik, nachdem das Wolff‘sche Telegraphenbüro meldete: „Kein Mitglied des Kabinetts denkt daran oder hat je daran gedacht, das Rätesystem in irgendeiner Form, sei es in der Verfassung, sei es in dem Verwaltungsapparat, einzugliedern.“
18. 2 1919 - Die Münchener Post fordert den Rücktritt Kurt Eisners
München * Die SPD-nahe Münchener Post fordert im Zusammenhang mit der Landeskonferenz der Mehrheitssozialisten - SPD den Rücktritt Kurt Eisners. Begründung: „Seine sich auf das Rätesystem stützende Politik muss zu den schwersten Konflikten mit dem bayerischen Volke führen.“
18. 2 1919 - Kritik am Vollzugsausschuss, Landessoldatenrat sowie an Kurt Eisner
München * In einer Erklärung des 1., 2. und 3. Fußartillerie-Regiments stellen sich diese gegen den Vollzugsausschuss und den Landessoldatenrat sowie gegen Kurt Eisner. Dafür unterstützen sie den Minister für militärische Fragen, Albert Roßhaupter.
18. 2 1919 - Die Münchner Augsburger Abendzeitung ruft zur Kundgebung auf
München * Die Münchner Augsburger Abendzeitung ruft zu einer Riesenkundgebung auf:
- Für Ordnung, Freiheit und Demokratie.
- Gegen die bolschewistische Gefahr und den drohenden Bürgerkrieg.
19. 2 1919 - Gegen 16 Uhr beginnt der sogenannte Lotter-Putsch
München * Gegen 16 Uhr beginnt in München der sogenannte Lotter-Putsch, an dem sich rund 600 bewaffnete, überwiegend bayerische Soldaten beteiligen, die am 15. Februar aus Wilhelmshaven kommend hier eingetroffen sind. Die Putschisten unter Führung des Obermatrosen Conrad Lotter schlagen gleichzeitig an drei Stellen zu:
- Sie besetzen das Telegraphenamt am Hauptbahnhof,
- verhaften zur gleichen Zeit den Stadtkommandanten Oskar Dürr und den Polizeipräsidenten Josef Staimer in ihren Dienststellen und
- wollen in das vom Rätekongress besetzte Landtagsgebäude in der Prannerstraße eindringen.
- Außerdem wollen sie Kurt Eisner festnehmen und in die Tschechoslowakei abschieben.
Während die putschenden Matrosen die beiden ersten Aktionen erfolgreich durchführen können, werden sie im Landtag von der Landtagswache mit Maschinengewehrfeuer vertrieben. Die Festnahme von Kurt Eisner verhindert der Landessoldatenrat Richard Scheid. Die Münchner Bevölkerung hält die Putschisten fälschlich für preußische Spartakisten. Es kommt am Bahnhofsplatz zu einer kurzen Schießerei, bei dem der Straßenbahnfahrer Franz Stangl durch einen Kopfschuss ums Leben kommt.
Gegen 17:30 Uhr ziehen sich die putschenden Matrosen zurück. Conrad Lotter wird verhaftet.
19. 2 1919 - Erich Mühsam begibt sich auf eine Agitationsreise nach Baden
München - Baden * Erich Mühsam reist auf Einladung der Spartakisten in Mannheim und Heidelberg zu einer Agitationsreise nach Baden.
20. 2 1919 - Anton Graf von Arco auf Valley legt seine Mordmotive schriftlich nieder
München * Einen Tag bevor Anton Graf von Arco auf Valley zur Waffe greift, legt er seine Motive schriftlich nieder:
- „Eisner strebt nach der Anarchie, er ist Bolschewist, er ist Jude, er fühlt nicht deutsch, er untergräbt jedes deutsche Gefühl, er ist ein Landesverräter. [...]
- Ich hasse den Bolschewismus, ich liebe mein Bayernvolk, ich bin ein treuer Monarchist und guter Katholik. Über alles achte ich die Ehre Bayerns.“
Arcos Zimmermädchen Walburga Kästele, die Arcos Wohnung in der Prinzregenten Straße 18 betreut, bestätigt die Entschlossenheit des jungen Grafen: „Gegen Abend des 20. Februar nach 6 Uhr sagte Arco ohne besondere Einleitung, als ich zu seiner Bedienung in seinem Zimmer war: Morgen erschieße ich den Eisner.
Er sagte das ganz lustig und hat dazu gelacht. Ich glaubte ihm nicht und sagte, das getraue er sich doch nicht, worauf er erwiderte: Doch, doch, ich mache es, der muss weg er ist ein Bolschewik und Jude.“
20. 2 1919 - Kurt Eisner bereitet seine Rücktrittsrede vor
München-Graggenau * Kurt Eisner gilt seit drei Jahren als Stammgast im Café Perzl am Marienplatz [heute: Kaufhaus Ludwig Beck am Rathauseck]. An diesem Tag sitzt der Ministerpräsident alleine an einem der runden Marmortischchen, schaut „einen Stoß handgeschriebener loser Blätter“ durch und nimmt Streichungen und Ergänzungen vor. Er bereitet offensichtlich seine für den nächsten Tag geplante Rücktrittsrede vor.
20. 2 1919 - Eine arbeitsreiche Regierungszeit
München - Freistaat Bayern * Die Regierung Eisner hat vom 8. November 1918 bis zum Tag der Ermordung Kurt Eisners insgesamt 85 Verordnungen, Bekanntmachungen, Entschließungen, Ministerialbekanntmachungen, Ministerialentschließungen und Ausführungsbestimmungen erlassen.
Darunter befinden sich Verordnungen, die mit dem Zusatz „mit Gesetzeskraft“ versehen sind. Zum Beispiel: die Verordnung betreffend die Bayerische Notenbank vom 20. November oder die Verordnung betreffend Beaufsichtigung und Leitung der Volksschulen vom 16. Dezember 1918.
20. 2 1919 - Kurt Eisners Vorstellungen für eine künftige Regierung
München-Kreuzviertel * Das Kabinett-Eisner beschließt, dass die Regierung ihre Ämter zur Verfügung stellt, sich aber bereit erklärt, die Geschäfte fortzuführen bis zur Wahl einer neuen Regierung. Für Kurt Eisner gibt es nur zwei Optionen:
- Eine sozialistische Regierung unter Zuziehung des Bauernbundes, die auf eine starke Minderheit gestützt ist, oder
- die gemeinsame Opposition der beiden sozialistischen Parteien gegen ein rein bürgerliches Kabinett.
- Er ist schon deshalb gegen eine Koalition mit der klerikalen Bayerischen Volkspartei - BVP, weil sozialistische Kulturpolitik nur gegen diese Partei zu machen sei.
- Den gleichen Standpunkt vertritt er in Bezug auf die Regierungsbildung in der Nationalversammlung des Reiches.
Er findet für seine politische Auffassung aber nur wenig Zustimmung.
In Bayern will er seine Opposition auf die kraftvolle Mitarbeit der Arbeiterräte stützen, deren weitere Wirksamkeit durch die Verfassung gesichert werden soll.
20. 2 1919 - Die Räte als Träger einer Zweiten Revolution
München * Kurt Eisner spricht in seiner Schlussansprache des Rätekongresses hoffnungsvoll von den Räten als Träger einer Zweiten Revolution: „Sie wird kein Plündern, kein Straßenkampf sein, sie ist die Sammlung der Massen in Stadt und Land, die ausführt, was die erste Revolution begonnen hat. […]
Das bayerische Volk hat sich den Landtag zusammengewählt, wie er nun einmal da ist. Es haben ja auch Kretinenanstalten dazu mitgewirkt! Die Mehrheit, die Bürgerlichen sollen nun bürgerliche Politik treiben. Wir werden sehen, ob sie regierungsfähig sind. Inzwischen sollen die Räte ihr Werk tun, die neue Demokratie aufzubauen.“
21. 2 1919 - Ein elfköpfiger Aktionsausschuss übernimmt die vollziehende Gewalt
München-Kreuzviertel * Ein elfköpfiger Aktionsausschuss übernimmt als Zentralrat der Bayerischen Republik an Stelle des Kabinetts Eisner
- die vollziehende Gewalt,
- ruft einen dreitägigen Generalstreik aus,
- verhängt den Belagerungszustand über München,
- besetzt die Zeitungsredaktionen und
- verfügt eine drei Wochen dauernde Zensur der bürgerlichen Presse.
21. 2 1919 - Viele glauben, dass Erzbischof Faulhaber hinter der Bluttat steht
München-Kreuzviertel * Als Ministerpräsident Kurt Eisner ganz in der Nähe des Erzbischöflichen Palais von Anton Graf von Arco-Valley ermordet wird, glauben viele, dass Erzbischof Faulhaber hinter dieser Bluttat steht. Das umso mehr, als er sich weigert, ein Trauergeläut anzuordnen. Daraufhin stürmen die Revolutionäre die Sakristei der Frauenkirche und lassen die Glocken ertönen.
21. 2 1919 - Die Vorgänge um Kurt Einsers Ermordung
München * Anton Graf von Arco auf Valley schreitet zur Mordtat. Dazu noch einmal Arcos Zimmermädchen Walburga Kästele:
„Am [...] Morgen weckte ich ihn um 7 Uhr, und er stand - entgegen seiner sonstigen Gewohnheit - sofort auf. [...] Er blieb über eine Stunde im Wasser. Als ich ihm etwa um 8 1⁄4 Uhr klopfte, sagte er: Sakrament, jetzt bin ich zu spät dran. [...] Er frug mich noch, ob ich meine, dass es im Gefängnis kalt sei, und befahl mir, ihm einen dicken Anzug herzurichten. Dann frühstückte er.“
21. 2 1919 - Die Kommunisten verlangen die sofortige Ausrufung der Räterepublik
München * Es ist ein ähnliches Machtvakuum entstanden wie am 7. November 1918. Alleine die Räte verfügen noch über ein gewisses Maß an Handlungsfähigkeit. Niemand ist mehr an der Übernahme der Regierung durch die Sozialdemokraten interessiert.
Die Kommunisten um Max Levien verlangen die sofortige Ausrufung der Räterepublik. Verhandlungen mit den Mehrheitssozialisten lehnen sie als Verrat ab. Die Kommunisten sind aber prinzipiell zur Zusammenarbeit mit der USPD bereit. Auch gegen Kurt Eisner haben sie plötzlich nichts mehr einzuwenden und loben - jetzt, wo es freilich zu spät ist - in einem Aufruf an das bayerische Proletariat sein ehrliches und edles Streben, das „Ideal des Sozialismus“ zu verwirklichen.
Ausgerechnet die radikale Linke, die zu seinen Lebzeiten scharf gegen Eisner Stimmung gemacht hat, nimmt jetzt für sich in Anspruch, sein Vermächtnis verwirklichen zu wollen.
21. 2 1919 - Ein Zentralrat der Bayerischen Republik konstituiert sich
München * Aus Vertretern der Mehrheitssozialisten, Unabhängigen Sozialdemokraten, Kommunisten sowie den Vollzugsorganen der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte und dem Revolutionären Arbeiterrat bildet sich ein Zentralrat der Bayerischen Republik. Dieser sogenannte Elfmännerausschuss fungiert als Regierungsgremium, das die Geschäfte so lange kommissarisch führen soll, bis eine endgültige Regelung gefunden wird.
Zum Vorsitzenden des Zentralrats wird Ernst Niekisch, ein junger Volksschullehrer, Vorsitzender der Augsburger Arbeiter- und Soldatenräte und Mitglied des Landesarbeitsrates gewählt. Ernst Niekisch ist zwar Mehrheitssozialdemokrat, gilt aber aufgrund seiner Befürwortung der Räte als Mann des Ausgleichs zwischen den ideologischen Gegensätzen und wird auch von den rechten Sozialdemokraten akzeptiert. Er gilt als die Integrationsfigur, die der Republik über die schwere Zeit hinweghelfen kann.
Neben Ernst Niekisch, Carl Kröplin und Hermann Eisenhut vom Vollzugsrat der Arbeiterräte gehören dem Zentralrat außerdem an:
- Karl Gandorfer, Wolfgang Hofmann und Johann Wutzlhofer vom Vollzugsrat der Bauernräte,
- Fritz Sauber, Engelbert Kohlschmidt und Johann Panzer vom Vollzugsrat der Soldatenräte
- sowie Max Levien und August Hagemeister vom Revolutionären Arbeiterrat.
Dem Zentralrat wird ein erweiterter Aktionsausschuss zur Seite gestellt, um die Fülle der anstehenden Arbeiten zu bewältigen. Dieser wiederum konstituiert verschiedene Kommissionen, die das tägliche Leben regeln sollen. So entstehen Kommissionen
- zur Bewaffnung des Proletariats,
- zur Ernährung,
- zur Lebensmittelversorgung,
- für das Wohnungswesen,
- für das Gerichtswesen,
- für Aufklärungs- und Nachrichtendienste,
- für Heereswesen und
- zur Produktionsregelung.
21. 2 1919 - Der Zentralrat nimmt seine Arbeit auf
München-Kreuzviertel * Gleich nach seiner Ernennung nimmt der Zentralrat seine Arbeit auf.
- Der von der USPD spontan ausgerufene Generalstreik wird bestätigt,
- alle Geschäfte und Vergnügungsstätten werden für drei Tage geschlossen,
- der Zug- und Straßenbahnverkehr wird eingestellt,
- eine nächtliche Ausgangssperre wird erlassen und der Belagerungszustand über München verhängt,
- und damit Raub, Plünderung und Diebstahl unter Todesstrafe gestellt.
21. 2 1919 - Ein Stimmungsumschwung gegenüber der Person Kurt Eisners
München * In der Bevölkerung tritt ein jäher Stimmungsumschwung gegenüber der Person Kurt Eisners ein. Eisner, der noch wenige Tage vor seiner Ermordung bespöttelt und als politisch gescheitert betrachtet wurde, ist nun auf einmal der „Märtyrer der Revolution“.
Die erstaunliche Sympathie und Popularität, die der tote Ministerpräsident trotz aller vorausgegangenen Auseinandersetzungen um seine Person und seine Politik genießt, gründet vor allem darauf, dass man seine Ermordung als reaktionäres Komplott aufgefasst. Dem Toten wird in diesen Tagen als „Integrationsfigur des Proletariats“ eine fast kultische Verehrung entgegengebracht.
Tausende von Münchnern besuchen den Schauplatz des Mordes. Noch an seinem Todestag wird an der Stelle, an der Kurt Eisner tödlich zusammengebrochen ist, ein Totenmal errichtet, in dessen Zentrum ein überlebensgroßes, von einem Trauerkranz gerahmtes und auf einer Gewehrpyramide befestigtes Fotoporträt Kurt Eisners imaginäre Gegenwart symbolisiert. Dieser provisorische Epitaph entwickelt sich zu einem von Soldaten bewachten sakralen Bezirk. Die darin niedergelegten Blumengebinde und Kränze verstärken den Eindruck eines grabähnlichen Erinnerungsmales. Es besteht in dieser Form bis zum April.
In seinem Roman „Wir sind Gefangene“ beschreibt Oskar Maria Graf auch die Ereignisse in der Nähe des Attentatortes: „Alle Menschen liefen mit verstörten Gesichtern stadteinwärts. Je weiter ich kam, desto aufgeregter wurde die dumpfe Hast. Vor dem Landtag ballte sich ein schwarzer Menschenknäuel, Soldaten und bewaffnete Zivilisten waren darunter. Ich stürmte weiter [...] an den Mordplatz. Da hatten sich Hunderte schweigend um die mit Sägspänen bedeckten Blutspuren Eisners zu einem Kreis gestaut.
Fast niemand sagte ein lautes Wort, Frauen weinten leise und auch Männer. Etliche Soldaten traten in die Mitte und errichteten eine Gewehrpyramide. Viele legten Blumen auf den Platz, immer mehr und mehr.“
21. 2 1919 - Der Landtag unterbricht seine Sitzung
München-Kreuzviertel * Pünktlich um 10 Uhr beginnt die Konstituierende Sitzung des Bayerischen Landtags. Nachdem die Nachricht von der Ermordung Kurt Eisners eintrifft, unterbricht der soeben zusammengetretene Landtag seine Sitzung umgehend.
21. 2 1919 - Auch Eisners Mörder wird niedergeschossen
München-Kreuzviertel * Nicht nur Eisner, auch Anton von Arco wird unmittelbar nach seiner Tat von einem Leibwächter Eisners niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Man bringt ihn umgehend in Sicherheit, da die herbeigeeilte Menge damit droht, ihn zu lynchen. Der damalige Direktor der Universitätsklinik Ferdinand Sauerbruch kann ihn erfolgreich operieren.
Die Schüsse von hinten auf Kurt Eisner hat Graf Arco übrigens sein Leben lang geleugnet. Soldaten tragen den toten Ministerpräsidenten ins Portierszimmer des Ministeriums des Äußeren.
21. 2 1919 - Die Öffentlichkeit reagiert politisch desorientiert
München * Die Öffentlichkeit, die das feige Attentat auf Kurt Eisner verabscheut, reagiert politisch desorientiert. Das wirkt sich in einem Zweifel an der Richtigkeit der Wiedereinführung des Parlamentarismus aus und führt zu einer raschen Wiederbelebung der Tätigkeit der Räte. Oskar Maria Graf beschreibt in „Wir sind Gefangene“ die Situation:
„Ich sah Zitternde, ich sah Wutblasse und Blutgierige. Überall wiederholte sich das gleiche Schreien nach Rache. Die Massen kamen ins Treiben, der Strom floss durch die Stadt. Das war anders, ganz anders als am 7. November. Wenn jetzt einer aufgestanden wäre und hätte gerufen: ‚Schlachtet die Bürger! Zündet die Stadt an! Vernichtet alles!‘ es würde geschehen sein.
Die tausend kleinen Stürme hatten sich vereinigt, und ein einziger dumpfer, dunkler, ungewisser Losbruch begann. Ich spürte es an mir am genauesten: Noch nie war ich so völlig Massentrieb gewesen wie jetzt, noch nie war ich so eins mit den Tausenden.
Auf die Theresienwiese jagten die Züge. Unter der Bavaria redeten viele; Toller trug ein Gedicht vor. Die Frauen wurden ergriffen davon, die Männer schrieen nach Waffen. Dann wurde verkündet, im Zeughaus seien sie. Ein dichter Haufen zog dahin ab, ich lief mit dem Zug wieder in die Stadt.
Voran marschierten Matrosen und Soldaten wie zum Sturm. Die roten Fahnen wehten. Die verschlossenen Türen des Deutschen Theaters wurden eingeschlagen, die Scheiben klirrten, es krachte, und alles peitschte in den Saal. ‚Der Arbeiter- und Soldatenrat tagt von heut‘ ab in Permanenz!‘ brüllte ein Matrose.“
21. 2 1919 - Das Attentat auf Erhard Auer (SPD)
München-Kreuzviertel * Als sich der Landtag gegen 11 Uhr wieder versammelt, ergreift Erhard Auer das Wort zu einer Gedenkrede:
„Damen und Herren!
Der provisorische Ministerpräsident Kurt Eisner hat soeben durch Mörderhand den Tod gefunden. [...] Die Tat wurde von ruchloser Hand in feiger Weise verübt [...]. Diese Handlung muss bei jedem anständigen Menschen tiefsten Abscheu hervorrufen. [...] Wir beklagen in dem Ermordeten den Führer der Revolution in Bayern und zugleich den vom reinsten Idealismus und von treuer Sorge für das Proletariat erfüllten Menschen.
Auf diesem Weg kann und darf nicht fortgefahren werden, wenn nicht vollkommene Anarchie eintreten soll. Angesichts dieser wahnsinnigen Mordtat, gegen deren Urheber mit rücksichtsloser Strenge vorgegangen wird, gilt es nunmehr, die Besonnenheit zu wahren und alle Kräfte zusammenzufassen, um die ungeheuere Aufgabe der nächsten Zeit so zu lösen, wie es das Interesse des gesamten bayerischen Volkes erfordert.“
Auer hatte seine Rede gerade beendet, da stürzt ein schnauzbärtiger junger Mann, bekleidet mit einem grauen Mantel und Hut, durch einen Seiteneingang in den Sitzungssaal, läuft direkt auf Auer zu, tituliert ihn mit „Du Lump!“, zieht eine Pistole aus seinem Mantel und drückt zweimal ab. Erhard Auer sinkt - in die Brust getroffen - zu Boden.
Der konservative Abgeordnete Major Paul Ritter von Jahreiß stellt sich dem fliehenden Attentäter in den Weg und wird durch einen Schuss in den Hals tödlich getroffen.
Der Täter ist der im Jahr 1887 in Kelheim geborene Metzger Alois Lindner. Er ist Mitglied in der USPD und im Revolutionären Arbeiterrat. Lindner ist von Auers Schuld an Eisners Ermordung überzeugt.
Inzwischen betreten weitere Mitglieder des Revolutionären Arbeiterrats den Saal. Auch sie glauben an Auers Schuld und fordern „Rache für Eisner!“. Es kommt zu einer wilden Schießerei, bei der einer der Mitbegründer der Bayerischen Volkspartei - BVP, Heinrich Osel, ums Leben kommt. In der allgemeinen Panik fliehen die übrigen Anwesenden.
Auch Lindner gelingt die Flucht. Unterstützt durch Freunde geht er nach Ungarn.
21. 2 1919 - Ministerpräsident Kurt Eisner wird von Anron Graf Arco auf Valley ermordet
München-Kreuzviertel * Kurt Eisner verlässt an diesem föhnigen Vorfrühlingstag, kurz vor zehn Uhr, seinen Amtssitz im Montgelas-Palais und begibt sich von dort zum Landtagsgebäude an der Prannerstraße. In seiner Aktentasche befindet sich sein bereits unterschriebenes Schreiben vom Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Er will dabei jedoch nicht seinen Rückzug aus der Politik signalisieren.
Begleitet wird Eisner von seinem Sekretär Felix Fechenbach und dem Leiter des Ministerpräsidentenbüros, Bruno Merkle. Da Eisner in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Morddrohungen erhalten hatte, gehen zwei bewaffnete Ordonnanzen als Leibwächter voraus. Angesichts der drohenden Gefahr schlagen Eisners Begleiter einen Schleichweg zum Landtag vor. Das lehnt Eisner entschieden ab, denn: „Man kann einen Mordanschlag auf die Dauer nicht ausweichen, und man kann mich ja nur einmal totschießen.“
Kurz nachdem die Gruppe um Eisner in die damalige Promenadenstraße eingebogen ist, pirscht sich Anton Graf von Arco auf Valley an den Ministerpräsidenten heran und schießt ihm aus kürzester Entfernung zweimal in den Hinterkopf. Im Nacken und unter dem rechten Ohr getroffen bricht Kurt Eisner sofort tot zusammen.
21. 2 1919 - MilitärministerAlbert Roßhaupter kommt in Schutzhaft
München-Kreuzviertel * Kultusminister Johannes Hoffmann tritt von seinem Amt zurück. Albert Roßhaupter, der Minister für militärische Angelegenheiten, wird in Schutzhaft genommen.
21. 2 1919 - Verwüstungen und Plünderungen
München * Die Redaktionsräume der Münchner Zeitungen werden besetzt und bereits gedruckte Exemplare in Paketen auf die Straße geworfen. Trotz der Ausgangssperre ab 19 Uhr kommt es in der Nacht zu Plünderungen von Adelspalais in Bogenhausen und Schwabing.
21. 2 1919 - Ein Trauergeläut für den ermordeten Ministerpräsidenten
München * Die Geistlichen werden gezwungen, in den Mittagsstunden der folgenden Tage ein Trauergeläut für den ermordeten Ministerpräsidenten abzuhalten.
21. 2 1919 - Beschäftigte legen die Arbeit nieder und nehmen an Versammlungen teil
München * Infolge verschiedener Aufrufe zum Generalstreik legen viele Beschäftigte die Arbeit nieder und nehmen überall in der Stadt an Versammlungen teil, bei denen Vergeltung für den Mord an Kurt Eisner gefordert wird.
21. 2 1919 - Erscheinen sämtlicher Münchner Zeitungen verhindert
München * Weil der Presse ein bedeutender Anteil an der Hetze gegen Kurt Eisner und damit an seiner Ermordung zugesprochen wird, verhindert man das Erscheinen sämtlicher Münchner Zeitungen mit Ausnahme der Parteiorgane der USPD und des Bayerischen Bauernbundes - BBB.
21. 2 1919 - Der Generalstreik in und um Münster wird beendet
Münster * Die Arbeiter- und Soldatenräte brechen den Generalstreik in und um Münster ab.
21. 2 1919 - Nicht nur Entsetzen, sondern auch Jubel und unverholene Freude
München * Die Ermordung Kurt Eisners löst nicht nur Trauer und Entsetzen aus. Teile des Bürgertums begrüßen die Freveltat. An der Universität muss Professor Wilhelm Röntgen wegen dem Jubel der Studenten absetzen.
21. 2 1919 - Bei der Nachricht applaudiert und getanzt
München-Bogenhausen * Thomas Mann vertraut seinem Tagebuch an: „Die Schulkameraden unserer Jungen haben bei der Nachricht applaudiert und getanzt.“
21. 2 1919 - Gustav Landauer reist nach Krumbach
München - Krumbach * Gustav Landauer reist aus Anlass des ersten Todestages seiner Frau nach Krumbach. Beim Verlassen des Zuges erfährt er von der Ermordung Kurt Eisners.
21. 2 1919 - Ernst Toller reist vom Engadin zurück nach München
Engadin - München * Ernst Toller reist vom Engadin nach München zurück. Auf einer Schweizer Bahnstation erfährt er von der Ermordung Kurt Eisners.
21. 2 1919 - Kurt Eisners letzte Rede
München-Kreuzviertel * Die aufgrund von Kurt Eisners Ermordung nicht mehr gehaltene Rücktrittsrede beginnt mit den Worten: „Meine Herren und verehrte Frauen!“.
In seinem Tätigkeitsbericht führt er zu seiner 105 Tage andauernden Regierungszeit folgendes aus: „[…] Am 8. November kam die revolutionäre Regierung zustande, die heute vor den von ihr versprochenen neuen Landtag tritt. In diesem Augenblick ist es uns ein Bedürfnis, Rechenschaft abzulegen, was wir gewollt, was wir getan.
In einer Zeit der schwersten Erschütterungen, des drohenden Zusammenbruchs übernahmen wir die Regierung und führten sie bis hierher durch Monate aufreibender Arbeit, ernster Gefahr und leidenschaftlicher Erregungen. Wir waren uns bewusst, dass wir die Aufgabe von ungeheuerer Verantwortlichkeit auf uns genommen hatten, trotz der verhängnisvollen Erbschaft eines unter den Flüchen des Volkes zusammengebrochenen Systems das im tiefsten Grunde kranke Leben der Gemeinschaft allmählich der Genesung näherzuführen. Genesung auf dem Wege, dass das Volk in dem es im Aufschwung revolutionärer Kraft zur Selbstbestimmung emporwuchs, mit dem neuen Bewusstsein der eigenen Macht, im Kampf um die Sicherung seiner Freiheit, im Glauben an den endgültigen Sieg der Demokratie und des Sozialismus, durch das Elend der Gegenwart sich in die Zuversicht künftiger Größe rettete.[…].“
Kurt Eisner geht in seiner Abschiedsrede als Ministerpräsident auf die Erfolge in den verschiedenen Ressorts ein. So hebt er seinen Kampf um die „föderative Grundlage unseres deutschen Staatenbundes“ hervor, da „ein großes Staatswesen sich um so reicher und gesünder entfalte, je lebendiger und selbstständiger die einzelnen Glieder sich zu gestalten vermöchten“.
Zu seiner Friedenspolitik führt er aus: „Nur eine Politik der unbedingten Wahrhaftigkeit, der kühnen Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens führt zu jenem Frieden, nach dem die zertretende Menschheit schmachtet“.
Er hebt seine Anstrengungen zur Wiederherstellung der durch den Krieg zertrümmerten „Internationale der Arbeiter“ hervor, denn nur wenn sie erstarkt, ist die Freiheit jeden Volkes verbürgt. In Eisners Redemanuskript liest sich das so: „So fasste ich - wenn mir eine mehr persönliche Zwischenbemerkung gestattet ist - meine Arbeit jüngst in Bern auf, wo ich erreichte, dass die Vertreter aller Völker, Hass und Erbitterung vergessend, für die Erlösung der deutschen und österreichischen Gefangenen sich vereinigten“.
Der Passus zu den „Räten“ ist vergleichsweise kurz gehalten, obwohl sie die Stütze der Eisner‘schen Politik bilden. Er verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, „dass die Räte sich in jenen Grenzen, in denen sie sich bei uns entwickelt haben, als unentbehrlich für die Schaffung einer tätigen Demokratie erweisen werden“.
Ein weiteres von Kurt Eisner angesprochenes Thema ist die „Ernährungslage“. Dabei stellt er fest: „Im allgemeinen sind die Ernährungsverhältnisse nach der Revolution bei uns in Bayern zum mindesten nicht schlechter geworden. Sehr ungünstig ist nach wie vor unsere Versorgung mit Kohlen und sonstigen Rohstoffen“. Dabei stellt er dar, welche Maßnahmen von der Regierung eingeleitet worden sind.
Breit behandelt Eisner das Thema „Demokratisierung“, die auch in der „Gemeinde, Distrikt und Kreis beachtet werden, deren Selbstverwaltung […] durchgeführt werden wird“. Und weiter: „Das Kriegsministerium hat sich nach der Revolution in ein Ministerium für militärische Angelegenheiten, in ein Ministerium zur Liquidierung des Krieges gewandelt. […] Die Demokratisierung der Armee […] wurde durchgeführt. […] Die Änderung der Militärgerichtsordnung war eine wichtige Errungenschaft des neuen Geistes“.
Nun folgt eine Beschreibung über die politischen Umwälzungen und Demokratisierung in der Justizverwaltung und die Einrichtung von Volksgerichten. Auch auf Fragen der Amnestie und Begnadigungen geht Kurt Eisner in seinem Redeentwurf ein. Ein weiterer Punkt seines Tätigkeitsberichts ist die Tätigkeit des Kultusministeriums, das „die Erneuerung des gesamten Volksbildungs- und Erziehungswesen“ vorbereitet hat. Im Verhältnis von „Schule und Kirche“ erklärt er: „Für jede Demokratie kann nur der unantastbare Grundsatz gelten, dass die Dreiheit der Schule zugleich mit der Freiheit der Kirche gesichert werden müsse“. Eisner erklärt die „Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht“ und die „Aufhebung des Zwangs zur Teilnahme am Religionsunterricht“ den Grundsatz, dass „ein Kind gegen den Willen der Erziehungsberechtigten nicht zur Teilnahme am Religionsunterricht oder Gottesdienst angehalten werden dürfe. Das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern wurde durch die Errichtung von Schülerausschüssen und Schülerversammlungen freier gestaltet“. Außerdem erklärt der Ministerpräsident, dass „die Entwürfe des Volksschullehrergesetzes und des Schulbedarfsgesetzes einer gründlichen Durcharbeitung unterzogen wurden“.
Ein weiterer kultureller Bereich sind die staatlichen Theater. Dazu führt Kurt Eisner aus: „Infolge der Revolution kamen die ehemaligen Hoftheater in den Bereich des Kultusministeriums. In dem jetzigen Nationaltheater vollzog sich zugleich die Demokratisierung des gesamten Betriebes“.
Nun folgen Kurt Eisners Ausführungen zur bayerischen Verkehrsverwaltung und der Finanzverwaltung.
Sehr ausführlich geht er auf die Tätigkeit des am 14. November 1918 neu geschaffenen Ministeriums für soziale Fürsorge ein. Er hebt dabei hervor, „die Schaffung neuer Referate, um die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter und Arbeiterinnen mit allen staatlichen Mitteln wahrzunehmen. Es wurde ein Referat für Arbeitsrecht geschaffen, für Angestelltenfragen, für Beamtenfragen usw..
Die Einrichtungen der Erwerbslosenfürsorge, Arbeitsvermittlung und im Wohnungswesen wurden ausgebaut und durchgeführt, soweit es unter den bestehenden Verhältnissen möglich war. Leider konnten in dieser kurzen, unruhigen Zeit nicht alle Pläne, die das Ministerium entworfen hatte, befriedigend ausgeführt werden.
Der Gewerbeaufsicht, dem Gesundheitswesen, den Kriegsbeschädigten wandte das Ministerium seine größte Aufmerksamkeit zu. Es sind auch hier Erfolge zu verzeichnen, doch nicht in so großem Maße, wie es im Interesse der leidenden Volksgenossen unbedingt notwendig gewesen wäre. Für die Parias [= jemand, der unterprivilegiert, von der Gesellschaft ausgestoßen ist] unter dem arbeitenden Volk, für die sogenannten Dienstboten, wurde ein neues Recht geschaffen. Ein Landarbeiterrecht ist in Ausarbeitung, wobei alle beteiligten Kreise der Landwirtschaft mitarbeiten.
Der Kleinwohnungsbau, das Siedlungswesen wurden in weitgehendem Maße gefördert. Notstandsarbeiten wurden angeregt und Zuschüsse wurden zur Verfügung gestellt, um Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, denn das Problem der Arbeitslosen kann nur durch Arbeitsbeschaffung gelöst werden.
Die sozialpolitische wichtigste Tat des Ministeriums war die Proklamierung des Achtstundentages, die von der Erkenntnis ausging, das die rationelle Verkürzung der Arbeitszeit der Ausgangspunkt aller sozialpolitischen Maßnahmen, die auf die physische, geistige und moralische Hebung der Arbeiterklasse abzielen, sein muss.
Für Erwerbslosenunterstützung wurden im Dezember rund zwei Millionen, im Januar rund zehn Millionen verausgabt. Zur Deckung der Kosten der Notstandsarbeiten wurde dem Haushalt des Ministeriums die Summe von zwölf Millionen Mark bewilligt und für überschreitbar erklärt. Nach den bisher eingelaufenen Meldungen wurden im ganzen rund zwei Millionen Mark Reichszuschüsse und eine Million Staatszuschüsse zugesichert“. Soweit seine Ausführungen zum Sozialministerium.
Kurt Eisners Rede, die er aufgrund seiner Ermordung nicht mehr im bayerischen Landtag vortragen könnte, endet mit den Worten: „Die revolutionäre Regierung hat einstimmig beschlossen, ihre Ämter dem auf dem revolutionären Wahlrecht beruhenden Landtag zur Verfügung zu stellen. Sie ist zugleich bereit, die Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung weiterzuführen.
Um die Neubildung zu beschleunigen, wird die Regierung unverzüglich dem Landtag den Entwurf eines vorläufigen Staatsgrundgesetzes zur Beratung und Beschlussfassung zugehen lassen, das bis zur Vollendung der Verfassung die Grundlage für die Arbeiten des Parlaments und der Regierung bieten soll.
Ein Entwurf der Verfassung selbst ist gleichfalls fertig gestellt; wir wollen ihn noch als Vermächtnis unserer demokratischen und sozialistischen Gesinnung der Öffentlichkeit übergeben, bevor die bisherige revolutionäre Regierung von dem Werk zurück tritt, über das das letzte Urteile die Geschichte fällen wird.“
21. 2 1919 - Josef Hofmiller: Kurt Eisner war Opfer der eigenen Politik
München-Haidhausen * Josef Hofmiller, nationalkonservativ gesinnter Gymnasiallehrer und Verfasser von Essays und Literaturkritiken, dazu Herausgeber der reaktionären Zeitschrift Süddeutsche Monatshefte, betrachtet Kurt Eisner in seinem Revolutionstagebuch als Opfer der eigenen Politik:
„Eisner forderte durch sein ganzes Verhalten zu seiner gewaltsamen Entfernung heraus. Er erklärte bei jeder Gelegenheit, dass es ihm nicht einfalle, als Ministerpräsident zu gehen. Er hätte sicher noch die schwerste Opposition gemacht. Es war nicht möglich, mit ihm zu regieren; es wäre vermutlich nicht möglich gewesen, ohne ihn zu regieren, da er einen zwar kleinen, aber zu allem entschlossenen Anhang hinter sich hatte. Unzweckmäßig scheint mir, dass man ihn nicht früher beseitigte, und zwar auf vollkommen harmlose Weise. Der gegebene Augenblick wäre gewesen, als er von der Schweiz zurückkehrte. […]
Man hätte ihn z. B. zwischen Füssen und Murnau in irgendeine Jagdhütte des Ammergebirges bringen können, von ihm Verzicht auf sein Amt verlangen, ihn sodann über die Grenze schaffen, ihm seine Papiere usw. abnehmen. Inzwischen wären acht bis vierzehn Tage vergangen, der Landtag wäre eröffnet worden, und der Unruhestifter wäre ohne Blutvergießen erledigt gewesen. So wird sein gewaltsamer Tod einen Bürgerkrieg zur Folge haben. Aber wäre dieser Bürgerkrieg nicht sowieso gekommen? Die Auseinandersetzung mit den Räten ist unvermeidlich. Es fragt sich jetzt nur, wer die Macht hat. Wer sie am Schluss haben wird, ist mir nicht zweifelhaft.
Aber einstweilen kann es immerhin ein heftiges Durcheinander geben. Ich bedaure, dass wir heute nicht im ‚Union‘ zusammenkommen können, nachdem ich schon vor acht Tagen nicht dort war. […] Ich habe den Tod Eisners vorausgesehen und vorausgesagt.“
22. 2 1919 - Geiseln werden in Schutzhaft genommen
München-Kreuzviertel * Um weiteren konterrevolutionären Attentaten vorzubeugen beschließt der Zentralrat Geiseln in Schutzhaft zu nehmen. Diese werden weitgehend zufällig aus Kreisen des Bürgertums und der Offiziere auswählt und in das Hotel Bayerischer Hof gebracht.
22. 2 1919 - Der Zentralrat wird erweitert
München-Kreuzviertel * Der Zentralrat wird durch die Aufnahme des Mehrheitssozialisten Karl Schmidt und des Gewerkschaftssekretärs Albert Schmid erweitert.
22. 2 1919 - Bewaffnete Kommunisten besetzen das Leo-Haus
München-Isarvorstadt * Bewaffnete Kommunisten besetzen am Vormittag die Hauptstelle der Katholisch-sozialen Vereine und die dazugehörige Druckerei im Leo-Haus an der Pestalozzistraße.
22. 2 1919 - Ein Nachrichtenblatt des Zentralrats erscheint
München * Der Zentralrat verbietet die gesamte Presse mit Ausnahme des USPD-Organs Neue Zeitung. Am 22. Februar erscheint neben der Neuen Zeitung, dem Bauernbund-Blatt Neue freie Volks-Zeitung nur das Nachrichtenblatt des Zentralrats.
Es wird in den vom Militär besetzten Räumen der Münchner Neuesten Nachrichten gefertigt und den Abonnenten der Münchner Neuesten Nachrichten, der Münchener Zeitung, der München-Augsburger Abendzeitung und des Bayerischen Kuriers zugestellt.
Die Redakteure, Setzer und Drucker der Münchener Post lehnen es ab, die Zeitung unter Vorzensur erscheinen zu lassen. Das Nachrichtenblatt des Zentralrats wird die erste und einzige Ausgabe bleiben.
Nach dem 22. 2 1919 - Bisherige Minister führen ihre Ressorts weiter
München-Kreuzviertel * Die bisherigen Minister Dr. Edgar Jaffé, Hans Unterleitner und Heinrich Ritter von Frauendorfer richten an den Zentralrat des Volksstaates Bayern das nachstehende Schreiben:
- „Die Unterzeichneten haben im Interesse des Landes seit dem 21. Februar 1919 die laufenden Geschäfte ihres Ressorts weitergeführt und sind auch bereit, dies fürderhin zu tun, bis eine neue Regierung gebildet ist.
- Sie erklären ausdrücklich, dass sie lediglich verantwortlich sind für die von Ihnen innerhalb ihres Verwaltungsbereiches getroffenen Maßnahmen.
- Sie stellen fest, dass sie die allgemeine Führung der Regierungsgeschäfte und für die Maßnahmen des Zentralrats keinerlei Mitverantwortlichkeit tragen, insbesondere auch nicht die Festnahme und Einbehaltung von Geiseln, sowie für die gegenüber der Presse getroffenen Maßnahmen.“
22. 2 1919 - Gespräche zur Überwindung der Spaltung der Linken
München * Ernst Niekisch strebt die Wiederannäherung von USPD und SPD an, weshalb drei Mitglieder des Zentralrats - Niekisch, Sauber und Gandorfer - versuchen, durch Gespräche mit Delegierten der Münchner Ortsgruppen von SPD, USPD und Freien Gewerkschaften die Spaltung der Linken zu überwinden und eine sozialistische Einheitsfront zu begründen.
Die sechs Verhandlungsführer bezeichnen sich als „Kommission zur Wiederherstellung der Einheit der sozialdemokratischen Parteien“. Sie erarbeiteten eine Vereinbarung als Grundlage für Verhandlungen unter den von ihnen vertretenen Interessengruppen.
- In der Präambel wird jeder politische Mord verurteilt, „gleich, von welcher Seite er verübt wird“,
- und ein Programm sozialistischer Einheit aufgestellt, das die Sicherung der Erfolge der Revolution gewährleisten und einen Bruder- und Bürgerkrieg vermeiden soll.
- Artikel 1 sieht vor, dass die Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte in der Bayerischen Verfassung anerkannt und verankert werden. Rätemitglieder sollen in Ausübung ihres Amtes Immunität genießen. Außerdem sollen sie den Ministerien beratend zur Seite stehen.
- Nach Artikel 2 sollen die im Amt verbliebenen Minister ihre Stellung behalten und mit anderen Parteigenossen ein sozialistisches Ministerium bilden, dem ein Mitglied es Bayerischen Bauernbundes als Landwirtschaftsminister beitreten soll.
- Artikel 3 lautet: „Der am 12. Januar rechtmäßig gewählte Landtag wird, sowie es die Verhältnisse gestatten, wieder einberufen werden.“
- Gemäß Artikel 4 soll das stehende Heer sofort aufgelöst und durch eine republikanische Schutzwehr, die aus Mitgliedern der Freien Gewerkschaften, des Bauernbundes und der organisierten Landarbeiterschaft besteht, ersetzt werden.
- Nach Artikel 5 wird die Freiheit der Presse grundsätzlich wiederhergestellt, doch werden gleichzeitig - „bis zur Rückkehr geordneter Verhältnisse“ - erhebliche Einschränkungen der Pressefreiheit gefordert.
Wie vorauszusehen war, geben die SPD-Führung und die Freien Gewerkschaften der Vereinbarung unverzüglich ihre Zustimmung.
Anders die Münchner Räte. Sie zeigten sich über die hinter ihrem Rücken stattfindenden Gespräche empört. Eine zur Beratung des Programms einberufene Versammlung löste sich wegen des dritten Artikels in einem Tumult auf. Die Münchner Räte drohen unverhohlen, dass sie einem Zentralrat, der bereit ist, den Landtag anzuerkennen, die Bestätigung verweigern will.
Damit besteht die geforderte und so hoch gelobte Einheitsfront nur noch auf dem Papier. Ernst Niekisch ist jetzt zwar quasi Regierungschef in Bayern. Doch den im Umbruch befindlichen Staat zu lenken, ist alles andere als einfach. Als zentrale Frage bleibt: Welches Regierungssystem - Parlamentarismus oder Räterepublik - soll künftig in Bayern herrschen?
22. 2 1919 - Gustav Landauer trifft wieder in München ein
Krumbach - München * Weil der Verkehr nach München gesperrt ist, kann Gustav Landauer erst am 22. Februar wieder nach München zurückreisen.
22. 2 1919 - Sofortige Ausrufung einer sozialistischen Räterepublik beschlossen
München * Arnold Wadler bringt im Namen des Revolutionären Arbeiterrats auf einer Versammlung von Münchner Räten, den Antrag zur „sofortigen Ausrufung der sozialistischen Räterepublik“. Der Antrag wird - nach einer kontroversen Debatte - einstimmig angenommen.
23. 2 1919 - Arbeiter können unter bestimmten Umständen eine Waffe erhalten
München-Theresienwiese * Auf der Theresienwiese versammeln sich gegen 13 Uhr mehrere Tausend Personen. Hier können freigewerkschaftlich organisierte oder einer sozialistischen Partei zugehörige Arbeiter eine Waffe erhalten, wenn sie mindestens 20 Jahre alt und an der Waffe ausgebildet sind. Ob und in welcher Anzahl Waffen ausgegeben wurden, ist unklar.
Gegen 16 Uhr formiert sich ein Demonstrationszug zur Innenstadt, der sich am Schiller-Denkmal auflöst.
23. 2 1919 - Der Generalstreik wird beendet
München * Der Zentralrat gibt bekannt, dass der Generalstreik sein Ziel erreicht hat. Die Arbeiter werden aufgefordert, am nächsten Tag [Montag] wieder an ihren Arbeitsstellen zu erscheinen.
23. 2 1919 - Der Bergarbeiterkongress beschließt Generalstreik
Halle * Der Bergarbeiterkongress beschließt in Halle den Generalstreik.
23. 2 1919 - Thomas Mann besucht die Ermordungsstelle Kurt Eisners
München-Kreuzviertel * Thomas Mann besucht den Ort an der Kurt Eisner ermordet wurde und schreibt darüber: „An der Straßenstelle, wo Eisner fiel, liegt ein Kranz mit seinem Bild, und ein Häufchen blutigen Straßenschmutzes ist zusammengekehrt.“
23. 2 1919 - Die sofortige Einberufung des Rätekongresses
München * Die Neue Zeitung teilt mit, dass der Zentralrat die sofortige Einberufung des Rätekongresses beschlossen hat.
23. 2 1919 - Bei der Berliner Stadtverordnetenwahl erringt die USPD 33 Prozent
Berlin * Bei der Berliner Stadtverordnetenwahl erringt die USPD 33 Prozent der Mandate. Der SPD laufen die Wähler davon.
23. 2 1919 - Die lokalen Räte sollen die Pressezensur vornehmen
München - Freistaat Bayern * Der Zentralrat fordert in Telegrammen die lokalen Räte außerhalb Münchens auf, bis auf weiteres die Zensur über die Presse auszuüben. Ausgenommen davon sind nur die sozialistischen und bauernbündlerischen Blätter.
23. 2 1919 - Tausende kondolieren Kurt Eisner am Ostfriedhof
München-Obergiesing * Der Leichnam von Kurt Eisner ist im Leichenschauhaus im Ostfriedhof aufgebahrt. Tausende Münchner kondolieren dem Verstorbenen.
23. 2 1919 - Die Ängste des Erzbischofs von München und Freising
München-Kreuzviertel * Erzbischof Michael von Faulhaber schreibt in sein Tagebuch: „Mich drückt eine böse Ahnung schwer nieder - Gott stehe uns bei. Man schreckt zusammen, wenn irgend ein Lärm an Schüsse erinnert, sogar das Teppichklopfen und das Zuwerfen der Türen.“
23. 2 1919 - Ein revolutionärer Arbeiterrat regiert in Bad Aibling
Bad Aibling * Ein revolutionärer Arbeiterrat wird in Bad Aibling zusammengesetzt.
24. 2 1919 - Paul Ritter von Jahreiß und Heinrich Osel werden beigesetzt
München-Schwabing - Pasing * Paul Ritter von Jahreiß und Heinrich Osel, die beim Attentat im Landtag erschossen worden waren, werden im Nordfriedhof beziehungsweise im Neuen Pasinger Friedhof beerdigt.
24. 2 1919 - Der Studentenausschuss verabscheut die politischen Morde
München * Der Studentenausschuss spricht „seine Entrüstung und den tiefsten Abscheu über die politischen Morde“ aus.
24. 2 1919 - Die Streiks im Bezirk Halle beginnen
Halle * Im Bezirk Halle, in Sachsen, Thüringen und Anhalt beginnen Streikmaßnahmen.
24. 2 1919 - Erich Mühsam wieder zurück in München
Baden - München * Erich Mühsam kommt aufgrund der schwierigen Verkehrsverbindungen erst jetzt wieder in München an, obwohl er am 21. Februar von der Ermordung Kurt Eisners erfahren hatte.
24. 2 1919 - Die Münchener Post erscheint wieder
München * Die Münchener Post erscheint als erste Münchner Zeitung seit dem Erscheinungsverbot.
25. 2 1919 - Alle bürgerlichen Zeitungen können wieder erscheinen
München * Alle bürgerlichen Zeitungen können wieder erscheinen, allerdings bis zum 15. März unter einer - mäßig strengen - Vorzensur. In den Münchner Neuesten Nachrichten, der Münchener Zeitung und der München-Augsburger Abendzeitung wird an prominenter Stelle ein vom Zentralrat vorformulierter Artikel veröffentlicht, der sich „gegen jede Reichseinmischung in bayerische Verhältnisse“ verwahrt.
25. 2 1919 - Die unterschiedlichen Standpunkte der Parteien
München * Bereits am ersten Tag fordert Max Levien als Delegierter des Revolutionären Arbeiterrats
- die sofortige Ausrufung der Räterepublik,
- die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur UdSSR,
- die Versendung wahrheitsgetreuer Flugblätter in fremden Sprachen,
- die Entfernung der Republikanischen Schutztruppe,
- die Bildung einer Roten Armee sowie
- die Annullierung der Staatsschulden und Kriegsanleihen.
Unterstützt wird Levien von dem Matrosen Rudolf Egelhofer, der von der „permanenten Proletarierversammlung“ im Wagnersaal abgesandt wurde, an der mehr als 5.000 Menschen teilnehmen.
Auch der Anarchist Erich Mühsam schließt sich dieser Forderung an. Er ist der Überzeugung, dass der Ausgang des Kongresses der bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte von entscheidender Bedeutung für den künftigen Verlauf der Weltrevolution ist.
In den weiteren Beratungen kristallisieren sich die unterschiedlichen Standpunkte der Parteien heraus.
- Die SPD-Delegierten sprechen sich gegen eine Räterepublik aus, setzen sich aber - anders als die Genossen um Erhard Auer - für die Verankerung der Räte in der Verfassung ein.
- Die KPD fordert dagegen die Regierung der Volksbeauftragten und eine Räterepublik.
25. 2 1919 - Der Kongress der bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte tagt
München-Kreuzviertel * Vor dem schwarz und rot umflorten Bildnis Kurt Eisners und unter teils chaotischen Verhältnissen tagen die Delegierten der bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte bis zum 8. März 1919 im Münchner Landtagsgebäude.
Radikale linke Gruppierungen, die im Plenum klar in der Minderheit sind, versuchen durch Versammlungen und Demonstrationen sowie durch massive Störungen von den Tribünenplätzen aus die Entscheidungen der Delegierten zu beeinflussen.
Am Rätekongress nimmt Johannes Hoffmann nicht teil, weil er sich gegen eine mögliche Räteregierung stellt. Im Gegenzug lehnt der Rätekongress Hoffmann als neuen Kultusminister ab.
25. 2 1919 - Rektor und Uni-Senat verurteilen die Freveltat
München-Maxvorstadt * Der Rektor und der Senat der Münchner Universität sprechen ihre „rückhaltlose Verurteilung der Freveltat“ vom 21. Februar aus.
25. 2 1919 - Die Presse als eigentliche Mörderin Kurt Eisners bezeichnet
München * Die Presse wird von Carl Kröpelin in seinem Redebeitrag am Rätekongress als „die eigentliche Mörderin an Kurt Eisner“ bezeichnet.
26. 2 1919 - 100.000 Menschen nehmen an Kurt Eisners Bestattungsfeierlichkeiten teil
München-Giesing * Zeugten schon die Geschehnisse am Ort des Attentats von breiter Betroffenheit über Kurt Eisners Tod, so wird sein Begräbnis zu einer außergewöhnlichen Trauerbekundung der Bevölkerung.
Der Zentralrat ordnet für ganz Bayern Landestrauer an. Die öffentlichen Gebäude sind auf Halbmast schwarz und rot beflaggt. Die Arbeit ruht. Annähernd 100.000 Menschen nehmen an den Bestattungsfeierlichkeiten teil.
Ab 9 Uhr bewegt sich der Trauerzug - begleitet von 20 Musikkapellen - von der Theresienwiese zum Ostfriedhof. Matrosen tragen den mit schwarzen Tüchern verhüllten Sarg. Um 10 Uhr beginnt ein halbstündiges Glockengeläut. Die Trauerfeier mit der Einäscherung in der Halle des Krematoriums beginnt um 10:30 Uhr. Sie dauert bis 11:40 Uhr.
Gustav Landauer hält eine Gedächtnisrede, in der er ausführt: „Kurt Eisner, der Jude, war ein Prophet, der unbarmherzig mit den kleinmütigen, erbärmlichen Menschen gerungen hat, weil er die Menschheit liebte und an sie glaubte und sie wollte. Er war ein Prophet, weil er mit den Armen und getretenen fühlte und die Möglichkeit, die Notwendigkeit schaute, der Not und Knechtung ein Ende zu machen. Er war ein Prophet, weil er ein Erkennender war, dieser Dichter, der zugleich von der Schönheit, die kommen sollte, träumte und den harten, bösen Tatsachen unerschrocken ins Gesicht sah.
Er war ein Prophet, und er wurde so zum Satiriker und zum Geißler der Verlogenheit und Verkleisterung, wie er sie zumal bei seinen Kollegen von der Presse fand, er war ein unermüdlicher, trockener Erforscher der Wirklichkeit. So war er, der Schauend-Gestaltend-Erkennende, auch ein Prophet in dem Sinne, dass er die Zukunft voraus sah. Er wollte mit den Menschen gehen, er wollte auf die Menschen wirken, aber nichts lag ihm ferner als Herrschaft oder unterdrückende Überlegenheit.“
Selbst die bürgerliche Presse ist beeindruckt und schreibt: „In ihrer reichen Geschichte hat die bayerische Hauptstadt wohl viele prunkvolle Leichenzüge zu verzeichnen, aber keinen, der, was Massenentfaltung anlangt, denjenigen übertrifft, der am Vorfrühlingstage des 26. Februar halb München in Bewegung setzte.“
26. 2 1919 - Bewaffnete Aktivisten stürmen das Erzbischöfliche Palais
München-Obergiesing - München-Kreuzviertel * Während der Beisetzungsfeierlichkeiten für Kurt Eisner am Ostfriedhof stürmen sechs mit Gewehren bewaffnete Aktivisten das Erzbischöfliche Palais und hängen zwei Trauerfahnen zu den Fenstern hinaus.
26. 2 1919 - Faulhaber: Warum wird Eisner wie ein König begraben?
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber schreibt zu Kurt Eisners Beerdigung in sein Tagebuch: „Wenn die Monarchie abgeschafft, warum wird Eisner doch wieder wie ein König begraben, während Osel und die anderen einfach zugeschaufelt werden, ist das Demokratie?“
Zu Gustav Landauers Satz seiner Trauerrede an Kurt Eisners Grab: „Er war einer wie Jesus und Hus, […] die von der Dummheit und dem Eigennutz hingerichtet wurden“, schreibt Faulhaber in sein Tagebuch, Eisner „war ein Teil von jener Kraft, die Jesus gekreuzigt hat, nicht aber von Jesus selber“.
26. 2 1919 - Das Erzbischöfliche Palais wird gestürmt
München-Kreuzviertel * Um 11 Uhr stürmen sechs Männer, darunter vier Soldaten mit Gewehr das Erzbischöfliche Palais und stellen die Frage: „Warum ist da nicht beflaggt?“ Erzbischof Michael von Faulhaber schreibt:
„Die Soldaten standen mit Gewehr am Fenster, so daß die Menge auf der Straße den Terror sah. Besonders ein junger Zivilist benahm sich sehr frech: Schleifen am Parkettboden, macht sich am Altar und Altarstein zu schaffen, schimpft über die leer stehenden schönen Räume. Andere Leute hätten keine Wohnung. […] Bis der Sekretär von mir heimkam, flatterten bereits die zwei Fahnen“.
27. 2 1919 - Versammlungen und Ansammlungen jeder Art verboten
München * Zum Schutze der Räterepublik wird verfügt, dass Versammlungen und Ansammlungen jeder Art verboten sind. Ab 19 Uhr müssen alle Nichtdiensttuenden und Zivilisten die Straßen verlassen haben. Die vom Stadtkommandanten Oskar Dürr und vom Polizeipräsidenten Josef Staimer unterzeichnete Anordnung wird in der Bayerischen Staatszeitung veröffentlicht.
27. 2 1919 - Das Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr
Weimar * Die in Weimar tagende Nationalversammlung beschließt das Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr mit deutlicher Reduzierung des Heeres von 800.000 auf 100.000 Mann. Die Reichswehr soll künftig aus bestehenden Freiwilligenverbänden und durch die Anwerbung von Freiwilligen gebildet werden.
Viele der aus dem Heer entlassenen Frontsoldaten schließen sich daraufhin paramilitärischen, oftmals rechtsradikalen Organisationen an.
27. 2 1919 - 76 Nicht-delegierte beteiligen sich an Abstimmungen
München * Am Rätekongress wird festgestellt, dass 76 Personen an den Beratungen teilnehmen, die nicht delegiert sind. Sie werden vom Kongress ausgeschlossen. Man beschließt, am nächsten Rätekongress die Zahl der Delegierten auf 250 zu begrenzen.
28. 2 1919 - Alle Schusswaffen bis zum 3. März abgegeben werden
München * Laut einer Anordnung der Polizeidirektion müssen alle Schusswaffen bis zum 3. März abgegeben werden.
28. 2 1919 - Demonstrationszüge zur Befreiung der Inhaftierten
München * Im Wagnersaal und im Mathäserbräu tagen die Unabhängigen Sozialdemokraten beziehungsweise die Kommunisten, als die Nachrichten über die Verhaftungen im Landtagsgebäude eintreffen.
Spontan bilden sich Demonstrationszüge zur Befreiung der Inhaftierten. Von der Türkenkaserne schließt sich ihnen eine Abordnung des Leibregiments an. Der inzwischen vereinigte Demonstrationszug bewegt sich zum Landtagsgebäude in der Prannerstraße, wo die inzwischen befreiten Gefangenen zur Menge sprechen und sich die Demonstration daraufhin unter Hochrufen auf die Räte auflöst.
28. 2 1919 - Verhaftungen aus dem Sitzungssaal heraus
München-Kreuzviertel * Noch vor der Abstimmung werden die Delegierten Max Levien, Erich Mühsam, Gustav Landauer, Franz Michael Cronauer und Wilhelm Reichart von der SPD-nahen und von Innenminister Erhard Auer errichteten Republikanischen Schutztruppe aus dem Sitzungssaal heraus verhaftet.
Ernst Niekisch versucht verzweifelt Herr der Lage zu bleiben und erreicht, dass die Verhafteten wenige Minuten später wieder freigelassen werden. Die Verantwortung für die unübersichtliche Situation übernimmt schließlich der Stadtkommandant Oskar Dürr und der Polizeipräsident Josef Staimer.
28. 2 1919 - Die Sperrstunde wird auf 22 Uhr festgesetzt
München * In Theatern, Kinos und Konzertsälen dürfen wieder Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Sperrstunde wird auf 22 Uhr festgesetzt. Ab 23 Uhr werden die Straßen vom Militär geräumt.
28. 2 1919 - Ein umfangreicher Kompromissantrag wird beraten
München-Kreuzviertel * Am Nachmittag beraten die Delegierten der bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte im Münchner Landtagsgebäude an der Prannerstraße einen Kompromissantrag. Darin wird festgelegt, dass der Kongress der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte den Provisorischen Nationalrat darstellt.
- In den nächsten Tagen sollen 250 Delegierte gewählt werden, die diesem Provisorischen Nationalrat künftig angehören.
- Im Anschluss daran soll ein Aktionsausschuss gewählt werden, der sich aus je sieben Mitgliedern der Vollzugsausschüsse der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, je drei Vertretern von SPD, USPD, Revolutionärem Arbeiterrat und Bayerischem Bauernbund - BBB zusammensetzt.
- Die Mitglieder des Aktionsausschusses können jederzeit vom Provisorischen Nationalrat abgesetzt werden.
- Der Aktionsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Zentralrat, dessen Mitglieder dem Aktionsausschuss verantwortlich sind.
- Außerdem soll in absehbarer Zeit das Staatsgrundgesetz vom 4. Januar 1919 zur Volksabstimmung vorgelegt werden.
- Das Staatsgrundgesetz soll zuvor aber noch in einigen Punkten abgeändert werden, in dem die Räte das Recht zur Gesetzesinitiative und ein Vetorecht gegen Parlamentsbeschlüsse festgeschrieben erhalten.
- Bei Streitigkeiten hat das Volk das letzte Wort und entscheidet per Volksentscheid.
Hans Unterleitner wirbt mit großem Engagement für den Kompromiss: „Die zweite Revolution ist eine Tatsache. Nun handelt es sich darum, sich klar zu sein, was die zweite Revolution will. [...] Wir haben die politische Macht erobert und lassen sie uns nicht mehr nehmen“.
- In seinen Ausführungen stellt er fest, dass die Beratungen mit den Bauernvertretern gezeigt haben, dass die Bauern einer Räterepublik jegliche Unterstützung verweigern.
- Ohne die Bauern kann jedoch so ein Experiment unmöglich funktionieren: „Wir dürfen die Augen vor der Tatsache nicht verschließen, in Deutschland und in Bayern liegen eben die Verhältnisse anders wie in Russland“.
28. 2 1919 - 304 Delegierte stimmen namentlich ab
München * Bei der namentlichen Abstimmung am Rätekongress nehmen 304 Delegierte teil. Da sind die 76 Nichtberechtigten vom Vortag bereits ausgeschossen.
28. 2 1919 - Der Zentralrat äußert sich zum Eisner-Attentat
München - Freistaat Bayern * In den Münchner Neuesten Nachrichten erscheint eine Proklamation, in der der Zentralrat über die Vorkommnisse nach dem Attentat schreibt:
„Der Schuss, der Kurt Eisner tötete und mit ihm die Revolution vernichten sollte, [musste] das Signal zur Sicherung und Fortführung von Eisners Werk sein. Die Arbeiterschaft aller Richtungen war geschlossen, die gesamte Garnison Münchens stellte sich ihr zur Seite“.
Doch das ist reines Wunschdenken.
28. 2 1919 - Der Antrag auf Ausrufung einer Räterepublik wird abgelehnt
München * Nun kann abgestimmt werden. Erich Mühsams Antrag auf Ausrufung einer Räterepublik wird mit 234 zu 70 Stimmen abgelehnt. Dafür einigen sich die Rätevertreter auf den vorgelegten Kompromissantrag.
1. 3 1919 - Der Rätekongress wählt einen Aktionsausschuss
München-Kreuzviertel - München-Theresienwiese * Der Rätekongress wählt einen Aktionsausschuss. Noch während der Sitzung kommt es auf der Theresienwiese zu einer Demonstration gegen die Verhaftungen vom Vortag und für die Proklamation der Räterepublik. Die daraufhin aufmarschierende Republikanische Schutztruppe schießt wahllos in die Menge, tötet drei Menschen und verletzt neun schwer.
Die Nachricht wird im Rätekongress mit einer Mischung aus Erleichterung und Abscheu aufgenommen. Die Radikalen sehen darin den völligen „Bankrott der Sozialdemokratie“. Für sie erklärte der Anarchist Gustav Landauer: „In der ganzen Naturgeschichte kenne ich kein ekelhafteres Lebewesen als die Sozialdemokratische Partei.“
1. 3 1919 - Eine von Martin Segitz (SPD) geführte Regierung wird gebildet
München-Kreuzviertel * Nachdem am Tag zuvor beschlossen worden ist, dass die Einberufung des Landtags auf unbestimmte Zeit verschoben wird, bestimmt der Rätekongress am Nachmittag des 1. März die neuen Minister.
- Der gemäßigte [!] Mehrheitssozialdemokrat Martin Segitz wird Ministerpräsident und leitet zudem noch das Außen- und Innenministerium,
- Ernst Niekisch [SPD] ist zuständig für Unterricht und Kultus,
- Fritz Endres [SPD] für Justiz,
- Richard Scheid [SPD] für militärische Angelegenheiten,
- Joseph Simon [USPD] für Handel, Gewerbe und Industrie,
- Edgar Jaffé [USPD] für Finanzen,
- Hans Unterleitner [USPD] für soziale Angelegenheiten und
- Theodor Dirr [BBB] für Land- und Forstwirtschaft.
- Der parteilose Heinrich von Frauendorfer übernimmt das Verkehrsministerium.
Nun müssen nur noch die betroffenen politischen Parteien ihren Mitgliedern die Annahme des Ministeramtes gestatten.
1. 3 1919 - Die Münchner Garnison stellte sich hinter den Stadtkommandanten Dürr
München * Sämtliche Münchner Truppenteile sprechen in einer Entschließung dem Stadtkommandanten Oskar Dürr, dem die Abteilung der Republikanischen Schutztruppe untersteht, die auf der Theresienwiese das Blutbad mit drei Toten hinterlassen hat, das Vertrauen aus. Sie fordern
- die sofortige Einsetzung eines rein sozialistischen Ministeriums unter Ausschaltung der Kommunisten und Spartakisten,
- die Bewaffnung der Arbeiterschaft und
- eine Vernünftige Pressezensur, die jede Partei zu Wort kommen lässt.
1. 3 1919 - Flugblätter flattern über München vom Himmel
München * Flugzeuge werfen über München Flugblätter ab. Die von Ernst Schneppenhorst und Hermann Ewinger für das Kommando des III. Armeekorps unterzeichneten Aufrufe fordern im Namen der Arbeiter und Soldaten von Amberg, Bayreuth, Sulzbach, Regensburg, Straubing, Erlangen, Ingolstadt, Grafenwöhr, Nürnberg und Fürth auf, sich gegen eine Diktatur der Kommunisten und Dr. Max Levien zu wenden.
1. 3 1919 - Überdruckte Briefmarken
München * In den Postämtern kommen Briefmarken des Freistaats Bayern zur Ausgabe. Es sind Marken der letzten Ausgabe mit dem Königsbild, das schwarz mit Volksstaat Bayern überdruckt sind.
1. 3 1919 - Thomas Mann notiert über die Räterrepublik
München * Thomas Mann notiert in sein Tagebuch: „Die politische Lage scheint einigermaßen entspannt. Ein Kompromiss, gegen das Geschrei der Kommunisten, ist geschlossen, die Räte-Republik abgelehnt.“
2. 3 1919 - Die Münchner Kasernenräte stellen sich hinter die neugewählte Regierung
München * In einer Erklärung geben die Münchner Kasernenräte bekannt, dass sie sich hinter die neugewählte Regierung stellen wollen.
2. 3 1919 - Im Münchener Tagblatt erscheint das Vorläufige bayerische Grundgesetz
München * Das Münchener Tagblatt veröffentlicht das vom 20. Februar datierte und noch von Kurt Eisner unterschriebene Vorläufige bayerische Staatsgrundgesetz.
2. 3 1919 - Außerordentlicher Parteitag der USPD in Berlin
Berlin * Die USPD trifft sich in Berlin zu einem außerordentlichen Parteitag. Er dauert bis zum 6. März. Hugo Haase, der Parteivorsitzende der USPD, spricht der SPD den Willen ab, eine antikapitalistische Politik betreiben zu können und zu wollen.
2. 3 1919 - Über Halle wird der Belagerungszustand ausgerufen
Weimar - Halle * Reichswehrminister Gustav Noske erteilt Generalmajor Georg Ludwig Rudolf Maercker den Befehl, mit seinem Landesjägerkorps in Halle einzumarschieren. An diesem 2. März verkündet Maercker den Belagerungszustand. In den nächsten Tagen kommt es bei der Bevölkerung von Halle zu 29 Toten und 67 Verwundeten.
3. 3 1919 - Die Kasernenräte kritisieren die Ausgabe der Waffen an die Arbeiter
München * Die Kasernenräte kritisieren in einem öffentlichen Aufruf die Ausgabe der Waffen an freigewerkschaftlich organisierte und sozialistischen Parteien angehörenden Arbeitern, weil dabei Spartakisten bevorzugt worden sein sollen.
3. 3 1919 - Die Frist zur Abgabe aller Schusswaffen endet
München * Die polizeilich vorgegebene Frist zur Abgabe aller Schusswaffen endet an diesem Tag.
3. 3 1919 - Der Belagerungszustand wird über Groß-Berlin verhängt
Berlin * Am Abend wird der Belagerungszustand über Groß-Berlin verhängt. Das bedeutet,
- dass die vollziehende Gewalt auf den Reichswehrminister übergeht,
- dass die Pressefreiheit,
- das Vereins- und Versammlungsrecht und
- die Unverletzlichkeit der Wohnung außer Kraft gesetzt werden.
3. 3 1919 - Generalstreik in Groß-Berlin beschlossen
Berlin * Die Vollversammlung der Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte beschließt - bei Enthaltung der sozialdemokratischen Delegierten - einen Generalstreik. Die Streikziele sind rein politische. Es geht um
- die Anerkennung der Arbeiter- und Soldatenräte,
- die sofortige Durchführung der Hamburger Punkte zur militärischen Kommandogewalt,
- die Freilassung aller politischen Gefangenen,
- die sofortige Bildung einer revolutionären Arbeiterwehr,
- die sofortige Auflösung aller Freikorps,
- die Aufnahme politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zu Sowjetrussland sowie
- umfassende Kompetenzen für Arbeiter- und Soldatenräte auf wirtschaftlichem Gebiet.
3. 3 1919 - In Berlin werden Polizeireviere gestürmt
Berlin * In Berlin werden Polizeireviere gestürmt und über 1.000 Gewehre und Maschinengewehre erbeutet. Fünf Polizeibeamte kommen ums Leben.
3. 3 1919 - Den Generalstreik zum bewaffneten Aufstand ausgeweitet
Berlin * Enttäuscht über die politische Entwicklung der Revolution von 1918/19, weiten Anhänger der Kommunistischen Partei Deutschlands - KPD einen Generalstreik zu einem bewaffneten Aufstand aus. Ihre Ziele sind dieselben wie beim Spartakusaufstand im Januar 1919:
- Sturz der Reichsregierung,
- Anerkennung der Arbeiter- und Soldatenräte und
- Errichtung einer Räterepublik nach sowjetrussischem Vorbild.
Zentrum der bürgerkriegsartigen Kämpfe ist die Innenstadt mit dem Berliner Polizeipräsidium am Alexanderplatz sowie Lichtenberg.
3. 3 1919 - Eine Verordnung zur Ausschaltung des Bodenwuchers
München * Der Zentralrat beschließt eine Verordnung zur Ausschaltung des Bodenwuchers. Durch diese wird die Bodenspekulation in Bayern verboten. Ein Verstoß gegen das Verbot soll mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe geahndet werden.
3. 3 1919 - Eine militante Rhetorik
Berlin * Anders als die Streikführer der USPD und der SPD, die die Arbeiter zum friedlichen und gewaltfreien Protest aufriefen, sind die Aufrufe der KPD und des Parteiorgans Rote Fahne von militanter Rhetorik geprägt. Die Rote Fahne ist davon überzeugt, dass Blut vergossen werden muss.
„Auf zum Kampfe! Auf zum Generalstreik! Nieder mit Ebert-Scheidemann-Noske, den Mördern, den Verrätern! Nieder mit der Nationalversammlung! Alle Macht den Arbeiterräten!“
3. 3 1919 - Thomas Manns Sympathie für die Räterepublik
München * Die Tagebuchnotiz von Thomas Mann lautet für den heutigen Tag: „Für die ‚Räte‘, sofern sie sich die Mühsam vom Leibe halten, bin ich im Grunde auch. Den bloßen Parlamentarismus kann ich nicht wollen. Es kommt ja gerade darauf an, ‚etwas Neues in politicis zu erfinden‘ und zwar etwas Deutsches.“
4. 3 1919 - Immer mehr existenzlose Menschen kommen nach München
München - Pasing * In München halten sich immer mehr Personen vorübergehend auf, bei denen es sich hauptsächlich um existenzlose Menschen handelt. Der Magistrat will diesen sich vorübergehend in der Stadt aufhaltenden Personen höchstens 14 Tage eine Unterstützung zukommen lassen.
Die selbstständige Stadt Pasing hat den Fremdenzuzug wegen Wohnungsmangel bereits unterbunden.
4. 3 1919 - Groß-Berlin wird mit 30.000 Soldaten besetzt
Weimar - Berlin * Reichswehrminister Gustav Noske erteilt General Walther von Lüttwitz den Befehl, Berlin zu besetzen und „rücksichtslos“ die Ordnung wiederherzustellen. Die Truppe besteht aus über 30.000 Mann, zu denen auch die Garde-Kavallerie-Schützen-Division gehört.
4. 3 1919 - Die SPD verurteilt die Gewalt der Straße und die Streiks
Berlin * Die Führung der Sozialdemokraten verurteilt die Gewalt der Straße und die Streiks. Damit nimmt sie die selbe Haltung wie die politisch Rechte ein.
4. 3 1919 - Angebliche Pöbelhaufen greifen Regierungstruppen an
Berlin * Das Wolff‘sche Telegraphenbüro berichtet über einen Pöbelhaufen, der auf dem Alexanderplatz mehrere Regierungssoldaten angreift. Sieben Soldaten sind angeblich spurlos verschwunden. Auch in anderen bürgerlichen Zeitungen mehren sich die Berichte über marodierende Pöbelhaufen, in denen die Gefährlichkeit der Streikenden hervorgehoben werden. Die Zeitungen werden hauptsächlich aus der Propagandazentrale des Kommandos Lützow mit Informationen versorgt.
General Walther von Lüttwitz ist Gustav Noskes ranghöchster militärischer Befehlshaber. Er und sein Stab haben bereits Pläne für die militärische Besetzung Berlins ausgearbeitet. Dazu gehört auch die psychologische Kriegsführung und die Propaganda.
5. 3 1919 - Auf dem Heumarkt findet der Aschermittwoch-Pferdemarkt statt
München-Untergiesing * Auf dem städtischen Heumarkt an der Schyrenstraße findet der traditionelle Aschermittwoch-Pferdemarkt statt. Mit 930 Pferden ist das Angebot sehr umfangreich, die Geschäfte gehen aber schlecht.
5. 3 1919 - Eugen Leviné kommt im Auftrag der Berliner KPD-Zentrale nach München
Berlin - München * Eugen Leviné kommt im Auftrag der Berliner KPD-Zentrale nach München, um hier die Ortsgruppe zu reorganisieren und die Redaktion der Münchner Roten Fahne zu übernehmen. Ihm folgen in den nächsten Wochen weitere Parteimitglieder.
Zu Beginn seiner Münchner Zeit ist Leviné noch im Verborgenen tätig. Er wird zusammen mit Max Levien, dem bayerischen KPD-Vorsitzenden, zum führenden Kopf der Münchner Kommunisten während der Rätezeit. Eugen Leviné verweigert sich der Zusammenarbeit mit der SPD, die bislang als die schärfste Gegnerin der Kommunisten aufgetreten ist.
5. 3 1919 - Der erste politische Aschermittwoch
Vilshofen * Der Bayerische Bauernbund - BBB lädt Mittags zu einer Volksversammlung, dem ersten Politischen Aschermittwoch, ein, nachdem am Vormittag eine Vertrauensmännerversammlung abgehalten worden war.
Der Bayerische Bauernbund ist im Bayerischen Landtag mit Abgeordneten vertreten. In der anstehenden Auseinandersetzung zwischen dem Parlament und dem Zentralrat der Republik Bayern hat sich der BBB für die Verwirklichung eines Rätesystems ausgesprochen. Als Redner treten auf:
- Der Landtagsabgeordnete Joseph Klarhauser und
- der Delegierte des Arbeiter- und Bauernrats Leitner.
5. 3 1919 - 25 Tote im von Regierungstruppen besetzten Königsberg
Königsberg * Nachdem Anfang März Königsberg ohne ersichtlichen Anlass von Regierungstruppen besetzt worden ist, kommt es an diesem 5. März zu einer Militäraktion, bei der 25 Zivilisten sterben müssen.
5. 3 1919 - Ein Vertreter der Erwerbslosen soll in den Aktionsausschuss
München * Während der Rätekongress am 28. Februar die Höchstzahl des Aktionsausschusses auf 33 Personen festgelegt hat, beschließt der Kongress nun die Aufnahme eines Vertreters der Erwerbslosen.
5. 3 1919 - Die Schlacht am Alexanderplatz beginnt
Berlin * Am Nachmittag beginnt die Schlacht am Alexanderplatz. Sie dauert bis zum 6. März. Es geht bei diesem Feuergefecht um das Polizeipräsidium. Über die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung gibt es verschiedene, vollkommen unterschiedliche Aussagen.
Tatsache ist, dass drei bewaffnete Truppen in der Nähe des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz aufeinander treffen:
- die Regierungstruppen unter General Walther von Lüttwitz,
- die Republikanische Sicherheitswehr und
- die übrig gebliebenen Reste der Volksmarinedivision.
Die Schuld für den Ausbruch der Kämpfe wird in den Zeitungen - je nach politischer Couleur - der jeweils anderen Seite zugewiesen.
Die Schlacht endet, nachdem die regierungsnahen Truppen die Kontrolle über das Polizeipräsidium und dessen Umgebung übernehmen können. Dennoch müssen ein Toter und fünf Schwerverwundete hingenommen werden.
6. 3 1919 - Die Bayerischen Volkspartei bekennt sich zur republikanischen Staatsform
München * Die Landtagsfraktion der Bayerischen Volkspartei - BVP bekennt sich zur republikanischen Staatsform.
6. 3 1919 - Die Fleischversorgung Münchens lässt stark zu wünschen übrig
München * Die Fleischversorgung Münchens lässt stark zu wünschen übrig. Die ständigen Unruhen in der Stadt haben die Bauern verunsichert und verbittert.
6. 3 1919 - Der Berliner Generalstreik wird ausgeweitet
Berlin * Der Generalstreik wird auf die Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke ausgeweitet.
6. 3 1919 - Die sofortige Freilassung der Geiseln gefordert
München * Der SPD-Landtagsabgeordnete und Rechtsanwalt Dr. Max Süßheim stellt auf dem Rätekongress den Antrag auf sofortige Freilassung der Geiseln, die aufgrund des Beschlusses des Zentralrats vom 22. Februar im Hotel Bayerischer Hof in Geiselhaft genommen worden waren. Zu diesem Zeitpunkt sind noch zwölf Geiseln in Stadelheim untergebracht. Fünfzehn sind bereits entlassen worden.
Der Rätekongress beschließt die sofortige Entlassung der Geiseln, „soweit nicht nachweisbare Verdachtsgründe vorliegen“.
6. 3 1919 - Die Ernährungskrise bei Dallmayr
München * Josef Hofmiller beschreibt die Ernährungskrise in München: „Ich war mit meiner Frau in der Stadt und führte sie durch den Laden von Dallmayr, um ihr etwas zu zeigen, was sie noch nie gesehen hatte: Dallmayr am Aschermittwoch ohne eine Spur von irgendeinem Fisch!
Man muss ihn im Frieden gesehen haben, um zu wissen, was das bedeutet. An Süßwasser- und Seefischen alles, was die Jahreszeit bot. […] Gestern: nichts, gar nichts, kein Schwanz von einem Fisch, nicht einmal ein Hering, nicht einmal eine Sardelle; bloß Stockfisch stank in einer Ecke, etwas, wozu sich Dallmayr im Frieden nie erniedrigt hätte.
Was gab es da? Oh, sehr nette Sachen: grüne Erbsen in Sulz, Erbsen mit Bohnen in Sulz, Sellerie in Sulz, rote Rüben in Sulz, gemischte Gemüse in Sulz. Dabei waren die Dinger klein und nicht einmal billig: 75 bis 90 Pfennig die Portion. Dazu Gemüsesalate, aber kein Tropfen Öl daran! Es ist ein Jammer! An Käsen nichts, gar nichts. Eine Dame neben uns bekam ein Ei (mit Ziffern 1 Ei).“
7. 3 1919 - Amerika will die Münchner Bevölkerung mit Lebensmittel versorgen
München * Ein Mitglied einer amerikanischen Lebensmittelkommission besichtigt gemeinsam mit Ernst Toller Proletarierwohnungen. Toller berichtet dem Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat, dass Amerika alles unternehmen werde, um die Münchner Bevölkerung mit Fleisch, Milch, Mehl, Reis, Butter, Gummi usw. zu versorgen.
7. 3 1919 - Eine Bande plündert Villen im Osten der Stadt
München-Bogenhausen * Eine Bande plündert Villen im Osten der Stadt. Mit Gewehren, Pistolen und Handgranaten stürmen sie die Häuser und rauben Bargeld, Schmuck, Waffen und sonstige Wertgegenstände.
7. 3 1919 - Die Streikführer sind für das Meer von Blut und Trümmern verantwortlich
Berlin * Beim Vorwärts löst die Nachricht vom Streikende regelrecht Triumphgefühle aus. Die Redakteure sind der Überzeugung, dass die Anführer des Streiks für das „Meer von Blut und Trümmern“, das er hinterlassen hat, verantwortlich sind.
7. 3 1919 - Der Aktionsausschuss hat sich konstituiert
München * Der Aktionsausschuss hat sich konstituiert. Er besteht aus 35 Mitgliedern, zwei mehr als ursprünglich vorgesehen.
Danach wählt der Aktionsausschuss aus seiner Mitte den Zentralrat. Den Vorstand des Zentralrats bilden:
- Ernst Niekisch [Vorsitzender, Arbeiterrat],
- Anton Hofmann [stellvertretender Vorsitzender, Bauernrat],
- Fritz Soldmann [Schriftführer, Arbeiterrat],
- Johann Panzer [stellvertretender Schriftführer, Soldatenrat].
Dem Zentralrat gehört kein Mitglied des Revolutionären Arbeiterrats an.
7. 3 1919 - Der Berliner Generalstreik endet um 19 Uhr
Berlin * Die Sozialdemokraten beantragen in der Vollversammlung des Berliner Arbeiterrats die sofortige Beendigung des Generalstreiks. Auch die Gewerkschaftskommission empfiehlt den Abbruch des Streiks.
Die Vollversammlung des Berliner Arbeiterrats beschließt - mit den Stimmen der USPD-Vertreter - den Generalstreik um 19 Uhr zu beenden. Das Ende des Streiks bedeutet aber nicht das Ende der Gewalt.
7. 3 1919 - Der Rätekongress lehnt die Einrichtung von Frauenräten ab
München * Anita Augspurg beantragt im Rätekongress die Einrichtung von Frauenräten. Die Delegierten lehnen den Antrag ab.
8. 3 1919 - Antrag auf sofortige Einberufung des Landtags
München * SPD, USPD und der Bauernbund legen dem Rätekongress einen gemeinsamen Antrag auf sofortige Einberufung des Landtags vor. Der Rätekongress nimmt den Antrag gegen die Stimmen der extremen Linken an. Dem Antrag voraus geht die Ablehnung, Bayern zur sozialistischen Räterepublik auszurufen.
Aus Protest gegen diese Beschlüsse erklären die zwei Vertreter des Revolutionären Arbeiterrats, Max Levien und August Hagemeister, sowie Fritz Sauber vom Soldatenrat, ihren sofortigen Austritt aus dem Zentralrat.
8. 3 1919 - Ernst Toller wird zum Vorsitzenden der Münchner USPD gewählt
München * Auf einer außerordentlichen Generalversammlung wird Fritz Schröder als Münchner USPD-Vorsitzender abgelöst und Ernst Toller zum neuen Vorsitzenden gewählt.
8. 3 1919 - Wo die Bestialität anfängt, hört die Solidarität auf!
Berlin * Das SPD-Organ Vorwärts schreibt: „Wo die Bestialität anfängt, hört die Solidarität auf!“. Die Zeitungsredakteure sprechen dem politischen Gegner jede Menschlichkeit ab und liegen damit voll auf der Linie der Konservativen.
8. 3 1919 - Der März-Streik als der sinnloseste aller vergeblichen Streiks
Berlin * Für das liberale Berliner Tageblatt ist der März-Streik der „sinnloseste aller vergeblichen Streiks, die jemals in Berlin stattgefunden haben“.
8. 3 1919 - Ein regelrechter Kleinkrieg beginnt
Berlin * Das Zentrum der Gewalt verlagert sich in den Osten von Berlin. Ein regelrechter Kleinkrieg, mit „kleinen Putschen […], Barrikadenkämpfen und Überfällen“ beginnt. Die Kampfhandlungen dauern bis zum 12. März an.
9. 3 1919 - Reichswehrminister Gustav Noske erlässt einen Schießbefehl
Weimar - Berlin * Reichswehrminister Gustav Noske reagiert umgehend auf den sogenannten „Lichtenberger Gefangenenmord“ und erteilt einen Schießbefehl: „Die zunehmende Grausamkeit und Bestialität der gegen uns kämpfenden Spartakisten zwingen mich zu befehlen: Jede Person, die im Kampf gegen die Regierungstruppen mit der Waffe in der Hand angetroffen wird, ist sofort zu erschießen.“
Innerhalb von drei bis vier Tagen werden aufgrund des Befehls in Berlin mindestens 177, möglicherweise sogar über 200 Personen liquidiert. Was zunächst nur für die Niederschlagung der Aufständischen der Berliner Märzkämpfe gilt, wird am 25. April schließlich auch im Freistaat Bayern umgesetzt. An diesem Tag wird das Standrecht eingeführt, das bis zum 1. August 1919 gilt.
9. 3 1919 - Ein angeblicher Massenmord der Spartakisten
Berlin * Das Wollf‘sche Telegraphenbüro meldet einen „gemeinen Massen- und Meuchelmord“ an sechzig Polizeibeamten und einigen Dutzend Regierungssoldaten, die von Spartakisten „wie Tiere abgeschlachtet“ worden sind. Der Mord an den „wehrlosen Gefangenen“ wird sofort und ungeprüft von den seriösen bürgerlichen Zeitungen übernommen. Der sogenannte „Lichtenberger Gefangenenmord“ ist sofort in aller Munde.
9. 3 1919 - Angriff gegen die Aufständischen mit schweren Waffen
Berlin * Die Reichsregierung will als Reaktion auf den Guerillakrieg der Aufständischen diese mit einer Einschnürungsoperation niederkämpfen. Der Vorwärts erklärt seinen Lesern, dass das Ziel der Operation darin besteht, den Feind „konzentrisch einzuschließen und von allen Zufuhren abzuschneiden“. Es erfolgt ein fortgesetzter Angriff von Artilleriegeschützen, Mörsern, Maschinengewehren, Jagdflugzeugen und Handgranaten. Auf die zivile Bevölkerung wird in dem dicht bebauten Wohngebiet keine Rücksicht genommen.
10. 3 1919 - Standrechtliche Erschießungen verteidigt
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Das Berliner Tageblatt verteidigt die standrechtlichen Erschießungen der Regierungstruppen, die schließlich einen <em>„Kampf gegen die Bestie“</em> führen. <em>„Diese Mordtat, diese ruchlose und feige Massenerschießung, ist nur ein einziger, besonders hervorstehender Fall in der Unzahl der bestialischen Scheußlichkeiten, die von dem spartakistisch-kommunistischen Verbrechertum gegenwärtig verübt werden“</em>. </p>
10. 3 1919 - Überfüllte Leichenhallen
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die Niederschlagung des Berliner Aufstands fordert viele - auch zivile - Todesopfer. Die Zahl der eingelieferten Toten übersteigt die Kapazität der Berliner städtischen Leichenhallen. Seit dem 10. März suchen die Berliner in den Leichenhäusern nach vermissten Angehörigen und Freunden.</p> <p>Der Vorwärts fordert: <em>„Keine Gnade den Mördern“</em>. Unter der Überschrift <em>„Totenschau“</em> schreibt er: die Getöteten haben genau die Physiognomie jener <em>„Typen, wie man sie in den Reihen des auf Verelendung aufbauenden Spartakusbundes nur zu häufig findet. Noch im Tode steht ihnen Wut, Hass und Verzweiflung auf den Gesichtern geschrieben“</em>. </p>
10. 3 1919 - Bedauerliche Übergriffe der Räte
<p><em><strong>München</strong></em> * Auf einer Besprechung des Zentralrats mit den Vertretern der Exekutivorgane der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte sowie sämtlicher Ministerien wird widerspruchslos festgestellt, dass die Räte <em>„die Grenzen ihrer Zuständigkeiten nicht selten überschreiten und in manchen Fällen sogar zu recht bedauerlichen Übergriffen sich hinreißen“</em> lassen würden. </p>
10. 3 1919 - Der erste Teil von Eisners nichtgehaltener Rede
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Das USPD-Organ Neue Zeitung veröffentlicht den ersten Teil der von <em>„Kurt Eisners nichtgehaltener Rede“</em>, die er eigentlich am 21. Februar vor der <em>Nationalversammlung</em> ausführen wollte. Der zweite Teil der Rede wird am 12. März folgen. </p>
11. 3 1919 - In Stadelheim verhandelt das Volksgericht über 21 Plünderer
München-Obergiesing * In Stadelheim verhandelt das Volksgericht über 21 zumeist jugendliche Angeklagte, die am 21. Februar zum Teil gewaltsam in Häuser eingedrungen sind und plünderten.
11. 3 1919 - In der Nordseefischhalle gibt's 8.000 Heringe
München-Angerviertel * Rund 8.000 Heringe werden an der Nordseefischhalle auf dem Viktualienmarkt verkauft. Jeder Käufer kann maximal zwei Heringe erhalten. In einer Doppelreihe stehen die Menschen von der Fischhalle über die Freibank um die Heiliggeist-Kirche.
11. 3 1919 - 29 Angehörige der Volksmarinedivision erschossen
Berlin * Oberleutnant Otto Marloh lässt 29 Angehörige der Volksmarinedivision gefangen nehmen und auf der Stelle erschießen.
11. 3 1919 - Hinweise für die Räte
München - Freistaat Bayern * Der Zentralrat gibt ein Schreiben an die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte heraus, in dem diese aufgefordert werden, Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Lebensmitteln nur mit Hinzuziehung der Polizeibehörden durchzuführen.
Beamtenabsetzungen durch örtliche Räte sind nicht erlaubt. Es müsse erst ein Antrag auf Entlassung an den Zentralrat gerichtet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass „Missgriffe der Räte […] die schlimmsten Feinde des Rätegedankens“ sind.
11. 3 1919 - Abkehr von bürgerlicher Demokratie und Parlamentarismus
München * Die Münchner USPD beschließt auf ihrer Generalversammlung eine politische Kundgebung. In dieser erklärt sie die Abkehr von der bürgerlichen Demokratie und dem bürgerlichen Parlamentarismus.
Sie sieht nur in den „aus der Revolution elementar erwachsenen Räten die Organisationsform, die notwendig ist, die Interessen aller produktiv Schaffenden in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu vertreten und die kapitalistische Ordnung in eine sozialistische umzugestalten“. Erforderlich dazu ist „die Eroberung der politischen Macht durch die Räte“.
12. 3 1919 - Die Münchner USPD spaltet sich von der Gesamtpartei ab
München * Die Münchner USPD spaltet sich von der Gesamtpartei ab. In einer Entschließung bekennt sie sich eindeutig
- zum Rätesystem,
- zur Diktatur des Proletariats und
- zur gemeinsamen Arbeit mit der KPD.
12. 3 1919 - Berlin wird für befreit erklärt
Berlin-Lichtenberg * Die Regierungstruppen haben ihren Einkesselungsring um die Aufständischen fest geschlossen und marschieren im Bezirk Lichtenberg ein. Berlin wird für „befreit“ erklärt.
12. 3 1919 - Der Lichtenberger Gefangenenmord war eine Lügenpropaganda
Berlin-Lichtenberg * Die Berichte über den „Lichtenberger Gefangenenmord“ stellen sich als Falschmeldungen dar. Es gab kein Massaker. Die Männer, die angeblich von den Spartakisten brutal ermorden sein sollen, leben noch alle.
Später stellt sich heraus, dass für die Lügenpropaganda Waldemar Pabst, der Erste Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, zuständig war. Er hatte auch am 15. Januar 1919 die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht befohlen.
12. 3 1919 - Der zweite Teil von Eisners nichtgehaltener Rede
München - Freistaat Bayern * Das USPD-Organ Neue Zeitung veröffentlicht den zweiten Teil von „Kurt Eisners nichtgehaltener Rede“ vom 21. Februar.
13. 3 1919 - Es gibt nur noch alle zwei Tage ein Achtel Liter Milch
München * Es gibt nur noch alle zwei Tage ein Achtel Liter Milch auf Lebensmittelkarten.
13. 3 1919 - Die Weimarer Nationalversammlung beschließt die Sozialisierung
<p><strong><em>Weimar</em></strong> * Die Weimarer Nationalversammlung beschließt die Sozialisierung geeigneter Betriebe. </p>
13. 3 1919 - Der Lichtenberger Gefangenenmord war eine Falschmeldung
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die Vossische Zeitung teilt ihren Lesern mit, dass <em>„sich alle Nachrichten über die Massenerschießungen von Schutzleuten und Kriminalbeamten als unwahr erwiesen haben“</em>. </p>
13. 3 1919 - Noske verteidigt in der Nationalversammlung seinen Schießbefehl
<p><em><strong>Weimar</strong></em> * Reichswehrminister Gustav Noske rechtfertigt vor der Nationalversammlung seinen Schießbefehl: Auf <em>„juristische Tüfteleien“</em> lasse er sich nicht ein; es sei ein Gebot der Staatsräson gewesen, so rasch wie möglich Ruhe und Sicherheit wieder herzustellen. Den Schießbefehl nimmt er noch nicht zurück. </p>
13. 3 1919 - Abscheu und Verachtung für die Regierung
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Harry Graf Kessel notiert in sein Tagebuch: <em>„Alle geistig und ethisch anständigen Menschen müssen einer so leichtsinnig und frech mit dem Leben ihrer Mitbürger spielenden Regierung den Rücken kehren. Die letzten acht Tage haben durch ihre Schuld, durch ihr leichtfertiges Lügen und Blutvergießen, einen in Jahrzehnten nicht wieder zu heilenden Riss in das deutsche Volk gebracht. Die Stimmung gegen sie heute Abend wechselt zwischen Abscheu und Verachtung.“</em> </p>
13. 3 1919 - Die Berliner Märzkämpfe enden
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die Märzkämpfe enden mit der kampflosen Einnahme Lichtenbergs durch Regierungstruppen. </p>
13. 3 1919 - Bayern will in der Sozialisierungsfrage mit Sachsen zusammenarbeiten
<p><strong><em>München - Sachsen</em> </strong>* Der Zentralrat sendet ein Telegramm an den sächsischen Zentralrat, der dortigen Regierung und der Volkskammer zur Vollsozialisierung. Er will die vollständige Kontrolle über die Rohstoffe und die Energieverwendung sowie ihre endgültige Verwertung in Angriff nehmen. Der Zentralrat schlägt eine </p> <ul> <li>enge Zusammenarbeit mit der sächsischen Volkskammer vor, die zuvor die Regelung der Produktion und Verteilung planmäßig nach sozialistischen Grundsätzen zu regeln beschlossen hatte und</li> <li>für den 16. März ein Treffen der Kenner der Sozialisierungsfragen beider Länder vor. </li> </ul>
13. 3 1919 - Der Zentralrat schlägt die Errichtung eines Zentralwirtschaftsamts vor
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Zentralrat schlägt die Errichtung eines Zentralwirtschaftsamts mit besonderen Vollmachten vor, das neben der Regierung arbeiten soll. </p>
13. 3 1919 - Das Verfahren der Wahl zum Reichsrätekongress
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Der Zentralrat teilt allen bayerischen Räten mit, wie die insgesamt 28 Delegierten zum nächsten Berliner Reichsrätekongress zusammengesetzt und nach welchem Verfahren sie gewählt werden. </p>
14. 3 1919 - Die Sozialisierungs-Konferenz ist Sachsen zu kurzfristig angesetzt
<p><em><strong>Sachsen - München</strong></em> * Der sächsische Zentralrat und die Volkskammer teilen dem bayerischen Zentralrat mit, dass die vorgeschlagene gemeinsame Konferenz zu Sozialisierungsfragen zu kurzfristig angesetzt sei. </p>
15. 3 1919 - Die Zensur der bürgerlichen Presse wird aufgehoben
<p><strong><em>München</em></strong> * Die seit drei Wochen andauernde Zensur der bürgerlichen Presse durch den Zentralrat wird aufgehoben. Bereits seit dem 25. Februar konnten wieder alle bürgerlichen Blätter erscheinen, allerdings bis zum 15. März nur unter einer - mäßig strengen - Vorzensur.</p>
15. 3 1919 - Rücktritt vom Rücktritt
<p><em><strong>Berlin - Weimar</strong></em> * Die Kommission zur Erarbeitung eines Sozialisierungskonzepts, die am 3. Februar 1919 ihren Rücktritt erklärt hatte, tritt vom Rücktritt zurück. </p>
16. 3 1919 - Der Rätekongress räumt das Landtagsgebäude
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Rätekongress räumt auf Verlangen des Innenministers das Landtagsgebäude in der Prannerstraße, um Platz zu machen für den am nächsten Tag zusammentretenden Bayerischen Landtag. Auch die rote Fahne am Dach wird entfernt. </p>
16. 3 1919 - Die Kämpfe in Berlin gehen zu Ende
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die Kämpfe in Berlin gegen die Aufständischen gehen zu Ende. </p>
16. 3 1919 - Der Noske-Schießbefehl wird zurückgenommen
<p><em><strong>Weimar - Berlin</strong></em> * Obwohl sich herausgestellt hat, dass es sich bei der Nachricht um den <em>„Lichtenberger Gefangenenmord“</em> um eine Falschmeldung handelt, wird der <em>„Noske-Schießbefehl“</em> vom 9. März erst am 16. März wieder zurückgenommen.</p> <ul> <li>Insgesamt haben nach vorsichtigen Schätzungen 1.200 Menschen in den Berliner Kämpfen ihr Leben verloren, darunter 75 Angehörige der Regierungstruppen.</li> <li>Später wird als Urheber der Falschmeldung der Erste Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, Waldemar Pabst, entlarvt. Der Befehlsgeber zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg hat die Meldung gezielt durch seine Propagandaabteilung verbreiten lassen. </li> </ul>
16. 3 1919 - Ein kräftiger Wintereinbruch verschärft die Lebensmittelkrise
<p><em><strong>München</strong></em> * Laut einem Gutachten von Kurt Eisners Wirtschaftsexperten Benno Merkle reichen die Lebensmittel für München noch genau bis Ende Mai, dann ist Schluss. Ein kräftiger Wintereinbruch am 16. März verschärft die Krise der Lebensmittelversorgung. </p>
17. 3 1919 - Johannes Hoffmann (SPD) einstimmig zum Ministerpräsidenten gewählt
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Bayerische Landtag tritt unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu seiner ersten Sitzung seit dem 21. Februar zusammen. Die Abgeordneten müssen nacheinander vier Leibesvisitationen und Ausweiskontrollen über sich ergehen lassen. </p> <p>Eine neue Regierung unter dem Vorsitz des Mehrheitssozialdemokraten Johannes Hoffmann wird eingesetzt und mit einem Ermächtigungsgesetz mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet. </p> <p>Johannes Hoffmann wird auf der Basis des noch von Kurt Eisner vorbereiteten Vorläufigen Staatsgrundgesetzes vom 17. März 1919 zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Er wird deshalb auch als erster parlamentarischer, also vom Vertrauen des gewählten Landtags getragener Ministerpräsident bezeichnet. Aus diesem Grund ist - bis zum heutigen Tag - in der Bayerischen Staatskanzlei in der Galerie der Ministerpräsidenten kein Bild von Kurt Eisner aufgenommen worden. </p> <p>Der Landtag nimmt das vorläufige Staatsgrundgesetz des Freistaates Bayern an. Darunter das Gesetz über die Aufhebung des bayerischen Adels. </p>
17. 3 1919 - Eine Schieberbande wird festgenommen
<p><em><strong>München</strong></em> * Eine Schieberbande, die Heeresgut im Wert von acht Millionen Mark (Zigaretten, Spirituosen und Medikamente) verschoben hat, wird ausgehoben. </p>
18. 3 1919 - Die neue bayerische Regierung wird bekannt gegeben
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Die neue bayerische Regierung wird bekannt gegeben:</p> <ul> <li>Ministerpräsident Johannes Hoffmann [SPD] übernimmt das Ministerium des Äußeren sowie das Ministerium für Unterricht und Kultus,</li> <li>Fritz Endres [SPD] wird Justizminister,</li> <li>Martin Segitz [SPD] übernimmt das Ministerium des Inneren,</li> <li>Staatsrat von Merkel übernimmt in Vertretung das Finanzministerium,</li> <li>Heinrich Ritter von Frauendorfer [Parteilos] leitet das Verkehrsministerium,</li> <li>Hans Unterleitner [USPD] steht an der Spitze des Ministeriums für Soziale Fürsorge,</li> <li>Josef Simon [USPD] übernimmt das Ministerium für Handel und Gewerbe,</li> <li>Martin Steiner [Bayerischer Bauernbund] führt das Landwirtschaftsministerium und</li> <li>Ernst Schneppenhorst [SPD] wird Minister für militärische Angelegenheiten.</li> </ul> <p>Dem neuen Ministerrat werden besondere Vollmachten übertragen. Nach der Regierungserklärung des neu gewählten Ministerpräsidenten vertagt sich der Landtag wieder. </p> <p>Ministerpräsident Johannes Hoffmann stellt in seiner Regierungserklärung fest, dass für ihn nur ein uneingeschränkter Parlamentarismus als Regierungsform in Frage kommt. Die Soldatenräte werden bald verschwinden, die Arbeiterräte zu Arbeiterkammern umgewandelt werden. Den Räten sollen allenfalls wirtschaftliche, keinesfalls aber politische Bedeutung zukommen. Hoffmann erteilt jeglichen bayerischen Partikularismus-Gedanken eine klare Absage: Denn: Bayern steht fest zum Reich.</p> <p>Die Koalitionsregierung wird schon deshalb von Anfang an von der revolutionären Arbeiterschaft abgelehnt und kann auch im weiteren Verlauf kein Vertrauen gewinnen, weil sie sich gegen Zugeständnisse in der Rätefrage sperrt und von ihr auch keine ernsthafte Sozialsierungspolitik zu erwarten ist. </p>
18. 3 1919 - Entsetzlich ist der Völkerkrieg, entsetzlicher der Bürgerkrieg
<p><strong><em>München</em></strong> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann meldet sich mit einer ersten Programmrede zu Wort. Er erklärt, dass die neue Regierung den Freistaat Bayern schützen wird <em>„gegen jede Reaktion von rechts, aber auch verteidigen gegen die drohende Anarchie von links“, </em>denn: <em>„Entsetzlich ist der Völkerkrieg, entsetzlicher ist der Bürgerkrieg. Er muss für Bayern verhindert werden.“</em></p> <p>Das ist möglich, wenn die neue Regierung tatkräftig handelt und die Siegermächte Nahrungsmittel sowie Rohstoffe ins Land lassen. Die Völker der Welt müssen sich versöhnen. </p>
18. 3 1919 - Niekisch: Die demokratisch-parlamentarische Republik ist hergestellt
<p><em><strong>München</strong></em> * Durch die Regierungsbildung ist - nach einer späteren Aussage des Zentralratsvorsitzenden Ernst Niekisch - seine <em>„Mission als Träger der obersten Gewalt zu Ende“</em>. Mit der Verabschiedung des vorläufigen Staatsgrundgesetzes ist <em>„formal die demokratisch-parlamentarische Republik verfassungsmäßig hergestellt“</em>. </p>
19. 3 1919 - Auf dem Heumarkt findet der Fasten-Pferdemarkt statt
<p><strong><em>München-Untergiesing</em></strong> * Auf dem Heumarkt an der Schyrenstraße wird mit rund 800 Pferden der Fasten-Pferdemarkt abgehalten. Die Kauflust hat sich gegenüber dem Aschermittwoch-Pferdemarkt erhöht.</p>
19. 3 1919 - Die neu ernannten Minister kommen zu ihrer ersten Sitzung zusammen
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * Die neu ernannten Minister kommen zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Bei der ersten Sitzung des Ministerrats nehmen nach der am 8. März vom Rätekongress beschlossenen Vereinbarung je ein Mitglied der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte mit beratender Stimme teil. </p>
20. 3 1919 - Der ungarische Ministerpräsident Graf Mihály Károlyi tritt zurück
<p><em><strong>Budapest</strong></em> * Die Alliierten fordern nach dem Zusammenbruch der k.u.k-Monarchie in einem Ultimatum zum Rückzug der ungarischen Armee in Transsylvanien um weitere 80 Kilometer zu Gunsten Rumäniens auf. Das Ultimatum soll einen Tag später in Kraft treten. Der ungarische Ministerpräsident Graf Mihály Károlyi verweigert die Annahme und tritt zurück. </p>
20. 3 1919 - Ein Sozialisierungsgesetz kündigt Verstaatlichungen nur an
<p><em><strong>Weimar</strong></em> * Das Sozialisierungsgesetz erklärt die Zuständigkeit des Reiches und kündigte die Verstaatlichung von Schlüsselbetrieben im Bergbau an.</p> <p>Spätestens im Sommer 1919 ist klar, dass es im Deutschen Reich nicht zu durchgreifenden Sozialisierungsmaßnahmen kommen wird. </p>
Um den 20. 3 1919 - Der Zentralrat zieht in das Wittelsbacher Palais
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Der Zentralrat zieht vom Landtagsgebäude in der Prannerstraße in das Wittelsbacher Palais an der Brienner Straße um. </p>
21. 3 1919 - Zuhörer stürmen den Sitzungssaal im Gerichtsgebäude am Mariahilfplatz
München-Au * Im Gerichtsgebäude am Mariahilfplatz stürmen während der Verhandlung gegen Plünderer Zuhörer den Sitzungssaal. Sie wollen die Verurteilten befreien. Doch das Vorhaben misslingt.
21. 3 1919 - Otto Neurath stellt dem Ministerrat sein Sozialisierungskonzept vor
München * Der Wiener Philosoph, Sozialdemokrat und Nationalökonom Otto Neurath stellt auf Betreiben des USPD-Ministers für Handel und Gewerbe, Josef Simon, dem bayerischen Ministerrat seine Sozialisierungspläne vor. Simon leitet damit den entscheidenden Schritt zur Umgestaltung der bayerischen Ökonomie ein, wie sie Ministerpräsident Johannes Hoffmann in seiner Regierungserklärung angekündigt hat.
- Otto Neurath ist ein Verfechter der Planwirtschaft.
- Er will die gesamte gesellschaftliche Produktion in Bereiche einteilen,
- alles nach sozialistischen Grundsätzen erzeugen und verteilen,
- und so die Versorgung jedes einzelnen mit Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung und Vergnügen gewährleisten.
- Die Bedarfsdeckung der Bevölkerung und nicht der Reingewinn der Unternehmen stehen im Vordergrund seiner Wirtschaftstheorie.
- „So wie man die Volkswirtschaft durch ein Hindenburg-Programm dem Kriege dienstbar machen konnte, müsste man sie auch dem Glück aller dienstbar machen können.“
Otto Neurath erhält den Auftrag, seine Pläne im Sozialisierungsausschuss und im Landtag zu erklären.
21. 3 1919 - Ungarn wird eine sozialistische Räterepublik
Budapest * In Ungarn wird durch den Revolutionären Regierungsrat eine sozialistische Räterepublik unter dem Vorsitz des Kommunisten Bela Kun ausgerufen. Sie bestärkt die Münchner Räteanhänger in ihren Forderungen. Man hofft auf eine Verbindung von Bayern mit Österreich, Ungarn und Russland.
Der in Bayern schon lange gepflegte Preußenhass verbindet sich mit der Räte-Idee.
22. 3 1919 - Artikel gegen das Gesetz über die Aufhebung des bayerischen Adels
München * Die München-Augsburger Abendzeitung wendet sich in einem Artikel gegen das vom Bayerischen Landtag vier Tage zuvor beschlossene Gesetz über die Aufhebung des bayerischen Adels.
22. 3 1919 - Die Saubande von Juden-Preußen in München
Schloss Wildenwart * Ex-Prinzessin Wiltrud notiert in ihr Tagebuch: „So lange Papa und Rupprecht etwas zu sagen gehabt hatten, wäre es nie so weit gekommen. Die Saubande von Juden-Preußen in München hat uns um unser Vaterland gebracht, wir werden jetzt eine Art Provinz des Reiches“.
22. 3 1919 - Diskussion um die Installation von Betriebsräten
Weimar * Auf der erste Parteikonferenz der SPD nach dem Krieg kommt es zu kontroversen Diskussionen in der Frage der Installation von Betriebsräten.
Carl Legien, der Vorsitzende der Generalkommission der freien Gewerkschaften, warnt davor, den Arbeiterräten das Recht der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zuzugestehen. Denn „dann haben die Gewerkschaften keine Existenzberechtigung mehr“.
22. 3 1919 - Thomas Manns Sympathie für Spartakismus und Kommunismus
München * Der Schriftsteller Thomas Mann vertraut seinem Tagebuch an: „Fortschritte des Bolschewismus in Italien und Ungarn, deutlich als Folge der gottverlassenen Ententepolitik. Wiederholte deutsche Versicherungen, daß man einen unmöglichen Frieden nicht unterzeichnen werde. […]
Meine Teilnahme wächst für das, was am Spartacismus, Kommunismus, Bolschewismus gesund, menschlich, national, anti-ententistisch, anti-politisch ist. Das Gerücht über meinen ‚Anschluß an die U.S.P.‘ ist nicht sinnlos“.
22. 3 1919 - Die Frauen werden aus dem Beruf gedrängt
München * In den Münchner Neuesten Nachrichten erscheint unter der Rubrik „Von Frauen für Frauen“ ein Artikel, der mit „Platz für den Mann!“ überschrieben ist.
Unter diesem Schlagwort werden die Frauen nun wieder aus den Berufen verdrängt, die sie während des Krieges ausgeübt haben, stellt die Verfasserin Thea Schneidhuber fest: „Die unzähligen Frauen aus all den verschiedenen Industrien haben den heimgekehrten Kriegern mehr oder minder bereitwillig ihren mit so viel Stolz und Selbstgefühl behaupteten Posten abtreten müssen“, schreibt sie.
Ihnen sei zwar von vornherein klar gewesen, dass sie diese Rolle nur provisorisch eingenommen hätten, gleichwohl sind vier Jahre genug gewesen, um auf den Geschmack zu kommen: „Jeder, der es erfahren hat - er sei Mann oder Weib - weiß die Freude am eigenen Erwerb zu verstehen, die umso größer ist, je notwendiger die Herbeischaffung der Mittel ist. Es kann die Tatsache nicht verkannt werden, dass zwei Drittel der Bevölkerung während der Kriegsjahre von der Frau ernährt worden sind, dass sie die Verdienerin war, die ihre Familie erhielt, während der Mann seinen Kriegslohn in den meisten Fällen für sich aufbrauchte“.
Und nun sollen die Frauen still abtreten und wieder den Männern die Bühne überlassen? Die Verfasserin räumt zwar ein, „die Pflichten der Hausfrau und Mutter“ seien der Frau „naturgemäß die liebsten und sie wird ihnen gern das Selbstgefühl opfern, das der eigenen Hände Arbeit ihr bescherte“. Aber das Selbstbewusstsein und den Anspruch auf Mitsprache will sie dennoch nicht aufgeben.
Mit einem „erstaunlichen Maß an Gleichgültigkeit“ stünden gerade die radikalen Vertreter der neuen Ordnung den Frauen gegenüber, klagt sie. Gerade weil die Frauen darauf verzichtet hätten, sich zu einer alle Lager übergreifenden Frauenpartei zusammenzuschließen, stünden die Männer aller Parteien in der Pflicht, ihre Sache nicht nur „ohne Feindseligkeit zu betrachten, sondern nach Kräften zu unterstützen“.
22. 3 1919 - Die Regierung Scheidemann befasst sich mit der Kriegsschuldfrage
Weimar * Die Regierung Scheidemann setzt sich auf Drängen des Reichspräsidenten Friedrich Ebert mit der Kriegsschuldfrage auseinander.
23. 3 1919 - Einführung der Betriebsräte auf SPD-Konferenz beschlossen
<p><em><strong>Weimar</strong></em> * Die SPD-Parteikonferenz beschließt die Einführung der Betriebsräte:</p> <ul> <li><em>„Zur Mitwirkung an Sozialisierungsmaßnahmen, zur Kontrolle sozialistischer Betriebe, zur Überwachung der Gütererzeugung und Verteilung im gesamten Wirtschaftsleben sind gesetzlich geordnete Arbeitervertretungen zu schaffen. </em></li> <li><em><em>In dem zu diesem Zweck schleunigst zu schaffenden Gesetz sind Bestimmungen zu treffen über die Wahl und Aufgaben von Betriebs-, Arbeiter- und Angestelltenräten, die bei der Regelung der allgemeinen Arbeitsverhältnisse gleichberechtigt mitzuwirken haben. </em></em></li> <li><em><em><em>Es sind weiter Bezirksarbeiterräte und ein Reichsarbeiterrat vorzusehen, die vor dem Erlass wirtschaftlicher und sozialpolitischer Gesetze ebenso wie die Vertretungen aller übrigen schaffenden Stände gutachtlich zu hören sind und selbst Anträge auf Erlass solcher Gesetze stellen können. </em></em></em></li> <li><em><em><em><em>Die entsprechenden Bestimmungen sind in der Verfassung der deutschen Republik festzulegen.“ </em></em></em></em></li> </ul>
24. 3 1919 - Witten: Elf Tote bei Zusammenstößen von Demonstranten und Polizei
Witten * Im rheinisch-westfälischen Witten kommt es am 24. und 25. März zu schweren Zusammenstößen zwischen demonstrierenden Arbeitern und der Polizei. Das Ergebnis sind elf Tote und viele Verwundete. Die Unruhen lösen eine neue große Streikwelle in der Region aus.
24. 3 1919 - Thomas Mann: Hoch der Kommunismus!
München * In dem Tagebuch von Thomas Mann findet sich die Mitteilung: „Die Nachrichten aus der Welt erschüttern mich sehr. Rücktritt des Grafen Karolyi und Ausrufung der Sowjet-Republik in Ungarn. Verständigung mit Moskau und Anmarsch russischer Truppen. In Wien kommunistische Demonstration. In Italien Übergang des gesamten Sozialismus zum Kommunismus. Alles gegen den Entente-Imperialismus gerichtet […].
Ich wünsche es fast nicht mehr, daß das ‚Siegerpack‘ sich durch die Wirkungen seiner Niedertracht in Ungarn witzigen lässt. Ablehnung des Friedens durch Deutschland! Aufstand gegen den Rhetor-Bourgeois! Nationale Erhebung, nachdem man sich von den Schwindel-Phrasen dieses Gelichters das Mark hat zermürben lassen, in Form des Kommunismus denn meinetwegen, ein neuer 1. August 1914!
Ich bin imstande, auf die Straße zu laufen und zu schreien ‚Nieder mit der westlichen Lügendemokratie! Hoch Deutschland und Russland! Hoch der Kommunismus!‘“
25. 3 1919 - Dr. Karl Neumaier wird Finanzminister
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Dr. Karl Neumaier übernimmt das Ministerium der Finanzen im 1. Kabinett Hoffmann. </p>
Um den 25. 3 1919 - Die Idee der Sozialistischen Räterepublik wieder populär
<p><strong><em>München</em></strong> * Unter der großstädtischen Arbeiterschaft wird die Idee der Sozialistischen Räterepublik wieder enorm populär. Man sieht in ihr das Allheilmittel gegen die unerträglich scheinenden wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten.</p>
25. 3 1919 - Otto Neurath stellt dem Landtag seine Sozialisierungspläne vor
<p><em><strong>München</strong></em> * Otto Neurath, Philosoph und Nationalökonom, tritt vor dem Landtag auf und stellt seine Sozialisierungs-Pläne vor. Der planwirtschaftliche Ansatz ruft Sympathien selbst bei Sebastian Schlittenbauer von der Bayerischen Volkspartei hervor. Das liegt an der zu dieser Zeit besonders großen Bedeutung des Genossenschaftswesens für die BVP. </p>
26. 3 1919 - Otto Neurath spricht vor dem Sozialisierungsausschuss des Landtags
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Philosoph und Nationalökonom Otto Neurath stellt dem Sozialisierungsausschuss des Landtags seine Sozialisierungs-Pläne vor. Der Ausschuss äußert Bedenken. </p>
27. 3 1919 - Der Ministerrat beschließt ein Zentralwirtschaftsamt
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Ministerrat beschließt einstimmig die vom Nationalökonomen Otto Neurath vorgeschlagene Einrichtung eines Zentralwirtschaftsamtes.</p> <p>Ministerpräsident Johannes Hoffmann versucht die Berufung Neuraths zum Leiter dieses Amtes zu verhindern, kann sich aber nicht durchsetzen. </p>
28. 3 1919 - Das Gesetz über die Abschaffung des Adels beschlossen
München * Das Gesetz über die Abschaffung des Adels wird beschlossen. Die Sozialdemokraten gehen wie selbstverständlich davon aus, dass im Rahmen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes mit dem Gesetz zugleich das Recht Adelsnamen zu führen entfallen ist.
29. 3 1919 - Protest gegen den Entwurf der Weimarer Verfassung
<p><strong><em>München</em></strong> * Dipl.-Ing. Otto Ballerstedt vom Bayernbund legt in einer von ihm einberufenen Versammlung Protest gegen die im Entwurf der Weimarer Verfassung beabsichtigte Beseitigung der bayerischen Reservatsrechte ein. Er sagt: <em>„Für Großpreußen haben wir in Süddeutschland kein Verständnis. Wir wollen ein großes deutsches Reich mit wahrhaft gleichberechtigten Bundesstaaten.“ </em></p>
30. 3 1919 - Essen: Unbefristeten Generalstreik beschlossen
<p><em><strong>Essen</strong></em> * Die Schachtdelegiertenkonferenz beschließt in Essen einen unbefristeten Generalstreik. Die Forderungen sind ebenfalls politisch motiviert. Es geht um</p> <ul> <li>die Anerkennung der Arbeiter- und Soldatenräte,</li> <li>die sofortige Durchführung der Hamburger Punkte zur militärischen Kommandogewalt,</li> <li>die Einführung der Sechs-Stunden-Schicht und</li> <li>die Entwaffnung der Polizei im Industriegebiet und ganz Deutschland. </li> </ul>
31. 3 1919 - Über das Ruhrgebiet wird der Belagerungszustand verhängt
<p><strong><em>Weimar - Ruhrgebiet</em></strong> * Die Reichsregierung</p> <ul> <li>verhängt den Belagerungszustand über das vom Streik betroffene Gebiet.</li> <li>Kündigt den Einmarsch von Truppen an und </li> <li>schickt den SPD-Abgeordneten und Gewerkschaftssekretär Carl Severing als Staatskommissar ins Industriegebiet. </li> </ul> <p>In der Folge werden zahlreiche Streikführer verhaftet, um die Arbeitskampfmaßnahme zu unterlaufen und zu schwächen. </p>
31. 3 1919 - In Württemberg wird ein Generalstreik ausgerufen
<p><em><strong>Württemberg</strong></em> * In Württemberg wird ein Generalstreik ausgerufen. Er dauert bis zum 7. April 1919 an. </p>
31. 3 1919 - Lenkung der bayerischen Wirtschaft durch ein Zentralwirtschaftsamt
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Mehrheit des Ministerrats beschließt ein Statut, das den wesentlichen Forderungen des Philosophen und Nationalökonomen Otto Neuraths nachkommt. Diese zielen darauf ab, die gesamte Wirtschaft des Landes durch ein Zentralwirtschaftsamt zu lenken, das dem noch zu errichtenden Handelsministerium unterstehen soll.</p> <p>Ziel ist es, mit Hilfe einer Universalstatistik einen Überblick über die vorhandenen Produktionsmittel, die Produktionsmöglichkeiten und den Produktionsbedarf zu gewinnen, der dann von einer Naturalrechnungszentrale für die Erstellung von Wirtschaftsplänen ausgewertet werden soll.</p> <ul> <li>Eine Kompensationszentrale soll den unmittelbaren Warenaustausch mit dem Ausland regeln.</li> <li>Eine Rationalisierungszentrale die modernen Erkenntnisse der wissenschaftlichen Betriebsführung nach Frederick Taylor zur Anwendung bringen, für Normierung und Typisierung sorgen und insbesondere die Arbeits- und Berufsforschung fördern.</li> <li>Eine Kontrollzentrale soll die Auswirkungen der Sozialisierungsgesetzgebung auf die Wirtschaft dauernd überprüfen.</li> <li>Eine Aufklärungszentrale soll die Arbeit des Zentralwirtschaftsamtes dem Volk nahe bringen.</li> </ul> <p>Ebenfalls noch am 31. März genehmigt der Ministerrat den Personaletat für das neue Amt. Zum Sitz des Amtes wird das Prinz-Carl-Palais bestimmt. </p>
1. 4 1919 - Die wöchentliche Fleischration wird herabgesetzt
<p><em><strong>München</strong></em> * Die bayerische Landeshauptstadt liegt unter einer Schneedecke von 40 Zentimetern.</p> <ul> <li>Die Arbeitslosenquote liegt konstant bei über 30.000,</li> <li>die Kohlenvorräte sind aufgebraucht,</li> <li>die Energiezufuhr stockt,</li> <li>der Preis für einen Trambahn-Fahrschein wird von 15 auf 20 Pfennige erhöht,</li> <li>die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch ist nicht mehr gewährleistet, weil sich immer mehr Bauern weigern, in die von Unruhe erfüllte Stadt zu fahren.</li> <li>Die wöchentliche Fleischration wird von 300 Gramm auf 250 Gramm herabgesetzt. Schwerstarbeiter erhalten auch weiterhin eine Zulage von 120 Gramm Wurst.</li> <li>Was blüht ist der Schwarzmarkt. Die Waren gibt‘s dort im Überfluss, aber halt zu entsprechend hohen Preisen.</li> </ul> <p>Der neu ernannte Staatskommissar für Ernährungswesen, Johann Wutzelhofer vom Bayerischen Bauernbund- BBB, stellt sein Programm vor. </p>
1. 4 1919 - Hermine Körner übernimmt die Leitung des Münchner Schauspielhauses
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Hermine Körner übernimmt die Leitung des Münchner Schauspielhauses. </p>
1. 4 1919 - 160.000 Arbeiter streiken im Ruhrgebiet
Ruhrgebiet * 160.000 Arbeiter befinden sich im Ruhrgebiet im Streik.
1. 4 1919 - Das Landwirtschaftsministerium wird gegründet
<p><em><strong>München</strong></em> * In Bayern nimmt das neuerrichtete Staatsministerium für Land- und Forstwirtschaft seine Tätigkeit auf. Leiter wird Martin Steiner vom Bayerischen Bauernbund - BBB. </p>
2. 4 1919 - Sämtliche Mietshäuser des Stadtgebiets sollen enteignet werden
<p><strong><em>München-Au</em></strong> * In einer Versammlung im Münchner-Kindl-Keller wird von den Teilnehmern die Forderung erhoben, sämtliche Mietshäuser des Stadtgebiets, mit Ausnahme der Einfamilienhäuser, zu enteignen. Zur Bekräftigung des Beschlusses will man ab 15. April keine Miete mehr bezahlen. </p>
Um den 2. 4 1919 - Oskar Maria Graf beschreibt die Münchner Lebenssituation
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Regierung Hoffmann strotzt in den letzten Märztagen nicht gerade vor Tatendrang. Wirtschaftlich geht‘s bergab, das miserable Wetter und der Schnee hindern alle weiteren Bemühungen.</p> <p>Oskar Maria Graf beschreibt die Situation folgendermaßen: <em>„Die Stadt machte seit Tagen einen verwahrlosten Eindruck, und die Menschen fingen an, aufeinander böse zu werden. Im Rathaus und im Landtag berieten Parteien und Ausschüsse in einem fort. Niemand wusste mehr, wer regiert. Ratlosigkeit und Unsicherheit gingen um. </em></p> <p><em>In der Stadt nämlich herrschte die Revolution und auf dem Lande die Gegenrevolution. Der Bahnverkehr stockte, wilde Streiks tobten, die Geschäftswelt war in tausend Ängsten, vor den Brotläden stauten sich lange Reihen und krakeelten mürrisch. Manchmal schlugen sie die Fenster ein, aber sie fanden kein Brot. Die ganze Maschinerie des täglichen Getriebes schien aus den Fugen, und ein ungeheuerer Druck lag über der Stadt. Der Hunger wurde immer drohender. </em></p> <p><em>Draußen auf den vielen Straßen und Sträßlein des flachen Landes trieb kein Viehtransporter mehr dahin, holperten keine watschelnden Milchfuhrwerke mehr zur nächsten Bahnstation. Jäh, fast von einem Tag auf den andern, gab es keine Milch, keine Butter, kein Ei und kein Fleisch mehr. Auf dem Güterbahnhof standen die leeren Waggons zu Dutzenden auf den angerosteten Schienen, die weiten Hallen gähnten schaurig leer, der Schlacht- und Viehhof lag still, und verlassen dehnten sich die sonst stets belebten Marktplätze aus“</em>. </p>
2. 4 1919 - Noch mehr Schnee
München * Die Schneedecke in der bayerischen Landeshauptstadt ist auf 50 Zentimeter angewachsen.
3. 4 1919 - Die Forderungen nach einem Rätesystem werden wieder lauter
<p><em><strong>Augsburg</strong></em> * Seit Ende März werden die Forderungen nach einem Rätesystem wieder lauter. Das tritt deutlich hervor, als der Vorsitzende des Zentralrats, Ernst Niekisch, auf der großen Räteversammlung in Augsburg eine Rede zum Thema <em>„Die zweite Revolution“</em> hält. Niekisch spricht sich zwar für ein Rätesystem aus, hält aber den Zeitpunkt für seine Einführung für noch nicht gekommen. Letztlich verteidigt er die Bildung der parlamentarischen Regierung.</p> <p>In der sich dem Referat anschließenden lebhaften Diskussion wird hauptsächlich von Vertretern der USPD die Ausrufung einer Räterepublik gefordert. Ein entsprechender Antrag wird mit überwiegender Mehrheit angenommen. Zudem wird ein Bündnis mit den Sowjetrepubliken Ungarns und Russlands gefordert. </p> <p>Um einen Ausweg aus der Bedrängnis zu finden, schlägt Niekisch die Bildung einer Kommission vor, die ihn nach München begleiten und die Forderungen im Ministerrat vortragen soll. </p>
3. 4 1919 - Johannes Hoffmann beruft den Landtag für den 8. April ein
München * Am Abend gibt Ministerpräsident Johannes Hoffmann völlig überraschend bekannt, dass der Landtag - entgegen bestehender Absprachen - am kommenden Dienstag, dem 8. April, wieder eine Sitzung abhalten würde.
Die angekündigte Einberufung des Parlaments ist eine politische Machtdemonstration Hoffmanns. Anschließend reist das bayerische Regierungsoberhaupt nach Berlin.
Unterstützt wird der SPD-Ministerpräsident von den bürgerlichen Parteien, die im Landtag das einzige Instrument sehen, politisch doch noch in Erscheinung zu treten.
Um den 3. 4 1919 - Die Sozialisierungskommission tritt endgültig zurück
Weimar - Berlin * Die Mehrheitssozialdemokraten lehnen tief greifende Sozialisierungsmaßnahmen unter dem Eindruck
- der harten Forderungen der Alliierten,
- der Demobilmachungsprobleme und
- der katastrophalen Ernährungslage ab.
Daraufhin tritt die Kommission zur Erarbeitung eines Sozialisierungskonzepts endgültig zurück.
3. 4 1919 - Das Ministerium für Handel, Industrie und Gewerbe wird gegründet
München * Das Ministerium für Handel, Industrie und Gewerbe wird gegründet.
3. 4 1919 - Die Tätigkeit der Räte unnötig behindert
München * Der Zentralrat beschwert sich bei der Regierung Hoffmann, dass die eingesetzten Kommissionen bei ihrer Arbeit auf Widerstand und Hindernisse stoßen. Damit wird die Tätigkeit der Räte unnötig behindert.
3. 4 1919 - Den Adel in Deutschösterreich abgeschafft
Wien * Die Adelstitel und Adelsprivilegien werden in Deutschösterreich aufgehoben.
3. 4 1919 - Die Presse polemisiert gegen die Einberufung des Landtags
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Gegen die Einberufung des Landtags polemisiert die Presse lautstark: Die Landtagsabgeordneten hätten sich nicht als würdige Volksvertreter erwiesen und seien nach dem 21. Februar feige aus der Hauptstadt geflohen. Daher können die Münchner guten Gewissens auf ihre Rückkehr verzichten.</p> <p>Die Räte, vor allem die Kommunisten und die Anarchisten unter ihnen, fühlen sich durch Hoffmanns Ankündigung provoziert. Sie antworten mit Demonstrationen und Protestveranstaltungen in ganz Bayern. </p>
3. 4 1919 - Ratschläge für das weitere politische Vorgehen in Bayern
München - Berlin * Ministerpräsident Johannes Hoffman fährt mit dem Nachtzug nach Berlin, um Ratschläge für das weitere politische Vorgehen in Bayern einzuholen.
- Reichskanzler Philipp Scheidemann weist Hoffmann an, in der Rätefrage keine Kompromisse zu dulden. Falls es die Zustände in München nicht erlauben, solle er den Landtag in eine ruhigere Stadt in Nordbayern verlegen.
- Reichswehrminister Gustav Noske bietet Hoffmann die militärische Hilfe der Reichswehr an, verlangt aber im Gegenzug den Verzicht Bayerns auf seine militärischen Sonderrechte und die bedingungslose Anerkennung des neuen Reichswehrgesetzes.
- Johannes Hoffmann lehnt ab. Er will selbst für Ordnung sorgen durch die Gründung einer aus Freiwilligen bestehenden Volkswehr.
- Der Freistaat Bayern hat zu diesem Zeitpunkt noch die Souveränität und ist damit noch im Besitz der Reservatrechte über das Militär, die Post und die Bahn.
3. 4 1919 - Den Gesichtsverlust mit übertriebenen Aktivismus besiegen
München * Da es Ministerpräsident Johannes Hoffmann am 27. März nicht gelungen ist, die Berufung des Wirtschaftssozialisten Otto Neuraths zum Leiter des Zentralwirtschaftsamtes zu verhindern, hat er einen herben Gesichtsverlust erlitten. Diesen versucht er jetzt durch übertriebenen Aktivismus in anderen politischen Bereichen wettzumachen.
3. 4 1919 - Gedanken zur Verlagerung des Landtags
München * Der Liberale Ernst Müller-Meinigen schreibt aus seiner Sicht: Ministerpräsident Johannes Hoffmann „klagte außerordentlich über den demagogischen Druck, den gerade Neurath ausübte, dem er allein auf die Dauer nicht gewachsen sei, da Neurath die Massen ungeheuer aufpeitsche und bei jeder Gelegenheit mit der Straße drohe.
Ich erklärte Hoffmann, dass dann ein Fortarbeiten des Landtags, das wir dringend fordern müssten, in München unmöglich sei und daher ernstlich an die Verlegung des Landtags nach Bamberg oder Landshut gedacht werden müsse. Hoffmann bestritt dies nicht, im Gegenteil.“
3. 4 1919 - Protestversammlung der Erwerbslosen
München-Au * Die Erwerbslosen protestieren in einer Versammlung im Münchner-Kindl-Keller gegen die Preissteigerungen von Brennmaterial und die am 1. April vorgenommene Erhöhung der Straßenbahn-Fahrpreise. Sie stellen weitreichende Forderungen an die Regierung Hoffmann. Sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden, „so wären die Erwerbslosen Münchens zur Selbsthilfe gezwungen“.
3. 4 1919 - Die Forderungen der revolutionären Soldaten
München-Maxvorstadt * Im Löwenbräukeller tagt eine Versammlung von über dreitausend revolutionären Soldaten. Sie fordern
- eine gründliche Säuberung der Soldatenräte,
- eine kommunistische Führung für das Rätesystem und
- die sofortige Bildung einer Roten Armee.
4. 4 1919 - Generalstreik in Augsburg ausgerufen
<p><em><strong>Augsburg - München</strong></em> * In Augsburg rufen Arbeiterräte einen Generalstreik aus. Eine Delegation der Augsburger Räte erscheint am Abend im Ministerrat und trägt ihre Forderung nach Ausrufung einer Räterepublik vor. Die SPD-Minister lehnen eine Räterepublik nicht kategorisch ab, wollen aber in Abwesenheit des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann keine Entscheidung treffen. </p>
4. 4 1919 - Stellenlose Kaufleute demonstrieren vor dem Montgelas-Palais
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Stellenlose Kaufleute demonstrieren vor dem Ministerium des Äußeren am Promenadeplatz, dem Montgelas-Palais. </p>
4. 4 1919 - Die Kommunisten lehnen die Räterepublik ab
<p><em><strong>München</strong></em> * In einer Vertreterversammlung der Arbeiter-, Angestellten- und Beamten-Ausschüsse fordert Gustav Klingelhöfer die Proklamation der Räterepublik.</p> <p>Eugen Leviné und Max Levien sprechen sich als Führer der kommunistischen Partei gegen die Räterepublik aus, obwohl sie diese bisher lautstark propagiert haben. </p>
4. 4 1919 - Dr. Arnold Wadler: Der Landtag wird am 8. April nicht zusammentreten
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Auf einer vom Zentralrat einberufenen und gut besuchten Veranstaltung im Löwenbräukeller teilt Dr. Arnold Wadler mit, dass der Landtag am 8. April nicht zusammentreten wird. Wadler fordert dagegen:</p> <ul> <li>die Schließung des Landtags,</li> <li>die Ausrufung eines Generalstreiks,</li> <li>die Proklamierung der Räterepublik und</li> <li>die Verbrüderung mit dem russischen und ungarischen Proletariat.</li> </ul> <p>Der Zentralrat beschließt nach einer lebhaften Diskussion, die für Dienstag [= 8. April] anberaumte Wiedereröffnung des Parlaments abzusagen. </p>
4. 4 1919 - Der Zentralrat ist gegen die Einberufung des Landtags
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Zentralrat spricht sich gegen das Vorhaben des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, den Landtag am 8. April erneut einzuberufen, aus, nachdem er es aus der Presse erfahren hatte. Er teilt dies dem Ministerrat mit und droht mit einem Generalstreik, falls der Landtag doch zusammentreten sollte. </p> <p>Die anwesenden Minister lehnen jetzt die Einberufung des Landtags ab, obwohl sie am Vortag keine Bedenken geäußert hatten. Nachdem die Münchner Garnison erklärt, dass sie nicht zum Schutz des Landtags zur Verfügung stehen wird, entscheidet sich der Ministerrat mehrheitlich gegen eine Einberufung des Landtags. </p>
4. 4 1919 - Die Kasernenräte unterstützen den Zentralrat
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Münchner Kasernenräte stellen sich voll hinter den Zentralrat. Sie beschließen einstimmig:</p> <ul> <li>Beim Zusammentritt des Landtags keine Bereitschaften zu stellen und Schutzmaßnahmen zu treffen.</li> <li>Bei einem Generalstreik liegen die Sympathien der Garnison bei den Arbeitern. <em>„Die Garnison bleibt neutral“</em>. </li> </ul>
4. 4 1919 - Beratungen zur Ausrufung einer Räterepublik
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * Im Außenministerium im Palais Montgelas treffen sich etwa dreißig Personen, darunter Minister der Regierung Hoffmann, Stadtkommandant Oskar Dürr und Polizeipräsident Joseph Staimer, Gewerkschafter, Vertreter des Zentralrats und weitere.</p> <p>Es geht um die Frage der Ausrufung einer Räterepublik. Doch die Versammlung unter der Leitung von Ernst Niekisch trennte sich ohne gefasste Beschlüsse. </p>
4. 4 1919 - Eine weitere geheime Beratung zur Räterepublik
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Um 22 Uhr findet eine erneute Besprechung im Militärministerium in der Ludwigstraße statt. Diesmal ist der Personenkreis auf 100 bis 150 angewachsen.</p> <ul> <li>Der Bauernführer Karl Gandorfer erklärt unter welchen Bedingungen die Bauern der Einführung eine Räterepublik zustimmen können. </li> <li>Die verspätet eintreffende Delegation der KPD will diese Form der Räterepublik nicht anerkennen, da die Massen selbst über die Räterepublik entscheiden müssten. Die Haltung der Kommunisten ruft Erstaunen hervor, weil sie bislang die Räterepublik am lautesten forderten. </li> <li>Auch jetzt werden noch keine Beschlüsse gefasst. </li> </ul> <p>Die geheime Zusammenkunft wird durch den Zentralratsvorsitzenden Ernst Niekisch geleitet. Er befindet sich in einem Dilemma, denn einerseits befürwortet er den Rätegedanken, andererseits will er im Interesse von Ruhe und Ordnung die Räterepublik verhindern.</p> <p>Zur Überraschung aller erklärt ausgerechnet Johannes Hoffmanns Stellvertreter Ernst Schneppenhorst, dass er eine Räterepublik zum jetzigen Zeitpunkt für die beste aller Lösungen hält. Der bayerische Militärminister will zwei Tage Bedenkzeit, um die Frage der Räterepublik mit der SPD-Parteibasis zu besprechen.</p> <p>Welche Motivation liegt hinter Schneppenhorsts Vorschlag? Sein Hauptziel ist die Machterhaltung der SPD. Zudem will er die Kommunisten unter seine Kontrolle bringen. Er möchte den Räten ihre eigene Regierungsunfähigkeit vor Augen führen, um sie dann, mit einem Militärputsch der Münchner Garnison, die er wenigstens teilweise in der Hand hat, schnell und möglichst schmerzlos zu beseitigen. Er und die Regierung Hoffmann wollen die Räte nicht nur schnell, sondern vor allem in eigener Regie, ohne die von Noske und Epp angebotenen außerbayerischen Freikorps und Regierungstruppen, loswerden. </p>
4. 4 1919 - Thomas Mann und die Proletarierkultur
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Schriftsteller Thomas Mann schreibt in sein Tagebuch: <em>„In Augsburg Generalstreik und Forderung der Räterepublik sowie des Anschlusses an Russland und Ungarn. Hätte außenpolitisch gewiß nichts dagegen. Aber die Proletarierkultur!“ </em></p>
5. 4 1919 - Das Führen bayerischer Adelstitel wird ausdrücklich verboten
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Bezugnehmend auf das <em>„Gesetz über die Aufhebung des bayerischen Adels“</em> wird in einer Bekanntmachung der Staatsregierung das Führen bayerischer Adelstitel ausdrücklich verboten. Das Gesetz wird durch die Weimarer Verfassung vom 11. August wieder aufgehoben. </p>
5. 4 1919 - Errungenschaften der Revolution auf Dauer erhalten
<p><strong><em>München</em></strong> * Am 5. und 6. April findet der Gautag der Sozialdemokraten Südbayerns statt. Die Versammelten erklären sich mit der Errichtung einer Räterepublik einverstanden, wenn sich die drei sozialistischen Parteien [SPD, USPD und Kommunisten] an der Durchführung beteiligen. Es geht ihnen um den Erhalt der <em>„Errungenschaften der Revolution gegen alle Anschläge der Reaktion“</em>. </p>
5. 4 1919 - Weitreichende Forderungen der Soldaten
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Die Soldaten des 1. Infanterie-Regiments beschließen die Umbenennung der Marsfeld-Kaserne in Kurt-Eisner-Kaserne. </p> <p>Sie fordern vom Zentralrat</p> <ul> <li>die sofortige Proklamierung der Räterepublik,</li> <li>wollen als erstes Regiment der zu bildenden Roten Armee geführt werden,</li> <li>fordern die Aufhebung der Offiziersvorrechte,</li> <li>die sofortige Einstellung der Gehaltszahlungen an Offiziere,</li> <li>eine Neuregelung des Mannschaftsversorgungsgesetzes unter Gleichstellung mit den Offizieren und</li> <li>keine Entlassung der Soldaten, bevor nicht ausreichend Arbeitsstellen geschaffen sind.</li> </ul> <p>Das 2. Infanterie-Regiment benennt seine Kaserne an der Lothstraße in Karl-Liebknecht-Kaserne um.</p>
5. 4 1919 - Gegen die vom Zentralrat geplante Ausrufung einer Räterepublik
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Kommunistische Partei spricht sich gegen die vom Zentralrat geplante Ausrufung einer Räterepublik aus. Denn, so seine Begründung:</p> <ul> <li>Die Proklamation ist entweder eine bewusste Provokation, um die Idee der Räterepublik zu diskreditieren, oder</li> <li>der Versuch bankrotter SPD-Führer, den Anschluss an die Massen zu gewinnen;</li> <li>die Massen sind nicht aufgeklärt,</li> <li>es gibt keinen eigenständigen bayerischen Weg der Revolution und</li> <li>die Kommunisten beanspruchen die Führung.</li> <li>Es wäre nur eine Diktatur des Zentralrates und eben nicht die von den Kommunisten angestrebte Diktatur des Proletariats. </li> </ul>
5. 4 1919 - Ministerpräsident Johannes Hoffmann verweigert sich einer Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann wird in der Sitzung des Ministerrats mit den Forderungen nach einer Räterepublik konfrontiert. Er verweigert sich dem Ansinnen entschieden. Am Abend reist Hoffmann zur Landeskonferenz der SPD nach Nürnberg. </p>
5. 4 1919 - Kommunistische Massenversammlungen lehnen die geplante Räterepublik ab
<p><em><strong>München</strong></em> * In Massenversammlungen im Hofbräuhaus, im Löwenbräukeller, im Münchner-Kindl-Keller und im Wagner-Saal wird die vom Zentralrat geplante Räterepublik ebenfalls abgelehnt. Die Versammlungen fordern dagegen die Ausrufung einer <em>„Räterepublik auf kommunistischer Grundlage nach russischem Vorbild“</em>. </p>
5. 4 1919 - Der Ältestenrat verzichtet auf die Landtags-Einberufung
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Ältestenrat des Landtags beschließt - unter Protest - den Verzicht auf Einberufung des Landtags. Begründung: <em>„Um einen offenen Bürgerkrieg zu vermeiden“</em>. </p>
5. 4 1919 - Für die Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * Auf einer Reihe von Massenversammlungen am 5. und 6. April wird für eine Räterepublik geworben. Die Redner treffen dort überall auf begeisterte Zustimmung. </p>
5. 4 1919 - Ministerpräsident Hoffmann wieder zurück in München - Aber zu spät
<p><em><strong>Berlin - München</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann ist wieder von seinen Beratungen mit der Reichsregierung in Berlin zurück in München. Zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hat Hoffmann den Machtkampf gegen den Zentralrat bereits verloren. Während seiner Abwesenheit haben sich in München wichtige Weichenstellungen ereignet. </p>
6. 4 1919 - Der Nürnberger SPD-Parteitag spricht sich gegen die Räterepublik aus
<p><em><strong>Nürnberg - München</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann ist zum Landesparteitag der SPD nach Nürnberg gereist, um dort die Genossen gegen die Räterepublik zu mobilisieren. Die Reichs-SPD hat Otto Wels geschickt, um die bayerischen Genossen auf Kurs zu halten.</p> <ul> <li>Der Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst, zählt die Gründe auf, die aus seiner Sicht unumgänglich für die Einführung der Räterepublik sind.</li> <li>Ministerpräsident Hoffmann verurteilt die Räterepublik aufs schärfste und sagt den Kommunisten und den Anarchisten den Kampf an.</li> </ul> <p>Durch seine Rücktrittsdrohung bringt er eine klare Mehrheit von 47 gegen 3 Stimmen - <em>„aus politischen und wirtschaftlichen Gründen“</em> - gegen eine bayerische Räterepublik aus. </p>
6. 4 1919 - Der Zentralrat informiert alle Behörden über die Räterepublik
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Bereits vor der Ausrufung der Räterepublik Baiern informiert der Zentralrat alle bayerischen Behörden über die bevorstehenden Maßnahmen telegraphisch und fordert die Beamten zur Mitarbeit auf. </p>
6. 4 1919 - Der Zentralrat entscheidet für die Ausrufung der Räterepublik Baiern
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * In der Nacht vom 6. zum 7. April sprechen sich im ehemaligen Schlafzimmer der Königin im Wittelsbacher Palais neben der SPD auch die USPD, die Mitglieder des Zentralrats und der Revolutionäre Arbeiterrat für eine Räterepublik Baiern aus, obwohl die KPD dieses Vorhaben ablehnt. Man glaubt dennoch, dass die Bevölkerung und die Armee geschlossen hinter diesem Systemwechsel steht.</p> <p>Ernst Niekisch führt den Vorsitz der Zusammenkunft. Er geht irrtümlich davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt keine rechtmäßige bayerische Regierung mehr existiert, da ihm mit Ausnahme von Hoffmann und Endres die Rücktrittserklärungen sämtlicher Minister vorliegen.</p> <p>Die Angaben über die Zahl der Anwesenden schwankt zwischen 70 und 150. Gustav Landauer stellt den Antrag, dass die Tagung zur konstituierenden Versammlung erklärt wird. Er hat einen Aufruf <em>„An das Volk in Baiern“</em> vorbereitet, der die Gründung der Räterepublik ankündigt. Der Entwurf wird nach kurzer Beratung von den Anwesenden akzeptiert. Damit kann er am nächsten Morgen in den Zeitungen erscheinen. </p>
6. 4 1919 - Die Eisenbahn verspätet sich
<p><em><strong>München</strong></em> * Ernst Schneppenhorst, der Minister für Militärangelegenheiten, soll den Zentralrat über die strikte Ablehnung einer Räterepublik informieren. Doch Schneppenhorsts Zug verspätet sich - und bis er in München eintrifft ist Bayern bereits eine Räterepublik. </p>
6. 4 1919 - Die SPD Oberbayern ist für die Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * Auf einem außerordentlichen Gautag der SPD Oberbayern in München sprechen sich die Delegierten mit 240 gegen 13 Stimmen für die Räterepublik aus. Andererseits haben sie sich zuvor mit 223 zu 30 Stimmen gegen eine bedingungslose Anerkennung der Räterepublik ausgesprochen. </p>
6. 4 1919 - Verwirrung um Ministerpräsident Johannes Hoffmann
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Liberale Ernst Müller-Meinigen leitet eine Dringlichkeitssitzung des Ältestensrats des Bayerischen Landtags. In seinem Tagebuch vermerkt er die Vorgänge:</p> <p><em>„Die Sachlage spitzte sich immer mehr zu. Wir waren gewärtig, jede Stunde als Geisel eingesteckt zu werden. Trotzdem beschlossen die Ältesten, am Sonntag </em>[= 6. April] <em>nochmals im Landtag zusammenzutreten, dann aber in Privatwohnungen die Beratungen fortzusetzen. </em></p> <p><em>Die wildesten Gerüchte verbreiteten sich, er </em>[Ministerpräsident Johannes Hoffmann] <em>sei in die Schweiz geflohen. Niemand wusste, wo er weilte, da er am Samstag</em> [= 5. April] <em>kein Wort über eine beabsichtigte Reise verlor. Allgemeine Verwirrung!“ </em></p>
6. 4 1919 - Nürnberg will nicht zum Landtags-Sitz werden
<p><em><strong>Nürnberg</strong></em> * Am Rande des SPD-Parteitages in Nürnberg berät sich Ministerpräsident Johannes Hoffmann mit seinem Parteifreund, dem Nürnberger Oberbürgermeister Otto Geßler, ob der Landtag künftig in Nürnberg tagen soll.</p> <p>Geßler spricht sich dagegen aus, da er befürchtet, dass sich der <em>„Schwabinger Literatenschwarm“</em> in Nürnberg breitmachen könnte. Er schlägt Hoffmann Ansbach oder Bamberg vor. </p>
6. 4 1919 - Die Fürther wollen eine Räteregieung und eine Rote Armee
<p><em><strong>Fürth</strong></em> * In Fürth erklärt der Arbeiter- und Soldatenrat und in der Nacht zum 7. April, dass er <em>„sowie die gesamte Garnison […] auf dem Boden der Räteregierung“</em> steht. Die Fürther fordern: <em>„Die Bildung einer roten Armee solle aus revolutionär sozialistischen Arbeitern sofort vorgenommen werden“</em>. </p>
6. 4 1919 - Ein Aufruf „An das Volk in Baiern!“ zur Gründung der Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * <em>„Der revolutionäre Zentralrat Baierns“</em> veröffentlicht einen Aufruf <em>„An das Volk in Baiern!“</em> zur Gründung der Räterepublik. Darin heißt es: </p> <ul> <li><em>„Die Entscheidung ist gefallen. Baiern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist Herr seines Geschickes. Die revolutionäre Arbeiterschaft und Bauernschaft Baierns, darunter auch alle unsere Brüder, die Soldaten sind, durch keine Parteigegensätze mehr getrennt, sind sich einig, dass von an jegliche Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende haben muss. Die Diktatur des Proletariats, die nun zur Tatsache geworden ist, bezweckt die Verwirklichung eines wahrhaft sozialistischen Gemeinwesens, in dem jeder arbeitende Mensch sich am öffentlichen Leben beteiligen soll, einer gerechten sozialistisch-kommunistischen Wirtschaft. </em></li> <li><em><em>Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst, das von ihm eingesetzte Ministerium zurückgetreten. Von den Räten des arbeitenden Volkes bestellte, dem Volk verantwortliche Vertrauensmänner erhalten als Volksbeauftragte für bestimmte Arbeitsgebiete außerordentliche Vollmachten. Ihre Gehilfen werden bewährte Männer aus allen Richtungen des revolutionären Sozialismus und Kommunismus sein; die zahlreichen tüchtigen Kräfte des Beamtentums, zumal der unteren und mittleren Beamten, werden zur tatkräftigen Mitarbeit im neuen Baiern aufgefordert. Das System der Bürokratie aber wird unverzüglich ausgetilgt. </em></em></li> <li><em><em><em>Die Presse wird sozialisiert. </em></em></em></li> <li><em><em><em><em>Zum Schutz der baierische Räterepublik gegen reaktionäre Versuche von außen und von innen wird sofort eine rote Armee gebildet. Ein Revolutionsgericht wird jeden Anschlag gegen die Räterepublik sofort rücksichtslos ahnden. Die Baierische Räterepublik folgt dem Beispiel der russischen und ungarischen Völker. Sie nimmt sofort die brüderliche Verbindung mit diesen Völkern auf. Dagegen lehnt sie jedes Zusammenarbeiten mit der verächtlichen Regierung Ebert, Scheidemann, Noske, Erzberger ab, weil diese unter der Flagge einer sozialistischen Republik das imperialistisch-kapitalistisch-militaristische Geschäft des in Schmach zusammengebrochenen deutschen Kaiserreichs fortsetzt. </em></em></em></em></li> <li><em><em><em><em><em>Sie ruft alle deutschen Brudervölker auf, den gleichen Weg zu gehen. Allen Proletariern, wo immer sie für Freiheit und Gerechtigkeit, wo immer sie für den revolutionären Sozialismus kämpfen, in Württemberg und im Ruhrgebiet, in der ganzen Welt, entbietet die Baierische Räterepublik ihre Grüße. </em></em></em></em></em></li> <li><em><em><em><em><em><em>Zum Zeichen der freudigen Hoffnung auf eine glückliche Zukunft für die ganze Menschheit wird hiermit der 7. April zum Nationalfeiertag erklärt. Zum Zeichen des beginnenden Abschied vom fragwürdigen Zeitalter des Kapitalismus ruht am Montag, den 7. April1919, in ganz Baiern dieArbeit, soweit sie nicht für das Leben des werktätigen Volkes notwendig ist, worüber gleichzeitig nähere Bestimmungen ergehen. </em></em></em></em></em></em></li> </ul> <p><em>Es lebe das freie Baiern! Es lebe die Räterepublik! Es lebe die Weltrevolution!“</em> </p>
7. 4 1919 - Die Mitglieder des Zentralrats rufen die Räterepublik Baiern aus
<p><strong><em>München</em></strong> * In der Nacht vom 6. auf den 7. April erfolgt im Wittelsbacher Palais - mit Zustimmung von Vertretern der SPD, der USPD, der Gewerkschaften und des Revolutionären Arbeiterrates - die Proklamation der Baierischen Räterepublik. Dieser Vorgang wird als 3. Revolution, als Räterepublik des Zentralrats oder - von den Kommunisten - auch als Scheinräterepublik bezeichnet. Die Regierung Hoffmann hat sich - wahrscheinlich unter dem Einfluss der Parteileitung in Berlin - im letzten Moment gegen die Ausrufung entschieden.</p> <p>Durch den Boykott der Kommunisten und den Rückzug der SPD fallen den Mitgliedern des Revolutionären Arbeiterrats und der USPD eine Schlüsselrolle zu. </p>
7. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann geht nach Nürnberg, später nach Bamberg
<p><em><strong>München - Nürnberg - Bamberg</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann verlegt den Sitz seines Ministerrats zunächst nach Nürnberg, später nach Bamberg, wo er mit dem Landtag und den noch verbliebenen SPD-Ministern Unterschlupf finden wird.</p> <p>Bis zum 16. August 1919 ist Bamberg der bayerische Regierungssitz. Untergebracht ist die Regierung in der ehemaligen Fürstbischöflichen Neuen Residenz am Domplatz. </p>
7. 4 1919 - Gründung eines Revolutionären Hochschulrats
<p><strong><em>München</em></strong> * Angehörige der Gruppe sozialistischer Akademiker gründen einen Revolutionären Hochschulrat. Er beseitigt den am 5. April gegründeten und aus drei Sudenten bestehenden Provisorischen Studentenrat der Universität München“. Der Revolutionäre Hochschulrat</p> <ul> <li>will die Universität sofort schließen,</li> <li>die bisherige Universitätsverfassung aufheben und</li> <li>einen Revolutionären Senat bilden. </li> <li>Sämtliche Lehrkräfte der Universität sollen entlassen und</li> <li>eine völlig neue Hochschule durch Neuberufungen geschaffen werden.</li> </ul> <p>Für den nächsten Tag wird eine allgemeine Studentenversammlung ins Auditorium Maximum der Universität München einberufen. </p>
7. 4 1919 - Die Räterepublik Baiern wird es lediglich ganze sechs Tage geben
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Die Räterepublik Baiern wird es lediglich ganze sechs Tage - bis zum 13. April - geben. Der Schwerpunkt der Rätebewegung findet sich in den Regierungsbezirken Oberbayern und Schwaben. Auch in den größeren niederbayerischen Städten und in der Oberpfalz folgen zahlreiche Städte dem Beispiel Münchens: in Amberg, Burglengenfeld, Landshut, Passau, Regensburg und Straubing, werden Räteregierungen gegründet.</p> <p>Auch in den nordbayerischen Städten Ansbach, Aschaffenburg, Fürth, Hof, Kulmbach, Marktredwitz und Würzburg. Lediglich Bamberg, Erlangen und Nürnberg bildeten in ihrem Stadtgebiet keine Räterepublik. Doch nur an wenigen Orten bestehen die Räterepubliken über den 10. April hinaus. </p>
7. 4 1919 - Die Ausrufung der Räterepublik Baiern funktioniert reibungslos
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Die Ausrufung der Räterepublik Baiern funktioniert in den Behörden reibungslos, </p> <ul> <li>die Besetzung und Übernahme der Zeitungsverlage geht überwiegend friedlich und widerstandslos vonstatten, </li> <li>Polizei und Militär verhalten sich ruhig und bekennen sich zur Räterepublik, </li> <li>KPD und SPD bleiben bei ihrer abwartenden Haltung und stellen sich den Ereignissen nicht entgegen. </li> </ul>
7. 4 1919 - Minister Josef Simon von der USPD tritt zurück
<p><em><strong>München - Nürnberg</strong></em> * Der im 1. Kabinett Hoffmann für Handel und Gewerbe zuständige Minister Josef Simon von der USPD tritt von dieser Funktion zurück. Begründung: <em>„Nachdem in München die Räterepublik ausgerufen ist, das Ministerium Hoffmann den Kampf gegen das Rätesystem proklamierte, ist mein Verbleiben in diesem Ministerium unmöglich.“</em></p>
7. 4 1919 - Der 7. April wird zum Nationalfeiertag erklärt
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern </strong></em>* Der 7. April wird von den Volksbeauftragten zum Nationalfeiertag erklärt.</p>
7. 4 1919 - Die Räterepublik lehnt Zusammenarbeit mit Reichsregierung ab
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Baierische Räterepublik lehnt die Zusammenarbeit mit der Reichsregierung ab und bezeichnet diese als <em>„verächtliche Regierung Ebert, Scheidemann, Noske, Erzberger, weil diese unter der Flagge einer sozialistischen Republik das imperialistisch-kapitalistisch-militärische Geschäft des in Schwachheit zusammengebrochenen deutschen Kaisertums unterstützt“</em>.</p>
7. 4 1919 - Die Münchner Rote Fahne bezeichnet die Räterepublik als Kompromiss
<p><em><strong>München</strong></em> * Die KPD-Zeitung Münchner Rote Fahne bezeichnet die Räterepublik als Kompromiss. Unter dem Titel <em>„Arbeiter! Folgt nur den Parolen der kommunistischen Partei!“</em> protestiert die Zeitung, dass <em>„durch die Proklamierung einer Scheinräterepublik der Gedanke des Rätesystems verwässert oder erwürgt wird“</em>.</p> <p>Die <em>„Abhängigen“</em> und die <em>„Unabhängigen“</em>, SPD und USPD, sind nicht befugt und geeignet, <em>„an Stelle des gesamten Proletariats die Räterepublik zu verkünden“</em>. Sie fordert dagegen die Errichtung einer kommunistischen Räterepublik, da nur sie <em>„die Arbeiterschaft aus aller Not und allem Elend befreien kann“</em>. </p>
7. 4 1919 - Die neue Räteregierung wird gebildet
<p><em><strong>München</strong></em> * In der Räteregierung, also dem Rat der Volksbeauftragten, haben die Schriftsteller Ernst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam führende Funktionen. Ihre geringe politische Erfahrung betrachten sie nicht als Mangel, da sie den herrschenden Konventionen der Politik ja sowieso ablehnend gegenüberstehen. Deshalb wird die Erste Räterepublik häufig auch abschätzend als Literatenrepublik bezeichnet.</p> <p>Das oberste Gremium der Räterepublik ist der Revolutionäre Zentralrat. Er ist den Volksbeauftragten übergeordneten. Der Rat der Volksbeauftragten wird jedoch nie zusammentreten.</p> <ul> <li>Oberster Repräsentant der Baierischen Räterepublik ist zunächst Ernst Niekisch, der aber bereits nach einem Tag den Vorsitz des Revolutionären Zentralrats niederlegt.</li> <li>Ernst Toller wird ab dem 9. April sein Nachfolger. Toller zählt zum linken Flügel der USPD und ist deren Vorsitzender in München.</li> <li>Das Amt des Volksbeauftragten für Finanzen übernimmt Silvio Gesell,</li> <li>Volksbeauftragter für Volksaufklärung wird der Anarchist Gustav Landauer.</li> <li>Volksbeauftragter für Äußeres wird Dr. Franz Lipp [USPD],</li> <li>Volksbeauftragter für Inneres wird Fritz Soldmann [USPD],</li> <li>Volksbeauftragter für Volkswohlfahrt, das ehemalige Ministerium für Soziale Fürsorge, wird August Hagemeister [USPD],</li> <li>Volksbeauftragter für Justiz wird Konrad Kübler [BBB],</li> <li>Volksbeauftragter für Verkehr wird Gustav Paulukum [USPD],</li> <li>Volksbeauftragter für Land- und Forstwirtschaft wird der bisherige Minister Josef Steiner [BBB],</li> <li>Volksbeauftragter für Volkswirtschaft wird Edgar Jaffé [USPD],</li> <li>Volksbeauftragter für Militär wird Otto Killer [USPD].</li> <li>Kommissar für das Ernährungswesen wird Johann Wutzlhofer [BBB] und</li> <li>Kommissar für das Wohnungswesen wird Dr. Arnold Wadler.</li> </ul> <p>Max Levien wird von von Erich Mühsam für das Amt als Volksbeauftragter für Militär vorgeschlagen, doch dieser sagt ab, da die KPD die Mitarbeit in der Räterepublik ablehnt.</p> <p>Damit wird weder die SPD noch die KPD bei der Ämterverteilung der Volksbeauftragten berücksichtigt.</p> <p>Mit der Ausrufung der Räterepublik wird der alte Zentralrat für <em>„erledigt“</em> erklärt. Gustav Landauer teilt mit: <em>„Der alte Zentralrat existiert nicht mehr“</em>. Auch der <em>Aktionsausschuss</em> existiert nicht mehr, was allerdings nirgends offiziell erwähnt wird. </p> <p>Der Bayerische Landtag wird</p> <ul> <li>als <em>„unfruchtbares Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters“</em> für aufgelöst erklärt und</li> <li>die sofortige Gründung einer Roten Armee angekündigt. </li> </ul>
7. 4 1919 - Die Regierung des Freistaates Bayern ist nicht zurückgetreten
<p><em><strong>Nürnberg - München</strong></em> * Mit einer neu gegründeten Propagandaabteilung beginnt der publizistische Kampf gegen die Räteregierung in München. Ein Flugzeug wird angeschafft, das noch am Abend über München und dem Umland der Stadt Flugblätter mit folgendem Inhalt abwirft:</p> <ul> <li><em>„Die Regierung des Freistaates Bayern ist nicht zurückgetreten. </em></li> <li><em><em>Sie hat ihren Sitz von München verlegt. </em></em></li> <li><em><em><em>Die Regierung ist und bleibt die einzige Inhaberin der Gewalt in Bayern und ist allein berechtigt, rechtswirksame Anordnungen zu erlassen und Befehle zu erteilen.“ </em></em></em></li> </ul>
7. 4 1919 - Der Revolutionäre Zentralrat proklamiert die Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * In Zeitungen und auf Flugblättern proklamiert der Revolutionäre Zentralrat die Räterepublik. Der Landtag wird als <em>„aufgelöst“</em> erklärt. Das von ihm eingesetzte Ministerium sei zurückgetreten. (Was nicht stimmt.) Außerdem wird erklärt, dass die gesamte öffentliche Gewalt und die Kontrolle der Verwaltungen durch die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte übernommen wird. </p>
7. 4 1919 - Die Schreibweise
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Räterepublik Baiern wird nun mit <em>„i“</em> statt mit <em>„y“</em> geschrieben. Die neuen Machthaber wollen damit verhindern, dass auch in der äußeren Form des Freistaats nichts mehr an die wittelsbachische Monarchie erinnert.</p> <p>Die Schreibweise <em>„Bayern“</em> ist durch König Ludwig I. am 20. Oktober 1825, nur zwei Tage nach seinem Regierungsantritt, in einer Rechtschreibreform eingeführt worden. Mit dem griechischen <em>„y“</em> im Landesnamen wollte er seine Verehrung für den griechischen Befreiungskampf ausdrücken.</p> <p>Das USPD-Organ Neue Zeitung hält allerdings an der unveränderten Namensgebung des Landes fest. </p>
7. 4 1919 - Die Räteregierung informiert Ungarns Regierung
<p><em><strong>München - Budapest</strong></em> * Die bayerische Räteregierung informiert umgehend den Revolutionären Regierungsrat in Budapest über den politischen Schritt. Der ungarische Regierungschef Bela Kun unterbricht daraufhin die Regierungssitzung und verliest das Münchner Telegramm unter tosendem Beifall:</p> <ul> <li><em>„Die Bayerische Räterepublik folgt dem Beispiel des russischen und ungarischen Volkes. Sie nimmt sofort die brüderliche Verbindung mit diesen Völkern auf. </em></li> <li><em><em>Dagegen lehnt sie jede Zusammenarbeit mit der verächtlichen Regierung Ebert, Scheidemann, Noske, Erzberger ab, weil dieser unter der Flagge einer sozialistischen Republik das imperialistisch-kapitalistisch-militaristische Geschäft des in Schmach zusammen gebrochenen deutschen Kaisertums fortsetzt“</em>.</em></li> </ul> <p>Damit gibt es in Europa schon drei Räterepubliken. </p>
7. 4 1919 - Die befürchtete Koalition Bayern-Österreich-Ungarn
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Die zweimal täglich erscheinende Deutsche Tageszeitung schreibt in ihrer Ausgabe: <em>„Man erwartet, dass die Ausrufung des zwischen Ungarn und Bayern eingekeilten Deutschösterreichs zur Räterepublik nur eine Frage von Tagen sein kann und dass dann durch eine Koalition Bayern-Österreich-Ungarn ein solcher Druck erfolgen werde, dass an die Stelle der Regierung Ebert-Scheidemann eine Räterepublik trete.“ </em></p> <p>Eine interessante Konstellation, die natürlich eine Signalwirkung für das Deutsche Reich hat. </p>
7. 4 1919 - Teile des Bürgertums sind für eine Räterepublik
München * Ein Teil des Bürgertums ist über die Friedensbedingungen der Alliierten so enttäuscht, dass sie nichts gegen die Installierung einer Räterepublik einzuwenden haben. Sie glauben, dass die sozialistischen Politiker das Land so schnell in den Ruin treiben würden, dass die Siegermächte keine Reparationsleistungen mehr aus Deutschland herausholen könnten.
7. 4 1919 - Sozialminister Hans Unterleitner tritt zurück
<p><em><strong>München</strong></em> * Der USPD-Minister für Soziales, Hans Unterleitner, tritt von seinem Amt zurück. In einem persönlich gehaltenen Brief schreibt er an Ministerpräsident Johannes Hoffmann:</p> <p><em>„Hochgeschätzter Herr Kollege Hoffmann!<br /> Infolge der Haltung meiner Partei ist es mir nicht möglich, weiter in der Regierung zu verbleiben. Ich bedauere aufs tiefste, dass eine so außerordentlich tüchtige Kraft wie Sie nicht für die Räte arbeitet. </em></p> <p><em>Manches, was jetzt in München geschieht und was einen mit Abscheu erfüllt, hätte vermieden werden können, wenn Sie sich mit der selben Energie wie für den Landtag für die Räte einsetzen würden.“ </em></p>
7. 4 1919 - Hoffnung auf eine Räterepublik
<p><em><strong>München-Bogenhausen</strong></em> * Thomas Mann vertraut seinem Tagebuch folgendes an:</p> <p><em>„Die erste Seite der Nachrichten mit der Proklamation der Räte-Republik bedeckt. Heute Generalstreik und ‚Nationalfeiertag‘. Anschluss an Ungarn und Russland, Bruch mit Berlin. Rote Garde. Sozialisierung der Presse. Expropriierungspläne</em> [= Sozialisierungspläne].</p> <p><em>Der Ton ist scharf, und doch ist klar, dass es sich um ein vorbeugendes Werk der Mehrheitssozialisten handelt, wie schon bei der ersten Revolution, allerdings so weit gehend, dass die Kommunisten mittun können. Doch rechne ich mit einer vierten, ganz radikalen Umwälzung, bevor der Rückschlag kommt. </em></p> <p><em>Es ist anzunehmen, dass das Reich folgen wird, und wenn der radikale Sozialismus in Deutschland haltbare Formen annimmt, wird auch den Proletariern der Entente-Länder, die dann von kapitalistischer Ausbeutung Deutschlands nichts mehr zu hoffen haben, nichts anderes mehr übrig bleiben. Man muss anerkennen, dass der Kapitalismus gerichtet ist.“ </em></p>
7. 4 1919 - Silvio Gesell wird Volksbeauftragter für Finanzen
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Freigeldtheoretiker Silvio Gesell trifft in München ein, wo er aufgrund des Vorschlags von Gustav Landauer zum Volksbeauftragten für Finanzen ernannt wird. Gesell hat sich in der Finanzwelt einen Namen gemacht, indem er die marode Wirtschaft Argentiniens saniert hatte.</p> <ul> <li>Er will die Geldwirtschaft zugunsten des Warenaustausches zurückdrängen,</li> <li>er vertraut auf die Kraft des freien Marktes,</li> <li>er will die Attraktivität des Geldes als Anlagemittel senken, indem die Währung nicht länger eine feste Größe bildet,</li> <li>er will das Geld - wie die Ware - einem Wertverlust unterwerfen. Bankguthaben sollen keine Zinsen mehr abwerfen und dadurch ein Konsumanreiz geschaffen werden, der das Geld wieder dem Wirtschaftskreislauf zuführt.</li> <li>Er will, dass unproduktives Kapital keine Gewinne mehr erbringt. </li> </ul>
7. 4 1919 - Brüderliche Grüße nach Moskau
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Volksbeauftragte für Äußeres, Dr. Franz Lipp, ein Stuttgarter Schriftsteller und Journalist, informiert die Regierungen von der Gründung der Räterepublik Baiern und übermittelt <em>„brüderliche Grüße“</em> nach Moskau. Die lesenswerte Depesche lautet:</p> <ul> <li><em>„Proletariat Oberbayerns glücklich vereint. Sozialisten plus Unabhängige plus Kommunisten fest als Hammer zusammen geschlossen, mit Bauernbund einig. Klerikal uns wohlgesinnt. Liberales Bürgertum als Preußens Agent völlig entwaffnet. </em></li> <li><em><em>Bamberg Sitz des Flüchtlings Hoffmann, der aus meinem Ministerium den Abtrittschlüssel mitgenommen hat. </em><em>Die preußische Politik, deren Handlanger Hoffmann ist, geht dahin, uns von Norden, Berlin, Leipzig, Nürnberg abschneiden, auch von Frankfurt und vom Essener Kohlengebiet und uns gleichzeitig bei der Entente als Bluthunde und Plünderer zu verdächtigen, dabei triefen die haarigen Gorillahände Gustav Noskes von Blut. </em></em></li> <li><em><em><em>Wir erhalten Kohle und wir erhalten Lebensmittel in reichlichen Mengen aus der Schweiz und aus Italien. Wir wollen den Frieden für immer. Immanuel Kant: Ewigen Frieden 1795 Thesen 2 bis 5. Preußen will den Waffenstillstand zur Vorbereitung des Rachekrieges.“ </em></em></em></li> </ul>
7. 4 1919 - In Rosenheim wird eine Räterepublik ausgerufen
<p><em><strong>Rosenheim</strong></em> * In Rosenheim wird eine Räterepublik ausgerufen und der Belagerungszustand erklärt. </p>
7. 4 1919 - Regensburg schließt sich der Münchner Räterregierung an
<p><em><strong>Regensburg</strong></em> * In Regensburg schließen sich SPD und USPD gemeinsam der Münchner Räteregierung an. </p>
7. 4 1919 - Auf dem Fürther Rathausturm weht die rote Fahne
<p><em><strong>Fürth - Nürnberg</strong></em> * Auf dem Fürther Rathausturm weht die rote Fahne. Doch das Experiment wird scheitern, da weder die Nachbarstadt Nürnberg noch die Mehrheitssozialisten mitmachen. </p>
7. 4 1919 - In Würzburg wird die Räteherrschaft sofort bekämpft
<p><em><strong>Würzburg</strong></em> * In Würzburg beginnt der Versuch der Räteherrschaft mit Belagerungszustand, Pressezensur und Generalstreik, die ein Abgesandter aus München am Nachmittag offiziell ausruft.</p> <p>Die SPD reagiert sofort: Sie wendet sich dagegen und fordert ihre Mitglieder auf, <em>„die volle Verantwortung denen [zu] überlassen, die der bisherigen Regierung eine geordnete Fortführung ihrer Geschäfte unmöglich machten“</em>.</p> <p>Die Revolutionäre nehmen daraufhin Geiseln, eine rätefeindliche Einheitsfront, der auch die SPD angehört, ruft zum Bürgerstreik auf. Es kommt zu Kämpfen um Residenz und Hauptbahnhof mit mehr als 20 Toten. </p>
7. 4 1919 - In Bad Aibling wird die Räterepublik ausgerufen
<p><em><strong>Bad Aibling</strong></em> * In Bad Aibling wird die Räterepublik ausgerufen. </p>
8. 4 1919 - Die Münchner Kasernenräte stehen hinter der Räterepublik
<p><strong><em>München</em></strong> * Über Flugblätter lässt der Vollzugsausschuss des Soldatenrats München erklären, dass die Kasernenräte sämtlicher Münchner Truppenteile hinter der Räterepublik stehen. </p>
8. 4 1919 - Der Revolutionäre Hochschulrat stellte seine Forderungen vor
<p><em><strong>München</strong></em> * Im Auditorium Maximum der Münchner Universität stellt der Revolutionäre Hochschulrat seine am Tag zuvor gefassten Forderungen vor.</p> <p>Bei der Vollversammlung werden die Räteanhänger niedergebrüllt. Von den Rängen regnet es Flugblätter mit Verlautbarungen der Regierung Hoffmann, die von den Anwesenden unter lauten Bravorufen aufgesammelt werden.</p> <p>Nicht nur die Studenten, auch die Professoren denken nicht daran, dem neuen revolutionären Geist zu weichen. Die allgemeine Studentenversammlung verweigert deshalb ihre Zustimmung zu den Maßnahmen. Gustav Landauer beschließt daraufhin, die Universität am 13. April zu schließen. </p>
8. 4 1919 - Ernst Niekisch überlässt Ernst Toller die Leitung des Zentralrats
<p><strong><em>München</em></strong> * Es fehlt der Räterepublik Baiern ein klares Regierungsprogramm. Entscheidungen werden individuell getroffen. Diese widersprechen sich teilweise oder heben sich sogar gegenseitig auf.</p> <p>Ernst Niekisch, der Vorsitzende des Revolutionären Zentralrats, gibt schon am zweiten Tag völlig entnervt auf. Der 25-jährige Anarchist und Schriftsteller Ernst Toller wird sein Nachfolger. </p>
8. 4 1919 - Russland und Ungarn gratulieren zur Errichtung der Räterepublik
<p><em><strong>Moskau - Belgrad - München</strong></em> * Die Räterepubliken in Russland und Ungarn begrüßen in Telegrammen die Errichtung der Baierischen Räterepublik. </p>
8. 4 1919 - Die Bewaffnung des Proletariats beginnt
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Arbeiter des Maffei-Werkes werden bewaffnet. Damit beginnt die vom Provisorischen Revolutionären Zentralrat angeordnete Bewaffnung des Proletariats. </p>
8. 4 1919 - Beschlagnahme und Rationierung der Wohnräume angeordnet
<p><em><strong>München</strong></em> * Um der seit Kriegsende immer schlimmer werdenden Wohnungsnot zu begegnen entschließt sich der Zentralrat unter Federführung von Dr. Arnold Wadler, dem Volkskommissar für das Wohnungswesen, zu drastischen Maßnahmen. Er ordnet die Beschlagnahme und Rationierung der Wohnräume in ganz Bayern an.</p> <ul> <li>Alle freistehenden Wohnungen in ganz Bayern, darunter auch Schlösser von Adeligen, werden beschlagnahmt und an Wohnungssuchende vermietet.</li> <li>Der Wohnraum wird rationiert. Das bedeutet, dass Einzelpersonen nur ein Zimmer und eine Küche zusteht; Familien können einen Gemeinschaftsraum, eine Küche und für je zwei Kinder einen Schlafraum beanspruchen.</li> <li>Jedes freie Zimmer muss der Gemeinde oder den Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten gemeldet werden. Werden Verwandte oder Freunde in überzählige Räume einquartiert, so muss das innerhalb von zwei Wochen geschehen. Nach dieser Frist werden die Räume durch die Gemeinde belegt. Kinderreiche werden gegenüber Kinderlosen bevorzugt, Verheiratete gegenüber Ledigen.</li> <li>Kann sich der Vermieter mit dem Mieter über den Mietpreis nicht einigen, so legt die Gemeinde die Miete fest.</li> <li>Eine private Wohnraumvermittlung ist ebenso streng verboten wie eine kommerzielle.</li> <li>Ein Verstoß gegen die Verordnung kann mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Mark und einem Jahr Gefängnis geahndet werden. </li> </ul>
8. 4 1919 - Ein reines Rätesystem wird vom Reichsrätekongress abgelehnt
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Robert Leinert (SPD), der Vorsitzende des Zentralrats der Deutschen sozialistischen Republik, eröffnet in Berlin den Zweiten Kongress der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte Deutschlands. Der Kongress dauert bis zum 14. April.</p> <ul> <li>Der Kongress lehnt die Einführung eines reinen Rätesystems als Alternative zur parlamentarischen Demokratie mit großer Mehrheit ab. </li> <li>Ein Antrag, der eine gleichberechtigte Kammer der Arbeit neben den Reichstag stellen möchte, wird dagegen angenommen. Vom Grundgedanken einer Demokratisierung der Betriebs- und Wirtschaftsverfassung werden nur die Personal- und Betriebsräte übrig bleiben. </li> </ul>
8. 4 1919 - Lehrtätigkeit an der Akademie der bildenden Künste aufgehoben
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Um eine sofortige durchgreifende Neugestaltung der Kunsterziehung zu ermöglichen, haben die vom Volksbeauftragten Gustav Landauer Ermächtigten, die Lehrtätigkeit an der Akademie der bildenden Künste aufgehoben.</p> <p><em>„Die Studierenden können ihre Arbeit bis auf weiteres fortsetzen, die Tätigkeit der Professoren ist suspendiert, ihre Gehälter werden vorläufig weiter bezahlt. Eine im Anschluss daran stattfindende Vollversammlung der Studierenden drückte in überwiegender Mehrzahl ihre Zustimmung zu der Maßregel aus.“ </em></p>
8. 4 1919 - Bayerische Großstädte schließen sich der Räterepublik an
<p><em><strong>Freistaat Bayern</strong></em> * Mit Ausnahme von Nürnberg haben sich alle großen bayerischen Städte der Räterepublik angeschlossen. </p>
8. 4 1919 - Auch die Münchener Post verwendet die Schreibweise Baiern
<p><strong><em>München</em></strong> * Das SPD-Organ Münchener Post verwendet die Schreibweise <em>„Baiern“</em> im Zusammenhang mit der Räterepublik. </p>
8. 4 1919 - Ankündigung einer Lebensmittelsperre für München und Augsburg
<p><em><strong>München - Augsburg</strong></em> * Am Nachmittag werden über München und Augsburg Flugblätter der Regierung Hoffmann abgeworfen. Sie beinhalten die Ankündigung einer Lebensmittelsperre für München und Augsburg. </p>
8. 4 1919 - Bürgermeister von Borscht stellt den Antrag auf Pensionierung
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Münchner Bürgermeister Wilhelm von Borscht bittet um Versetzung in den Ruhestand zum 1. Oktober 1919. Das Gremium billigt den Pensionierungsantrag und ein 100 Prozent des Diensteinkommens betragendes Ruhegehalt. </p>
Um den 8. 4 1919 - Gesell fordert die Abschaffung der systemlosen Papiergeldwirtschaft
<p><em><strong>München - Berlin</strong></em> * Der Volksbeauftragte für Finanzen, Silvio Gesell, fordert den Reichsbankpräsidenten Rudolf Havenstein auf, auf die <em>„systemlose Papiergeldwirtschaft“</em> zu verzichten. </p>
Um den 8. 4 1919 - Württemberg und der Schweiz den Krieg erklärt
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Volksbeauftragte für Äußeres, Dr. Franz Lipp, erklärt Württemberg und der Schweiz den Krieg, weil sie sich weigern, ihm leihweise 65 Lokomotiven zu überlassen.</p> <p>Er schreibt an den Volksbeauftragten für Verkehr, Gustav Paulukum: <em>„Ich bin sicher, dass wir siegen, außerdem werde ich den Segen des Papstes, mit dem ich gut bekannt bin, für diesen Sieg erflehen.“ </em></p>
Um den 8. 4 1919 - Verweigerung der Telefonate
<p><em><strong>München</strong></em> * Dr. Franz Lipp, der Volksbeauftragte für Äußeres, weigert sich strikt, Telefonate anzunehmen. Seinem Mitarbeiterstab erklärt er dies so:</p> <p><em>„Da die Verleumder meines Vorgängers Kurt Eisner sich regelmäßig auf Hörfehler und Missverständnisse durch das Telefon herausgelogen haben, so gebe ich bekannt, dass ich dem Tefefonruf nach meiner Person bei der Verantwortlichkeit meines Amtes grundsätzlich keine Folge leiste.“</em> </p>
8. 4 1919 - Die Republikanische Schutztruppe unterstützt die Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * Alfred Seyfferitz, der Kommandant der Republikanischen Schutztruppe, gibt eine Erklärung für seine Einheit die Erklärung ab, dass sie - ebenso wie die gesamte Münchner Garnison - <em>„hinter der sozialistisch-kommunistischen Räterepublik“</em> steht. </p>
8. 4 1919 - Propagandaflugblätter der Regierung Hoffmann über München
<p><em><strong>Bamberg - München</strong></em> * Flugzeuge werfen über München Propagandaflugblätter der nach Bamberg geflohenen Regierung Hoffmann ab. Auf ihnen ist zu lesen:</p> <p><em>„Werktätiges Volk Münchens!<br /> Willst Du Dich noch länger von verkommenen Literaten und Revolutionsbummlern terrorisieren lassen!“</em>. </p>
9. 4 1919 - Zugverbindungen und Lebensmittelversorgung werden unterbrochen
München * Zugverbindungen werden unterbrochen und damit der Nachschub von Lebensmitteln und Kohle unterbunden.
9. 4 1919 - In Braunschweig wird die Räterepublik ausgerufen
<p><strong><em>Braunschweig</em></strong> * In Braunschweig wird die Räterepublik ausgerufen. </p>
9. 4 1919 - Gemäßigte Linke wollen kommunistische Führer der Räterepublik verhaften
<p><strong><em>München</em></strong> * Führende Männer der gemäßigten politischen Linken planen, die kommunistischen Führer der Räterepublik und die Ausländer und Juden zu verhaften. Zusammen mit Carl Gandorfer, dem Polizeipräsidenten Josef Staimer und Stadtkommandant Oskar Dürr will der Volksbeauftragte der Justiz, Konrad Kübler, gegen die Kommunisten gewaltsam vorgehen. </p>
9. 4 1919 - Telefonverkehr mit München stark eingeschränkt
München - Bayern - Berlin - Leipzig - Frankfurt - Hamburg * Den telefonischen Verkehr mit München haben inzwischen Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, Würzburg, Berlin, Hof, Leipzig, Frankfurt und Hamburg eingestellt.
9. 4 1919 - Lebensmittelsperre über München und Augsburg verhängt
<p><em><strong>Bamberg - München</strong></em> * Flugzeuge werfen am Nachmittag Flugblätter der inzwischen nach Bamberg übersiedelten Regierung Hoffmann über München ab. In diesem wird mitgeteilt, dass die Bauernschaft Frankens, der Oberpfalz und des Rieses vom 8. April an eine Lebensmittelsperre über München und Augsburg verhängt haben. </p>
9. 4 1919 - Wilhelm Reichart wird Volksbeauftragter für das Militärwesen
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Kellner und Mitglied des Vollzugsausschusses des Landessoldatenrats, Wilhelm Reichart, wird einvernehmlich zwischen dem Provisorischen Revolutionären Zentralrat und den Kasernenräten zum Volksbeauftragten für das Militärwesen ernannt. Er wird das Amt bis zum 13. April ausüben.</p>
9. 4 1919 - Betriebsobleute und Soldaten fordern die Abdankung des Zentralrats
<p><em><strong>München</strong></em> * Die KPD ruft eine Versammlung der Revolutionären Obleute in den Münchner-Kindl-Keller ein, den Rat Revolutionärer Betriebsobleute und Revolutionärer Soldatenvertreter.</p> <ul> <li>Eugen Leviné erklärt die Versammlung zum Träger der politischen Gewalt und</li> <li>den Revolutionären Zentralrat für abgesetzt.</li> <li>Ein neuer, aus zwanzig Personen bestehender provisorischer Zentralrat wird gewählt.</li> <li>Um 23 Uhr wird ein Generalstreik ausgerufen und</li> <li>zur Entwaffnung der Polizei aufgerufen.</li> </ul> <p>Eine Abordnung wird mit der Aufforderung zum Rücktritt zum Revolutionären Zentralrat gesandt.</p> <p>Ernst Toller und Gustav Klingelhöfer, die an der Versammlung teilnehmen, werden in Gewahrsam genommen. </p>
9. 4 1919 - Die Kapitalflucht soll unterbunden werden
<p><em><strong>München</strong></em> * Ernst Tollers erste Verordnung betrifft den Bankensektor. Ein Anschlag des Revolurionären Zentralrats gibt bekannt, dass <em>„Der revolutionäre Bankrat für Baiern“</em> in München <em>Vertrauensleute</em> bestimmt hat, die <em>„die Auszahlung von Geldern bei den Banken zu überwachen haben, um zu verhindern, dass landesverräterische Kapitalisten ihr Geld ins Ausland verbringen“</em>. Damit soll die Kapitalflucht verhindert werden.</p> <p>Es dürfen nur noch Beträge bis zu 100 Mark täglich oder 700 Mark wöchentlich abgehoben werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind ausstehende Rechnungen, Kreditrückzahlungen und Zinstilgungen sowie Lohnzahlungen und Zahlungen im Geschäftsverkehr von Firmen. Die zuletzt genannten müssen vom Betriebsrat gegengezeichnet werden. </p>
9. 4 1919 - Ernst Toller ist Vorsitzender des Revoutionären Zentralrats
<p><em><strong>München</strong></em> * Ernst Toller beginnt seine Tätigkeit als Vorsitzender des Revolutionären Zentralrats. </p>
9. 4 1919 - Ein Aufruf des Revolutionären Zentralrats an alle Proletarier
<p><em><strong>München</strong></em> * In einem Aufruf des Revolutionären Zentralrats <em>„An alle Proletarier“</em> ist ein Rätekongress vorgesehen, der nach Neuwahlen der Arbeiterräte entstehen soll. Weder zur Wahl noch zum Zusammentreffen eines Rätekongresses wird es je kommen. </p>
9. 4 1919 - Linke Kritik an der Räteregierung
<p><em><strong>München</strong></em> * In der <em>Münchner Roten Fahne</em> erscheint ein Artikel von Eugen Leviné, in dem er die Politik der Räteregierung scharf angreift:</p> <p><em>„Alles wie sonst. In den Betrieben schuften und fronen die Proletarier nach wie vor zugunsten des Kapitals. In den Ämtern sitzen nach wie vor die [...] kgl. Wittelsbacher Beamten. An den Straßen die alten Hüter der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit dem Schutzmannssäbel. </em></p> <p><em>Kein bewaffneter Arbeiter zu erblicken. Keine roten Fahnen. Keine proletarische Besetzung in den Machtpositionen der Bourgeoisie. Noch liegen die Kapitale in den Safes der Banken. Noch klappern die Kuponscheren der Kriegsgewinnler und Dividendenjäger. Noch üben in den Gerichten die königlichen Landgerichtsräte Klassenjustiz. Alles wie sonst. Noch rattern die Rotationsmaschinen der kapitalistischen Presse und speien ihr Gift und ihre Galle, ihre Lügen und ihre Verdrehungen in die nach revolutionären Kampfworten begierige Menge. Alles wie sonst. </em></p> <p><em>Nur an den Straßen von Wind und Regen zerfetzte Plakate: ‚Nationalfeiertag!‘ steht darauf! Nationalfeiertag! Nicht proletarischer Feiertag. Nicht internationaler Feiertag. Von der Nation sprechen sie, der einigen Nation der Arbeiter und Kapitalisten. [...] Sie sitzen zusammen im Wittelsbacher Palais und dichten Dekrete. [...] </em></p> <p><em>Räterepublik ohne Räte. Proletarische Diktatur ohne Proletariat. Volksbeauftragte ohne Auftrag des arbeitenden Volkes. Ein Projekt der Roten Armee ohne Beihilfe des Proletariats, Sozialisierungsprojekte ohne wirkliches Eingreifen der Macht. Angebliche Siege ohne Kämpfe. Revolutionäre Phrasen ohne revolutionären Inhalt, revolutionäre Worte ohne revolutionäre Taten.“ </em></p>
9. 4 1919 - Die Rote Armee wird gegründet
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Zentralratsvorsitzende Ernst Toller gründet nach russischem und ungarischem Vorbild eine schlagkräftige Rote Armee.</p> <ul> <li>Jeder Angehörige der Roten Armee erhält bei freier Verpflegung, Unterkunft und Kleidung eine Tageslöhnung von 7.- Mark.</li> <li>Verheiratete (Selbstverpfleger) erhalten zusätzlich 7,50 Mark.</li> <li>Eintretende Erwerbslose haben nach dem Austritt aus der Roten Armee Anspruch auf Arbeitslosenfürsorge. </li> </ul>
Um den 9. 4 1919 - Außenminister Dr. Franz Lipp unterschreibt seinen Rücktritt
<p><em><strong>München</strong></em> * Das Telegraphenamt leitet Dr. Franz Lipps Telegramme vom 7. und 8. April zwar weiter, doch die Kontrollbeamten informieren den Revolutionären Zentralrat vom Inhalt der Schreiben.</p> <p>Die von Ernst Toller umgehend eingeleiteten Nachforschungen ergeben, dass sich Lipp schon mehrmals in psychiatrischer Behandlung befunden hatte. Toller schreibt: <em>„Zweifellos, Lipp ist wahnsinnig geworden. Wir beschließen, ihn sofort in eine Heilanstalt zu überführen. Um Aufsehen in der Öffentlichkeit zu vermeiden, muss er freiwillig seinen Rücktritt erklären.“</em></p> <p>Dr. Lipp wird seinen Rücktritt mit den Worten: <em>„Was tue ich nicht für die Revolution“</em> unterschreiben. Damit ist die Fehlbesetzung mit dem psychisch kranken <em>Außenminister</em>, der den Anforderungen an sein Amt nicht gewachsen ist, schnell erledigt worden. Dennoch wird sich der Fehlgriff bei der Besetzung des Postens als schwerer Schlag für das Ansehen der Räterepublik erweisen. </p>
9. 4 1919 - In Würzburg endet die Herrschaft der Räte
<p><em><strong>Würzburg</strong></em> * In Würzburg endet die Herrschaft der Räte. Für den Würzburger Oberbürgermeister Andreas Grieser ist das <em>„ein einmütiges Bekenntnis zur reinen Demokratie“</em>. </p>
9. 4 1919 - Victor Klemperers Prophezeiungen
<p><em><strong>München</strong></em> * Victor Klemperer schreibt: <em>„Ich will nicht provezeien, ich glaube aber: der kommende Mann heißt Levien, der gegenwärtige: Landauer, der übernächste: Epp.“ </em></p>
9. 4 1919 - Erich Mühsam übernimmt kein Amt für die Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * Erich Mühsam teilt in einem öffentlichen Aufruf mit, dass er so lange kein öffentliches Amt für die Räterepublik übernehmen wird, bis die Einigung der Arbeiterschaft, symbolisiert durch die Mitarbeit der Kommunisten, Wirklichkeit geworden ist. </p>
Um den 10. 4 1919 - Dr. Fritz Gerlich flieht mit gefälschten Papieren nach Bamberg
<p><strong><em>München - Bamberg</em></strong> * Dr. Fritz Gerlich flieht mit gefälschten Papieren nach Bamberg, wo sich auch die Bayerische Regierung aufhält. Er stellt die Verbindung zu Reichswehrminister Gustav Noske her und agiert als Redner vor den Freikorps für die <em>„Befreiung Münchens von der Räteregierung“</em>.</p>
10. 4 1919 - Einstellungsbeginn für die Rote Armee
<p><strong><em>München-Schwabing</em></strong> * Um 10 Uhr beginnt im Städtischen Wehramt an der Winzererstraße die Werbung für die Rote Armee der Räterepublik Baiern. Es melden sich zwar viele Freiwillige, dennoch ist fraglich, ob ein derart zusammen gewürfeltes und mangelhaft ausgerüstetes Heer, das nur wenige Offiziere aufweist, den gut organisierten Reichswehr- und Freikorpstruppen standhalten kann. </p> <ul> <li>Jeder Angehörige der Roten Armee erhält bei freier Verpflegung, Unterkunft und Kleidung eine Tageslöhnung von 7.- Mark. </li> <li>Verheiratete (Selbstverpfleger) erhalten zusätzlich 7,50 Mark.</li> <li>Eintretende Erwerbslose haben nach dem Austritt aus der Roten Armee Anspruch auf Arbeitslosenfürsorge. </li> </ul>
10. 4 1919 - Gegenrevolutionärer Truppenverbände ziehen in Ingolstadt ein
<p><strong><em>Ingolstadt</em></strong> * Der Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst, und das Freikorps Epp, mit Franz Xaver Ritter von Epp an der Spitze gegenrevolutionärer Truppenverbände, ziehen in Ingolstadt ein. </p>
10. 4 1919 - Ernst Toller redet im Hofbräuhaus vor den Betriebsräten
<p><strong><em>München</em></strong> * Ernst Toller redet im Hofbräuhaus vor den Betriebsräten. Er erklärt zu der am Vorabend vom Rat der Revolutionären Betriebsobleute und vom Rat der Revolutionären Soldatenvertreter beschlossenen sofortigen Abdankung des Zentralrats und seiner eigenen Einsetzung als Träger der gesamten Gewalt, dass</p> <ul> <li>die Kommunisten aus wirtschaftlichen, politischen und militärischen Gründen nicht in der Lage sind, die Herrschaft anzutreten und auf Dauer zu behaupten und</li> <li>der Bauernrat einer kommunistischen Räterepublik jede Unterstützung verweigern würde. </li> </ul>
10. 4 1919 - Ein Anschlag auf Erhard Auer kann verhindert werden
<p><em><strong>München</strong></em> * Am Abend wird in der Chirurgischen Klinik ein Anschlag auf Erhard Auer verhindert. Die bewaffneten Eindringlinge können überwältigt und verhaftet werden. </p>
10. 4 1919 - Der Verein der Staatsbürger jüdischen Glaubens wehrt sich
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Verein der Staatsbürger jüdischen Glaubens wehrt sich in Erklärungen gegen die in Flugblättern erhobenen Vorwürfe, dass die Juden die eigentlichen Triebkräfte der Revolution sind.</p>
10. 4 1919 - Der Verband sozialistischer Lehrer und Lehrerinnen Baierns
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Verband sozialistischer Lehrer und Lehrerinnen Baierns gibt folgende Erklärung ab: </p> <ul> <li><em>„Die Räterepublik ist ausgerufen. Das Volk hat die Macht übernommen. Der Kapitalsmus wird vernichtet. </em></li> <li><em>Frei soll die Schule sein. Das Zerrbild des Armen, abhängigen Schulmeisters ist für immer vernichtet. </em></li> <li><em>Jetzt sind auch wir frei von Kirche und Juristerei. </em></li> <li><em>Helft mit am Siege der Räterepublik!“ </em></li> </ul>
10. 4 1919 - Die Milchlieferungen aus dem Allgäu sind vollständig ausgeblieben
<p><em><strong>Allgäu - München</strong></em> * Nachdem die Milchlieferungen aus dem Allgäu vollständig ausgeblieben sind, kann in den Münchner Kaffeehäusern keine Milch verabreicht werden. </p>
10. 4 1919 - Die Reichsbank stellt die Zahlungsüberweisungen nach Bayern ein
<p><em><strong>Berlin - Freistaat Bayern</strong></em> * Der Versuch, die Stadt und die Räteregierung über Sanktionsmaßnahmen auszuhungern, nimmt immer konkretere Formen an: </p> <ul> <li>Die Reichsbank hat die Zahlungsüberweisungen nach Bayern eingestellt. <br /> Damit wird auch die Belieferung der Banken mit Banknoten wird unterbunden. </li> <li>Die Sparkasse ist für den Publikumsverkehr geschlossen.</li> <li>Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank hat auf Anweisung der Preußischen Regierung die bei ihr liegenden Depots von 80 Millionen Mark nach Berlin geschickt. </li> </ul>
10. 4 1919 - Einsetzung von Revolutionstribunalen bekanntgegeben
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Revolutionäre Zentralrat gibt die Einsetzung von Revolutionstribunalen und deren Zusammensetzung bekannt. Der Name erinnert an die blutige Zeit der Französischen Revolution, doch hier wird kein einziges Todesurteil gesprochen werden, im Gegenteil, die meisten Prozesse enden mit einem Freispruch.</p> <ul> <li>Die höchste Strafe sind eineinhalb Jahre Gefängnis, die höchste Geldbuße beträgt 5.000 Mark.</li> <li>Die Revolutionstribunale bestehen aus vier Gerichten, die in Permanenz, also Tag und Nacht tagen.</li> <li>Jedes Gericht besteht aus sieben Richtern und einem Juristen als Beisitzer.</li> <li>Hinzu kommt ein Verteidiger, den der/die Angeklagte selbst wählen darf.</li> <li>Die Verhandlungen sind öffentlich,</li> <li>die Urteile werden sofort vollstreckt.</li> <li>Von den 28 Richtern gehören je fünf der SPD, der USPD, der KPD und dem Bauernbund an. Vier Richter sind Mitglieder des Revolutionären Arbeiterrats, vier weitere den parteilosen Anarchisten. </li> </ul>
10. 4 1919 - Im Ruhrgebiet streiken 307.000 Beschäftigte
<p><em><strong>Ruhrgebiet</strong></em> * Am Generalstreik im Ruhrgebiet beteiligen sich 307.000 Beschäftigte. Das sind 73 Prozent aller Zechenbelegschaften der Region. </p>
Um den 10. 4 1919 - Hedwig Kämpfer wird als Richterin in das Revolutionstribunal aufgenommen
<p><em><strong>München</strong></em> * Hedwig Kämpfer wird als einzige Frau als Richterin in das 28 Personen umfassende Revolutionstribunal aufgenommen. Lida Gustava Heymann schreibt über sie:</p> <p><em>„Niemals erlebte ich, dass ein Mann selbst bei bestem Willen und Bemühen zustande brachte, was einer Frau, Hedwig Kämpfer, beim Revolutionstribunal gelang. […]<br /> Ihre Fragestellung war einfach, natürlich, führte von Tatsache zu Tatsache, bis das Eingeständnis unvermeidbar geworden war, ihr psychologisches Einfühlungsvermögen arbeitete untrüglich. Der Abzuurteilende war für sie, was für den Musiker sein Instrument ist, das er meisterhaft zu spielen versteht, ihm die feinsten Töne entlockt.“ </em></p>
10. 4 1919 - Der Provisorische Zentralrat tritt zurück
<p><em><strong>München</strong></em> * Der in der Nacht zuvor gewählte 20-köpfige provisorische Zentralrat tritt wieder zurück. Dafür wählt jetzt der Rat Revolutionärer Betriebsobleute und Revolutionärer Soldatenvertreter eine zehnköpfige Abordnung, darunter Eugen Leviné und Max Levien, die mit beratender Stimme an den Sitzungen des Revolutionären Zentralrats teilnehmen sollen. </p>
10. 4 1919 - Eine Frauenquote für die Betriebsräte
<p><em><strong>München</strong></em> * Die <em>„Leitsätze für Betriebsräte“</em> werden herausgegeben. Sie enthalten eine frühe Form einer Frauenquote, da sie entsprechend ihrem zahlenmäßigen Anteil eine Vertretung erhalten. Dadurch erhöht sich der Anteil der Frauen in den Betriebsräten.</p> <p>Von den 1.725 Betriebsräten in München sind 233 weiblichen Geschlechts. Das sind immerhin 13,5 Prozent. In keinem anderen Rätegremium wird eine solche Quote erreicht. </p>
10. 4 1919 - Lena Christ bittet den Zentralrat um finanzielle Unterstützung
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Schriftstellerin Magdalena Jerusalem, genannt Lena Christ, bittet den Zentralratsvorsitzenden Ernst Toller um finanzielle Unterstützung. <em>„Zurzeit habe ich fast 600 Mark Schulden und gar keine Einnahme. Ich muss alle Tage etwas von meinen sauer erworbenen Sachen verkaufen. Bitte unterstützen Sie mich durch eine einmalige größere Summe oder durch ein Monatsgeld, damit ich wieder aufschnaufen kann.“</em></p> <p>Sie endet ihr Schreiben mit dem Satz: <em>„Ich bitte aber inständig, meine Bitte nicht in der Zeitung zu veröffentlichen!“ </em></p>
10. 4 1919 - Die Vossische Zeitung zum Verzicht der systemlosen Papiergeldwirtschaft
<p><em><strong>Berlin - München</strong></em> * Auf Silvio Gesells Vorschlag gegenüber dem Reichsbankpräsidenten Rudolf Havenstein, auf die <em>„systemlose Papiergeldwirtschaft“</em> zu verzichten, titelt die auf die Auflage schielende Vossische Zeitung in Berlin: „<em>Abschaffung des Bargeldes in Bayern“</em>.</p> <p>Darin heißt es: <em>„Gesell, der mit einem Kern gesunder währungspolitischer Kritik utopische Ideen der Lösung aller Fragen durch seine sogenannte absolute Währung verband, wurde in Fachkreisen nicht ganz ernst genommen. Sein Auftauchen in der Münchener Räteregierung rief einiges Lächeln hervor, und das neueste Telegramm dürfte auch kaum den Reichsbankdirektorium Anlass zu sehr schwierigen Beratungen geben.“ </em></p>
10. 4 1919 - Ret Maruts Sozialisierungsplan für die Presse
<p><em><strong>München</strong></em> * Ret Marut [= B. Traven, Otto Feige] veröffentlicht in den Münchner Neuesten Nachrichten seinen <em>„Sozialisierungsplan für die Presse“</em> sowie einen Artikel über <em>„Pressefreiheit oder Befreiung der Presse“</em>. </p>
11. 4 1919 - Pläne für einen Putsch gegen die Räteregierung werden geschmiedet
<p><em><strong>Bamberg</strong></em> * Der Kommandant der Republikanischen Schutztruppe, Alfred Seyfferitz, arbeitet gemeinsam mit Ministerpräsident Johannes Hoffmann und dem Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst, Pläne für einen Putsch gegen die Räteregierung aus. Dieser soll - so die Absprache - in der Nacht vom 15. zum 16. April erfolgen.</p> <ul> <li>Ministerpräsident Hoffmann zögert noch, da er nicht mit Waffengewalt gegen Münchner Arbeiter und Sozialisten vorgehen möchte. </li> <li>Militärminister Ernst Schneppenhorst möchte einen <em>„klinischen Putsch“</em> durchführen. Darunter versteht er den Sturz der Regierung durch eine militärische Überrumpelung ohne großes Blutvergießen. </li> </ul>
11. 4 1919 - Gustav Landauer führt Sozialreformen im Bildungsbereich durch
<p><em><strong>München</strong></em> * Gustav Landauer, der Volksbeauftragte für Volksaufklärung, führt in der kurzen Zeit der (sozialistischen) Räterepublik Baiern einige Sozialreformen im Bildungsbereich ein. Nachdem das Erziehungswesen durch die Regierung Eisner auf eine staatliche Grundlage gestellt worden war, führt Landauer folgende Neuerungen ein:</p> <ul> <li>Die Einheitsschule für alle Schüler vom 7. bis zum 13. Lebensjahr,</li> <li>die Handwerksschulen für die praktische Ausbildung,</li> <li>die Mittelschulen für die weiterführende geistige Ausbildung.</li> <li>Die Abschaffung der Prügelstrafe,</li> <li>die Aufhebung des Zölibats für Lehrerinnen und</li> <li>die Wahl von Schulräten, in die Lehrer, Eltern und Schüler gewählt werden.</li> <li>Die Kirche spielt in diesem Erziehungskonzept keine Rolle mehr.</li> <li>Ein neues Hochschulprogramm für die zweitgrößte deutsche Universität in München wird entwickelt.</li> <li>Der Lehrkörper und die Studenten sollen auf rechtsextremistische Aktivitäten überprüft werden. </li> </ul>
11. 4 1919 - Die Regierung ist vollständig nach Bamberg umgezogen
<p><em><strong>Bamberg</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann, die Minister und die Landessekretariate der einzelnen Parteien sind inzwischen vollständig nach Bamberg übergesiedelt. In den nächsten Tagen soll sich hier auch der Ältesten-Ausschuss zusammenfinden und über die Einberufung des Landtags einen Beschluss fassen. </p>
11. 4 1919 - Das Revolutionstribunal nimmt seine Tätigkeit auf
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Zwischen 10. und 12. April tritt das aus mehreren Gerichten bestehende Revolutionstribunal im Justizpalast zusammen und nimmt seine Tätigkeit auf. Es soll sowohl politische Straftäter als auch gewöhnliche Verbrecher Ihrer Bestrafung zuführen. </p>
11. 4 1919 - Urabstimmung zur Räterepublik
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Sozialdemokratische Verein München hat eine Urabstimmung zur Räterepublik durchgeführt. Knapp ein Drittel der Mitglieder beteiligt sich daran. Das Ergebnis ist gespalten. Eine Hälfte spricht sich für, die andere gegen die Räterepublik aus. </p>
11. 4 1919 - Entwaffnung der Bourgeoisie angeordnet
<p><em><strong>München</strong></em> * Um 19 Uhr ordnet der Revolutionäre Zentralrat (Ernst Toller) die Entwaffnung der Bourgeoisie an. Die bürgerliche Bevölkerung muss innerhalb von 24 Stunden die in ihrem Besitz befindlichen Waffen abliefern.</p> <p>Toller veranlasst auch die Entwaffnung der Polizei. Er befürchtet, dass die Beamten, die bereits im Königreich ihren Dienst verrichtet haben, sich bei einer Gegenrevolution auf die Seite der Putschisten stellen werden. </p>
11. 4 1919 - Die Republikanische Schutztruppe muss den Rückzug antreten
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Im Gasthaus Zum Steyrer in der Schützenstraße kommt es gegen 15 Uhr zu einer Rauferei, bei der ein Angehöriger der Bahnhofswache Prügel bezieht. Die herbeigeeilte Republikanische Schutztruppe greift ein, muss aber vor der aufgebrachten Volksmenge den Rückzug antreten. Daraufhin versucht die Menge den Hauptbahnhof zu stürmen.</p> <p>Gegen 16:45 Uhr kann das herbeigerufene Leibregiment mit Schreckschüssen den Bahnhofsplatz räumen und später den Hauptbahnhof besetzen. Mindestens neun Personen, darunter eine Frau und ein Kind, werden verletzt.</p>
11. 4 1919 - Das Gemeindekollegium lehnt die Räterepublik ab
<p><em><strong>München</strong></em> * In einer geheimen Sitzung beschließt das Münchner Gemeindekollegium die Ablehnung der Baierischen Räterepublik. Die Räteregierung ernennt daraufhin Emil Schmaderer zum Regierungskommissar für die Gemeindeverwaltung München. </p>
11. 4 1919 - Regensburg und Straubing stellen den Telefonverkehr mit München ein
München - Regensburg - Straubing * Auch Regensburg und Straubing stellen den Fernsprechverkehr mit München ein.
11. 4 1919 - Viele Kunden wollen ihr Geld von der Bank abholen
<p><em><strong>München</strong></em> * Durch die Berichterstattung der Presse wird in der bayerischen Bevölkerung eine Panik ausgelöst. Es heißt: <em>„Gesell will uns unser Geld wegnehmen!“</em>. Deshalb finden sich bereits am frühen Morgen viele Kunden vor den Banken ein und wollen ihr Geld abholen. Große Teile der Bevölkerung sind jetzt erstmals gegen die Räteregierung eingestellt. </p>
11. 4 1919 - Der Revolutionäre Zentralrat wird erweitert
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Revolutionäre Zentralrat hat jetzt zehn neue Mitglieder: die am Tag zuvor gewählte Abordnung des Rats Revolutionärer Betriebsobleute und Revolutionärer Soldatenvertreter. Die Neuen lehnen ein Stimmrecht und die Verantwortung für die Maßnahmen des Zentralrats ab. </p>
11. 4 1919 - Die Münchner SPD gegen eigene Vertreter in den Rätegremien
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Mitglieder der Münchner SPD sprechen sich mit knapper Mehrheit gegen die Entsendung eigener Vertreter in die Gremien der Räterepublik aus. </p>
11. 4 1919 - Schließung der Akademie der bildenden Künste
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Ein Viererrat der Studenten setzt die völlige Schließung der Akademie der bildenden Künste durch. </p>
11. 4 1919 - Die bürgerlichen Pressehäuser werden sozialisiert
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Pressehäuser der bürgerlichen Presse werden sozialisiert und die Zeitungsbesitzer enteignet. Die Betriebe gehen in die Hände der Arbeiter über.</p> <ul> <li>Die Zeitungen werden auch weiterhin von den Redaktionen gemacht. Ihnen wird allerdings ein Aufpasser zur Seite gestellt. Redakteure, die ihre Entlassung einreichen, erhalten eine Lohnfortzahlung für sechs Monate. </li> <li>In leitender Funktion arbeitet bei der Zensurbehörde der Schriftsteller Ret Marut, der später unter seinem Pseudonym B. Traven bekannt wird. </li> </ul>
11. 4 1919 - Die Freilassung aller Kriegsgefangenen beschlossen
<p><em><strong>München</strong></em> * Ernst Toller und der Revolutionäre Zentralrat veranlassen die Freilassung aller Kriegsgefangenen. Sie sollen nicht durch erneute Kampfhandlungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie können sich ab sofort frei bewegen und dürfen den Freistaat Bayern verlassen. </p>
11. 4 1919 - In Regensburg wird die Räteregierung wieder aufgelöst
<p><em><strong>Regensburg</strong></em> * In Regensburg wird die von SPD und USPD unterstütze Räteregierung wieder aufgelöst. </p>
11. 4 1919 - Die Betriebsräte sprechen der Räteregierung das Vertrauen aus
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Auf einer Massenversammlung im Hofbräuhaus sprechen Erich Mühsam, Ernst Toller, Gustav Landauer und Max Levien.</p> <ul> <li>Ernst Toller gibt bekannt, dass die Entwaffnung der Bourgeoisie ebenso fortschreitet wie die Bewaffnung des Proletariats.</li> <li>Gustav Landauer verteidigt die Ausrufung der Räterepublik.</li> <li>Erich Mühsam bekennt sich zur ablehnenden Haltung der KPD zur sozialistischen Räterepublik, kritisiert aber ihren gegenwärtigen Boykott in aller Schärfe.</li> <li>Max Levien erklärt erneut, warum sich die KPD nicht an der Räteregierung beteiligt.</li> <li>Als Werner Fröhlich die Spaltung der sozialistischen Parteien verteidigt, kommt es zu Tumulten. Selbst KPD-Mitglieder wenden sich gegen die unversöhnliche Haltung ihrer Parteizentrale.</li> </ul> <p>Ein Antrag der Betriebsräte, der gegenwärtigen Räteregierung das Vertrauen auszusprechen, wird mit überwältigender Mehrheit angenommen. Erich Mühsam stimmt allerdings dagegen. </p>
12. 4 1919 - Sämtliche Fernsprechleitungen nach Südbayern gekappt
<p><strong><em>Bamberg - Südbayern - München</em></strong> * Die Regierung Hoffmann kappt sämtliche Fernsprechleitungen nach Südbayern. Um ihre Informationen weiterzugeben, lässt die Regierung Flugblätter über München abwerfen. </p>
12. 4 1919 - Die Kommunisten bestreiten den Führungsanspruch des Zentralrats
<p><strong><em>München</em> </strong>* Die Räterepublik Baiern ist nicht nur bei den bürgerlich-konservativen Kräften umstritten, sondern insbesondere bei den Kommunisten. Sie bestreiten den Führungsanspruch des Zentralrats. </p>
12. 4 1919 - Ebert fordert die Wiederherstellung des früheren Zustandes in Bayern
<p><em><strong>Berlin - Bamberg</strong></em> * In einem drängenden Telegramm fordert Reichspräsident Friedrich Ebert vom bayerischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, dass <em>„die Wiederherstellung des früheren Zustandes in Bayern baldigst erfolgt, zumal da nach neueren mir zugegangenen Nachrichten aus München man dort anfängt, sich an die Räteregierung zu gewöhnen. </em></p> <p><em>Wenn die wirtschaftlichen Maßnahmen, welche Sie in Aussicht genommen haben, nicht in kürzester Zeit zum Ziel führen, erscheint mir als einzige Lösung militärisches Vorgehen. Dass je rascher und durchgreifender dieses erfolgt, um so weniger Widerstand und Blutvergießen zu erwarten ist, hat uns die Erfahrung an anderen Stellen gelehrt.“ </em></p> <ul> <li>Damit ist das Schicksal der bayerischen Revolution besiegelt. Eine Niederschlagung nach dem Beispiel des Spartakus-Aufstandes in Berlin ist naheliegend. </li> <li>Unter dem Druck aus Berlin gibt Bayerns Ministerpräsident Hoffmann nach. Nun wird auf Landesebene dasselbe Muster durchgespielt wie das auf Reichsebene bereits erprobte: Der Bund mit antirevolutionären, auch antidemokratischen rechten Kräften, um der Linken Herr zu werden. </li> <li>Militärminister Ernst Schneppenhorst wird beauftragt, bayerische Freiwilligenverbände aufzustellen. Ministerpräsident Hoffmann bittet Berlin telefonisch um Verstärkungen. Die Reichstruppen dürfen in Bayern einmarschieren. </li> <li>Auch das von dem bayerischen Oberst Franz Ritter von Epp im thüringischen Ohrdruf gebildete Freikorps wird gegen München in Marsch gesetzt. Während aus dem Westen württembergische Truppen anrücken, sammeln sich im Süden die Freikorps. Rund 30.000 Mann sind im Anmarsch, als sich der Ring um München schließt. </li> <li>Für die Rote Armee wird der Kampf gegen die an Zahl, Ausrüstung und Professionalität überlegenen Weißen nicht mehr zu gewinnen sein. </li> </ul>
12. 4 1919 - Inwieweit fühlen sich die Kommunisten an die Zusagen gebunden?
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Die Vertreter der sozialistischen Parteien beschließen im Hofbräuhaus - nach zahlreichen Kompromissen gegenüber der KPD - die Zusammenarbeit. </p> <p>Dabei ist immer unklar, ob und inwieweit sich die Kommunisten an die Zusagen gebunden fühlen und ob sie überhaupt ein ernsthaftes Interesse an der Zusammenarbeit haben oder einfach nur auf Zeit spielen. </p>
12. 4 1919 - Münchner Bürger als Geiseln verhaftet
<p><em><strong>München</strong></em> * In der gleichen Nacht beginnt parallel daneben eine Verhaftungskommission des Zentralrats Geiseln aus der Münchner Bürgerschaft festzunehmen. </p>
12. 4 1919 - Eine umfangreiche Liste von festzunehmenden Personen
<p><em><strong>Bamberg</strong></em> * In der Nacht zum 13. April wird von Alfred von Seifferitz, Franz Guttmann, Emil Aschenbrenner und Walter Löwenfeld eine umfangreiche Liste von festzunehmenden Personen aufgestellt. Die Regierung in Bamberg lässt ihnen dabei größtmögliche Freiheit. Es sollten aber hauptsächlich Leute verhaftet werden, <em>„die entweder als Haupträdelsführer mitgewirkt hätten, oder von denen bekannt und anzunehmen war, dass sie zu den Haupthetzern gehörten“</em>. </p>
12. 4 1919 - Massenversammlungen zum Thema „Das Gebot der Stunde“
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Zentralrat veranstaltet in sechs Sälen Münchner Brauereien Massenversammlungen zum Thema<em> „Das Gebot der Stunde“</em>. </p>
12. 4 1919 - Schließung der Universität verfügt
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Hochschulrat verfügt die Schließung der Universität für den nächsten Tag. </p>
12. 4 1919 - Die Münchener Post zur Schließung der Akademie der bildenden Künste
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Münchener Post schreibt zur Schließung der Akademie der bildenden Künst<em>e</em>: <em>„Niemand wird dem verrotteten Institut eine Träne nachweinen. Es hat seit langem nichts mehr geleistet, es fungierte als unnützer Repräsentationsposten im Staatshaushalt.“</em> </p>
Um den 12. 4 1919 - Ich warne Sie vor Experimenten!
<p><em><strong>Berlin - München</strong></em> * Reichsbankpräsident Rudolf Havenstein antwortet in einem Telegramm auf Silvio Gesells Vorschlag, auf die <em>„systemlose Papiergeldwirtschaft“</em> zu verzichten, mit dem Satz: <em>„Ich warne Sie vor Experimenten!“ </em></p>
12. 4 1919 - Der Zentralrat bestimmt den Inhalt der Bayerischen Kurier
<p><em><strong>München</strong></em> * Der konservative <em>Bayerische Kurier</em> gibt seinen Lesern bekannt:</p> <p><em>„Nach neuerlicher Anordnung des Revolutionären Zentralrats wird der gesamte Inhalt des ‚Bayer. Kurier‘ von der Pressabteilung des Revolutionären Zentralrats bestimmt. Das Blatt hat auch den gesamten Raum dem Revolutionären Zentralrat zur Verfügung zu stellen.“ </em></p>
12. 4 1919 - Die BVP wehrt sich gegen land- und rassefremde Elemente
<p><em><strong>München</strong></em> * In einem von der Bayerischen Volkspartei - BVP veröffentlichten Aufruf lehnt sie <em>„jede Vergewaltigung des Volksganzen durch eine terroristische, von land- und rassefremden Elementen geführte Minderheit entschieden ab und verlangt, </em>[dass] <em>endlich die Verhetzung weiter Kreise durch ausländische politisierende Juden ein Ende hat“</em>. </p>
12. 4 1919 - Ministerpräsident Hoffmann setzt auf Rechtsextreme und Völkische
<p><em><strong>Bamberg - Weimar - München</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann sieht sich durch das Telegramm des Reichspräsidenten Friedrich Ebert zum Handeln gezwungen. Er wird die Hilfe von Rechtsextremisten und Völkischen in Anspruch nehmen, in dem er beispielsweise über einen bekannten Augsburger Rechtsanwalt an den Chef der Thule-Gesellschaft, Rudolf von Sebottendorf, anfragen lässt, ob dieser für die Regierung tätig sein will.</p> <p>Reichswehrminister Gustav Noske und der Freikorps-Führer Franz Ritter von Epp hoffen auf eine überstürzte militärische Aktion der Regierung Hoffmann. Sie rechnen damit, dass ein Putsch der schwachen bayerischen Verbände fehlschlagen würde. Damit hätten sie die Legitimation für den Einmarsch von Reichswehr und Freikorps in den Freistaat Bayern. </p>
12. 4 1919 - Die Räteregierung in Fürth wird abgesetzt
<p><em><strong>Fürth</strong></em> * Nach lediglich fünf Tagen wird die Räteregierung in Fürth durch Abstimmungen im Arbeiterrat und bei einer Garnisonsversammlung für abgesetzt erklärt. </p>
12. 4 1919 - Gustav Landauer gibt einen zuversichtlichen Lagebericht ab
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Auf einer Sitzung des Revolutionären Zentralrats über die politische, militärische und wirtschaftliche Situation der Räterepublik gibt Gustav Landauer einen zuversichtlichen Bericht über die derzeitige Lage ab. </p>
12. 4 1919 - Regierungsaufträge an die Thule-Gesellschaft
<p><em><strong>Augsburg</strong></em> * In der Gastwirtschaft Goldenes Lamm in Augsburg treffen sich der Thule-Gesellschaft-Chef Rudolf von Sebottendorf und der von Ministerpräsident Johannes Hoffmann beauftragte Augsburger Rechtsanwalt. Sebottendorf erhält den Auftrag,</p> <ul> <li>die Publikationen der Regierung zu vervielfältigen und</li> <li>die Gegenrevolution mit allen Mitteln zu organisieren, damit die Regierung Hoffmann in Kürze auch in München wieder die Macht hat.</li> <li>Mit diesem Auftrag sind alle Handlungen des Kampfbundes als legal gedeckt. </li> </ul>
12. 4 1919 - Silvio Gesell will die Währung sanieren
<p><em><strong>München - Berlin</strong></em> * Der Volksbeauftragte für Finanzen, Silvio Gesell, sendet folgendes Telegramm an den Reichsbankpräsidenten Rudolf Havenstein: <em>„Ich will mit durchgreifenden Mitteln die Währung sanieren, verlasse die Wege der systemlosen Papiergeldwirtschaft, gehe zur absoluten Währung über und bitte um Bekanntgabe Ihrer Stellungnahme.“ </em></p>
13. 4 1919 - Bewaffnete Soldaten dringen in das Erzbischöfliche Palais ein
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * Fünf mit Handgranaten und Pistolen bewaffnete Soldaten, die sich als Beauftragte der Militärpolizei ausgeben, dringen an diesem Palmsonntag, um 1:30 Uhr, in das Erzbischöfliche Palais ein, um Michael von Faulhaber zu verhaften.</p> <p>Die Soldaten durchsuchen das ganze Gebäude, können den Bischof aber nicht finden, weil sich dieser bereits seit dem 11. April in Freising aufhält. </p>
13. 4 1919 - Die Verhaftungskommission des Zentralrats nimmt Geiseln
<p><em><strong>München</strong></em> * Zwischen 2 und 3 Uhr nimmt die Verhaftungskommission des Zentralrats Geiseln aus der Münchner Bürgerschaft und dem Adel fest. Die Festgenommenen werden in die Polizeidirektion gebracht.</p> <p>Unter den Verhafteten befindet sich auch der Bahnhofskommandant Emil Aschenbrenner, der aber später von seinem Stellvertreter wieder befreit wird und sich danach umgehend zum Hauptbahnhof begibt. </p>
13. 4 1919 - Der Palmsonntag-Putsch der Regierung Hoffmann
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Bewaffnete Mitglieder der Republikanischen Schutztruppe unter der Führung von Alfred Seyfferitz dringen - entgegen der ursprünglichen Abmachung - bereits in der Nacht zum Palmsonntag in das Wittelsbacher Palais ein und verhaften den Wohnungskommissar Dr. Arnold Wadler und die USPD-Volksbeauftragten August Hagemeister und Fritz Soldmann. Auch der Ex-Minister Dr. Franz Lipp wird festgenommen. Er hatte sich trotz seiner Entlassung Zutritt in sein ehemaliges Ministerium verschafft.</p> <p>Insgesamt werden 13 Personen verhaftet. Ernst Toller wird rechtzeitig gewarnt und kann so seiner Festnahme entkommen. </p>
13. 4 1919 - Erich Mühsam wird verhaftet und nach Eichstätt gebracht
<p><em><strong>München</strong></em> * Um vier Uhr früh wird auch Erich Mühsam von Angehörigen der Republikanischen Schutztruppe aus seinem Bett heraus verhaftet. Alle Festgenommenen werden zum Hauptbahnhof gebracht und von dort sofort mit der Bahn nach Eichstätt gebracht, wo sie in der Willibaldsburg inhaftiert werden. </p>
13. 4 1919 - Die Verstärkung für den Palmsonntag-Putsch wartet in Ingolstadt
<p><em><strong>München-Maxvorstadt - Ingolstadt</strong></em> * Die Republikanische Schutztruppe hat sich im Hauptbahnhof verschanzt. Ihr Anführer, Alfred Seyfferitz, wartet dort auf die versprochene Verstärkung aus Ingolstadt.</p> <p>In Ingolstadt befindet sich zu diesem Zeitpunkt der Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst, der dort mit 600 Soldaten auf das Eintreffen der Nachricht aus München hofft, dass der erste Teil des Putsches erfolgreich abgelaufen ist, um dann die bayerische Landeshauptstadt einnehmen zu können.</p> <p>Schneppenhorst wird die Nachricht jedoch nie erhalten, da sein Verbindungsmann am nördlichen Stadtrand von einer Patrouille der Roten Armee abgefangen werden wird. </p>
13. 4 1919 - Der Palmsonntag-Putsch scheint geglückt
<p><em><strong>München</strong></em> * Um 9 Uhr treffen sich Vertreter der gemäßigten Parteien beim Kommandanten der Republikanischen Schutztruppe, Alfred Seyfferitz, zu einer Lagebesprechung. Sie wenden sich gegen dessen Forderung nach Standrecht und Militärdiktatur.</p> <p>Am Vormittag des Palmsonntags scheint der Handstreich geglückt. Doch während in der ganzen Stadt die Absetzung des Revolutionären Zentralrats und die Rückkehr der Regierung plakatiert wird, rufen die Anhänger der Räterepublik zum Widerstand auf. Erste Schüsse fallen. </p>
13. 4 1919 - Flugblatt: Verhängung des Kriegszustandes über München
<p><em><strong>München</strong></em> * Anschläge - mit der Unterschrift <em>„Die Garnison München“</em> - verkünden die Verhängung des Kriegszustandes über München. Die Entscheidung fällt, nachdem das Leibregiment erklärt, dass es sich in der ganzen Auseinandersetzung neutral verhalten will und eine Unterstützung der Republikanischen Schutztruppe ablehnt. </p>
13. 4 1919 - Soldaten und demonstrierende Arbeiterschaft erklären sich solidarisch
<p><em><strong>München-Theresienwiese</strong></em> * Auf Massenversammlungen am Vormittag auf der Theresienwiese haben sich bereits Teile des 1. und 2. Infanterie-Leibregiments mit der demonstrierenden Arbeiterschaft solidarisch erklärt. </p>
13. 4 1919 - Kommunisten besetzen das Waffendepot in der Ausstellungshalle
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> * Kommunistische Arbeiter und Soldaten besetzen das Waffendepot in der Ausstellungshalle auf der Theresienhöhe. </p>
13. 4 1919 - Eine Demonstration bewegt sich zum Hauptbahnhof
<p><em><strong>München</strong></em> * Gegen 16 Uhr bewegt sich ein gewaltiger Demonstrationszug durch die Bayerstraße in Richtung Hauptbahnhof. </p>
13. 4 1919 - Bewaffnete Arbeitermilizien rücken zum Hauptbahnhof vor
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Mit Maschinengewehre bewaffnete Arbeitermilizien unter der Führung des kommunistischen Matrosen Rudolf Egelhofer und des anarchistischen Schriftstellers Josef Sontheimer rücken am Nachmittag zum Hauptbahnhof vor.</p> <p>Eine aus drei Personen bestehende Abordnung wird gebildet, die mit dem Chef der Republikanischen Schutztruppe, Alfred Seyfferitz, verhandeln sollen.</p> <p>Der Bahnhofskommandant Emil Aschenbrenner lässt die Abgesandten festnehmen und umgehend erschießen. Spätestens in diesem Moment ist eine friedliche Lösung ausgeschlossen. </p>
13. 4 1919 - Der Hauptbahnhof wird gestürmt
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Nun nehmen die Belagerer das Bahnhofsgebäude unter Beschuss. Die Schlacht dauert fünf Stunden und fordert 21 Tote und über achtzig Verletzte.</p> <p>Die Belagerer stürmen ab etwa 18 Uhr den Hauptbahnhof. Nach einer mehrstündigen Schießerei, bei der die Angreifer sogar Minenwerfer einsetzen, geben die Putschisten von der Republikanischen Schutztruppe gegen 21 Uhr auf. Ihre Anführer fliehen mit einer Lokomotive nach Ulm. Der Rest der Bahnhofsbesatzung kann durch unterirdische Gänge entkommen. </p>
13. 4 1919 - Fürstenfeldbrucker Pioniere werden entwaffnet
<p><em><strong>Fürstenfeldbruck</strong></em> * Sechzig Mann vom 2. Pionier-Bataillion in Fürstenfeldbruck werden noch vor ihrem Einsatz in München entwaffnet. Einzelne treten zur Roten Armee über, die anderen gehen wieder nach Fürstenfeldbruck zurück. </p>
13. 4 1919 - Die Verstärkung der Thule-Gesellschaft bleibt aus
<p><em><strong>München</strong></em> * Die von der Thule-Gesellschaft angebotenen <em>„mehrere hundert Mann“</em> Unterstützung reduzieren sich auf insgesamt zehn Personen. So aber hat die Republikanische Schutztruppe keine Chance gegen die anstürmenden Räterepublikaner, besonders als die KPD am Nachmittag ihre Anhänger zum Widerstand aufruft. </p>
13. 4 1919 - Johann Dosch wird neuer Polizeipräsident
<p><em><strong>München</strong></em> * Johann Dosch, ein steckbrieflich gesuchter Krimineller, wird neuer Polizeipräsident. </p>
13. 4 1919 - Flugblätter verkünden: Es lebe das revolutionäre Internationale Proletariat!
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Generalstreik wird für den nächsten Tag ausgerufen und bürgerliche Zeitungen mit einem Erscheinungsverbot belegt. Flugblätter verkünden:</p> <p><em>„Es lebe das revolutionäre Internationale Proletariat!<br /> Es lebe die Weltrevolution!“</em> </p>
13. 4 1919 - Die Zweite oder Kommunistische Räterepublik wird ausgerufen
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Noch während der Kämpfe am Hauptbahnhof kommen im Hofbräuhaus die Betriebs- und Soldatenräte zusammen.</p> <ul> <li>Sie rufen die Zweite Räterepublik oder Kommunistische Räterepublik aus,</li> <li>erklären den Revolutionären Zentralrat für abgesetzt und</li> <li>übertragen die gesamte gesetzgebende und vollziehende Gewalt einem 15-köpfigen Aktionsausschuss. Das Gremium, bestehend aus Mehrheitssozialisten, Unabhängigen und Kommunisten.</li> <li>Dieses wählt einen fünfköpfigen Vollzugsrat, dem unter dem Vorsitz von Eugen Leviné, KPD, Wilhelm Duske und Emil Maenner von der USPD sowie Willi Budich und Max Levien von der KPD angehören.</li> <li>Stadtkommandant wird der 23-jährige Rudolf Egelhofer.</li> </ul> <p>Levinés Schritt widerspricht der Lagebeurteilung der Berliner KPD-Parteizentrale, die seit den Januarereignissen vor politischen Abenteuern warnt. es wird spätere parteiinterne Kontroversen zur Folge haben. </p>
13. 4 1919 - Nächtliche Ruhestörung
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Josef Hofmiller beschreibt in seinem Tagebuch die Situation in der Nähe seines Wohnortes an diesem Tag:</p> <p><em>„Der Nachmittag verlief bei uns in Haidhausen ganz ruhig. Abends, gegen ½ 9 Uhr, hörten wir mehrere starke Schüsse, wie von Artillerie, aber in einiger Entfernung. Um 10 Uhr gingen wir ins Bett. </em></p> <p><em>Als hätten die Schweine nur auf diesen Augenblick gewartet, fangen sie plötzlich an, in unmittelbarer Nähe zu schließen, vermutlich aus der Kirchenschule; mit Gewehren, Handgranaten und Maschinengewehren. Die nächtliche Ruhestörung dauerte etwa bis ½ 11 Uhr.“ </em></p>
13. 4 1919 - Das Regierungsprogramm der Kommunistischen Räterepublik
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Die Proklamation der Zweiten Räterepublik ist ein aussichtsloses Unterfangen, denn Münchens Isolation in Gesamtbayern ist noch weiter gestiegen und von außen ist keine Unterstützung zu erwarten, da die Reichsregierung Herr der militärischen Lage ist. Eine vage Hoffnung verbindet sich allenfalls mit Aufständen in Österreich.</p> <ul> <li>Eugen Leviné will ein revolutionäres Exempel statuieren, den <em>„Massen Anschauungsunterricht geben, ihnen zeigen, wie eine Räterepublik aufgebaut wird“</em>, und hofft, auch eine niedergeschlagene Räterepublik würde weitere Emanzipationsversuche herausfordern.</li> <li>Gegenüber ihrer Vorgängerin bemüht sich die kommunistische Räteregierung mit Hochdruck um die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats.</li> <li>Ihr geht es nicht um die bloße Übernahme der Gewalt, sondern um die Zerschlagung des bestehenden Staatsapparates. Vorrang besitzt die Bildung eines eigenen Behördenapparates mit verschiedenen Kommissionen und die Schaffung einer Roten Armee.</li> <li>Zur Abwehr gegenrevolutionärer Putschvorhaben tritt bis zum 23. April ein Generalstreik in Kraft.</li> <li>Das gesamte Bankwesen wird unter der Leitung von Emil Maenner und Towia Axelrod nationalisiert,</li> <li>die Gewerbe- und Industriebetriebe vorerst nicht sozialisiert, aber der Kontrolle der Betriebsräte unterstellt.</li> <li>Mit drakonischen Strafandrohungen wird versucht, gegen Plünderer und <em>„Revolutionsschmarotzer“</em> vorzugehen.</li> <li>Die bürgerliche Presse wird verboten. Während des Generalstreiks erschienen allein die kostenlos verteilten „Mitteilungen des Vollzugsrates der Betriebs- und Soldatenräte“.</li> </ul> <p>Trotz großer Anstrengungen bleiben auch die Herrschaftsorgane der Zweiten Räteregierung weitgehend ineffizient - es fehlt an zuverlässigen Kräften und der Zeitdruck ist groß. </p>
13. 4 1919 - Der Aktionsausschuss besetzt alle öffentlichen Gebäude
<p><em><strong>München</strong></em> * Noch in der Nacht besetzt der Aktionsausschuss alle öffentlichen Gebäude und die Standquartiere der Republikanischen Schutztruppe (Luitpold-Gymnasium, Kirchenschule und Stielerschule).</p> <p>Damit ist am Abend des Palmsonntag nicht die Wiedereinsetzung der Regierung Hoffmann, sondern die Übernahme der Regierung durch die Kommunisten erreicht. </p>
13. 4 1919 - Landauer, Toller und Klingelhöfer bieten ihre Mitarbeit an
München * Gustav Landauer gibt eine öffentliche Erklärung ab, in der er die neue Lage anerkennt und seine Mitarbeit anbietet. Gleiches gilt für Ernst Toller und Gustav Klingelhöfer.
13. 4 1919 - Die Wirtschaftsblockade zwingt die Augsburger Räte in die Knie
<p><em><strong>Augsburg</strong></em> * Sechs Tage nach der Ausrufung der Räterepublik in Augsburg zwingt die von der Bamberger Regierung verhängte Wirtschaftsblockade die Augsburger Räte in die Knie. <em>„Unter dem Zwang der Verhältnisse“</em> beenden sie den Versuch einer Räteregierung, verwerfen die Räteverfassung als <em>„verfrüht“</em> und setzen sich von der Münchner Räterepublik ab. </p>
13. 4 1919 - Gegenrevolution in Rosenheim niedergeschlagen
<p><em><strong>Rosenheim</strong></em> * Die Gegner der Revolution wollen in Rosenheim die Räterepublik beseitigen. Sie müssen sich jedoch zurückziehen, als rätetreue Soldaten aus München mit dem Zug eintreffen. </p>
13. 4 1919 - Der Palmsonntag-Putsch ist gescheitert
<p><em><strong>München - Freistaat Bayern</strong></em> * Der Palmsonntag-Putsch ist gescheitert. Zurück bleibt die Erkenntnis, dass der erste militärische Schlag gegen die Räterepublik missglückt ist und die gewählte Regierung Hoffmann eine bittere Niederlage einstecken musste. </p>
13. 4 1919 - Mitteilung der Werbezentrale des Freikorps Epp
<p><em><strong>Ohrdruf </strong></em>* Die Werbezentrale des Freikorps Epp veröffentlicht ein Flugblatt mit folgendem Inhalt:</p> <p><em>„Vertraulich! Nicht auf bayr. Boden mitnehmen!<br /> Ministerpräsident Hoffmann hat das Versprechen gegeben, dass die Werbung für das Freikorps zwar nicht offiziell erlaubt würde, dass aber weitere Schwierigkeiten den Werbern nicht gemacht werden sollten. [...]<br /> Es ist anzunehmen, dass dagegen der bayr. Mil. Minister alles versuchen wird, um die Werbung zu hemmen.“ </em></p>
13. 4 1919 - Oskar Maria Graf beschreibt die Kampfhandlungen
<p><em><strong>München</strong></em> * In seinem Roman <em>„Wir sind Gefangene“</em> schildert Oskar Maria Graf die Ereignisse so:</p> <p><em>„Von der Prielmayr-, von der Schützen-, Schiller- und Bayerstraße heraus liefen bewaffnete Massen andauernd Sturm gegen den feuerspeienden Hauptbahnhof, glitten brüllend und heulend wieder zurück und stürmten mit erneuter Erbitterung vor. […]</em><br /> <em>Getroffene fielen um, Boden und Häuser zitterten, die Menge, in der ich steckte, wogte weiter vor mit den Stürmern und mit furchtbarem Geschrei in den krachenden Bahnhof.“ </em></p>
14. 4 1919 - Karl Gandorfer wird ins Zuchthaus Straubing gebracht
<p><strong><em>Straubing</em></strong> * Der Bauernführer Karl Gandorfer wird von Angehörigen der Regierungstruppen verhaftet und ins Zuchthaus Straubing gebracht. </p>
14. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann organisiert den Einsatz von Freiwilligen
<p><strong><em>Bamberg</em></strong> * Die in Bamberg sitzende bayerische Regierung Hoffmann organisiert mit Flugblättern den Einsatz von Freiwilligen. Um 17:30 Uhr wird das nachstehende Flugblatt über München abgeworfen:</p> <ul> <li><em>„In München rast der russische Terror, entfesselt von landfremden Elementen.</em></li> <li><em>Diese Schmach darf keinen Tag, keine Stunde weiter bestehen. [...].</em></li> <li><em>Ihr Männer der bayerischen Berge, des bayerischen Hochlandes, des bayerischen Waldes, erhebt Euch wie ein Mann. [...]. </em></li> <li><em>Ein grüner Buschen am Hute und die weißblaue Binde am Arm ist Euer Erkennungszeichen.</em></li> <li><em>Die Bahn befördert Euch zu den Sammelpunkten. [...]. </em></li> <li><em>Die Münchner Schmach muss verschwinden.</em></li> <li><em>Das ist bayerische Ehrenpflicht.“ </em></li> </ul>
14. 4 1919 - Die Vergeltungsmaßnahmen gegen die bayerische Räterepublik beginnen
<p><strong><em>Berlin - Bamberg - München</em></strong> * Die Vergeltungsmaßnahmen gegen die bayerische Räterepublik können beginnen.</p> <ul> <li>Reichswehrminister Gustav Noske übernimmt den Oberbefehl über die Aktion.</li> <li>Generalleutnant Ernst Friedrich Otto von Oven erhält den Oberbefehl über die Invasionstruppen.</li> <li>General Arnold Ritter von Möhl erhält den Titel Bayerischer Oberbefehlshaber, bleibt aber Statist ohne Befehlsgewalt. </li> </ul>
14. 4 1919 - Der Vollzugsrat hat den Generalstreik ausgerufen
<p><em><strong>München</strong></em> * Erster Tag des Generalstreiks, den der Vollzugsrat ausgerufen hat. Er wird bis zum 22. April andauern. </p>
14. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann arbeitet mit Rechtsextremisten zusammen
<p><strong><em>Bamberg</em></strong> * Die Regierung Hoffmann setzt auf das neu eingerichtete Propagandaministerium und die Zusammenarbeit mit bekennenden Rechtsextremisten. Im Regierungsorgan Freistaat werden die Räteanhänger aufs übelste diffamiert und als <em>„ausländische Juden“, „land- und rassenfremde Elemente“</em> sowie als <em>„Terroristen“</em> diffamiert.</p> <p>Ernst Toller gibt daraufhin im Auftrag des Zentralrats ein Flugblatt an die Bürger der Räterepublik heraus. In diesem macht er auf die antisemitischen Hintergründe aufmerksam und fordert die Bevölkerung zum Widerstand dagegen auf. </p>
14. 4 1919 - Die Münchner Bürger müssen ihre Waffen abgeben
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Münchner Bürger müssen innerhalb von 12 Stunden jede Art von Waffen bei der Stadtkommandantur abgeben. Im Weigerungsfall wird mit Erschießung gedroht. </p> <p>Andererseits werden die Arbeiter von den neuen Machthabern bewaffnet. Die Bewaffnung erfolgt in den Betrieben. Die Arbeiter müssen die Waffen immer bei sich tragen.</p>
14. 4 1919 - Polizeipräsident Johann Dosch nimmt Hausdurchsuchungen vor
<p><strong><em>München</em></strong> * Johann Dosch, der neue Polizeipräsident, nimmt mit acht Mitgliedern der Roten Armee auf eigene Faust Hausdurchsuchungen vor. Er beschlagnahmt dabei Gegenstände im Wert von rund 100.000 Mark.</p>
14. 4 1919 - Am Ostbahnhof werden elf Geiseln genommen
München-Haidhausen * Am Ostbahnhof werden elf aus Rosenheim stammende Bürger als Geiseln genommen. Sie sollen im Austausch für mehrere kommunistische Geiseln, die in Rosenheim inhaftiert sind, übergeben werden.
14. 4 1919 - Das Erscheinen der Münchner Zeitungen wird verboten
München * Das Erscheinen der Münchner Zeitungen wird verboten. Ersatzweise werden ab dem nächsten Tag „Mitteilungen des Vollzugsrats der Betriebs- und Soldatenräte“ gedruckt und kostenlos an die Bevölkerung verteilt.
14. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann bittet das Reich um militärische Unterstützung
<p><em><strong>Bamberg</strong></em> * Die im Exil in Bamberg befindliche Regierung Hoffmann bittet nach dem gescheiterten Palmsonntag-Putsch das Reich um militärische Unterstützung im Kampf gegen die Münchner Räteherrschaft. </p>
14. 4 1919 - 5.000 Württemberger für die Niederschlagung der Räterepublik
<p><em><strong>Bamberg</strong></em> * Während Ministerpräsident Johannes Hoffmann nur noch Schadensbegrenzung betreiben und dem Freikorpsführer Franz Ritter von Epp die Erstürmung Münchens verbieten möchte, hofft der Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst, dass 5.000 württembergische Soldaten für die Niederschlagung der Münchner Räterepublik bereitgestellt werden.</p> <p>Das Angebot hat die Regierung Hoffmann vom Stuttgarter Ministerpräsidenten Wilhelm Blos erhalten, dem es darum geht, die Eigenständigkeit Süddeutschlands im Reich zu stärken. Ihm war klar, wenn Bayern unter die Reichshoheit fallen sollte, dann würden in Zukunft auch die übrigen süddeutschen Länder nur noch eine untergeordnete Rolle gegenüber Preußen spielen können. </p>
14. 4 1919 - Die erste Diktatur des Proletariats in Deutschland
<p><em><strong>München</strong></em> * Nun beginnt der erste Versuch, auf deutschem Boden eine Diktatur des Proletariats zu errichten. </p>
15. 4 1919 - Wir leben von der Hand in den Mund
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Josef Hofmiller schreibt seine Gedanken in seinem Tagebuch nieder: <em>„Heute um 3 Uhr große Proletarierversammlung vor dem Wittelsbacher Palais. Von da soll vermutlich die Parole zum Plündern ausgegeben werden. </em></p> <p><em>Ich fürchte, wir gehen einer verdammt interessanten Zeit entgegen. </em><em>Wenn wir heute in einem Jahr noch leben, können wir erzählen, dass wir etwas mitgemacht haben, das nicht alltäglich ist. Aber ich fürchte, es handelt sich nicht um heute in einem Jahr, sondern heute in einem Monat, heute in vierzehn Tagen. Wir leben derart von der Hand in den Mund, dass sich die Sache bald entscheiden muss. Entweder es kommen Truppen von auswärts oder wir verhungern.“ </em></p>
15. 4 1919 - Warnung vor Geldhamstern und Lebensmittelwucher
<p><em><strong>München</strong></em> * Plakatanschläge der Räteregierung warnen vor dem <em>„Geldhamstern“</em> und vor <em>„Lebensmittelwucher“</em>. </p>
15. 4 1919 - Emil K. Maenner wird Volksbeauftragter für Finanzwesen
<p><em><strong>München</strong></em> * Emil K. Maenner, ein junger Bankangestellter, wird zum Nachfolger von Silvio Gesell als Volksbeauftragter für das Finanzwesen gedrängt. Ihm wird der Russe Towia Axelrod als politischer Kommissar für das Finanzwesen und als Stellvertreter zur Seite gestellt. </p>
15. 4 1919 - Hans Köberl wird Polizeipräsident
<p><em><strong>München</strong></em> * Der mit 21 Vorstrafen behaftete Hans Köberl, bisher stellvertretender Polizeipräsident, übernimmt von Johann Dosch das Amt des Polizeipräsidenten. Dosch wird nun sein Stellvertreter. </p>
15. 4 1919 - Ein Revolutionärer Zentralschülerrat wird gegründet
<p><em><strong>München</strong></em> * Ein Revolutionärer Zentralschülerrat, bestehend aus Schülern der Münchner Mittelschulen, wird gegründet. </p>
15. 4 1919 - Giesinger Mieter verweigern die Bezahlung ihrer Miete
<p><em><strong>München-Giesing</strong></em> * Eine Gruppe Giesinger Mieter verweigert - bis zum Einmarsch der Regierungstruppen - die Bezahlung ihrer Miete. </p>
15. 4 1919 - Militärminister Schneppenhorst will die Räteregierung überraschen
<p><em><strong>Dachauer Moos</strong></em> * Der Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst, zieht seine bayerischen Truppen im Dachauer Moos zusammen. Seine Hoffnung beruht auf einem Überraschungscoup, da er glaubt, dass die kommunistische Räteregierung bisher noch nicht in der Lage war, ihre Rote Armee gefechtsbereit zu machen. </p>
15. 4 1919 - Regierungstruppen rücken aus Richtung Dachau nach München
<p><strong><em>München - Dachau</em></strong> * Als sich am Abend in München das Gerücht über das Anrücken einer aus Richtung Dachau kommenden, 800 Mann starken Regierungstruppe verbreitet, lässt Stadtkommandant Rudolf Egelhofer</p> <ul> <li>umgehend die Kasernen- und Betriebsräte informieren,</li> <li>den Zugverkehr unterbrechen,</li> <li>den Hauptbahnhof und den Bahnhofsplatz räumen und in Verteidigungszustand versetzen,</li> <li>den Telefon- und Telegraphenverkehr einstellen und</li> <li>alle Zubringerstraßen nach München durch Soldaten absperren.</li> </ul>
15. 4 1919 - Die Rote Armee erringt ihren ersten Sieg
<p><em><strong>München - Allach - Karlsfeld</strong></em> * Mit Lastwagen werden die eingetroffenen Rotgardisten an die Front bei Allach gebracht. Südlich der Straße Allach - Ludwigsfeld stoßen die Roten auf den Feind. Ihnen gelingt es, die von der Gegenwehr völlig überraschten Regierungstruppen nach Karlsfeld zurückzudrängen.</p> <p>Da die Angreifer - trotz ihrer guten Ausrüstung - weder über den notwendigen Kampfesmut verfügen, noch auf ihre bayerischen Kameraden schießen wollen, laufen viele Weiße zum Feind über oder fliehen zurück nach Dachau. Damit hat die Rote Armee ihren ersten Sieg errungen. </p>
15. 4 1919 - Ernst Toller wird Heerführer
<p><em><strong>München - Karlsfeld</strong></em> * Auch Ernst Toller begibt sich zur Front. In einem Karlsfelder Wirtshaus haben sich Vertrauensleute der Münchner Arbeiter versammelt. Toller schreibt:</p> <p><em>„‚Der Toller soll die Führung übernehmen!‘ ruft einer. […] Ich sträube mich und versuche zu erklären, dass ein Heerführer andere Fähigkeiten braucht. ‚Oana muaß sein Kohlrabi herhalten, sonst gibts an Saustall, und wennst nix verstehst, wirst es lerna, die Hauptsach is, dich kennen wir‘. </em></p> <p><em>Ich weiß nichts zu erwidern, welche Gründe konnten auch dieses töricht-rührende Vertrauen von Männern, die eben eine aktive, militärisch geführte Truppe besiegt hatten, erschüttern? So werde ich Heerführer.“</em> </p>
15. 4 1919 - Von der Eichstätter Willibaldsburg ins Zuchthaus Ebrach
<p><em><strong>Eichstätt - Ebrach</strong></em> * Die von der Republikanischen Schutztruppe im Wittelsbacher Palais festgenommenen Personen, darunter der Münchner Arbeiterrat Erich Mühsam, werden von der Eichstätter Willibaldsburg ins Zuchthaus Ebrach gebracht und dort in Isolierhaft verwahrt. </p>
15. 4 1919 - Nummer 1 der „Mitteilungen“ erscheint
<p><em><strong>München</strong></em> * Nummer 1 der Mitteilungen des Vollzugsrats der Betriebs- und Soldatenräte erscheint. Eugen Leviné schreibt darin die folgenden Zeilen zu der ins Stocken geratenen Revolution in Deutschland:</p> <p><em>„München ist heute eine revolutionäre Insel mitten in einem schwarzen Meere. Aber die revolutionäre Flut steigt. In Revolutionszeiten kommt jede Stunde einem Monat gleich. Die Massen lernen mit jedem Tag immer mehr ihre wirklichen Ziele kennen und schlagen sich auf unsere Seite.“</em> </p>
15. 4 1919 - 500 Weißgardisten versuchen Dachau zu besetzen
<p><em><strong>Dachau</strong></em> * 500 Weißgardisten - von Pfaffenhofen kommend - besetzen Dachau, um den Ring um München zu schließen. In der Stadt werden sie von Arbeiterinnen der Pulver- und Munitionsfabrik beschimpft und teilweise entwaffnet. </p>
16. 4 1919 - Karl Gandorfer wird nach zwei Tagen aus der Haft entlassen
Straubing * Karl Gandorfer wird nach zwei Tagen aus der Haft im Zuchthaus Straubing entlassen.
16. 4 1919 - Ernst Toller setzt auf Verhandlungen mit den Angreifern
Dachau * Ernst Toller, der zwischenzeitlich zum Abschnitts-Kommandanten der bei Dachau stationierten Roten Armee ernannt worden ist, verweigert Rudolf Egelhofers Befehl, die Stadt mit Artillerie zu beschießen. Toller will mit den Angreifern verhandeln. Nachdem die Verhandlungen gescheitert sind, gelingt der Roten Armee ein weiterer Sieg über die Regierungstruppen.
Egelhofers Befehl, die gefangen gesetzten Offiziere standrechtlich zu erschießen, wird von Ernst Toller erneut verweigert. Er setzt auch weiterhin auf Verhandlungen und die Vernunft beider Seiten. Damit erreicht er zwar einen Waffenstillstand, der jedoch den Regierungstruppen die dringend notwendige Atempause verschafft, um sich zu sammeln und um den Gegenschlag vorzubereiten. Außerdem ersuchen die Weißen in Berlin um Verstärkung nach.
Die Weißen Truppen haben Dachau bedingungslos übergeben. Der Roten Armee fallen mehrere Millionen Schuss Infanterie-Munition, 4 Geschütze, 3 Maschinen-Gewehre, Sanitätsfahrzeuge und anderes Material in die Hände. „Wir machten mehrere Hundert Gefangene, darunter 4 Offiziere. Wir beklagen 8 Tote und eine Zahl Verwundete. Unsere Arbeiter undTruppen schlugen sich hervorragend. Unsere Truppen sind über Dachau hinaus vorgestoßen“, heißt es in einem Flugblatt des Vollzugsrats der Betriebs- und Soldatenräte Münchens vom 17. April.
16. 4 1919 - Rudolf Egelhofer wird Oberkommandierender der Roten Armee
München * Rudolf Egelhofer wird Oberbefehlshaber der Roten Armee.
16. 4 1919 - Räteregierung: München droht militärisch keine Gefahr
München * Die Räteregierung teilt mit, dass München militärisch keine Gefahr droht. Die Weißen Truppen werden bei Dachau in Schach gehalten.
16. 4 1919 - München ist noch immer von der Außenwelt abgeschlossen
München * Die Stadt ist noch immer von der Außenwelt abgeschlossen. Es gibt keinen Post-, Eisenbahn-, Nachrichten- und Geldverkehr. Weder Lebensmittel noch Kohlen werden nachgeliefert.
16. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann ruft zur Befreiung Münchens auf
München * Die Regierung Hoffmann lässt Flugblätter über der Stadt abwerfen. Unter der Überschrift „In München rast der russische Terror“ fordert sie die Bevölkerung des Freistaats Bayern zur Befreiung Münchens mit Waffengewalt auf.
16. 4 1919 - Die Wirtschaftskommission des Vollzugsrats droht Unternehmen
München * In einem Anschlag der Wirtschaftskommission des Vollzugsrats heißt es: „Wer sein Geschäft böswillig schließt, wird sofort dem Revolutionstribunal übergeben und sein Geschäft wird nationalisiert.“ Diese Anordnung gilt für Lebensmittelgeschäfte, Speditionen, Apotheken, Drogerien, Konditoreien und Cafés.
16. 4 1919 - Die Unternehmer sollen Lohnausfall für den Streik zahlen
München * Am dritten Tag des Generalstreiks werden die Unternehmer angewiesen, Lohn für den Streik zu zahlen.
16. 4 1919 - Willy Weinberger wird stellvertretender Stadtkommandant
München * Der Schriftsteller Willy Weinberger wird stellvertretender Stadtkommandant von München.
16. 4 1919 - Auch die zeremonielle Fußwaschung findet nicht mehr statt
München * Die seit über einhundert Jahren am bayerischen Königshof durchgeführte, zeremonielle Fußwaschung an zwölf „armen alten Männern aus ganz Bayern“ findet erstmals nicht statt.
16. 4 1919 - Die Mitglieder des Revolutionstribunals werden inhaftiert
München-Maxvorstadt * Die Mitglieder des Revolutionstribunals werden im Justizpalast von Soldaten festgenommen und in Haft genommen.
16. 4 1919 - Der Goldvorrat der Reichsbank wird beschlagnahmt
München * Auf Anordnung des Revolutionären Bankrats werden die Safes der Münchner Banken geöffnet. Der Gold- und Papiergeldvorrat der Reichsbank wird beschlagnahmt. Der Volksbeauftragte für das Finanzwesen, Emil K. Maenner, empfindet die Beschlagnahme der Stahlkammern in den Banken als „politischen Diebstahl“.
16. 4 1919 - 110 Millionen Mark werden gedruckt
München-Kreuzviertel * In der Firma Parcus am Promenadeplatz wurden vom Betriebsrat Geldscheine im Wert von 110 Millionen Mark mit den Originalplatten gedruckt. Sie werden jetzt ausgegeben.
16. 4 1919 - Eine Besprechung im Preußischen Kriegsministerium zu Bayern
Berlin * Im Preußischen Kriegsministerium findet eine Besprechung - ohne bayerische Vertreter - statt. Es wird beschlossen, dass sich beim „Marsch auf München“ - neben bayerischen und württembergischen Verbänden - auch preußische Truppen beteiligen werden.
16. 4 1919 - Eine disziplierte Rote Armee in Dachau
Dachau * Bei der Roten Armee ist jeder systematische Dienst als Militarismus und „Ludendorfferei“ verpönt. Es gibt keine Befehle, nur Anweisungen. Militärische Titel werden bewusst nicht geführt. Dennoch geht es auch in dieser Truppe recht diszipliniert zu.
16. 4 1919 - Gustav Lanauer distanziert sich von der kommunistischen Räterepublik
München * Gustav Landauer schreibt an den Aktionsausschuss: „Ich habe mich um der Sache der Befreiung und des schönen Menschenlebens willen der Räterepublik zur Verfügung gestellt; als der alte Zentralrat von einer Organisation ersetzt worden war, die vom Vertrauen der Münchner Arbeiterschaft getragen zu sein schien. Sie haben meine Dienste bisher nicht in Anspruch genommen.
Inzwischen habe ich Sie am Werke gesehen, habe Ihre Aufklärung, Ihre Art den Kampf zu führen, kennengelernt. Ich habe gesehen, wie im Gegensatz zu dem, was Sie ,Schein-Räte-Republik‘ nennen, Ihre Wirklichkeit aussieht. Ich verstehe unter dem Kampf, der Zustände schaffen will, die jedem Menschen gestatten, an den Gütern der Erde und der Kultur teilzunehmen, etwas anderes als Sie.
Ich stelle also fest - was schon vorher kein Geheimnis war - , dass die Abneigung gegen eine gemeinsame Arbeit gegenseitig ist. Der Sozialismus, der sich verwirklicht, macht sofort alle schöpferischen Kräfte lebendig; in Ihrem Werke aber sehe ich, dass Sie auf wirtschaftlichem und geistigem Gebiet […] sich nicht darauf verstehen.
Diese Mitteilung bleibt von mir streng privat; es liegt mir fern, das schwere Werk der Verteidigung, das Sie führen, im geringsten zu stören. Aber ich beklage aufs schmerzlichste, daß es nur noch zum geringsten Teil mein Werk, ein Werk der Wärme und des Aufschwungs, der Kultur und der Wiedergeburt, ist, das jetzt verteidigt wird.“
16. 4 1919 - Militärhilfe vom Reich für die Regierung Hoffmann
Weimar - Bamberg * Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann gibt dem Ersuchen des bayerischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann um Militärhilfe statt. Spätestens jetzt liegt die Regelung der Verhältnisse in Bayern in der Hand der Reichsregierung, ohne dass der Regierung Hoffmann ein Mitspracherecht geblieben ist.
16. 4 1919 - Die Räteregierung lehnt Gustav Landauers Kulturprogramm ab
München * Der Aktionsausschuss der Republik Baiern lehnt Gustav Landauers Kulturprogramm ab, weshalb sich dieser resigniert aus der Politik der kommunistischen Räteregierung zurückzieht.
16. 4 1919 - Befehlsentgegennahme an bestimmten Plätzen der Stadt
München * Die Stadtkommandantur ruft die Arbeiter auf, sich täglich an bestimmten Sammelplätzen im Stadtgebiet einzufinden, um Befehle und Instruktionen zu empfangen.
16. 4 1919 - Erich Mühsam tritt in den Hungerstreik
Ebrach * Erich Mühsam tritt im Zuchthaus Ebrach in einen Hungerstreik, um gegen seine Verhaftung und die Zustände im Zuchthaus zu protestieren.
16. 4 1919 - Der einzige Sieg der Räterepublik
Dachau * Die 500 Mann der Regierungstruppen werden von Arbeitern und Soldaten aus München vertrieben. Es bleibt aber der einzige Sieg der Räterepublik.
Das Kommando der Roten Armee besteht aus fünf Bataillone. Das zweite Bataillon, in dem 20 Italiener und 80 Russen dienen, ist besonders diszipliniert. Die Männer heben in ihrem Abschnitt nördlich der Stadt sofort Schützengräben aus, im Unterschied zu bayerischen Genossen, wie der Kommandeur Erich Wollenberg später berichtet. Die Russen stammen aus dem Lager in Puchheim.
16. 4 1919 - Bewaffnung und militärische Organisation der Arbeiterschaft
München * Eugen Leviné spricht vor einer Vollversammlung der Räte zur Bewaffnung und der militärischen Organisation der Arbeiterschaft:
„Es nützt nichts, dass wir die Waffen haben und nicht auch gleichzeitig alle anderen Sicherungen treffen, um der Situation gewachsen zu sein. […] Was wir jetzt durchleben ist nicht eine Periode des plötzlichen Umschwungs, sondern es beginnt jetzt ein schwerer Kampf, und deshalb müssen wir verlangen, dass alle Mann an Bord bleiben.“
17. 4 1919 - Einsatz von Reichswehrverbänden gegen München beschlossen
Weimar * Reichswehrminister Gustav Noske ordnet an diesem Gründonnerstag den Einsatz von Reichswehrverbänden und hartes Vorgehen gegen München an. Das militärische Ungleichgewicht ist überwältigend.
17. 4 1919 - Der Vollzugsrat macht Ernst Toller Vorwürfe
München * Der Vollzugsrat wirft Ernst Toller vor, dass er die Verteidigungslinie bei Dachau allzu leichtfertig preisgegeben habe. Das wird mit Verrat gleichgesetzt.
Im Protokoll des Vollzugsrats steht: „Dieses Vorgehen ist unerhört, man müsse denken, man stehe im Krieg, da dürfe ein Genosse nicht auf eigene Faust handeln. Wenn Toller das in der kaiserlichen Armee getan hätte, wäre er wegen Hochverrat vor das Kriegsgericht gestellt worden“.
17. 4 1919 - Über 10.000 Safes werden auf Bargeld kontrolliert
München * Der Volksbeauftragte für Finanzen, Emil K. Maenner, lässt eine Woche lang über 10.000 Safes auf Bargeld kontrollieren. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Nur etwas über 50.000 Mark können sichergestellt werden.
17. 4 1919 - Offizieller Haftbefehl erlassen und nachgeschoben
München * Gegen die am 13. April im Wittelsbacher Palais festgenommenen Personen, darunter Erich Mühsam, wird erst jetzt ein offizieller Haftbefehl erlassen.
Eine schriftliche Haftanordnung des Staatsanwalts lag bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor.
17. 4 1919 - Bernhard Dernburg löst Eugen Schiffer ab
Weimar * Bernhard Dernburg, DDP, übernimmt im Kabinett Scheidemann von Eugen Schiffer, DDP, die Funktionen des stellvertretenden Reichsministerpräsidenten [= stellvertretender Reichskanzler] und des Finanzministers.
17. 4 1919 - Ein Aufruf „An die Bauernschaft des baierischen Landes“
München * In einem Aufruf „An die Bauernschaft des baierischen Landes“ heißt es:
- „Es besteht überall Ruhe und Ordnung und jedermann weiß,
- dass die geschichtliche Entwicklung mit Notwendigkeit zum Rätesystem führt,
- dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist,
- dass jeder Vernünftige sich ihr anpasst“.
17. 4 1919 - Am Wiener Parlamentsgebäude wird Feuer gelegt
Wien * Eine aufgebrachte Menge zündet in Wien das Parlamentsgebäude an.
17. 4 1919 - Ferienkurse für Proletarier an der Universität
München * An der Münchner Universität beginnen Ferienkurse für Proletarier.
Der national-konservative Josef Hofmiller schreibt dazu in sein Tagebuch: „Ein Plakat kündigt Ferienkurse für die Arbeiter in der Universität an mit den Worten: ‚Arbeiter, bemächtigt euch der Kultur!‘. Aber sie bemächtigen sich lieber der Schweinshaxen“.
18. 4 1919 - Der fünfte Tag des Generalstreiks
<p><strong><em>München</em></strong> * Karfreitag: An diesem fünften Tag des Generalstreiks dürfen die Friseurgeschäfte auf Anordnung der Streikkommission wieder öffnen. </p>
18. 4 1919 - Willy Weinberger wird Stadtkommandant
<p><em><strong>München</strong></em> * Willy Weinberger wird Stadtkommandant. Er übernimmt diese Funktion von Rudolf Egelhofer. </p>
18. 4 1919 - Verschleppt ins Zuchthaus Ebrach
<p><em><strong>München - Ebrach</strong></em> * Am Nachmittag erfährt das Mitglied des Vollzugsrats Wilhelm Karl Duske, dass im Zuchthaus Ebrach die gewaltsam entführten 13 Linken, darunter die acht Mitglieder des Zentralrats, wie die Volksbeauftragten Dr. Franz Lipp und Fritz Soldmann, sowie der Wohnungskommissar Dr. Arnold Wadler und der Münchner Arbeiterrat Erich Mühsam, einsitzen. </p> <p>Rudolf Egelhofer erklärt dazu:<em> „Wir können nichts weiter tun, als Hoffmann-Genossen festnehmen“</em>.</p>
18. 4 1919 - Flugblätter gegen die Regierung Hoffmann
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Kasernenräte werfen aus fahrenden Autos gegen die Regierung Hoffmann gerichtete Flugblätter ab. </p>
18. 4 1919 - Victor Klemperer beschreibt Gustav Landauer
<p><em><strong>München</strong></em> * Victor Klemperer, der für die Münchner Räterepublik nicht das Geringste übrig hat und die Ereignisse als Tragikomödie betrachtet, schreibt in sein Revolutionstagebuch. <em>„Gestern nachmittag lernte ich Gustav Landauer kennen, der einige Tage das Schicksal und speziell das geistige Schicksal Münchens – er selbst hoffte: Bayerns – bedeutet hat. </em></p> <p><em>Nur die lang herabfallenden Haare verrieten den Sonderling: sonst macht der hagere Mann mit dem ergrauenden Vollbart einen völlig kultivierten, weder revolutionären noch proletarischen Eindruck; die großen braunen Augen blicken viel eher gütig als fanatisch, Stimme und Ausdrucksweise sind von geschliffener Milde.“</em> </p>
18. 4 1919 - Ernst Niekisch bezeichnet Ernst Toller als gänzlich unfähig
<p><em><strong>München</strong></em> * Ernst Niekisch notiert über Ernst Toller in sein Tagebuch: <em>„Toller: junger, eitler, ehrgeiziger Student, Judenbengel, der aber voller Zerfahrenheit und gänzlich unfähig ist.“ </em></p>
18. 4 1919 - Die Kautsky-Dokumente zur Kriegsschuldfrage werden nicht veröffentlicht
<p><em><strong>Weimar</strong></em> * Dem Kabinett Scheidemann liegt die Dokumentensammlung zur Kriegsschuldfrage vor. Diese wurde im November 1918 an Karl Kautsky von der USPD in Auftrag gegeben. Die Dokumente belegen, dass die deutsche Reichsregierung im Juli 1914 Österreich-Ungarn zum Krieg gegen Serbien gedrängt hat und damit die Hauptverantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs trägt.</p> <p>Nach ausführlichen Beratungen empfiehlt Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann von der Veröffentlichung der Kautsky-Dokumente vorerst Abstand zu nehmen. </p>
18. 4 1919 - Die Rätebewegung kann sich in Deutschösterreich nicht durchsetzen
<p><em><strong>Wien</strong></em> * Die österreichischen Kommunisten rufen zum Generalstreik auf, der jedoch von den Wiener Arbeitern nicht befolgt wird. Die Rätebewegung kann sich in Deutschösterreich nicht durchsetzen. </p>
18. 4 1919 - Den Einmarsch von Regierungstruppen nach Augsburg genehmigt
<p><em><strong>Bamberg - Weimar - Augsburg</strong></em> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann gibt seine Einwilligung zum Einmarsch von Regierungstruppen nach Augsburg. </p>
18. 4 1919 - Die Betriebsräte kontrollieren die Leitung der Betriebe
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Aktionsausschuss der Betriebs- und Soldatenräte beschließt <em>„Leitsätze für die Geschäftskontrolle durch Betriebsräte“</em>. Die Betriebsräte kontrollieren die Leitung der Betriebe vollständig. Jedes Mitglied des Betriebsrates ist jederzeit durch die Belegschaft abwählbar. </p>
18. 4 1919 - Ernst Niekisch geht zurück nach Augsburg
München - Augsburg * Ernst Niekisch zieht sich aus der Politik in München zurück und verlässt die bayerische Landeshauptstadt in Richtung seiner Heimatstadt Augsburg.
Um den 19. 4 1919 - Ein Regierungs-Telegramm geht an alle Pfarrämter Bayerns
<p><strong><em>Bamberg</em></strong> * Ministerpräsident Johannes Hoffmann lässt in seinem Auftrag auf Staatskosten vom Bischöflichen Generalvikariat Bamberg folgendes Telegramm an alle Pfarrämter Bayerns übermitteln:</p> <p><em>„Ein Haufen von Ausländern hat sich der Hauptstadt München bemächtigt, übt daselbst eine Schreckensherrschaft aus und bedroht von dorther die Provinzen, namentlich die Landbevölkerung, mit Raub und Brandstiftung. </em><em>Die rechtmäßig bestehende Regierung hat einen Aufruf zur Bildung von Freikorps ergehen lassen.Von seinem Erfolg hängt das Wohl und Wehe des Vaterlandes ab. </em></p> <p><em>Wir ersuchen die Geistlichkeit, durch Hausbesuche und auch von der Kanzel aus kräftigst dafür einzutreten, dass möglichst viele tüchtige Gemeindeangehörige dem Rufe folgen.“</em></p>
19. 4 1919 - Arbeiter übernehmen den Sicherheitsdienst
<p><strong><em>München</em></strong> * Karsamstag und Sechster Tag des Generalstreiks: Die Zivile Sicherheitswache, bestehend aus organisierten Arbeitern, übernehmen den Sicherheitsdienst anstelle der suspendierten und entwaffneten Polizeiwachleute. </p>
19. 4 1919 - Die Belieferung mit Lebensmitteln ist extrem mangelhaft
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Belieferung mit Lebensmitteln ist extrem mangelhaft. Das Angebot reicht nur teilweise für die ausgegebenen Lebensmittelkarten. Selbst der Viktualienmarkt wird nur sehr schlecht beliefert. </p>
19. 4 1919 - Regierungs-Flugblätter stellen baldige Hilfe in Aussicht
<p><em><strong>München</strong></em> * Flugzeuge werfen Flugblätter der Regierung Hoffmann ab. Diese stellen baldige Hilfe in Aussicht.</p>
19. 4 1919 - Der Straßenbahnbetrieb wird wieder aufgenommen
München * Karsamstag: Die Stadtverwaltung darf nach über fünftägiger zwangsweiser Stilllegung den Straßenbahnbetrieb wieder aufnehmen. Damit sollen Einnahmen sichergestellt werden.
19. 4 1919 - Blumengeschäfte und Theater dürfen wieder öffnen
<p><em><strong>München</strong></em> * Blumengeschäfte und Theater, nicht jedoch Kinos, dürfen - trotz des Generalstreiks - wieder öffnen.</p>
19. 4 1919 - Fake News - Die Propaganda der Gegenrevolution
<p><em><strong>München - Berlin</strong></em> * Nach dem Palmsonntag-Putsch der regierungstreuen Truppen dominiert außerhalb Münchens die Propaganda der Konterrevolution. Der USPD-Politiker Felix Fechenbach liest Berliner Zeitungen und notiert in sein Tagebuch:</p> <p><em>„Es ist grauenvoll, was alles über München gelogen wird. Der Bahnhof zertrümmert, die Neuhauser Straße in Flammen, Massenmorde, Vermögensbeschlagnahme und die Erklärung der Frauen des Bürgertums zum Gemeineigentum. […] Wahr ist von all diesen Nachrichten nicht ein Wort.“ </em></p>
19. 4 1919 - Schützt Euch vor den Revolutionsschmarotzern
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Volksbeauftragte für das Militärwesen, Wilhelm Reichart, ruft gegen unberechtigte Requirierungen und Plünderungen auf: <em>„Schützt Euch vor den Revolutionsschmarotzern“</em>. </p>
19. 4 1919 - Ernst Toller berichtet den Betriebsräten im Hofbräuhaus
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Auf der Versammlung der Betriebsräte im Hofbräuhaus berichtet Ernst Toller von den Kämpfen in und um Dachau. Er zeigt kein Verständnis für den Befehl des Münchner Generalstabs, die Truppen sofort zurückzuziehen. Nach Tollers Ansicht wäre es möglich gewesen, ohne Blutvergießen ganz Südbayern für die Räterepublik zu gewinnen. </p>
19. 4 1919 - Aufstellung von weiteren Freiwilligenverbänden genehmigt
<p><em><strong>Bamberg</strong></em> * Die nach Bamberg geflohene bayerische Staatsregierung genehmigt die Aufstellung von weiteren Freiwilligenverbänden. </p>
19. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann genehmigt das Freikorps Oberland
<p><strong><em>Bamberg - München </em></strong>* Der Chef der Thule-Gesellschaft, Rudolf von Sebottendorff erhält nach kurzen Verhandlungen von der Bamberger Regierung die Ermächtigung, in Treuchtlingen das Freikorps Oberland aufzustellen. Das Freikorps Oberland setzt sich aus dem Kampfbund Thule und aus Freiwilligen zusammen, die in Treuchtlingen und Eichstätt angeworben werden. </p>
19. 4 1919 - Dr. Rudolf Schollenbruch wird Armeearzt der Roten Armee
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Haidhauser Armenarzt, Dr. Rudolf Schollenbruch, wird zum Armeearzt der Roten Armee ernannt. </p>
20. 4 1919 - Regierungstruppen marschieren in Augsburg ein
<p><em><strong>Augsburg</strong></em> * Obwohl die Augsburger Räteregierung am 13. April durch die von der Bamberger Regierung verhängte Wirtschaftsblockade aufgegeben hat, marschieren an diesem 20. April Regierungstruppen in aller Frühe in Augsburg ein. Die Augsburger gelten bei den Regierenden als <em>„politisch unzuverlässig“</em>. </p>
20. 4 1919 - „Münchner! Habt noch wenige Tage Geduld!“
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Regierung Hoffmann lässt über München Flugblätter abwerfen. In der Überschrift heißt es: <em>„Münchner! Habt noch wenige Tage Geduld!“ </em></p>
20. 4 1919 - Ein weiterer Verhaftungsversuch misslingt
München-Kreuzviertel * Ein weiterer Versuch Erzbischof Michael von Faulhaber zu verhaften misslingt.
20. 4 1919 - Finanzmittel für die Räterepublik sollen beschafft werden
<p><em><strong>München - Budapest - Moskau - Wasserburg</strong></em> * Am Nachmittag fliegen Eugen Leviné, Wilhelm Reichart, der Volksbeauftragte für das Militärwesen und der Student Karl Petermeier, der Adjudant Rudolf Egelhofers, mit Ziel Budapest und Moskau ab. Sie wollen dort Finanzmittel für die Räterepublik beschaffen. Der Flug endet jedoch bereits in Wasserburg am Inn, wo der Pilot unter Vortäuschung eines Motordefekts notlandet.</p>
20. 4 1919 - Die größte militärische Operation der Nachkriegszeit hat begonnen
<p><em><strong>Weimar - Augsburg - München</strong></em> * Mit dem von Reichswehrminister Gustav Noske eingerichteten <em>„Oberkommando der Reichsaktion gegen München“</em> hat die größte militärische Operation der Nachkriegszeit begonnen. 35.000 Soldaten aus Bayern, Württemberg und Norddeutschland marschieren auf München zu. </p>
20. 4 1919 - Mit erhobenem Haupte untergehen
<p><em><strong>München</strong></em> * Eugen Leviné erkennt, dass es für die bedrängte Räterepublik keine Unterstützung von außen geben wird. Doch wenn die Revolution untergehen soll, dann - so seine Auffassung - mit erhobenem Haupt:</p> <p><em>„Es ist ein Irrtum zu glauben, dass kleinmütige Unterwerfung ein besserer Weg sei, um Blutvergießen zu vermeiden oder zu verhindern. Im Gegenteil: Nur wenn die Weißen Garden eine kühn entschlossene Armee vor sich haben und merken, dass der Kampf auch in ihren Reihen Opfer fordern wird, werden sie bereit sein, Konzessionen zu machen. […] </em></p> <p><em>Die Weiße Armee wird auf jeden Fall einen Vorwand für ein Blutbad finden. […] Ist Arbeiterblut so billig, dass man es zur Genugtuung von neugebackenen Pazifisten wehrlos vergießen darf?“</em>.</p> <p>Leviné argumentiert damit gegen Ernst Toller und Gustav Klingelhöfer, die mit der Regierung Hoffmann verhandeln wollen. Doch auch der KPD-Parteiführer in Berlin, Paul Levi, befürwortet eine bedingungslose Kapitulation, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. </p>
21. 4 1919 - Der Generalstreik wird um einen Tag verlängert
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Versammlung der Betriebsräte im Festsaal des Hofbräuhauses beschließt, den Generalstreik auf Dienstag auszuweiten. Der letzte Streiktag soll zu einer <em>„wuchtigen Demonstration des Münchner klassenbewussten Proletariats“</em> werden. </p> <p>Abgelehnt wird der Vorschlag von Eugen Leviné, die Massendemonstration mit einer Schlusskundgebung in der rot ausgekleideten Frauenkirche zu beenden. </p>
21. 4 1919 - In Banken dürfen wöchentlich nicht mehr als 600 Mark abgehoben werden
<p><em><strong>München</strong></em> * An diesem Ostermontag ordenen Emil K. Maenner, der Volksbeauftragte für Finanzen und Towia Axelrod, der als Politischer Kommissar dem Vollzugsrat angehört und zugleich Stellvertretender Volksbeauftragter für Finanzen ist, an, dass bei den Geldinstituten wöchentlich nicht mehr als 600 Mark abgehoben werden dürfen. </p>
21. 4 1919 - Ernst Toller zieht sich mit seinen Truppen nach München zurück
Dachau - München * Als Ernst Tollers Truppen den Befehl erhalten, sich an den Rand von München zurückzuziehen, kehrt dieser in die Landeshauptstadt zurück.
21. 4 1919 - Regierungs-Flugblatt: Kopf hoch, Mut nicht sinken lassen!
<p><em><strong>München</strong></em> * Über München abgeworfene Flugblätter der nach Bamberg geflohenen Regierung Hoffmann besagen: <em>„Kopf hoch, Mut nicht sinken lassen! Hilfe naht baldigst“</em>. Unterzeichnet ist das Flugblatt von Ministerpräsident Johannes Hoffmann und dem Minister für militärische Angelegenheiten, Ernst Schneppenhorst. </p>
22. 4 1919 - Die Demonstration des Proletariats mit einer großen Truppenschau
<p><em><strong>München</strong></em> * Um 11 Uhr beginnt an diesem neunten und letzten Tag des Generalstreiks die <em>„Demonstration des Proletariats“</em> mit einer großen Truppenschau, die zugleich der Massenmobilisierung in München dient. Rund 12 bis 15.000 bewaffnete Angehörige der Roten Armee marschieren mit. Sie will so ihre Stärke darstellen.</p> <p>Um 15 Uhr finden in den größten Münchner Sälen elf Massenversammlungen statt, auf denen Mitglieder des Vollzugsrats Reden halten.</p> <p>Um 17 Uhr setzt sich ein großer Demonstrationszug in Bewegung, der von der Theresienwiese durch die Innenstadt bis zum Siegestor zieht und sich schließlich vor dem Wittelsbacher Palais auflöst. </p>
22. 4 1919 - Ernst Toller will mit der Regierung Hoffmann verhandeln
München * Ernst Toller warnt - trotz der erzielten Siege gegen die Weißen Truppen bei Dachau - vor einer Fortsetzung der kriegerischen Auseinandersetzungen. Er will lieber mit Vertretern der in Bamberg tagenden Regierung Hoffmann verhandeln.
22. 4 1919 - Pfarrer Hans Meiser wird als Geisel verhaftet
München-Maxvorstadt * Am frühen Morgen wird Pfarrer Hans Meiser, der spätere Landesbischof der evangelischen Kirche, mit zwölf weiteren Personen als Geisel verhaftet und zunächst in die Guldeinschule, später auf die Polizeiwache in der Astallerstraße gebracht.
Durch Bestechung eines Postens können die Geiseln Kontakt mit einem Mitglied des Vollzugsrats aufnehmen, der die Verhaftung als Eigenmächtigkeit der Soldaten erklärt und die Geiseln ab 18 Uhr wieder in die Freiheit entlässt. Bei Hans Meiser dauert die Entlassung am längsten, weil er als Geistlicher dem „System Kirche“ angehört, das gegen die Räterepublik eingestellt ist.
22. 4 1919 - Der Dentist Johann Clemens Waldschmidt wird Polizeipräsident
<p><em><strong>München</strong></em> * Polizeipräsident Hans Köberl und sein Stellvertreter Johann Dosch werden abgesetzt und verhaftet. Neuer Chef im Polizeipräsidium wird der ebenfalls vorbestrafte Dentist Johann Clemens Waldschmidt.</p>
22. 4 1919 - In Sachsen entsteht eine Landesstelle für Gemeinwirtschaft
Sachsen * Obwohl in Sachsen die sozialistischen Parteien die absolute Mehrheit im Landtag haben und dadurch prädestiniert scheinen, die Sozialisierung umzusetzen, entsteht nur eine „Landesstelle für Gemeinwirtschaft“, die den politischen Handlungsdruck verringern soll.
22. 4 1919 - Die Auswirkungen des Generalstreiks
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Generalstreik hat natürlich Auswirkungen, die sich spätestens jetzt zeigen. Ernst Toller schreibt:</p> <p><em>„Kohle fehlt, Geld fehlt, die Lebensmittel werden knapp, bisher lieferten die Bauern täglich 150.000 Liter Milch nach München, jetzt nur noch 17.000 Liter, ein Edikt der Regierung verbietet das Verarbeiten der Milch zu Butter und Käse und bezeichnet es als konterrevolutionäre Handlung.“</em> </p>
22. 4 1919 - Augsburg kapituliert
Augsburg * Augsburg kapituliert, nachdem sich die Arbeiter erbittert gewehrt haben. Dadurch können die Weißen Truppen den strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt einnehmen. Eine für die Eroberung Münchens wichtige Voraussetzung.
Alleine an diesem 22. April kommen zehn Regierungssoldaten und 34 Einwohner von Augsburg ums Leben, darunter vier Frauen und ein Kind. Die meisten sind unbeteiligte Zivilisten.
23. 4 1919 - Die Vorlesungen des Sommersemesters beginnen nicht vor dem 1. Juli
München * Der Revolutionäre Hochschulrat ordnet an, dass die Vorlesungen des Sommersemesters nicht vor dem 1. Juli beginnen.
23. 4 1919 - Reichswehrminister Gustav Noske ordnet den Angriff auf München an
Weimar * Reichswehrminister Gustav Noske [SPD] ordnet den Angriff Münchens durch zwei große militärische Einheiten an und übernimmt für die Aktion selbst die Oberleitung.
- Die an der bayerischen Nordgrenze stehenden Preußischen Hilfstruppen unter Generalleutnant Ernst von Oven und
- die Württembergischen Einheiten sowie die noch zu sammelnden bayerischen Verbände und das Bayerische Schützenkorps bei Augsburg-Ulm.
Noske gibt dazu militärisch präzise Anweisungen: „Das Operationsziel ist München. In München ist die Gewalt der gesetzmäßigen bayerischen Regierung wiederherzustellen. […] Sobald München besetzt und der Widerstand in München erloschen ist, übernimmt der bayerische Generalmajor [Arnold Ritter] von Möhl den Befehl in München“.
Die Gesamtstärke der gegen die Räteregierung eingesetzten, voll ausgerüsteten Streitkräfte beträgt annähernd 35.000 Mann. Der Oberbefehl wird dem preußischen Generalleutnant Ernst von Oven übertragen.
23. 4 1919 - Der Installateur Ferdinand Mairgünther wird Polizeipräsident
München * Polizeipräsident Johann Clemens Waldschmidt wird nach nur knapp einem Tag durch den Installateur Ferdinand Mairgünther, dem Schriftleiter der Münchener Roten Fahne, abgelöst.
23. 4 1919 - Regierungs-Flugblätter fordern zum Durchhalten auf
München * Regierungstreue Flugzeugbesatzungen werfen wieder Flugblätter der Regierung Hoffmann über München ab, die zum Durchhalten auffordern.
23. 4 1919 - Die Münchener Post wird als erste Tageszeitung zugelassen
München * Die Münchener Post wird als erste Tageszeitung zugelassen.
Gleichzeitig erscheint die Nummer 10 der „Mitteilungen des Vollzugsrats der Betriebs- und Soldatenräte“.
24. 4 1919 - Neue Papiergeld-Zwanzigmarkscheine werden gedruckt
München * Um den Missstand der Zahlungsmittelnot zu beheben, wird mit den noch vorhandenen Druckplatten für Zwanzigmarkscheine neues Papiergeld gedruckt. Das Notenpapier reicht allerdings gerade Mal für 10 Millionen Mark.
24. 4 1919 - Neuer Stadtkommandant wird Max Mehrer
München * Willy Weinberger wird wieder Stellvertretender Stadtkommandant. Neuer Stadtkommandant ist nun Max Mehrer.
24. 4 1919 - Der Personenverkehr auf den Bayerischen Staatsbahnen wird eingestellt
Bamberg * „Der Freistaat“, das amtliche Organ der in Bamberg residierenden Regierung Hoffmann, gibt bekannt: „Wegen Kohlenmangel muss ab heute der Personenverkehr auf den bayerischen Staatseisenbahnen eingestellt werden.“
24. 4 1919 - Ein Drittel der Belegschaften streikt im Ruhrgebiet noch immer
Ruhrgebiet * Noch immer streikt ein Drittel der Belegschaften im Ruhrgebiet.
24. 4 1919 - Erscheinungsverbot für bürgerliche Zeitungen
München-Graggenau * Die Betriebsräte beschließen im Hofbräuhaus-Parlament, dass auch weiterhin keine bürgerlichen Zeitungen erscheinen dürfen.
24. 4 1919 - Dr. Rudolf Schollenbruch wird Volksbeauftragter für das Gesundheitswesen
München * Der Kommunist, Haidhauser Armenarzt und Armeearzt der Roten Armee, Dr. Rudolf Schollenbruch, wird zum Volksbeauftragten für das Gesundheitswesen bestimmt.
25. 4 1919 - Aufruf zum Eintritt in die Freikorps und in die Volkswehr
München - Bamberg - Freistaat Bayern * In Flugblättern der Regierung Hoffmann wird zum Eintritt in die Freikorps und in die Volkswehr aufgerufen.
25. 4 1919 - Für das rechtsrheinische Bayern gilt das Standrecht
Bamberg - Freistaat Bayern * Die Regierung Hoffmann beschließt von Bamberg aus für das rechtsrheinische Bayern das Standrecht. Damit haben die Soldaten die Anweisung, jeden zu erschießen, den sie „mit der Waffe in der Hand“ antreffen.
25. 4 1919 - Das Kuchenverbot bleibt auch weiterhin bestehen
München * Die Betriebsräte beschließen, dass Kleinkunstbühnen, Cafés und Weinlokale wieder bis zur Polizeistunde geöffnet haben dürfen. Bars und Animierkneipen müssen dagegen geschlossen bleiben. Auch das Kuchenverbot besteht weiterhin.
25. 4 1919 - Die Rote Armee verstärkt ihre Anwerbeaufrufe
München * Die Rote Armee verstärkt ihre Anwerbeaufrufe und begründet das mit dem Heranrücken der Regierungstruppen.
25. 4 1919 - Die größte militärische Operation der Nachkriegszeit kommt auf München zu
Freistaat Bayern * 35.000 bayerische, württembergische und norddeutsche Soldaten marschieren in Richtung München. Das ist die größte militärische Operation der Nachkriegszeit.
25. 4 1919 - Gewerkschaften bekennen sich zum Mitbestimmungsrecht der Arbeiter
Berlin * Die Spitzen der Gewerkschaft beschließen nahezu einstimmig eine Resolution, in der sie sich zu einem Mitbestimmungsrecht der Arbeiter bekennen.
25. 4 1919 - Milch nur für Kranke mit Attest auf Lebensgefahr
München * Das Lebensmittelamt der Stadt München plakatiert zur „Milchversorgung“, dass es sich als notwendig erweist, den Verbrauch von Milch für alle zu verbieten.
„An Kranke kann bis auf weiteres nur bei unmittelbarer Lebensgefahr Milch abgegeben werden. Die Lebensgefahr ist durch ein ärztliches Zeugnis zu bestätigen“.
25. 4 1919 - Macht Euch selbst einen Eindruck über die Lage in München
München * Die Kasernenräte fordern in Flugblättern die Weißen Truppen auf, sich selbst einen Eindruck über die wirkliche Lage in München zu verschaffen: „Das Proletariat Münchens garantiert Eurer Abordnung absolute Sicherheit, Ihr könnt jederzeit kommen, Euch alles ansehen und jederzeit ungehindert zurückkehren“.
25. 4 1919 - Milde ist Schlappheit, Gutmütigkeit ist Unzuverlässigkeit
Freistaat Bayern * An die Kommandeure der Regierungstruppen und Freikorps wird folgende Anweisung gegeben:
„Die Gruppen haben ihre Aufträge mit Gewalt durchzuführen, jedes Verhandeln mit dem Feinde oder mit der Bevölkerung ist verboten. Milde wird als Schlappheit, Gutmütigkeit als Unzuverlässigkeit der Truppen gedeutet“.
Außerdem erhalten die Regierungssoldaten Belehrungen über die Verkommenheit ihrer Gegner, mit denen sie es in München zu tun haben werden. Eigens ausgebildete Agitatoren bläuen den Soldaten ein, dass die Spartakisten jeden auf der Stelle umbringen, der einen „Noske-Ausweis“ bei sich trägt. Als „Noske-Ausweis“ bezeichnet man umgangssprachlich die Kärtchen, mit denen sich die Regierungssoldaten ausweisen.
26. 4 1919 - Die Versorgung Münchens mit Milch ist nahezu eingestellt
München * Die Versorgung Münchens mit Milch ist nahezu eingestellt.
Selbst an Kranke kann nur noch bei unmittelbarer Lebensgefahr Milch abgegeben werden.
26. 4 1919 - Die neu gedruckten Zwanzigmarkscheine sind wertlos
München * Die neu gedruckten Zwanzigmarkscheine haben eine Seriennummer (Serie B, Nummern über 800.000). Die Regierung Hoffmann lässt über München Flugblätter abwerfen, in denen sie diese Scheine für „wertlos“ erklärt.
26. 4 1919 - Die DDP mahnt den Schutz der Frauen und Kinder an
München * Die Deutsche Demokratische Partei - DDP mahnt in Flugblättern den Schutz der Frauen und Kinder für die zu erwartenden Kämpfe an. Die Betroffenen sollen ihre Häuser und Wohnungen schließen und weder an die Fenster treten noch auf die Straße gehen.
26. 4 1919 - Der Einmarsch in München wird organisatorisch vorbereitet
Nordbayern * Generalleutnant Ernst von Oven bereitet den Einmarsch in München organisatorisch vor. Dazu lässt er unter anderem Stadtpläne an die Truppen verteilen.
26. 4 1919 - Die seit Längerem bestehenden Differenzen brechen auf
München-Graggenau * Im Hofbräuhaus, in dem sich täglich die Betriebs- und Kasernenräte treffen, treten die seit längerer Zeit bestehenden politischen Differenzen zwischen den Kommunisten, Eugen Leviné, Max Levien und Towia Axelrod einerseits, und den Unabhängigen Sozialdemokraten, Emil K. Maenner, Ernst Toller und Gustav Klingelhöfer andererseits, offen zutage. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, in deren Folge die drei Letztgenannten von ihren Ämtern zurücktreten.
- Der Volksbeauftragte für Finanzen, Emil K. Maenner, erklärt, dass er nicht mehr für Handlungen bereitsteht, die „politischem Diebstahl“ gleichkommen und keine Lust mehr hat, in einem „Marionettentheater“ zu sitzen.
- Der Kommandeur des Truppenabschnitts I (Dachau), Ernst Toller, betrachtet die jetzige Räteregierung als ein „Unheil für das werktätige Volk“, weil die führenden Männer nur zerstören, ohne das geringste aufzubauen. Deshalb kann er eine weitere Zusammenarbeit mit dem Vollzugsausschuss und dem Generalstab nicht mehr verantworten.
- Aus den gleichen Gründen will auch der Abschnittskommandant der Roten Armee in Dachau, Gustav Klingelhöfer, seine Ämter niederlegen.
Der Bankrat stellt sich geschlossen hinter Emil K. Maenner und bezeichnet die Mitglieder des Vollzugsausschusses als „Hampelmänner“.
Mit ähnlich harten Worten wird die „katastrophale Versorgungslage“ von den Anwesenden kritisiert, an der die Regierung Hoffmann nur zum Teil schuld ist.
Nach einem weiteren Beschluss der Betriebsräte sollen die Münchner Tageszeitungen - unter Auflage einer Vorzensur - wieder erscheinen können.
Während der Sitzung trifft die Nachricht ein, dass im Passamt fünfzig Pässe gestohlen worden sind. Zur Untersuchung des Vorgangs wird daraufhin eine Zehnerkommission gebildet.
26. 4 1919 - Die Aktivitäten der Thule-Gesellschaft werden aufgedeckt
München * Die Aktivitäten der Thule-Gesellschaft werden von der Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution aufgedeckt. Mit Hilfe von gefälschten Stempeln und Ausweisen hat sich die Thule-Gesellschaft Zugang zur Roten Armee verschafft und alle gesammelten Informationen an die Regierung Hoffmann in Bamberg weitergegeben.
Die Angreifer sind damit im Besitz wertvoller Informationen über Abwehrstellungen, Truppenstärke, Bewaffnung und die Verteidigungsstrategie der Roten Armee.
Die Durchsuchung der Logen-Räume der Thule-Gesellschaft im Hotel Vier Jahreszeiten bestätigt den Verdacht, aber die Verantwortlichen sind inzwischen geflohen. Allerdings haben sie die Mitgliederkartei vergessen. Dadurch kann die Rote Armee mehrere Mitglieder der Thule-Gesellschaft verhaften. Sie stehen unter dem Verdacht, für die Regierungstruppen und Freikorps geworben zu haben.
Anschließend werden sie ins Luitpold-Gymnasium gebracht.
26. 4 1919 - Mit gefälschten Freisfahrtsscheinen nach Eichstätt
München-Isarvorstadt - Eichstätt * Vom 18. April bis zur Besetzung der Thule-Büros im Hotel Vier Jahreszeiten und der Verhaftung der noch in München verbliebenen Thule-Mitglieder am 26. April werden weit über 500 Personen zum Teil mit gefälschten Freifahrtscheinen aus München herausgeschleust und nach Eichstätt gebracht.
Unter den Reisenden befinden sich auch Rudolf Heß und der Berufssoldat Ernst Röhm, der sich dem Freikorps Epp anschließen will. In kürzester Zeit ist das Freikorps Oberland zu einem voll bewaffneten Regiment mit 250 Mann ausgebaut.
26. 4 1919 - Josef Hofmiller beklagt den Mangel an Information
München-Haidhausen * Josef Hofmiller vertraut seinem Tagebuch folgende Zeilen an: „Seit 13. April sind wir ohne Zeitungen und von der Außenwelt so abgeschnitten, wie das belagerte Paris, eigentlich viel ärger, weil wir nicht einmal erfahren, was in unserer eigenen Stadt vorgeht.
Es könnten die nächsten Bekannten sterben, wir würden es nicht erfahren, da es keine Todesanzeigen gibt. Wir können selbst sterben, unsere nächsten Verwandten würden es nicht erfahren“.
26. 4 1919 - Beunruhigend sind die beruhigenden Flugblätter
München-Haidhausen * Ein weiterer Tagebucheintrag von Josef Hofmiller, dem Herausgeber der reaktionären Süddeutschen Monatshefte, beschreibt die unsichere Situation der Bevölkerung:
„Es wird allmählich das reinste Geduldsspiel: kommt sie, kommt sie nicht, nämlich die weiße Garde? Wir wissen gar nichts. Am meisten beunruhigt, dass immer wieder beruhigende Flugblätter abgeworfen werden“.
26. 4 1919 - Die Vorwürfe Ernst Tollers in der Neuen Zeit
München * In der Neuen Zeitung vom 30. April wird die Anklage Ernst Tollers im Hofbräuhaus-Parlament wiedergegeben.
„Bei jeder Aktion wird nicht gefragt, ob sie die Lage unserer besonderen Verhältnisse, den Anschauungen der großen Masse unserer arbeitenden Bevölkerung, der Sorge für unsere Gegenwart und Zukunft entspricht, sondern nur, ob sie den Lehren des russischen Bolschewismus gemäß ist, ob Lenin oder Trotzki so oder so im gleichen Falle verfahren würden. […] Wir Baiern sind keine Russen!“.
Außerdem verurteilt Ernst Toller, dass das Volk über die wirkliche Lage im Unklaren gelassen wird und veröffentlicht eine Erklärung dazu.
27. 4 1919 - Im Hofbräuhaus eskaliert schließlich der Konflikt
München-Graggenau * Im Festsaal des Hofbräuhauses eskaliert nun der Konflikt zwischen den Befürwortern und Gegnern der Verhandlungen mit der Regierung Hoffmann.
Verhandlungen mit der Bamberger Regierung sind jedoch nicht mehr möglich, da sowohl die Regierung des Freistaats Bayern als auch die Reichsregierung die Bedingungslose Kapitulation und die Auslieferung aller Führer fordern.
„Die Verhältnisse in Südbayern haben sich nunmehr durch Verschulden des Münchener Terrors zum direkten Kriegszustand entwickelt. [...] Gewalt kann nur mit Gewalt bekämpft und unterdrückt werden. Verhandlungen, Besprechungen und Abmachungen mit den Volksfeinden, die unser Südbayern ins Unglück gestürzt haben, sind vergeblich“.
Durch diese unnachgiebige Haltung sehen die Kommunisten keine andere Wahl, als bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Sieg oder Niederlage - dazwischen gibt es für sie keine Alternative.
27. 4 1919 - Besetzungs-Befehle des Reichswehrtruppenkommandos
Freistaat Bayern * Auf Befehl des Reichswehrtruppenkommandos sind Generalleutnant Ernst von Oven alle bayerischen und württembergischen Truppen einschließlich des Freiwilligen Bayerischen Schützenkorps unter Oberst Franz Ritter von Epp unterstellt.
27. 4 1919 - München ist von der Außenwelt vollständig abgeschnitten
München * München ist inzwischen von der Außenwelt vollständig abgeschnitten.
27. 4 1919 - Die Thule-Gesellschaft als gemeingefährliche Verbrecherbande bezeichnet
München * Die am Tag zuvor verhafteten Mitglieder und Anwärter der Thule-Gesellschaft werden auf einem Plakat als „gemeingefährliche Bande von Verbrechern“ bezeichnet, die neben der Fälschung militärischer Stempel auch Diebstähle, Plünderungen und sogar Viehraub im großen Stil begangen hat.
27. 4 1919 - Die Bewohner Münchens sind der Willkür ausgesetzt
München * Die Bewohner Münchens sind weiterhin willkürlichen Verhaftungen, Beschlagnahmungen, Plünderungen und Bedrohungen ausgesetzt.
27. 4 1919 - Eugen Leviné beschwert sich über die Zehnerkommission
München * Über das Auftauchen der Zehnerkommission - mit Unterstützung von zehn Angehörigen der Roten Armee - im Beratungszimmer des Vollzugsausschusses beschwert sich Eugen Leviné in der Versammlung im Hofbräuhaus.
27. 4 1919 - Die Zehnerkommission berichtet zur Passangelegenheit
München * Das Hofbräuhaus-Parlament tritt auch an diesem Sonntag zusammen. Die am Vortag gebildete Zehnerkommission berichtet den Betriebs- und Soldatenräten über das Ergebnis ihrer Untersuchungen zur sogenannten Passangelegenheit.
Die Pässe wurden im Auftrag von Max Levien geholt, „um sie der Bourgeoisie zu entziehen und ihr die Flucht in das Ausland unmöglich zu machen“. Über den Verbleib der Pässe können allerdings keine Aussagen gemacht werden.
27. 4 1919 - Die nur einen Tag andauernde Diktatur der Betriebsräte beginnt
München-Graggenau * Anschließend bildet sich eine „Geschäftskommission der Betriebs- und Soldatenräte“, der keine Kommunisten, sondern ausschließlich Mitglieder der USPD, darunter Ernst Toller und Gustav Klingenhöfer angehören. Gustav Landauer bietet diesem sofort seine Mitarbeit an.
Sie soll bis zur Wahl eines neuen Aktionsausschusses am nächsten Tag regieren. Damit beginnt die nur einen Tag andauernde „Diktatur der Betriebsräte“.
27. 4 1919 - Die Betriebs- und Kasernenräte stürzen die kommunistische Räterepublik
München-Graggenau * Ernst Toller bekräftigt im Hofbräuhaus erneut seine Meinung, dass die jetzige Räteregierung eine „Gefahr für das Proletariat und die Räterepublik“ darstellt.
Die Betriebs- und Kasernenräte zwingen den Aktionsausschuss zum Rücktritt und entziehen damit auch dem Vollzugsrat das Vertrauen. Damit beenden sie die kommunistische Diktatur des Proletariats von Eugen Leviné und Max Levien.
27. 4 1919 - Lenin beglückwünscht den Freistaat Bayern zur Räterepublik
Moskau - München * Der russische Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin gratuliert telegrafisch aus Moskau zur Räterepublik. Das Schreiben erreicht jedoch keinen der beglückwünschten Empfänger.
28. 4 1919 - Die Betriebs- und Soldatenräte wählen einen neuen Aktionsausschuss
München-Graggenau * Im Hofbräuhaus treffen sich die Betriebs- und Soldatenräte zur endgültigen Neuwahl des Aktionsausschusses. Lediglich gewählte Betriebsräte sind zugelassen. Der als Mitglied der Pressekommission anwesende Gustav Landauer muss den Saal verlassen.
- Ernst Toller erklärt, dass sich der gestrige Beschluss der Betriebsräte nicht gegen die KPD allgemein richtet, sondern gegen Einzelpersonen, die zufällig der KPD angehören.
- Gustav Klingelhöfer betont in seinem Redebeitrag, dass er sich nur gegen die diktatorischen Maßnahmen einzelner Führer wendet und nicht gegen die KPD insgesamt.
Anschließend wird ein zwanzigköpfiger Aktionsausschuss gewählt, der aus 15 Betriebsräten und fünf Soldatenräten besteht. Unter ihnen ist kein Kommunist. Ernst Toller, Gustav Klingelhöfer und Rudolf Egelhofer kandidieren nicht für dieses Gremium.
28. 4 1919 - Erzbischof Michael von Faulhaber verlässt München
München-Kreuzviertel * Erzbischof Michael von Faulhaber verlässt München, um außerhalb Münchens Firmungen vorzunehmen. Er kommt erst am 6. Mai wieder zurück.
28. 4 1919 - Die Regierung Hoffmann hat sich der Reichswehr ausgeliefert
München * Mit dem Herannahen der Regierungstruppen wird die Zahl derer, die bereit sind zu kämpfen, immer kleiner. Doch die Regierung Hoffmann hat sich bei der Befreiung Münchens praktisch der Reichswehr ausgeliefert. Nachdem sie einmal die Zustimmung zur Reichsexekution gegeben hat, kann sie keinerlei Einfluss mehr auf den ganzen Vorgang ausüben.
28. 4 1919 - Späherberichte zeigen eine deutlich sinkende Stimmung
München * Die Späherberichte zeigen ganz deutlich die Stimmung in der Betriebs- und Soldatenräte-Versammlung: „Die Reden in der siebenstündigen Versammlung zeigten, dass man bestrebt ist, so gut es geht den Weg zum Ausgangspunkt zurückzufinden. Das ist die Stellung der vernünftigen und größeren Mehrheit der Münchner Arbeiter“.
28. 4 1919 - Die Einschließung Münchens bis zum 30. April befohlen
Freistaat Bayern * Generalleutnant Ernst von Oven befiehlt den Vollzug der Einschließung Münchens bis zum 30. April. Er ordnet an, dass die bayerischen Streitkräfte nicht vorzeitig und vereinzelt losschlagen. Die Befehle für den Zeitpunkt des Einmarsches in München sind eindeutig.
- Am Freitag, 2. Mai, um 12:00 Uhr, soll gleichzeitig und überraschend in die Landeshauptstadt eingerückt werden und damit dem Gegner möglichst wenig Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Kampfstärke gegeben werden.
28. 4 1919 - Das Luitpold-Gymnasium wird Sitz des Aktionsausschusses
München-Isarvorstadt * Das Luitpold-Gymnasium wird Sitz des Aktionsausschusses und des Vollzugsausschusses, nachdem es zuvor schon Sitz der IV. Abteilung der Roten Armee war.
28. 4 1919 - Max Levien soll mit der Kasse der Kriegsgeschädigten durchgebrannt sein
München * Gerüchte tauchen in München auf, wonach der Kommunistenführer Max Levien mit der Kasse der Kriegsgeschädigten durchgebrannt sei.
28. 4 1919 - Giesinger Kommunisten stürmen das Polizeipräsidium
München-Kreuzviertel * Am Abend stürmen achtzig bis einhundert Giesinger Kommunisten das Polizeipräsidium, entwenden und vernichten Material des Erkennungsdienstes und der Fahndungsabteilung und verwüsten das Gebäude. Wertgegenstände und Waffen werden gestohlen.
Die Steckbriefsammlung, die Akten der Zigeuner-Nachrichtenstelle und die Einwohnerlisten türmen sich meterhoch in den Höfen des Präsidiums. Sie werden teilweise mit Benzin übergossen und angezündet.
28. 4 1919 - Eugen Leviné und Max Levien rechtfertigen das Scheitern ihrer Politik
München-Au * Während das Hofbräuhaus von der Roten Armee belagert wird, findet im Münchner-Kindl-Keller eine Versammlung der Kommunisten statt. Darin versuchen Eugen Leviné und Max Levien das Scheitern ihrer Politik zu rechtfertigen. Dabei erklärt Levien: Es kommt nicht drauf an, „ein paar Tausend Bürgerlichen die Gurgel abzuschneiden“.
28. 4 1919 - Die Diktatur der Roten Armee beginnt
München-Graggenau * Noch vor der Wahl wird das Hofbräuhaus von Einheiten der Roten Armee umstellt. Diese fordern
- die sofortige Beseitigung der Polizei und
- die Ausstattung des Oberkommandos der Roten Armee mit allen Vollmachten, „um den erfolgreichen Kampf gegen die Weiße Garde und besonders gegen die innere Reaktion führen zu können“.
Aus der Diktatur der Betriebsräte ist eine Diktatur der Roten Armee geworden. Unter ihrem Oberkommandierenden Rudolf Egelhofer ist die Wahl des neuen Aktionsausschusses mehr oder weniger gegenstandslos geworden.
28. 4 1919 - Die Rote Armee ist zur Verteidigung der Diktatur gegründet worden
München * In der KPD-Zeitung Münchener Rote Fahne äußert sich der Chef der Roten Armee, Rudolf Egelhofer, so: „Die Rote Armee wurde gegründet nicht als Instrument der Politik, sondern als Organ der Verteidigung der Diktatur des Proletariats und der Räterepublik gegen die Konterrevolution der weißen Garden.
Entsprechend dieser Aufgabe erklärt das Oberkommando, dass es das revolutionäre Proletariat, koste es was es wolle, gegen die weiße Garde verteidigen wird und sich von keiner Seite, auch nicht von den Betriebsräten, zu einem Verrat an der sozialen Revolution wird zwingen lassen“.
28. 4 1919 - Ernst Toller tritt als Truppenkommandant der Roten Armee zurück
München * Ernst Toller legt daraufhin seinen Posten als Truppenkommandant nieder. Er kann es sich gegenüber nicht verantworten, mit den Führern der KPD und der Roten Armee, deren Maßnahmen er verabscheut, zusammenzuarbeiten.
Spätestens seit dem 28. 4 1919 - Die Regierungssoldaten werden indoktriniert
Freistaat Bayern * Die Regierungssoldaten werden in den Tagen vor dem Einmarsch nach München intensiv indoktriniert. Man warnt sie davor, dass ihnen die sofortige Erschießung droht, wenn sie den Spartakisten in die Hände fallen. Gleichzeitig erklärt man ihnen, dass jeder Feind ein minderwertiger Ausländer sei.
Unter diesen Umständen stößt der Befehl, jeden zu erschießen, der sich den Regierungstruppen widersetzt, auf breite Zustimmung.
28. 4 1919 - Vor willkürlichem Machtmissbrauch der Räterepublik bewahren
München-Maxvorstadt * Bis zum Zusammenbruch der Räterepublik sitzen die Revolutionsgerichte über rund 300 Personen zu Gericht. In den drei Wochen Ihrer Tätigkeit gelingt es den Richtern weitgehend, die Angeklagten vor willkürlichem Machtmissbrauch der Räterepublik zu bewahren.
29. 4 1919 - Öffentliche Aufrufe zum Eintritt in das Freikorps Werdenfels
Garmisch * In Garmisch und Umgebung werden Aufrufe zum Eintritt in das Freikorps Werdenfels öffentlich angeschlagen und in den Zeitungen veröffentlicht.
29. 4 1919 - Egelhofers geplante Geiselnahme wird mit Stimmenmehrheit abgelehnt
München * Der Oberkommandierende der Roten Armee, Rudolf Egelhofer, stellt in der Sitzung der Stadtkommandantur den Antrag, die „Angehörigen der Bourgeoisie“ auf der Theresienwiese zusammenzutreiben und beim Einmarsch der Weißen Truppen zu erschießen.
Der Antrag wird mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt.
29. 4 1919 - Die Verwüstungen im Polizeipräsidium gehen weiter
München-Kreuzviertel * Im Polizeipräsidium gehen die Plünderungen und Verwüstungen weiter.
Die Aktenvernichtung im Polizeipräsidium wird von den konservativen und reaktionären Kräften als ein „besonderer Fall von Vandalismus“ bezeichnet und entsprechend politisch bewertet.
Der von der Berliner KPD nach München geschickte Karl Retzlaw hat eine völlig andere Sicht auf die Vorgänge: „Doch sprachen wir es auch offen aus, dass es nicht Sache eines Revolutionärs sei, sich dem Henker auszuliefern. Zu den Schutzmaßnahmen gehörte es auch, die Akten des Polizeipräsidiums zu vernichten. Das Prüfen der Akten würde eine Zeit von Monaten in Anspruch genommen haben, auch das Heraussuchen nur der politischen Akten würde zu lange dauern. Bedenken brauchten nicht zu bestehen, weil kulturell wertvolle Dokumente nicht in Polizeiakten zu finden sind. So war es am zweckmäßigsten, alles zu vernichten.
Menschenleben sind wichtiger als bedrucktes Papier. Zwei Tage lang brannten die Akten auf dem zementierten Hof des Polizeipräsidiums. Wohl an die hundert Helfer aus der Bevölkerung, der Partei und der Roten Armee warfen die Akten aus den Fenstern in die Flammen. Damit retteten wir Hunderten von politisch und antimilitärisch Verdächtigten aus der Zeit der Zusammenbruchsmonate 1918/19 Freiheit und Leben“.
29. 4 1919 - Nuntius Eugenio Pacelli flieht in die Schweiz
München-Maxvorstadt * Nuntius Eugenio Pacelli flieht umgehend in die Schweiz. Er wird erst am 8. August 1919 wieder nach München zurückkehren.
29. 4 1919 - Schwerbewaffnete Soldaten der Roten Armee in der Nuntiatur
München-Maxvorstadt * Gegen 15 Uhr tauchen schwerbewaffnete Soldaten der Roten Armee in der Nuntiatur in der Brienner Straße auf und fordern - unter persönlicher Bedrohung des Nuntius Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., - die Herausgabe seines Dienstautos.
Eine Beschwerde beim Kriegsministerium verstärkt nur die Forderung: „Wenn das Auto nicht sofort abgeliefert wird, dann wird die Nuntiatur zusammengeschossen und die ganze Bande verhaftet!“
Die Eindringlinge ziehen erst ab, nachdem die Stadtkommandantur eingreift.
29. 4 1919 - Rudolf Egelhofer ruft den sofortigen Generalstreik aus
München - Schleißheim - Starnberg * Rudolf Egelhofer, der Oberkommandierende der Roten Armee, ruft den sofortigen Generalstreik aus. Denn:
- in Schleißheim stehen schon die „Söldner des Kapitalismus“,
- in Starnberg haben die „weißgardistischen Hunde die Sanitätsmannschaften niedergemetzelt“, deshalb
- „Alle Mann zu den Waffen! Zeigt der weißen Garde, wie die Rote Armee zu siegen versteht!“
29. 4 1919 - Die Arbeiter sollen bewaffnet in ihren Betrieben erscheinen
München * Der Vollzugsrat der Betriebs- und Soldatenräte fordert die Arbeiter auf, am nächsten Tag bewaffnet in ihren Betrieben zu erscheinen.
29. 4 1919 - Max Leviens Diebstahl-Gerüchte werden dementiert
München * In Plakatanschlägen wird das in der Stadt umlaufende Gerücht dementiert, wonach Max Levien mit der Kasse der Kriegsgeschädigten durchgebrannt wäre.
29. 4 1919 - Die letzte Ausgabe der „Mitteilungen“ erscheint
München * Die letzte Ausgabe der „Mitteilungen des Vollzugsrats der Betriebs- und Soldatenräte“ (Nummer 15) erscheint.
29. 4 1919 - Ein von der Militärführung und der Regierung unterzeichnetes Kommuniqué
München * In München wird ein gemeinsam von der Militärführung und der Regierung Hoffmann unterzeichnetes Kommuniqué veröffentlicht, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird:
„Wer den Regierungstruppen mit der Waffe in der Hand entgegentritt, wird mit dem Tode bestraft. […] Jeder Angehörige der Roten Armee wird als Feind des bayerischen Volkes und des Deutschen Reiches behandelt“.
29. 4 1919 - Zwei Berliner Regierungsoldaten in Oberschleißheim festgenommen
Oberschleißheim * Die Rote Armee nimmt in Oberschleißheim zwei Regierungssoldaten des Berliner 8. Husarenregiments fest. Sie werden in das Luitpold-Gymnasium in der Müllerstraße gebracht und dort inhaftiert.
29. 4 1919 - Hinrichtungen in Starnberg von württembergischen Regierungssoldaten
Starnberg * In Starnberg marschieren Regierungstruppen ein. Es folgt ein ungleicher Kampf: Die Roten verfügen über etwa 100, die Weißen über 2.000 Männer.
Die Weißen Truppen, darunter die „Gruppe Seutter“, ein Kampfverband aus Württemberg, verhaften in Starnberg Männer, von denen sie glauben, dass sie feindliche Sparakisten wären. Sie werden eingesperrt und ein paar Stunden später auf der Bleicher-Wiese erschossen. Die 27 Spartakisten, andere Quellen sprechen sogar von 37 Kommunisten, werden ermordet, weil sie angeblich Waffen bei sich getragen haben. Diese Anschuldigungen werden mittlerweile bezweifelt.
Auch die unbeteiligte Kunstmalerin Sophie Banzer befindet sich unter den Opfern. Sie hatte sich eine rote Bluse angezogen und wird deshalb auf ihrem Anwesen getötet.
29. 4 1919 - Die Giesinger „Rote Garde. Abteilung: Bergbräu“
München-Giesing * Die Giesinger „Rote Garde. Abteilung: Bergbräu“ umfasst exakt 232 Mann.
29. 4 1919 - In Kolbermoor regiert ein Revolutionärer Arbeiterrat
Kolbermoor * In Kolbermoor regiert ein Revolutionärer Arbeiterrat.
29. 4 1919 - Franz von Stuck wird in der Kirchenschule inhaftiert
München-Haidhausen * Der Malerfürst Franz von Stuck wird - nach eigenen Aussagen - „Nachts um zwei Uhr“ von „zwei Soldaten mit aufgepflanztem Seitengewehr nach einem Schulgefängnis in Haidhausen“ gebracht.
29. 4 1919 - Anton Graf Arco-Valley wird in die Haidhauser Kirchenschule gebracht
München-Haidhausen * Mitglieder der Roten Armee bringen den beim Attentat schwerverletzten Kurt-Eisner-Mörder Anton Graf Arco auf Valley aus der Chirurgischen Klinik als Geisel in die Haidhauser Kirchenschule.
29. 4 1919 - Professor Ferdinand Sauerbruch kommt als Geisel in die Kirchenschule
München-Haidhausen * Professor Ferdinand Sauerbruch, der behandelnde Arzt des Kurt-Eisner-Mörders Anton Graf Arco auf Valley, wird ebenfalls in der Haidhauser Kirchenschule, dem Hauptquartier der Roten Armee, gebracht.
29. 4 1919 - Dem Münchener Spießer geschah es schon recht
Schleißheim * Im Jahr 1927 kommt das in insgesamt zehn Auflagen erschienene Buch „Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben“ auf den Markt. Darin beschreibt Manfred von Killinger seine stark antisemitisch geprägten Erinnerungen als Freikorpsführer der Marine-Brigade-Ehrhardt in der Zeit der Niederschlagung der Münchner Räterepublik. Das Buch beginnt so:
„Von Saalfeld kommend, luden wir in Schleißheim aus. Das Vierte Regiment hatte bereits gesichert. Wir bekamen Befehle. München war umstellt. Diesmal würde es zu harten Kämpfen kommen. In München hatte die rote Brut das Heft fest in der Hand. Lewin [!] Leviné-Nissen, Mühsam usw., was waren das für Namen. Waren das Bayern? Jüdisches, internationales Gesindel, die Intellektuellen aus Schwabing.
Es musste ja so kommen. Dem Münchener Spießer geschah es schon recht. Jahrelang hatte er das Treiben in Schwabing mit angesehen, das Treiben, das im Simplicissimus seinen Niederschlag gefunden hatte. Jahrelang hatte er behäbig lachend mit angesehen, wie Kirche und Thron von diesen Kreisen in den Dreck gezogen wurden, und das als guten Witz aufgefasst. Jetzt zeigte ihm die Bestie das wahre Gesicht“.
29. 4 1919 - Die Räteherrschaft in München ist gar nicht so schlimm wie befürchtet
Berlin - München * Die rechtsorientierte, alldeutsche Deutsche Zeitung, ein Blatt, das ganz bestimmt nicht in Verdacht steht, die „spartakistische Gefahr“ zu unterschätzen, druckt einen aus München herausgeschmuggelten Bericht ab, der vermittelt, dass die Räteherrschaft in München gar nicht so schlimm sei, wie befürchtet.
29. 4 1919 - Die Hinrichtungsaktion in Starnberg bringt die Gewaltspirale in Gang
Starnberg * An diesem Tag setzen die Regierungstruppen mit ihrer Hinrichtungsaktion in Starnberg die Gewaltspirale in Gang. Sie mündet in den Geiselmord vom Luitpold-Gymnasium und anderen Gräueltaten.
29. 4 1919 - Infos der Starnberger Hinrichtungen erreichen das Luitpold-Gymnasium
Starnberg - München-Ludwigsvorstadt * In der Nacht vom 29. zum 30. April erreichen Berichte der Hinrichtungen in Starnberg durch die Regierungssoldaten erreichen das Luitpold-Gymnasium.
30. 4 1919 - Der neue Aktionsausschuss will die Waffen niederlegen
<p><strong><em>München - Bamberg</em></strong> * Der neue Aktionsausschuss wendet sich an Ministerpräsident Johannes Hoffmann und erklärt sich bereit, die Waffen niederzulegen. Voraussetzung ist, dass die Weißen Truppen die Stadt nicht betreten werden. Ministerpräsident Hoffmann lehnt das Ansinnen mit den Worten ab: <em>„Bedingung ist unannehmbar. </em><em>Legt die Waffen nieder, jeder Widerstand ist nutzlos“</em>. </p>
30. 4 1919 - Zerfall der Räteregierung und der Roten Armee
<p><em><strong>München</strong></em> * In München werden keine Verteidigungsanlagen installiert. Dieser Tag bringt vielmehr der Zerfall der Räteregierung und der Roten Armee. </p> <p>Bei etwas gutem Willen der leitenden Offiziere der heranrückenden Truppen wäre eine geordnete Übergabe oder Rückgabe der Macht möglich gewesen. Doch sie haben kein Interesse an einer friedlichen Verständigung. Durch ihre kompromisslose Haltung fördern sie nur den Widerstandswillen der Fanatiker. </p>
30. 4 1919 - Der frühere Stadtkommandant Willy Weinberger ist ertrunken
<p><em><strong>München-Untergiesing</strong></em> * Am Rechen der Bäckerkunstmühle wird eine uniformierte Leiche aus dem Auer Mühlbach gezogen. Es handelt sich um den früheren Stadtkommandanten Willy Weinberger. </p>
30. 4 1919 - Versammlung der Betriebs- und Soldatenräte im Hofbräuhaus
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Um 23 Uhr wird eine Versammlung der Betriebs- und Soldatenräte ins Hofbräuhaus eingeladen. Die Versammlung distanziert sich von den Geiselmorden.</p> <p>Aus ihrem Kreis wählen die Versammelten gegen Mitternacht jeweils drei Betriebs- und Soldatenräte, die in Dachau wegen der Übergabemodalitäten für München verhandeln sollen.</p> <p>Ernst Toller beantragt die sofortige Einberufung eines Bayerischen Rätekongresses. Der Antrag wird angenommen. Danach vertagt sich die Versammlung. </p>
30. 4 1919 - Im Hof des Luitpold-Gymnasiums werden Geiseln erschossen
<p><em><strong>München-Isarvorstadt</strong></em> * Zwischen 16:30 und 17.30 Uhr werden im Hof des Luitpold-Gymnasiums weitere acht Geiseln von Angehörigen der Roten Armee - erneut ohne gerichtliches Verfahren und Urteil - erschossen. Nach den Hinrichtungen räumen die Rotarmisten die Schule.</p> <p>Mit Ausnahme des Kunstmalers und Professors Ernst Berger sind die restlichen sieben Erschossenen Mitglieder oder Anwärter auf eine Mitgliedschaft in der Thule-Gesellschaft.</p> <p>Wer den Befehl für die Hinrichtung gegeben hat, kann nicht mehr herausgefunden werden, weil sich der verantwortliche Kommandant bei seiner späteren Festnahme erschießt. </p>
30. 4 1919 - Das Dienstauto des geflohenen päpstlichen Nuntius beschlagnahmt
<p><em><strong>München</strong></em> * Auf schriftlichen Befehl Rudolf Egelhofers hin, wird das Dienstauto des inzwischen geflohenen päpstlichen Nuntius Eugenio Pacelli beschlagnahmt. Der Wagen ist jedoch nicht fahrbereit.</p>
30. 4 1919 - Die KPD wirbt zum Eintritt in die Rote Armee
<p><em><strong>München</strong></em> * Plakate der Roten Armee fordern die Arbeiter und Soldaten auf, die <em>„preußische Herrschaft“</em> abzuschütteln und sich bewaffnet dem Feind entgegenzustellen. Die KPD wirbt in einem Flugblatt zum Eintritt in die Rote Armee, während sich Eugen Leviné, Max Levien und Towia Axelrod in Sicherheit bringen. </p>
30. 4 1919 - Flugblätter über München: „Kopf hoch und Mut! Hilfe naht“
München * Über München kreisende Flugzeuge werfen Flugblätter mit Durchhalteparolen ab:
„[...] Kopf hoch und Mut! Hilfe naht, die Euch vom russischen Terror und Schrecken des Bolschewismus befreien wird“.
Ein anderes Flugblatt informiert darüber, dass München von bayerischen Truppen umstellt ist und fordert die Bevölkerung auf:
- „Hört die Stimme der Vernunft! Lasst ab vom bewaffneten Widerstand.
- Meidet die Straßen und Plätze, damit das Blut Unschuldiger nicht vergossen wird.
- Die Truppen der Regierung brechen schonungslos jeden bewaffneten Widerstand, um der Not Aller ein Ende zu machen.
- Lebensmittel, Kohlen, Rohstoffe stehen zur Einfuhr nach München bereit.
gez. Hoffmann, Ministerpräsident“
30. 4 1919 - Perlacher Rotarmisten gegen das Freikorps Regensburger Volkswehr
<p><em><strong>Perlach</strong></em> * Im Kampf um München liefern sich in Perlach Rotarmisten und das Freikorps Regensburger Volkswehr ein kurzes Feuergefecht. </p>
30. 4 1919 - Nieder mit den Hunden der Weißen Garde !
München * Handzettel mit folgendem Inhalt werden verteilt:
„Die Weiße Garde steht vor den Toren Münchens!
Nieder mit den Hunden der Weißen Garde!“
30. 4 1919 - Die Verhaftung von 500 Geiseln verweigert
<p><em><strong>München</strong></em> * Stadtkommandant Max Mehrer verweigert die geplante Verhaftung von weiteren 500 Geiseln. </p>
30. 4 1919 - Zwei Regierungssoldaten im Luitpold-Gymnasium hingerichtet
<p><em><strong>München-Isarvorstadt</strong></em> * Um 10 Uhr werden im Hof des Luitpold-Gymnasiums an der Müllerstraße zwei Angehörige des Berliner 8. Husarenregiments - ohne gerichtliches Urteil - erschossen. Sie haben - nach Misshandlungen - zugegeben, an der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts am 15. Januar beteiligt gewesen zu sein.</p> <p>Die Hingerichteten sind Regierungssoldaten, die am 29. April in Oberschleißheim gefangen genommen worden waren. </p>
30. 4 1919 - Der Kunstprofessor Ernst Berger wird festgenommen
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Kunstprofessor Ernst Berger wird am Nachmittag von Rotarmisten festgenommen, nachdem er über ein Plakat der Räterepublik laut lästerte. Er wird ins Luitpold-Gymnasium gebracht. </p>
30. 4 1919 - Kunstprofessor Ernst Berger drängt sich vor
<p><em><strong>München-Isarvorstadt</strong></em> * Als der 62-jährige Kunstprofessor Ernst Berger im Luitpold-Gymnasium mitbekommt, dass die Bewacher eine Liste erstellen, geht er davon aus, dass diese die freizulassenden Häftlinge enthält. Er bittet um Aufnahme in die Liste. Und der Wunsch wird ihm erfüllt. Doch bei der Liste handelt es sich um die zur Erschießung Ausgewählten. </p>
30. 4 1919 - Eine durch nichts zu rechtfertigende Mordaktion
<p><em><strong>München-Isarvorstadt</strong></em> * Fakt ist, die Mordaktion im Luitpold-Gymnasium ist durch nichts zu rechtfertigen. Fakt ist aber auch, dass sie die einzige ist, die in diesen Tagen von Anhängern der Räterepublik verübt wird. Dennoch ist der <em>„Geiselmord im Luitpold-Gymnasium“</em> bis heute fester Bestandteil jeder Erzählung über die Münchner Räterepublik.</p> <p>Der Begriff <em>„Geiselmord“</em> für die Bluttat im Luitpold-Gymnasium ist irreführend, da es sich bei den Opfern um Gefangene handelt. Die Thule-Leute hatten im Hotel Vier Jahreszeiten eine Widerstandszelle eingerichtet. Dort wurden Ausweise der Räterepublik gefälscht, mit denen Freiwillige München verlassen konnten, um sich den Regierungstruppen anzuschließen. Wer sich aber unter den Bedingungen eines Bürgerkrieges auf derartige Aktivitäten einlässt, muss wissen, dass er mit seinem Leben spielt.</p> <p>In der Geschichtsschreibung herrscht die Auffassung, dass der sogenannte <em>„Geiselmord von München“</em> die Welle der blutigen Racheaktionen bei den Regierungstruppen ausgelöst hat. Eine andere These besagt, dass die routinemäßige Tötung von Zivilisten und die für ihre Hinrichtung angegebenen Gründe schon zuvor zum Repertoire der Regierungstruppen gehörte.</p>
30. 4 1919 - Ernst Toller befürchtet Vergeltungsmaßnahmen der Weißen Truppen
<p><em><strong>München</strong></em> * Als die Nachricht von den Hinrichtungen bei den - inzwischen gemäßigten - Betriebsräten im Hofbräuhaus-Parlament eintrifft, verlässt Ernst Toller umgehend die Versammlung und begibt sich in das Luitpold-Gymnasium.</p> <p>In der nahezu menschenleeren Schule entdeckt Toller noch sechs Inhaftierte, die die Rotarmisten in einem verschlossenen Raum zurückgelassen haben. Die Befreiung der unter Todesangst stehenden Gefangenen wird in dem späteren Prozess gegen den Dramaturgen eine große Bedeutung erlangen.</p> <p>Ernst Toller befürchtet Vergeltungsmaßnahmen der Weißen Truppen und bittet deshalb Professor Ferdinand Sauerbruch, die Getöteten abholen zu lassen. Doch der Mediziner verweigert diese Bitte. </p>
30. 4 1919 - Der Belagerungsring um München wird geschlossen
<p><em><strong>Dachau</strong></em> * Nach heftigen Gefechten bei Dachau gelingt den Regierungstruppen unter Generalleutnant Friedrich von Friedeburg - trotz heftiger Gegenwehr der Roten Armee - der Durchbruch. Damit kann der Belagerungsring um München durch Regierungssoldaten und Freikorps geschlossen werden. </p> <p>Dass Dachau aufgegeben wird, ist für die Kommunisten ein verhängnisvoller Fehler. <em>„Nachdem auch die Nordfront dem Feinde freiwillig geöffnet war, brach auch der Kampfwille der Arbeiter zusammen. Jetzt war der Demoralisation, der Feigheit, dem Verrat, der Panik weit das Tor geöffnet. </em></p> <p><em>Die Massendesertation der Arbeiter setzte ein. Gewehre wurden zerbrochen, in die Isar geworfen, […] der Zusammenbruch war da. […] Die weißen Garden konnten ungehindert nach München einmarschieren.“ </em></p>
30. 4 1919 - Das Ende der Räterepublik in Starnberg
<p><em><strong>Starnberg</strong></em> * Der Starnberger Land-und Seebote feiert das Ende der Räterepublik und titelt: <em>„Starnberg frei von Terror“</em>. </p>
30. 4 1919 - Franz von Stuck wird aus der Kirchenschule entlassen
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Franz von Stuck kann die Kirchenschule unversehrt wieder verlassen, <em>„nachdem ich mit meinen Leidensgefährten aus einem Topf mein ziemlich schmackhaftes Mittagessen (Spartanische Suppe mit Fleisch) erhalten“</em> hatte. </p>
30. 4 1919 - Professor Ferdinand Sauerbruch wird aus der Geiselhaft entlassen
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Professor Sauerbruch kann die Kirchenschule wieder verlassen. Er schreibt in seiner im Jahr 1951 erschienenen Autobiographie <em>„Das war mein Leben“</em>, dass er bereits <em>„Zum Tode verurteilt“</em> war, dann aber auf glückliche Weise gerettet wurde. </p>
30. 4 1919 - Anton Graf Arco auf Valley wird von einer Kommunistin gerettet
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Auch Anton Graf Arco auf Valley erhält völlig unerwartete Hilfe in der Person von Frau Dr. Hildegard Menzi. Diese ist zu diesem Zeitpunkt Mitglied der KPD und die engste Freundin von Rudolf Egelhofer, dem Oberkommandierenden der Roten Armee.</p> <p>Sie sucht Arco in der Kirchenschule auf, um ihn zu versorgen und vereinbart mit Dr. Rudolf Schollenbruch, einem Arzt mit der roten Armbinde, dass Arco und die anderen Geiseln in ein sicheres Versteck gebracht werden. Arco trifft am Abend wieder in der Chirurgischen Klinik ein. </p>
30. 4 1919 - Thomas Mann gegen die Kommunisten
<p><em><strong>München-Bogenhausen</strong></em> * Mit Blick auf führende Kommunisten wie Eugen Leviné notiert Thomas Mann in sein Tagebuch, man solle mit <em>„aller aufbietbaren Energie und standrechtlicher Kürze gegen diesen Menschenschlag vorgehen“</em>. </p>
30. 4 1919 - Seit 7. November 1918 sind 46 Personen bei inneren Unruhen getötet worden
<p><em><strong>München</strong></em> * Vom 7. November 1918 bis zum 30. April 1919 sind in München bei inneren Unruhen 46 Menschen zu Tode gekommen. </p>
30. 4 1919 - 53 russische Kriegsgefangene werden in Pasing festgenommen
<p><em><strong>Pasing - Lochham</strong></em> * Am Pasinger Bahnhof werden 53 ehemalige russische Kriegsgefangene von Regierungstruppen festgenommen.</p> <p>Die Kriegsgefangenen wurden auf Veranlassung des Revolutionären Zentralrats am 11. April aus der Haft entlassen. Sie konnten sich frei bewegen und durften den Freistaat Bayern verlassen. Aufgrund der Unruhen in ihren Heimatländern war ihnen aber die Rückreise nicht möglich. Deshalb schlossen sie sich, wie viele andere Kriegsgefangene auch, freiwillig den Roten Garden in München an.</p> <p>Nach Kämpfen in Fürstenfeldbruck sind sie - unbewaffnet und aus der Roten Armee entlassen - nach München zurückgekehrt, wo in Pasing die Festnahme erfolgte. Sie werden nach Lochham gebracht. </p>
Nach dem 5 1919 - Die Vereinsarbeit des TSV München-Ost auf dem Tiefpunkt angelangt
München-Obergiesing * Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges ist die Vereinsarbeit des TSV München-Ost auf dem Tiefpunkt angelangt. „Als die Kriegs- und Revolutionswirren vorüber waren, zählte man zweihundert Mitglieder und betrauerte 49 gefallene Sportkameraden“, heißt es in einer Vereinschronik.
Außerdem kann der Turnsaal im Schleibinger-Bräu nicht mehr benutzt werden, da dort seit dem Jahr 1917 ein Malzwerk für die Cenovis-Werke eingerichtet worden ist. Damit beginnt erneut eine Wanderschaft durch die Schulturnsäle und die Nebenzimmer großer Münchner Wirtshäuser.
5 1919 - Dr. Fritz Gerlich kämpft gegen den marxistischen Sozialismus
München * Dr. Fritz Gerlich kämpft im Münchner Bürgerrat, im Bayerischen Heimatdienst sowie mit der Wochenzeitschrift Feurjo gegen den marxistischen Sozialismus.
Daneben beschafft er Geldmittel zur Gründung der Bayerischen Einwohnerwehr und für die Überwachung der Kommunistischen Partei. Dieses Engagement trägt zu seinem Ruf als „Marxistentöter“ bei.
1. 5 1919 - Die Gegenrevolution marschiert
München * In aller Frühe kann die Republikanische Schutztruppe das Luitpold-Gymnasium erobern und große Mengen Waffen erbeuten.
Ab dem 1. 5 1919 - Das Marianum ist ein Hauptquartier der Weißen Freikorps-Soldaten
München-Untergiesing * Während der Niederschlagung der Münchner Räterepublik ist das Marianum ein Hauptquartier der Giesing stürmenden Weißen Freikorps-Soldaten.
1. 5 1919 - Das Freikorps Werdenfels fährt mit dem Zug nach München
Garmisch - Bernried * Das aus circa 250 Männern bestehende Freikorps Werdenfels fährt mit dem Zug nach München.
Bei Bernried wird der Zug von einer Schublokomotive angefahren. Drei Verletzte und ein Toter müssen vermeldet werden. Der Unfall führt zum verspäteten Eingreifen des Freikorps Werdenfels in die Kampfhandlungen.
1. 5 1919 - Eine erdrückende Übermacht der Regierungstruppen steht vor München
München * Die aus zahlreichen Freikorps, Reichswehr und einem württembergischen Gruppenkommando bestehenden Weißen Truppen belagern München.
Insgesamt stehen rund 35.000 Regierungssoldaten den etwa 10.000 bis 12.000 Rotarmisten gegenüber.
1. 5 1919 - Bayerns Regierung verhängt den Kriegszustand und das Standrecht
München * Auf Regierungsplakaten wird bekannt gegeben, dass die bayerische Regierung „den Kriegszustand und das Standrecht verhängt“ hat. „Wer den Regierungstruppen mit der Waffe entgegentritt, wird mit dem Tode bestraft“.
1. 5 1919 - Die Betriebs- und Soldatenräte fordern zur waffenlosen Demonstration auf
München * In einem anderen Pakataufruf der Betriebs- und Soldatenräte Münchens wird aufgefordert „waffenlos“ auf einer Maikundgebung auf der Theresienwiese zu demonstrieren. Die Räte „protestieren mit Entrüstung gegen die fluchwürdigen Verbrechen jener Elemente, welche durch ihr Handeln die heilige Sache des Proletariats im Kampf für die Menschlichkeit verraten haben“. Sie fordern auf:
„Soldaten! Laßt Eure Waffen in den Kasernen!
Arbeiter! Laßt Eure Waffen in den Betrieben!
Kommt mit den Frauen und Kindern heraus auf alle großen Plätze und Wiesen!
Ungebeugt wird das Proletariat an diesem Tage seine Räte und den Geist seiner Räterepublik hochhalten.
Es lebe der Rätegedanke!“
1. 5 1919 - Die Betriebs- und Soldatenräte Münchens verabscheuen den Geiselmord
München * In einer in Flugblättern veröffentlichten Erklärung distanzieren sich die Betriebs- und Soldatenräte Münchens von den „bestialischen Handlungen (Erschießung von Geiseln im Gymnasium)“ und erläutern, dass sie „in keiner Weise verantwortlich sind.
Die Betriebs- und Soldatenräte sprechen einstimmig ihren tiefsten Abscheu über solche unmenschliche Taten aus. Sie versprechen, die in der Versammlung am 30. April 1919 anwesenden Führer Toller, Maenner und Klingelhöfer, die nur im Auftrag des Proletariats gehandelt haben, in jeder Weise zu decken“.
1. 5 1919 - Stadtkommandant Max Mehrer tritt zurück
München * Stadtkommandant Max Mehrer verlässt wegen der Geisel-Erschießungen seinen Posten.
1. 5 1919 - Das Freikorps Oberland wird vom Thule-Führer befehligt
<p><em><strong>München</strong></em> * Das Freikorps Oberland wurde vom Thule-Führer Rudolf von Sebottendorf gegründet und wird jetzt auch von ihm angeführt.</p> <p>Der aus diesem Freikorps hervorgehende Bund Oberland wird ab 1921 den Kern der SA in Bayern bilden und wird Teil des Deutschen Kampfbundes sein, der sich im November 1923 am Hitler-Ludendorff-Putsch beteiligt. </p>
1. 5 1919 - Der Geiselmord von München bleibt in der Geschichte tief verwurzelt
München * Auf Plakaten wird behauptet, dass die ermordeten Mitglieder der Thule-Gesellschaft im Luitpold-Gymasium verstümmelt worden sind. Angeblich hat man ihnen die Geschlechtsteile abgeschnitten und in Abfalleimern entsorgt. Es stellt sich zwar heraus, dass es sich bei den Fleischabfällen um Schweinefleisch handelt, doch das interessiert niemanden mehr.
Der sogenannte Geiselmord wird als Beweis für die unmenschliche Grausamkeit der Roten gewertet. Obwohl die Schüsse im Luitpold-Gymnasium die einzige „linke“ Gewalttat während der Revolutionszeit ist, bleibt der Geiselmord von München in der Geschichte tief verwurzelt.
1. 5 1919 - Die Weißen Truppen müssen sich wieder aus der Innenstadt zurückziehen
München * Nach Bekanntwerden der voreiligen und unabgestimmten Kampfmaßnahmen ergeht vom leitenden Offizierskorps ein sofortiger Rückzugsbefehl. Einige Befehlshaber ignorieren diesen Befehl jedoch. Dass es einigen relativ kleinen Einheiten gelingt, ohne größere Verluste bis in den Stadtkern vorzudringen, ist nur der Beweis für das Nichtvorhandensein einer schlagkräftigen Gegenwehr.
Bis zum Abend müssen sich die regierungstreuen Weißen Truppen dennoch wieder aus der Innenstadt zurückziehen oder sie verschanzen sich in der Residenz. Auch den Hauptbahnhof müssen sie wieder an die Rote Armee und die Arbeiterwehr übergeben.
Bei den Angehörigen der Roten Armee und der Arbeiterwehr entsteht andererseits der Eindruck, dass die Weißen durchaus besiegbar sind. Sie wissen freilich nicht, dass sie nur gegen einige befehlswidrig vorgerückte Einzelgruppen gekämpft haben und ihnen nicht die eigentliche Streitmacht gegenübersteht.
1. 5 1919 - Es kommt in der Innenstadt zu Kämpfen und Verwüstungen
München * Obwohl der Einmarsch der Weißen Truppen in München erst für den nächsten Tag, pünktlich zur Mittagsstunde vorgesehen ist, kommt es bereits am 1. Mai in der Innenstadt zu Schießereien, Kämpfen und Verwüstungen. Wie, wann und wo sich die kriegsähnlichen Auseinandersetzungen entzünden, lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen. Die Regierungstruppen werden auf ihrem Weg in den Stadtkern jedenfalls nicht von den Roten angegriffen oder aufgehalten.
Hinterher wird gerne behauptet, die Freikorpstruppen hätten sich aufgrund der durchsickernden Informationen über den Geiselmord nicht mehr zurückhalten lassen und wären auf eigene Faust losgestürmt. Doch das ist nur eine nachträgliche Entschuldigung für eine nicht zu entschuldigende Disziplinlosigkeit auf Seiten der Weißen Truppen.
1. 5 1919 - Rudolf Egelhofer wird aufgegriffen und verhaftet
München-Lehel * Der Oberbefehlshaber der Roten Armee, Rudolf Egelhofer, wird um die Mittagszeit in der Wohnung der Ärztin Dr. Hildegard Menzi in der Maximilianstraße 22, wo er zur Untermiete wohnt, aufgegriffen und verhaftet.
Er wird zum Verhör in Kriegsministerium an der Ludwigstraße gebracht und brutal misshandelt. Anschließend wird er zur Residenz transportiert und im Keller des Kolonadenhofes eingesperrt.
1. 5 1919 - Hedwig Kämpfer wird verhaftet
München * Hedwig Kämpfer wird verhaftet, weil sie sich am Revolutionsgeschehen beteiligt hatte.
1. 5 1919 - Egelhofers Befehl zum Niederlegen der Waffen
München * Der Oberkommandierende der Roten Armee, Rudolf Egelhofer, befiehlt in einem Tagesbefehl unter der Parole „Trotzki“ die Waffen niederzulegen.
1. 5 1919 - Die Residenz wird kampflos geräumt
München-Graggenau * In der Nacht zum 1. Mai wird die Residenz von der „roten Besatzung“ kampflos geräumt.
1. 5 1919 - Legitimation zur Rücksichtslosigkeit
München * Der sogenannte Geiselmord im Luitpold-Gymnasium liefert den Regierungstruppen und Freikorps genügend Legitimation, keinerlei Rücksichten zu nehmen und barbarisch zu wüten. Die Weißen Truppen werden eine nicht zu übersehende Blutspur hinterlassen.
1. 5 1919 - Das Leibregiment erobert den Ostteil der Türkenkaserne
München-Maxvorstadt * Bis 9 Uhr erobern und übernehmen rund 200 Mann des Leibregiments den Ostflügel der Türkenkaserne.
1. 5 1919 - Das Freikorps Lützow erobert die Kirchenschule
München-Haidhausen * Erste Abteilungen der Regierungstruppen dringen in Richtung östliche Vorstädte vor und erobern die Gasfabrik am Kirchstein in Steinhausen.
Um 9:30 Uhr stürmen Angehörige des Freikorps Lützow - von Berg am Laim aus kommend - die von der Roten Armee besetzte Kirchenschule in Haidhausen, verteilen die erbeuteten Waffen an unbewaffnete Bürger und sympathisierende Anwohner.
Später dringen sie bis zur Neuhauser Straße vor, müssen sich aber kurz darauf wieder zurückziehen.
1. 5 1919 - Geschütze vor und hinter dem Friedensengel
München-Bogenhausen * Am heutigen Europaplatz beim Friedensengel werden zwei 15-Zentimeter-Geschütze aufgebaut, direkt am Denkmal Maschinengewehre in Richtung Prinzregentenstraße aufgestellt. Ihr Ziel sind Stellungen der Roten Armee an der Theresienwiese.
Die Rotgardisten schießen aus den Häusern an der Wiedenmayerstraße.
1. 5 1919 - Vollkommene Säuberung und Sicherung der Vorstädte
München * Major a.D. Karl Deuringer: „Über den wahren Gewinn einer Großstadt entscheidet im Bürgerkrieg nicht der Besitz des Stadtkerns, sondern die vollkommene Säuberung und Sicherung der Vorstädte“.
1. 5 1919 - Dr. Hildegard Menzi wird verhaftet
München-Lehel * Am Vormittag wird Dr. Hildegard Menzi auf dem Weg in ihre Wohnung in der Maximilianstraße 22 von bewaffneten Zivilisten verhaftet und in die Kommandantur in der Residenz gebracht.
Die Ärztin, die noch am Tag zuvor Anton Graf Arco auf Valley medizinisch versorgt hat, wird von der Münchner Stadtkommandantur als „geistiger Führer des Egelhofer“ eingeschätzt. Rudolf Egelhofer, der 23-jährige Oberbefehlshaber der Roten Armee, hat demzufolge „nur nach den Direktiven der Frau Menzi gehandelt“.
1. 5 1919 - Am Rathaus und an der Residenz die weiß-blaue Fahne gehisst
München-Graggenau * Kurz vor Mittag wird auf dem Rathaus und auf der Residenz die weiß-blaue Fahne gehisst.
1. 5 1919 - Eine Kompanie der „Abteilung Scharff“ marschiert in Richtung Innenstadt
München-Haidhausen * Um 12:45 Uhr marschiert eine Kompanie der „Abteilung Scharff“ zum Maximilianeum und von dort durch die Maximilianstraße weiter in Richtung Innenstadt.
Die „Abteilung Scharff“ wird sich am Abend wieder zurückziehen und in den Gasteig-Anlagen biwakieren.
1. 5 1919 - In Rosenheim beginnt die Rückeroberung durch Freikorps
Rosenheim * In Rosenheim beginnt die Rückeroberung der oberbayerischen Stadt durch Freikorps.
1. 5 1919 - Lenin rühmt den Kampf der Genossen im Freistaat Bayern
Moskau * Der russische Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin rühmt auf der Maiparade auch den Kampf der Genossen im Freistaat Bayern.
„In allen Ländern haben die Arbeiter den Weg des Kampfes mit dem Imperialismus betreten. Die Arbeiterklasse, die sich befreit hat, feiert ihren Tag nicht nur in Sowjetrussland frei und offen, sondern auch in Sowjetungarn und Sowjetbayern“.
1. 5 1919 - Pasing wird kampflos von den Regierungstruppen eingenommen
Pasing * Um 15 Uhr wird Pasing kampflos von den Regierungstruppen eingenommen.
1. 5 1919 - Thomas Mann und der Geiselmord im Luitpold-Gymnasium
München-Bogenhausen * Thomas Mann wird von seiner Schwiegermutter am Vormittag von den Geiselmorden im Luitpold-Gymnasium informiert. Er schreibt in sein Tagebuch:
„In der Nacht sind die im Luitpold-Gymnasium internierten bürgerlichen und adeligen Geiseln, man kennt ihre Namen nicht, es sollen zehn sein, unter Verstümmelungen ermordet worden“.
1. 5 1919 - Regierungstruppen besetzen das Maximilianeum
München-Haidhausen * Regierungstruppen besetzen das Maximilianeum. In zwei Studentenzimmern werden Maschinengewehre aufgestellt, ein Waffenlager mit weiteren acht MGs und achthundert Gewehren angelegt und im Keller Pferdestallungen eingerichtet, um von hier aus München zu „befreien“.
1. 5 1919 - Hauptbahnhof vorübergehend von bürgerlichen Kampftruppe erobert
München-Maxvorstadt * Eine bürgerliche Kampftruppe erobert vorübergehend den von den Roten besetzten Hauptbahnhof.
1. 5 1919 - Das schwerverwundete Brunnenbuberl
München * Bei den Kämpfen am Karlsplatz erhält das Brunnenbuberl der Brunnengruppe Satyrherme und Knabe des Bildhauers Matthias Gasteiger, das sich in der Nähe des Toilettenhäuschens in der Stachus-Grünanlage befindet, zwei Einschüsse.
Die dazu veröffentlichte Postkarte trägt die Mitleid erweckende Beschriftung: „Unser schwerverwundetes Buberl“.
1. 5 1919 - Erbitterte Kämpfe in Obergiesing
München-Giesing * Als die Weißen Truppen auf der Tegernseer-Landstraße gegen die rote Hochburg Giesing vorrücken, postiert die Rote Armee auf dem für sie strategisch günstig gelegenen, 95 Meter hohen Kirchturm der neugotischen Heilig-Kreuz-Kirche ihre Maschinengewehre.
Am Giesinger Berg werden die Regierungssoldaten mit MG-Feuer und Handgranaten empfangen. Es folgen erbitterte Straßenschlachten, besonders an der Martin-Luther- und Ichostraße. Eine spezielle Kampfart der Giesinger Roten Armee, durch das Kanalisationssystem hinter die Linien der Feinde zu gelangen, dort aus den Kanaldeckeln herauszuschießen und sofort wieder zu verschwinden, führt dazu, dass es trotz der Überlegenheit der Weißen und des Einsatzes eines Panzerzuges bei der Pilgersheimer Eisenbahnbrücke Tage dauert, bis der Widerstand gebrochen ist.
In den Augen der Konterrevolutionäre die „Schmach von Giesing“.
1. 5 1919 - Bürgerliche Kampfverbände werden gebildet
München * Bürgerliche Kampfverbände, bestehend aus bewaffneten Bürgern, Studenten, ehemaligen Soldaten und Polizisten sowie zahlreichen Freiwilligen, sammeln sich vor der Feldherrnhalle und besetzen schließlich die geräumte Residenz.
Oskar Maria Graf schreibt über die sich nun, unter dem Schutz der militärischen Übermacht wieder zeigende und sich an der „Treibjagd auf verdächtige Zivilisten“ beteiligende Bürgerwehr:
„Jetzt waren auf einmal wieder die verkrochenen Bürger da und liefen emsig mit umgehängten Gewehr und weißblauer Bürgerwehr-Armbinde hinter den Truppen her. Wahrhaft gierig suchten sie mit den Augen herum […], rannten einen Menschen nach, schlugen plärrend auf ihn ein, spuckten, stießen wie wildgeworden und schleppten den Halbtotgeprügelten zu den Soldaten.“
1. 5 1919 - Kämpfe: Der Stachus-Kiosk brennt lichterloh
München * Am Nachmittag dringen eigenmächtig operierende Freikorps von der Residenz aus bis zum Lenbachplatz vor. Die Marine-Brigade Ehrhardt erreicht - von Schleißheim kommend - gegen Mittag Schwabing und beteiligt sich später an den Kämpfen am Stachus. Auch aus Regensburg stammende Soldaten sowie Angehörige des Freikorps Grafing und die Batterie Zenetti sind an diesen Kämpfen beteiligt. Dort entfacht sich ein mehrstündiges Gefecht.
Die Rotarmisten leisten erbitterten Widerstand und verteidigen den Stachus mit Gewehrfeuer. Ein Zeitzeugenbericht schildert die weiteren Ereignisse:
„Mittlerweile hatten die Regierungstruppen bei der Anlage an der Deutschen Bank ein Geschütz in Stellung gebracht und eine Brandbombe in den Kiosk gesetzt, der bald lichterloh aufflammte und die Roten Gardisten zwang, ihren verzweifelten Widerstand aufzugeben und sich gegen die protestantische Kirche und das Kaufhaus Horn zurückzuziehen. Bald war der Karlsplatz zum wütendsten Kampfplatz geworden. […]
Gegen Abend bekamen die Regierungstruppen Verstärkungen von der Herzog-Wilhelm-Straße und dem Sendlingertor-Platz her. Die Rotgardisten wurden über den Karlsplatz in den Justizpalast und gegen die Elisenstraße geworfen, von wo aus sie heftigen Widerstand leisteten.
Das an der Deutschen Bank postiert gewesene Geschütz wurde infolgedessen bis zum Wittelsbacher-Brunnen zurückgezogen und beschoss in den Nachmittagsstunden den Justizpalast, der an der gegen den Stachus gerichteten Seite zwei Treffer im dritten Stock erhielt. […] Viele Spartakisten flüchteten in den Mathäser“.
Doch es gibt auch Gegenwehr von anderer Seite, die die Weißen Truppen letztlich zum Abziehen zwingen. Dazu zählen auch die Teilnehmer der Maikundgebung auf der Theresienwiese, die dort „waffenlos demonstriert“ haben und sich nun auf dem Nachhauseweg befinden.
1. 5 1919 - Mit Fahrerpeitschen bearbeitet
München * In Manfred von Killingers Buch „Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben“ rühmt er seinen verächtlichen Umgang mit den Roten und besonders mit linken Frauen:
„Ein Weibsbild wird mir vorgeführt. Das typische Schwabinger Malweibchen. Kurzes, strähniges Haar, verlotterter Anzug, freches, sinnliches Gesicht, wüste Augenringe.
‚Was ist mit der los?‘
Da geifert sie los: ‚Ich bin Bolschewikin! Ihr feige Bande, Fürstenknechte, Speichellecker! Anspucken sollte man euch! Hoch Moskau!‘ und dabei spuckt sie einen Unteroffizier ins Gesicht.
‚Fahrerpeitsche! Dann laufen lassen‘, sagte ich kurz.
Zwei Mann packen sie. Sie will beißen. Eine Maulschelle bringt sie zur Räson. Im Hof wird sie über die Wagendeichsel gelegt und so lange mit Fahrerpeitschen bearbeitet, bis kein weißer Fleck mehr auf ihrer Rückseite war.
‚Die spuckt keinen Brigadier mehr an. Jetzt wird sie erst mal drei Wochen auf dem Bauche liegen‘, sagt Feldwebel Herrmann“.
1. 5 1919 - Ein russischer Kriegsgefangener wird in Lochham erschossen
Lochham * In der Nacht zum 1. Mai wird einer der 53 gefangen genommenen russischen Kriegsgefangenen in Lochham erschossen.
2. 5 1919 - Das Freikorps Werdenfels beteiligt sich an den Säuberungsmaßnahmen
München-Großhesselohe * Das Freikorps Werdenfels wird um 10 Uhr in Großhesselohe ausgeladen. Um 12 Uhr marschiert die Kompanie Garmisch zum Isarthalbahnhof in Thalkirchen, um dann im „Krüppelheim“ [= Orthopädische Klinik] in Obergiesing zu verbleiben. Dort wird das Freikorps Werdenfels dem Bayerischen Schützenkorps unter Führung von Oberst Franz Xaver Ritter von Epp als Reserve zugeteilt.
Die Kompanie Partenkirchen vereinigt sich mit dem Korps Schwaben und begibt sich zur Humboldtstraße, wo es zu Kampfhandlungen kommt. Leider geben uns weder der Gefechtsbericht noch der Erlebnisbericht eines Ettaler Schülers genauen Bericht davon.
Jedenfalls beteiligt sich das Freikorps Werdenfels bis zum 6. Mai an den „Säuberungsmaßnahmen“ in Harlaching und Giesing, die als „Hochburg kommunistischer Verseuchung und Verhetzung“ angesehen werden.
Mehr Informationen über die Giesinger Vorgänge liefern Berichte des Freikorps Schwaben.
2. 5 1919 - Gustav Landauer wird im Gefängnis Stadelheim ermordet
München-Obergiesing * Gustav Landauer wird ins Gefängnis Stadelheim gebracht, wo er von Freikorpssoldaten in grausamster Weise misshandelt und schließlich ermordet wird. Ein Zeuge berichtet:
„Am 2. Mai stand ich als Wache vor dem großen Tor zum Stadelheimer Gefängnis. Gegen 1¼ Uhr brachte ein Trupp bayerischer und württembergischer Soldaten Gustav Landauer. Auf dem Gang vor dem Aufnahmezimmer versetzte ein Offizier dem Gefangenen einen Schlag ins Gesicht. Die Soldaten riefen dazwischen: ‚Der Hetzer, der muss weg. D‘erschlagts ihn!‘.
Landauer wurde dann mit Gewehrkolben an der Küche vorbei in den ersten Hof rechts hinaus gestoßen. Im Hof begegnete der Gruppe ein Major in Zivil, der mit einer schlegelartigen Keule auf Landauer einschlug. Unter Kolbenschlägen und den Schlägen des Majors sank Landauer zusammen. Er stand zwar wieder auf und wollte zu reden anfangen. Da rief ein Vizewachmeister: ‚Geht mal weg!‘. Unter Lachen und freudiger Zustimmung der Begleitmannschaften gab der Vizewachmeister zwei Schüsse ab, von denen einer Landauer in den Kopf traf. Landauer atmete immer noch.
Da sagte der Vizewachmeister: ‚Das Aas hat zwei Leben, der kann nicht kaputtgehen!‘. Da Landauer immer noch lebte, legte man ihn auf den Bauch. Unter dem Ruf: ‚Geht zurück, dann lassen wir ihm noch eine durch!‘, schoss der Vizewachmeister Landauer in den Rücken, dass es ihm das Herz heraus riss und er vom Boden schellte. Da Landauer immer noch zuckte, trat ihn der Vizewachmeister zu Tode. Dann wurde ihm alles heruntergerissen und seine Leiche zwei Tage lang ins Waschhaus geworfen“.
2. 5 1919 - Erst an diesem Mittag sollte der Einmarsch nach München beginnen
München * Eigentlich war der Einmarsch in München eindeutig für Freitag, 2. Mai, um 12:00 Uhr, festgesetzt worden.
2. 5 1919 - 52 ehemaligen russischen Kriegsgefangene werden erschossen
Gräfelfing * Die 52 russischen Kriegsgefangenen aus dem Lager Puchheim werden in der Volksschule Gräfelfing vor ein selbsternanntes Feldgericht gestellt - ohne Berufsrichter. Die Angeklagten haben zudem keine Möglichkeit sich zu verteidigen.
Bei Tagesanbruch werden sie in einer Kiesgrube in Gräfelfing erschossen. Man wirft ihnen vor, auf Seiten der Räterepublik und der Roten Armee gekämpft zu haben.
2. 5 1919 - Der Mathäserbräu wird in Brand geschossen
München-Ludwigsvorstadt * In den Vormittagsstunden wird der Mathäser von schweren Minen getroffen. Feuer bricht aus, weshalb die Rotarmisten das Gebäude verlassen müssen.
2. 5 1919 - München wird von den Regierungstruppen eingenommen
München * München wird nach harten Kämpfen gegen die sich erbittert verteidigenden Roten von den Regierungstruppen genommen. Bis zum Abend ist die Rote Armee geschlagen und die Stadtviertel von den Regierungstruppen militärisch besetzt. Die Militärs bereiten sich nun auf die bevorstehende „Säuberung und Befriedung“ vor.
Für Giesing liest sich das dann so: „Da brechen sie in Häuser, durchsuchen die Wohnungen, die Keller, die Böden. Reihenweise schleift man die roten Schützen auf die Straße - stellt sie an die Wand. Und dumpf bricht sich das Krachen der Erschießungssalven an den Mauern“.
Die Wirklichkeit ist oft noch viel grausamer. Nach dem Sieg über die Rote Armee durchkämmen die Weißen fast alle Häuser Haidhausens, der Au und Giesings. Über 5.000 Münchner, die irgendwie verdächtig erscheinen, werden verhaftet. Über eintausend, darunter viele unschuldige, oftmals denunzierte Menschen, müssen sterben.
Die letzten Einheiten der Roten Armee werden am 4. Mai in der Umgebung von München zerschlagen. Vereinzelte Feuergefechte in der Stadt dauern noch bis zum 22. Mai an.
2. 5 1919 - 92 Spartakisten und Rotarmisten werden erschossen
München-Stadelheim * 92 Spartakisten und Rotarmisten werden alleine an diesem Tag in Stadelheim standrechtlich erschossen.
2. 5 1919 - Gustav Landauer wird in Großhadern festgenommen
Großhadern * Gustav Landauer wird in der Villa von Kurt Eisner und Else Belli in Großhadern festgenommen.
2. 5 1919 - Der Generalstreik im Ruhrgebiet ist beendet
Ruhrgebiet * Die Kohleförderung im Ruhrgebiet läuft wieder in seinen gewohnten Bahnen. Der Generalstreik ist beendet.
2. 5 1919 - Erich Mühsam zur Ermordung von Gustav Landauer
Ebrach * Erich Mühsam, der beim Palmsonntagsputsch von den Republikanischen Schutztruppen verhaftet und ins Zuchthaus Ebrach gebracht worden war, notiert:
„Landauer tot. Ich will und kann es nicht für möglich halten und muss es doch glauben […].
Niemand weiß, welch ein Geist hier zerstört ward“.
2. 5 1919 - 103 Münchner Zivilisten müssen ihr Leben lassen
München * Alleine an diesem Tag kommen in München 103 Zivilisten ums Leben.
2. 5 1919 - Frühmorgentliche Gefechte in Haidhausen
München-Haidhausen * Um 8 Uhr früh kommt es Johannisplatz und am Straßenbahn-Depot an der Einstein-/Seeriederstraße zu Gefechten.
2. 5 1919 - Bad Aibling wird von den Regierungstruppen besetzt
Bad Aibling * Bad Aibling wird kampflos von den Regierungstruppen besetzt.
2. 5 1919 - Die Weißen Truppen ziehen in die Stadt ein
München * Das Gros der Weißen Truppen zieht in die Stadt ein. In einigen Stadtteilen kommt es noch zu Einzelkämpfen. Am Abend ist die Stadt in der Hand der Regierungstruppen. Verbliebene Widerstandsnester werden in den folgenden Tagen ausgehoben.
2. 5 1919 - Die Kämpfe am Karlsplatz sind beendet
München * Die Kämpfe am Karlsplatz sind beendet. Provisorische Barrikaden, mit Bierfässern und Wägen errichtet, bieten den Rotarmisten keinen Schutz gegen die mit Panzerwagen anrückenden Regierungsstreitkräfte.
2. 5 1919 - Flugblätter bereiten auf die kommenden Ereignisse vor
München * Um 11:40 Uhr werden aus Flugzeugen Flugblätter der Regierung Hoffmann abgeworfen, die die Bevölkerung auf die kommenden Ereignisse vorbereiten sollen.
2. 5 1919 - Ein von den Roten abgeschossenes Flugzeug
München-Theresienwiese * Ein von Rotarmisten beschossenes Flugzeug der Regierungstruppen stürzt auf die Theresienwiese.
2. 5 1919 - Heftige Kämpfe um den Hauptbahnhof
München-Maxvorstadt * Auch um den Hauptbahnhof wird heftig gekämpft. Es dauert bis zum Nachmittag, bis es den Regierungstruppen glückt, von zwei Panzerzügen gedeckt, bis zum Bahngebäude vorzurücken.
Bei der Verteidigung des Hauptbahnhofs kommen viele Rotgardisten, aber auch viele Zivilisten ums Leben. Die Weißen nehmen keine Rücksicht, weder auf Alte noch auf Frauen und Kinder.
2. 5 1919 - Kampfhandlungen rund um das Maximilianeum
München-Haidhausen * Im Rahmen der Kampfhandlungen zwischen den Weißen Truppen und der Roten Armee kommt es auch zu Kampfhandlungen rund um das Maximilianeum.
Ein von den Spartakisten vorgenommener Beschuss führt zu einem Volltreffer im oberen Rundbogen des Nordturms. So jedenfalls schreibt es Vorstand von Riezler an den Verwaltungsausschuss.
2. 5 1919 - Die Maschinengewehrfabrik Sedlbauer in Obergiesing wird beschossen
München-Giesing * Giesinger Rotarmisten verschanzen sich in der Maschinengewehrfabrik Sedlbauer in Obergiesing und versuchen, den vom Osten anrückenden Truppen - darunter das Bayerische Schützenkorps - Widerstand entgegenzusetzen.
Sie werden durch intensivem Artilleriebeschuss aus dem während des Weltkriegs errichteten Betonbau vertrieben.
2. 5 1919 - Ein Siegerbericht über die Giesinger Kämpfe
München-Giesing * In dem im Jahr 1934 erschienenen tendenziösen Machwerk „Rotmord über München“ werden die Kämpfe in Giesing aus der Sicht der Sieger geschildert. Dort heißt es:
„Am furchtbarsten raste der Kampf im roten Giesing, wo das Korps Epp am 2. Mai eingerückt ist. Da kracht es aus den Fenstern, aus den Dachluken und aus den Kellerlöchern. Da hämmert es von der Mariahilfkirche [es muss sich dabei allerdings um die Giesinger Heilig-Kreuz-Kirche handeln] das MG. Da tun Frauen Winkerdienste für die roten Schützen, da schießt man mit mit zerfleischenden Dum-Dum auf deutsche Brüder, da muss Artillerie eingesetzt werden gegen einzelne feuer- und todspeiende Dächer, und ihre Einschläge fallen in den Giesinger Kirchturm und in das Pfarrhaus. […]
Rechts und links an die Häuserwände gedrückt arbeiten sich die Soldaten vor. ‚Straße frei - Fenster zu!‘ und wenn sie an manch stillen Stellen vorbei sind, oder auch an Stellen, wo man sie mit dem Ruf: ‚Hoch Epp!‘ empfangen hat, dann schiebt sich leise aus dem Keller das tückische Gewehr und streckt hinterrücks einen Kameraden nieder“.
2. 5 1919 - Kinder werden ausgehorcht
München * Zum Aushorchen bedienen sich die Söldner sogar der Kinder.
„Dann sind sie reingekommen und es hieß: ‚Alles rauf, Kinder und Frauen auf die Seite, Männer da rüber, Kinder in die Mitte‘. Dann haben sie die Kinder gefragt: ‚So, wer gehört da nicht zum Haus?“, Tja, Kinder verstehen halt nicht, wissen‘s halt nicht, sagten, der und der ...‘, zeigten auf die, die im Haus Zuflucht gesucht hatten. Die wurden dann mit Hosenträgern gefesselt, ins Lastauto geschafft. Die sind dann erschossen worden in Stadelheim an der Wand“.
2. 5 1919 - Befreiungshelden als Frauenmörder
München-Giesing * Auch Frauen gehören zu den Opfern der Befreier. Oskar Maria Graf: „Gell, Weiber hast unter den Toten nicht gesehen? Nein, die hat man weggeräumt, dass es nicht so feig aussieht“, sagte er.
„Frauenmörder“ haben keinen Platz im Bild der „Befreiungshelden“, und die Gegenpropaganda lässt auch von den politisch aktiven Frauen, die überleben, nur ein Zerrbild. Sie sind „Flintenweiber“ und „Kommunisten-Huren“, in jedem Fall aber vogelfrei.
2. 5 1919 - Eine Denunziationswelle setzt ein
München * Eine Denunziationswelle setzt ein. Das für politische Straftaten zuständige Stand- und Volksgericht am Mariahilfplatz hat Hochkonjunktur. Da wird so manche offene Rechnung beglichen.
Beispiel: Der Straßenbahnschaffner Alois Bosch gerät mit seinem Nachbarn in Streit. Daraufhin geht dieser zur Polizei und behauptet, Bosch hätte am 2. Mai auf heranrückende Truppen geschossen. Obwohl er seine Aussage später widerruft, wird der Straßenbahner wegen Mitgliedschaft in der Roten Armee zu zwei Wochen Haft verurteilt. Wegen dieser Vorstrafe wird Bosch von seinem Arbeitgeber, der Stadt München, entlassen.
2. 5 1919 - Im Polizeipräsidium beginnen die Aufräumarbeiten
München-Kreuzviertel * Im Polizeipräsidium an der Ettstraße beginnen die Aufräumarbeiten. Es dauert Wochen, bis die 800.000 zum Teil verbrannten Akten von den Beamten auf verwendbare Schriftstücke hin sortiert sind.
2. 5 1919 - Thomas Mann ängstigt sich
München-Bogenhausen * Thomas Mann macht sich Sorgen um den Ausgang der Kämpfe. Seinem Tagebuch vertraut er an.
„War nachmittags recht erregt und besorgt. Das Telefon funktionierte vorübergehend nicht. Die Kanonade und das Maschinengetack war heftig und unaufhörlich. Ich fürchtete für den Ausgang der Sache.
Schließlich ist, wie die Dinge liegen, der definitive Sieg der Truppen eine persönliche Lebensnotwendigkeit geworden; der gegenteilige Ausgang wäre eine undenkbare Katastrophe“.
2. 5 1919 - Krieg ist Gewalt, Bürgerkrieg ist Gewalt in höchster Potenz!
München * Noch ein Beispiel aus Manfred von Killingers Buch „Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben“, in der er in verachtlicher Art und Weise seine Sicht auf die Niederschlagung der Räterepublikaner preis gibt:
„Plötzlich höre ich einen Mordskrach vor der [Elisabeth-] Schule. Ein großer, starker Kerl schimpft mit den gröbsten Tönen auf einen Unteroffizier von mir los. Der bleibt die Ruhe selbst. Da schlängelt sich eine Frau an mich heran. ‚Aufpassen! Ein Bolschewik. Man will die Bevölkerung gegen die Truppen aufhetzen‘. Aha, die Brüder kennen wir.
Ich winke Obermaat Zimmermann. ‚Machen Sie eine Handgranate fertig. Ich werde dem Kerl das Maul verbieten. Hört er nicht augenblicklich auf, dann eins rin in die Kiemen‘.
Ich fasse den Kerl beim Knopfloch und sage: ‚Gehen Sie augenblicklich Ihrer Wege, noch einen Ton und ich verspreche Ihnen, dass Sie in den nächsten vierzehn Tagen keinen Ton mehr sprechen‘.
‚Hoho! Da wollen wir doch mal sehen, wer was zu reden hat!‘ brüllt er.
Krach, da saust ihm die Handgranate in die linke Kiemenseite. Wie vom Blitz getroffen bricht er zusammen. Er erhebt sich, stolpert, fällt wieder. Blut läuft ihm aus Mund und Nase. Er erhebt sich wieder, will was sagen, aber es geht nicht mehr. Er gurgelt etwas und torkelt von dannen.
‚Guten Morgen, mein Herr, wir pflegen unsere Versprechen einzulösen‘“.
Killing begründet seine menschenverachtende und gewalttätige Einstellung so: „Krieg ist Gewalt, Bürgerkrieg ist Gewalt in höchster Potenz. Mäßigung ist Dummheit, nein, sie ist Verbrechen am eigenen Volk und Staat“.
3. 5 1919 - Rudolf Egelhofer wird ohne Gerichtsverhandlung erschossen
München-Graggenau * Der im Keller der Residenz inhaftierte Rudolf Egelhofer wird in aller Frühe zum Verhör geholt. Wenig später wird er mit einem Kopfschuss getötet. Da der Exekution keine Gerichtsverhandlung vorausgeht, handelt es sich bei der Erschießung Rudolf Egelhofers um vorsätzlichen Mord.
Ernst Toller schreibt später in seinen Erinnerungen: „Egelhofers Gegner nannten ihn einen Bluthund, in Wahrheit war er ein sensibler Mensch, den erst das Erlebnis der Kieler Matrosenaufstände hart und mitleidlos gemacht hat“.
3. 5 1919 - Jetzt beginnt „die Reinigung von dem roten Gesindel“
München * Jetzt beginnt „die Reinigung von dem roten Gesindel“, wie es eine Zeitung formuliert. Nicht Befreiung, sondern Terror einer grausamen Soldateska müssen die Münchner in den nächsten Tagen erleben. Willkürliche Erschießungen, furchtbare Folterungen und Morde werden begangen.
Oskar Maria Graf schreibt: „Überall zogen lange Reihen verhafteter, zerschundener, blutig geschlagener Arbeiter mit hochgehaltenen Armen. Seitlich, hinten und vorne marschierten Soldaten, brüllten, wenn ein erlahmter Arm niedersinken wollte, stießen mit Gewehrkolben in die Rippen, schlugen mit Fäusten auf die Zitternden ein. [...]
Das sind alle meine Brüder, dachte ich zerknirscht. [...]
Sie sind alle Hunde gewesen wie ich, haben ihr Leben lang kuschen und sich ducken müssen, und jetzt, weil sie beißen wollten, schlägt man sie tot. [...]
Tage hindurch hörte man nichts mehr als Verhaftungen und Erschießungen. [...]
Die Räterepublik war zu Ende. Die Revolution war besiegt. Das Standgericht arbeitete emsig“.
3. 5 1919 - Noch vereinzelte Schießereien
München-Haidhausen * Es kommt noch zu vereinzelten Schießereien. An der Ecke Rosenheimer-/Steinstraße in Haidhausen werden Regierungstruppen angegriffen, die Gefangene mit sich führen.
3. 5 1919 - Die Lebensmittelversorgung Münchens ist sichergestellt
Bamberg * Die Regierung Hoffmann teilt mit, dass die Lebensmittelversorgung Münchens sichergestellt ist.
3. 5 1919 - Bildung der Volkswehr und von Freiwilligenkorps zugelassen
Bamberg * Das Ministerium für militärische Angelegenheiten lässt die Bildung der Volkswehr und von Freiwilligenkorps zu.
3. 5 1919 - Die Hochschulen und bleiben bis auf weiteres geschlossen
München * Die Hochschulen und die Universität bleiben bis auf weiteres geschlossen.
3. 5 1919 - Die Münchner Tageszeitungen erscheinen wieder
München * Nach fast dreiwöchiger Abstinenz erscheinen in München wieder bürgerliche Tageszeitungen, die in der Räterepublik verboten waren.
3. 5 1919 - Es herrscht Freude in der Stadt
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten feiern die Regierungstruppen als Befreier mit der Überschrift „Es herrschte Freude in der Stadt“.
3. 5 1919 - Die MNN verstärkt die Gerüchte zum Geiselmord
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten verbreiten und verstärken unter der Überschrift „Die bestialische Ermordung der Geiseln“ die eh schon kursierenden Gerüchte.
3. 5 1919 - Der Eisendreher Johann Lehner wird im Schlachthof erschossen
München * Der 18-jährige, an den revolutionären Ereignissen unbeteiligte Eisendreher Johann Lehner wird in einem Bierlokal verhaftet. Auf bloßem Verdacht hin, am Geiselmord beteiligt gewesen zu sein, wird er von württembergischen Freikorpssoldaten zusammen geschlagen und kurz darauf im Schlachthof erschossen. Anschließend wird seine Leiche von der Kampftruppe ausgeraubt.
3. 5 1919 - Giesing wird wie ein feindliches Gebiet besetzt
München-Giesing * Die Regierungstruppen besetzen nach erbitterten Straßen- und Häuserkämpfen Giesing wie ein feindliches Gebiet.
3. 5 1919 - Der Ostfriedhof muss die meisten Terror-Opfer aufnehmen
München-Ostfriedhof * Der Ostfriedhof wird die „letzte Heimat“ vieler, die dem Terror von Rechts zum Opfer gefallen sind. Mit 198 Opfern der Gewalttätigkeiten muss der Friedhof in Obergiesing das größte Kontingent an Toten aufnehmen.
3. 5 1919 - Oskar Maria Graf übernimmt die Chronistentätigkeit am Ostfriedhof
München-Ostfriedhof * Oskar Maria Graf übernimmt die Chronistenpflicht und beschreibt, welche Eindrücke er vom Ostfriedhof mitnimmt, wo die Freunde und Angehörigen der Toten sie noch einmal sehen dürfen oder sie identifizieren müssen:
„Im Leichenhaus lagen blumenüberdeckt, mit vielen Bändern geziert die gefallenen Regierungssoldaten. Alle gingen vorbei, fast keiner sah hin. […]
Mit diesen Trauernden und Suchenden kam ich in einen langen, kellerdumpfen Schuppen mit Seitenfenstern. Auf dem schmutzigen Pflaster lagen die toten Arbeiter. Hingeschmissen, gerade, schief auf dem Rücken oder auf der Seite. Nur die Füße bildeten eine gerade Linie mit der Wand. Es roch gräßlich nach Blut und Leichen.
Man schlurfte auf den rotgefärbten Sägespänen dahin von Mann zu Mann. Um mich herum flüsterten, weinten, klagten und wimmerten die Leute und beugten sich ab und zu nieder auf die Toten, an die man Paketadressen oder kleine Pappendeckel geheftet hatte. Darauf stand der Name oder eine Nummer. […]
Die meisten Toten waren zerfetzt, der lag im blutigen Hemd da, dem hing aus einer trichterförmigen Halswunde ein Stück Schlagader, dem fehlte der Unterkiefer, diesem die Nase, zwei, drei und mehr Schüsse hatten den ausgelöscht, dort lag einer mit überdecktem Haupt, daneben einer mit halben Kopf mit ausgelaufenen Hirn, nur ein kleines Stück Wand vom Hinterschädel war noch zu sehen. Dem hatte man die Paketadresse an die Zehe gebunden, weil alles an ihm zerrissen war, alles nur Blut.
Das Weinen und Jammern verstärkte sich. Furchtbar sind die Blicke der Suchenden, der Gehetzten! Als ich herauskam, schien mir, als rieche die ganze Stadt nach Leichen“.
3. 5 1919 - Die Truppen der Regierung Hoffmann kommen nicht als Feinde
<p><em><strong>München</strong></em> * Die SPD lässt folgende Erklärung in den Münchner Zeitungen veröffentlichen:</p> <p><em>„Jene wahnwitzige Politik des Terrors und der Gewalt, die München in Gegensatz stellte zum ganzen Land, die den Bürgerkrieg in Bayern entbrennen ließ, hat das schlimme Ende gefunden, das vorauszusehen war. [...] </em></p> <p><em>Die Truppen der sozialistischen Regierung Hoffmann kommen nicht als Feinde der Arbeiterschaft, nicht als ‚Weiße Garde‘, sondern als Schützer der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, ohne die ein Neuaufbau im sozialistischen Sinne nicht möglich ist. Arbeiter, helft den Soldaten bei ihrer schweren Aufgabe!“</em></p>
3. 5 1919 - Die Emotionenn der Regierungssoldaten werden aufgepuscht
München * Bei der Gerichtsverhandlung im Oktober 1919 wegen der Ermordung der 21 Kolpinggesellen erklärt der angeklagte Schütze Jakob Müller, dass ihm und seinen Kameraden von den Vorgesetzten gesagt wurde, die Spartakisten haben am 2. oder 3. Mai in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs eine achtzig Mann starke Patrouille von Regierungssoldaten bis auf vier Mann niedergemetzelt.
Diese Falschinformationen lassen bei den Soldaten freilich den Hass auf die Roten ins Unendliche wachsen.
4. 5 1919 - Josef Sontheimer wird im Franziskaner-Keller hinterrücks ermordet
München-Au * Josef Sontheimer wird von einer Abteilung des aus Thule-Kampfbündlern bestehenden Freikorps Oberland verhaftet und im Franziskaner-Keller hinterrücks ermordet, nachdem man ihm zuvor - scheinheilig - die Möglichkeit zur Flucht gegeben hat. Sontheimer war ein führendes Mitglied der Münchner Arbeiter- und Soldatenräte.
4. 5 1919 - Immer mehr Weiße Truppen rücken in München ein
München * Am Sonntag, dem 4. Mai 1919 herrschte warmes und schönes Frühlingswetter. Immer mehr Weiße Truppen rücken in München ein, darunter Volkswehren aus dem Oberland. Und wieder werden 27 Spartakisten standrechtlich hingerichtet.
4. 5 1919 - Die Herstellung und Verbreitung aller linken Zeitungen wird verboten
München * Die Herstellung und Verbreitung aller „kommunistischen, spartakistischen und bolschewistischen Zeitungen und Zeitschriften“ wird verboten. Gleiches gilt für „Skandal- und Revolverblätter“.
4. 5 1919 - Oberstleutnant Adolf Herrgott wird Stadtkommandant
München * Oberstleutnant Adolf Herrgott wird Stadtkommandant.
4. 5 1919 - Die letzten Einheiten der Roten Armee werden zerschlagen
München-Umland * Die letzten Einheiten der Roten Armee werden vor München zerschlagen.
4. 5 1919 - Sadistische Erschießungen von jungen Frauen in Stadelheim
München-Stadelheim * Die Neue Zeitung vom 3. Juni 1919 berichtet: „Am 4. Mai kamen zwei Autos mit Gefangenen vor Stadelheim an. Drei Männer und zwei Mädchen von ungefähr 18 Jahren wurden heruntergerissen. Die Männer wurden natürlich sofort erschossen. Bezüglich der Mädchen riefen die württembergischen Soldaten: ‚Die Frauen müssen sofort erschossen werden!‘ Stadtpfarrer Wagner und Pfarrer Freudenstein von Giesing […] suchten auf die Soldaten einzuwirken.
Es gelang ihnen jedoch nicht, ebenso wenig drei Offizieren, die immer wieder die Soldaten bestimmten, dass Erschießungen ohne Urteil nicht zulässig seien. Es half alles nichts, selbst Stadtpfarrer Wagner wurde bedroht.
Die Mädchen weinten nicht, sie wurden an die Wand gestellt, und - jetzt kommt das Erbärmlichste - zuerst in die Fußknöchel und Knie geschossen, und erst dann, als sie zusammengebrochen waren, völlig erschossen“.
Die Namen der Mädchen sind bekannt, eine Strafverfolgung des Falles kann jedoch nicht stattfinden, da die Akten auf unerklärliche Weise verloren gingen.
4. 5 1919 - Hier wird aus Spartakisten Blut- und Leberwurst gemacht
München-Stadelheim * Am Tor des Stadelheimer Gefängnisses steht ein Schild mit folgendem Inhalt: „Hier wird aus Spartakisten Blut- und Leberwurst gemacht, hier werden die Roten kostenlos zu Tode befördert.“
4. 5 1919 - Instruktionen zum Mord
München - Perlach * Bei einer geheimen Offiziersbesprechung in München sagt Major Walter Schulz Folgendes: „Meine Herren, wer es jetzt nicht versteht, oder wer es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, hier nur harte Arbeit zu leisten, der soll lieber gehen. Lieber ein paar Unschuldige mehr an die Wand, als nur einen einzigen Schuldigen entgehen zu lassen.
[...] Meine Herren, Sie wissen ja selbst, wie Sie es machen müssen. Sie nehmen, den Betroffenen beiseite, erschießen ihn und geben Fluchtversuch oder tätlichen Angriff an.“
4. 5 1919 - Josef Hofmiller und die Geiselmorde im Luitpold-Gymnasium
München-Haidhausen * Josef Hofmiller schreibt auch zu den Geiselmorden im Luitpold-Gymnasium in der Müllerstraße. Er gibt darin die in der Stadt umlaufenden Gerüchte wieder:
„Zuerst wurden die Geiseln im Keller des Gymnasiums ermordet. Und zwar ganz bestialisch: Man machte Russen betrunken, bis sie vollkommene Tiere geworden waren, und ließ sie dann auf die unglücklichen Geiseln los.“
Um den 4. 5 1919 - Ret Marut gelingt die Flucht
München * Ret Marut [= B. Traven], der Leiter der Zensurbehörde in der Ersten Räterepublik, wird von Studenten, die sich der Weißen Garde angeschlossen haben, erkannt und von Regierungstruppen vor ein Feldgericht gebracht. Dieses besteht aus einem Offizier, der entscheidet, ob der Verhaftete sofort standrechtlich erschossen wird oder nicht. Im Zweifelsfall wird das Todesurteil vollstreckt, weil das sicherer sei.
Noch vor seiner Vernehmung gelingt dem Schriftsteller - mit Unterstützung von zwei Soldaten - die Flucht.
4. 5 1919 - Erschießungen in Haidhausen
München-Haidhausen * Josef Hofmiller berichtet in seinem Tagebuch über Erschießungen, in der er eine Notwehr erkennt, die ihm wegen der Angriffe aus dem Hinterhalt für erforderlich erscheinen: „Heute früh kam das Lieserl von den Hausleuten herauf und erzählte, einer von den Regierungstruppen sei gestern durch die ‚Grube‘ gegangen mit einem Zivilisten, um Haussuchung zu halten, da wäre er vor einem Fenster aus erschossen worden. Man habe dann die Kommunisten, Vater und Sohn, herausgeholt und an die Wand gestellt.
In der äußeren Maximiliansstraße habe man fünf Mann aus einem Haus herausgeholt und erschossen. Auf der Wiese oberhalb der Flurstraße soll man vierzig erschossen haben. Einen habe man aus dem Prinzregententheaterkeller heraufgeholt und gleich auf der Straße erschossen. Immer wieder wurde aus den Häusern auf die Regierungstruppen geschossen, noch mehr auf einzelne.“ l
4. 5 1919 - Kolbermoor ergibt sich widerstandslos
Kolbermoor * Widerstandslos ergibt sich das rote Kolbermoor den Weißen Truppen. In der Gemeinde hängen Plakate, die zur kampflosen Übergabe aufrufen. Waffen und Munition stehen zur Ablieferung bereit.
4. 5 1919 - Das Freikorps Chiemgau marschiert in Bad Aibling ein
Bad Aibling * Die weiße Garde des Freikorps Chiemgau marschiert nach dem Sturz der Räteregierung in Bad Aibling ein.
5. 5 1919 - Die Angehörigen der Garnison München müssen in ihre Kasernen
München * Die Angehörigen der Garnison München haben sich umgehend wieder in ihren Kasernen einzufinden.
5. 5 1919 - Kommandeure übernehmen wieder den Befehl über die Truppe
München * Soldatenräte, die die Kommandogewalt übernommen hatten, sind abgesetzt. Ab sofort übernehmen wieder Kommandeure den Befehl über die Truppe.
5. 5 1919 - Der Schienen-Nahverkehr wird teilweise wieder aufgenommen
München * Der Schienen-Nahverkehr wird vom Hauptbahnhof aus wieder aufgenommen. Der Fernverkehr sowie jeder vom Ostbahnhof ausgehende Verkehr bleibt gesperrt.
5. 5 1919 - Fernsprech- und Telegrafenverkehr nur für Presse und Behörden
München * Der Fernsprech- und Telegrafenverkehr in andere Ortsnetze ist vorläufig nur den Behörden und der Presse erlaubt. Berlin ist nicht erreichbar.
5. 5 1919 - Urteile der Revolutionstribunale sind null und nichtig
München * Das Justizministerium erklärt, dass Urteile der Revolutionstribunale null und nichtig sind und Strafen nicht vollstreckt werden.
5. 5 1919 - Von der Räteregierung ausgegebenes Papiergeld als „ungültig“ erklärt
München * Das von der Räteregierung ausgegebene Papiergeld wird vom Finanzministerium als „ungültig“ erklärt.
5. 5 1919 - Beerdigungen finden jetzt auch vor- und nachmittags statt
München * Wegen der vielen Leichen finden die Beerdigungen jetzt auf den Münchner Friedhöfen vor- und nachmittags statt.
5. 5 1919 - Die Leitung der Volksschulen wird Lehrerräten übertragen
München - Freistaat Bayern * Die Leitung der Volksschulen wird Lehrerräten übertragen. An größeren Schulen, wo die Schulleitung nicht ehrenamtlich zu besorgen ist, kann die Gemeindeverwaltung auf Vorschlag des Lehrerrats einen Lehrer hauptamtlich mit der Schulleitung beauftragen. Er ist jedoch nicht Vorgesetzter anderer Lehrer.
5. 5 1919 - Gräuelgeschichten in den Münchner Neuesten Nachrichten
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten liefern neue haarsträubende Details der Ermordung der Geiseln im Luitpold-Gymnasium und berufen sich dabei auf Informationen aus dem Polizeipräsidium.
Demnach wurde im Luitpold-Gymnasium „ein männliches Geschlechtsteil“ und „Eingeweide“ gefunden. Später stellt sich zwar heraus, dass es sich um Fleischabfälle eines geschlachteten Schweins handelt, doch das interessiert niemanden mehr.
Um den 5. 5 1919 - Roheitsexesse bei der Exekution von spartakistischen Frauen
München-Stadelheim * Erich Mühsam berichtet über grauenvolle Roheitsexesse bei der Exekution von spartakistischen Frauen: „Dort haben die weißen Pelotons zum wiederholten Male die ersten Schüsse auf die Geschlechtsteile von Frauen und Mädchen gezielt, in anderen Fällen die Exekution vollzogen, indem sie zuerst in die Beine, dann in den Unterleib schossen und sich an den Qualen der langsam verendenden Opfer weideten.
Leider sind diese entsetzlichen Dinge, für deren Wahrheit Zeugen beizubringen sind selbst von den frömmsten Staatsschützern stets unterdrückt worden“.
5. 5 1919 - Ernst Niekisch wird verhaftet
Augsburg * Ernst Niekisch wird in seiner Augsburger Wohnung verhaftet. Die Zeit bis er abgeführt wird nutzt er, um aus der SPD auszutreten und in die USPD einzutreten.
5. 5 1919 - Zustände wie 1914 in Belgien
München-Haidhausen * Josef Hofmiller wird von seinem Schwager informiert, dass in seinem Wohnviertel „die Straßenkämpfe so schlimm [waren], wie 1914 in Belgien.
Wer mit der Waffe in der Hand angetroffen wurde, wurde auf der Stelle erschossen. Es ist jetzt so weit gekommen, dass viele Gewehre von Kindern mitgeführt werden, die angeben, sie hätten sie gefunden“.
6. 5 1919 - 6 Tote gegenüber 200 Tote alleine in Giesing
München * Auf Seiten der Freikorps gibt es nach einem Bericht des Bayerischen Schützenkorps seit Ausbruch der Kämpfe in Giesing 6 Tote und 33 Verwundete; auf der Gegenseite aber rund 200 Tote und eine nicht festzustellende Zahl von Verletzten.
6. 5 1919 - Michael von Faulhaber kommt wieder nach München zurück
München-Kreuzviertel * Erzbischof Michael von Faulhaber kommt von seiner Firmungsreise wieder nach München zurück.
6. 5 1919 - Nuntius Eugenio Pacelli befürchet weitere Unruhen
München - Vatikan * Nuntius Eugenio Pacelli schreibt in seinem Bericht in die Vatikanstadt: „Die Behauptung der Regierung Hoffmann, sie habe die Stadt lediglich von den Spartakisten befreien wollen und beabsichtige, nach der Ermordung des Anführers der Roten Armee in München, Rudolf Egelhofer, streng zu ermitteln und festgenommene Spartakisten menschlich zu behandeln.“
Der Nuntius fürchtet nämlich „weitere Unruhen angesichts dessen, dass viele Spartakisten, die nicht alle hingerichtet werden können, das Gefängnis mit ihrer Rachsucht verlassen werden“. Harte Worte für den ranghohen Kirchenmann und späteren Papst.
6. 5 1919 - Die Bilanz der Toten ist sehr einseitig
München * Zwischen dem 29. April und 6. Mai 1919 kommen in München zwischen 600 und über 1.000 Menschen ums Leben. Die Bilanz der Toten ist sehr einseitig. Es sterben
- 58 Regierungssoldaten und
- 93 bewaffnete Anhänger der Räterepublik.
- Der größte Teil sind jedoch unbeteiligte Zivilisten.
7. 5 1919 - Das Leben in München normalisiert sich wieder
München * Der Straßenbahnbetrieb, der Eisenbahn-Personenverkehr und der Fernsprechverkehr haben vollumfänglich ihren Betrieb wieder aufgenommen. Auch die Münchner Börse ist wieder eröffnet.
7. 5 1919 - Übergabe des Entwurfs für den Versailler Vertrag
Versailles * Im Trianon-Palast-Hotel in Versailles wird dem deutschen Bevollmächtigten der Entwurf der Friedensbedingungen überreicht. Deutschland kann innerhalb von 14 Tagen schriftliche Bemerkungen dazu abgeben. Eine mündliche Aussprache soll nicht stattfinden.
7. 5 1919 - Wiedereingesetzte Professoren an der Kunstakademie
München-Maxvorstadt * Die Professoren der Akademie der bildenden Künste werden wieder in Amt und Würden eingesetzt. Alles geht in seinem gewohnten - ultra-konservativen - Gang weiter.
7. 5 1919 - Ultimativer Aufruf zur Abgabe der Waffen
München * Stadtkommandant Adolf Herrgott (der heißt tatsächlich so) fordert in einem mit „Letzte Warnung“ überschriebenen Aufruf zur endgültigen Ablieferung aller Waffen bis spätestens 8. Mai 1919, 18 Uhr, auf. Anderenfalls droht die Bestrafung nach dem Kriegszustandsgesetz.
7. 5 1919 - Josef Hofmiller analysiert die Lage der SPD
München-Haidhausen * Josef Hofmiller, der Herausgeber der reaktionären Zeitschrift Süddeutsche Monatshefte, analysiert die Situation: „Die Sozialdemokratie ist in einer Zwickmühle: sie ist gezwungen Farbe zu bekennen, und diese Farbe ist nicht rot, wie die Masse geglaubt hat. Sie hat niemals gewagt, den trennenden Strich zwischen sich und den Kommunisten zu ziehen; die Leute aber, die die Regierung Hoffmann jetzt erschießen lässt, sind lauter Kommunisten.
Die Sozialdemokratie hat die Massen immer auf den großen Kladderatatsch [= eine alte, in der Kaiserzeit gebrauchte, humorvolle Bezeichnung für die Revolution] vertröstet und scharf gemacht; jetzt, wo die Massen den Kladderatatsch machen und ausnützen wollen, lässt sie auf sie schießen.
Man sieht es jeder Nummer der ‚Münchener Post‘ an, wie greulich der offiziellen Sozialdemokratie die durch ihre eigene Schuld unheilbar gewordene Lage ist.“
7. 5 1919 - Ein niedergeschlagener Erich Mühsam
Ebrach * Der im Zuchthaus Ebrach einsitzende Erich Mühsam schreibt in sein Tagebuch: „Man blickt im Geiste um sich: lauter Tote, lauter Ermordete - es ist grauenhaft. […] Mit den Münchner Schandtaten hat Noske sogar seine Berliner Blutorgien übertroffen. Das ist die Revolution, der ich entgegen gejauchzt habe. Nach einem halben Jahr ein Bluttümpel: mir graut“.
7. 5 1919 - Ein Korpsbefehl soll die Wilden Erschießungen beenden
München * Das Generalkommando von Oven erlässt einen Korpsbefehl, der den wilden Erschießungen ein Ende bereiten soll. Der Befehl bezieht sich ausdrücklich auf das Massaker vom Vorabend an den Kolpinggesellen. Der Schlusssatz des Befehls lautet:
„Dieser Befehl ist unverzüglich beim Appell allen Mannschaften bekanntzugeben. Es ist Sorge zu tragen, dass ihn auch Abkommandierte, Neuhinzutretende unverzüglich erfahren.“
8. 5 1919 - Das Freikorps Werdenfels präsentiert sich der Bevölkerung
München * Das Freikorps Werdenfels präsentiert sich der Bevölkerung bei einem Marsch durch die Münchner Innenstadt.
8. 5 1919 - Erst jetzt enden die Kämpfe in München
München * Erst jetzt enden die Kämpfe in München.
- Die Zahl der Opfer wird offiziell mit 557 Menschen angegeben.
- 145 sind in militärischen Auseinandersetzungen gefallen,
- 186 hat man standrechtlich erschossen und
- 226 werden noch nach der Einnahme der Landeshauptstadt ermordet.
Neueste Schätzungen gehen allerdings von bis zu 1.200 Opfern aus.
8. 5 1919 - Protest gegen die Versailler Friedensbedingungen
Weimar - Deutsches Reich * Nachdem in Deutschland zu den Versailler Friedensbedingungen ein Sturm der Entrüstung ausgelöst wurde, veröffentlichen der Reichspräsident Friedrich Ebert und die Reichsregierung einen „Aufruf an das deutsche Volk“.
Darin spricht man von einem „Friedensvorschlag der Vergewaltigung“. Dem deutschen Volk wird „Gewalt ohne Maß und Grenzen“ angetan. Aus einem solchen „aufgezwungenen Frieden müsste neuer Hass zwischen den Völkern und im Verlauf der Geschichte neues Morden erwachsen“.
8. 5 1919 - Die Säuberung Münchens ist kein Maiausflug
Regensburg * Der Regensburger Anzeiger gibt seinen Lesern, „zu bedenken, dass die Säuberung Münchens vom spartakistischen Gesindel kein Maiausflug ist“.
8. 5 1919 - Missgriffe können nicht ganz vermieden werden!
München * Die halbamtliche Bayerische Staatszeitung rechtfertigt die standrechtlichen Erschießungen mit der Aussage:
„Die Bevölkerung verurteilt aufs Schwerste jene feigen Häuserschützen, die aus dem Hinterhalt Angehörige der Regierungstruppen heimtückisch niederknallen, und versteht es, dass solche Schützen, wo sie auf der Tat oder mit der Schusswaffe ertappt werden, nach dem Grundsatz ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn!‘ an die Wand gestellt werden.“
Und natürlich muss nach Auffassung der Bayerischen Staatszeitung Verständnis dafür aufgebracht werden, „dass in der Erregung des Augenblicks vielleicht Missgriffe nicht ganz vermieden werden können“.
9. 5 1919 - Dankschreiben des Ministerpräsidenten an die Weißen Truppen
München * Im Regierungsorgan Freistaat wird ein Dankschreiben des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann [SPD] an Generalleutnant Ernst Friedrich Otto von Oven veröffentlicht. Dem militärisch Verantwortlichen für den hundertfachen Mord und Oberbefehlshaber der Weißen Truppen spricht die bayerische Staatsregierung den „herzlichen Dank“ aus.
Wörtlich heißt es: „Für die umsichtige Leitung und Durchführung der zur Befreiung Münchens aus der Hand der Bolschewisten notwendigen militärischen Operationen spreche ich zugleich im Namen des Gesamtministeriums den herzlichen Dank aus.
Größte Anerkennung gebührt den aus allen Gauen Deutschlands herbeigeeilten Truppen, die in selbstloser Opferbereitschaft unserm bedrängten Bayernland und dem ganzen Reich den größten Dienst erwiesen.“
Um den 10. 5 1919 - Dr. Fritz Gerlich kehrt wieder nach München zurück
München * Nach der blutigen Niederschlagung der Räterepubliken kehrt Dr. Fritz Gerlich wieder nach München zurück. Er überarbeitet dort das „antikommunistische Material für die Aufklärung und Erziehung der Reichswehr“ und tritt als Redner vor den Soldaten auf.
10. 5 1919 - Pater Rupert Mayer predigt beim Begräbnis der 21 Kolpinggesellen
München * Pater Rupert Mayer hält die Predigt beim Begräbnis der 21 Kolpinggesellen, die von den Weißen Truppen am 6. Mai bestialisch ermordet worden sind.
10. 5 1919 - Das Freikorps Werdenfels verlässt München
München - Weilheim - Garmisch * Das Freikorps Werdenfels verlässt München. In Weilheim, Garmisch und Partenkirchen werden die Befreier Münchens begeistert empfangen.
10. 5 1919 - An der Maximiliansbrücke fallen Gewehrschüsse
München-Lehel * In der Nacht um 1 Uhr fallen an der Maximiliansbrücke 15 bis 20 Gewehrschüsse.
10. 5 1919 - Die in der Martin-Schule stationierten Posten werden angegriffen
München-Obergiesing * Die in der Martin-Schule stationierten Posten der Regierungstruppen werden in der Nacht dreimal angegriffen.
10. 5 1919 - Gründung der Deutschen Bürgervereinigung
München * Gründung der Deutschen Bürgervereinigung in München.
10. 5 1919 - Eine Volksaufklärungsstelle für Bayern wird gegründet
München * Eine Volksaufklärungsstelle für Bayern wird in München gegründet.
10. 5 1919 - Die Polizeistunde wird auf 22 Uhr festgesetzt
München * Die Polizeistunde wird auf 22 Uhr festgesetzt. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist der Aufenthalt auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten.
10. 5 1919 - Zurückgegebene Waffenarsenale
München * Seit dem Einmarsch der Weißen Truppen wurden folgende Waffen abgeliefert:
- 169 leichte Geschütze,
- 11 schwere Geschütze,
- 760 Maschinengewehre,
- 21.351 Gewehre, Karabiner und Pistolen,
- 70.000 Stichwaffen,
- 300.000 Handgranaten und
- 8 Millionen Patronen.
10. 5 1919 - Truppenaufzug im Film in den Kammerspielen
München-Maxvorstadt * Seit dem 10. Mai kann die Münchner Bevölkerung in den Kammerspielen, damals noch in der Augustenstraße 89, täglich viermal den Film „Vorbeimarsch des Freikorps Faupel“ vom 6. Mai ansehen.
10. 5 1919 - Josef Hofmiller unterschätzt die Thule-Gesellschaft
München-Haidhausen * Josef Hofmiller schreibt zur Thule-Gesellschaft völlig naiv in sein Tagebuch: „Diese Thule-Gesellschaft scheint eine harmlose alldeutsche Loge gewesen zu sein, die in den Verdacht monarchistischer Umtriebe gekommen war und an der die Roten offenbar ein Exempel statuieren wollten. Sie hatten als Vereinsabzeichen das germanische Hakenkreuz.“
Josef Hofmiller hat - wie die meisten Angehörigen des bürgerlichen Lagers - die Entschlossenheit der Thule-Gesellschaft, den demokratischen Staat zu beseitigen und durch eine völkische Diktatur zu ersetzen, völlig unterschätzt.
10. 5 1919 - Zur Nicht-Unterzeichnung des Versailler Friedensvorschlags aufgefordert
Berlin * Im SPD-Organ Vorwärts erscheint ein Leitartikel des Chefredakteurs Friedrich Stampfer zum Versailler Friedensvorschlag. Er beinhaltet die klare Aufforderung: „Unterzeichnet nicht!“.
10. 5 1919 - Ministerpräsident Hoffmann verteidigt seine Entscheidungen
Bamberg - München * Ministerpräsident Johannes Hoffmann gibt eine öffentliche Erklärung ab. Darin bringt er zum Ausdruck: „Schrecklich ist der Krieg, am schrecklichsten der Bürgerkrieg. Entsetzliche Bluttaten sind in München geschehen, Verbrechen auf beiden Seiten. Das unschuldig vergossene Blut der grausam ermordeten Geiseln schreit zum Himmel. Die Kunde von der Erschießung der 21 friedlichen Bürger durch wahnsinnig erregte Soldaten erfüllte uns mit tiefstem Entsetzen.“
Im gleichen Atemzug verteidigt Hoffmann die Rückendeckung seiner Regierung für die Regierungstruppen mit der Behauptung, man habe monatelang Geduld walten lassen und damit nichts erreicht, als den „blutigen Taten einer Diktatur der Gewalt“ Tür und Tor zu öffnen. Auf den „Terror des Kommunismus und der Roten Armee“ kann man nur mit Kampf und nicht mit Verständigung antworten.
11. 5 1919 - Diplomatische Schriftstücke bei Hausdurchsuchung entdeckt
München * Die Wohnungen des ermordeten Ministerpräsidenten Kurt Eisner und seines Sekretärs Felix Fehrenbach werden durchsucht.
Dabei werden diplomatische Schriftstücke aus dem Ministerium des Äußeren gefunden, darunter der Schön‘sche Bericht vom 18. Juli 1914 und das sogenannte Ritter-Telegramm.
11. 5 1919 - Die militärische, politische und verwaltungsmäßige Führung Münchens
München * Das Bayerische Reichswehr Gruppenkommando Nr. 4 - Gruko übernimmt die militärische, politische und verwaltungsmäßige Führung und Überwachung in München, nachdem die bayerische Regierung unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann aufgrund der politischen Situation nach Bamberg geflohen war.
12. 5 1919 - Einstellungsbeginn für die Münchner Einwohnerwehr
München * Einstellungsbeginn für die Münchner Einwohnerwehr.
12. 5 1919 - Philipp Scheidemann spricht von einem „Gewaltfrieden“
Berlin * Die Nationalversammlung tagt erstmals wieder in Berlin und befasst sich mit den Versailler Friedensbedingungen. Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann spricht von einem „Gewaltfrieden“.
13. 5 1919 - Eugen Leviné wird verhaftet und des Hochverrats angeklagt
München-Haidhausen * Eugen Leviné wird unter dem Namen Ludwig Geisenberg in der Schneckenburgerstraße 20 festgenommen und wegen Hochverrats angeklagt.
13. 5 1919 - 30.000 Mark Kopfgeldprämie für die Ergreifung Ernst Tollers
München * Zur Ergreifung Ernst Tollers werden 30.000 Mark ausgesetzt.
13. 5 1919 - SPD-Massenkundgebung gegen die Versailler Friedensbedingungen
Berlin * Die SPD ruft zu einer Massenkundgebung gegen die Versailler Friedensbedingungen in Berlin auf. Etwa 10.000 Menschen beteiligen sich an dieser Protestkundgebung. Eine erstaunlich geringe Anzahl.
14. 5 1919 - Forderungen der bürgerlichen Parteien an die Regierung
München * Die bürgerlichen Parteien in München fordern von der Regierung:
- Die sofortige Wiederherstellung der gesetzmäßigen Zustände;
- die Wiederaufnahme eines geregelten Polizeibetriebes;
- die Entwaffnung der Roten Armee;
- die Aufstellung einer Volkswehr;
- durchgreifende Maßnahmen zur Sicherung der demokratischen Verfassung;
- die Festnahme und Bestrafung der für die ungesetzlichen Zustände verantwortlichen Führer und
- die Ausweisung aller politisch nicht einwandfreien landfremden Elemente.
Da die Abgabe der Waffen und Munition nur zögerlich vonstatten geht, werden Belohnungen ausgesetzt.
14. 5 1919 - Oskar Maria Graf wird verhaftet
München * Der Schriftsteller Oskar Maria Graf wird wegen seiner Mitarbeit im Zensurrat verhaftet. Dank dem Einsatz seiner Lebensgefährtin Mirjam Sachs sowie der Fürsprache von Rainer Maria Rilke und Professor Roman Woerner kommt er nach zwölf Tagen Haft wieder frei.
14. 5 1919 - Towia Axelrod wird im Achental verhaftet
Tirol * Towia Axelrod, der politische Kommissar in der kommunistischen Räterepublik, wird im Achental verhaftet und nach Bayern ausgeliefert. Er wird 15 Jahre Festungshaft erhalten.
17. 5 1919 - Erstes Zusammentreten des Standgerichts München
München-Au * Erstes Zusammentreten des Standgerichts München.
20. 5 1919 - Nuntius Eugenio Pacelli erholt sich in Rorschach
München - Rorschach * Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli hält sich bis zum 8. August 1919 in Rorschach auf.
21. 5 1919 - Silvio Gesell und Emil K. Maenner werden verhaftet
München * Die ehemaligen Volksbeauftragten für Finanzen Silvio Gesell [1. Räterepublik] und Emil K. Maenner [2. Räterepublik] werden verhaftet.
21. 5 1919 - Auguste Pielmaier stürzt sich von der Frauenkirche
München-Kreuzviertel * Die 17-jährige Auguste Pielmaier, Tochter eines Haidhauser Steinmetzmeisters, stürzt sich vom nördlichen Turm der Frauenkirche.
21. 5 1919 - Die Polizeistunde wird auf 23 Uhr festgelegt
München * Die Polizeistunde wird auf 23 Uhr festgelegt. Danach dürfen nur Personen mit besonderer Berechtigung die öffentlichen Straßen und Plätze betreten.
23. 5 1919 - Adolf Hitler sagt gegen den Soldatenrat Georg Dufter aus
München * Das früheste nachweisbare Dokument aus Adolf Hitlers politischer Laufbahn ist ein Protokoll vom 23. Mai 1919, in dem der Gefreite vor einer militärischen Untersuchungskommission über die Revolutionsvorgänge als Zeuge gehört und in dieser Funktion gegen den Soldatenrat Georg Dufter, der zugleich Mitglied der USPD ist, auftritt. Über Dufter, der die Propagandaabteilung des 2. Infanterieregiments geleitet hat, sagt Adolf Hitler im Standrechtlichen Vernehmungsbüro folgendes aus:
„Dufter war einer der ärgsten und radikalsten Hetzer des Regiments und hat jederzeit für die Räterepublik Propaganda gemacht. In den öffentlichen Versammlungen des Regiments hat er jederzeit den radikalsten Standpunkt vertreten und für die Diktatur des Proletariats agitiert. Dass einzelne Teile des Regiments der roten Armee sich anschlossen, ist jedenfalls auf die Propagandatätigkeit des Dufter und des Bataillonsrates Seiß zurückzuführen.
Durch seine Hetzereien gegen die Regimentstruppen, die Dufter noch am 7. Mai belästigte, hat er bewirkt, dass auch Regimentsangehörige an diesem Nachmittage mit den Pionieren sich zu Feindseligkeiten gegen die Regierungstruppen hinreißen ließen.“
26. 5 1919 - Oskar Maria Graf wird aus der Haft entlassen
München * Der Schriftsteller Oskar Maria Graf wird nach 12 Tagen wieder aus der Haft entlassen.
28. 5 1919 - Dem Landtag wird ein Verfassungsentwurf vorgelegt
Bamberg * Dem in Bamberg tagenden Landtag wird der Entwurf einer Verfassung vorgelegt. Er basiert auf einem noch unter Kurt Eisner in Auftrag gegebenen Entwurf, der vom Staatsrechtler Robert Piloty, Ministerialrat Josef von Graßmann und drei weiteren hochrangigen Ministerialbeamten des Außen- und Finanzressorts erarbeitet worden ist.
31. 5 1919 - Umbildung der Regierung Hoffmann in Bamberg
Bamberg * Umbildung der bayerischen Regierung. Ministerpräsident Johannes Hoffman tritt zurück, um den Weg für das zweite Kabinett Hoffmann freizumachen. In der neuen Koalition aus SPD, BVP sowie der DDP und einem parteifreien Minister haben USPD und der Bauernbund keinen Platz mehr.
31. 5 1919 - Rosa Luxemburgs Leichnam im Landwehrkanal entdeckt
Berlin * Der Leichnam der am 15. Januar 1919 ermordeten Rosa Luxemburg wird im Landwehrkanal entdeckt.
6 1919 - Hedwig Kämpfer wird aus der Haft entlassen
München * Hedwig Kämpfer wird aus der Haft entlassen, weil sie für die USPD zum Stadtrat kandidiert.
1. 6 1919 - Der Münchner Flugplatz am Oberwiesenfeld
München-Oberwiesenfeld * Vom Münchner Flugplatz am Oberwiesenfeld bricht Hermine Körner, die neue Intendantin des Münchner Schauspielhauses, mit zwei Kollegen zu einem Gastspiel nach Augsburg auf.
2. 6 1919 - Der Prozess gegen den Kommunistenführer Eugen Leviné beginnt
München-Au * Vor dem Standgericht in der Au beginnt der Prozess gegen den Kommunistenführer Eugen Leviné. In seiner Verteidigungsrede sagt er: „Wir Kommunisten sind Tote auf Urlaub, dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie mir meinen Urlaubsschein noch verlängern werden, oder ob ich einrücken muss zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ich sehe auf jeden Fall Ihrem Spruch mit Gefasstheit und mit einer inneren Heiterkeit entgegen. Die Ereignisse sind nicht aufzuhalten.
Die Staatsanwaltschaft glaubt, die Führer hätten die Massen aufgepeitscht. Wie die Führer die Fehler der Massen nicht hintertreiben konnten unter der Scheinräterepublik, so wird auch das Verschwinden des einen oder des anderen Führers unter keinen Umständen die Bewegung hindern. Und über kurz oder lang werden in diesem Raume andere Richter tagen, und dann wird der wegen Hochverrats bestraft werden, der sich gegen die Diktatur des Proletariats vergangen hat.“
3. 6 1919 - Eugen Leviné wird zum Tode verurteilt
München-Au * Eugen Leviné wird zum Tode verurteilt.
5. 6 1919 - Eugen Leviné wird im Gefängnis Stadelheim erschossen
München-Obergiesing * Der Kommunistenführer Eugen Leviné wird an der Gefängnismauer im Gefängnis Stadelheim erschossen. Zuvor erhebt er noch die Faust und ruft: „Es lebe die Weltrevolution!“
Um 10. 6 1919 - Die Verhandlungen über die Fürstenabfindung beginnen
München-Kreuzviertel * Aufgrund der politischen Wirren leitet die Kommission zur Fürstenabfindung erst jetzt Verhandlungen ein. Es geht dabei „um die finanzielle Auseinandersetzung des Königlichen Hauses mit dem Staat und zwar, wenn möglich, auf allen Gebieten, auf welchen finanzielle Berührungen bestehen“.
Die Verhandlungen dauern vier Jahre an und werden mit dem festen Willen einer einvernehmlichen Lösung geführt.
13. 6 1919 - Rosa Luxemburg wird neben Karl Liebknecht beigesetzt
Berlin * Rosa Luxemburg wird neben dem Grab von Karl Liebknecht in Berlin-Friedrichsfelde beigesetzt.
Um den 15. 6 1919 - Hitler absolviert einen Kurs für Propagandaleute
München * Hauptmann Karl Mayr, ein Förderer Adolf Hitlers, lässt neben der politischen Überwachung der damals über fünfzig Parteien und Organisationen in München durch Agenten und V-Leute - auch geeignete Soldaten als „antibolschewistisch geschulte Propagandaleute“ für die „Beeinflussung des Übergangsheeres“ ausbilden.
Auf Vorschlag seiner Vorgesetzten absolviert Hitler im Juni 1919 den ersten Kurs an der Universität München, wo ihn besonders die nationalistischen und antisemitischen Schlagworte von Gottfried Feder und Karl von Bothmer beeindrucken.
16. 6 1919 - Erste Verhandlungen zur Fürstenabfindung
München-Kreuzviertel * Bei der ersten Zusammenkunft der Verhandlungsführer fordert die Kommission zur Fürstenabfindung einen Katalog der Wittelsbachischen Gesamtforderungen.
16. 6 1919 - Der Verfassungsausschuss beginnt mit seinen Beratungen
Bamberg * Der Verfassungsausschuss beginnt im Spiegelsaal der Bamberger Harmonie mit seinen Beratungen. In 21 Sitzungen berät er den vorliegenden Verfassungsentwurf bis zum 11. August.
21. 6 1919 - Matthias Erzberger wird Reichsminister der Finanzen
Berlin * Unter dem Reichskanzler Gustav Bauer wird Matthias Erzberger zum Reichsminister der Finanzen.
23. 6 1919 - Ernst Niekisch zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt
München * Ernst Niekisch wird wegen Beihilfe zum Hochverrat zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt.
24. 6 1919 - Ernst Niekisch wird ins Zuchthaus Ebrach gebracht
München - Ebrach * Ernst Niekisch wird ins Zuchthaus nach Ebrach, später nach Eichstätt, gebracht.
26. 6 1919 - Eduard Schmid (SPD) wird Erster Bürgermeister von München
München * Wahl von Eduard Schmid (SPD) zum Ersten Bürgermeister von München.
26. 6 1919 - Enorme Zugewinne der USPD in Giesing
München-Giesing * Die SPD erreicht in ihrer einstigen Hochburg Giesing statt der bei der Landtagswahl am 12. Januar 1919 erreichten 58,9 Prozent jetzt bei der Stadtratswahl nur noch 18 Prozent. Dagegen erhöht sich der Stimmenanteil der USPD von 7,1 Prozent auf 45,4 Prozent der Giesinger Wahlberechtigten.
28. 6 1919 - Den Versailler Vertrag unter Protest angenommen
Berlin * Die Reichsregierung nimmt den Versailler Vertrag unter Protest an.
10. 7 1919 - Reichswirtschaftsminister Rudolf Wissell erklärt seinen Rücktritt
Weimar * Der Reichswirtschaftsminister Rudolf Wissell erklärt den Rücktritt von seinem Amt.
12. 7 1919 - Der Prozess gegen Ernst Toller beginnt
München-Au * Der Prozess gegen Ernst Toller beginnt vor dem Standgericht in der Au.
16. 7 1919 - Ernst Toller wird zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt
München * Erich Mühsam wird zu fünfzehn Jahre Festungshaft verurteilt.
Im Urteil heißt es: „Mühsam hat sich durch seine Tätigkeit bei Aufmachung der ersten Räterepublik als das treibende Element erwiesen. […] Bei Mühsam ist nicht festgestellt worden, dass seine Handlungsweise aus ehrloser Gesinnung entsprungen ist; so werden ihm auch mildernde Umstände zugebilligt; denn er hat zeitlebens in ehrlicher Überzeugung, wenn auch mit einem an psychopathischen Zustand grenzenden Fanatismus, die Durchführung seiner Ideen verfochten hat.
Die Beweiserhebung aber hat ergeben, dass Mühsam während der ganzen Revolutionszeit einen höchst verderblichen Einfluss auf die an sich erregten Massen in skrupelloser Weise ausgeübt hat. Die Verhängung der Höchststrafe ist daher geboten“.
Man unterstellt Toller jedoch eine ehrenhafte Gesinnung, was ihm - anders als Eugen Leviné - letztlich das Leben rettet. Er wird zunächst nach Eichstätt überführt.
21. 7 1919 - Dr. Hildegard Menzi wird freigesprochen
München-Au * Die Ärztin Dr. Hildegard Menzi wird wegen „Landesverrat und Begünstigung des Hochverrates“ angeklagt. Sie wird vom standrechtlichen Gericht in der Au freigesprochen.
26. 7 1919 - Das deutsche Branntweinmonopol tritt in Kraft
Deutsches Reich * Das deutsche Branntweinmonopol tritt in Kraft. Es verpflichtet den Staat, kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Brennereien den Alkohol zu einem fixierten Preis abzunehmen, ihn zu reinigen und zu vermarkten. Es war bereits ein Jahr zuvor von Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet worden.
31. 7 1919 - Verabschiedung der Weimarer Verfassung
Weimar * Verabschiedung der Weimarer Verfassung durch die Nationalversammlung.
1. 8 1919 - Aufhebung des Standrechts - Einsetzung von Volksgerichten
München * Aufhebung des Standrechts. Einsetzung von Volksgerichten.
1. 8 1919 - Mit dem Schulaufsichtsgesetz wird die Fachaufsicht eingeführt
München * Mit dem Schulaufsichtsgesetz wird die geistliche Schulaufsicht bei der Volksschule beseitigt und durch die Fachaufsicht ersetzt.
Im gesamten Schulwesen sollen Elternvertretungen eingerichtet werden.
8. 8 1919 - Alois Lindner wird an der österreichisch-ungarischen Grenze aufgegriffen
Ungarn * Nach dem Zusammenbruch der Räterepublik in Ungarn wird Alois Lindner an der österreichisch-ungarischen Grenze aufgegriffen und von Österreich an Bayern ausgeliefert.
8. 8 1919 - Eugenio Pacelli kehrt aus seinem Exil in der Schweiz wieder zurück
Rorschach - München * Nuntius Eugenio Pacelli kehrt aus seinem Sommerurlaub in Rorschach in der Schweiz wieder nach München zurück.
11. 8 1919 - Die Verfassung der Weimarer Republik tritt in Kraft
Weimar * Die Verfassung der Weimarer Republik tritt in Kraft. Diese enthält stärkere zentralistische Elemente und schränkt die Eigenständigkeit der alten Staaten ein.
Die Preußische Gesandtschaft in der Prinzregentenstraße besteht weiter. Sie hat nun die Aufgabe den Kontakt zwischen den beiden Länderregierungen zu vermitteln und Probleme, die im Reichsrat zu verhandeln sind, vorher zu koordinieren und abzustimmen.
11. 8 1919 - Die Weimarer Verfassung hebt bayerische Gesetze auf
Weimar * Das Gesetz über die Aufhebung des bayerischen Adels wird durch die Weimarer Verfassung vom 11. August wieder zurückgenommen. Bis dahin ist das Führen bayerischer Adelstitel ausdrücklich verboten.
11. 8 1919 - In der Weimarer Republik wird das Eheverbot für Lehrerinnen aufgehoben
Weimar * Erst in der demokratischen Weimarer Republik darf die Lehrerin vom Hochzeitsmahl wieder an die Schultafel zurückkehren. Das Zölibat für Beamtinnen wird durch die Weimarer Verfassung aufgehoben.
11. 8 1919 - Verfassungsberatungen beendet
Bamberg * Der Verfassungsausschuss hat in 21 Sitzungen die neue bayerische Verfassung beraten.
Es werden noch redaktionelle Angleichungen an die Weimarer Verfassung vorgenommen, die am gleichen Tag in Kraft getreten ist. Zum Beispiel die in Paragraph 13 festgelegte Homogenitätsklausel „Reichsrecht bricht Landesrecht“.
12. 8 1919 - Der Landtag beschließt in Bamberg die Bayerische Verfassung
Bamberg * Mit 165 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen von der USPD und einer Enthaltung beschließen die Mitglieder des Landtags in Bamberg die in elf Abschnitte und 95 Paragraphen gegliederte neue Bayerische Verfassung.
In ihr wird Bayern als Freistaat und Mitglied des Deutschen Reiches bezeichnet. Sie enthält einen Grundrechtekatalog und sieht für alle Personen, die ihren Wohnsitz mindestens ein halbes Jahr in Bayern haben, die bayerische Staatsbürgerschaft vor.
14. 8 1919 - Die Bayerische Verfassung wird unterzeichnet
Bamberg * Die zwei Tage zuvor beschlossene bayerische Verfassung wird unterzeichnet. Sie tritt am 15. September 1919 in Kraft.
14. 8 1919 - Die bayerischen Volksschullehrer werden Staatsbeamte
München - Freistaat Bayern * Mit dem neuen Volksschullehrergesetz werden die bayerischen Volksschullehrer Beamte des Staates. Damit wird eine seit Jahrzehnten von den Lehrern erhobene Forderung erfüllt.
Um den 15. 8 1919 - Eintritt in die Deutsche Arbeiterpartei - DAP
München * Eintritt des Kreises um den völkischen Dichter Dietrich Eckart in die Deutsche Arbeiterpartei - DAP.
16. 8 1919 - Abschiedsfest für die Regierung und den Landtag
Bamberg * Die Stadt Bamberg veranstaltet im Kloster Michelsberg ein Abschiedsfest für die Regierung und die Landtagsabgeordneten.
17. 8 1919 - Ein Volksfest zugunsten der gefallenen Revolutionäre
München-Giesing * Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei - USPD lädt „alle sozialistisch denkenden Männer und Frauen Münchens“ in die Waldrestauration Altstadelheim zu einem „Volks-Fest mit Tanz, Glückshafen, Taubenstechen und Kegelscheiben“ ein. Der Erlös wird „den Hinterbliebenen der gefallenen Revolutionäre“ zufallen.
17. 8 1919 - Die Regierung und der Landtag sind in München zurück
Bamberg - München * Das Gesamtministerium und der Landtag kehren nach München zurück.
25. 8 1919 - Übernahme des bayerischen Militärkontingents von der Reichswehr
Berlin - München * Übernahme des bayerischen Militärkontingents von der Reichswehr.
27. 8 1919 - Der „Sedantag“ wird abgeschafft
Deutsches Reich * Der „Sedantag“ wird abgeschafft.
28. 8 1919 - Eltern und Lehrern erhalten ein Mitspracherecht
München - Freistaat Bayern * Eine Verordnung über „Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsicht für Volksschulen“ wird erlassen. Damit wird erstmals Eltern und Lehrern ein Mitspracherecht eingeräumt.
9 1919 - Ernst Niekisch wird nach Niederschönenfeld verlegt
Eichstätt - Niederschönenfeld * Ernst Niekisch wird in die Festungsanstalt in Niederschönenfeld verlegt.
1. 9 1919 - Der erste Geiselmordprozess vor dem Volksgericht München beginnt
München-Au * Der erste Geiselmordprozess vor dem Volksgericht München beginnt. Er wird bis zum 18. September andauern. Es geht um den Mord an zehn Geiseln am 30. April im Hof des Luitpold-Gymnasiums. Von den 16 Angeklagten werden sechs zum Tode verurteilt. Sieben Angeklagte werden zu 15 Jahre Zuchthaus verurteilt.
Um den 5. 9 1919 - Bayerns Bischöfe lehnen die demokratische Weimarer Verfassung ab
München * Alle acht bayerischen Bischöfe lehnen die demokratische Weimarer Verfassung mit der Begründung ab: „Halte sich wenigsten der Priesterstand das Gewissen rein und frei gegenüber einer Republik und ihrer Verfassung, die aus der Sünde der Revolution und damit aus dem Fluche geboren sind und diesen Fluch bis in das dritte und vierte Geschlecht vererben werden“.
6. 9 1919 - Erich Mühsam wird nach Ansbach verlegt
Ebrach - Ansbach * Erich Mühsam wird vom Zuchthaus Ebrach nach Ansbach verlegt.
10. 9 1919 - Friedensvertrag zwischen Österreich und den Alliierten geschlossen
Saint-Germain-en-Laye * Der Friedensvertrag von Saint-Germain-en-Laye zwischen Österreich und den Alliierten wird geschlossen.
11. 9 1919 - Erich Mühsam tritt der KPD bei
Ansbach * Erich Mühsam tritt der KPD bei.
12. 9 1919 - Adolf Hitler als Reichswehr-Spitzel im Sterneckerbräu
München-Angerviertel * Der arbeitslose Gefreite Adolf Hitler erhält von Hauptmann Karl Mayr den Befehl, als Spitzel der Reichswehr eine Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei - DAP im Sterneckerbräu im Tal zu besuchen, Informationen zu sammeln und Kontakt mit der Partei aufzunehmen. Die neue Partei gehört zwar der völkischen Bewegung an, doch der Namensteil Arbeiter lässt in nationalistischen Kreisen Verdacht aufkommen.
Auf der Versammlung referiert Gottfried Feder im Leiberzimmer über das Thema: „Wie und mit welchen Mitteln beseitigt man den Kapitalismus?“. Feder ist Mitglied der Thule-Gesellschaft und steigt später zum Parteiideologen der NSDAP auf. Anwesend sind 43 Personen, darunter als Begleiter Hitlers der Feldwebel Alois Grillmeier und zwei Propagandamänner des Gruko. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich das Bayerische Reichswehr Gruppenkommando Nr. 4 - Gruko, das unter der Führung des Generalmajors Arnold von Möhl steht.
Als am Ende der Diskussion ein Teilnehmer bemerkt, dass sich Bayern vom Reich lösen sollte, schreitet Adolf Hitler ein. Noch am gleichen Abend bietet ihm der DAP-Vorsitzende Anton Drexler den Parteieintritt an.
Um den 14. 9 1919 - Der Antisemitismus von Hitlers Förderer
München * Der den Gefreiten Adolf Hitler stark unterstützende Hauptmann Karl Mayr äußert sich zu Hitlers stark ausgeprägten Antisemitismus so: „Ich bin mit dem Herrn Hitler durchaus der Anschauung, dass das, was man Regierungssozialdemokratie heißt, vollständig an der Kette der Judenheit liegt. […] Alle schädlichen Elemente müssen wie Krankheitserreger ausgestoßen oder ‚verkapselt‘ werden. So auch die Juden.“
15. 9 1919 - Die demokratische Bayerische Verfassung tritt in Kraft
Freistaat Bayern * Die Verfassung des Freistaats Bayern tritt mit ihrer Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats Bayern in Kraft. Sie bildet die Grundlage des bayerischen Staatslebens bis zum Jahr 1933.
In Artikel 2 heißt es:
- Die Staatsgewalt geht von der Gesamtheit des Volkes aus.
In Artikel 15 heißt es:
- Alle Bayern sind gleich.
- Der bayerische Adel ist aufgehoben.
Die Idee der Räterepublik findet trotz der revolutionären Entstehungsgeschichte nur wenig Berücksichtigung. Lediglich die plebiszitären Elemente Volksbegehren und Volksentscheid werden aufgenommen. Der Landtag besitzt die uneingeschränkte Gesetzeshoheit einschließlich der Verfassungsgesetzgebung.
17. 9 1919 - Die ersten Schallplattenaufnahmen mit Liesl Karlstadt
München-Au * Am 17. und 18. September entstehen die ersten Schallplattenaufnahmen - im Trichterverfahren - mit Liesl Karlstadt und der Schallplattenfirma Polyphon im Festsaal der Paulanerbräu-Gaststätte München.
17. 9 1919 - Adolf Hitler wird Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei - DAP
München * Adolf Hitler wird in der Gaststätte Altes Rosenbad als Mitglied in die Deutsche Arbeiterpartei - DAP aufgenommen, zum Werbeobmann der Partei ernannt und gehört als siebtes Mitglied dem Arbeitsausschuss an. Vermutlich hat Hauptmann Karl Mayr dem Gefreiten Hitler zu diesem Schritt geraten.
Hauptmann Mayr, der Leiter der Nachrichtenabteilung Ib/P, der Propaganda- und Presseabteilung des Bayerischen Reichswehr Gruppenkommandos Nr. 4 - Gruko, unterstützt den Reichswehrsoldaten Hitler bei seiner weiteren politischen Agitation in der Deutschen Arbeiterpartei großzügig.
28. 9 1919 - Ein Herbstfest als Ersatz für das Oktoberfest
München-Theresienwiese * Als Ersatz für das Oktoberfest wird ein Herbstfest durchgeführt.
30. 9 1919 - Der Verlag Franz Eher Nachfolger wird eine GmbH
München * Aus dem Verlag Franz Eher Nachfolger wird die Franz Eher Nachfolger GmbH. Gesellschafterinnen sind nun Käthe Bierbaumer, die Freundin von Rudolf von Sebottendorff, und Sebottendorffs Schwester Dora Kunze.
1. 10 1919 - Der erste Hortleiterinnenkurs wird abgehalten
München-Bogenhausen * Der erste Hortleiterinnenkurs innerhalb der Städtischen Frauenschule wird abgehalten.
1. 10 1919 - Der Kriegszustand wird aufgehoben
München * Der seit 1. August 1914 bestehende Kriegszustand wird aufgehoben.
4. 10 1919 - Ilse Eisner heiratet in Großhadern Hans Unterleitner
Großhadern * Ilse Eisner, die Tochter von Kurt Eisner und Else Belli, heiratet in Großhadern Hans Unterleitner, den ehemaligen Minister für soziale Angelegenheiten. Als Trauzeugin wird die Privatsekretärin Toni Gernsheimer verzeichnet.
6. 10 1919 - Die Hirschau wird parkartig bewirtschaftet
München-Englischer Garten - Hirschau * Die Forstärarialische Hirschau wird parkartig bewirtschaftet.
7. 10 1919 - Max Levien wird in Wien verhaftet
Wien * Max Levien wird in Wien verhaftet, aber nicht an Bayern ausgeliefert.
13. 10 1919 - Der zweite Geiselmordprozess vor dem Volksgericht München beginnt
München * Der zweite Geiselmordprozess vor dem Volksgericht München beginnt. Er dauert zwei Tage. Ein Angeklagter wird zum Tode verurteilt. Vier Angeklagte erhalten Zuchthausstrafen von jeweils 15 Jahren.
25. 10 1919 - Zuchthausstrafen für die Mörder der Kolpinggesellen
München * Die beiden Haupttäter, der Schütze Jakob Müller und der Vizefeldwebel Konstantin Makowski, die maßgeblich an den Ermordungen der 21 Kolpinggesellen am 6. Mai mitgewirkt haben, werden zu jeweils 14 Jahren Zuchthaus verurteilt, Otto Grabatsch erhält ein Jahr Gefängnis. Sie werden wegen Totschlag - nicht jedoch wegen Mord - verurteilt.
30. 10 1919 - Willy Heide kommt zur Welt
München ? * Die spätere Wiesnwirt-Legende Willy Heide kommt zur Welt.
4. 11 1919 - Husar Stefan Latosi zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt
München * Der ehemalige Husar Stefan Latosi, der in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai blutbefleckt mit gestohlenen Uhren und Geldbörsen den Keller des Prinz-Georg-Palais am Karolinenplatz 5 verlassen hatte, wird in einem abgetrennten Verfahren vom Verbrechen des Totschlags freigesprochen. Er erhält aber wegen schweren Diebstahls zehn Jahre Zuchthaus. Latosi hat die zuvor ermordeten Kolpinggesellen ausgeraubt.
8. 11 1919 - Festversammlungen zum Jahrestag der Revolution
München * Aus Anlass des Jahrestages der Revolution beschließen die sozialistischen Betriebsräte eine völlige Arbeitsruhe und Einstellung des Straßenbahnbetriebs. SPD und USPD veranstalten mehrere Festversammlungen.
Am Nachmittag dieses ohne jeden Zwischenfall verlaufenden Tages findet am Ostfriedhof eine Totenfeier statt.
18. 11 1919 - Hindenburg und die lange vorbereitete Dolchstoßlegende
Berlin * Vor einem Untersuchungsausschuss des Reichstags äußert sich Paul von Hindenburg, dass die deutsche Armee im Felde nicht besiegt, sondern von hinten „erdolcht“ worden ist. Damit ist die lange schon vorbereitete Dolchstoßlegende in der Welt.
25. 11 1919 - Ludwig Siemer gründet den Volksbund für Kunst und Theater
München * Der Reiseunternehmer Ludwig Siemer gründet den Volksbund für Kunst und Theater, aus dem später die Theatergemeinde München hervorgehen wird.
Siemer steht der katholischen Bewegung nahe und betrachtet die politische Linke als Gegner. Deshalb will er den sozialistischen Kräften auf dem Feld der Kultur etwas entgegensetzen. Er gründet eine Organisation für Schauspielfreunde, die „die Kunst im Theater und auf allen Gebieten der Kunst im Sinne volkstümlich-deutscher Kultur und christlicher Lebensauffassung fördern“ will.
1. 12 1919 - Das Kriegsrecht in Bayern wird aufgehoben
München * Das Kriegsrecht in Bayern wird aufgehoben.
8. 12 1919 - Weitere Verhandlungen zur Fürstenabfindung
München-Kreuzviertel * Zwischen dem 8. und 20. Dezember 1919 finden weitere Verhandlungen über die Fürstenabfindung statt.
9. 12 1919 - Bayern bildet fortan den Wehrkreis VII der Reichswehr
Berlin - München * Die Reichswehr übernimmt das Kommando über das Bayerische Kriegsministerium. Bayern bildet fortan den Wehrkreis VII der Reichswehr.
10. 12 1919 - Der Verein kommunistischer Sozialisten wird gegründet
München * In München wird der Verein kommunistischer Sozialisten gegründet.
15. 12 1919 - Alois Lindner zu 14 Jahre Zuchthaus verurteilt
München * Das Volksgericht München verurteilt Alois Lindner zu einer Zuchthausstrafe von 14 Jahren. Er hat am 21. Februar 1919 bei einem Attentat im Bayerischen Landtag
- den Innenminister Erhard Auer [SPD] durch Pistolenschüsse schwer verletzt.
- In den Auseinandersetzungen wird der BVP-Abgeordnete Heinrich Osel und Major Paul Ritter von Jahreiß getötet.
Für die Dauer von fünf Jahren erkennt man ihm wegen niederer Gesinnung die bürgerlichen Ehrenrechte ab.
21. 12 1919 - Karl Valentin bekommt einen Waffenschein
München * Karl Valentins Gesuch um Ausstellung eines Waffenscheins wird von der Polizeidirektion genehmigt.
1920 - Das Geschäftsfeld der Firma Münchner Möbelheim, vormals Falk & Fey
München * Die Firma Münchner Möbelheim, vormals Falk & Fey betätigt sich mit der „Einrichtung von Wohnungen nach eigenen Entwürfen, Handel und Kommissionshandel von Waren aller Art insbesondere Antiquitäten und Kunstgegenständen, außerdem Übernahme von Versteigerungen“.
1920 - Der Stummfilm „Der Kinematograph“ mit Karl Valentin wird gedreht
München * Der Stummfilm „Der Kinematograph“ mit Karl Valentin, August Junker und Alois Hönle in den Hauptrollen wird gedreht.
Der Film ist verschollen.
1920 - Die Stadtgemeinde erwirbt das Anwesen des „Salzburger Hofes
München-Haidhausen * Die Stadtgemeinde erwirbt das Anwesen des „Salzburger Hofes" an der Rosenheimer Straße 1.
1920 - Die „Drahtfabrik Bucher“ ist technologisch auf dem neuesten Stand
München-Au * Die „Drahtfabrik Bucher“ wird technologisch auf den neuesten Stand gebracht.
1920 - Der „Deutsche und österreichische Alpenverein“ triftet nach rechts ab
Wien * Eduard Pichl, studierter „Chemiker“ und „Hofrat“ in Wien, der „Vater der Bergwarte“ und Schwärmer für ein „germanisches Christentum“, gibt seinen Beruf auf, um sich fortan als hauptamtlicher Funktionär des „Deutschen und österreichischen Alpenvereins“ der „völkischen Propaganda“ zu widmen.
Innerhalb kürzester Zeit gewinnen seine Sympathisanten die Oberhand in 45 „Sektionen“, die sich als „Deutsch-Völkischer Bund im DuOeAV“ zusammenschließen und mit ihrer Mehrheit Abstimmungsprozesse an den Vollversammlungen vorbei in ihnen genehme Ausschüsse umleiten.
1920 - Die „Bayerische Staatsbahn“ wird vom Reich übernommen
Berlin * Die „Bayerische Staatsbahn“ wird vom Reich übernommen.
Ihr Streckennetz umfasst mehr als 8.500 Kilometer, auf dem etwa 2.400 Lokomotiven, 5.000 Personen- und 64.000 Güterwaggons bewegt werden.
Nach 1920 - Die „Deutsche Eiche“ entwickelt sich zum Schwulenlokal
München-Isarvorstadt * Die „Deutsche Eiche“ entwickelt sich zum Lieblingslokal von Künstlern und Homosexuellen.
Vor allem Tänzer des benachbarten „Gärtnerplatz-Theaters“ verkehren hier.
1920 - Der „Evangelische Verein für München-Giesing“ wird gegründet
München-Obergiesing * Der „Evangelische Verein für München-Giesing“ wird gegründet.
Er tagt im „Cafe-Restaurant Giesing“, der späteren „Bergstube“, dem heutigen „Cafe Giesing“.
1920 - Hans Gruß wird neuer Leiter des „Deutschen Theaters“
München-Ludwigsvorstadt * Hans Gruß wird neuer Leiter des „Deutschen Theaters“.
1920 - Gustl Annast übernimmt das „Hofgarten-Café“
München-Graggenau * Der aus Salzburg stammende Gustl Annast übernimmt gemeinsam mit seiner Frau das „Hofgarten-Café“.
1920 - Das Bayerische Volksschulgesetz führt das Zölibat wieder ein
München * Das Bayerische Volksschulgesetz führt die Unvereinbarkeit zwischen Ehe und Lehrberuf, also das Zölibat für Lehrerinnen, wieder ein.
1920 - Ganz langsam geht es wieder aufwärts mit dem Vereinsleben
Gronsdorf * Ganz langsam geht es wieder aufwärts mit dem Vereinsleben des „TSV München-Ost“.
Und auf dem „Waldsportplatz“ in Gronsdorf erblüht zaghaft neues Leben, sodass der „TSV München-Ost“ im Jahr 1920 bereits wieder 1.088 Mitglieder zählt.
Auch erste größere sportliche Erfolge stellten sich wieder ein.
Gleichzeitig erlebte das Spiel mit dem Fußball nach dem verlorenen Weltkrieg und der alles verändernden Revolution im Rahmen des Arbeitersports ihren ersten großen Aufschwung.
1920 - 45,6 Prozent der Münchner sind Mitglied in einer Konsumgenossenschaft
München * 45,6 Prozent der Münchner Einwohner versorgen sich als Mitglied mit Waren aus den Konsumgenossenschaften.
Um 1920 - Telefonleitungen sind teuer und die Nachfrage steigt überdimensional an
München * Da die Telefonleitungen teuer sind und die Nachfrage überdimensional ansteigt, wird auf die Frauen an der Telefonvermittlung ein entsprechender Leistungsdruck ausgeübt.
Dreihundert Gespräche pro Stunde werden zum Durchschnitt erklärt.
1920 - Die Münchner „Residenz“ wird zum „Residenzmuseum“
München-Graggenau * Die Münchner „Residenz“ wird als „Residenzmuseum“ der Allgemeinheit für Besichtigungen zugänglich gemacht.
5. 1 1920 - Soll die Deutsche Arbeiterpartei Loge oder Kampfpartei sein?
München * Karl Harrer verlässt die Deutsche Arbeiterpartei - DAP, in der er als Reichsvorsitzender über eineinviertel Jahre amtiert hat. Er scheitert an der von Adolf Hitler angestoßenen Diskussion, ob die Deutsche Arbeiterpartei - DAP eine „Loge oder Kampfpartei“ sein soll.
Hitler verlangt für den damals noch nach demokratischen Regeln tätigen DAP-Arbeitsausschuss eine straffere Organisation und eine gewisse Autorität, was „jede Form einer Bevormundung [durch eine] Über- oder Nebenregierung, sei es als Zirkel oder Loge, ein für allemal“ ausschließt.
8. 1 1920 - Gründungsfeier des Volksbundes für Kunst und Theater
München-Kreuzviertel * Im Konzertsaal des Hotels Bayerischer Hof findet die offizielle Gründungsfeier des Volksbundes für Kunst und Theater statt. Der antisemitisch gesinnte Komponist Hans Pfitzner spielt Klavier. Die Initiatoren des Verbandes rufen auf
- zum Aufbau eines neuen Deutschlands und beschwört
- die Wiedererweckung geistiger Werte in einer Zeit materialistischer Kultur,
- die Volksseele muss veredelt werden „für eine neue größere Zukunft“.
Alles Schlagworte aus dem Repertoire völkischer Ideologen, die sich gegen die künstlerische Moderne und die Weimarer Demokratie richten. Damit will der Volksbund „alle christlichen Volksteile Münchens“ erreichen, um sie letztlich „von der Diktatur des Cliquenwesens und der Tagesmode“ zu befreien.
10. 1 1920 - Der Versailler Vertrag tritt in Kraft
Deutsches Reich * Der Versailler Vertrag tritt in Kraft. Der Vertrag weist Deutschland und seinen Verbündeten die alleinige Rolle des Aggressors im Ersten Weltkrieg zu.
- Das Deutsche Reich wird finanziell für die Schäden an Land und Menschen haftbar gemacht. Hohe Reparationsforderungen sind die Folge.
- Dazu umfangreiche Gebietsabtretungen und
- eine militärische Abrüstung durch die Reduzierung der Berufsarmee auf maximal 100.000 Mann einschließlich höchstens 4.000 Offiziere und eine Marine mit 15.000 Mann.
- Dazu kommen Vorschriften zur Ausstattung der Wehrmacht.
13. 1 1920 - 42 Tote bei Demonstration gegen das Betriebsrätegesetz
Berlin * Etwa 100.000 Menschen protestieren vor dem Reichstagsbäude gegen das Betriebsrätegesetz, das in zweiter Lesung diskutiert wird. Nach Handgreiflichkeiten schließt die preußische Sicherheitspolizei in die Menge. 42 Demonstranten sterben, 105 werden verletzt.
15. 1 1920 - Der Prozess gegen Graf Anton von Arco auf Valley beginnt
München * Aufgrund seiner Schussverletzungen beginnt der Prozess gegen Graf Anton von Arco auf Valley erst jetzt im Münchner Justizpalast. Der Gerichtspsychiater Professor Rüdin beschreibt Arco als „eine intellektuell mäßige, gerade noch durchschnittliche Begabung, eine unreife, ungefestigte Persönlichkeit, die zu impulsivem Handeln neigt“.
16. 1 1920 - Graf Anton von Arco auf Valley zum Tode verurteilt
München * Da sich die Richter und der Verteidiger über die Wertung der Tat im Grunde einig sind, ergeht das Urteil gegen Graf Anton von Arco auf Valley bereits um 16.08 Uhr. Es wird vom Landgerichtsdirektor Georg Neithardt gesprochen und lautet:
- „[...] wegen eines Verbrechens des Mordes zum Tode und in die Kosten verurteilt.“
- Es lässt sich einfach nicht umgehen anzuführen: „Der Angeklagte führte die Tötung nach einem wohlbedachten Plan mit Überlegung aus.“
Die Justiz öffnet sich aber gleich selbst die Tür für ihr weiteres Vorgehen. Am Ende des Urteils stehen die bemerkenswerten Zeilen: „Von einer Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte konnte natürlich keine Rede sein, weil die Handlungsweise des jungen, politisch unmündigen Mannes nicht niedriger Gesinnung, sondern der glühenden Liebe zu seinem Volke und seinem Vaterland entsprang und ein Ausfluss seines Draufgängertums und der in weiten Volkskreisen herrschenden Empörung gegen Eisner war, weil ferner der Angeklagte seine Tat in allen ihren Einzelheiten ohne jeden Versuch der Beschönigung oder Verschleierung mit offenem, edlem Mute in achtungsgebietender Weise als aufrechte Persönlichkeit eingestand.“
Graf Arco nimmt sein Todesurteil mit vollkommener Ruhe zur Kenntnis und ruft in seinem Schlusswort die Zuhörer zum Aufbau einer nationalen Zukunft auf. Stürmischer Beifall erhebt sich im Sitzungssaal.
16. 1 1920 - Freispruch für Anton Graf Arco auf Valley gefordert
München * In der Stadt finden zahlreiche Kundgebungen statt, auf denen zumeist Studenten unter schwarz-weiß-roten Fahnen einen Freispruch Arcos fordern. Es drohen antisemitische Ausschreitungen, bis der Verteidiger Arcos die Gemüter mit der Ankündigung beruhigen kann, dass begründete Aussicht auf Begnadigung des Verurteilten besteht.
17. 1 1920 - Der Eisner-Mörder wird zu lebenslanger Festungshaft begnadigt
München * Der mehrheitlich konservative Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen, um die Begnadigung des Mörders Graf Anton von Arco auf Valley zu beschließen. Der Beschluss erfolgt in Abwesenheit des Ministerpräsidenten und Eisner-Nachfolgers Johannes Hoffmann, eines königlich-bayerischen Sozialdemokraten, der nicht ohne Unverständnis für die Tat ist. In der Sitzung äußert Justizminister Ernst Müller-Meiningen den aufschlussreichen Satz: „Ich würde mich vor meinen Kindern schämen, einen Mann wie Arco ins Zuchthaus zu schicken.“
Da eine Zuchthausstrafe als die schärfste Haftart angesehen wird, begnadigt man den Grafen Arco zu einer lebenslangen Festungshaft, der komfortabelsten Art des Freiheitsentzugs, die gleichzeitig als ehrenvoll gilt. Bei dieser Begnadigung bezieht man sich ausdrücklich auf die erst am Vortag selbst formulierte Achtungsbezeugung vor dem Mörder eines amtierenden Ministerpräsidenten. Anton Graf von Arco auf Valley tritt als erster Festungshäftling seine Luxushaft in Landsberg am Lech an.
19. 1 1920 - Die Bestimmungen der Prohibition in den USA treten in Kraft
USA * Die Bestimmungen zur Einführung der Prohibition in den USA treten in Kraft.
28. 1 1920 - Ein Attentatsversuch auf Reichsfinanzminister Matthias Erzberger
Berlin * Auf Matthias Erzberger, den Reichsminister der Finanzen, wird ein Attentat versucht, als er in Berlin-Moabit das Gerichtsgebäude verlässt. Die zwei Schüsse feuert der ehemalige Fähnrich Oltwig von Hirschfeld ab. Eine Kugel verletzt Erzberger leicht an der Schulter, die andere prallt an einem Metallgegenstand in seiner Tasche ab.
Bis 2 1920 - 5.233 Strafprozesse gegen Räterepublikaner
München * 5.233 Strafprozesse gegen Räterepublikaner werden eröffnet.
- Zehn Todesurteile werden ausgesprochen und vollzogen.
- Viele werden zu langen Haftstrafen verurteilt.
- Auf Milde dürfen sie nicht hoffen.
2. 2 1920 - Nummerierte Mitgliederlisten der Deutschen Arbeiterpartei
München * Erst ab jetzt hat die Deutsche Arbeiterpartei - DAP nummerierte Mitgliederlisten. Hitler erhält die Nummer 555, wobei man aus propagandistischen Gründen mit 501 zu zählen anfängt. Der auf Militärkosten ausgebildete Propagandamann ist innerhalb kürzester Zeit zum Parteifunktionär und Politiker geworden.
4. 2 1920 - Das Betriebsrätegesetz wird verabschiedet
Berlin * Die Nationalversammlung verabschiedet das Betriebsrätegesetz.
Die Mitwirkungsrechte der Betriebsräte sind auf soziale Belange beschränkt.
20. 2 1920 - Die DAP wird in NSDAP umbenannt
München * Die Deutsche Arbeiterpartei - DAP wird in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP umbenannt. Das Kürzel NS soll die Besonderheit der Partei hervorheben und wird von Adolf Hitler, Dietrich Eckart, Hermann Esser, Rudolf Heß, Ernst Röhm und Gottfried Feder an der Parteiführung vorbei eingeführt.
24. 2 1920 - Die erste Massenversammlung der NSDAP im Hofbräuhaus-Festsaal
München-Graggenau * Für den 24. Februar 1920 setzt Adolf Hitler gegen Bedenken von Anton Drexler die erste Massenversammlung der Deutschen Arbeiterpartei - DAP unter dem Motto „Was uns Not tut!“ an. Als Ankündigungsmittel werden rote Plakate geklebt, um die linken Arbeiterparteien zu provozieren. Veranstaltungsort ist der Festsaal des Hofbräuhauses am Platzl. Es erscheinen 2.000 Menschen.
Zusätzlich zum Redner Hitler erlebten sie erstmals auch eine vollkommen neue Art der Versammlung. Es gilt, strikte Disziplin zu wahren, die Abläufe sind klar vorgezeichnet und erstmals schützten junge Parteimitglieder und -sympathisanten den Saal vor Störungen. Aus diesem Saalschutz wird schon wenig später die SA hervorgehen.
An diesem Abend wird die Bezeichnung NSDAP von Hitler etabliert.
29. 2 1920 - Die Marinebrigade Ehrhardt soll aufgelöst werden
Berlin * Reichswehrminister Gustav Noske verfügt die Auflösung der Marinebrigade Ehrhardt. Durch den am 10. Januar in Kraft getretenen Versailler Friedensvertrag wurde
- das deutsche Heer auf 100.000 Mann sowie
- die Marine auf 15.000 Mann beschränkt.
Das bedeutet einen massiven Personalabbau der etwa 400.000 Mann starken Reichswehr. Auch die Freikorps sollen aufgelöst werden.
13. 3 1920 - Der Kapp-Putsch führt zum Rücktritt der bayerischen Regierung
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * In Berlin findet der rechtsradikale Kapp-Putsch statt. Parallel dazu fordern in München der Regierungspräsident von Oberbayern Gustav von Kahr, Polizeipräsident Ernst Pöhner und Wehrkreiskommandant Arnold von Möhl den von der SPD gestellten bayerischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann zum Rücktritt auf. </p> <p>Was in Berlin scheitert, gelingt in München. Gustav Ritter von Kahr bildet - unter Beteiligung der Bayerischen Volkspartei - BVP - eine rechtskonservative Regierung, die alle rechtsextremen Gruppierungen sowie militanten Verbände fördert und schützt. </p> <p>Ministerpräsident wird Gustav von Kahr, der zu dieser Zeit auch Adolf Hitler kennenlernt und den er als <em>„Trommler“</em> für die nationale Sache einspannen will, um mit seiner Hilfe den Kommunismus und den Marxismus abzuwehren und um die <em>„gestörte Ordnung“</em> in Deutschland wieder ins rechte Lot zu bringen. </p> <p>Die rechtsradikalen Verbände können umgekehrt von Bayern aus ihren ideellen Boden vorbereiten.<br /> Gustav von Kahr ist die Integrationsfigur all jener Kräfte in Bayern, die durch einen Staatsstreich die parlamentarische Demokratie abschaffen und die staatliche Unabhängigkeit Bayerns von Berlin vorbereiten wollen.</p>
13. 3 1920 - Der Kapp-Putsch beginnt
<p><em><strong>Berlin</strong></em> * Unter der Führung von General Walther von Lüttwitz wird - mit Unterstützung von General Erich Ludendorff - ein konterrevolutionärer Putsch gegen die nach der November-Revolution geschaffene Weimarer Republik versucht. Wolfgang Kapp, der Namensgeber des Putsches, spielt mit seiner Nationalen Vereinigung nur eine untergeordnete Rolle. Gründe für den Putsch sind</p> <ul> <li>die Republikfeindlichkeit der Anführer sowie</li> <li>die Frustration vieler früherer Soldaten, die in etwa 120 Freikorps organisiert sind und</li> <li>weil die politischen Generäle nicht gewillt sind, auf die Instrumente ihrer politischen Macht zu verzichten.</li> </ul> <p>Der Putschversuch scheitert nach 100 Stunden. </p>
16. 3 1920 - Der Antisemitismus wird gewalttätig
<p><strong><em>München</em></strong> * Der <em>Antisemitismus </em>wird gewalttätig.</p> <ul> <li>Der konservative Ministerpräsident Gustav von Kahr (BVP) kündigt in seiner ersten Regierungserklärung an, gegen die <em>„Überfremdung durch Stammesfremde“</em> einzuschreiten und erklärt die <em>„Reinhaltung des eigenen Volkes von fremden Elementen“</em> zum Gebot der Stunde. Er meint damit den besonders verhassten <em>„Teil der jüdischen Rasse“</em>, die Ostjuden.</li> <li>Münchens Polizeipräsident Ernst Pöhner hält es für nicht ausgeschlossen, wenn <em>„wegen der unerträglichen Teuerung etwas unternommen, etwa einige Juden aufgehängt würden“</em>. Gegen die gewalttätigen und gewaltbereiten Antisemiten unternimmt die Münchner Polizei allerdings nichts.</li> <li>Nun wird die Situation für die jüdischen Mitbürger unerträglich. Viele verlassen die Stadt.</li> </ul>
16. 3 1920 - Gustav Ritter von Kahr wird bayerischer Ministerpräsident
<p><em><strong>München</strong></em> * Nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch wird der evangelische Monarchist Gustav Ritter von Kahr zum Nachfolger von Johannes Hoffmann zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt.</p> <p>Kahr steht einer bürgerlichen Rechtsregierung vor und betreibt eine eigenständige Stellung Bayerns innerhalb des Deutschen Reiches. Gestützt auf seine Einwohnerwehr lässt er die Arbeiter- und Soldatenräte auflösen und begründet den Ruf Bayerns als <em>„Ordnungszelle des Reiches“</em>. </p>
20. 3 1920 - Das Gesetz über die Bauernkammern
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Landtag beschließt das Gesetz über die Bauernkammern, in dem die Bauernräte durch die Bauernkammern ersetzt und aufgehoben werden sollen. </p>
31. 3 1920 - Adolf Hitler wird vom Militärdienst entlassen
<p><em><strong>München</strong></em> * Adolf Hitler wird vom Militärdienst entlassen. Hauptmann Karl Mayr unterstützt ihn offenbar geistig-politisch als auch finanziell. Hitlers in der Münchner Revolutionszeit und Räteherrschaft radikalisierter Antisemitismus wird durch Mayr ebenfalls bestärkt. </p>
4 1920 - Der „Österreichische Touristenklub - öTK“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein
Wien * Der „Österreichische Touristenklub - öTK“ in Wien führt den „Arier-Paragraphen“ ein.
1. 4 1920 - Das Deutsche Reich über nimmt die bayerische Bahn und Post
<p><strong><em>Freistaat Bayern - Deutsches Reich</em></strong> • Das Deutsche Reich übernimmt die bayerische Eisenbahn und die Post. Die geleistete Entschädigung macht nur einen geringen Teil des Anlagewerts aus. </p>
1. 5 1920 - Ein Denkmal für die „Toten der Revolution - 1919“
München-Obergiesing * Im Rahmen der „Maifeiern“ wird im „Ostfriedhof“ von den „Münchner Freien Gewerkschaften“ der Grundstein für ein Denkmal für die „Toten der Revolution - 1919“ errichtet.
12. 5 1920 - Dr. Fritz Gerlichs Wahl zum Stadtrat ist ungültig
München * Dr. Fritz Gerlichs Wahl zum hauptamtlichen Stadtrat in München wird für ungültig erklärt.
18. 5 1920 - Karol Józef Wojtyla, der spätere Papst Johannes Paul II., wird geboren
Wadowice * Karol Józef Wojtyla, der spätere Papst Johannes Paul II., wird in Wadowice, einem kleinen polnischen Städtchen bei Krakau, geboren.
21. 5 1920 - Die Arbeiter- und Bauernräte werden abgeschafft
München * Der Bayerische Landtag beschließt das Gesetz über die Aufhebung der Arbeiterräte. Damit werden die Richtlinien für die Bauernräte vom 26. November 1918 und die Bestimmungen für die Arbeiterräte vom 17. Dezember 1918, die die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit der Bauern- und Arbeiterräte bildeten, abgeschafft.
31. 5 1920 - Die Münchner Neuesten Nachrichten werden aufgekauft
München * Ein „Konsertium von Münchner und auswärtigen Vaterlandsfreunden“ kauft Bayerns einzige weltweit beachtete Tageszeitung auf: die Münchner Neuesten Nachrichten. Die Mehrheit hält die Gutehoffnunghütte. Sie will die Zeitung für die Propagierung ihrer Ziele benutzen und macht sie zu einem „Bollwerk für nationale Erneuerung gegen Sozialismus und republikanische Politik“.
Das besondere Interesse der Redaktion gilt der Dolchstoß-Theorie, nach der das siegreiche deutsche Heer im Ersten Weltkrieg von den Umstürzlern in der Heimat zur Kapitulation gezwungen worden sein soll. Diese „Schmach“ soll durch die Wiederaufrüstung getilgt und Deutschland zu einer Weltmacht gemacht werden. Finanziert durch die deutsche Schwerindustrie und einflussreiche politische Kreise spielen die Münchner Neuesten Nachrichten eine wichtige Rolle bei der Entstehung der rechtsradikalen „Ordnungszelle Bayern“. Professor Paul Nicolaus Cossmann wird politischer Leiter der Zeitung.
6. 6 1920 - Dr. Fritz Gerlich kandidiert erfolglos zum Reichstag und zum Landtag
Freistaat Bayern - Deutsches Reich * Dr. Fritz Gerlich kandidiert erfolglos für die Deutsche Demokratische Partei - DDP bei den Wahlen zum Reichstag und zum Bayerischen Landtag.
6. 6 1920 - Towia Axelrod kann nach Petrograd ausreisen
München - Petrograd * Towia Axelrod (Tobias Akselrod) kann nach Petrograd ausreisen.
12. 6 1920 - Der dritte Geiselmordprozess beginnt
München * Der dritte Geiselmordprozess beginnt. Das Volksgericht verhängt ein Todesurteil, das zwei Tage später vollstreckt wird.
14. 6 1920 - Max Weber, der Soziologe, stirbt in München
München * Max Weber, der Soziologe, Ökonom, Jurist, Historiker und politische Analyst, stirbt in München.
Um den 15. 6 1920 - Fritz Gerlichs Buch „Der Kommunismus als Lehre vom Tausendjährigen Reich“
München * Aus zahlreichen Aufsätzen in den Süddeutschen Monatsheften, der Liberalen Korrespondenz sowie den Historisch-politischen Blättern entsteht Dr. Fritz Gerlichs Buch „Der Kommunismus als Lehre vom Tausendjährigen Reich“. Es wird im Bruckmann-Verlag verlegt. Gerlich rechnet darin den Kommunismus zu den Erlösungsreligionen und verurteilt den verbreiteten Antisemitismus.
1. 7 1920 - Fritz Gerlich wird Chefredakteur der Münchener Neuesten Nachrichten
München * Paul Nicolaus Cossmann verpflichtet den fanatischen Nationalisten und Sozialistenhasser Dr. Fritz Gerlich als Chefredakteur der Münchener Neuesten Nachrichten. Gerlich unterstützt damit indirekt Adolf Hitlers Aufstieg.
8. 7 1920 - Eine Straße und ein Platz für den Brauereigründer Joseph Schülein
München-Berg am Laim * In Berg am Laim wird eine Straße und ein Platz nach dem Brauereigründer Joseph Schülein benannt.
Seit dem 15. 7 1920 - Ludwig Thoma schreibt für den Miesbacher Anzeiger
Tegernsee * Ludwig Thoma schreibt für den Miesbacher Anzeiger antisemitische und gegen die demokratische Weimarer Republik gerichtete Artikel. Es werden bis zu Thomas Tod 167 derartiger Artikel werden.
22. 8 1920 - Erste Aufführung des „Jedermann“ in Salzburg
Salzburg • Erstmals finden die Salzburger Festspiele statt. Auf dem Domplatz wird der „Jedermann“ aufgeführt.
26. 8 1920 - Wahlrecht für Amerikanerinnen
<p><strong><em>USA</em></strong> • Die amerikanischen Frauen erhalten durch einen Verfassungszusatz das nationale Wahlrecht. </p>
5. 9 1920 - Adolf Hitler hält im Münchner-Kindl-Keller eine Rede vor 3.000 Zuhörern
München-Au * Adolf Hitler hält im Münchner-Kindl-Keller eine Rede vor 3.000 Zuhörern, in der er die Juden verurteilt, da sie hinter dem Elend Deutschlands stecken. Wenn man erst mal die Macht habe, so sagt Hitler weiter, dann „werde man den Fetzen von einem Friedensvertrag zerreißen”.
Der NSDAP-Parteivorsitzende führt aus, dass Deutschland zwar geknebelt und wehrlos ist, sich aber nicht vor einem Krieg gegen Frankreich scheuen darf. Seine Rede beendet er mit dem Schiller-Wort: „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, nicht trennen uns in Not und Gefahr“.
14. 9 1920 - Verbot von Schnapsschenken auf dem Oktoberfest beantragt
München-Theresienwiese * Der Rechtsrat Max Heiglmayer stellt im Stadtrat den Antrag, „dass die auf der Wiesn zugelassenen Schnapsschenken wegen der zahlreichen Fälle sinnloser Betrunkenheit, wodurch die Anwohner der Wiesn belästigt wurden, geschlossen werden“.
25. 9 1920 - Als Ersatz für das Oktoberfest wird ein Herbstfest durchgeführt
München-Theresienwiese * Als Ersatz für das Oktoberfest wird ein Herbstfest durchgeführt.
1. 10 1920 - Das Rettungswesen geht auf die Berufsfeuerwehr über
München * Das Rettungswesen, das von der Münchner Freiwilligen Rettungsgesellschaft und der Freiwilligen Sanitätskolonne des Roten Kreuzes betrieben wurde, geht jetzt auf die Berufsfeuerwehr über.
31. 10 1920 - Kardinal Michael von Faulhaber segnet die Wolfgangs-Pfarrkirche
München-Au * Erzbischof Michael von Faulhaber nimmt die Einsegnung der neuen Wolfgangs-Pfarrkirche an der Balanstraße in der Hochau vor.
4. 11 1920 - Erzbischof Michael von Faulhaber soll Kardinal werden
München - Vatikan * Führende Politiker der Bayerischen Volkspartei richten ein Schreiben an die Regierung des Freistaats Bayern, in dem sie sich für die Ernennung des Erzbischofs von München und Freising zum Kardinal aussprechen. Ministerpräsident Gustav von Kahr übermittelt das Schreiben nach Rom.
7. 11 1920 - Eine Gedenktafel für Kurt Eisner wird enthüllt
München-Isarvorstadt * Im Lichthof des Gewerkschaftshauses an der Pestalozzistraße wird eine Gedenktafel für Kurt Eisner enthüllt.
12 1920 - Die Einstellungsvorschriften für Telefonistinnen werden geändert
Berlin * Die Einstellungsvorschriften für Frauen im „Fernsprechdienst“ bezogen auf die Körpergröße wird geändert:
Seither können Bewerberinnen noch als geeignet angesehen werden,
- „wenn ihre Sitzhöhe, d.i. die Entfernung vom Scheitel der sitzenden Person bis zur Stuhlfläche, 81 Zentimeter und ihre Armspannweite, das ist das Maß zwischen den Spitzen der Mittelfinger bei ausgestreckten Armen, 152 Zentimeter betragen.
- Ein Weniger an Sitzhöhe kann durch ein Mehr an Armspannweite oder umgekehrt ausgeglichen werden, beide zusammen müssen aber mindestens 233 Zentimeter ausmachen“.
4. 12 1920 - Die Eberl-Faber-AG wird städtisch
München-Haidhausen * Die Eberl-Faber-Aktiengesellschaft am Gasteig, die zuletzt im Besitz der Paulaner-Salvator-Brauerei Aktiengesellschaft war, geht in das Eigentum der Landeshauptstadt München über. Sie wird unter dem Namen „Stadtkeller“ weitergeführt.
1921 - Die „Bürgerbräu AG“ fusioniert mit der „Löwenbräu AG“
München * Die „Bürgerbräu AG“ fusioniert mit der „Löwenbräu AG“.
1921 - Der Karl-Valentin-Film „Drei Stunden im Himmel“ entsteht
München * Der in diesem Jahr entstandene Karl-Valentin-Film „Drei Stunden im Himmel“ ist verschollen.
Um 1921 - Der Stummfilm „Zirkus Schnabelmann“ wird gedreht
München * Karl Valentin, Liesl Karlstadt und August Junker spielen die Hauptrollen in dem Stummfilm „Zirkus Schnabelmann“.
Der Film ist verschollen.
1921 - Der Film „Die Schönheitskonkurrenz oder: Das Urteil des Paris“ entsteht
München * Dreharbeiten zu dem Stummfilm „Die Schönheitskonkurrenz oder: Das Urteil des Paris“ mit Karl Valentin und August Junker.
Um 1921 - Karl Valentin spielt in dem Stummfilm „Der dritte Schlüssel“ einen Amtsdiener
München * Karl Valentin spielt in dem Stummfilm „Der dritte Schlüssel“ einen Amtsdiener.
Der Film ist verschollen.
1921 - Der Stummfilm „Der ‚entflohene‘ Hauptdarsteller“ entsteht
München * Der Stummfilm „Der ‚entflohene‘ Hauptdarsteller“ entsteht.
Wahrscheinlich ist das Fragment „Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Oktoberfestwiese“ diesem verschollenen Film zuzuordnen.
1921 - Die „Pharmacia M. Schmidt & Co“ erwirbt die „Betz'sche Gaststätte“
München-Bogenhausen * Der Inhaber der Chemiefirma „Pharmacia M. Schmidt & Co“ Gerhard Schmidt erwirbt das Anwesen der ehemaligen „Gaststätte und Metzgerei Betz“ an der Ismaninger Straße.
1921 - Die „Münchner-Kindl-Brauerei“ wird stillgelegt
München-Au * Die „Münchner-Kindl-Brauerei“ wird stillgelegt.
1921 - Die „Ungerer-Villa“ gehört den „Amper-Werken Elektrizität AG“
München-Maxvorstadt * Die Herrschafts-Villa an der Brienner Straße 38/40 gehört den „Amper-Werken Elektrizität AG“.
1921 - Die „Farbenfabriken, vormals Friedr. Bayer u. Co. Leverkusen“
München-Maxvorstadt * Neuer Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 3 und 5 sind die „Farbenfabriken, vormals Friedr. Bayer u. Co. Leverkusen“.
1921 - Die Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 16 und 18
München-Maxvorstadt * Die „Kaufmänner“ Paul und Siegwart Steinharten sind Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 16 und 18.
1921 - Joseph Schülein kauft das „Schlossgut Kaltenberg“ zurück
Kaltenberg * Joseph Schülein kauft das „Schlossgut Kaltenberg“, das kurzfristig in der Fusionsmasse zwischen „Löwenbräu“ und „Unionsbräu“ aufgegangen war, zurück.
1921 - Pater Rupert Mayer tritt im „Bürgerbräukeller“ ans Rednerpult
München-Haidhausen * Pater Rupert Mayer tritt bei einer NS-Veranstaltung im „Bürgerbräukeller“ ans Rednerpult, um den Anwesenden seine ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus darzulegen.
1921 - Die „Alpenvereins-Sektion München“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein
München * Die „Alpenvereins-Sektion München“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein.
1921 - Der „Österreichische Gebirgsverein - öGV“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein
Wien * Der „Österreichische Gebirgsverein - öGV“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein.
1921 - Der „Österreichische Alpenklub - öAK“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein
Wien * Der „Österreichische Alpenklub - öAK“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein.
1921 - „Carl Gabriels Lichtspiele“ in der Dachauer Straße 16
München-Maxvorstadt * „Gabriels Tonbildtheater“ in der Dachauer Straße 16 wird in „Carl Gabriels Lichtspiele“ umbenannt.
1921 - Das Ausflugslokal „Die Rosenau“ wird geschlossen
München-Milbertshofen * „Die Rosenau“, das Gartenlokal in der Schleißheimer Straße 128, wird geschlossen.
Karl Valentin wird das Gartenlokal in seinem Bühnenstück „Das Brilliantfeuerwerk oder ein Sonntag in der Rosenau“ verewigen.
1921 - Das Reichsgericht erklärt bayerischen Alleingang für verfassungswidrig
Berlin - München * Das Reichsgericht erklärt den bayerischen Alleingang der Unvereinbarkeit zwischen Ehe und Lehrberuf, also das Zölibat für Lehrerinnen, für verfassungswidrig und beendet.
Trotzdem kommt es in Bayern immer wieder zu Entlassungen verheirateter Frauen. Selbst Dienstwohnungen I. Ordnung können Lehrerinnen nicht erhalten, da sie den männlichen Lehramtsinhabern vorbehalten sind.
Ab dem Jahr 1921 - Lion Feuchtwanger arbeitet an dem Roman „Jud Süß“
München * Lion Feuchtwanger arbeitet an dem Roman „Jud Süß“.
1921 - Josephine McDonald heiratet Willie Baker
<p><strong><em>USA</em></strong> * Josephine McDonald heiratet fünfzehnjährig den Zugbegleiter Willie Baker, dessen Nachnamen sie zeitlebens behält. Auch diese Ehe hält nicht lange. </p>
5. 1 1921 - Fusion zwischen der Löwenbräu AG und der Unionsbrauerei
München * Die Aktionäre der Löwenbräu AG stimmen der Fusion mit der Unionsbrauerei rückwirkend zum 1. Oktober 1919 zu. Obwohl Friedrich Ritter von Mildner offiziell den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, leitet dennoch Dr. Hermann Schülein das Großunternehmen.
29. 1 1921 - Deutsche Reparationszahlungen auf 226 Milliarden Goldmark festgelegt
Paris * Die Alliierten setzen die deutschen Reparationszahlungen auf 226 Milliarden Goldmark fest, gestreckt auf 42 Jahre.
2 1921 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt gastieren im „Monachia“
München-Hackenviertel * Karl Valentin und Liesl Karlstadt gastieren bis Ende Januar 1922 im „Monachia“ am Karlstor.
2 1921 - Evangelischer Sonntagsgottesdienst im Turnsaal der Kolumbusschule
München-Au * Bis zur Fertigstellung der „Martin-Luther-Kirche“ kann auch im Turnsaal der „Kolumbusschule“ der evangelische Sonntagsgottesdienst abgehalten werden.
7. 3 1921 - Michael von Faulhaber wird zum Kardinal erhoben
Vatikan * Michael von Faulhaber, der Erzbischof von München-Freising, wird durch Papst Benedikt XV. in Rom in das Kardinalskollegium aufgenommen.
20. 3 1921 - Kardinal Michael von Faulhaber wieder in München
<p><strong><em>Vatikan - München</em></strong> * Der frisch ernannte Kardinal Michael von Faulhaber kommt in seine Erzdiözese zurück und wird von zahlreichen Gläubigen, Persönlichkeiten und Studentenverbindungen empfangen.</p>
4 1921 - Die ausgeschlossenen Juden gründen die „Sektion Donauland“
Wien * Die von ihren „arisierten“ Sektionen ausgeschlossenen Juden gründen die „Sektion Donauland“.
Dieser gehören bald 4.000 Mitglieder an, von denen ein Fünftel Nicht-Juden sind und aus Solidarität beitreten.
4 1921 - Josephine Baker erstmals am Broadway
<p><strong><em>New York</em></strong> * Mit <em>„Shuffle Along“</em> wird das erste erfolgreiche afroamerikanische Musical am Broadway aufgeführt. Nach mehreren Versuchen schafft Josephine Baker die Aufnahme in das Ensemble. </p> <p>Gleich am ersten Abend tanzt sie - zum Ärger ihrer Kolleg*innen - aus der Reihe und improvisiert eine clowneske Tanznummer. Der Manager will ihr umgehend kündigen, doch der Komponist hält ihn davon ab. Und tatsächlich erreicht es Josephine, in fast allen Kritiken positiv erwähnt zu werden. So wird ihr die Aufmerksamkeit zuteil, die sie schon immer gesucht hat. </p>
8. 4 1921 - Ludwig Thoma hetzt im viel gelesenen Miesbacher Anzeiger
<p><strong><em>München</em></strong> * Welche antisemitische Stimmung in Bayern weit verbreitet ist, zeigt ein Beitrag des Schriftstellers Ludwig Thoma, den er anonym im viel gelesenen <em>„Miesbacher Anzeiger“</em> drucken lässt: </p> <p><em>„In München haben wir mit der Hinrichtung des Eisner den Nachweis geliefert, dass es uns nicht an Temperament fehlt. [...] Immerhin waren dies nur Vorspiele zu größeren Kuren, die wir uns gelobt haben für den Fall, dass sich die Beschnittenen bei uns noch einmal mausig machen. Dann geht‘s in die Vollen.“</em></p>
11. 4 1921 - Die Ex-Kaiserin Auguste Viktoria stirbt in Doorn
<p><em><strong>Doorn</strong></em> * Die Ex-Kaiserin und Ex-Preußenkönigin Auguste Viktoria, die Ehefrau von Ex-Kaiser Wilhelm II., stirbt im holländischen Doorn. </p>
27. 4 1921 - Deutsche Reparationszahlungen auf 132 Milliarden gesenkt
Paris * Die alliierte Reparationskommission modifiziert die Zahlungsforderungen:
Das Deutsche Reich soll 132 Milliarden Goldmark in 66 Jahresraten zahlen.
29. 4 1921 - Edgar Jaffé stirbt in München
München * Edgar Jaffé stirbt in München.
13. 5 1921 - Hugo Alois von Maffei stirbt
München * Hugo Alois von Maffei stirbt. Bis zuletzt ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank.
Um 6 1921 - Die „Sektion Donauland“ wird mit einer Stimme Mehrheit genehmigt
Wien * Die „Sektion Donauland“ wird gegen die mehrheitliche ablehnende Haltung der „Wiener Sektionen“ vom „Hauptausschuss des DuOeAV“ mit einer Stimme Mehrheit genehmigt.
9. 6 1921 - Karl Gareis wird von echtsradikalen ermordet
München * Der USPD- und Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag Karl Gareis wird nach einem Vortrag im Mathäserbräu zum Thema Säkularisierung der Schule vor seinem Wohnort in München von Rechtsradikalen ermordet. Als verantwortlich für diesen Mord gilt die Organisation Consul.
23. 7 1921 - Heinrich Ritter von Frauendorfer stirbt durch Selbstmord
Geiselgasteig * Heinrich Ritter von Frauendorfer stirbt durch Selbstmord in Geiselgasteig.
27. 7 1921 - General Erich Ludendorff besucht Ludwig Thoma auf der Tuften
Tegernsee * Der Weltkriegs-General Erich Ludendorff besucht Ludwig Thoma auf der Tuften 12.
6. 8 1921 - Ludwig Thoma wird an seinem Magenkrebs operiert
München * Ludwig Thoma wird an seinem Magenkrebs operiert.
18. 8 1921 - Im Miesbacher Anzeiger erscheint der letzte Hassartikel von Ludwig Thoma
Miesbach * Im Miesbacher Anzeiger erscheint der letzte antisemitische und antidemokratische Hassartikel von Ludwig Thoma.
26. 8 1921 - Matthias Erzberger wird im Schwarzwald ermordet
Bad Griesbach im Schwarzwald * Der ehemalige Reichsminister der Finanzen, Matthias Erzberger, wird in Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet. Die Attentäter sind Heinrich Tillessen und Heinrich Schütz, die der rechten Organisation Consul, dem Freikorps Oberland und dem Germanenorden angehören. Den Auftrag zu diesem politischen Fememord gab ihnen der Kapitänleutnant Manfred von Killinger im Monat des Anschlags.
26. 8 1921 - Ludwig Thoma stirbt in seinem Haus Tuften 12
Tegernsee * Ludwig Thoma stirbt in seinem Haus Tuften 12.
29. 8 1921 - Ludwig Thoma wird am Friedhof in Egern beerdigt
Rottach-Egern * Ludwig Thoma wird am Friedhof in Egern beerdigt. Sein Grabnachbar ist Ludwig Ganghofer.
29. 8 1921 - Eine Republikschutz-Verordnung wird erlassen
Berlin * Nach der Ermordung des bayerischen USPD-Vorsitzenden Karl Gareis am 9. Juni und dem tödlichen Anschlag auf den Reichsminister der Finanzen, Matthias Erzberger, am 26. August erlässt Reichspräsident Friedrich Ebert eine Republikschutz-Verordnung zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
12. 9 1921 - Ministerpräsident Gustav von Kahr tritt aus Protest zurück
München * Gustav Ritter von Kahr tritt aus Protest als Ministerpräsident zurück und übernimmt seinen früheren Posten als Regierungspräsident von Oberbayern wieder. Der Grund für seinen Protest ist die am 29. August erlassene Republikschutz-Verordnung, die im Anschluss an die Ermordung von Matthias Erzberger erlassen worden war. Dadurch kann Kahr die Auflösung der Einwohnerwehr nicht verhindern.
28. 9 1921 - Generalleutnant Otto Hermann von Lossow übernimmt die 7. Division
München * Generalleutnant Otto Hermann von Lossow übernimmt die Befehlsgewalt über die in Bayern stationierte 7. Division.
28. 9 1921 - Eine zweite Republikschutz-Verordnung wird erlassen
Berlin * Eine zweite, erweiterte Republikschutz-Verordnung wird erlassen.
10 1921 - In der „Sektion Austria des DuOeAV“ gilt der „Arier-Grundsatz“
Wien * In der „Sektion Austria des DuOeAV“ wird mit 98 Protent aller abgegebenen Stimmen der „Arier-Grundsatz“ durchgesetzt.
2. 10 1921 - Karl Valentin betreibt die von ihm entwickelte Froschbahn
München-Theresienwiese * Auf dem Münchner Oktoberfest betreibt Karl Valentin die von ihm entwickelte Froschbahn.
Ab 2. 10 1921 - Franz Halmanseger, der Rekommandeur vor dem Hippodrom
München-Theresienwiese * Franz Halmanseger, Dienstmann am Münchner Hauptbahnhof, spielt bis zu seinem Tod im Jahr 1962 den Rekommandeur - heute würde man sagen Animateur vor dem Hippodrom.
Er ist die Personifikation des Herrenreiters. Im roten Rock, weißen Breeches, schwarzen Stiefeln und gebürstetem Zylinder, die Chrysantheme im Knopfloch, das Monokel am Auge, das Gesicht blasiert erstarrt, wippt er elegant mit seiner Reitpeitsche und deutete mit kaum merklichem Schulterzucken und Kniefedern den Rhythmus von Trab und Galopp an.
2. 10 1921 - 13 Ochsen werden in der Ochsenbraterei gebraten
München-Theresienwiese * 13 Ochsen werden bis zum Wiesn-Ende in der Ochsenbraterei gebraten.
2. 10 1921 - Das erste Nachkriegs-Oktoberfestes beginnt im Oktober
München-Theresienwiese * Der Beginn des ersten Nachkriegs-Oktoberfestes wird auf den ersten Sonntag im Oktober festgelegt.
18. 10 1921 - Ex-König Ludwig III. stirbt in seinem ungarischen Exil Sárvár
Sárvár * Der abgesetzte König Ludwig III. stirbt in seinem ungarischen Exil Sárvár an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Tod und die Rückkehr der sterblichen Hülle des alten Königs wird von ultrakonservativen Kreisen zur politischen Demonstration hochstilisiert. Da für die Bayerische Staatsregierung ein Staatsbegräbnis nicht in Frage kommt, stellt sich Gustav von Kahr als Privatperson für die Organisation der Feierlichkeiten zur Verfügung.
Kahr verfolgt zielgerichtet sein Anliegen, bei den Trauerzeremonien die „Kraft des monarchischen Gedankens“ herauszustellen. Die geplanten Beisetzungsfeierlichkeiten für den abgesetzten König sollen eine Antwort auf den Trauerzug für den Revolutionär Kurt Eisner werden, der sich am 26. Februar 1919 mit nahezu 100.000 Menschen durch die Straßen Münchens bewegt hatte. Es sollte eine „Trauerfeier werden, wie sie München und Deutschland noch nie gesehen haben, ein Akt treuer Huldigung, aber auch Abbitte für das dem König angetane große Unrecht“.
5. 11 1921 - Trauerzeremonie für das Königspaar
München * Von der Ludwigskirche aus führt der Weg des Trauerzugs für das tote Ex-Königspaar - über den Karolinenplatz und Königsplatz - zur Frauenkirche. Am Trauerzug beteiligen sich 40.000 Personen, darunter eine große Anzahl staatlicher Beamte und Angestellte, die eigens aus den acht Regierungsbezirken herangekarrt worden sind.
Der Trauerzug vermittelt den Eindruck, als wären die alten Zeiten wieder zurückgekehrt und als hätte sich seit der Thronbesteigung Ludwigs III. im Jahr 1912 nichts entscheidendes geändert. Der Prunk-Leichenwagen des Ex-Königs und der Wagen mit dem Sarg der Ex-Königin werden jeweils von sechs Pferden gezogen, die mit schwarzen, mit Kronen geschmückten Schabracken bedeckt sind. Zehntausende Zuschauer säumen den Weg.
Da Münchens SPD-Bürgermeister Eduard Schmid verfügt hat, dass „die städtischen Ämter und Betriebe am Tag der Beisetzung grundsätzlich in vollem Umfange arbeiten“ müssen, müssen städtische Beamte für die Teilnahme am Trauerzug eigens einen Urlaubstag opfern.
5. 11 1921 - Kardinal Faulhaber rechnet mit der Revolution ab
München-Kreuzviertel * Die Kirche - allen voran Kardinal Michael von Faulhaber - fühlt sich aufgefordert mit der Revolution abzurechnen. Der hohe katholische Kleriker steht als Garant für das Gottesgnadentum der angestammten Herrscher und für eine auf das christliche Herrschaftsverständnis gegründete Regierung.
In seiner Trauerrede sagt Kardinal Faulhaber in Anspielung auf die Hunger- und Friedensdemonstrationen vor und die revolutionären Veranstaltungen nach Kriegsende, besonders aber auf die Beisetzungsfeierlichkeiten für den ermordeten ersten demokratischen bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner: „Die heutige Trauerfeier hebt sich durch die kirchliche Weihe himmelhoch hinauf über alles Trauertheater, das auf dem Straßenpflaster von München jemals gewesen ist.“ Ausführlich hebt Faulhaber hervor, dass Ludwig III. „kein König von Volkes Gnaden“, sondern ein „König von Gottes Gnaden“ gewesen sei.
Der monarchistische und antidemokratische Kirchenvertreter verurteilt die Revolution, indem er sagt: „Könige von Volkes Gnaden sind keine Gnade für das Volk, und wo das Volk sein eigener König ist, wird es über kurz oder lang sein eigener Totengräber“. Dieser Satz lässt den Kardinal am Ende des Zweiten Weltkrieges prophetisch erscheinen. Ein größerer zeitlicher Abstand zeigt aber die Untauglichkeit solcher Ängste erzeugender Geschichtsverklärungen.
5. 11 1921 - Anspruch der Wittelsbacher auf die bayerische Krone
München-Kreuzviertel * Bei seiner Traueransprache erneuert der erstgeborene Sohn Ludwigs III., Ex-Kronprinz Rupprecht von Bayern, den Anspruch der Wittelsbacher auf die bayerische Krone.
Doch die Befürchtungen der konservativen bayerischen Staatsregierung, dass die Trauerzeremonie mit der Proklamation Rupprechts zum neuen König von Bayern enden würde, erfüllen sich nicht, da sowohl der Ex-Kronprinz als auch der Regierungspräsident Gustav von Kahr den Zeitpunkt für noch nicht geeignet halten.
Um den 15. 11 1921 - Das Café Prinzregent wird geschlossen
München-Lehel * Das Café Prinzregent, das zu den schönsten und vornehmsten Münchner Kaffee-Gaststätten zählte, wird geschlossen. Seine Räume werden in eine Bank umgewandelt.
1. 12 1921 - Die Jesuiten übernehmen die Seelsorge in Sankt Michael
München-Kreuzviertel * Die Jesuiten übernehmen wieder die Seelsorge in Sankt Michael. Pater Rupert Mayer wirkt dort als Prediger, Caritasapostel und Beichtvater.
16. 12 1921 - Der Reichstag hebt die Republikschutz-Verordnungen wieder auf
Berlin * Der Reichstag hebt die Republikschutz-Verordnungen vom 29. August und 28. September wieder auf.
Um 1922 - Der Valentin-Stummfilm „Die harten Köpfe“ entsteht
München * Der Valentin-Stummfilm „Die harten Köpfe“ entsteht.
Er ist verschollen.
1922 - Karl Valentins Stummfilm „Verfilmte Anekdoten“ entsteht
München * Karl Valentins Stummfilm „Verfilmte Anekdoten“ entsteht.
Er ist verschollen.
1922 - Liesl Karlstadt bringt die Idee zum „Firmling“ aus einem Zigarrenladen mit
München * Liesl Karlstadt bringt die Idee zum „Firmling“ aus einem Zigarrenladen mit, in dem ein Mann aus Begeisterung über den Firmanzug seines Sohnes immer wieder auf die Theke schlägt und laut ausruft: „Der Bua probiert den Anzug - und stellen S‘Eahna vor - passt hat er!“
1922 - Die „Firma Falk & Fey“ wird eine Aktiengesellschaft
München-Neuhausen * Umfirmierung der ehemaligen „Firma Falk & Fey“ in eine Aktiengesellschaft unter dem Namen „Transhand Transport- und Handels AG, vormals Falk & Fey“.
1922 - Ein- und Zweifamilienhäuser mit mehr lebendem als totem Inventar
München * Der „Lustige Führer durch München“ bezeichnet die „Herbergen“ als „Ein- und Zweifamilienhäuser mit mehr lebendem als totem Inventar.
Der Haustürschlüssel wird in der Dachrinne aufbewahrt.
Viel Kleintier- und Kleinkinderzucht“.
1922 - Die „Cenovis-Werke“ betreiben die größte „Hefeverwertungsanlage“
München-Au * Die „Cenovis-Werke“ betreiben die größte „Hefeverwertungsanlage“ Deutschlands.
Sie übernehmen auch den „Saalbau“ der ehemaligen „Münchner-Kindl-Brauerei“ in der Rosenheimer Straße.
1922 - Der „Franziskaner-Leistbräu“ fusioniert mit der „Spatenbrauerei“
München-Au * Die „Brauerei zum Franziskaner-Leistbräu“ fusioniert mit der „Spatenbrauerei“, die im Besitz der anderen Sedlmayer-Familienlinie ist.
Die Brauerei wird als „Gabriel und Josef Sedlmayer Spaten-Franziskaner-Leistbräu AG“ weitergeführt.
1922 - Der „Arier-Paragraph“ gilt im „österreichischen Touristenklub - öTK“
Wien * Der „Arier-Paragraph“ gilt im Gesamtbereich des „österreichischen Touristenklubs - öTK“.
1922 - Die „Akademische Sektion Dresden“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein
Dresden * Die „Akademische Sektion Dresden des DuOeAV“ führt den „Arier-Paragraphen“ ein.
Um 1922 - Das Ende der Untergiesinger Lederfabrik zeichnet sich ab
München-Untergiesing * In den 1920er Jahren zeichnet sich das Ende der Lederfabrik ab, nachdem zuvor die „Aufrüstung“ und der Erste Weltkrieg noch für volle Auftragsbücher gesorgt hat.
1922 - Eine Beschreibung des „sprichwörtlichen Giesingers“
<p><strong><em>München-Giesing</em></strong> * Der München-Führer <em>„Rund um die Frauentürme“</em> beschreibt den <em>„sprichwörtlichen Giesinger“</em> so:</p> <p><em>„Hochgelegen, gesunde Luft, gesunde oder auch runde Bevölkerung. Im allgemeinen wie jeder Münchner gutmütig, ist der Giesinger in gereiztem Zustand in einer ziemlich gefährlichen Körper- und Geistestesverfassung. Die Giesinger sind in der Regel nicht in politisch konservativen Parteien zu suchen, sondern von Natur aus revolutionär“</em>.</p> <p>In Giesing wohnen viele Arbeiter mit entsprechend ausgeprägtem Klassenbewusstein. Weit über sechzig Prozent wählen <em>„rote Parteien“</em>. Demzufolge sind die Nazis lange Jahre hier völlig chancenlos.</p>
1922 - Adolf Hitler und der „sprichwörtliche Giesinger“
Berlin - Wien - Giesing * Adolf Hitler sagt: „Den widerwärtigen italienischen Typ - den haben wir auch. Wenn ich denke, Wien-Ottakring, München-Giesing, Berlin-Pankow!
Vergleiche ich den unangenehmen südlichen Typ mit dem unangenehmen Typen bei uns, so ist schwer zu sagen, welcher unsympathischer ist“.
1922 - Peter Kräuter wird „musikalischer Leiter“ des „Deutschen Theaters“
München-Ludwigsvorstadt * Peter Kreuder, der Schlager- und Filmkomponist, der auch das Lied „Ich wollt‘, ich wär‘ ein Huhn“ komponiert hat, wird zum „musikalischen Leiter“ des „Deutschen Theaters“.
Im Jahr 1922 - Die Konsumvereine produzierten billiger und sauberer
München-Au * Der „Konsumverein München von 1864“ erwirbt noch das Grundstück Auerfeldstraße 26.
Dort entsteht eine Bäckerei mit Feinbäckerei und Nudelfabrikation.
Mit der Verlegung sämtlicher zentraler Einrichtungen in die Auerfeldstraße gelang dem „Konsumverein von 1864“ nach der Jahrhundertwende zwar der Durchbruch, mit den Sendlingern kann er aber nicht mithalten.
Die Genossenschaften gehen bald zur Eigenproduktion über.
Im Fabrikgebäude in der Auerfeldstraße befinden sich eine eigene Bäckerei, eine Kaffeebrennerei und eine Dampfspalterei für Brennholz sowie das Hauptlager für die zahlreichen Filialen.
In München stellte die Genossenschaft Brot her.
Die meisten anderen Waren beziehen sie aus den Zweigwerken der Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine.
Die Bäcker bekommen die Konkurrenz der Brotindustrie massiv zu spüren.
Um ein ganzes Viertel unterbieten der Auer und der Sendlinger Konsumverein die Preise der Münchner Bäcker.
Ihr Brot und ihre Semmeln vertreiben die Verbrauchsgenossenschaften in Filialen in der ganzen Stadt.
Doch die Konsumvereine produzierten nicht nur billiger, sondern auch noch sauberer als die kleinen Bäcker.
Sie bieten ihren Beschäftigten außerdem höheren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen.
Dadurch entwickelten sich die Konsumvereine schnell zur Zielscheibe von Kleinhandel und Handwerk.
Die Mittelständler fordern vom Gesetzgeber Maßnahmen, um die neuen Formen des Großhandels [hierzu gehören auch die Waren- bzw. die Kaufhäuser] an ihrem Siegeszug zu hindern.
Ab dem Jahr 1922 - In München telefoniert man nur noch mit Selbstwahl
München * In München telefoniert man nur noch mit Selbstwahl.
Ab dem Jahr 1922 - Lion Feuchtwanger arbeitet an dem Roman „Die häßliche Herzogin“
München * Lion Feuchtwanger arbeitet an dem Roman „Die häßliche Herzogin“.
1. 2 1922 - Das Komikerpaar Valentin-Karlstadt tritt im Germania-Brettl auf
München-Ludwigsvorstadt * Das Komikerpaar Valentin-Karlstadt tritt bis 15. August im Germania-Brettl in der Schwanthalerstraße auf.
10. 2 1922 - Stucks Tochter Mary wird Alleinerbin
München-Haidhausen * Franz von Stucks Tochter Mary wird in seinem Testament als Alleinerbin eingesetzt. Seine Frau Mary soll eine Leibrente von jährlich 100.000 Mark erhalten.
26. 5 1922 - Der Ministerrat befasst sich erstmals mit der Fürstenabfindung
München-Kreuzviertel * Der Entwurf der Fürstenabfindung wird dem Ministerrat vorgelegt.
14. 6 1922 - Verhandlungen über den Wittelsbacher Ausgleichfonds
München-Kreuzviertel * Der Ministerrat befasst sich mit der Fürstenabfindung. Die ausgehandelten Vermögenswerte sollen in einem Wittelsbacher Ausgleichsfonds, einer Stiftung des öffentlichen Rechts, eingebracht werden.
24. 6 1922 - Reichsaußenminister Walther Rathenau wird ermordet
Berlin * Reichsaußenminister Walther Rathenau wird von der Organisation Consul in Berlin ermordet.
24. 6 1922 - Verabschiedung der Fürstenabfindung im Landtag vertagt
München-Kreuzviertel * Die ursprünglich geplante Verabschiedung der Fürstenabfindung im Landtag wird wegen der Ermordung des Außenministers Walther Rathenau verschoben. Das Finanzministerium fürchtet um die erforderliche Mehrheit im Landtag. Die Delegationen nutzen die Zwangspause zu Vertragsveränderungen. Nun werden neben dem Kunstbesitz auch die ehemaligen kurfürstlichen Kunstsammlungen mit einbezogen. Dazu wird die „Wittelsbachische Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft“ geschaffen.
26. 6 1922 - Reichspräsident Ebert erlässt erneut zwei Republikschutz-Verordnungen
Berlin * Reichspräsident Friedrich Ebert erlässt erneut zwei Republikschutz-Verordnungen. Ein Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik wird eingerichtet und die Straftatbestände neu aufgelistet.
1. 7 1922 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Das Christbaumbrettl“
München-Ludwigsvorstadt * Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Das Christbaumbrettl“ im Germania-Brettl in der Schwanthalerstraße 28. Das Stück wird 193 Mal aufgeführt.
18. 7 1922 - Georg Franz Kreisler wird in Wien geboren
Wien • Georg Franz Kreisler, der spätere Komponist, Dichter und Sänger, kommt in Wien zur Welt.
21. 7 1922 - Ein Republikschutzgesetz wird vom Reichstag erlassen
Berlin * Ein Gesetz zum Schutze der Republik (Republikschutzgesetz) wird vom Reichstag erlassen.
27. 8 1922 - Der Deutsche Katholikentag in München wird eröffnet
München - München-Maxvorstadt * Der Deutsche Katholikentag in München wird eröffnet. Für die anreisenden Zehntausenden von Gläubigen wird ein großer Festgottesdienst auf dem Königsplatz abgehalten, bei dem sich die katholische Kirche mit eindrucksvollem Gepränge darstellt. Die Straßen der Stadt sind mit Fahnen geschmückt, nur das Schwarz-Rot-Gold der Weimarer Republik ist demonstrativ vergessen worden.
Kardinal Michael von Faulhaber enthält sich bei dieser zur politischen Kundgebung umgestalteten Veranstaltung weder politischer noch demokratiefeindlicher Äußerungen und ruft in seiner Ansprache zum Kampf der Kirche gegen den Staat auf:
„Wehe dem Staat,
- der seine Rechtsordnung und Gesetzgebung nicht auf den Boden der Gebote Gottes stellt,
- der eine Verfassung schafft ohne den Namen Gottes,
- der die Rechte der Eltern in seinem Schulgesetz nicht kennt,
- der die Theaterseuche und die Kinoseuche nicht fernhält von seinem Volk,
- der Gesetze gibt, die die Ehescheidung erleichtern,
- die die uneheliche Mutterschaft in Schutz nehmen“.
Diesem Satz folgt ein - von den dicht gedrängten Besuchern stürmisch bejubelter - rhetorischer Tiefschlag gegen die Republik und ihrer Gründer: „Die Revolution war Meineid und Hochverrat und bleibt in der Geschichte erblich belastet und mit dem Kainsmal gezeichnet“. Diese Worte wirken, wie Faulhaber später einmal recht zufrieden feststellt, wie eine Bombe. Der Kardinal versagt sich damit wieder einmal - mit seiner ganzen Autorität und in der Öffentlichkeit - der Weimarer Republik und bereitet damit - ohne das möglicherweise direkt zu beabsichtigen - Adolf Hitler den Weg.
Schon damals stellt die sozialdemokratische Münchener Post unter der Überschrift „Wohin des Wegs, Herr Kardinal?“ fest: „Seine Ansichten sind ein Beweis für den Machthunger der römischen Kirche und ihres Klerus, die nicht mit dem Staat in Frieden und Verträglichkeit zusammenleben, sondern ihn um jeden Preis beherrschen wollen.“
Die in Anwesenheit der Spitzen von Kirche, Staat und Gesellschaft gemachten Aussagen des Kardinals führen allerdings auch zu einem „weltweit hallenden Eklat“ und veranlasst die - konservative - Reichsregierung, sich bei Papst Pius XI. zu beschweren. Damit, dass sich ein Widerstand derjenigen Katholiken formiert, die im neuen Staat ehrlich mitarbeiten wollen, hat Faulhaber nicht gerechnet.
30. 8 1922 - Konrad Adenauer widerspricht Kardinal Michael von Faulhaber
München * Der Präsident des Katholikentages, der damalige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, widerspricht Kardinal Michael von Faulhaber zwar erst drei Tage später, verwahrt sich aber immerhin öffentlich gegen diese Aussagen: „Es sind hie und da Äußerungen gefallen, die man sich aus Verhältnissen örtlicher Natur erklären kann, hinter denen aber die Gesamtheit der deutschen Katholiken nicht steht. [...] Es verrät Mangel an historischem Blick, die heutige Verfassung verantwortlich zu machen für die heutigen Zustände“.
Denn, so Adenauer weiter: „Wenn im Herbste der Wind die Blätter von den Bäumen fegt, so ist der Wind nur der Anstoß, denn die Blätter waren alt und müde, und wenn der Sturm Äste und Bäume bricht, so war der Sturm bloß der Anstoß, denn die Bäume und Äste waren alt, denn wären sie nicht morsch und lebensschwach gewesen, so hätten sie den Sturm überdauert.“ Und der Rheinländer setzte noch einen drauf, als er sagte: „Wie ich an das Walten einer Gerechtigkeit glaube, so glaube ich auch daran, daß etwas, was gut und stark ist, nicht untergehen kann“.
Jetzt wird Kardinal Faulhaber richtig zornig. „Herr Oberbürgermeister“, herrscht der Münchner Erzbischof den späteren Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wie einen Schuljungen an: „Sie haben unserem König nicht die schuldige Achtung erwiesen“.
In einer Denkschrift hält Konrad Adenauer die Gefährlichkeit der Haltung und Auffassung des Kardinals in aller Deutlichkeit fest: „Die Haltung des Kardinals Faulhaber ist unverträglich mit den Interessen des deutschen Katholizismus. Er muß entweder eine grundsätzliche Schwenkung einnehmen oder dazu angehalten werden, sich jeder politischen Betätigung auf das Strikteste zu enthalten“.
9 1922 - Der „Ausnahmezustand“ wird aufgehoben
München * Der „Ausnahmezustand“ wird aufgehoben.
19. 9 1922 - Faulhaber verhindert Ordensverleihung an Adenauer
München-Kreuzviertel - Rom-Vatikan * Kardinal Michael von Faulhaber schreibt an den Unterstaatssekretär im Vatikan, Giuseppe Pizzardo, über die öffentliche Auseinandersetzung mit Konrad Adenauer:
„Er behauptete, die Revolution sei organisch geworden, die gestürzten Herrscherhäuser seinen morsche Bäume gewesen, der deutsche Katholizismus sei auf das deutsche Vaterland angewiesen. [...] Ich bitte darum Eure Exzellenz, es möge keine päpstliche Kundgebung erfolgen, die von den Katholiken als Zustimmung zur Politik des Zentrums und zu einer Koalition mit der Sozialdemokratie ausgelegt werden könnte. Präsident Adenauer wird die päpstliche Auszeichnung, die früher für den Präsidenten üblich war, nicht erhalten können“.
Damit verhindert Kardinal Faulhaber, dass Konrad Adenauer den sonst üblichen päpstlichen Orden bekommt.
In einer eigenwilligen Rechtfertigung gegenüber dem bayerischen Gesandten beim Vatikan schreibt Faulhaber am selben Tag: „[...] Damit habe ich nicht die Verfassung von Weimar und die republikanische Staatsform an sich verurteilt; denn eine Verfassung kann rechtmäßig zustandegekommen sein, ohne daß dadurch die vorausgehende Revolution legitimiert wird. Ein unehelich Geborener kann ein ordentlicher Mensch werden, ohne daß damit die uneheliche Mutterschaft als solche Rechtsdasein erhält.“
29. 9 1922 - Das Brecht-Bühnenstück „Trommeln in der Nacht“ wird uraufgeführt
München-Maxvorstadt * Das Theaterstück „Trommeln in der Nacht“ des 24-jährigen Bert Brecht, wird unter der Regie von Otto Falckenberg in den Münchner Kammerspielen, damals noch in der Augustenstraße 89, uraufgeführt.
Das Stück spielt vor dem Hintergrund der revolutionären Kämpfe in Deutschland 1918/19. Bei der Uraufführung hängen im Zuschauerraum Plakate mit Aufschriften wie „Glotzt nicht so romantisch“.
Karl Valentin und Liesl Karlstadt sind bei der Premiere anwesend. Das Stück wird am nächsten Tag unter Mitwirkung von Karl Valentin und Liesl Karlstadt parodiert.
30. 9 1922 - Gemeinsamer Auftritt Valentin-Karlstadt mit Berthold Brecht
München-Maxvorstadt * Nach der Aufführung des Bert-Brecht-Bühnenstücks „Trommeln in der Nacht“ wird in den Münchener Kammerspielen in der Augustenstraße 89 in der Nachtvorstellung zwischen 22:00 und 23:30 Uhr die Uraufführung von „Die rote Zibebe. Improvisationen in zwei Bildern von Bert Brecht und Karl Valentin“ gezeigt.
Die „Improvisationen“ bestehen laut Programmzettel im ersten Bild aus dem Bert-Brecht-Stück „Der Abnormitätenwirt“ und dem zweiten Teil „Weihnachtsabend“, der sich aus einer „Hochradnummer“ und dem Valentin-Karlstadt-Einakter „Das Christbaumbrettl“ zusammensetzt.
Für das Humoristenpaar Valentin-Karlstadt stellen die Auftritte in „Die rote Zibebe“ zugleich ihr Debüt auf einer Theaterbühne dar, womit ihnen erstmals der Sprung ins „richtige Theater“ gelingt.
30. 9 1922 - Uraufführung: „Die rote Zibebe“ und „Weihnachtsabend“
München-Maxvorstadt • Nach der Aufführung des Bert-Brecht-Bühnenstücks „Trommeln in der Nacht“ wird in den Münchener Kammerspielen in der Augustenstraße 89 in der Nachtvorstellung zwischen 22:00 und 23:30 Uhr die Uraufführung von „Die rote Zibebe. Improvisationen in zwei Bildern von Bert Brecht und Karl Valentin“ gezeigt.
- Die „Improvisationen“ bestehen laut Programmzettel im ersten Bild aus dem Bert-Brecht-Stück „Der Abnormitätenwirt“ und dem zweiten Teil „Weihnachtsabend“, der sich aus einer „Hochradnummer“ und dem Valentin-Karlstadt-Einakter „Das Christbaumbrettl“ zusammensetzt.
- Für das Humoristenpaar Valentin-Karlstadt stellen die Auftritte in „Die rote Zibebe“ zugleich ihr Debüt auf einer Theaterbühne dar, womit ihnen erstmals der Sprung ins „richtige Theater“ gelingt.
1. 10 1922 - Weitere Aufführungen des Bühnenstücks Die rote Zibebe
München-Maxvorstadt * Nach der Nachmittagsvorstellung des Dramas „Das Weib auf dem Tiere“ von Bruno Frank und schließlich nach der Abendvorstellung des Bühnenstücks „Helden“ von George Bernard Shaw wird jeweils „Die rote Zibebe. Improvisationen in zwei Bildern von Bert Brecht und Karl Valentin“ gezeigt.
Die „Improvisationen“ bestehen aus dem Bert-Brecht-Stück „Der Abnormitätenwirt“ und aus einer „Hochradnummer“ und dem Valentin-Karlstadt-Einakter „Das Christbaumbrettl“.
5. 10 1922 - Das Christbaumbrettl weiterhin in den Münchener Kammerspielen
München-Maxvorstadt * Das Valentin-Karlstadt-Bühnenstück „Das Christbaumbrettl“ bleibt als „einaktiger Scherz“ weiterhin im Programm der Münchener Kammerspiele in der Augustenstraße 89 und wird zwischen dem 5. und 15. Oktober 1922 noch viermal in den legendären Nachtvorstellungen aufgeführt.
30. 10 1922 - Der Deutsche Städtetag für kolonialgeschichtliche Straßenbenennungen
Deutsches Reich * Der Deutsche Städtetag gibt die Anregung der Deutschen Kolonialgesellschaft weiter, „den Städten zu empfehlen, geographische Namen aus den deutschen Schutzgebieten zur Benennung von Straßen und Plätzen zu verwerten“.
1923 - Der Stummfilm „Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Oktoberfestwiese“
München * Der Stummfilm „Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Oktoberfestwiese“ wird gedreht.
1923 - Erste Aufzeichnung des Auftritts von Karl Valentin und Liesl Karlstadt
Hackenviertel * Eine erste Aufzeichnung des Auftritts von Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der „Monachia-Bühne“ zeigt „Orchester- und Fliegerszenen“.
Der Film ist verschollen.
Um 1923 - Der Stummfilm „Die Mysterien eines Frisiersalons“ wird gedreht
Schwabing * Unter der Regie von Erich Engel und Berthold Brecht entsteht der Stummfilm „Die Mysterien eines Frisiersalons“.
Er wird auf dem Speicher eines Hauses in der Tengstraße gedreht.
Karl Valentin lässt den Film aus dem Verkehr ziehen, nachdem er zufällig entdeckt, dass eine amerikanische Groteske den gleichen Inhalt erzählt.
Worum es sich handelte, ist allerdings unklar.
1923 - Die Isar hat sich weiter in den Untergrund eingegraben
Oberföhring - Englischer Garten * Trotz der Aufweitung ihres Flussbetts im Jahr 1889 hat sich die Isar weiter in den Untergrund eingegraben.
Mit dem Bau des „Stauwehrs Oberföhring“ steigt der Wasserspiegel um vier Meter an.
Doch unterhalb des „Stauwehrs“ befindet sich fast kein Wasser mehr, weil 92 Kubikmeter Isarwasser in der Sekunde in den. „Isarkanal“ umgeleitet werden.
In der Folge sinkt der Grundwasserspiegel im nördlichen „Englischen Garten“, weshalb die alten Bäume reihenweise absterben.
1923 - Der „Biedersteiner See“ ist eingetrocknet und halb verfüllt
Schwabing * Der „Biedersteiner See“ ist eingetrocknet und halb verfüllt.
1923 - Das Ausflugslokal „Tivoli“ schließt für immer seine Pforten
Englischer Garten - Tivoli * Das bei den Münchnern als Ausflugslokal beliebte „Tivoli“ schließt für immer seine Pforten.
1923 - Die „Lederfirma Adler und Oppenheimer“ kauft die Giesinger Lederfabrik
Untergiesing * Im „Inflationsjahr“ 1923 kaufte die Berliner „Lederfirma Adler und Oppenheimer“ die Aktienmehrheit an dem Giesinger Unternehmen auf.
In Folge der „Rezession auf dem internationalen Ledermarkt“ entschloss sich die Firma, ihre Münchner Niederlassung aufzulösen.
Das riesige Firmengelände verkaufte sie - mit Gewinn - an die „Münchner Siedlungs-GmbH“.
1923 - „Propagandamärsche“ der politischen Parteien durch Giesing
Obergiesing - Untergiesing * Ende 1922 häufen sich die „Propagandamärsche“ der politischen Parteien durch Giesing.
Rechte, linke und konservativ-katholische Parteien ziehen durch die Straßen und singen ihre Parteilieder.
„So habe ich aus einem Lied der Nationalsozialisten gehört: ‚Der Tag der Abrechnung wird kommen‘.
Dass solche Lieder in der Hochburg des Kommunismus, in Obergiesing, reizen, ist selbstverständlich“, schreibt Polizeikommisar Prebeck von der Polizeistation an der Tegernseer Landstraße.
1923 - Die „Franziskaner“ übernehmen die neu errichtete „Pfarrei St. Gabriel“
München-Lehel - München-Haidhausen * Neben dem Kloster und der angeschlossenen „Pfarrei St. Anna“ übernehmen die „Franziskaner“ auch noch die neu errichtete „Pfarrei St. Gabriel“ in Haidhausen.
1923 - Mit der „Personalabbauverordnung“ wird das „Zölibat“ wieder eingeführt
Berlin * Mit der „Personalabbauverordnung“ wird das „Zölibat für Beamtinnen“ wieder eingeführt.
Dort heißt es:
„Das Dienstverhältnis verheirateter weiblicher Beamter und Lehrer [...] kann jederzeit gekündigt werden. [...] Dies gilt auch bei lebenslänglicher Anstellung“.
Gleichzeitig wird eine „Heiratsprämie“, eine Abfindungssumme im Falle der Eheschließung, eingeführt.
Die Beamtinnen verlieren nicht nur ihre Arbeit, sondern auch jeglichen Anspruch auf Pension.
11. 1 1923 - Truppen marschieren in das Ruhrgebiet ein
Ruhrgebiet * Französische und belgische Truppen marschieren in das Ruhrgebiet ein.
13. 1 1923 - Mit passivem Widerstand gegen die Besatzer
Berlin * Reichskanzler Wilhelm Cuno verkündet den „passiven Widerstand“ gegen die Besatzer des Ruhrgebiets und verweigert jegliche Zusammenarbeit. In der Folge wird die Inflation immer weiter angeheizt.
14. 1 1923 - Johanna Maria Fey stirbt
München * Johanna Maria Fey, Karl Valentins Mutter, stirbt.
14. 1 1923 - Pater Rupert Mayer spricht gegen die Besetzung des Ruhrgebiets
Maxvorstadt * Pater Rupert Mayer spricht auf dem Königsplatz vor 10.000 Menschen gegen die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen.
3. 2 1923 - Das endgültige Übereinkommen zur Fürstenabfindung liegt vor
München-Kreuzviertel * Der Ministerrat billigt das nochmals überarbeitete Übereinkommen zur Fürstenabfindung.
1. 3 1923 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielen bis 31. März in Wien
Wien * Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielen bis 31. März in Wien bei Leopoldi/Wiesenthal in der Rotgasse.
8. 3 1923 - Landtag verabschiedet die Gesetze zum Wittelsbacher Ausgleichsfonds
München-Kreuzviertel * Nach einer stürmischen Diskussion im Landtag am 8. und 9. März 1923 wird
- das „Gesetz über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung des Bayerischen Staates mit dem vormaligen Bayerischen Königshause“ mit
- dem „Übereinkommen zwischen dem Bayerischen Staate und dem vormaligen Bayerischen Königshause“
mit 92 gegen 26 Stimmen angenommen.
9. 3 1923 - Der Landtag beschließt den Wittelsbacher Ausgleichsfond
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Landtag ruft per Gesetz den Wittelsbacher Ausgleichsfond - WAF ins Leben. In den Fonds gehen viele Kunstschätze, diverse Schlösser, Wälder und Geld über, aber nicht in Familienbesitz, sondern in eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Deren Erträge kassieren die Wittelsbacher, der Staat gibt für sie kein Steuergeld aus. Auf alle weiteren Ansprüche verzichtet die Familie.</p>
Um 4 1923 - Die erste persönliche Begegnung zwischen Adolf Hitler und Dr. Fritz Gerlich
Maxvorstadt * Es kommt zur ersten persönlichen Begegnung zwischen Adolf Hitler und Dr. Fritz Gerlich in der Richard-Wagner-Straße 27.
Gerlich zweifelt bereits zu dieser Zeit an Hitlers intellektuellen Fähigkeiten.
13. 5 1923 - Der Muttertag wird erstmals in Deutschland gefeiert
<p><strong><em>Deutsches Reich</em></strong> * Auf Initiative des Verbands Deutscher Blumengeschäftsinhaber wird am 13. Mai 1923 erstmals der <em>„Muttertag“</em> in Deutschland gefeiert. Die Nationalsozialisten nutzten den Muttertag für ihre Propaganda und machten ihn zum Feiertag, was ihn bis heute teils umstritten macht.</p>
1. 6 1923 - Gastspielreise von Karl Valentin und Liesl Karlstadt nach Zürich
Zürich * Gastspielreise von Karl Valentin und Liesl Karlstadt nach Zürich, wo sie bis 15. Juni in der Bonbonniere auftreten.
1. 7 1923 - Die Münchner Edelmesse GmbH wird eine Aktiengesellschaft
Bogenhausen * Die von Friedrich Lauer in seiner Villa in der Neuberghausener Straße 11 gegründete Münchner Edelmesse GmbH wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Sie wird als „Ständige Musterschau Deutscher Qualitätswaren mit Großhandelsvertretung für das In- und Ausland“ definiert. Nur geschultes, sprach- und warenkundiges Verkaufspersonal bedient die kaufkräftige, elitäre und vornehme Kundschaft. „Kein Schund, kein Kitsch, keine Ramschware wird zur Schau gestellt, sondern Gediegenes, Zweckentsprechendes, Echtes, mit einem Wort: ,Edles'."
9. 8 1923 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Großfeuer“
München-Maxvorstadt * Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Großfeuer“ im Steinickesaal in der Adalbertstraße 15. Das Stück wird 67 Mal aufgeführt.
26. 9 1923 - Gustav Ritter von Kahr wird zum Generalstaatskommissar ernannt
München * Die bayerische Regierung ernennt Gustav Ritter von Kahr - aus Protest gegen den Abbruch des Ruhrkampfes durch die Reichsregierung - zum Generalstaatskommissar, auf den die gesamte exekutive [= vollziehende] Gewalt übergeht. Er hat damit diktatorische Vollmachten.
Gustav von Kahr, Otto von Lossow, der Befehlshaber des Wehrkreises VII, und der Chef der Landespolizei, Hans Ritter von Seisser, regieren den Freistaat Bayern als Triumvirat und bereiten zusammen mit Rechtsradikalen in Norddeutschland den Staatsstreich in München und Berlin vor.
26. 9 1923 - Abbruch des passiven Widerstands im Ruhrgebiet
Berlin * Reichskanzler Gustav Stresemann gibt den Abbruch des „passiven Widerstands“ im Ruhrgebiet und die Wiederaufnahme der Reparationslieferungen bekannt.
26. 9 1923 - Generalstaatskommissar von Kahr verhängt den Ausnahmezustand
München * Der gerade zum Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten ernannte Gustav Ritter von Kahr verhängt den Ausnahmezustand in Bayern.
- Damit unterstellt er die in Bayern stationierten Einheiten der Reichswehr seinem Kommando.
- Gleichzeitig verbietet er das Erscheinen der sozialdemokratischen Zeitung Münchener Post.
10 1923 - Die „Inflation“ zwingt den Magistrat zur Absage des „Oktoberfestes“
Theresienwiese * Die „Inflation“ zwingt den Magistrat zur Absage des „Oktoberfestes“.
11 1923 - An Gustav von Kahrs Rede hat Fritz Gerlich mitgearbeitet
München-Haidhausen * Dr. Fritz Gerlich ist mit Begeisterung dabei, als unter Mitwirkung des „Generalstaatskommissars“ Gustav Ritter von Kahr der „Staatsstreich gegen das Reich“ vorbereitet wird.
Kahrs Rede im „Bürgerbräukeller“ stammt aus den Redaktionsräumen der „Münchner Neuesten Nachrichten“.
Dr. Fritz Gerlich hat an ihr mitgearbeitet.
6. 11 1923 - Kardinal Faulhaber verweigert sich gegenüber Reichskanzler Stresemann
<p><strong>Kreuzviertel</strong> * Erzbischof Michael von Faulhaber, der seit dem Kriegsende nicht müde wird zu betonen, dass die Ausschaltung der Kirchen aus dem öffentlichen Leben Anstand, Sitte, öffentliche Moral und Autoritätsglauben untergraben, verweigert sich aber gegenüber dem Reichskanzler Gustav Stresemann, als ihn dieser im Oktober 1923 bittet, <em>„sich in den Dienst der Sache der sittlichen Wiedergeburt zu stellen“</em>. </p> <p>Zwei Tage vor dem sogenannten Hitler-Ludendorff-Putsch teilt ihm der Kardinal mit, dass er für eine Mitarbeit <em>„aus gesundheitlichen Gründen und aus kirchenrechtlichen Bedenken“</em> nicht zur Verfügung steht. Ansonsten meint er aber, <em>„daß die Kirche es als eine Gewissenspflicht empfindet, an der sittlichen Wiedergeburt des Volkes, im Besonderen an dem Abbau der Kritiksucht und an der Pflege des Autoritätssinnes, an dem Abbau- der Selbstsucht und an der Pflege des Opfersinnes nach Kräften mitzuarbeiten.“</em> </p> <p>Weitere allgemein gehaltene und nicht zur Problemlösung beitragende Floskeln folgen. </p>
8. 11 1923 - Adolf Hitler stürmt mit einem Stoßtrupp den Bürgerbräukeller
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * Adolf Hitler stürmt mit einem bewaffneten Stoßtrupp den Bürgerbräukeller, in dem die Freie Vereinigung von Erwerbsständen zu einer Veranstaltung eingeladen hatte, und erklärte die <em>„Nationale Revolution“</em> für <em>„ausgebrochen“</em>.</p> <p>Am nächsten Tag machen sich die Putschisten auf den Weg in die Innenstadt. An der Feldherrnhalle kommt es zu einer Schießerei mit der Landespolizei. Sechzehn Putschisten und vier Polizisten kommen dabei ums Leben.</p>
9. 11 1923 - Der Marsch zur Feldherrnhalle
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Beim Hitler-Ludendorff-Putsch ist das Kriegsministerium ein Zwischenziel des <em>„Marsches nach Berlin“</em>, der jedoch an der Feldherrnhalle gestoppt wird.</p> <p>Ernst Röhm besetzt im Auftrag Hitlers mit 400 Bewaffneten sein eigenes Bürohaus, in dem er Stabsoffizier war. Ohne Erfolg!</p>
11. 11 1923 - Schutzhaft für Adolf Hitler in Landsberg
<p><strong><em>Landsberg am Lech</em></strong> • Adolf Hitler kommt in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech in Schutzhaft. </p>
14. 11 1923 - Adolf Hitler wird in Untersuchungshaft genommen
<p><strong><em>Landsberg am Lech</em></strong> • Adolf Hitler, der sich seit dem 11. November 1923 in Landsberg am Lech in Schutzhaft befindet, wird nun in Untersuchungshaft genommen. Für die Dauer des Prozesses [ab 1. April 1924] wird er nach München verlegt. </p> <p> </p>
15. 11 1923 - Valentin und Karlstadt geben ein Gastspiel im „chat noir“ in Wien
Wien * Karl Valentin und Liesl Karlstadt geben bis 15. Dezember ein Gastspiel im „chat noir“ in der Mariahilferstraße in Wien.
16. 11 1923 - Mit der Ausgabe der Rentenmark wird die Inflation beendet
Berlin * Mit der Ausgabe der Rentenmark wird die Inflation beendet.
1924 - Karl Valentin kauft in der Georgenstraße 2 in Planegg ein Landhaus
Planegg * Karl Valentin kauft in der Georgenstraße 2 in Planegg ein Landhaus um 14.000 Mark auf einem 1.440 qm großen Grundstück, das er auf seine Ehefrau Gisela Fey überschreiben lässt.
1924 - Die „Isarwerke AG“ werden gegründet
München *Die Hauptgesellschafter der „Isarwerke GmbH“: Jakob Heilmann, das „Bankhaus Merck Finck & Co“ und Georg von Simson, Gesellschafter der „Danat-Bank – Darmstädter und Nationalbank“, gründen zum Zwecke des Betriebes des „Wasserkraftwerks Mühltal“ bei Schäftlarn die „Isarwerke AG“.
1924 - Josef Liebl leitet die „Museum-Lichtspiele“
München-Au * Josef Liebl leitet die „Museum-Lichtspiele“.
1924 - Die Vollstreckung der Todesurteile erfolgt durch die „Guillotine“
München * Die traditionellen „Schwurgerichte“ treten wieder an die Stelle der „Volksgerichte“.
Die Vollstreckung der Todesurteile erfolgt nun grundsätzlich durch die „Guillotine“.
1924 - „Schloss Biederstein“ wird von den wittelsbachischen Erben veräußert
München-Schwabing * Zur besseren wirtschaftlichen Verwertung wird die 250 Tagwerk [= ~53.000 Quadratmeter] große Immobilie um das „Schloss Biederstein“ von den wittelsbachischen Erben veräußert.
Die „Firma Heilmann & Littmann“ erhält den Auftrag zum Verkauf.
1924 - Das bestbezahlte Revuegirl der Welt
<p><strong><em>New York</em></strong> * Bei der am Broadway aufgeführten Komödie <em>„Chocolate Dandies“</em> ist Josephine Baker auf der Besetzungsliste als <em>„das bestbezahlte Revuegirl der Welt“</em> aufgeführt. Sie verdient 125 $ in der Woche und tanzt eine Solonummer. Als selbstironischer Clown hat sie sich ein Alleinstellungsmerkmal ertanzt. Mit dieser Revue gelingt ihr auch der erfolgreiche Sprung nach Europa.</p>
24. 1 1924 - Das Walchensee-Kraftwerk erzeugt Strom
Walchensee * Das Walchensee-Kraftwerk geht in Betrieb.
26. 2 1924 - Der Hitler-Ludendorff-Prozess beginnt
<p><em><strong>München-Neuhausen</strong></em> • Bis zum 1. April 1924 findet die Hauptverhandlung an 25 Verhandlungstagen gegen die Angeklagten Adolf Hitler, Erich Ludendorff, Ernst Pöhner, Wilhelm Frick, Heinz Otto Kurt Pernet, Ernst Röhm, Hermann Kriebel, Friedrich Weber, Wilhelm Friedrich Karl Brückner und Robert Wagner statt. </p> <p>Ursprünglich sollte die Verhandlung im Gerichtsgebäude am Mariahilfplatz in der Au durchgeführt werden, dann erwog man aus Sicherheitsgründen die Gefangenenanstalt Landsberg am Lech als Verhandlungsort. Schließlich entschied man sich aber für die Räume der ehemaligen Kriegsschule in der Blutenburgstraße in München.</p>
29. 2 1924 - Generalleutnant Lossow wird seines Amtes enthoben
Berlin * Reichswehrminister Otto Geßler enthebt Generalleutnant Otto Hermann von Lossow seiner Funktion als Generalkommandant der VII. Division.
26. 3 1924 - Dr. Hermann Schülein wird Generaldirektor der Löwenbräu AG
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Nach dem Tod von Friedrich Ritter von Mildner übernimmt Dr. Hermann Schülein als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender dessen Nachfolge in der Löwenbräu AG. </p>
27. 3 1924 - Johann Reichhart erhält einen Arbeitsvertrag als Scharfrichter
<p><strong><em>München</em></strong> * Der 31-jährige Johann Reichhart erhält vom Landgerichtsbezirk München I zum 1. April 1924 einen Arbeitsvertrag als Bayerischer Scharfrichter.</p>
29. 3 1924 - Das Bayerische Konkordat - ein Staatsvertrag
<p><strong>München</strong> * Durch die Revolution und der damit verbundenen veränderten Staatsform wird dem Staatskirchentum das Fundament entzogen. Deshalb versucht die katholische Kirche seit dem Jahr 1920 vergeblich, einen Staatsvertrag - ein Konkordat - mit den Vertretern der Weimarer Republik zu schließen, mit dem ihre Stellung im Staat fest definiert wird.</p> <p>Nachdem sich dieser Weg so nicht realisieren lässt, beginnt der päpstliche Nuntius in München, Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., gemeinsam mit Kardinal Michael von Faulhaber, mit dem republikanischen Freistaat Bayern ein Konkordat abzuschließen. Das bayerische Konkordat</p> <ul> <li>sichert der Kirche nach Außen den Schutz durch den Staat zu und</li> <li>gibt ihr gleichzeitig die völlige Unabhängigkeit nach Innen.</li> <li>Die Ernennung und Abberufung von Professoren an den theologischen Fakultäten der Universitäten und der Religionslehrer an den höheren Schulen obliegen nun allein den Bischöfen, die wiederum nur vom Papst ernannt werden.</li> <li>Der Religionsunterricht wird zum Hauptfach an den Schulen erklärt und die Bekenntnisschule zur Regelschule gemacht. </li> <li>Schulgebet und Schulgottesdienste werden staatsrechtlich abgesichert.</li> <li>Weiter wird festgelegt, dass der Freistaat Bayern feste Beträge an die Kirche abzutreten und bei finanziellen Notlagen die Kirche zu unterstützen hat.</li> <li>Der Steuerzahler finanziert die Gehälter und Wohnungen der Geistlichen, ihre Ruhestandsgelder, Gebäude usw. </li> <li>Die katholische Kirche in Bayern lässt sich ihre Ausgaben zu einem großen Teil vom Staat zahlen, ohne gleichzeitig dessen Kontrolle dulden zu müssen. Dazu wird die Kirchensteuer festgeschrieben. </li> </ul> <p>Das „bayerische Konkordat“ hat Vorbildfunktion für weitere Abkommen zwischen Staat und Kirche. </p>
1. 4 1924 - Uraufführung der „Raubritter vor München“ in den Kammerspielen
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks <em>„Raubritter vor München“</em> in den Kammerspielen in der Augustenstraße 89. Das Stück erlebt 284 Vorstellungen.</p>
1. 4 1924 - Adolf Hitler tritt seine Strafe an
<p><strong><em>Landsberg am Lech</em></strong> • Adolf Hitler und die anderen Verurteilten [Pöhner, Weber und Kriebel] treten am Tag der Urteilsverkündung ihre Strafe in der Strafvollzugsanstalt Landsberg am Lech an. Dort ist ein Gebäude zur <em>„Festungshaftanstalt Landsberg“</em> deklariert worden. </p> <p>Während seiner Haft kann Hitler zahlreiche Besucher empfangen. Dies steht ihm als Festungshäftling zwar grundsätzlich zu, doch wird ihm wesentlich mehr als nach der Hausordnung für den Vollzug der Festungshaft zulässig ist von der ihm wohlgesonnenen Anstaltsleitung genehmigt. Hitler schreibt in Landsberg den ersten Teil seines Buchs <em>„Mein Kampf“</em>. </p>
1. 4 1924 - Der Hitler-Ludendorff-Prozess endet
<p><strong><em>München-Neuhausen</em></strong> • Der Prozess gegen die Beteiligten am Hitler-Ludendorff-Putsch wird mit einem Urteil beendet. </p> <ul> <li>Hitler wird wegen Hochverrats zur gesetzlichen Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft und einer Geldstrafe von 200 Goldmark verurteilt, ebenso Kriebel, Weber und Pöhner. </li> <li>Brückner, Röhm, Pernet, Wagner und Frick erhalten wegen Beihilfe jeweils ein Jahr und drei Monate Festungshaft sowie 100 Goldmark als Strafe auferlegt. </li> <li>Ludendorff wird mit der wenig glaubwürdigen Begründung, dass er keine Kenntnis von den eigentlichen Plänen Hitlers gehabt hätte, freigesprochen. </li> <li>Den Verurteilten Hitler, Pöhner, Weber und Kriebel wird durch Beschluss des Volksgerichts nach Verbüßung eines weiteren Strafteils von sechs Monaten Bewährung für den Strafrest in Aussicht gestellt. </li> <li>Für Brückner, Röhm, Pernet, Wagner und Frick wird diese Bewährung sofort bewilligt. </li> </ul> <p>Die Staatsanwaltschaft hatte für Hitler eine Strafe von acht Jahren beantragt. </p> <ul> <li>Von der zwingenden Ausweisung Hitlers als Ausländer nach § 9 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Republik sieht das Volksgericht ausdrücklich ab. </li> <li>Ebenso berücksichtigt es nicht, dass der 1922 wegen Landfriedensbruch verurteilte Hitler bereits unter Bewährung stand und ihm daher nicht erneut Bewährung gewährt hätte werden dürfen. </li> <li>Die Volksgerichte sind für die ihnen zugewiesenen Fälle in Bayern erste und letzte Instanz, so dass gegen ihre Urteile keine Rechtsmittel statthaft sind. Das Urteil ist somit sofort rechtskräftig.</li> </ul>
2. 4 1924 - Graf Arco und Adolf Hitler lernen sich in der Haft kennen
Landsberg * Während der letzten sechs Wochen seiner Inhaftierung lernt Graf von Arco einen Neuzugang kennen, der die Haftruhe - wie auch Graf Arco selbst - zum Niederschreiben seiner Gedanken und Pläne nutzt: Adolf Hitler.
Dieser beginnt in Landsberg mit seinem Werk „Mein Kampf“, in dem er unter anderem den deutschen „Föderalismus“ als Schwächung Deutschlands geißelt.
13. 4 1924 - Anton Graf Arco-Valley wird aus der lebensklangen Haft entlassen
<p><em><strong>Landsberg am Lech</strong></em> * Anton Graf von Arco auf Valley verlässt die Festung Landsberg am Lech - bereits vier Jahre nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Festungshaft - wieder als freier Mann.</p> <p>Er wird wegen Strafunterbrechung entlassen, ohne dass die sonst übliche Bewährungsfrist ausgesprochen wird. Ein lebenslanger Gefängnisaufenthalt war für Arco eh nie ernstlich in Betracht gezogen worden.</p> <p>Bei seiner Rückkehr nach Schloss Sankt Martin wird der Kurt-Eisner-Mörder von der Bevölkerung jubelnd empfangen. </p>
18. 4 1924 - Die Unionsbrauerei wird geschlossen
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * Die Unionsbrauerei in der Äußeren-Wiener-Straße in Haidhausen wird geschlossen.</p>
Um den 10. 5 1924 - Anton von Arco verlässt die Festung Landsberg als freier Mann
Landsberg * Bereits vier Jahre nach seiner Verurteilung verlässt Anton von Arco auf Valley die Festung Landsberg wieder als freier Mann. Bei seiner Rückkehr nach Schloss Sankt Martin wird der Graf von der Bevölkerung jubelnd empfangen und die farbentragende katholische bayerische Studentenverbindung Rhaetia nimmt im Rahmen einer Festkneipe im Sommer 1925 den aus der Haft entlassenen Mörder in ihren Reihen auf.
Anton von Arco ist durch seinen Mord am bayerischen Ministerpräsidenten zum Helden der nationalen Rechten aufgestiegen. Dass er dabei von den Leibwächtern schwer verletzt wurde, macht auch noch einen Märtyrer aus ihm.
12. 5 1924 - Ermittlungsverfahren gegen Kahr, Seißer und Kossow eingestellt
<p><em><strong>München</strong></em> • Die Staatsanwaltschaft München I stellt das Ermittlungsverfahren gegen Kahr, Seißer und Lossow mit der Begründung ein, dass bei den Beschuldigten ein Vorsatz, sich an dem Putsch zu beteiligen, nicht erwiesen sei. </p>
Bis zum 15. 5 1924 - Der Hitler-Ludendorff-Prozess endet
<p><strong><em>München-Neuhausen</em></strong> • Drei weitere Prozesse gegen die am Hitler-Ludendorff-Putsch Beteiligten finden noch bis Mitte Mai 1924 statt wegen der Angriffe auf die <em>„Münchener Post“</em>, der Beschlagnahme von Banknoten in Druckereien und Waffendiebstahls.</p>
24. 7 1924 - Scharfrichter Reichharts erste Hinrichtung
Landshut * Der Scharfrichter Johann Reichhart vollzieht im Hof des Landgefängnisses Landshut seine erste Hinrichtung.
16. 8 1924 - Neuregelung der deutschen Reparationsleistungen
London * Neuregelung der deutschen Reparationsleistungen durch den Dawes-Plan.
12. 9 1924 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt zu einem Gastspiel nach Berlin
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt machen sich zu einer Gastpielreise nach Berlin auf.
15. 9 1924 - Valentin und Karlstadt treten im Neuen Operettenhaus in Berlin auf
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im Neuen Operettenhaus am Schiffbauerdamm in Berlin mit „Theater in der Vorstadt“ auf.
10 1924 - Die „Inflation“ zwingt den Magistrat zur Absage des „Oktoberfestes“
München-Theresienwiese * Die „Inflation“ zwingt den Magistrat zur Absage des „Oktoberfestes“.
7. 10 1924 - Karl Valentin darf eine Rundfunkempfangsanlage betreiben
München-Lehel * Karl Valentins Gesuch zur Genehmigung zur Errichtung und zum Betriebe einer Rundfunkempfangsanlage in der Wohnung wird von der Polizeidirektion positiv beschieden.
14. 12 1924 - Der Alpenverein schließt die jüdische Sektion Donauland aus
München-Ludwigsvorstadt * Im Deutschen Theater in München stimmen 1.663 von 1.906 Delegierten des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins - DuOeAV dem Ausschluss der jüdischen Sektion Donauland zu. Dies geschieht elf Jahre vor den Rassegesetzen der NS-Regierung.
20. 12 1924 - Adolf Hitler wird vorzeitig aus der Festungshaft entlassen
Landsberg * Adolf Hitler wird - nach nur neun Monaten - vorzeitig aus der Festungshaft aus Landsberg entlassen.
20. 12 1924 - Adolf Hitler wird aus der Festungshaft entlassen
<p><strong><em>Landsberg am Lech</em></strong> • Adolf Hitler wird, auch aufgrund der günstigen Prognosen des Anstaltsleiters und gegen die Auffassung der Staatsanwaltschaft, auf Bewährung aus der Festungshaftanstalt entlassen.</p>
30. 12 1924 - München erhält Lenbachs Hinterlassenschaft
München-Maxvorstadt * Lolo von Lenbach stiftet Franz von Lenbachs Hinterlassenschaft an Gemälden, Kunstwerken und Erinnerungsstücken der Landeshauptstadt München.
31. 12 1924 - Der amerikanische Ku-Klux-Klan hat vier Millionen Mitglieder
USA * Der amerikanische Ku-Klux-Klan hat vier Millionen Mitglieder und verfolgt eine Politik weißer Vorherrschaft insbesondere gegenüber Afro-Amerikanern. Er vertritt aber auch einen militanten Antikatholizismus und Antisemitismus.
1925 - Der Spaten-Slogan „Lass Dir raten, trinke Spaten“
<p><em><strong>München</strong></em> * Unter der Registiernummer 340054 meldet die Spatenbrauerei den Slogan <em>„Lass Dir raten, trinke Spaten“</em> als Motto an.</p>
Seit dem Jahr 1925 - Karl Valentin sammelt alte Fotgrafien von München
<p><em><strong>München</strong></em> * Karl Valentin beginnt - ohne Rücksicht auf finanzielle Belastungen - alte Fotgrafien von München zu sammeln. Sigi Sommer überlieferte Valentins Ausspruch: <em>„A oids Buidl vo München is mehra wert ois a Brilliant“</em>.</p>
1925 - Die theoretische Ausbildung des Kindergarten-Seminars in Bogenhausen
<p><em><strong>München-Lehel - München-Bogenhausen</strong></em> * Die theoretische Ausbildung des <em>„Kindergarten-Seminars“</em> wird vom Anna-Lyzeum im Lehel an den Bogenhausener Kirchplatz verlegt.</p>
1925 - Die Kuppel der Georgskirche wird mit Kupferblech überzogen
<p><em><strong>München-Bogenhausen</strong></em> * Die Kuppel der Sankt-Georgs-Kirche in Bogenhausen wird mit Kupferblech überzogen.</p>
Um 1925 - Protest gegen den Teilabriss der Bogenhausener Georgskirche
<p><em><strong>München-Bogenhausen</strong></em> * Gegen Planungen, die Bogenhausener Georgskirche umzubauen und dazu das Gotteshaus teilweise abzureißen, formiert sich massiver Protest, der auch von Liesl Karlstadt unterstützt wird.</p>
1925 - Die Musikwerke Richard Wagners sind unglaublich populär
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Werke Richard Wagners sind derart populär, dass eine Simlicissimus-Karikatur einen Biergartenbesucher philosophieren lässt: <em>„Wagner kann man bloß in München hören - in Bayreuth gibt's nur in den Pausen Bier“</em>.</p>
Um 1925 - Der Münchner trinkt durchschnittlich 200 Liter Bier
<p><em><strong>München</strong></em> * Der Pro-Kopf-Bier-Verbrauch hat sich in München bei etwa 200 Liter eingependelt. Das entspricht in etwa dem Doppelten des heutigen Verbrauchs, wobei man Touristen und Gäste der Stadt berücksichtigen muss.</p>
1925 - Die evangelischen Giesinger gründen die Martin-Luther-Gemeinde
<p><em><strong>München-Giesing - München-Haidhausen</strong></em> * Die evangelischen Giesinger trennen sich von <em>„St.-Johannes“</em> in Haidhausen und gründen die selbstständige <em>„Martin-Luther-Gemeinde“</em>.</p>
1925 - Faulhabers Buch: „Deutsches Ehrgefühl und katholisches Gewissen“
München * „Erzbischof“ Michael von Faulhaber veröffentlicht ein Buch mit dem Titel: „Deutsches Ehrgefühl und katholisches Gewissen“.
Zunächst stellt der „Erzbischof“ fest, dass „darüber zu urteilen, was katholisch ist oder was an das Wesen des Katholizismus greift, [...] Sache des kirchlichen Lehramtes“ ist.
Im nächsten Satz gibt er sich als „Träger“ dieses „Lehramtes“ aus.
Und dann beginnt er zu politisieren.
Benito Mussolini, der im Oktober 1922 mit seinem „Marsch auf Rom“ die Macht in Italien an sich gerissen hatte und die Verfassung nach seinen Vorstellungen abänderte, wurde vom „Kardinal“ hoch gelobt, da „das Oberhaupt des italienischen Faschismus [...] die Geister des Kulturkampfes [...] bis heute mit fester Hand [...] im Zaun gehalten“ habe.
Gleich darauf lässt Faulhaber seine Bewunderung für den „deutschen Faschistenführer“ folgen, wenn er schreibt:
„Adolf Hitler wußte besser als die Diadochen seiner Bewegung, daß die deutsche Geschichte nicht erst 1870 und nicht erst 1517 begann, daß für die Wiederaufrichtung des deutschen Volkes die Kraftquellen der christlichen Kultur unentbehrlich sind, daß mit Wotanskult und Romhaß das Werk der Wiederaufrichtung nicht geleistet werden kann.
Als Mann des Volkes kannte er auch die Seele des süddeutschen Volkes besser als andere und wußte, daß mit seiner Bewegung, die in ihrer Kehrseite Kampf gegen Rom ist, die Seele des Volkes nicht erobert wird“.
Das Buch erscheint wohlgemerkt in dem Jahr,
- in dem die „NSDAP“ neu gegründet worden ist,
- in dem Adolf Hitler für mehrere Jahre ein „Auftrittsverbot“ erhalten hat,
- in dem der erste Band von Hitlers „Mein Kampf“ erscheint und
- in dem die berüchtigte „Schutzstaffel - SS“ gegründet wird.
Ab dem Jahr 1925 - „Hier Amt, was beliebt?“
Berlin * Allein zwischen den Jahren 1925 und 1930 erhöht sich die Zahl der vermittelten Gespräche pro Telefonistin um rund 25 Prozent.
Das geschieht einerseits durch verbesserte Geräte und andererseits durch eine effektivere Bedienung der Arbeitsmittel.
Sprechausbildung und Vorschriften über militärisch knappe Redewendungen wie „Hier Amt, was beliebt?“ oder noch kürzer „Bitte melden“ tun ein Übriges.
Die Beamtinnen dürfen sich nicht ohne Erlaubnis der Aufsichten von ihrem Arbeitsplatz entfernen.
Jeder Fehler wird in das „Strafregister“ der „Personalakte“ aufgenommen.
Das Aufsichtspersonal steht hinter den Frauen.
Zuerst sind es ausschließlich Männer, später auch ältere befähigte Gehilfinnen.
Vom Aufsichtstisch aus kann die Platzkraft ständig kontrolliert und mit einer Mithöreinrichtung überprüft werden, wie schnell die Teilnehmer bedient und ob die Formen der streng reglementierten Gespräche eingehalten werden.
Ein Zählschrank registriert jede ausgeführte Verbindung und gestattet so die regelmäßige Überprüfung der Arbeitsintensität jeder einzelnen Kraft.
1925 - München hat 680.704 Einwohner
München * München hat 680.704 Einwohner.
1. 1 1925 - Das Valentin-Bühnenstück „Der Bittsteller“ hat Premiere
München-Graggenau * Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Der Bittsteller“ in der „Bonbonniére“ in der Neuturmstraße 5. Das Stück wird 139 Mal aufgeführt.
16. 2 1925 - Das Verbot der NSDAP wird in Bayern aufgehoben
München * Der Ausnahmezustand und das Verbot der NSDAP werden in Bayern aufgehoben. Damit ist der Weg für eine Parteineugründung frei. Das auch, nachdem Hitler dem bayerischen Ministerpräsidenten Heinrich Held [BVP] die Erklärung gegeben hatte, nur mehr im Rahmen der Verfassung agieren zu wollen.
25. 2 1925 - Ferdinand Schmid wird in Berchtesgaden geboren
Berchtesgaden * Ferdinand Schmid, der spätere Direktor der Augustiner-Bräu Wagner K.G. und Vorstand der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung wird in Berchtesgaden geboren.
3 1925 - Faulhaber verweigert dem Reichspräsidenten Ebert das Trauergeläut
München-Kreuzviertel * Unversöhnlich zeigt sich Erzbischof Michael von Faulhaber gegenüber dem am 28. Februar 1925 verstorbenen, der SPD angehörenden Reichspräsidenten Friedrich Ebert.
Der Kardinal verweigert ihm ein Trauergeläut in seiner Diözese, weil der Verstorbene ja auf dem Boden einer Verfassung stand, die „auf eine Trennung von Staat und Kirche abzielte“. Außerdem war Friedrich Ebert als „Mitglied und Führer einer politisch grundsätzlich religions- und kirchenfeindlichen Partei, nicht durch die Wahl des deutschen Volkes ‚Reichspräsident‘ geworden“.
10. 3 1925 - Der TSV München-Ost verkauft den Waldspielplatz
<p><em><strong>Gronsdorf</strong></em> * Der TSV München-Ost verkauft den Waldspielplatz in Gronsdorf, um noch am selben Tag den Kauf eines neuen Grundstücks an der St.-Martin-Straße in Obergiesing perfekt zu machen. Um den Bau eines Vereinsheimes, einer Turnhalle und eines Sportplatzes finanzieren zu können, wird der Verkaufserlös des alten Waldsportplatzes verwendet und der Beitrag auf eine Mark verdoppelt.</p> <p>Die Vereinsleitung und die Mitgliedschaft verspricht sich von dem Neubau-Projekt wesentlich bessere Trainingsbedingungen als in den Nebensälen der Großgaststätten und den Schulturnsälen. <br /> Und damit verbunden eine stärkere Unabhängigkeit von geschäftstüchtigen Wirten und mit Vorurteilen behafteten Schulrektoren. </p>
4. 4 1925 - Uraufführung des Bühnenstücks „Der reparierte Scheinwerfer“
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks <em>„Die beiden Elektrotechniker“</em>, später <em>„Der reparierte Scheinwerfer“</em> im <em>„Cherubin-Theater“</em> in der Maximilianstraße, Eingang Marstallstraße 7. Das Stück wird 296 Mal aufgeführt.</p>
26. 4 1925 - Paul von Hindenburg wird zum Reichspräsidenten gewählt
<p><em><strong>Berlin - Deutsches Reich</strong></em> * Im Alter von 77 Jahren wird Paul von Hindenburg als Vertreter des antirepublikanischen Reichsblock zum Reichspräsidenten gewählt. </p>
7. 5 1925 - Das Deutsche Museum wird eröffnet
München-Isarvorstadt * Das Deutsche Museum auf der Kohleninsel wird eröffnet.
6. 7 1925 - Bill Haley kommt in Highland Park, Michigan, zur Welt
Highland Park * Bill Haley kommt in Highland Park, Michigan, zur Welt.
14. 7 1925 - Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli übersiedelt nach Berlin
<p><em><strong>München - Berlin</strong></em> * Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli gibt nach dem erfolgreichen Abschluss des Bayerischen Konkordats sein Amt in München auf, um sich auf seine Aufgaben in Berlin zu konzentrieren. </p>
Um 8 1925 - Die „Studentenverbindung Rhaetia“ nimmt den Eisner-Mörder auf
<p><em><strong>München</strong></em> * Die farbentragende katholische bayerische <em>„Studentenverbindung Rhaetia“</em> nimmt im Rahmen einer Festkneipe den eben aus der Haft entlassenen Mörder Anton Graf von Arco auf Valley in ihren Reihen auf.</p> <p>Arco war durch seinen Mord am bayerischen Ministerpräsidenten zum Helden der nationalen Rechten aufgestiegen. Dass er dabei von den Leibwächtern schwer verletzt wurde, machte auch noch einen Märtyrer aus ihm.</p>
15. 8 1925 - Pater Rupert Mayer führt die Bahnhofsgottesdienste in München ein
München * Pater Rupert Mayer führt die Bahnhofsgottesdienste in München ein.
18. 8 1925 - Nuntius Eugenio Pacelli beendet seine Tätigkeit in München
München * Der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli beendet seine Tätigkeit in München. Seine Aufgabe übernimmt Alberto Vassallo di Torregrossa.
22. 8 1925 - Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa nimmt seine Tätigkeit auf
München-Maxvorstadt * Der päpstliche Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa nimmt seine Tätigkeit in München auf.
9 1925 - Das erste „Zentral-Landwirtschaftsfest“ nach dem Ersten Weltkrieg
München-Theresienwiese * Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet erstmals nach dem Ersten Weltkrieg statt.
3. 9 1925 - Der Stadtbezirk Gern für kolonialgeschichtliche Straßenbenennungen
Gern - Trudering * Der 28. Stadtbezirk [= Gern] nimmt die Anregung der Deutschen Kolonialgesellschaft für folgende Straßenbenennungen zum Anlass: Togostraße, Kamerunplatz, Dar-es-Salaam-Straße, Tsingtaustraße, Sansibarplatz und Samoaplatz. Die Straßennamen werden jedoch erst am 22. Juni 1933 in Trudering vergeben.
10 1925 - Die „Münchner Edelmesse AG“ in Bogenhausen ist bankrott
München-Bogenhausen * Die „Münchner Edelmesse AG“ in Bogenhausen ist bankrott und wird aus dem Handelsregister gelöscht.
2. 10 1925 - Josephine Baker als Hauptdarstellerin in der Revue Negre
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Mit ihrem Auftritt im Théâtre des Champs Elysées betritt Josephine Baker die Bühne der Welt als Hauptdarstellerin der <em>„Revue Negre“</em> [= „<em>Negerrevue“</em>]. Das heute - mit Recht - verpönte Wort <em>„Neger“</em> ist damals gang und gäbe. Das Interesse an afrikanischer Kunst [= <em>„Negerkunst“</em>] ist in Paris bereits um 1900 erwacht. Künstler wie Henri Matisse und Pablo Picasso beschäftigen sich damit.</p> <p>Josephine bringt all das auf die Bretter, die die Welt bedeuten, was sich Paris unter <em>„schwarzer Kultur“</em> vorstellt: Sie ist wild, sie ist exotisch, sie ist Afrika. Eine Unterscheidung zwischen afroamerikanisch und afrikanisch wurde auch in Frankreich noch nicht gemacht. Schwarz ist Schwarz und Schwarz ist Afrika. </p>
1926 - Hannes König tritt der Kommunistischen Partei bei
<p><em><strong>München</strong></em> * Hannes König tritt der Kommunistischen Partei bei. Er wird während der Zeit des Nationalsozialismus überwacht und hat Berufsverbot.</p>
1926 - Das Alpine Museum wird vergrößert
<p><em><strong>München-Lehel - Praterinsel</strong></em> * Zur Vergrößerung der Ausstellungsflächen im Alpinen Museum auf der Praterinsel wird die Terrasse im ersten Obergeschoss überbaut. Damit gewinnt der Bau an Monumentalität.</p>
1926 - Die Stadtverwaltung weitet den Münchner Burgfrieden aus
<p><em><strong>München-Theresienwiese</strong></em> * Die Stadtverwaltung erwirbt erneut Privatgrundstücke auf der Theresienwiese und weitet damit den Münchner Burgfrieden auf das Gebiet der Nachbargemeinde Untersendling aus.</p>
Bis 1926 - In der Maffei'schen Fabrik sind 44 Dampfschiffe entstanden
<p><em><strong>München-Englischer Garten - Hirschau</strong></em> * In der Maffei'schen Fabrik in der Hirschau sind 44 Dampfschiffe für deutsche Seen und Flüsse entstanden.</p>
1926 - Das Klärwerk Großlappen geht in Betrieb
<p><em><strong>München-Großlappen</strong></em> * Das Klärwerk Großlappen geht in Betrieb.</p>
Um 1926 - Frauenturnfest und Pluder-Badekostüme für beide Geschlechter
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * <em>Kardinal</em> Michael von Faulhaber beschäftigt sich mit Bagatellen. Es geht um das Verhindern</p> <ul> <li>eines zweiten Frauenturnfestes,</li> <li>der Entziehung der Portofreiheit für kirchliche Stellen,</li> <li>der moralischen Zuchtlosigkeit der Jugend,</li> <li>um die uneheliche Mutterschaft,</li> <li>darum, <em>„dass das Turnen nach Geschlechtern getrennt geschehe,<br /> daß die Turnkleidung die Körperformen nicht aufdringlich betone,<br /> daß jede Turnübung, besonders an Geräten, vermieden wird, die der weiblichen Art nicht angemessen sind, und </em></li> <li><em>dass das Schauturnen von Frauen und Mädchen unterlassen werde“</em>.</li> <li>Gemeinschaftsbäder hält er für überflüssig.</li> </ul> <p>Und wenn sie schon bestehen sollen, dann fordert Kardinal Faulhaber <em>„Volles Pluder-Badekostüm für beide Geschlechter“</em>.</p>
1926 - Anton von Arco arbeitet bei der neu gegründeten Lufthansa
<p><em><strong>München</strong></em> * Da Anton von Arco nach dem Krieg seinen erlernten Beruf eines Leutnants nicht mehr ausüben kann, arbeitet er bei der neu gegründeten Lufthansa. </p> <p>Bald darauf verdient er sein Geld als Immobilienmakler und als Vortragsreisender, wo er seine politischer Ideen propagiert und von seinem Heldenstatus profitiert. </p>
1926 - Der erste „Bugatti Royale Typ 41“ wird hergestellt
<p><em><strong>Molsheim</strong></em> * Der erste <em>„Bugatti Royale“</em> (Chassis 41-111) wird hergestellt. Die Konstruktion des Typs 41 führt Jean Bugatti aus, Ettore Bugattis Sohn.</p> <p>Wie damals im Luxuswagen-Markt üblich, liefert die Firma Bugatti nur das <em>„Rolling Chassis“</em>, also, das Fahrgestell mit allen Komponenten samt Motor und Kühlergrill, während die Gestaltung des Aufbaus unabhängigen Karosseriebauunternehmen überlassen wird.</p> <p>Ettore Bugatti behält jedoch die Kontrolle über sein Projekt, indem er die Lieferung des Chassis von seiner Zustimmung zum ausgewählten Karosseriebauer und zum Karosserie-Entwurf abhängig macht:<br /> Nur die angesehensten Firmen und die geschmackvollsten Aufbauten sollen für seinen <em>„Royale“</em> gut genug sein.<br /> Jean Bugatti zeichnet einige dieser Entwürfe. </p>
1926 - Josephine Baker mit einem Gürtel aus 16 Plüschbananen
<p><strong>Paris</strong> * Als Josephine Baker im Folies-Bergère mit einem Gürtel aus 16 Plüschbananen über die Bühne fegt, sind ihr die Pariser Männer endgültig verfallen. Ihr schlanker, biegsamer Körper, der exotische Charme, die Verheißung erotischer Abenteuer jenseits von Zivilisation und abendländischer Moral passt genau zu dem nach Amüsement und Ekstase lechzenden Geist der Zwanzigerjahre. </p>
14. 1 1926 - Berlin: Ein Triumphzug für Josephine Baker
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Josephine Bakers Auftritt im Nelson-Theater am Kurfürstendamm in Berlin löst bei etlichen Zuschauern nicht nur Schnappatmung aus, sondern verleiht - zum Entsetzen konservativer Kreise - auch Jazz und Charleston enorme Popularität. <em>„Berlin, das ist schon toll! Ein Triumphzug. Man trägt mich auf Händen“</em>, schreibt sie später. </p>
1. 5 1926 - Umbenennung in „Soziales Landesmuseum in München“
München-Lehel * Umbenennung des „Königlich Bayerischen Arbeitermuseums“ in „Soziales Landesmuseum in München“.
5. 5 1926 - Premiere des Valentin-Bühnenstücks „Das Brilliantfeuerwerk“
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks <em>„Brilliantfeuerwerk oder Ein Sonntag in der Rosenau“</em> im <em>„Schausspielhaus“</em> in der Maximilianstraße 26. Das Stück erlebt 256 Vorstellungen.</p>
1. 6 1926 - Die Schauspielerin Marilyn Monroe wird in Los Angeles geboren
Los Angeles * Die Schauspielerin Marilyn Monroe wird als Norma Jeane Mortenson (Baker) in Los Angeles geboren.
27. 6 1926 - Der Grundstein für die Giesinger Martin-Luther-Kirche wird gelegt
München-Obergiesing * Der Grundstein für die Giesinger Martin-Luther-Kirche wird gelegt. Auf gleicher Höhe sollen sich hier zwei Kirchen einander gegenüberstehen: der katholische Kathedralbau der Heilig-Kreuz-Kirche und die evangelische Martin-Luther-Kirche. Die Kirche steht auf dem Grund des ehemaligen Lehner-Bauerhofs.
Ihre bewusste Platzwahl solle die Präsenz der protestantischen Gemeinde in Giesing betonen.
4. 7 1926 - Grundsteinlegung für die neuen Vereinsanlagen des TSV München-Ost
München-Obergiesing * Ein Jahr dauerten die Planungsarbeiten und nun kann der Grundstein für die neuen Vereinsanlagen des TSV München-Ost an der St.-Martin-Straße gelegt werden. „Ein imposanter Festzug bewegte sich vom Vereinslokal in der Kellerstraße durch Haidhausen zur Baustelle.“
Obwohl die Grundsteinlegung ein Fest für den ganzen Münchner Osten ist, erscheint kein offizieller Vertreter der Stadt. Doch unabhängig von der Geringschätzung einer konservativ-völkisch-nationalen Stadtregierung und Stadtverwaltung kommt der Bau zügig voran.
16. 7 1926 - Pater Rupert Mayer wird Präfekt am Bürgersaal in München
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * Pater Rupert Mayer wird zum Präfekten und Kirchenvorstand am Bürgersaal in München ernannt. </p>
9 1926 - Carl Gabriel zeigt auf dem Oktoberfest „Die Drei dicksten Mädchen“
<p><em><strong>München-Theresienwiese</strong></em> * Carl Gabriel zeigt auf dem Oktoberfest mit <em>„Die Drei dicksten Mädchen“</em> eine als <em>„7. neuestes Weltwunder“</em> bezeichnete Schau.</p>
9 1926 - Die Witwe Rössler übernimmt die Geschäfte der „Ochsenbraterei“
München-Theresienwiese * Als Johann Rössler stirbt, übernimmt seine Witwe die Geschäfte der „Ochsenbraterei“ und betreibt diese bis 1958.
9 1926 - Xaver Kugler betreibt das „Augstiner-Festzelt“
München-Theresienwiese * Xaver Kugler betreibt das „Augstiner-Festzelt“.
Die „Festhalle“ erhält einen Turm.
Er besteht bis zur „Wiesn“ im Jahr 1938.
Erst 2010 wird er wieder aufgebaut.
9 1926 - Johann Reichhart muss seine Wirtschaft wieder aufgeben
<p><em><strong>München-Au</strong></em> * Nach wenigen Monaten muss Johann Reichhart seine Wirtschaft am Mariahilfplatz 1 wieder aufgeben.</p> <ul> <li>Sobald seine Gäste von seiner Nebentätigkeit als Scharfrichter erfahren, verlassen sie entsetzt das Lokal. <em>„Zu Dir kann man nicht mehr kommen. An jedem Bierglas, das Du in der Hand hältst, klebt Blut“</em>.</li> <li>Seine Ehefrau hat ihn verlassen. Seinen Kindern schreien die Mitschüler nach:<em> „Dein Vater is a Kopfabschneider, Kopfabschneider!“ </em></li> </ul>
1. 9 1926 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Im Senderaum“
München-Ludwigsvorstadt * Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Rundfunkszene“, später „Der Antennendraht/Im Senderaum“ im Deutschen Theater in der Schwanthalerstraße 13. Das Stück wird insgesamt 498 Mal aufgeführt.
15. 9 1926 - Die Straßenbahnlinie 31 nach Berg am Laim wird eröffnet
München-Berg am Laim * Die Straßenbahnlinie 31 nach Berg am Laim wird eröffnet. Die Wendeschleife ist in der Baumkirchner Straße.
28. 11 1926 - Das Vereinsheim und die Turnhalle des TSV München-Ost sind fertig
München-Obergiesing * Das Vereinsheim und die Turnhalle kann an die Vereinsleitung des TSV München-Ost übergeben werden. Für einige Jahre wird es mit dem Turn- und Sportverein München-Ost noch aufwärtsgehen, doch mit den beginnenden 1930er-Jahren kommt die Wirtschaftskrise und damit verbunden eine hohe Arbeitslosigkeit, die auch die Mitglieder des Sportvereins trifft.
Die dadurch sinkenden Beitragszahlungen machen die Rückzahlung der Bauschulden und die Begleichung der laufenden Kosten immer schwieriger. Die größte Gefahr für den Arbeiterverein kam jedoch von den Nationalsozialisten.
1. 12 1926 - Der Betriebshof bei der Straßenbahn-Direktion wird aufgelassen
München-Haidhausen * Die ab dem Jahr 1925 beschafften Trambahn-Wagen haben auf dem Gelände der Straßenbahn-Direktion in Haidhausen überhaupt keinen Platz mehr. Die Folge sind unwirtschaftliche Leerfahrten zu anderen Betriebshöfen.
Man lässt deshalb den Betriebshof auf und beginnt sofort mit dem Einbau von Büroräumen für die Direktion und einer neuen Fahrerschule in der Motorwagenhalle.
21. 12 1926 - Einstweilige Verfügung gegen das Valentin-Bühnenstück „Im Senderaum“
<p><em><strong>München</strong></em> * Theaterdirektor Hermann Haller, der im Berliner Admiralspalast seine bekannte <em>„Haller Revue“</em> aufführt, erwirkt am Landgericht München I eine einstweilige Verfügung gegen das Valentin-Karlstadt-Bühnenstück <em>„Im Senderaum“</em>. </p> <p>Es geht dabei um Plagiatsvorwürfe gegen Karl Valentin, wobei nicht der Münchner Komiker, sondern der Leiter des Deutschen Theatern, Hans Gruß, der das Valentin-Bühnenstück <em>„Im Senderaum“</em> aufgeführt hat, im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen steht. </p> <p>Hermann Haller behauptet in seiner Anklageschrift, dass Karl Valentin sein später entstandenes Bühnenstück <em>„Im Rundfunksenderaum“</em> aus dem Sketch <em>„Hinter den Kulissen des Rundfunks“</em> von Roland Jeans aus Hermann Hellers Revue <em>„An und Aus“</em> geklaut hätte. Der Kläger verlangt die </p> <ul> <li>Unterlassung der weiteren Karl-Valentin-Aufführungen, </li> <li>Rechnungslegung über die aus den bisherigen Aufführungen erzielten Einnahmen </li> <li>und natürlich Schadensersatz.</li> </ul>
1927 - Münchens erste elektrische Ampel
München-Maxvorstadt * Münchens erste elektrische Ampel leuchtet auf der Nordseite des Bahnhofplatzes.
1927 - Die „Villa Lauer“ wird von den „Suevia-Corpsbrüdern“ gekauft
München-Bogenhausen * Die „Villa Lauer“ in der Neuberghausener Straße 11 wird von den „Suevia-Corpsbrüdern“ für 320.000 Rentenmark gekauft.
Es war das großzügiste und exclusivste Verbindungshaus Münchens.
Ab 1927 - Erste Ausstellungen von Karl Valentins „Alt-Münchner Bildersammlung“
München * Erste Ausstellungen von Karl Valentins „Alt-Münchner Bildersammlung“.
Ab 1927 - Die Landeshauptstadt München lässt einen neuen Museumsbau errichten
München-Maxvorstadt * An der Stelle der abgebrochenen „Heß-Villa“ in der Luisenstraße lässt die Landeshauptstadt München einen neuen Museumsbau errichten.
1927 - Der „Heß-Atelierbau“ und die „Heß-Villa“ werden abgerissen
München-Maxvorstadt * Der „Heß-Atelierbau“ und die „Heß-Villa“ an der Luisenstraße werden abgerissen.
1927 - Der „DuOeAV“ erklärt den „Arier-Paragraphen“ reichsweit für „zulässig“
Wien - München * Der „Deutsche und österreichische Alpenverein - DuOeAV“ erklärt den „Arier-Paragraphen“ reichsweit für „zulässig“.
Bis 1927 - Ein evangelischer „Betsaal“ in der „Volksschule an der Kolumbusstraße“
München-Au * Eine der „Turnhallen“ der „Volksschule an der Kolumbusstraße“ dient der evangelischen Gemeinde bis zum Bau der „Martin-Luther-Kirche“ als „Betsaal“.
1927 - Sie sehen in Adolf Hitler den neuen „Heiland und Erlöser“
Thüringen * Seit dem Jahr 1927 sammeln ehemals bayerische Pfarrer in Thüringen Protestanten, die den „völkischen Enthusiasmus“ an die Stelle des „christlichen Glaubensbekenntnisses“ setzen und in Adolf Hitler den neuen „Heiland und Erlöser“ sehen.
1927 - Josef Bernbacher zieht mit seiner Bäckerei nach Trudering
München-Au - Trudering * Auch wegen des Konkurrenzdrucks der Konsumvereine weicht Josef Bernbacher mit seiner Bäckerei von der Rablstraße 38 nach Trudering aus.
1927 - Gründung des Reichsverbandes für deutschen Seidenbau in Halle
Halle * In Halle kommt es zur Gründung des Reichsverbandes für deutschen Seidenbau.
Eine Denkschrift an den Deutschen Reichstag trägt den Titel „Deutscher Seidenbau schafft Werte für Volk, Staat, Familie, ist Kulturaufgabe, ist soziale Tat“. Natürlich dreht sich bei der schon von nationalsozialistischem Gedankengut durchdrungenen Schrift alles um die „deutsche Seide“, um die „deutsche Maulbeere“ und natürlich um die „deutsche Brut“.
1927 - Die deutsche Turbo-Seidenraupe
Berlin * In Berlin erscheint eine Broschüre mit dem euphorischen Titel: „Doch deutscher Seidenbau! Der lohnende neue Betriebszweig“. In der Broschüre ist die Rede vom „mangelnden Rohstoff im Lande“ und den durch Professor Pasteur besiegten Raupenkrankheiten.
Außerdem hätten deutsche Raupenzüchter neue „Blutlinien“ hervorgebracht, die die „deutsche Raupe“ einen bedeutend längeren Faden spinnen lässt, als ausländische Raupen. Sozusagen die „deutsche Turbo-Seidenraupe“. Und weiter: Es sollte unbedingt die „deutsche Edelbrut“ verwendet werden, da von „ausländischer Brut“ eine erhebliche Infektionsgefahr ausgeht. Schließlich will man sich ja auch die Unabhängigkeit vom Ausland bewahren.
1. 1 1927 - Die evangelische Martin-Luther-Kirche wird eingeweiht
München-Obergiesing * Die Martin-Luther-Kirche ist fertig zur Einweihung. Natürlich erreichte diese Kirche nicht die Dimensionen der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche, ist aber mit elf Metern Breite und 19 Metern Länge durchaus eine der größeren evangelischen Kirchen Münchens. Auf jeden Fall ist sie die höchstgelegene.
Bereits am Tag der Einweihung reichen ihre 800 Plätze nicht mehr aus für die hereindrängenden Giesinger Protestanten. Anders als bei früheren Kirchenbauten ist hier ein Zentrum mit Kirche und großem Pfarrhaus entstanden. Trotz der hohen Kosten von 971.225 Mark kann man die Kirche noch mit reichem Bauschmuck und einer Orgel ausstatten.
Außen, auf der Bronzetür des Hauptportals, sind die wichtigsten der 95 Thesen Luthers zu lesen; rechts und links davon stehen die Figuren der vier Evangelisten und der vier großen Propheten. Das Innere der Kirche ist mit Gemälden ausgestattet, die alle einem theologischen oder geschichtlichen Programm folgen.
5. 1 1927 - Das Landgericht München I hebt die einstweilige Verfügung wieder auf
München * Das Landgericht München I hebt in der Widerspruchsverhandlung die einstweilige Verfügung wieder auf, die Hermann Haller gegen das Valentin-Karlstadt-Bühnenstück „Im Senderaum“ am 21. Dezember 1926 erwirkt hatte.
Theaterdirektor Hermann Haller zieht nach dieser Niederlage vor das Oberlandesgericht München. Und nachdem er auch dort nicht zu seinem Recht kommt, zieht er vor das Reichsgericht in Leipzig.
8. 1 1927 - Rudolph Karstadt übernimmt das Kaufhaus Oberpollinger
München-Kreuzviertel * Nachdem sich die hanseatische Kaufmannsfamilie Emden & Söhne aus München zurückzieht, übernimmt Rudolph Karstadt für drei Millionen Reichsmark das Kaufhaus Oberpollinger in der Neuhauser Straße.
16. 4 1927 - Papst Benedikt XVI. wird in Marktl geboren
Marktl * Joseph Aloisius Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., wird in Marktl geboren.
2. 5 1927 - Karl Valentin absolviert die Fahrschule, macht aber keinen Führerschein
München * Karl Valentin besucht eine Fahrschule zum Erwerb des Führerscheins.
Obwohl man ihm bestätigt, dass er „an 13 verschiedenen Tagen eine Gesamtstrecke von 150 km während eines Zeitraumes von im ganzen 8 ¾ Stunden unter Aufsicht auf öffentlichen Wegen und Plätzen gelenkt hat“, legt er - trotz dreimaliger Aufforderung - die Prüfung nicht ab.
23. 5 1927 - Dieter Hildebrandt kommt in Bunzlau (Schlesien) zur Welt
Bunzlau * Dieter Hildebrandt kommt in Bunzlau (Schlesien) zur Welt.
3. 6 1927 - Josephine Baker heiratet Giuseppe Pepito Abatino
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Josephine Baker heiratet den sizilianischen Steinmetz Giuseppe Pepito Abatino, der bereits zuvor künstlerisch in ihren Shows mitgewirkt hat. Abatino gibt sich als Graf Di Albertini aus. Damit trägt Josephine als erste schwarze Amerikanerin aus Publicity-Gründen einen europäischen Adelstitel.</p>
7. 6 1927 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Im Photoatelier“
München-Maxvorstadt * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Im Photoatelier“ im Apollo-Theater in der Dachauer Straße 19. Das Stück wird 348 Mal gespielt.
26. 7 1927 - Das Kennedy-Brünnlein spendet erstmals Wasser
München-Ramersdorf * Das Kennedy-Brünnlein an der Ramersdorfer Kirchhofmauer spendet erstmals Wasser.
31. 8 1927 - Fritz Gerlich untersucht die Stigmatisierung der Resl von Konnersreuth
Konnersreuth * Im Auftrag der Münchner Neuesten Nachrichten untersucht Dr. Fritz Gerlich die rätselhafte Heilung und Stigmatisierung der Therese Neumann von Konnersreuth. Gerlich will - wie er sagt - „dem Schwindel auf die Spur kommen“.
2. 10 1927 - Anton Graf Arco auf Valley wird endgültig amnestiert
Berlin - München * Aus Anlass des 80. Geburtstags des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg wird der Kurt-Eisner-Mörder Anton Graf Arco auf Valley endgültig amnestiert. Eine Amnestie beseitigt weder das Urteil noch die Schuld des Straftäters. Sie ist in diesem Fall ein vollständig erfolgter Straferlass.
1928 - Antonie (Toni) Pfülf zieht in das Gartenhaus der Kaulbachstraße 12
München-Maxvorstadt * Die „Hauptlehrerin“ und „SPD-Aktivistin“ Antonie (Toni) Pfülf zieht in das Gartenhaus der Kaulbachstraße 12.
1928 - Dreharbeiten zur Stummfilmversion der „Orchesterprobe“ entsteht
München * Dreharbeiten zur Stummfilmversion der „Orchesterprobe“ entstehen.
Der Film ist verschollen.
Um 1928 - Der Stummfilm „In der Schreiner-Werkstätte“ entsteht
München * Der Stummfilm „In der Schreiner-Werkstätte“ entsteht.
In den Hauptrollen spielen Karl Valentin und Liesl Karlstadt.
Der Film, der Teil einer Tonfilmimitation ist, gilt als verschollen.
1928 - Dr. med. Alfred Haas kauft das Anwesen in der Richard-Wagner-Straße 17
München-Maxvorstadt * Dr. med. Alfred Haas kauft das Anwesen in der Richard-Wagner-Straße 17.
1928 - Dr. Fritz Gerlich verlässt die „Münchner Neuesten Nachrichten“
München * Nach einer Auseinandersetzung mit der Verlagsleitung verlässt Dr. Fritz Gerlich die „Münchner Neuesten Nachrichten“.
Ab 1928 - Dr. Fritz Gerlich und der „Konnersreuther Kreis“
München * Dr. Fritz Gerlich bewegt sich verstärkt in katholischen Kreisen.
Im „Konnersreuther Kreis“ finden sich konservative Katholiken zusammen, die die „Weimarer Republik“ retten wollen und „gegen die immer schärfere Radikalisierung des deutschen politischen Lebens eine Zeitung zu schaffen, um der Gefahr dieser Entwicklung mit der Macht des Naturrechts und der Festigkeit der christlichen Grundsätze entgegenzutreten“.
1928 - Die „Museum-Lichtspiele“ werden umgebaut und erweitert
München-Au * Wilhelm van Laak und Valentin Neumeier übernehmen die „Museum-Lichtspiele“ in der Lilienstraße 2.
Das Kino wird umgebaut und das Fassungsvermögen auf 280 Plätze erhöht.
Ab 1928 - Die Holzkonstruktion der „Mariannenbrücke“ wird durch Stahlbeton ersetzt
München-Lehel * Die Holzkonstruktion der „Mariannenbrücke“ wird durch die noch heute bestehende Stahlbetonbrücke ersetzt.
1928 - Die „Moriskentanzfiguren“ werden durch Kopien ersetzt
München-Graggenau * Die „Moriskentanzfiguren“ von Erasmus Grasser aus dem „Festsaal des Alten Rathauses“ werden abgenommen und durch Kopien ersetzt.
Die Originale werden im „Bayerischen Nationalmuseum“ zunächst untersucht, restauriert und anschließend ausgestellt.
Bei der Restaurierung bleibt eine Figur umgefasst, um so die charakteristische Schnitzarbeit Erasmus Grassers darstellen zu können.
1928 - Anton Lindner wird aus dem „Zuchthaus Straubing“ entlassen
Straubing * Anton Lindner wird aus dem „Zuchthaus Straubing“ entlassen.
Anfang der 1930er-Jahre geht er ins sowjetrussische Exil.
Seine Spur verliert sich im Jahr 1943.
1928 - Die Ein- und Verkaufsgenossenschaft für das Droschkengewerbe Münchens
München * Die am 7. November 1917 von den Münchner „Kraft- und Pferdedroschkenbesitzern“ gegründete „Einkaufsgenossenschaft“ wird in „Ein- und Verkaufsgenossenschaft für das Droschkengewerbe Münchens, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung“ umbenannt.
Der Grund ist der Rückgang der von Pferden gezogenen Kutschen.
Ab dem 1 1928 - Karl Valentin soll die Rolle des „Froschs“ in der „Fledermaus“ übernehmen
München-Graggenau * Karl Valentin soll im Januar und Februar insgesamt acht Mal die Rolle des „Froschs“ in der „Fledermaus“ übernehmen.
Pro Auftritt sollte der Komiker eine Gage von 300 Mark erhalten.
Das entspricht dem Monatsgehalt eines verheirateten Beamten mit zwei Kindern.
Doch Karl Valentin schreibt dem „Generalintendanten der Bayerischen Staatstheater“, Erwin Georg Heinrich Karl Bonaventura Klemens Freiherr von Franckenstein einen Brief, in dem er das Engagement aus gesundheitlichen Gründen absagt.
14. 1 1928 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Berliner Kabarett der Komiker
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im Berliner Kabarett der Komiker auf. Das Engagement ist ursprünglich bis zum 20. Februar geplant. Vier Stücke spielt das Komikerpaar Valentin-Karlstadt: „Der Firmling“, „Die Orchesterprobe“, „Der reparierte Scheinwerfer“ und „Im Senderaum“. Während die anderen Stücke Pulikumsrenner sind, fällt „Der Firmling“ bei den Berlinern durch.
Der Überredungskunst Liesl Karlstadts ist es zu verdanken, dass er dem Wunsch der Theaterleitung zustimmt und seine Auftritte Ende des Monats ausdehnt. Er erhält dafür - mit 350 Mark für täglich zwei Vorstellungen - die höchste Gage, die je einem Gaststar im Kabarett der Komiker bezahlt worden ist. Gutes Geld vermindert scheinbar das Heimweh des Volkssängers.
2 1928 - Beim „Faschingszug“ reitet der „Cowboy Club München München Süd“ mit
München * Beim ersten „Faschingszug“ nach dem Ersten Weltkrieg nimmt der „Cowboy Club München München Süd“ mit 25 Indianern und Cowboys teil.
Als Motto geben sie sich „Auswanderer“.
2 1928 - Parlamentarischer Disput über Josephine Bakers Auftritt
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Als Josephine Baker für Februar 1928 einen Auftritt im Wiener Ronacher ankündigt, gehen die Wogen hoch. Eine fast nackte, dunkelhäutige Frau ist für das Wien der 1920er-Jahre zu viel. Die konservativen und katholischen Kreise protestieren, organisieren Aufmärsche und warnen, dass <em>„der schwarze Teufel kommt“</em>.</p> <p>Tageszeitungen sprechen vom <em>„Negerskandal“</em>, Vertreter der katholischen Kirche organisieren Sondergottesdienste zur Buße gegen Bakers <em>„schwere Verstöße gegen die Moral“</em>, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP - Wiens protestiert gegen ihre <em>„obszönen“</em> Auftritte und fordert ein Auftrittsverbot.</p> <p>Es wird öffentlich und sogar im Parlament diskutiert, ob man ihren Auftritt nicht verbieten sollte. Ein christsozialer Abgeordneter meint, dass Josephine Baker eine Gefährdung der öffentlichen Moral sei. <em>„Wir können keine pornografischen Tanzaufführungen zulassen.“</em> Worauf ein liberaler Abgeordneter kontert: <em>„Gott hat die Menschen nackt erschaffen. Wenn wir Nacktheit verbieten, kommt das Blasphemie gleich.“</em></p>
1. 3 1928 - Josephine Baker im Wiener Johann-Strauß-Theater
<p>Wien * Infolge des öffentlichen Drucks erhält das Ronacher keine Bewilligung für die Josephine-Baker-Show. Der Kompromiss ist, dass Baker ab dem 1. März für sechs Wochen im Johann-Strauß-Theater in der Revue <em>„Schwarz auf Weiß“</em> anstatt in einer Solo-Show auftritt. </p>
5. 3 1928 - Nacktarbeit im Bakergewerbe verboten
<p>Wien * Im <em>„Morgen“</em> ist zu lesen, dass in Erfahrung gebracht wurde, dass <em>„Dr. Jerzabek und Genossen ein Gesetz einzubringen gedenken, wodurch die Nacktarbeit im Bakergewerbe verboten wird.“</em></p>
9. 3 1928 - Josephine Baker ist keine Menschenfresserin
<p>Wien * Die satirische Zeitung <em>„Götz von Berlichingen“</em> schreibt: <em>„Die Gerüchte, wonach Josephine Baker eine Menschenfresserin sein soll, beruhen auf der tendenziösen und böswilligen Entstellung dermTatsache, daß sie neulich im Café einen Weißen verlangt hat.“</em> </p>
18. 4 1928 - Das Reichsgericht in Leipzig beendet den Plagiats-Rechtsstreit
<p><strong><em>Leipzig</em></strong> * Das Reichsgericht in Leipzig beendet einen Rechtsstreit in letzter Instanz, in dem es um Plagiatsvorwürfe gegen Karl Valentin geht. Der Prozess dauert bereits eineinhalb Jahre und ist vom Berliner Theaterdirektor vom <em>„Admiralspalast“</em>, Hermann Haller, mit außergewöhnlicher Heftigkeit durch drei Instanzen durchgepeitscht worden. Vom Landgericht München I über das Oberlandesgericht München bis hinauf zum Reichsgericht in Leipzig.</p> <p>Hermann Haller hat den Direktor des Deutschen Theaters in München, Hans Gruß, verklagt, weil er das Valentin-Bühnenstück „Im Senderaum“ aufführte und verlangt dafür Schadensersatz. Der Kläger behauptet, dass Karl Valentin sein Bühnenstück <em>„Im Senderaum“</em> aus dem Sketch <em>„Hinter den Kulissen des Rundfunks“</em> von Roland Jeans aus Hermann Hellers Revue <em>„An und Aus“</em> geklaut hätte.</p> <p>Das höchste deutsche Gericht kommt jedoch zur Auffassung, dass sich Valentins Werk grundlegend vom Sketch von Roland Jeans unterscheidet und es sich dabei um zwei völlig eigenständige Arbeiten handelt. Der Plagiatsvorwurf gegenüber Karl Valentin und alle sonstigen Beschuldigungen werden vom Gericht als völlig haltlos zurückgewiesen.</p> <p>In der Urteilsbegründung heißt es: Der Vergleich der beiden Stücke <em>„beweise auf das bündigste, dass Karl Valentin nicht das vorbestehende Bühnenstück von Roland Jeans nachgeschrieben, sondern etwas völlig anderes eigenschöpferisch neu geschaffen habe“</em>.</p> <p>Damit stellt das Reichsgericht auch fest, dass Valentin gar nicht in der Lage ist, <em>„etwas Vorgegebenes nachzumachen, gar nachzuschreiben oder auch nur nachzuspielen“</em>. </p>
Ab 5 1928 - Proteste gegen Baker-Auftritt in Budapest, Stockholm und Zagreb
<p><strong><em>Europa</em></strong> * Nicht nur in Wien, sondern auch in Budapest, Stockholm und Zagreb kommt es während Josephine Bakers Europa-Tournee zu zum Teil massiven Protesten. Ihr Kommentar zu solchen Vorkommnissen lautete nur: <em>„Farbige sind nicht genötigt, zu provozieren: Die Zwischenfälle ereignen sich ganz von alleine.“</em></p>
6 1928 - Der „Bugatti Royale Typ 41“ erstmals beim „Großen Preis von Deutschland“
Nürburgring * Beim „Großen Preis von Deutschland“ am „Nürburgring“ wird der „Bugatti Royale Typ 41“ erstmals öffentlich vorgeführt.
Das Auto ist sechs Meter lang, schluckt fünfzig Liter Benzin pro hundert Kilometer und erreicht dank seines 300 PS starken Motors eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.
14. 6 1928 - Erste Schallplattenaufnahmen der Monologe und Couplets von Karl Valentin
München-Isarvorstadt * Erste Schallplattenaufnahmen der Monologe und Couplets von Karl Valentin im Auftrag der Carl Lindström AG im kleinen Saal des Varietés Kolosseum.
18. 6 1928 - Der Schülein-Brunnen am Schüleinplatz geht in Betrieb
München-Berg am Laim * Der Schülein-Brunnen am Schüleinplatz wird in Betrieb genommen.
8 1928 - „Eine Stätte solider Trinkfestigkeit scheint der Ratskeller zu sein“
München-Graggenau * In der „Stadtchronik“ ist zu lesen:
„Eine Stätte solider Trinkfestigkeit scheint der Ratskeller zu sein; dort und in der Regieweinkellerei wurden im letzten Jahre 195.000 Flaschen Rot- und Weißweine und 5.000 Flaschen Schaumweine umgesetzt und hierfür 560.000 Mark eingenommen; 285.000 Mark wurden wieder für Weinankauf ausgegeben, einschließlich Fracht, Umsatzsteuer, Weinproben und Reisekosten; von dem Gesamtumsatze von 567.000 Mark werden 20.000 Mark an den Gemeindehaushalt abgeliefert“.
23. 8 1928 - Premiere des Valentin-Stücks Der Flug zum Mond im Rakentenflugzeug
München-Isarvorstadt * Uraufführung des als technische Bühnenneuheit angepriesen Karl-Valentin-Stücks „Der Flug zum Mond im Rakentenflugzeug“ im Kolosseum, Kolosseumstraße 4. Das Stück erlebt 64 Vorstellungen.
30. 8 1928 - Franz von Stuck stirbt im Alter von 65 Jahren
München * Franz von Stuck stirbt im Alter von 65 Jahren in München. Seine Asche wird am Nordfriedhof beigesetzt.
9 1928 - Carl Gabriel betreibt fünf Attraktionen auf dem „Oktoberfest“
München-Theresienwiese * Carl Gabriel betreibt fünf Geschäfte auf dem „Oktoberfest“.
Darunter
- „Carl Gabriel's und Ehrlich's Riesen-Völkerschauen“,
- „Carl Gabriel's Pracht-Reitbahn (Hippodrom)“,
- „Carl Gabriel's und L. Ruhe's Riesen Orang-Utan-Schau aus den Urwäldern Sumatras“ und
- „Carl Gabriel's Jagd- und Preis-Schießen, Schießen am Walde auf laufende Tiere mit echten Jagdgewehren und mit echter Munition!“
Für die „Orang-Utan-Schau“ wurden im Frühjahr 85 Exemplare dieser äußerst seltenen Affenart auf der Insel Sumatra gefangen und nach Europa gebracht.
Dabei verendete ein Großteil der Tiere.
Einzelne der kostbaren Orang-Utans wurden an zoologische Gärten verkauft, der Rest wurde in einem beheizbaren Käfig dem Publikum gezeigt.
10 1928 - Rudolph Karstadt gibt das „Magazin für Mode, Heim und Welt“ heraus
München-Kreuzviertel * Rudolph Karstadt veröffentlicht alle 14 Tage das „Magazin für Mode, Heim und Welt“, eine Kundenzeitung zum Preis von 10 Pfennigen.
Es enthält aktuelle Modetipps und Schnittmuster, Kurzgeschichten, Witze und Sportreportagen.
12 1928 - Die ersten 23 Hinrichtungen des „Scharfrichters“ Johann Reichhart
München * Seit seinem Amtsantritt im April 1924 hat der „Scharfrichter“ Johann Reichhart insgesamt 23 Delinquenten hingerichtet.
1929 - Der Film „Karl Valentins humoristische Wochenschau“ wird gedreht
München * Der verschollene Film „Karl Valentins humoristische Wochenschau“ entsteht.
Um 1929 - Der Stummfilm „Die beiden Musikal-Clowns“ wird gedreht
München * Der Stummfilm „Die beiden Musikal-Clowns“ nach der Originalszene „Die verhexten Notenständer“ von Karl Valentin und Liesl Karlstadt entsteht.
1929 - Der Stummfilm „Mit dem Fremdenwagen durch München“ entsteht
München * Der Stummfilm „Mit dem Fremdenwagen durch München“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt als „Erzähler“ und Josef Rankl als „Fremdenautoführer“ entsteht.
Es ist der Anfangs- und Schlussfilm einer multimedialen Live-Darbietung mit Lichtbildern.
Er wird im Rahmen des von Walter Jerven moderierten Stummfilmprogramms „Aus der Kinderstube des Films“ gezeigt.
1929 - Die „Löwenbräu AG“ knackt die „Ein-Millionen-Hektoliter-Grenze“
München-Maxvorstadt * Die „Löwenbräu AG“ kann als erste Münchner Brauerei die „Ein-Millionen-Hektoliter-Grenze“ durchbrechen.
1929 - Von der „Kunstgewerbeschule“ zur „Staatsschule für angewandte Kunst“
München-Maxvorstadt * Die „Kunstgewerbeschule“ wird in „Staatsschule für angewandte Kunst“ umbenannt.
1929 - Richard-Wagner-Straße 3 und 5 gehören den „I. G. Farben“
München-Maxvorstadt * Die Anwesen Richard-Wagner-Straße 3 und 5 gehören den „I. G. Farben Aktiengesellschaft, Frankfurt Hoechst“.
Die „I. G. Farben“ war eine Partnerin der US-amerikanischen Firma „Standard Oil“.
Sie beliefert später die deutschen „Vernichtungslager“ mit dem tödlichen Gas „Zyklon B“.
1929 - „Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth“
München * Dr. Fritz Gerlichs zweibändiges, 700 Seiten langes Werk „Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth“ erscheint.
1929 - Das „Wählsystem 29“ kommt im Fernmeldenetz zum Einsatz
Deutsches Reich * Das mit dem kostengünstiger zu produzierenden Flachrelais ausgestattete „Wählsystem 29“ kommt im Fernmeldenetz zum Einsatz.
1929 - Frauen wird die Aufnahme in den „Cowboy Club München Süd“ verweigert
München * Frauen wird die Aufnahme in den „Cowboy Club München Süd“ verweigert.
Die Regelung gilt bis in die 1980er Jahre.
Erst nach 2000 wird den Frauen eine „aktive Mitgliedschaft“ ermöglicht.
20. 1 1929 - Wiederentdeckte Valentin-Stummfilme
München-Hackenviertel * Der Filmsammler und Publizist Walter Jerven führt die wiederentdeckten Stummfilme „Valentins Hochzeit“ aus dem Jahr 1914 und „Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Oktoberfestwiese“ im Ufa-Theater am Sendlinger Tor vor. Unter dem Titel „Aus der Kinderstube des Films“ werden die Streifen in einer Matineeveranstaltung der Bayerischen Landesfilmbühne gezeigt.
2 1929 - Die Wiederentdeckung des Valentin-Films „Die lustigen Vagabunden“
München * Wiederentdeckung des Karl-Valentin-Stummfilms „Die lustigen Vagabunden“ aus dem Jahr 1914.
13. 2 1929 - Premiere: „In der Schreiner-Werkstätte“
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Premiere der Valentin-Karlstadt-Tonfilmimitation <em>„In der Schreiner-Werkstätte“</em> im Apollotheater. Während auf der Leinwand der Film läuft, wird dahinter die dazu passende Tonkulisse erzeugt. <br /> Die <em>„Münchner Neuesten Nachrichten“</em> schreiben dazu: <em>„Man hört Hunderte verschiedene Geräusche, fallende Bretter, Suppenlöffel, Säge, Laufschritte usw.: sehr deutlich ist das, was gesprochen, gezankt wird; und sogar durchaus synchron.“</em> </p>
14. 2 1929 - Auftrittsverbot für Josephine Baker
<p><strong><em>München</em></strong> * Wegen einer zu erwartenden <em>„Verletzung des öffentlichen Anstands“</em> erteilt die Stadt München der Tänzerin Josephine Baker zwei Tage vor ihrem Engagement im Deutschen Theater ein Auftrittsverbot. Der Grund: Ihr <em>„Bananentanz“</em> verstößt gegen die <em>„guten Sitten“</em>. </p>
16. 2 1929 - Der abgesagte Auftritt der Josephine Baker
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Vom 16. bis 20. Februar 1929 soll Josephine Baker im Deutschen Theater auftreten. Zwei Tage vorher wird ihr Auftritt verboten. </p>
19. 2 1929 - Josephine-Baker-Film im Münchner Lichtspielhaus
<p><strong><em>München</em></strong> • Die <em>„Münchner Zeitung“</em> berichtet: <em>„Josefine Baker, das umstrittene, farbige Tanzwunder, tanzt ab heute in ihrem ersten Großfilm ‚Papitou, die Sirene der Tropen‘ im Münchner Lichtspielhaus.“</em></p>
3. 3 1929 - Erfolg in Berlin: Aus der Kinderstube des Films
Berlin * Im Berliner Kino Kapitol am Zoo werden die unter dem Titel „Aus der Kinderstube des Films“ zusammengefassten Karl-Valentin-Filme gezeigt. Der Münchner Komiker wird von der überregionalen Filmkritik gefeiert.
9. 3 1929 - Karl Valentin vergrößert seinen Planegger Besitz
Planegg * Karl Valentin vergrößert um 3.800 Mark seinen Planegger Besitz durch den Ankauf von weiteren 1.348 qm Grund.
4 1929 - Die „Karl Valentin Filmproduktion“ wird gegründet
München * Walter Jerven, Johannes Eckhardt, Karl Valentin und Liesl Karlstadt gründen die „Karl Valentin Filmproduktion“.
Um 4 1929 - Der „Brunnen mit jagdbaren Tieren” wird gebaut
München-Haidhausen * Der Brunnen im heutigen „Bordeauxplatz“ mit einer Abmessung von 20 auf 9 Metern wird gebaut.
Wegen seiner vier Tierskulpturen erhält er den in herrlich trockener Beamtenlyrik gehaltenen Namen „Brunnen mit jagdbaren Tieren”.
Zuvor befindet sich am „Forum“ an der Wörthstraße ein sogenannter „Kustermannbrunnen“.
Darunter versteht man einen klassischen Münchner Trinkbrunnen mit einer gusseisernen Stele und einer Dackeltränke, den „Kommerzienrat“ Max Kustermann den Haidhausern schenkt.
3. 4 1929 - Das Apollo-Theater wird geschlossen
München-Maxvorstadt * Das Apollo-Theater in der Dachauer Straße 19 wird geschlossen.
5 1929 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Films „Fern-Kino“
??? * Der Valentin-Karlstadt-Stummfilm „Fern-Kino“ wird im „Filmpalast“ uraufgeführt.
1. 5 1929 - Die „Städtische Galerie am Lenbachhaus“ wird eröffnet
München-Maxvorstadt * Die „Städtische Galerie am Lenbachhaus“ in der Luisenstraße wird eröffnet.
Nach dem 29. 5 1929 - Filmpremiere: „Wochenschau von Karl Valentin und Liesl Karlstadt“
München * Uraufführung der „Wochenschau von Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Serie 14“.
7. 6 1929 - Der Young-Plan regelt die deutschen Reparationen neu
Paris * Der Young-Plan regelt die deutschen Reparationen neu. Das Deutsche Reich soll 112 Milliarden für die Dauer von 58 Jahren zahlen.
Um 8 1929 - Ein „Florida für die Armen“ mitten in Haidhausen
München-Haidhausen * In der „Münchner Chronik“ der „Süddeutschen Sonntagspost“ findet sich eine Reportage über die Vorkommnisse während der besonders heißen „Hundstage“.
Ein Journalist beschreibt darin, mit welcher jubelnder Begeisterung die Haidhauser, besonders die Kinder, den neuen Brunnen angenommen haben.
„Der Magistrat“, so der Zeitungsschreiber, hat den Kindern „ein kleines Paradies“ spendiert, ein „Florida für die Armen“, mit frischem, kaltem Wasser und einer Fontäneninsel in der Mitte, bei dem eigentlich nur die einladende Tafel „Familienbad für Kinder“ fehlt.
Die Kleinen waten „lustig hinein in den Märchenbrunnen zu den dreißig anderen, die da planschen und spritzen, pfeifend und singend, umgeben von einem Kranz wohlwollender erwachsener Zuschauer”.
Ein wahres Geschenk, denn die Badeanstalt kostet „ein Zehnerl Eintritt, das man erst haben muß, wenn man es ausgeben will”.
Der gelobte „Münchner Stadtrat“ reagiert auf die Hymnen unbeholfen und verlegen.
Denn, so die Verlautbarung, er „hat gar nicht gewußt, was die Haidhauser Wirbelköpfe aus seinem Brunnen gemacht haben!“
Und weiter, die „Stadtverwaltung“ hat „es erst erfahren durch Zuschriften einiger galliger Umbewohner, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen, die nicht verstehen, daß diese kleinen blassen Körperchen, die trotz der Ferien ans Großstadtpflaster gebannt sind, sich ein wenig austollen wollen.
Ruhestörung! Es war ein Irrtum.
Der Brunnen ist mißverstanden worden von den Kindern, von den Zuschauern, sogar von dem wackeren Polizeimann, der schmunzelnd vorbeiging und ebenfalls dachte, es sei ganz in Ordnung so“.
Im Gegenteil. „Die Haidhauser hatten das Waten einfach auf eigene Faust eingeführt“ und angesichts der „Hundstage“ die „amtliche Billigung“ vorausgesetzt, muss sich der Journalist von der Stadtverwaltung belehren lassen.
Natürlich muss ein Schild her, eine „leuchtende Verbotstafel“ mit der Aufschrift „Waten und Baden verboten“.
Die sarkastische, weder die Stadtverwaltung noch die Miesmacher schonende Reportage stammt aus der Feder des nachmaligen „SZ-Chefredakteurs“ und „Herausgebers der Münchner Abendzeitung“, Werner Friedmann.
Um 9 1929 - Dreharbeiten zu Valentins Stummfilm „Der Sonderling“
München-Geiselgasteig * Die Dreharbeiten zu Karl Valentins ersten langen Stummfilm „Der Sonderling“ beginnen.
9 1929 - Konsul Heilmann ersteigert die „Villa Stuck“
München-Haidhausen * Konsul Albert Heilmann, der Ehemann der Stuck-Tochter Mary, erhält für sein Gebot von 351.000 Mark den Zuschlag für die „Villa Stuck“.
Die Versteigerung kam zustande, weil sich die Witwe und die Tochter Stuck nicht über den Wert des Hauses einigen konnten.
27. 10 1929 - Mary von Stuck stirbt.
München-Haidhausen * Mary von Stuck, die Witwe des berühmten Malerfürsten, stirbt.
29. 10 1929 - Der Schwarze Freitag ist ein Dienstag
USA * Der „Schwarze Freitag“ wird mit einem legendären Börsencrash in den USA in Verbindung gebracht, der durch eine Spekulationsblase ausgelöst wird.
In den sogenannten Goldenen Zwanziger Jahren steigen die Aktienkurse ununterbrochen. Viele Anleger träumen vom großen Geld und nehmen sogar Kredite auf, um Aktien zu kaufen. Als dann die Aktien stagnieren bricht am Donnerstag, dem 24. Oktober eine Panik an der Wall Street aus. Der Handel bricht mehrmals zusammen. Das ist der Beginn einer Wirtschaftskrise, die alle Industrienationen betrifft. Massenarbeitslosigkeit und Deflation sind die Folge.
Der Crash zieht sich über Tage hin. Am Dienstag, dem 29. Oktober versuchen viele Investoren gleichzeitig ihre Aktien zu verkaufen. Damit fällt der „Schwarze Freitag“ auf einen Dienstag, weshalb die Amerikaner auch vom „Black Thursday“ sprechen.
11 1929 - Adolf Hitler zieht in eine 317 Quadratmeter große Neun-Zimmer-Wohnung
München-Haidhausen * Adolf Hitler zieht aus seinem kleinen Zimmer im Lehel hinauf in das noble Viertel um das „Prinzregententheater“, in eine 317 Quadratmeter große Neun-Zimmer-Wohnung.
Sein sozialer und politischer Aufstieg ist durch das Großbürgertum gefördert und finanziert worden.
Hugo Bruckmann hilft Hitler bei der Finanzierung der Wohnung, nachdem sich der Vermieter zunächst skeptisch zeigt, ob denn der neue Mieter überhaupt in der Lage ist, die Jahresmiete von 4.176 Reichsmark bezahlen zu können.
Erst nachdem Bruckmann für die pünktliche Bezahlung der Miete bürgt, wird der Mietvertrag abgeschlossen.
Geli Raubal, Hitlers Nichte, zieht ebenfalls in die Wohnung ihres Onkels am Prinzregentenplatz 16 ein.
Das „Medizinstudium“ gibt „Geli“ nach einem Semester auf, da sie „Wagner-Sängerin“ werden will.
Hitler bezahlt den Gesangsunterricht.
Doch ihre begrenzte Begabung und das Leben im Glanz des aufstrebenden Polit-Stars lenkt sie stark von intensiver Gesangsarbeit ab.
Ab dem 1. 11 1929 - Gastspiel von Karl Valentin und Liesl Karlstadt in Berlin
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt geben ein Gastsspiel im Kabarett der Komiker in Berlin. Im November geben sie das Bühnenstück „Im Photoatelier“.
1. 12 1929 - Die SA-Männer meiden das Rote Giesing
München - München-Giesing * Kurz vor der Gemeindewahl zieht ein Propaganda-Umzug mit zweitausend SA-Männern fünf Stunden lang durch Münchens Straßen, um sich den Münchner Wählern als dynamische und entschlossene Partei darzustellen. Doch das unsichere Terrain des „Roten Giesing“ meiden sie, wie der Teufel das Weihwasser.
Ab dem 1. 12 1929 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielen in Berlin „Die Orchesterprobe“
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielen im BerlinerKabarett der Komiker das Bühnenstück „Die Orchesterprobe“ (= „Tingeltangel“).
8. 12 1929 - Karl Scharnagl [BVP] wird erneut Oberbürgermeister
München * Bei der Kommunalwahl erringt
- die SPD 17 Sitze und wird damit stärkste Fraktion.
- Die BVP verliert leicht und erreicht 12 Sitze.
- Die NSDAP kann 8 Sitze erreichen.
Karl Scharnagl [BVP] wird erneut Oberbürgermeister.
28. 12 1929 - Uraufführung des Stummfilms „Der Sonderling“
München * Uraufführung des Stummfilms „Der Sonderling“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt in den Hauptrollen in drei Münchner Kinos. Der Film wird 1942 von der NS-Zensur wegen „Verletzung des künstlerischen Empfindens“ verboten.
1930 - Die Zahl der „Weinwirtschaften“ in München hat sich auf 74 reduziert
München * Die Zahl der „Weinwirtschaften“ in München hat sich auf 74 reduziert.
1930 - Liesl Karlstadt wagt den künstlerischen Alleingang
München * Liesl Karlstadt wagt den künstlerischen Alleingang.
Sie nimmt professionellen Schauspielunterricht bei Adele Feldern-Förster.
Um 1930 - Tonfilmprobeaufnahmen der Valentin-Soloszene „Der Feuerwehrtrompeter“
München-Maxvorstadt * Es entstehen Tonfilmprobeaufnahmen der Valentin-Soloszene „Der Feuerwehrtrompeter“ im „Arri-Atelier“ in München.
1930 - Die Familie Haas zieht in die Richard-Wagner-Straße 17
München-Maxvorstadt * Die Familie Haas zieht von der Richard-Wagner-Straße 19 in den ersten Stock des Hauses Nr. 17.
1930 - Neuer Leiter der „Museum-Lichtspiele“ ist Erich König
München-Au * Neuer Leiter der „Museum-Lichtspiele“ ist Erich König.
1930 - Die beiden Grützner-Kinder versteigern alle Güter
München-Haidhausen * Die beiden Grützner-Kinder versteigern alle Güter - einschließlich der umfangreichen und kostbaren Antiquitätensammlung.
Die „Künstler-Villa“ erwirbt die Studentenvereinigung „Danubia“, die einige Räume umbauen lässt.
1930 - Die Gebäude der „Untergiesinger Lederfabrik“ werden abgebrochen
München-Untergiesing * Die Fabrikgebäude der „Untergiesinger Lederfabrik“ werden abgebrochen.
1930 - Das „Deutsche Theater“ ist Münchens zweitgrößtes Kino
München-Ludwigsvorstadt * Das „Deutsche Theater“ ist Münchens zweitgrößtes Kino.
Ab Ostern 1930 - Die politischen Unruhen im roten Giesing wachsen
München-Obergiesing * Während der Wirtschaftskrisen wachsen die politischen Unruhen im roten Giesing, sodass mehrmals Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche gegen kommunistische Störer geschützt werden müssen.
Der Grund ist, dass viele Giesinger Gemeindemitglieder im Nationalsozialismus den „Retter religiöser Werte“ sehen.
Spätestens seit 1930 - Karl Valentin plant ein Buch über seine Jugenderlebnisse
München-Lehel * Der Komiker Karl Valentin beginnt „die mir noch in Erinnerung gebliebenen Erlebnisse aus meiner Jugend-, Jünglings- und Mannszeit“ zu sammeln.
Das geplante Buch, das „eine Reihe hübscher Jugendbegebenheiten, illustriert von Ludwig Greiner“ enthalten soll, wird so nie veröffentlicht.
Die „Süddeutsche Sonntagspost“ bringt ab dem 28. August 1932 einige Auszüge.
Erst 1951 werden „Die Jugendstreiche des Knaben Karl“ veröffentlicht.
Gerhard Pallmann gibt eine Zusammenstellung aus Karl Valentins Nachlass heraus.
Um das Jahr 1930 - Ein Dienstkleid aus blauem Baumwollstoff
Berlin * Die weiblichen Telefon-Vermittlungskräfte müssen ein Dienstkleid aus blauem Baumwollstoff tragen, das nach der Vorschrift mindestens zwanzig Zentimeter unter das Knie zu reichen hat.
1930 - Das Inventar aus den Schlössern „Biederstein“ wird versteigert
München-Schwabing * Das Inventar aus den Schlössern „Biederstein“ wird versteigert.
1930 - Erfolg: Ludwig Thoma wird die bösartige Figur des „Dr. Matthäi“.
München * Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger verarbeitet Ludwig Thoma in seinem Roman „Erfolg“ in der bösartigen Figur des „Dr. Matthäi“.
Ab dem 1. 1 1930 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielen das „Clownsduett“ in Berlin
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im Berliner Kabarett der Komiker mit dem Bühnenstück „Clownsduett“ (= „Die verhexten Notenständer“) auf. Das Berliner Engagement endet am 15. Januar.
2 1930 - Der „Cowboy Club München Süd“ tritt im „Tierpark Hellabrunn“ auf
München-Untergiesing * Der „Faschingszug“ fällt aus.
Im „Tierpark Hellabrunn“ wird ein Ersatzfasching abgehalten, bei dem sich der „Cowboy Club München Süd“ mit 17 Reitern, einem Wagen und Fußvolk präsentiert.
Eine Münchner Zeitung erklärt daraufhin den „CCMS“ zum „Höhepunkt des Zuges“.
3. 4 1930 - Helmut Kohl wird in Ludwigshafen geboren
Ludwigshafen * Helmut Kohl, der spätere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und CDU-Vorsitzende, wird in Ludwigshafen geboren.
23. 8 1930 - Der Cowboy Club München Süd beteiligt sich am Großen Kinderfest
München-Untergiesing * Der Cowboy Club München Süd beteiligt sich am „Großen Kinderfest“ im Tierpark Hellabrunn. Als Motto wird ausgegeben: „Ein Tag bei den Indianern.“
9 1930 - Carl Gabriel's Völkerschau zeigt „Lippen-Negerinnen der Sara-Kaba“
München-Theresienwiese * Carl Gabriel zeigt die „Völkerschau der aussterbenden Lippen-Negerinnen vom Stamme der Sara-Kaba in Zentralafrika“.
9 1930 - Die ersten „Steilwandfahrer“ Deutschlands auf der Wiesn
München-Theresienwiese * Auf dem „Oktoberfest“ kann man in Deutschland die ersten „Steilwandfahrer“ bewundern.
Gezeigt werden sie in „Gabriel und Ruprechts Amerikanische Steilwand Todesfahrt“.
9 1930 - Der „Wirtsbudenring“ wird endgültig aufgelöst
München-Theresienwiese * Der „Wirtsbudenring“ wird endgültig aufgelöst.
Wo einst das „Königszelt“ stand, wird jetzt eine „Achterbahn“ aufgebaut.
9. 9 1930 - Brandbrief an Kardinal Faulhaber und die Bischofskonferenz
München * Pater Rupert Mayer schreibt einen Brief an Kardinal Michael Faulhaber und die Bischofskonferenz, in dem sich der Jesuit wiefolgt äußert:
„Die völkischen Hetzereien können wir uns nicht groß genug vorstellen. So herrscht in unserem katholischen Volk eine beispielslose Verwirrung. Unbegreiflich, aber wahr ist es, daß der Hitlerschwindel wieder die weitesten, auch katholischen Volkskreise erfasst hat“.
10 1930 - Die erste Ausgabe des „Illustrierten Sonntag“ erscheint
München * Im neugegründeten „Naturverlag“ erscheint die erste Ausgabe des „Illustrierten Sonntag“ mit Dr. Fritz Gerlich als „Chefredakteur“.
Aus der unbedeutenden „Sonntagszeitung“ macht er in nur zwei Jahren ein viel beachtetes „politisches Kampfblatt gegen den Nationalsozialismus“.
Gerlich hat sich von einem scharfen Nationalisten mit antidemokratischen Sympathien zu einem erbitterten Gegner Hitlers und einem wütenden Verteidiger der „Weimarer Republik“ entwickelt.
Um das Jahr 10 1930 - Lion Feuchtwangers Roman „Erfolg“ erscheint
München * Lion Feuchtwangers Roman „Erfolg - Drei Jahre Geschichte einer Provinz“ erscheint.
3. 11 1930 - Uraufführung des Karl-Valentin-Bühnenstücks „An Bord“
München-Isarvorstadt * Uraufführung des Karl-Valentin-Bühnenstücks „An Bord“ im Kolosseum, Kolosseumstraße 4. Das Stück erlebt 188 Vorstellungen.
18. 11 1930 - Die Bischöfe beschäftigen sich mit dem Nationalsozialismus
München * Die Bischöfe beschäftigen sich in einer Diözesansynode auch mit dem Nationalsozialismus. Domdekan Prälat Dr. Anton Scharnagl referiert über dieses Thema. Seine Ausführungen beginnen mit den Worten: „Der Nationalsozialismus ist politische Partei und Weltanschauung zugleich“ und kommt zum Ergebnis, dass der Nationalsozialismus mit den Aussagen der katholischen Glaubenslehre unvereinbar sei.
Dr. Scharnagl begründet danach seine Thesen mit den
- von den Nationalsozialisten propagierten germanischen Christentum,
- der Ablehnung des Alten Testaments,
- der Forderung nach einer deutschen Volkskirche,
- die Ablehnung der Bekenntnisschule und
- einer rassisch definierten Sittlichkeit, die die kinderlose Frau als minderwertiges Mitglied der Volksgemeinschaft betrachtet.
In den angefügten Feststellungen wird der Sachverhalt in nie mehr wiederholter Deutlichkeit schließlich auf den Punkt gebracht: „Der Nationalsozialismus ist eine Häresie und mit der christlichen Weltanschauung nicht in Einklang zu bringen.“
Das im Februar 1931 veröffentlichte Amtsblatt Nr. 4 schwächt allerdings entscheidende Passagen bereits wieder ab.
7. 12 1930 - In der sowjetischen Botschaft in Rom wird ein Max Levien ermordet
Rom * In der sowjetischen Botschaft in Rom wird ein Max Levien ermordet. Ob es sich dabei um den Münchner Kommunistenführer handelt, ist nicht geklärt.
14. 12 1930 - Liesl Karlstadt spielt in den Kammerspielen im Schauspielhaus
München-Graggenau * Otto Falckenberg holt Liesl Karlstadt an die Münchner Kammerspiele im Schauspielhaus an der Maximilianstraße, wo sie die Rolle der um ihren Hund kämpfenden Frau Vogl in der Komödie „Sturm im Wasserglas“ schlüpft. Liesl Karlstadt vertritt Therese Giehse, die zu diesem Zeitpunkt ein Engagement in Berlin hat.
14. 12 1930 - Der Cowboy Club München Süd beginnt mit dem Rodeo-Reiten
München-Neuhausen * Der Cowboy Club München Süd beginnt in der Reithalle an der Albrechtstraße des Oberleutnants a.D. Otto Hermann Fegelein mit dem Rodeo-Reiten. Fegelein wird über Eva Braun Hitlers Schwippschwager werden. Er gilt als rücksichtsloser Opportunist und Karrierist, der auch an mehreren Kriegsverbrechen beteiligt sein wird.
15. 12 1930 - Johannes Hoffmann stirbt nach einer Operation in Berlin
Berlin * Johannes Hoffmann, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, stirbt nach einer Operation in Berlin.
1931 - Bürgerproteste verzögern das Togal-Genehmigungsverfahren
München-Bogenhausen * Aufgrund von Bürgerprotesten dauert das Genehmigungsverfahren für den Betrieb einer Chemieanlage des Pharma-Unternehmens „Pharmacia M. Schmidt & Co“, den späteren „Togal-Werken“, auf dem Anwesen des ehemaligen Betz‘schen Anwesens zehn Jahre lang.
1931 - Willy Heide baut das Wirtshaus „Heide-Volm Planegg“ erfolgreich um
Planegg * Willy Heide pachtet eine heruntergewirtschaftete, halbvergessene Waldwirtschaft in Planegg und baut sie zu einer florierenden Ausflugsgaststätte um.
Der Name seines Vorgängers Wilhelm Volm findet sich noch heute im Namen des Wirtshauses: „Heide-Volm Planegg“.
1931 - Die Firmen „Krauss“ und „Maffei“ fusionieren
München-Englischer Garten - Hirschau * Die Firmen „Krauss“ und „Maffei“ fusionieren.
Das Werk in der „Hirschau“ wird stillgelegt nach Allach verlegt.
1931 - Der „Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund“ führt an
Berlin * Der „Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund - NSDStB“ übernimmt in der „Deutschen Studentenschaft“, dem Dachverband der „Allgemeinen Studentenausschüsse“, die Führung.
1931 - Den ersten „Bugatti Royale“ kauft der Industrielle Armand Esders
Frankreich * Der Erste, der einen „Bugatti Royale“ kauft, ist der französische Industrielle Armand Esders.
1931 - Ludwig Weinberger jun. tritt in das väterliche Karosserie-Unternehmen ein
München-Au * Ludwig Weinberger junior, der zuvor sein Studium am „Technikum“ in Köthen abgeschlossen hat, tritt in das väterliche Karosserie-Unternehmen in der Au ein.
Fast gleichzeitig übernimmt Weinberger eine BMW-Vertretung.
Seit dieser Zeit werden fast nur noch BMW-Fahrgestelle mit Aufbauten – häufig offene Zweisitzer – versehen.
Bis zum Zweiten Weltkrieg entstehen etwa 300 Karosserien.
Dr. Joseph Fuchs, der rennfahrende Chirurg aus Nürnberg, lässt sich von Ludwig Weinberger jun. einen Bugatti Typ 50 mit 4,9-Liter-Maschine karossieren.
Die schwarze Lackierung und die postgelb abgefassten Tür- und Seitenbänder lassen das ohnehin niedrige Zweitüren-Cabriolet noch gestreckter erscheinen.
Die Gestaltung dieses Autos weist schon eine große Ähnlichkeit mit dem „Bugatti Royale“ auf.
1931 - Namensbezeichnungen mit „kolonialem Bezug“ für Zamdorf
München-Graggenau - München-Zamdorf * Der Münchner Stadtrat beschließt einstimmig die Vorschläge der Namensbezeichnungen mit „kolonialem Bezug“ für eine „Emin-Pascha-Straße“, die „Wißmannstraße“, die „Lüderitzstraße“ und die „Dominikstraße“.
17. 1 1931 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im Goethesaal auf
München-Schwabing * Am 17. und 18. sowie vom 26. bis 28. Januar treten Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Goethesaal in der Leopoldstraße auf.
2. 2 1931 - Karl Valentins Antrag eines Bühnenspielbetriebs im Goethesaal
München-Schwabing * Karl Valentin stellt den „Antrag zur Erteilung eines Bühnenspielbetriebs im Goethesaal“ in der Leopoldstraße 46a und begründet diesen mit seiner Asthmaerkrankung. Doch selbst ein Künstler wie Karl Valentin muss sich den polizeilichen Vorgaben unterwerfen. Er erhält zwar die Konzession, doch kleinliche behördliche Auflagen zwingen ihn schon bald wieder zur Aufgabe des Lokals.
Die Feuerpolizei will ihm sogar eine wichtige Pointe aus dem Bühnenstück „Im Photoatelier“ zunichte machen. Sie verbietet Karl Valentin, dass das in der Szene vom Gehilfen abgeschnittene glühende Ende der Zigarette, die Valentin verbotenerweise im Atelier raucht, auf den Boden fällt und sich durch seine Rauchentwicklung verrät, was zu Valentins Ausrede führt, es handle sich dabei wohl um ein „Glühwürmchen“.
23. 2 1931 - Karl Valentin erhält die Konzession für eine „Valentin-Bühne“
München-Schwabing * Karl Valentin erhält die Konzession für eine „Valentin-Bühne im Goethesaal“.
28. 2 1931 - Offizielle Eröffnung der Valentin-Bühne im Goethesaal
München-Ludwigsvorstadt * Offizielle Eröffnung von Karl Valentins und Liesl Karlstadts „Valentin-Bühne im Goethesaal“. Das Unternehmen entwickelt sich im ersten Monat ganz gut.
4 1931 - „Münchner Stadtmuseum“ wird wiedereröffnet
München-Angerviertel * Nach einer vierjährigen Umbauphase wird das „Münchner Stadtmuseum“ wiedereröffnet.
Die Hauptattraktion sind die „Moriskentänzer“ von Erasmus Grasser aus dem „Festsaal des Alten Rathauses“.
22. 4 1931 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Die beiden Musikal-Clowns“
München-Ludwigsvorstadt * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Stummfilms „Die beiden Musikal-Clowns“ im „Deutschen Theater“ anlässlich der Tagung des „Reichsverbands Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer“.
Der Film kommt nie in die Kinos.
23. 4 1931 - Die „Valentin-Bühne im Goethesaal“ ist am Ende
München-Schwabing * Das „Valentin-Karlstadt-Unternehmen im Goethesaal“ ist schon wieder am Ende.
Ein Berg offener Rechnungen bleibt übrig.
26. 4 1931 - „Die Behörden erschwerten ihm die Arbeit auf seiner eigenen Bühne“
München * In der „Süddeutschen Sonntagspost“ heißt es zu Karl Valentins Scheitern im „Goethesaal“:
„Seine Nervenzerrüttung ist in erster Linie auf die zahlreichen, fortgesetzten, paragraphenhaften, kleinlichen Reklamationen zurückzuführen, mit denen die Behörden ihm die Arbeit auf seiner eigenen Bühne erschwerten“.
30. 4 1931 - Karl Valentin gibt die „Konzession für den Goethesaal“ zurück
München * In einem aus einer Zeile bestehenden Brief an die Polizeidirektion gibt Karl Valentin - knapp zwei Monate nach der Eröffnung - seine „Konzession für einen Spielbetrieb im Goethesaal“ in der Leopoldstraße 46a wieder zurück.
5. 6 1931 - Ein Großbrand zerstört den Münchner Glaspalast
München-Maxvorstadt * Ein Großbrand zerstört den Münchner Glaspalast. Fast 3.000 Gemälde werden ein Raub der Flammen.
30. 6 1931 - Preußen schließt wegen Geldmangel seine Münchner Gesandtschaft
Berlin - Lehel * Wegen der Weltwirtschaftskrise schließt Preußen aus Geldmangel seine Münchner Gesandtschaft.
7 1931 - Ein „Katholischer Bildersturm“ gegen das Valentin-Stück „Der Firmling“
München * Es kommt zum „Katholischen Bildersturm“ gegen ein ausgestelltes Szenenfoto aus dem Valentin-Stück „Der Firmling“.
Die katholische Kirche hatte in der Presse verlautbaren lassen, dass das Bild „eine unwürdige und verzerrende Verletzung des heiligen Sakraments der Firmung“ darstelle.
Karl Valentin droht München zu verlassen.
1. 7 1931 - Die Berliner Industrie- und Handelskammer will Auskünfte über Cenovis
Berlin - München * Die Berliner Industrie- und Handelskammer will in einer Anfrage über die Cenovis-Werke wissen, ob das Unternehmen für Lieferungen an Behörden geeignet ist.
Die umgehend erfolgte Antwort führt dazu aus, dass die Firma „als durchaus leistungsfähig und zuverlässig zu gelten hat. Das Unternehmen kann deshalb auch für die Lieferung an Behörden als geeignet bezeichnet werden. Der Generaldirektor des Unternehmens ist Herr Dr. Julius Schülein aus der bekannten, hochangesehenen, alteingesessenen Brauerfamilie, der die Aktienbrauerei zum Löwenbräu gehört“.
12. 7 1931 - Die Auflage des „Illustrierten Sonntags“ steigt auf 100.000 Exemplare
München * Die Auflage des „Illustrierten Sonntags“ steigt von 30.000 Exemplare im Oktober 1930 auf über 100.000 Exemplare an.
9 1931 - Carl Hagenbeck zeigt auf dem „Oktoberfest“ die „Kanaken der Südsee“
München-Theresienwiese * Der Hamburger Carl Hagenbeck zeigt auf dem „Oktoberfest“ die „Kanaken der Südsee“.
18. 9 1931 - Angelika Maria „Geli“ Raubal begeht Selbstmord
München-Haidhausen * Die 23-jährige „Privatstudierende“ Angelika Maria „Geli“ Raubal begeht in Adolf Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz 16 Selbstmord durch Erschießen. Es handelt sich dabei um eine Tochter von Hitlers Halbschwester Angela Raubal.
Die schweren Verletzungen und die weitere Umstände, über die die Münchener Post berichtet, signalisieren der Öffentlichkeit den Verdacht auf ein Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft beauftragt deshalb sofort den Polizeiarzt, die Leiche nochmals zu untersuchen.
21. 9 1931 - Geli Raubal’s Leichnam überraschend freigegeben
München - Wien • Die Ermittlungsbehörden geben überraschend den Leichnam von Hitlers Nichte Geli Raubal zur Bestattung frei, ohne eine Obduktion anzuordnen. Ungewöhnlich rasch wird die Tote nach Wien überführt, wo sie bereits am 23. September auf dem Zentralfriedhof beerdigt wird.
29. 9 1931 - Dr. Fritz Gerlich trifft die Resl von Konnersreuth
Eichstätt * Die Begegnung mit der Resl von Konnersreuth war Dr. Fritz Gerlichs persönliches Damaskus-Erlebnis. Er konvertiert am Fest des heiligen Michael in der Chorkapelle der Kapuziner in Eichstätt zum katholischen Glauben und lässt sich auf den Namen Michael taufen.
18. 10 1931 - Chuck Berry erblickt in St. Louis, Missouri, das Licht der Welt
St. Louis * Chuck Berry erblickt in St. Louis, Missouri, das Licht der Welt.
Um den 23. 12 1931 - Der Fotoband „Das Karl Valentin Buch“ erscheint
München * Der Fotoband „Das Karl Valentin Buch“ erscheint im Verlag Knorr & Hirth. Der überdimensionale Untertitel des Buches lautet: „Erstes und einziges Bilderbuch von Karl Valentin über ihn und Lisl Karlstadt mit Vorwort und ernsthafter Lebensbeschreibung und Bildunterschriften von ihm selbst, sowie zwei Aufsätzen von Tim Klein und Wilhelm Hausenstein.“
1932 - Der „Kenotaph“ für Kaiser Ludwig dem Baiern unter dem Südturm
München-Kreuzviertel * Der „Kenotaph“ für Kaiser Ludwig dem Baiern wird unter den Südturm der „Frauenkirche“ verschoben.
1932 - Der Braubetrieb im „Bürgerlichen Bräuhaus“ wird eingestellt
München-Haidhausen * Der Braubetrieb im „Bürgerlichen Bräuhaus“ an der Kellerstraße in Haidhausen wird eingestellt.
1932 - Die „Amperwerke“ werden zum größten oberbayerischen Stromversorger
München-Maxvorstadt * Die „Amperwerke“ werden mit der übernahme der „Oberbayerischen Überlandzentrale - OBüZ“ zum größten oberbayerischen Stromversorgungsunternehmen, noch vor den „Isarwerken“.
1932 - Margarete Merz gehört das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9
München-Maxvorstadt * Der „Oberingenieurs-Ehefrau“ Margarete Merz aus Bielefeld gehört das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9.
1932 - Das „Sckell-Denkmal“ muss abgetragen werden
München-Englischer Garten - Schwabing * Das „Sckell-Denkmal“ am Südufer des „Kleinhesseloher Sees“ muss abgetragen werden.
Das aus „Grünkalkstein“ bestehende Denkmal ist schnell verwittert.
Ab 1932 - Auf der ehemaligen Untergiesinger Lederfabrik entsteht eine Wohnsiedlung
München-Untergiesing * Auf dem Areal der ehemaligen Untergiesinger Lederfabrik entsteht eine Wohnsiedlung, deren Hauptachse die Waldeckstraße ist.
Es werden Häuser mit expressionistischen Fassaden und mit Wohnungen gehobenen Stils errichtet.
Der „Beamtenblock“ umschließt einer Burg gleich einen großen Innenhof. Die Fenster in der Vorderfront gleichen in ihrer länglichen schmalen Form eher Schießscharten.
1932 - Ludwig Weinberger designet Dr. Joseph Fuchs' „Bugatti Royale“
München-Au * Ludwig Weinberger junior macht den Zwanzig-Mann-Betrieb in der Zeppelinstraße 41 in der Autowelt über Nacht berühmt.
Der Nürnberger Modearzt Dr. Joseph Fuchs, der bereits auch einige Rennen mit kleineren „Bugatti-Rennwagen“ gefahren ist, lässt in der Werkstatt in der Au sein „Bugatti Royale“-Fahrgestell (Typ 41) mit einer imposanten Karosserie versehen.
Das Chassis 41-121 ist das erste Fahrgestell der „Bugatti-Royale“-Serie, das nur einen Aufbau erhält.
Das Luxusauto erhält eine Cabriolet-Karosserie mit langer Motorhaube und knapp geschnittenem Fahrgastabteil.
Das Auto wird mit einer schwarzen Lackierung, die auch die postgelb abgefassten Tür- und Seitenbänder aufweist, und hellem Verdeck ausgeliefert.
Die Sitze werden mit grobporigem Schweinsleder bezogen.
Die Kühlermaske und die Stoßstangen sind verchromt.
Drei Monate dauert die Herstellung der „Karosserie“, die etwa 7.000 RM kostet.
Das Fahrgestell für das Auto der Luxusklasse war rund 75.000 RM teuer.
Der Gesamtpreis entspricht dem Wert von mehr als acht Einfamilienhäusern.
3. 1 1932 - Der gerade Weg - Deutsche Zeitung für Wahrheit und Recht
München * Der Illustrierte Sonntag wird in Der gerade Weg - Deutsche Zeitung für Wahrheit und Recht umbenannt.
12. 1 1932 - Uraufführung der Valentin-Komödie „Er und Sie“
München-Isarvorstadt * Im Kolosseum, Kolosseumstraße 4, kommt die Valentin-Komödie „Er und Sie“ zur Uraufführung. Das Stück beruht im Wesentlichen auf dem Stummfilm „Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Oktoberfestwiese“ von 1923. Es erlebt 87 Vorstellungen.
5. 3 1932 - Fritz Gerlich: „Kein Katholik darf nationalistisch wählen“
München * Dr. Fritz Gerlich überschreibt die Zeitung „Der gerade Weg“ mit den Worten: „Nein! Nein! Nein! Kein Katholik darf nationalistisch wählen“.
6. 3 1932 - Dr. Fritz Gerlich kommentiert Auszüge aus Hitlers „Mein Kampf“
München * Dr. Fritz Gerlich kommentiert Auszüge aus Hitlers „Mein Kampf“ und identifiziert Alfred Rosenberg, den Chefredakteur des Völkischen Beobachters, als den eigentlichen „geistigen und weltanschaulichen Führer des Nationalsozialismus“, der „turmhoch über dem kleinen Dekorationsmaler aus Braunau steht“.
Rosenberg hat in seinem Buch „Mythos des 20. Jahrhunderts“ klar Position gegen deutsch-christliche und speziell katholische Ideen bezogen.
1. 4 1932 - Trudering wird nach München eingemeindet
<p><em><strong>München-Trudering</strong></em> * Die bis dahin eigenständige Gemeinde Trudering wird nach München eingemeindet. Um Mehrfachbenennungen von Straßennamen zu vermeiden müssen Straßen umbenannt werden. </p>
9. 4 1932 - Carl Perkins wird in Tiptonville, Tennessee, geboren
Tiptonville * Carl Perkins wird in Tiptonville, Tennessee, geboren.
10. 4 1932 - Der „Gerade Weg“ schreibt gegen die Führer der NSDAP
<p><strong><em>München</em></strong> * Dr. Fritz Gerlich schreibt im <em>„Geraden Weg“ </em>die Zeilen: <em>„Den Führern der NSDAP kann man nicht den Vorwurf machen, sie verschwiegen ihre letzten Ziele.“</em></p>
10. 4 1932 - Hitlers schlechtes Ergebnis im Wahlkreis Oberbayern-Schwaben
<p><strong><em>Deutsches Reich</em></strong> * Bei der Stichwahl um das Amt des Reichspräsidenten zwischen Paul Hindenburg und Adolf Hitler erzielt der Führer der NSDAP im Wahlkreis Oberbayern-Schwaben mit 24,9 Prozent das drittschlechteste Ergebnis im gesamten Reich (36,8 Prozent). </p>
16. 5 1932 - Die Dreharbeiten für „Die verkaufte Braut“ beginnen
München-Geiselgasteig * Die Dreharbeiten für Karl Valentins und Liesl Karlstadts ersten abendfüllenden Tonfilm „Die verkaufte Braut“ in den Emelka-Studios in Geiselgasteig beginnen. Sie dauern bis zum 5. Juli 1932. Der Regisseur Max Ophüls versteht es ausgezeichnet, sich auf Karl Valentins Textschwäche einzustellen.
4. 6 1932 - Karl Valentin feiert seinen 50. Geburtstag
München * Zu Karl Valentins 50. Geburtstag trägt Liesl Karlstadt ein langes und liebevolles Geburtstagsgedicht vor.
9. 7 1932 - Aufhebung des Young-Plans und Ende der deutschen Zahlungen
Lausanne * Eine internationale Konferenz zur Regelung der Reparationsfrage führt zur Aufhebung des Young-Plans und dem Ende der deutschen Zahlungen.
20. 7 1932 - Es kommt zum sogenannten Preußenstaatsstreich
Berlin * An diesem Tag kommt es zum sogenannten Preußenstaatsstreich. Mit Vollmacht des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg setzt Reichskanzler Franz von Papen die sozialdemokratische Preußische Staatsregierung ab und ernennt sich selbst zum Reichskommissar für Preußen.
Die preußischen Ministerien werden durch die Reichswehr besetzt und die Minister unter Gewaltandrohung aufgefordert, ihre Amtsräume zu verlassen. Preußen erhält den Status eines Reichslandes, das ohne eigene Regierung, von der Reichsregierung mit der linken Hand mitregiert wird. Das bedeutet das Ende der staatlichen Eigenexistenz Preußens, womit die diplomatische Vertretung an der Prinzregentenstraße überflüssig geworden ist.
Die Schack-Galerie wird seither - bis zum Jahr 1939 - von der Berliner Schlösserverwaltung betreut. Mit dem Verschwinden der Preußischen Gesandtschaft geht aber auch ein Stück bayerische Eigenständigkeit verloren.
31. 7 1932 - Die Konsequenzen einer Naziherrschaft für das ganze Land
München * Dr. Fritz Gerlich beschreibt in der Zeitschrift „Der gerade Weg“ die Konsequenzen einer Naziherrschaft für das ganze Land: „Nationalismus bedeutet: Feindschaft mit den benachbarten Nationen, Gewaltherrschaft im Inneren, Bürgerkrieg, Völkerkrieg. Nationalsozialismus heißt auch: Lüge, Hass, Brudermord und grenzenlose Not.“
Ab dem 16. 8 1932 - Liesl Karlstadt steht - alleine - mit großem Erfolg auf der Bühne
München * Liesl Karlstadt steht in dem Stück „Die drei Gschpusi der Zenta“ mit großem Erfolg auf der Bühne. Karl Valentin hält von diesen „Eskapaden“ nicht sehr viel.
16. 8 1932 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Die verkaufte Braut“
München * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Die verkaufte Braut“ im Phoebus-Palast und im Gloria-Filmpalast.
20. 8 1932 - Karl Gandorfer stirbt im Berliner Reichstag
Berlin * Karl Gandorfer stirbt während einer Rede im Reichstag in Berlin.
28. 8 1932 - Jugenderinnerungen: „Karl Valentin der Lausbub“
München * In der Süddeutschen Sonntagspost erscheinen unter dem Titel „Karl Valentin der Lausbub“ die Jugenderinnerungen des großen Komikers.
28. 9 1932 - Der Zwickelerlass regelt das öffentliche Baden
Berlin * Ein Erlass des preußischen Innenministeriums regelt das öffentliche Baden. Er wird auch Zwickelerlass genannt, weil das Wort Zwickel [Stoffeinsatz im Schritt] häufig vorkommt. Der Grund liegt in der immer knapper werdenden Badebekleidung der Frauen in den 1920er Jahren.
- Paragraph 1 regelt demzufolge auch, dass das Baden in anstößiger Badekleidung verboten ist.
- Das Öffentliche Nacktbaden wird generell untersagt.
- „Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen.“
- „Männer dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. In sogenannten Familienbädern haben Männer einen Badeanzug zu tragen.“
Der Zwickelerlass sorgt für große Heiterkeit in der Presse.
7. 10 1932 - Weitere Straßennamen mit kolonialem Bezug für Zamdorf
München-Graggenau - München-Zamdorf * Der Münchner Stadtrat beschließt die Vorschläge der Namensbezeichnungen mit kolonialem Bezug für die „Windhukstraße“, „Dualastraße“, „Günther-Plüschow-Straße“ und „Karl-Peters-Straße“.
Die Beschlüsse fasst der Stadtrat einstimmig. Begründet werden die Straßenbenennungen mit der Erinnerung an die „geraubten ehemaligen deutschen Kolonien“.
Ab 26. 11 1932 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Im Photoatelier“ wird gedreht
München-Geiselgasteig * Der 29-Minuten-Film „Im Photoatelier“, nach der gleichnamigen Originalszene von Karl Valentin und Liesl Karlstadt, wird in Geiselgasteig gedreht.
12 1932 - Die Raubritter-Revue „Wie‘s früher war“ mit Valentin/Karlstadt
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im „Deutschen Theater“ in der Raubritter-Revue „Wie‘s früher war“ auf.
15. 12 1932 - Die Zeitschrift „Der gerade Weg“ erscheint zweimal wöchentlich
München * Die Zeitschrift „Der gerade Weg“ erscheint zweimal wöchentlich.
1933 - Karl Valentin arbeitet an seiner Fotosausstellung
München * Karl Valentin arbeitet an seiner Fotosausstellung „Alt-München in der Photographie 1850 - 1900“.
Ab 1933 - Die Aufgaben des „Reichsfinanzhofes“ ändern sich
München-Bogenhausen * Die Aufgabe des „Reichsfinanzhofes“ bestand während der Jahre von 1933 bis 1945 im Wesentlichen in der Weiterentwicklung der Steuergesetze und der Entwicklung des Steuerrechts im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung.
Den Boykott jüdischer Geschäfte, die Entziehung der Berufszulassungen von jüdischen ärzten und die Entfernung jüdischer Beamten aus dem öffentlichen Dienst bezeichneten die Finanzrichter lediglich als „in steuerlicher Hinsicht irrelevante Belästigungen“.
Mit ihren Urteilen nahmen die „furchtbaren Juristen von der Ismaninger Straße“ entscheidenden Einfluss an der „Arisierung“ jüdischen Vermögens.
So mussten Juden, deren Wohnung von der „Gestapo“ versiegelt wurden, nachdem sie ins Ausland geflohen waren, ein Viertel ihres Vermögens als „Reichsfluchtsteuer“ zahlen.
1933 - Karl Valentin zieht von der Kanalstraße 8 im Lehel in die Sckellstraße 1
München-Lehel - München-Haidhausen * Karl Valentin zieht von der Kanalstraße 8 im Lehel in die Sckellstraße 1, direkt hinter dem Maximilianeum, nach Haidhausen um.
1933 - Karl Valentin zieht von der Sckellstraße 1 an den Mariannenplatz 4
München-Haidhausen - München-Lehel * Karl Valentin zieht von der Sckellstraße 1 an den Mariannenplatz 4 im Lehel.
1933 - Charlotte Haas, Enkelin von Joseph Schülein, studiert in England
Großbritannien * Charlotte Haas, Enkelin von Joseph Schülein, nimmt ihr Studium in England auf.
1933 - Dem „Kaufmannsehepaar“ Lieb gehört die Richard-Wagner-Straße 16
München-Maxvorstadt * Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 16 gehört dem „Kaufmannsehepaar“ Karl und Franziska Lieb aus Lichtenfels.
1933 - Die Museum-Lichtspiele werden von Anton Rösch betrieben
München-Au * Die Museum-Lichtspiele werden von Anton Rösch betrieben.
1933 - Die „Altöttinger-Kapelle“ am Gasteig wird geschlossen
München-Haidhausen * Die „Altöttinger-Kapelle“ am Gasteig wird geschlossen, da die Wände durch die täglich rund 200 geopferten Kerzen vollständig geschwärzt sind.
1933 - Eine Ausstellung zur Erinnerung an Richard Wagner
München-Graggenau * In der Münchner Residenz wird eine Ausstellung zur Erinnerung an Richard Wagner eröffnet.
„Reichsstatthalter“ Franz Xaver Ritter von Epp stellt dabei fest: „Die Nationalsozialisten empfinden Wagner als den deutschesten Mann, den nur einer gleichen Blutes voll zu verstehen vermag“.
1933 - München hat 840.188 Einwohner
München * München hat 840.188 Einwohner.
3. 1 1933 - Premiere für den Valentin-Karlstadt-Film: „Im Photoatelier“
München * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Im Photoatelier“ in München.
21. 1 1933 - Der Cowboy Club München Süd lädt ins Josefshaus ein
München-Au * Der Cowboy Club München Süd lädt in sein künftiges Clublokal im Josefshaus in der Hochstraße 28 in der Au ein. Neben Lebenden Bildern, bei denen sogar vier Pferde integriert werden, führen die Aktivisten Stepptänze und Lassospiele vor. Eine 25 Mann starke Sioux-Indianertruppe führt „heimatliche Tänze“ auf.
30. 1 1933 - Machtübernahme: Adolf Hitler wird Reichskanzler
Berlin * Der Tag der sogenannten Machtübernahme. Adolf Hitler wird vom Reichspräsidenten Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Er leitet eine Koalitionsregierung bestehend aus NSDAP, DNVP und Stahlhelm.
Nach dem 30. 1 1933 - Mit dem Nationalsozialismus kommt das Eheverbot für Lehrerinnen zurück
Deutsches Reich * Mit dem Nationalsozialismus kommen die alten, stockkonservativen Töne wieder zurück. Die NS-Machthaber entlassen alle verheirateten Lehrerinnen und kürzen den verbliebenen das Gehalt um zehn Prozent.
Die Meinung, „die deutsche Mutter gehört zu den Kindern nach Hause“, ändert sich programmatisch erst wieder, nachdem die Lehrer zum Kriegsdienst eingezogen worden sind. Nun darf die Frau wieder einmal ihren Mann stehen.
2 1933 - „Snip, der Springende Punkt“, ein Reklamefilm mit Karl Valentin entsteht
München * „Snip, der Springende Punkt“, ein Reklamefilm der „Austria Tabak“ mit Karl Valentin entsteht.
2 1933 - Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann emigrieren nach Zürich
Zürich * Anita Augspurg und ihre Lebensgefährtin Lida Gustava Heymann emigrieren nach der „Machtübernahme Hitlers“ am 30. Januar 1933 nach Zürich.
Sie befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Mittelmeerreise.
2 1933 - In der NS-Parteiuniform zum evangelischen Gottesdienst
München-Obergiesing * Nach dem Regierungswechsel erscheinen viele Gemeindemitglieder in ihren Partei- beziehungsweise SA-Uniformen zu den evangelischen Gottesdiensten in die Martin-Luther-Kirche.
Nach 2 1933 - Im „Kriegerheim“ ist die „Ortsgruppe Giesing der NSDAP“ untergebracht
München-Obergiesing * An der Ecke Gietl- und Untere Grasstraße, wo heute das „Pfarrzentrum“ steht, befand sich früher die Wirtschaft „Kriegerheim“, in der während der NS-Zeit die „Ortsgruppe Giesing der NSDAP“ untergebracht ist.
Hier finden an den Wochenenden zahlreiche Appelle und Kundgebungen von NS-Partei-Organisationen statt.
Zuvor dient die Wirtschaft den „Unabhängigen Sozialisten - USPD“ Giesings als Versammlungs- und Vereinslokal.
1. 2 1933 - Auflösung des Reichstags durch die Reichsregierung
Berlin * Auflösung des Reichstags durch die zwei Tage zuvor ernannte Reichsregierung.
2. 2 1933 - Demonstrationsverbot der Kommunisten in Preußen
Berlin * Das Demonstrationsverbot der Kommunisten in Preußen wird eingeführt.
Um den 5. 2 1933 - SA- und SS-Horden ziehen in einem Triumphzug durch die Arbeiterviertel
München-Giesing * Giesing gilt den Nazis als ein zu brechendes Symbol der Opposition. Schon eine Woche nach Hitlers Machtergreifung ziehen die braunen SA- und SS-Horden in einem Triumphzug durch die Arbeiterviertel, um sich als Sieger und Träger der Staatsgewalt zu präsentieren.
Mit diesem Propagandamarsch durch Giesing und Haidhausen - geschützt durch Polizei und Staatsgewalt - wollen sie ihren Herrschaftsanspruch demonstrieren.
10. 2 1933 - Für eine differenzierte Auseinandersetzung mit Richard Wagners Werken
München-Maxvorstadt * Im „Richard-Wagner-Jahr“ hält Thomas Mann aus Anlass des 50. Todestages des berühmten Künstlers im Auditorium maximum der Universität München einen Vortrag über „Leiden und Größe Richard Wagners“. Thomas Mann verliest dabei ein zwanzigseitiges Manuskript aus einem rund siebzig Seiten umfassenden Aufsatz.
In seinem Referat spricht sich Thomas Mann gegen eine einseitig heroisierende Verherrlichung und eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Werken Richard Wagners aus.
11. 2 1933 - Thomas Mann verlässt München
München - Holland * Der Schriftsteller Thomas Mann verlässt München zu weiteren Wagnervorträgen in mehreren europäischen Großstädten. Diese Reise wird der Beginn seines mehrjährigen Exils.
18. 2 1933 - Yoko Ono kommt in Tokyo zur Welt
Tokyo * Yoko Ono kommt in Tokyo als Tochter eines wohlhabenden Bankiers zur Welt.
21. 2 1933 - Hermann Göring will SPDler durch „national gesinnte“ Beamte ersetzen
Berlin * Hermann Göring will in den Polizeiverwaltungen in Preußen SPD-Mitglieder durch „national gesinnte“ Beamte ersetzen.
21. 2 1933 - Dr. Julius Schülein ist Generaldirektor der Cenovis-Werke
München-Au * In der Liste der Gesellschafter der Cenovis-Werke wird Dr. Julius Schülein als Generaldirektor aufgeführt. Er wohnt in der Brienner Straße 51 und hat einen Geschäftsanteil von 392.000 RM.
Kommerzienrat Emil Zeckendorf ist mit 140.000 RM, Fräulein Nelly Zeckendorf mit 47.800 RM am Unternehmen beteiligt. Die Letztgenannten wohnen in der Richard-Wagner-Straße 11.
27. 2 1933 - Der Reichstag brennt
Berlin * In der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1933 brennt der Reichstag in Berlin ab.
28. 2 1933 - Die Reichstagsbrandverordnung wird erlassen
Berlin * Die Verordnung des Reichspräsidenten Hindenburg „Zum Schutz von Volk und Staat“, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung wird erlassen. Damit werden unter anderem Grundrechte außer Kraft gesetzt und willkürliche polizeiliche Schutzhaft ohne richterliche Kontrolle ermöglicht.
28. 2 1933 - Erich Mühsam wird in Schutzhaft genommen
München * Erich Mühsam wird in Schutzhaft genommen.
5. 3 1933 - NSDAP erreicht bei der Reichstagswahl nur 43,9 Prozent
Deutsches Reich - Berlin * Trotz NS-Terror und verfassungswidriger Behinderung von KPD, SPD und Zentrum erreicht die NSDAP nur 43,9 Prozent. Es reicht aber für eine knappe absolute Mehrheit für die Regierungskoalition aus NSDAP, DNVP und „Stahlhelm“.
5. 3 1933 - Die gemeinsamen Feinde der katholischen Kirche und der NSDAP
München-Kreuzviertel - München-Maxvorstadt * In ihrer unbedingten Gegnerschaft zum Bolschewismus und zur Freidenker- und Gottlosenbewegung sind sich katholische Kirche und NSDAP einig. In einem Schreiben teilt Kardinal Michael von Faulhaber dem päpstlichen Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa mit:
„Verbot auf die gesamte kommunistische Propaganda und auf die sozialdemokratischen Freidenkerverbände ausgedehnt, die ebenso radikal wie die eigentlichen Proletarier gegen christlichen Glauben und christliche Sitte wüteten. [...] Sicher müssen neben den staatlichen Gewaltmitteln heute die kirchlichen Kräfte neu erweckt werden, um den Vormarsch des russischen Bolschewismus zum Weltbolschewismus in Deutschland aufzuhalten.“
8. 3 1933 - Die letzte Ausgabe der Zeitschrift „Der gerade Weg“ erscheint
München * Die letzte Ausgabe der Zeitschrift „Der gerade Weg“ erscheint. Dr. Fritz Gerlich bezeichnet darin Hitler und dessen Politik als „undemokratisch und verbrecherisch“. Die Auflage der Zeitschrift liegt bei 1,25 Millionen Exemplare.
9. 3 1933 - Sturz der konservativen Regierung Held in Bayern
München-Kreuzviertel * Sturz der konservativen Regierung Held in Bayern durch die Nationalsozialisten. Bayern wird als Letztes der deutschen Länder in Hitlers Herrschaft eingefügt. Ritter Franz-Xaver von Epp wird Reichskommissar für Bayern, Heinrich Himmler kommissarischer Polizeipräsident in München.
Nach dem 9. 3 1933 - Die Gedenktafel für Kurt Eisner wird von den Nazis entfernt
München-Isarvorstadt * Die Gedenktafel für Kurt Eisner im Gewerkschaftshaus an der Pestalozzistraße wird von den Nazis entfernt. Sie gilt seither als verschollen.
9. 3 1933 - Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Bayern
München-Graggenau * Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Bayern. Max Amann hisst die Hakenkreuzfahne am Münchner Rathaus. Nun beginnt die systematische Ausschaltung ihrer politischen Gegner.
9. 3 1933 - Dr. Fritz Gerlich wird noch am Tag der Machtübernahme verhaftet
München-Maxvorstadt * Dr. Fritz Gerlich wird noch am Tag der Machtübernahme verhaftet. Obwohl er keinen Widerstand leistet, verprügeln ihn die Nazi-Schläger und bringen ihn ins Polizeipräsidium an der Ettstraße, wo er in Einzelhaft sitzt und gefoltert wird.
11. 3 1933 - Felix Fechenbach wird in Schutzhaft genommen
Detmold * Felix Fechenbach wird in Schutzhaft genommen.
12. 3 1933 - Die Hakenkreuzfahne wird zur Reichsflagge
Berlin * Die Hakenkreuzfahne wird zur Reichsflagge.
13. 3 1933 - Päpstlicher Dank an Adolf Hitler
<p><strong><em>Rom-Vatikan - Berlin</em></strong> * Papst Pius XI. drückt Adolf Hitler öffentlich seinen Dank dafür aus, dass er als erster Staatsmann klar und deutlich vom Bolschewismus abgerückt ist. </p>
15. 3 1933 - Ministerpräsident Heinrich Held muss der Gewalt weichen
<p><strong><em>München</em></strong> * Bayerns Ministerpräsident Heinrich Held von der konservativen Bayerischen Volkspartei - BVP muss der nationalsozialistischen Gewalt weichen und zurücktreten.</p>
16. 3 1933 - Franz Xaver Ritter von Epp übernimmt die Macht in Bayern
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Franz Xaver Ritter von Epp übernimmt als Kommissarischer Reichsstatthalter und Ministerpräsident die Macht in Bayern.</p>
17. 3 1933 - Gründung der SS-Leibstandarte Adolf Hitler
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Die SS-Leibstandarte Adolf Hitler wird gegründet. </p>
19. 3 1933 - Liesl Karlstadt steht für Therese Giehse auf der Bühne
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Liesl Karlstadt steht in den Kammerspielen für Therese Giehse auf der Bühne, weil diese - aufgrund ihrer jüdischen Abstammung - in die Schweiz emigrieren musste.</p>
20. 3 1933 - Das Konzentrationslager Dachau wird geöffnet
<p><strong><em>Dachau</em></strong> * Das Konzentrationslager Dachau wird geöffnet. Einen Tag später folgt das KZ Oranienburg<em>. </em></p>
20. 3 1933 - Abschluss des Kokordats des Reichs-Konkordats
<p><strong><em>Berlin - Rom-Vatikan</em></strong> * Abschluss des Kokordats zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan. </p>
21. 3 1933 - Ein Konzentrationslager für politische Gefangene
München - Dachau * Im Völkischen Beobachter und in den Münchner Neuesten Nachrichten erscheint eine von Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS und zugleich kommissarischen Polizeipräsidenten von München, veranlasste Pressemeldung mit der Überschrift „Ein Konzentrationslager für politische Gefangene“.
In der Meldung ist zu lesen: „Am Mittwoch [nächster Tag] wird in der Nähe von Dachau das erste Konzentrationslager eröffnet. Es hat ein Fassungsvermögen von 5.000 Menschen.“ Weiter heißt es, dass dort „die gesamten kommunistischen und - soweit notwendig - Reichsbanner- und marxistische Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen“ werden.
Abschließend erklärt Himmler: „Wir haben diese Maßnahme ohne jede Rücksicht auf kleinliche Bedenken getroffen in der Überzeugung, damit zur Beruhigung der nationalen Bevölkerung und in ihrem Sinn zu handeln.“
21. 3 1933 - Das Konzentrationslager Oranienburg wird geöffnet
Oranienburg * Das Konzentrationslager Oranienburg wird geöffnet.
Nach dem 22. 3 1933 - Die aufgestaute Angst vor den „Roten“ hat ein Nachspiel
<p><strong><em>München-Giesing</em></strong> * Die aufgestaute Angst vor den <em>„Roten“</em> hat ein Nachspiel. Die männlichen Erwachsenen ganzer Giesinger Straßenzüge werden verhaftet und ins KZ Dachau gebracht.</p>
22. 3 1933 - Im KZ Dachau werden die ersten Menschen inhaftiert
<p><strong><em>Dachau</em></strong> * Im KZ Dachau werden die ersten Menschen inhaftiert. Am Vormittag gegen 10 Uhr steigen im Zuchthaus Landsberg die ersten 50 Gefangenen auf Lastwagen, die sie nach Dachau bringen. Gegen Mittag trifft der Transport an der ehemaligen Pulverfabrik ein, vor deren Eingang sich eine Menschenmenge Schaulustiger versammelt hat. Das Konzentrationslager Dachau wird von der 2. Polizei-Hundertschaft der Bayerischen Landespolizei bewacht.</p> <p>Der Münchner Rechtsreferendar Claus Bastian trägt die Gefangenennummer 1. Über 200.000 werden ihm folgen. In den zwölf Jahren der Nazi-Herrschaft werden im KZ Dachau 41.500 Menschen ermordet, verhungern oder an Krankheiten sterben. </p>
23. 3 1933 - Das Christentum als unerschütterliche Grundlage des Dritten Reiches
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Adolf Hitler stellt in seiner Regierungserklärung fest, dass die Reichsregierung im Christentum die <em>„unerschütterliche Grundlage des Dritten Reiches“</em> erblicke. </p>
24. 3 1933 - Der Reichstag beschließt das sogenannte Ermächtigungsgesetz
Berlin * Der Reichstag beschließt - nach der Aberkennung der Reichstagsmandate der KPD und mit den Gegenstimmen der SPD das Gesetz zur Behebung der Not im Volk und Staat, das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Für das Gesetz stimmen die Reichstagsfraktionen der NSDAP, DNVP, des Zentrums, der Bayerischen Volkspartei - BVP, DVP und DStP.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes wird kein Steuergesetz mehr parlamentarisch beraten und beschlossen.
24. 3 1933 - Faulhaber: Mehr Toleranz gegenüber der neuen Regierung
<p><strong><em>München</em></strong><em> * </em>Kardinal Michael von Faulhaber fordert seine bayerischen Amtsbrüder auf, <em>„trotz allem mehr Toleranz gegen die neue Regierung zu üben, die heute nicht bloß im Besitz der Macht ist, was unsere Grundsätze nicht umstoßen könnte, sondern rechtmäßig wie noch keine Revolutionspartei in den Besitz der Macht gelangte.“ </em></p>
29. 3 1933 - Die Nazis führen die Vollstreckungsmethode des Erhängens wieder ein
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Die nationalsozialistische Regierung führt die Vollstreckungsmethode des Erhängens wieder ein.</p>
29. 3 1933 - Ein Ministerialerlass mit Auswirkungen auf die Arbeiter-Sportvereine
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Ein Ministerialerlass -<em> „betr. Verbot marxistischer Organisationen“</em> - ergeht. Er hat auch Auswirkungen auf die Arbeiter-Sportvereine. </p>
30. 3 1933 - Faulhaber rechtfertigt die Ausschreitungen gegen die Juden
<p><strong><em>München-Kreuzviertel - Chicago</em></strong> * Der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber rechtfertigt die Ausschreitungen gegen die Juden und schreibt dazu seinem Amtsbruder George Mundelein nach Chicago: </p> <p><em>„Die unwahren Berichte über blutige Greueltaten in Deutschland, die in amerikanischen und anderen ausländischen Zeitungen erschienen sind, und die Angriffe gegen die neue Regierung in Deutschland wegen ihres Kampfes gegen den Kommunismus, haben die deutsche Regierung veranlaßt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und vom 1. April ab den Boykott gegen alle jüdischen Geschäfte mit aller Strenge durchzuführen.“</em></p>
1. 4 1933 - Die NSDAP ruft zum reichsweiten „Judenboykott“ auf
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Die NSDAP ruft zum reichsweiten <em>„Judenboykott“</em> auf. Über 600 jüdische Firmen in München werden boykottiert,<em> „zum Schutz der Inhaber und zur Belehrung des Publikums durch Posten gesichert und durch Plakatierung gekennzeichnet“</em>. Der reichsweite <em>„Boykott jüdischer Geschäfte“</em> dauert bis zum 3. April an.</p>
1. 4 1933 - Heinrich Himmler wird Politischer Polizeikommandeur in Bayern
<p><strong><em>München</em></strong> * Heinrich Himmler wird zum Politischen Polizeikommandeur Bayerns ernannt. </p>
3. 4 1933 - Uni-Klinik Gießen: Ist die Cenovis eine christliche Firma?
Gießen * Die Universitäts-Klinik Gießen fragt bei der IHK München an, ob die „Cenovis eine christliche Firma“ ist.
5. 4 1933 - Ärger über einen Artikel gegen den Judenboykott
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Geistliche Dr. Alois Wurm, der gleichzeitig Herausgeber der Monatsschrift <em>„Seele“</em> ist, wendet sich an Kardinal Michael von Faulhaber. Wurm hat einen Artikel gegen den <em>„Judenboykott“</em> an eine bayerische Zeitung geschrieben, diese den aber nicht abgedruckt. </p> <p>Aus diesem Grund appelliert der Priester an Faulhaber, in der katholischen Presse zur Orientierung der Katholiken klare Aussagen zum Vorgehen gegen die Juden zu machen. Schließlich, so Wurm weiter, sei es mit der katholischen Lehre nicht vereinbar, wenn ein Mensch unschuldig, nur wegen seiner Rasse gehasst oder verfolgt werde.</p> <p>Scheinbar ist dem Kardinal der Ton des Geistlichen zu fordernd. Jedenfalls reagiert Michael von Faulhaber sehr ungehalten auf diesen Brief. </p>
5. 4 1933 - Laut NSDAP fällt „Cenovis“ nicht unter den Juden-Boykott
<p><strong><em>München - München-Au</em></strong> * Das <em>„Zentralkomitee zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze“</em> der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei - NSDAP antwortet auf die Anfrage der Universitäts-Klinik Gießen, ob die <em>„Cenovis eine christliche Firma“</em> sei: Sie ist der Auffassung, <em>„dass die Voraussetzung für einen Boykott der Cenovis Werke München, Rosenheimer Straße, nicht gegeben sind und die Firma daher nicht unter dem Boykott am 1. April 1933 gefallen ist“</em>.</p>
Seit etwa 6. 4 1933 - „Für volksbewusstes Denken und Fühlen im deutschen Schrifttum“
Berlin * Die „Deutsche Studentenschaft“, der Dachverband der „Allgemeinen Studentenausschüsse“, wirbt bei den Studenten der einzelnen Hochschulen per Rundschreiben zur Mitarbeit an einer vierwöchigen Aktion „gegen den jüdischen Zersetzungsgeist und für volksbewusstes Denken und Fühlen im deutschen Schrifttum“.
6. 4 1933 - Erich Mühsam wird in das KZ Sonnenburg gebracht
<p><strong><em>Krustin</em></strong> * Erich Mühsam wird in das KZ Sonnenburg bei Krustin an der Oder gebracht. </p>
7. 4 1933 - Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Das <em>„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“</em> tritt in Kraft. Es ermächtigt die neuen Machthaber zur Entlassung oder Zwangspensionierung politisch <em>„unzuverlässiger Elemente“</em> und von Beamten jüdischer Herkunft.</p>
7. 4 1933 - „Das Kapital der Cenovis befindet sich in christlichen und jüdischen Händen“
<p><strong><em>München</em></strong> * Auf die Anfrage der Universitäts-Klinik Gießen, ob die <em>„Cenovis eine christliche Firma“</em> ist, antwortet die IHK München. Sie führt dabei aus, dass sich <em>„das Kapital der Firma Cenovis München teils in christlichen, teils in israelitischen Händen befindet“</em>. </p>
8. 4 1933 - Faulhaber erklärt sich als nicht zuständig für die Juden
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * In seinem Antwortschreiben an den Geistlichen Dr. Alois Wurm erklärt sich Kardinal Michael von Faulhaber gleich im ersten Satz als nicht zuständig, sich für Juden einzusetzen und fordert im Gegenzug Dr. Wurm zum Handeln auf. </p> <p>Natürlich findet auch er, dass <em>„dieses Vorgehen gegen die Juden [...] derart unchristlich [ist], daß jeder Christ, nicht bloß jeder Priester, dagegen auftreten müsste“</em>. </p> <p>Aus Faulhabers Sicht bestehen aber für die <em>„kirchlichen Oberbehörden [...] weit wichtigere Gegenwartsfragen; denn Schule, der Weiterbestand der katholischen Vereine, Sterilisierung sind für das Christentum in unserer Heimat noch wichtiger, zumal man annehmen darf, und zum Teil schon erlebte, daß die Juden sich selber helfen können, daß wir also keinen Grund haben, der Regierung einen Grund zu geben, um die Judenhetze in eine Jesuitenhetze umzubiegen. </em></p> <p><em>Ich bekomme von verschiedenen Seiten die Anfrage, warum die Kirche nichts gegen die Judenverfolgung tue. Ich bin darüber befremdet; denn bei einer Hetze gegen die Katholiken oder gegen den Bischof hat kein Mensch gefragt, was man gegen diese Hetze tun könne.<br /> Das ist und bleibt das Geheimnis der Passion“</em>. </p>
10. 4 1933 - Franz Xaver Ritter von Epp wird Reichsstatthalter von Bayern
<p><strong><em>Berlin - München</em></strong> * Franz Xaver Ritter von Epp wird durch Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichsstatthalter von Bayern ernannt.</p>
Seit etwa 10. 4 1933 - Die Voraussetzungen für die „Bücherverbrennungen“ werden geschaffen
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Der nationalsozialistisch orientierte Bibliothekar Dr. Wolfgang Herrmann erstellt im Auftrag des <em>„Verbandes Deutscher Volksbibliothekare“</em> Listen, die die Grundlage für die <em>„Bücherverbrennungen“</em> liefern. Sie werden am 26. April in der <em>„Berliner Illustrierten Nachtausgabe Nr. 97“</em> abgedruckt. </p>
11. 4 1933 - Die „SS“ übernimmt das Kommando im KZ Dachau
<p><strong><em>Dachau</em></strong> * Die <em>„SS“</em> übernimmt das Kommando im KZ Dachau. </p>
12. 4 1933 - Die ersten Gefangenen werden im KZ Dachau ermordet
<p><strong><em>Dachau</em></strong> * Die ersten Gefangenen werden im KZ Dachau ermordet. Das ist nur ein Tag, nachdem die SS das Kommando übernommen hat. </p>
13. 4 1933 - „Wider den undeutschen Geist!“
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Die Deutsche Studentenschaft gibt ihre Thesen <em>„Wider den undeutschen Geist!“</em> heraus. Darin wird unter anderem den Juden der Gebrauch der deutschen Sprache untersagt. Denn:</p> <ul> <li><em>„Der Jude kann nur jüdisch denken“</em>. Und weiter: <em>„Schreibt er deutsch, dann lügt er“</em>.</li> <li><em>„Der Deutsche, der deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist ein Verräter!“</em></li> </ul>
16. 4 1933 - Der „Protest der Richard-Wagner-Stadt München“ gegen Thomas Mann
München * Gegen den „Wagner-Vortrag“ Thomas Manns organisieren der Bayerische Staatsoperndirektor Prof. Hans Knappertsbusch und der Generalmusikdirektor Prof. Dr. Hans Pfitzner einen „Protest der Stadt München“. Dieser wird in den Münchner Neuesten Nachrichten abgedruckt und ist von den führenden Vertretern des künstlerischen Lebens Münchens unterzeichnet worden. Darunter
- der Präsident der Akademie der Bildenden Künste, Prof. Dr. German Bestelmeyer;
- der Bildhauer Bernhard Bleeker;
- Oberbürgermeister Karl Fiehler;
- der Akademieprofessor Olaf Gulbransson;
- der Generalintendant der Bayerischen Staatstheater, Clemens von Frankenstein;
- der Generalmusikdirektor Dr. Richard Strauß;
- der Präsident der Industrie- und Handelskammer Josef Pschorr
- und viele andere Honoratioren mehr.
In dem Protestschreiben heißt es: „Nachdem die nationale Erhebung Deutschlands festes Gefüge angenommen hat, kann es nicht mehr als Ablenkung empfunden werden, wenn wir uns an die Öffentlichkeit wenden, um das Andenken an den großen deutschen Meister Richard Wagner vor Verunglimpfung zu schützen.
Wir empfinden Wagner als musikalisch-dramatischen Ausdruck tiefsten deutschen Gefühls, das wir nicht durch ästhetisierenden Snobismus beleidigen lassen wollen, wie das mit so überheblicher Geschwollenheit in Richard-Wagner-Gedenkreden von Herrn Thomas Mann geschieht. [...]
Wir lassen uns eine solche Herabsetzung unseres großen deutschen Musikgenies von keinem Menschen gefallen, ganz sicher aber nicht von Herrn Thomas Mann, [...].
Wer sich selbst als derart unzuverlässig und unsachverständig in seinen Werken offenbart, hat kein Recht auf Kritik wertbeständiger deutscher Geistesriesen.“
Thomas Mann wiederholt seinen Vortrag in Amsterdam, Brüssel und Paris. Doch nach dem „Protest der Richard-Wagner-Stadt München“ kann er nicht mehr in seine Heimatstadt zurückkehren.
26. 4 1933 - Die „Bücherverbrennungs-Listen“ werden veröffentlicht
Deutsches Reich * In der „Berliner Illustrierten Nachtausgabe Nr. 97“ werden die vom nationalsozialistisch orientierte Bibliothekar Dr. Wolfgang Herrmann erstellten Listen abgedruckt und den „Studentenschaften“ von ihrem Dachverband zugänglich gemacht.
Die Listen bilden die Grundlage für die „Bücherverbrennungen“.
26. 4 1933 - Die SPD protestiert gegen die Ernennung Hitlers zum „Ehrenbürger“
München-Graggenau * Die SPD protestiert gegen die Ernennung des „Reichskanzlers“ Adolf Hitler und des „Reichsstatthalters“ Franz Ritter von Epp zu „Münchner Ehrenbürgern“.
Das ist der Anlass, weshalb die NSDAP-Stadträte die SPDler bei der nächsten Sitzung aus dem Sitzungssaal prügeln werden.
In einer Erklärung lehnt die NSDAP „jede weitere Zusammenarbeit mit den marxistischen Arbeiterverrätern“ ab.
Die SPD-Stadträte fordert sie auf, „sofort und ein für allemal aus der Gemeindevertretung zu verschwinden“.
27. 4 1933 - Uraufführung des Valentin-Stücks „Ehescheidung vor Gericht“
München-Ludwigsvorstadt * Uraufführung des Valentin-Stücks „Ehescheidung vor Gericht“ im „Kabarett Wien-München“ im „Hotel Wagner“, Sonnenstraße 23.
Innerhalb von 15 Minuten tritt Liesl Karlstadt als Ehemann, Ehefrau, Sohn, preußischer Untermieter und als „Ratschkathl“ auf.
Das Stück wird in 64 Vorstellungen aufgeführt.
28. 4 1933 - Der Bayerische Landtag tritt letztmals zusammen
München-Kreuzviertel * Der Bayerische Landtag tritt an diesem und dem darauffolgenden Tag letztmalig für die nächsten 13 Jahre zusammen. Der Landtag wird nach dem Ergebnis der Reichstagswahlen,vom 5. März 1933 gebildet. Von den 103 Abgeordneten gehören 51 Abgeordnete der NSDAP an, 30 der Bayerischen Volkspartei - BVP, 17 der SPD und 5 der Kampffront. Von einer freien Volksvertretung kann allerdings keine Rede mehr sein.
Der Landtag hat nur mehr das Ermächtigungsgesetzes zur endgültigen Selbstausschaltung als Verfassungsorgan zu erlassen. Ansonsten dienen die beiden Sitzungen vornehmlich der Demonstration der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Bayern.
29. 4 1933 - Der Bayerische Landtag verabschiedet das Ermächtigungsgesetz
München-Kreuzviertel * Im Bayerischen Landtag wird das Ermächtigungsgesetz verabschiedet.
Lediglich die 16 anwesenden SPD-Abgeordneten stimmen gegen die vollständige Machtergreifung Hitlers.
Damit wird die bayerische Parlaments-Tradition mit einem Federstrich beendet.
1. 5 1933 - Der „Allgemeine Deutsche Automobilclub“ spendet der NSDAP Benzin
München * Der „Allgemeine Deutsche Automobilclub“ spendet der NSDAP Benzin, damit sie den „Tag der Deutschen Arbeit“ kostengünstiger organisieren kann.
2. 5 1933 - Den Konsumgenossenschaften schlägt die letzte Stunde
München - München-Au * Die Nazis übernehmen schnell die Argumente der Mittelstandsbewegung, weshalb nach der Machtübernahme der NSDAP allen Konsumgenossenschaften die letzte Stunde schlägt.
Die „SA“ besetzt die Zentrale des „Konsumvereins München von 1864“, schließt die Betriebe und Geschäfte und enteignet den Verein.
2. 5 1933 - Die „Freien Gewerkschaften“ werden gewaltsam aufgelöst
Deutsches Reich * Die „Freien Gewerkschaften“ werden im gesamten Reich mit brutaler Gewalt aufgelöst.
5. 5 1933 - Ein „Hirtenbrief“ der bayerischen Bischöfe
München-Kreuzviertel - Bayern * Angeblich wollte „Kardinal“ Michael von Faulhaber das „Unrecht gegen die Juden“ in seinem „Hirtenbrief“ vom 5. Mai ansprechen, wird aber von den anderen Bischöfen davon abgehalten.
In dem „Hirtenbrief“ der bayerischen Bischöfe heißt es jetzt:
„Unsere jetzige Reichsregierung hat sich große und schwierige Aufgaben gestellt; sie will das deutsche Volk, das an den Folgen des verlorenen Weltkrieges und der Revolution so unsäglich viel leidet, wieder zur früheren Höhe emporführen durch eine geistige, sittliche und wirtschaftliche Erneuerung. [...]
Daher rufen wir Bischöfe in tiefer Liebe zu unserem armen Vaterlande, [...] den Blick nicht mehr zu richten auf die Vergangenheit, nicht auf das zu sehen, was uns trennt, sondern auf das, was uns eint, daher einander die Hand zu reichen und in hochherziger Opferwilligkeit die vereinten Kräfte einzusetzen, um der furchtbaren Not, dem immer weiter fortschreitenden Niedergang und dem unseligen Unfrieden Einhalt zu bieten. [...]
Der Wiederaufbau unseres Volks- und Staatslebens muß zur Grundlage haben die ewigen, unantastbaren Gesetze des christlichen Glaubens, der christlichen Sitte, der christlichen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens.
Es verdient aufrichtigen Dank, daß der höchste Vertreter der Reichsregierung in feierlicher Stunde erklärte, das Werk der Wiedererneuerung unseres Volkes auf den Felsengrund des christlichen Glaubens stellen und freundschaftliche Beziehungen zur Kirche pflegen zu wollen. [...]
Wir sind dankbar für die Erklärung des Reichskanzlers, daß die Rechte der Kirchen nicht geschmälert, ihre Stellung zum Staate nicht geändert werden wird“.
6. 5 1933 - Die erste Bücherverbrennung durch die Hitlerjugend
München * Die Hitlerjugend - HJ führt in München die erste Bücherverbrennung durch.
10. 5 1933 - Das Vermögen der SPD wird beschlagnahmt
Berlin * Das gesamte Vermögen der SPD wird beschlagnahmt.
11. 5 1933 - Angriffe der NS-Machthaber auf den „Vorstand der Löwenbräu AG“
München-Maxvorstadt * Im „Vorstand der Löwenbräu AG“ wird über die „Angriffe der nationalsozialistischen Machthaber“ diskutiert.
Das Protokoll vermerkt, „gewisse Anzeichen, die auf den künftigen Wegfall städtischer und staatlicher Bierlieferungen und darüber hinaus auf die Möglichkeit eines Boykottes abzielen“.
Daraufhin stellen einige jüdische Vorstandsmitglieder ihre Mandate zur Verfügung.
Joseph Schülein zieht sich auf sein „Gut Kaltenberg“ zurück.
Dr. Hermann Schülein bleibt - aufgrund seiner unersetzlichen Fachkompetenz - formal im „Löwenbräu-Vorstand“, muss aber als Vorsitzender zurücktreten.
12. 5 1933 - „Die Löwenbrauerei ist nunmehr ein deutsches Unternehmen“
München * Der Völkische Beobachter stellt zufrieden fest:
„Die Löwenbrauerei kann nunmehr mit vollem Recht als ein deutsches Unternehmen bezeichnet werden. [...] Damit entfallen die bisherigen Anwürfe“.
12. 5 1933 - Oskar Maria Graf veröffentlicht: „Verbrennt mich! - Ein Protest“
Wien * Oskar Maria Graf veröffentlicht in der marxistischen Wiener Arbeiter-Zeitung unter der Überschrift „Verbrennt mich! - Ein Protest“ seine Nachverbrennung.
„Laut ‚Berliner Börsencourier‘ stehe ich auf der ‚weißen Autorenliste‘ des neuen Deutschlands, und alle meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerkes ‚Wir sind Gefangene‘, werden empfohlen:
Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des ‚neuen‘ deutschen Geistes zu sein!
Vergebens frage ich mich: Womit habe ich diese Schmach verdient?
[...] Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen.
Verbrennt die Werke des deutschen Geistes!
Er selbst wird unauslöschlich sein wie eure Schmach!“
Oskar Maria Graf
Um den 15. 5 1933 - Den Nationalsozialisten sind die Kaufhäuser ein Dorn im Auge
Berlin * Den Nationalsozialisten sind die Kaufhäuser als „Prototypen wurzellosen kapitalistischen Gewinnstrebens“ ein Dorn im Auge. Adolf Hitler erlässt eine „Errichtungs- und Erweiterungssperre für Warenhäuser“. Die Gewerbekapitalsteuer für solche Unternehmen verdoppelt sich in dieser Zeit.
Vor den Kaufhäusern verteilen Nazis Flugblätter mit Boykottaufrufen. Sprechchöre verkünden: „Wer im Warenhaus kauft, ist ein Lump!“ Selbst die Kaufhaus-Verkäuferinnen sind von den brauen Machthabern nicht gerne gesehen, weil die materielle Abhängigkeit von männlichen Vorgesetzten und der stete Kontakt mit einem anonymen Publikum ihre Tugend überfordern könnte. Außerdem verlockt die Atmosphäre der Kaufhäuser zu „Vergnügungs- und Putzsucht“.
Vor allem aber fürchtet die NSDAP, dass sich durch diesen neuen Frauenberuf die „selbstbewusste, unabhängige, arbeitende Frau“ emanzipieren und „Mutterschaft und Haushalt“ nicht mehr als das erstrebenswerte Ziel ansehen könnte.
Um den 15. 5 1933 - Die Reaktion auf Oskar Maria Grafs Nachverbrennungs-Aufruf
München * Die Münchner Neuesten Nachrichten antworten auf Oskar Maria Grafs „Nachverbrennungs-Aufruf“ derart:
„Wir haben bisher die Bücher von Oskar Maria Graf [...] für viel zu unbedeutend gehalten. [...]
Aber wenn der Herr Dichter durchaus will, nun wir sind gar nicht so. [...]
Also hinein mit ihm ins Feuer!“
19. 5 1933 - Der Turn- und Sportverein München-Ost wird aufgelöst
München-Obergiesing * Der Turn- und Sportverein München-Ost wird durch das NS-Regime aufgelöst.
- Das gesamte Vereinsvermögen wird beschlagnahmt,
- das Vereinsheim in das SA-Heim Georg Hirschmann umfunktioniert.
22. 5 1933 - Die Münchner SPD-Stadträtekommen in Schutzhaft
München * Sämtliche Münchner SPD-Stadträte werden in Schutzhaft genommen.
6 1933 - Professor Dr. Ernst von Romberg hält weiterhin Vorträge
München-Maxvorstadt * Professor Dr. Ernst von Romberg, Bewohner der Richard-Wagner-Straße 2, kann, obwohl er Jude ist, noch einen Vortragszyklus halten, der sogar in einem Organ der NSDAP angekündigt wird.
Der Grund: Nach dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ konnten alle jüdischen Ärzte, die ihren Beamtenstatus vor 1914 erhalten haben, noch weitere zwei Jahre im Amt bleiben.
Da Romberg seit 1912 Professor war, trifft für ihn diese „Ausnahmeregelung“ zu.
6 1933 - Die jüdische Gesellschaft in München und Bayern
Bayern - München * In ganz Bayern leben etwa 42.000 „Glaubensjuden“, also Mitglieder der jüdischen Relegionsgemeinschaften.
Das entspricht 0,55 Prozent der Gesamtbevölkerung.
9.005 davon sind in München ansässig.
6 1933 - Eine Webekampagne für die nordisch-völkischen „Deutschen Christen“
München * Vor den Kirchenwahlen beginnen die nordisch-völkischen „Deutschen Christen“ auch in Bayern eine großangelegte Werbekampagne.
22. 6 1933 - Der NS-Stadtrat fordert die Entfernung des Revolutions-Denkmals
München * Der NS-Stadtrat Hans Zölberlein fordert die Entfernung des Grabmals, das Kurt Eisner und dem Gedenken der Toten der Revolution gewidmet ist, da es „ein Ärgernis für jeden guten Deutschen und alten bayerischen Soldaten“ darstellt.
- Nachdem die Nationalsozialisten im Jahr 1933 den Gedenkstein zertrümmert haben, übergeben sie Kurt Eisners Urne dem Neuen Israelitischen Friedhof an der Ungererstraße.
- Auch Gustav Landauers Grab wird für erloschen erklärt. „Der Abbruch der Denkmäler und die Beseitigung der Aschen hat unverzüglich zu erfolgen.“ Die Urnen von Eisner und Landauer werden der Israelitischen Kultusgemeinde übergeben, die auch noch die Kosten zu tragen hat.
22. 6 1933 - Ein neuer Vertrag mit dem Scharfrichter Johann Reichhart
München * Der dem NS-Reichsstatthalter Ritter von Epp unterstellte Freistaat Bayern schließt mit dem Scharfrichter Johann Reichhart einen neuen Vertrag. Damit erhöht sich dessen Jahresgehalt auf stattliche 3.000.- RMark (monatlich 250 RM). Er verfügt nun über ein regelmäßiges Einkommen, das dem eines Regierungsrates entspricht.
22. 6 1933 - In Trudering entsteht ein Kolonialviertel
München-Graggenau - München-Trudering * Der von den Nationalsozialisten dominierte Stadtrat lässt aufgrund der durch die Eingemeindung Truderings am 1. April 1932 notwendigen Straßenumbenennungen ein sogenanntes Kolonialviertel entstehen.
Die NSDAP kommt damit den alten Forderungen der Kolonialverbände und der Kriegerschaft Deutscher Kolonialtruppen entgegen. Die Straßen dieses Viertels setzen seither zusammen aus reinen Länderbezeichnungen - aber auch aus Ehrungen für einige der grausamsten Offiziere der Kolonialgeschichte des Deutschen Reiches.
22. 6 1933 - Die SPD wird reichsweit verboten
Berlin * Die SPD wird im gesamten Reich verboten. Die Mandate der SPD-Abgeordneten erlöschen damit.
26. 6 1933 - Empörung über die Zwangsmaßnehmen gegen Eisner und Landauer
München * In der Hauptstadt der Bewegung gibt es zu dieser Zeit noch immer Menschen, die die Zwangsmaßnahmen gegen die toten Kurt Eisner und Gustav Landauer empören. Es geht bei der NSDAP-Stadtratsfraktion ein anonymer Brief ein, in dem zu lesen ist:
„Scheusale der Kultur!! Ihr seid doch echte Idioten
lasst nicht einmal in Ruh die Toten
der Geist der Toten lebet fort
trotz brauner Pest und Nazimord!!“
27. 6 1933 - Was tun mit Kurt Eisners und Gustav Landauers Urnen ?
München * Nachdem das Denkmal für die „Toten der Revolution - 1919“ am Ostfriedhof abgerissen worden war, wollen die Nationalsozialisten die darin untergebrachten Urnen von Kurt Eisner und Gustav Landauer an die Israelitische Kultusgemeinde Münchens loswerden.
Diese antwortet an 27. Juni 1933: „[…] beehren wir uns mitzuteilen, dass wir derzeit nicht feststellen können, ob die Genannten bei Eintritt des Todes dem israelitischen Bekenntnis angehört haben. […] Wir wollen aber keine Schwierigkeiten schaffen und erklären uns bereit, die Urnen entgegen zu nehmen und sie einstweilen der Erde zu übergeben.“
28. 6 1933 - Die Akademie des Deutschen Rechts wird gegründet
München-Maxvorstadt * Die Akademie des Deutschen Rechts wird vom Rechtsanwalt Hans Frank gegründet.
4. 7 1933 - Die Bayerische Volkspartei - BVP löst sich auf
München * Die Bayerische Volkspartei - BVP löst sich auf. Zuvor hat Heinrich Himmlers Bayerische Politische Polizei - BPP nahezu alle wichtigen Funktionäre und sämtliche BVP-Land- und Reichstagsabgeordnete verhaften lassen.
5. 7 1933 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt nehmen den Film Orchesterprobe auf
München-Geiselgasteig * Karl Valentin und Liesl Karlstadt nehmen den 23-Minuten-Film „Orchesterprobe“ in Geiselgasteig auf. Regie führt Carl Lamac.
8. 7 1933 - Das Konkordat wird paraphiert
Rom-Vatikan - Berlin * Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich wird paraphiert.
11. 7 1933 - Juden dürfen nicht mehr auf christlichen Friedhöfen beigesetzt werden
München * Die Nazi-Stadträte regeln, dass die Asche verstorbener Juden nicht mehr auf christlichen Friedhöfen beigesetzt werden darf.
14. 7 1933 - Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Berlin * Im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses bestimmten die Nationalsozialisten, dass Menschen in acht Krankheitsfällen - auch gegen ihren Willen - sterilisiert, also unfruchtbar gemacht werden können. Die aufgeführten Krankheiten sind:
- angeborener Schwachsinn,
- Schizophrenie,
- manisch-depressives Irresein,
- Epilepsie,
- Veitstanz,
- erbliche Blindheit und Taubheit und
- schwere körperliche Mißbildungen.
Außerdem können Personen, die an schwerem Alkoholismus leiden, unfruchtbar gemacht werden.
In den Jahren von 1933 bis 1945 werden aufgrund dieses Gesetzes circa 400.000 Männer und Frauen mit erblichen Krankheiten sterilisiert. Nach den Grundsätzen nationalsozialistischer Erbgesundheitspflege gehört die Maßnahme der Sterilisation zur künstlichen Ausmerze, die bis zur Vernichtung lebensunwerten Lebens geht.
20. 7 1933 - Das Konkordat wird ratifiziert
Rom-Vatikan - Berlin * Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich wird vom - katholischen - Vizekanzler Franz von Papen und vom Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli im Vatikan unterzeichnet.
- Das Vertragswerk bestätigt die bestehenden Länderkonkordate mit Bayern, Preußen und Baden und
- den Fortbestand der katholischen theologischen Fakultäten an den Universitäten,
- sichert den katholischen Religionsunterricht an allen Schularten und
- die Beibehaltung und Neueinrichtung von Bekenntnisschulen,
- die Freiheit des Bekenntnisses und
- der öffentlichen Ausübung der Religion,
- den staatlichen Schutz für Geistliche,
- den Schutz des Beichtgeheimnisses und
- den Schutz der katholischen Organisationen.
- Außerdem wird die Militärseelsorge und
- das eigene kirchliche Steuerrecht garantiert.
Die Kirche gesteht hingegen den neuen Machthabern nur wenig zu:
- Entpolitisierung des Klerus,
- Treueeid der Bischöfe gegenüber dem Deutschen Reich und seinen verfassungsmäßig gebildeten Regierungen.
Die Reichsregierung macht der Kirche sehr große Zugeständnisse mit dem Ziel, internationale Anerkennung zu erhalten und die deutschen Katholiken für die Bewegung zu gewinnen, solange deren Macht noch nicht gefestigt ist.
Keine der anderen neunzehn Weimarer Regierungen, auch nicht die Koalitionen mit Zentrumsbeteiligung, war der katholischen Kirche so weit entgegengekommen.
22. 7 1933 - Reichskanzler Hitler unterstützt die Deutschen Christen
Berlin * Noch am Vorabend der Kirchenwahlen macht Hitler in einer Rundfunkrede klar, was die evangelischen Christen zu wählen haben:
„Die Kräfte einer lebendigen Bewegung. Diese Kräfte sehe ich in jenem Teil des evangelischen Kirchenvolkes in erster Linie versammelt, die als Deutsche Christen bewusst auf den Boden des NS-Staates getreten sind“.
23. 7 1933 - Der Kirchenvorstand besteht zu 50 Prozent aus NS-Parteigenossen
München-Obergiesing * Der gewählte Kirchenvorstand der evangelischen Martin-Luther-Kirche besteht zu fünfzig Prozent aus NS-Parteigenossen. Der Münchner Dekan sagt:
„Dass der Wunsch geherrscht hat, es möchten in unseren Kirchenvorständen besonders auch solche Männer Platz finden, die in der deutschen Freiheitsbewegung an hervorragender Stelle stehen - das war allen verständlich. Wir brauchen diese Männer in der kirchlichen Arbeit“.
Hauptsache ist, dass die Gottlosen-Propaganda ihr Ende findet.
25. 7 1933 - Die Machtergreifung der Nazis in München ist abgeschlossen
München * Durch das Verbot der KPD und SPD sowie der Auflösung der BVP wird das Stadtratsgremium auf 40 Sitze reduziert.
Aus dem Kreis der NSDAP rücken 17 Stadträte in den nun rein nationalsozialistischen Stadtrat nach. Damit ist die Machtergreifung der Nazis in München abgeschlossen.
7. 8 1933 - Felix Fechenbach wird „auf der Flucht erschossen“
Scherfede * Felix Fechenbach wird auf dem Weg von Detmold ins KZ Dachau in Scherfede „auf der Flucht erschossen“.
23. 8 1933 - Lion Feuchtwanger wird die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt
Berlin * Lion Feuchtwanger wird die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.
9 1933 - Das letzte „Zentral-Landwirtschaftsfest“ vor dem Zweiten Weltkrieg
München-Theresienwiese * Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ wird letztmals vor dem Zweiten Weltkrieg veranstaltet.
Kurz danach werden die Bauernkammern „gleichgeschaltet“, weshalb das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ während der NS-Zeit von der „Theresienwiese“ verschwindet.
9 1933 - Juden werden für das Oktoberfest nicht mehr zugelassen
München-Theresienwiese * Personen jüdischer Abstammung werden „im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ zur Verabreichung von Speisen und Getränken und zur „Veranstaltung von Lustbarkeiten“ nicht mehr auf dem „Oktoberfest“ zugelassen.
Dies gilt auch für Angestellte, Mitarbeiter, Gehilfen oder Mitspieler.
9 1933 - Der „Bierpreis“ wird vom NS-Stadtrat auf 90 Pfennige festgesetzt
München-Theresienwiese * Der „Bierpreis“ wird vom NS-Stadtrat auf 90 Pfennige festgesetzt.
1. 9 1933 - Johann Reichhart gehört verschiedenen Untergliederungen der NSDAP an
München * Der Scharfrichter Johann Reichhart gehört verschiedenen Untergliederungen der NSDAP an.
10. 9 1933 - Das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl tritt in Kraft
Rom-Vatikan - Berlin * Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich tritt in Kraft.
11. 9 1933 - Ein Denkmal für die Befreiung Münchens von den Räten
München * Der NS-Stadtrat Hans Zölberlein beantragt
- „ein Denkmal für die Befreiung Münchens vom Rätewahnsinn. [...]
- Zur dauernden Erinnerung an die geschichtlich bedeutsamen Maitage und
- als Dank für das Opfer des Lebens von über 200 Freikorpssoldaten“.
Der Münchner Stadtrat schreibt daraufhin einen Wettbewerb für eine „Erinnerungsstätte zum Gedenken an die Befreiung Münchens 1919“ aus. Diese soll am Ostrand der Ramersdorfer Muster-Siedlung aufgestellt werden und die über Ramersdorf ankommenden Autobahnbenutzer begrüßen. Doch der für Ramersdorf geplante „Autofahrerschreck“ kommt nicht zur Aufstellung, dafür wird Giesing - aufgrund seiner „linken“ Vergangenheit - vom Nazi-Stadtrat als Standort für ein Freikorps-Denkmal auserkoren.
1. 10 1933 - Wilhelm Adam wird Kommandierender General im Wehrkreis VII
München * Kommandierender General im Wehrkreis VII wird Wilhelm Adam.
11. 10 1933 - Adolf Hitler legt den Grundstein für das Haus der Deutschen Kunst
München-Lehel * Reichskanzler Adolf Hitler legt, begleitet vom Geläute sämtlicher Münchner Kirchenglocken, den Grundstein für das Haus der Deutschen Kunst. Dabei bricht der Zeremonienhammer in zwei Teile. Ein böses Omen.
Zugleich verleiht der „Führer“ der bayerischen Hauptstadt den Ehrentitel „Hauptstadt der Deutschen Kunst“.
11. 10 1933 - Josef Hofmiller stirbt in Rosenheim
Rosenheim * Josef Hofmiller stirbt in Rosenheim.
21. 10 1933 - Uraufführung des Valentin-Bühnenstücks „Der Theaterbesuch“
München-Ludwigsvorstadt * Uraufführung des Valentin-Bühnenstücks „Der Theaterbesuch“ im Kabarett Wien-München, im Hotel Wagner in der Sonnenstraße 23. Das Stück wird 156 Mal aufgeführt.
8. 11 1933 - Adolf Hitler eröffnet im Sterneckerbräu das NSDAP-Parteimuseum
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet im ehemaligen Sterneckerbräu das Parteimuseum der NSDAP. Es wird zur Wallfahrtsstätte der Nationalsozialisten und zum Magneten für Einheimische und Fremde. 20 Pfennig kostet der Eintritt zu den museal hergerichteten Räumen.</p> <p>Im Rahmen der alljährlichen pompösen Veranstaltungen am 9. November zur Erinnerung an den Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 findet beim Marsch vom Bürgerbräukeller zur Feldherrnhalle eine Gedenkminute vor dem Sterneckerbräu statt. </p>
15. 11 1933 - Der Bau der Reichsautobahn München - Salzburg wird begonnen
Unterhaching * Ohne Zeremoniell wird der Bau der Reichsautobahn München - Salzburg begonnen.
27. 11 1933 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Die Orchesterprobe
Berlin * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Die Orchesterprobe" in Berlin im Beiprogramm zu „Glückliche Reise“.
12 1933 - Dreharbeiten zu dem Film „Es knallt“
München-Geiselgasteig * Dreharbeiten zu dem Film „Es knallt“ mit Karl Valentin als Fürst und Kunstschützen sowie Liesl Karlstadt als Wirtin in den Hauptrollen.
7. 12 1933 - Antisemitisch motivierte Straßenumbenennungen
München-Berg am Laim * Die Berg am Laimer Schüleinstraße und der Schüleinplatz werden aufgrund des Antrags des NSDAP-Stadtrats in Halserspitzstraße und Halserspitzplatz umbenannt.
10. 12 1933 - Der Kommerzienrat Emil Zeckendorf stirbt
München-Maxvorstadt * Der Kommerzienrat und Handelsrichter Emil Zeckendorf, Eigentümer des Hauses Richard-Wagner-Straße 11, stirbt.
18. 12 1933 - Professor Dr. Ernst von Romberg stirbt
München-Maxvorstadt * Professor Dr. Ernst von Romberg, Bewohner des Hauses in der Richard-Wagner-Straße 2, stirbt im Alter von 68 Jahren.
31. 12 1933 - Die Münchner Brockensammlung wird aufgelöst
München-Isarvorstadt * Die Münchner Brockensammlung wird aufgelöst.
1934 - Planungen für ein „Jagdmuseum“ im „Palais Leopold“
München-Schwabing * Das Areal des „Leopoldparks" samt dem dazugehörenden „Palais Leopold“ geht in den Besitz der Stadt über.
Der Nazi-Führer Christian Weber plant hier die Errichtung eines „Jagdmuseums“, das dann aber im „Schloss Nymphenburg“ verwirklicht wird.
1934 - Der Valentin-Film „Der Zithervirtuose“ wird gedreht
München * Nach seiner Originalszene „Der Zithervirtuose“ wird im Münchner „Arri-Atelier“ der gleichnamige Film gedreht.
Karl Valentin spielt den Zithervirtuosen, Adolf Gondrell den Ansager.
1934 - Der „Metzgersprung“ wird für das „Winterhilfswerk“ noch einmal aufgeführt
München-Graggenau * Der „Metzgersprung“ wird zugunsten des „Winterhilfswerkes“ noch einmal aufgeführt und ein dreijähriger Turnus beschlossen.
Der Brauch schläft aber systembedingt bald darauf ein.
1934 - Das „Kuratorium für das Braune Band von Deutschland“ gegründet
München * Der „NS-Ratsherr“ Christian Weber gründet das „Kuratorium für das Braune Band von Deutschland“.
1934 - Der „SA Sturm 4“ nistet sich im „Bezirksamtes am Lilienberg“ ein
München-Au * In den Erdgeschossräumen des „Bezirksamtes am Lilienberg“ nistet sich der „SA Sturm 4“ ein.
1934 - German Bestelmeyer plant den Abriss der „Ruhmeshalle“
München-Theresienwiese * Der Architekt German Bestelmeyer plant den Abriss der „Ruhmeshalle“, um dort ein Versammlungsgebäude zu errichten.
1934 - Ausbau der „Omnibusstraße“ durch den „Englischen Garten“
München-Englischer Garten - Lehel - Schwabing * Ausbau der „Omnibusstraße“ durch den „Englischen Garten“ zwischen Martiusbrücke und Oettingnstraße.
1934 - Das „Neue Schloss Biederstein“ wird abgerissen
München-Schwabing * Das „Neue Schloss Biederstein“ - von Leo von Klenze - wird abgerissen.
Das Gelände um das „Schloss Biederstein“ wird als Bauland parzelliert.
Ab 1934 - Mit der „Martin-Luther-Kirche“ ist die Gefängnisseelsorge verbunden
München-Obergiesing * Mit der „Martin-Luther-Kirche“ ist die Gefängnisseelsorge im Gefängnis „Stadelheim“ verbunden.
Da die Zahl der Hinrichtungen ständig ansteigt, muss Pfarrer Alt zweimal in der Woche den Verurteilten tröstend beistehen, darunter auch den Geschwistern Scholl.
1934 - Dr. Joseph Fuchs flieht samt seinem „Bugatti Royale“ vor den Nazis
Nürnberg * Der Nürnberger Arzt Dr. Joseph Fuchs muss nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten - aufgrund seiner „jüdischen Abstammung“ - emigrieren.
Seinen „Bugatti Royale“ nimmt er mit ins Exil, das ihn über die Schweiz, Shanghai und Kanada nach New York führt.
1934 - Der „Cowboy Club München Süd“ wird für den Film engagiert
München-Geiselgasteig * Mitglieder des „Cowboy Clubs München Süd“ werden mit ihren Frauen als Komparsen für den Film „Mit dir durch dick und dünn“ engagiert.
Anfang 1 1934 - Die Arbeiten zum Valentin-Karlstadt-Film „Der Theaterbesuch“ beginnen
München-Geiselgasteig * Die Arbeiten zum Film „Der Theaterbesuch“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt in den Hauptrollen beginnen.
Der Film dauert 23 Minuten.
Die Regie führt Joe Stöckel.
6. 1 1934 - Kardinal Faulhaber verteidigt Adolf Hitler
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber wird nicht müde, Adolf Hitler gegen Angriffe zu verteidigen. „Ich betone wiederholt: Der Reichskanzler will Christentum, man kann nicht sagen, er will Heidentum.“
18. 1 1934 - Das Jahreseinkommen des Scharfrichters Reichhart wird erhöht
München * Das Jahreseinkommen des Scharfrichters Johann Reichhart wird auf 3.720 RM (monatlich 310 RM) angehoben.
30. 1 1934 - Das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches
München-Kreuzviertel * Der Freistaat Bayern geht mit dem Gesetz über den Neuaufbau des Reiches unter.
- Die Länderparlamente und die Hoheitsrechte der Länder werden aufgehoben.
- Die Länderregierungen werden zu Mittelbehörden des Reichs.
- Die deutschen Länder dürfen keine eigenen diplomatischen Vertretungen mehr unterhalten.
- Reichsstatthalter Franz Xaver Ritter von Epp untersteht der Dienstaufsicht des Reichsinnenministeriums.
- Seine Aufgabe besteht hauptsächlich in der schrittweisen Auflösung der politischen Selbstständigkeit Bayerns.
Als Epps Amtssitz wird das ehemalige Gebäude der Preußischen Gesandtschaft ausgewählt, das inzwischen in den Besitz des Deutschen Reichs übergegangen war.
30. 1 1934 - Bischöflicher Fahnenschmuck zum Jahrestag der Machtübernahme
München-Kreuzviertel * Am ersten Jahrestag der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten lässt Kardinal Michael von Faulhaber das Erzbischöfliche Palais mit Fahnen schmücken. In sein Tagebuch schreibt er: „Die Übernahme war legal, also feiern.“
31. 1 1934 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Stücks „Beim Rechtsanwalt“
München-Ludwigsvorstadt * Premiere des Valentin-Karlstadt-Bühnenstücks „Beim Rechtsanwalt“ im Kabarett Wien-München im Hotel Wagner in der Sonnenstraße 23. Das Stück erlebt insgesamt 138 Vorstellungen.
2 1934 - Valentin/Karlstadt beteiligen sich am
München * Karl Valentin und Liesl Karlstadt beteiligen sich mit einem Wagen am "Münchner Faschingszug".
Er ist mit Gerümpel vollgestellt und trägt die Aufschrift: "Entschuldigung wir sind mit dem Wagen nicht fertig worn".
2 1934 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Im Schallplattenladen“ wird gedreht
München-Geiselgasteig * Der 19-Minuten-Film „Im Schallplattenladen“ nach der gleichnamigen Originalszene von Karl Valentin und Liesl Karlstadt entsteht unter der Regie von Hans H. Zerlett.
2. 2 1934 - Erich Mühsam wird in das KZ Oranienburg gebracht
Oranienburg * Erich Mühsam wird in das KZ Oranienburg gebracht.
17. 3 1934 - Karl Valentin beantragt die Konzession für sein „Panoptikum“
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Karl Valentin beantragt die Konzession für sein <em>„Panoptikum“</em> in den Kellerräumen des <em>Hotels Wagner</em> in der Sonnenstraße. </p> <ul> <li>Als Unternehmer gibt er an: <em>„Karl Valentin (Fey) Schauspieler, Liesl Karlstadt (Wellano) Schauspielerin, Eduard Hammer Universitätsplastiker und Gebrüder Wagner, Besitzer des Hotels Wagner.</em></li> <li>Die Illustrationen für das <em>„Panoptikum“</em> fertigt Ludwig Greiner.</li> </ul>
21. 3 1934 - Ein durchinszenierter Auftritt an der Autobahn-Baustelle
Unterhaching * Der Tag soll nach dem Willen der Nationalsozialisten als „Großkampftag der Arbeitsschlacht“ in die Annalen eingehen. Es wird das Bild einer zupackenden NS-Herrschaft vermittelt, die Menschen mit dem Bau der „Straßen des Führers“ schnell in Arbeit bringt.
Der durchinszenierte Auftritt, bei dem Adolf Hitler auf der Reichsautobahn-Baustelle den Beginn der „Arbeitsschlacht“ gegen die Arbeitslosigkeit verkündet, erzielt die gewollte Wirkung. Das Ereignis bei Unterhaching begründet den Mythos vom Wirtschaftswunder und von den Autobahnen, die dem NS-Regime zu verdanken seien.
Die Propaganda-Schau soll über den Ort hinauswirken. Man hat Tausende Arbeiter herangekarrt und lässt diese mit geschulterten Spaten antreten. Im gesamten Land ruht die Arbeit. In Behörden, Betrieben und Schulen sind auf Anordnung Radiogeräte anzuschalten. 180 Journalisten ausländischer Zeitungen sind anwesend.
26. 3 1934 - Kardinal Faulhaber nimmt Hitler erneut in Schutz
<p><em><strong>München-Kreuzviertel</strong></em> * Kardinal Michael von Faulhaber schreibt:<em> „Ich nehme Hitler in Schutz, dass er guten Willen und staatsmännische Fähigkeiten habe.“ </em></p>
9. 4 1934 - Konzession für Karl Valentins „Panoptikum“ bewilligt
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Polizeidirektion bewilligt die Konzession für Valentins <em>„Panoptikum“</em> für die Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 1934.</p>
11. 4 1934 - Filmpremiere des Valentin-Karlstadt-Films „Der Theaterbesuch“
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films <em>„Der Theaterbesuch“</em> im Primus Palast in Berlin als Beiprogramm zu <em>„Achtung, wer kennt diese Frau“</em>.</p>
17. 4 1934 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Films „Es knallt“
Berlin * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Es knallt“ im „Atrium" in Berlin im Beiprogramm zu „Die vertauschte Braut".
5 1934 - Der Valentin-Karlstadt-Film „So ein Theater/Vorstadttheater“ entsteht
München-Geiselgasteig * In Geiselgasteig entsteht der Film „So ein Theater/Vorstadttheater“ mit Karl Valentin als Geiger und Liesl Karlstadt als Kapellmeister in den Hauptrollen.
8. 5 1934 - Geschwindigkeitsbegrenzungen werden aufgehoben
Berlin - Deutsches Reich * Mit der Reichs-Straßenverkehrsordnung werden alle Bestimmungen über Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgehoben. Damit soll der Autoabsatz angekurbelt werden.
Ab 29. 5 1934 - „Der verhexte Scheinwerfer“ wird in Geiselgasteig gedreht
München-Geiselgasteig * Karl Valentin und Liesl Karlstadt spielen die Hauptrollen in dem 21-Minuten-Film „Der verhexte Scheinwerfer“, der in Geiselgasteig gedreht wird. Er entsteht nach der Originalszene „Der reparierte Scheinwerfer“ des Komikerduos.
29. 5 1934 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Films „Im Schallplattenladen“
Berlin * Der Valentin-Karlstadt-Film „Im Schallplattenladen“ wird in Berlin im Primus-Palast und im Titania-Palast im Beiprogramm zu „Bei der blonden Kathrein“ uraufgeführt.
29. 5 1934 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Der Geizhals/Der Geizige“ entsteht
München-Geiselgasteig * In Geiselgasteig entsteht in zwei Tagen der 22 Minuten dauernde Film „Der Geizhals/Der Geizige“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt in den Hauptrollen. Der Film ist verschollen.
30. 5 1934 - Die päpstliche Nuntiatur in München wird aufgelöst
München-Maxvorstadt * Die päpstliche Nuntiatur in München wird aufgelöst.
31. 5 1934 - Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa beendet offiziell seine Tätigkeit
München * Der päpstliche Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa beendet offiziell seine Tätigkeit in München.
Nach dem 20. 6 1934 - Der Karl-Valentin-Film „Der Geizhals/Der Geizige“ feiert Premiere
München * Der inzwischen verschollene Karl-Valentin-Film „Der Geizhals/Der Geizige“ feiert Premiere.
30. 6 1934 - Der sogenannte Röhm-Putsch
München * Der sogenannte Röhm-Putsch.
30. 6 1934 - Dr. Fritz Gerlich wird im KZ Dachau erschossen
Dachau * Dr. Fritz Gerlich wird in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ins KZ Dachau gebracht und noch in der selben Nacht erschossen.
3. 7 1934 - Das KZ-Wachpersonal fordert Erich Mühsam zum Selbstmord auf
Oranienburg * Das zur Leibstandarte Adolf Hitler gehörende Wachpersonal im KZ Oranienburg fordert Erich Mühsam zum Selbstmord auf. Doch Mühsam weigert sich.
10. 7 1934 - Mithäftlinge finden Erich Mühsam erhängt an einem Pfahl in der Latrine
Oranienburg * Mithäftlinge finden Erich Mühsam im KZ Oranienburg erhängt an einem Pfahl in der Latrine.
10. 7 1934 - Kardinal Faulhaber traut den Eisner-Mörder
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber traut den Kurt-Eisner-Mörder Anton Graf von Arco auf Valley mit Gabrielle Gräfin von Arco-Zinneberg in der Dreifaligkeitskirche.
Arco hatte den Gründer des Freistaats Bayern am 21. Februar 1919 hinterrücks ermordet, war zunächst zum Tode verurteilt, aber am nächsten Tag zu lebenslänglicher Festungshaft begnadigt worden. Nach fünf Jahren wurde er aus der Haft entlassen.
Anton Graf von Arco auf Valley war durch seine Tat in monarchistischen und konservativen Kreisen hoch angesehen. Deshalb ist es dem Münchner Erzbischof und Kardinal ein persönliches Anliegen, die Trauung durchzuführen.
24. 7 1934 - Faulhaber: „Gott erhalte unseren Reichskanzler“
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber schreibt an Adolf Hitler:
„Was die alten Parlamente und Parteien in sechzig Jahren nicht fertigbrachten, hat Ihr staatsmännischer Weitblick in sechs Monaten weltgeschichtlich verwirklicht. […]
Uns kommt es aufrichtig aus der Seele: Gott erhalte unseren Reichskanzler“.
Nach dem 31. 7 1934 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Films Der verhexte Scheinwerfer
München * Premiere des Valentin-Karlstadt-Films „Der verhexte Scheinwerfer“.
Nach dem 31. 7 1934 - Der Valentin-Karlstadt-Film So ein Theater wird uraufgeführt
München * Der Valentin-Karlstadt-Film „So ein Theater/Vorstadttheater“ wird uraufgeführt.
8 1934 - Dreharbeiten zu dem Film „Der Firmling“ im „Arya-Atelier“
München-Geiselgasteig * Dreharbeiten zu dem Film „Der Firmling“ im „Arya-Atelier“.
Karl Valentin spielt den Vater, Liesl Karlstadt dessen Sohn Pepperl.
9 1934 - Der NS-Stadtrat führt die „Pferderennen“ auf dem „Oktoberfest“ wieder ein
München-Theresienwiese * Der NS-Stadtrat führt die „Pferderennen“ auf dem „Oktoberfest“ wieder ein - bis 1938.
9 1934 - Die „Bräurosl“ erhält zwei beleuchtete Glastürme
München-Theresienwiese * Die „Bräurosl“ erhält mit ihrer neuen „Heustadl-Fassade“ zwei beleuchtete Glastürme, die an die Pylonen des Berliner Olympiastadions erinnern.
21. 9 1934 - Leonard Norman Cohen wird in Montreal geboren
Montreal • Leonard Norman Cohen wird in Montreal geboren.
14. 10 1934 - Liesl Karlstadt investiert in Karl Valentins „Panoptikum“
München * Liesl Karlstadt übergibt ihrem Bühnenpartner Karl Valentin 4.000.- Mark - zinsfrei - für das „Panoptikum“. Dafür erhält das „Frl. Karlstadt von den Einnahmen auf die Zeitdauer des Unternehmens ein Drittel Gewinnanteil“.
21. 10 1934 - Karl Valentin eröffnet sein Panoptikum
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin eröffnet in den Kellerräumen des Hotels Wagner in der Sonnenstraße sein Panoptikum, einen Kuriositäten- und Schauerkeller, mit dem angeschlossenen Nachtlokal Die Hölle mit Barbetrieb und Höllenmusik.
11 1934 - Der Reichsbauerntag in Goslar und die Seidenerzeugung
Goslar * Der Durchbruch für die erneute Seidenerzeugung in Deutschland kommt erst auf dem Reichsbauerntag in Goslar im November 1934.
Die NSDAP hat dort zur „Erzeugungsschlacht der deutschen Landwirtschaft“ aufgerufen. Das Ziel des Agrarprogramms ist die maximale Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, um den Bedarf an Nahrungs- und Futtermitteln, aber eben auch an Textilrohstoffen weitestgehend aus eigener Erzeugung zu sichern.
Das bedeutete die Förderung der Seidenraupenzucht durch den Anbau von Maulbeerbäumen.
9. 11 1934 - Karl Valentin schreibt an den Präsidenten der Reichsfilmkammer
München - Berlin * In einem Brief an den Präsidenten der Reichsfilmkammer schreibt Karl Valentin, dass es „1927 einem gewissen Walter Jerven (richtiger Name: Samuel Wucherpfennig) [gelang], das Bankhaus Löwenthal und Walther zur Finanzierung eines Valentin-Films ‚Der Sonderling‘ heranzuziehen“.
Aufgrund der Zeilen musste der Angegriffene, der eigentlich Wilhelm Wucherpfennig hieß und sich 1924 in Walter Jerven umbenannte, seine arische Abstammung nachweisen. Zum Glück war das für ihn kein Problem, denn sonst hätte er mit Konsequenzen rechnen müssen.
15. 11 1934 - Attentat auf Pater Rupert Mayer in Pasing verfehlt sein Ziel
Vorstadt Pasing * Während der Predigt in der Pasinger Kirche Maria Schutz wird auf Pater Rupert Mayer ein Attentat verübt, das jedoch sein Ziel verfehlt.
12 1934 - Liesl Karlstadt wegen „Depressionen“ in ärztlicher Behandlung
München * Liesl Karlstadt ist wegen „Depressionen“ bei Dr. Leonhard Seif und Dr. Oskar Wolfram in ärztlicher Behandlung.
4. 12 1934 - In Karl Valentins Panoptikum wird eine Guillotine ausgestellt
München-Ludwigsvorstadt * In Karl Valentins „Panoptikum“ ist auch die Nachbildung der im Gefängnis Stadelheim verwendeten Fallschwertmaschine [= Guillotine] ausgestellt. Der Nachrichtergehilfe Donderer erklärt dem Publikum die Tötungsvorrichtung.
Nun fragt das Bayerische Justizministerium beim Innenministerium an, ob die Genehmigung der Darstellung der Hinrichtung weiterhin aufrecht erhalten werden soll. Gleichzeitig wird ausgeführt, dass „der bisherige Nachrichtergehilfe Donderer [...] künftig zur Vollstreckung von Todesurteilen nicht mehr herangezogen werden" wird. Er wird wegen seiner Erklärertätigkeit im „Panoptikum“ aus dem Staatsdienst entlassen.
14. 12 1934 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Der Firmling“
Berlin * Premiere des Valentin-Karlstadt-Films „Der Firmling“ im Ufa-Pavillon am Nollendorfplatz in Berlin, im Beiprogramm zu „Schach der Eva“.
Nach dem 21. 12 1934 - Uraufführung des Karl-Valentin-Films „Der Zithervirtuose“
München * Uraufführung des Karl-Valentin-Films „Der Zithervirtuose“.
31. 12 1934 - Vorläufiges Aus für Karl Valentins „Panoptikum“
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentins „Panoptikum“ wird geschlossen, nachdem die Konzession ausgelaufen ist.
1935 - Das „Palais Leopold“ wird abgerissen
München-Schwabing * Das „Palais Leopold“ wird abgerissen.
1935 - Der fünfminütige Film „Karl Valentin bei der Wahrsagerin“ entsteht
München-Geiselgasteig * Der fünfminütige Film „Karl Valentin bei der Wahrsagerin“ entsteht.
Es handelt sich um einen selbstständigen Dialogsketch, in den Szenen aus „Kirschen in Nachbars Garten“ einmontiert wurden.
1935 - Der Film „Kirschen in Nachbars Garten“ wird gedreht
München-Geiselgasteig * Unter der Regie von Erich Engels entsteht der Film „Kirschen in Nachbars Garten“ in den „Bavaria-Ateliers“ in Geiselgasteig.
Karl Valentin spielt einen Gärtner, Liesl Karlstadt eine Magd.
1935 - Das bekannte Schmerzmittel „Togal“ wird in 46 Ländern verkauft
München-Bogenhausen * Das bekannte Schmerzmittel „Togal“ wird in 46 Ländern verkauft.
Seit 1935 - Die „Korpsführung des NS-Kraftfahrkorps“ in der „Klopfer-Villa“
München-Maxvorstadt * In der „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41 befindet sich die „Korpsführung des NS-Kraftfahrkorps“.
1935 - Dem „Zahnarzt“ Alfons Hoetlmayr gehört die Richard-Wagner-Straße 9
München-Maxvorstadt * Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9 ist der „Zahnarzt“ Alfons Hoetlmayr.
1935 - Gerhard Haas macht sein Abitur am „Wittelsbacher Gymnasium“
München-Maxvorstadt * Gerhard Haas, Enkel von Joseph Schülein, macht sein Abitur am „Wittelsbacher Gymnasium“ und studiert ab 1936 in England.
1935 - Die „SA-Gruppe Hochland“ ist in der Richard-Wagner-Straße 2 untergebracht
München-Maxvorstadt * Von 1935 bis Kriegsende ist die „SA-Gruppe Hochland“ im Anwesen Richard-Wagner-Straße 2 untergebracht.
1935 - Das „Gesundheitsamt“ bezieht Räume im „Bezirksamt am Lilienberg“
München-Au * Das „Gesundheitsamt“ bezieht Räume im „Bezirksamt am Lilienberg“.
1935 - Verbreiterung der Rosenheimer Straße
München-Haidhausen * Im Zuge der Erweiterung des Rosenheimer Berges zum Zubringer der "Autobahn München - Landesgrenze" müssen das "Gasthaus zum Salzburger Hof" und der "Stadtkeller" mit seiner lang gestreckten Fasshalle abgetragen werden.
1935 - Das baufällig gewordene „See-Restaurant Kleinhesselohe“ wird abgerissen
München-Schwabing - Englischer Garten * Das baufällig gewordene „See-Restaurant Kleinhesselohe“ wird abgerissen und durch einen etwas größeren hölzernen Neubau von Professor Rudolf Esterer ersetzt.
1935 - Mit dem Abbruch der „Maffei'schen Maschinenfabrik“ wird begonnen
München-Englischer Garten - Hirschau * Mit dem Abbruch der „Maffei'schen Maschinenbaufabrik“ wird begonnen.
1935 - Hans Gruß wird von den Nazis entlassen
München-Ludwigsvorstadt * Weil am „Deutschen Theater“ Stücke von jüdischen Autoren aufgeführt werden, entlassen die Nazis den Theaterleiter Hans Gruß.
1935 - In die Lehrerinnenanstalt kommt die Hans-Schemm-Aufbauschule
München-Au * Im Gebäude der Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern in der Frühlingstraße [heute: Eduard-Schmid-Straße] wird die Hans-Schemm-Aufbauschule untergebracht.
Seit etwa 1935 - Die „Schutzgemeinschaft Bayerischer Bäcker und Müller GmbH“
München-Au * Der neue Besitzer der Zentrale des „Konsumvereins München von 1864“ heißt „Schutzgemeinschaft Bayerischer Bäcker und Müller GmbH“.
Das Ende der Konsumgenossenschaften ist der Aufschwung des Auer Bäckers Josef Bernbacher.
Nach der Auflösung der „Verbrauchsgenossenschaften“ nutzt er die Gunst der Stunde und kehrte in die Au zurück.
Unter dem Versprechen, kein Brot mehr herzustellen, übernimmt Bernbacher das Gelände des „Konsumvereins München von 1864“ und verlegt sich auf einen Geschäftszweig, den die Genossenschaft im Jahr 1922 eingeführt hatte: die Teigwarenherstellung.
Heute ist die „Josef Bernbacher & Sohn GmbH & Co KG“ einer der größten Nudelhersteller in Deutschland.
8. 1 1935 - Elvis Presley kommt zur Welt
Tulepo * Elvis Presley kommt in Tulepo, Mississippi, zur Welt.
16. 2 1935 - Keine Probleme mit der „Fallschwertmaschine“ in Valentins Panoptikum
München * Das Bayerische Innenministerium hat mit der Ausstellung der Nachbildung der im Gefängnis Stadelheim genutzten „Fallschwertmaschine“ in Karl Valentins Panoptikum keinerlei Probleme. Denn:
„Der unbefangene Besucher kommt bei der Besichtigung dieser Hinrichtungsszene wohl nicht auf den Gedanken, dass die Darstellung genau der Wirklichkeit entspricht, vielmehr hält er sie, wie auch die sonstigen Gegenstände des Juxmuseums für ein Erzeugnis der verschrobenen Fantasie des Ausstellers Valentin.
Durch ein Verbot dieser Hinrichtungsszene würden zweifellos mehr abträgliche Wirkungen ausgelöst werden, als durch deren Weiterduldung.“
1. 4 1935 - Die Deutsche Gemeindeordnung tritt in Kraft
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Die Deutsche Gemeindeordnung tritt in Kraft. Die Stadträte heißen seither Ratsherren.</p>
6. 4 1935 - Liesl Karlstadts Selbstmordversuch
München-Lehel * An der Prinzregentenbrücke wird vormittags um 9 Uhr eine junge Frau aus der Isar gezogen, die sich das Leben nehmen wollte: Liesl Karlstadt.
4. 5 1935 - Karl Valentin eröffnet sein „Panoptikum“ erneut
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin eröffnet sein „Panoptikum“ erneut.
2. 6 1935 - Wohnungskündigungen gegenüber jüdischen Mietern sind möglich
Berlin * Wohnungskündigungen gegenüber jüdischen Mietern sind möglich.
25. 6 1935 - Ein Sicherheits- und Hilfsdienst wird eingerichtet
Berlin * Das Luftschutzgesetz verpflichtet alle Deutschen zu „Dienst- und Sachleistungen sowie zu sonstigen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen [...], die zur Durchführung des Luftschutzes erforderlich sind“. In Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern muss ein Sicherheits- und Hilfsdienst unter der Leitung des Polizeipräsidenten aufgestellt werden. Er erhält später den Namen Luftschutzpolizei.
Die Feuerwehr untersteht somit bei kriegsbedingten Einsätzen dem örtlichen Luftschutzleiter, bei „normalen“ - friedensmäßigen - Einsätzen ist weiterhin der Oberbürgermeister ihr höchster Dienstvorgesetzter in der Stadt.
29. 6 1935 - Die Autobahn geht bis nach Holzkirchen
München - Holzkirchen * Der erste Abschnitt der Reichsautobahn München – Salzburg bis Holzkirchen wird eingeweiht.
4. 8 1935 - München wird „Hauptstadt der Bewegung“
Berlin - München * Adolf Hitler erklärt München zur „Hauptstadt der Bewegung“. a
17. 8 1935 - Anfertigung einer zentralen Judenkartei durch die Gestapo
Berlin * Anfertigung einer zentralen Judenkartei durch die Geheime Staatspolizei - Gestapo.
9 1935 - Die „Valentin-Zeitung“ wird von den Nationalsozialisten verboten
München * Die „Valentin-Zeitung“, in der Originaltexte, Witze und Erinnerungen von Karl Valentin publiziert werden, erscheint einmalig.
Weil das Erscheinungsdatum mit „nur Hie und Da“ angegeben ist, wird die „Valentin-Zeitung“ von den Nationalsozialisten - mit der offiziellen Begründung des presserechtlich unzulässigen Impressums - verboten.
13. 9 1935 - Karl Valentins Schwiegersohn wird im KZ Dachau inhaftiert
Dachau * Karl Valentins Schwiegersohn Ludwig Freilinger wird zusammen mit drei Freunden im KZ Dachau inhaftiert. Die Vier hatten den Aufhausener Bürgermeister der Veruntreuung von Teilen der Winterhilfssammlung verdächtigt und sind dann wegen „staatsfeindlicher Äußerungen“ in Schutzhaft genommen worden.
Der Komiker hat gegenüber dem Schlosser ein angespanntes Verhältnis, weil er ihm nicht den richtigen Mann für seine Tochter Gisela sieht.
15. 9 1935 - Die Nürnberger Gesetze bringen die völlige Entrechtung der Juden
Nürnberg * Mit den Nürnberger Gesetzen wird die völlige Entrechtung der Juden in Deutschland eingeleitet. Sie teilen sie in sogenannte Voll-, Halb- oder Viertel-Juden ein. Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verbietet die Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden sowie den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen ihnen.
Für „Verbrechen der Rassenschande“ werden hohe Zuchthausstrafen oder KZ verhängt. Unter Zuhilfenahme der „Verordnung gegen Volksschädlinge“ können Angeklagte sogar zum Tode verurteilt werden. Das Reichsbürgergesetz macht Juden zu Bürgern zweiter Klasse.
Anton von Arco gehört damit zu den Halbjuden, doch sein Ruhm als Eisner-Mörder schützt ihn vor weiteren Verfolgungen.
Ab 20. 9 1935 - Die Dreharbeiten zu „Kirschen in Nachbars Garten“
München-Geiselgasteig • Aufnahmen zu „Kirschen in Nachbars Garten“ in Geiselgasteig. Drehbeginn für Liesl Karlstadt.
21. 9 1935 - Das 125. Jubiläum des Oktoberfestes
München-Theresienwiese • Das 125. Jubiläum des Oktoberfestes stellen die Nationalsozialisten unter das Motto: „Stolze Stadt - Fröhliches Land“.
21. 9 1935 - Ein Ehrenfass für die Ehrengäste vom Schottenhamel-Festzelt
München-Theresienwiese • Der Wirt vom Schottenhamel-Festzelt lässt für seine Ehrengäste ein Ehrenfass anstechen.
21. 9 1935 - Die Festplatzstraßen auf der Wiesn werden asphaltiert
München-Theresienwiese • Die Festplatzstraßen auf der Wiesn werden asphaltiert. Entlang dieser Straßen führen auch alle Zuleitungen für Wasser und Energie, weshalb eine Grundrissänderung mit enormen Kosten verbunden wäre.
1. 10 1935 - General Walter von Rückenau übernimmt den Wehrkreis VII
München * Nachfolger von Wilhelm Adam als Kommandierender General im Wehrkreis VII wird General Walter von Rückenau, der als einer der wenigen Vertrauten Adolf Hitlers im Generalstab gilt.
8. 10 1935 - In München wird die erste Luftschutzübung abgehalten
München * In München wird die erste Luftschutzübung abgehalten.
18. 10 1935 - Das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes
Berlin * Das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes, auch Ehegesundheitsgesetz genannt, wird verkündet. Es soll alle - nach Ansicht der Nationalsozialisten unerwünschten und nach ihrer Auffassung minderwertigen Nachkommen verhindern.
Das Gesetz verbietet in einer Reihe von Fällen die Eheschließung. Deshalb müssen die Verlobten vor der Eheschließung „durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes [Ehetauglichkeitszeugnis] nachweisen, daß ein Ehehindernis nach § 1 nicht vorliegt“.
- Als Ehehindernis gilt, wenn einer der Partner an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Krankheit leidet, die nach nationalsozialistischer Ansicht eine erhebliche gesundheitliche Schädigung des Partners oder der Nachkommen befürchten ließ.
- Darüber hinaus wurde mit dem Ehetauglichkeitszeugnis bescheinigt, dass die Eheschließung nicht gegen das Blutschutzgesetz verstößt.
- Das Ehegesundheitsgesetz schreibt ja vor: „Eine Ehe soll ferner nicht geschlossen werden, wenn aus ihr eine die Reinhaltung des deutschen Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten ist.“
- Damit ist nicht nur das Verbot der Ehe zwischen Juden und Nicht-Juden gemeint, sondern nach dem Gesetzeskommentar auch die Verheiratungen mit „Negern und Zigeunern“.
Später wird die Vorschrift noch auf die Eheschließung zwischen Deutschen und Angehörigen osteuropäischer Volker ausgedehnt.
11 1935 - Dr. Hermann Schülein tritt „aus der Löwenbräu AG“ aus
München-Maxvorstadt * Dr. Hermann Schülein tritt „mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand auf seinem Wunsch aus der Löwenbräu AG“ aus.
11 1935 - Die „Ludwigsbrücke“ wird erweitert
München-Lehel - München-Isarvorstadt * Nachdem die „Ludwigsbrücke“ schon wieder für den sich ständig verstärkenden Verkehr zu schmal geworden war, wird sie auf 29 Meter verbreitert.
Sie dient nun als Zubringer für die nach Salzburg führende „Autobahn München - Landesgrenze“.
Alle vier „Pylone“ werden an der Altstadtseite angebracht.
9. 11 1935 - Die Särge der Toten des Hitler-Ludendorff-Putsches kommen in die Ehrentempel
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Die Särge der Toten des Hitler-Ludendorff-Putsches von 1923 werden in der Nacht mit einem Fackelzug durch das Siegestor getragen und am Tag in den neu erbauten Ehrentempeln am Königsplatz aufgestellt.</p>
16. 11 1935 - Karl Valentins „Panoptikum“ im Hotel Wagner schließt endgültig
München-Ludwigsvorstadt * Das „Panoptikum“ Karl Valentins im Hotel Wagner schließt - wegen Erfolglosigkeit - endgültig.
1. 12 1935 - Erneutes Gastspiel im Berliner im „Kabarett der Komiker“
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt absolvieren bis 12. Dezember im „Kabarett der Komiker“ in Berlin ein Gastspiel.
2. 12 1935 - Die NSDAP befragt die IHK zur arischen Abstammung
München * Die NSDAP befragt die IHK München, ob der Generaldirektor der Cenovis-Werke arischer Abstammung ist.
12. 12 1935 - Der Lebensborn e.V. wird in Berlin gegründet
Berlin * Der Lebensborn e.V. wird auf Veranlassung des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, in Berlin gegründet und ist von Anfang an in die nationalsozialistische Rassenpolitik eingebunden. Himmler will die „erbgesundheitlich wertvolle Sippe deutscher nordisch bestimmter Art“ erhalten und vermehren, wobei die SS die „Elite des Herrenvolkes“ der Deutschen werden soll.
Der Gedanke des „guten Blutes“ basiert auf der nationalsozialistischen Rassenkunde und der Gedankenwelt des Sozialdarwinismus, in der behauptet wird, es gibt minderwertige Rassen und eine hochwertige, die nordische Rasse, zu der die Mehrheit der Deutschen zu zählen sei.
20. 12 1935 - Premiere des Films „Kirschen in Nachbars Garten“
Berlin * Die Premiere des unter Beteiligung von Karl Valentin und Liesl Karlstadt gedrehten Films „Kirschen in Nachbars Garten“ findet im Titania-Palast in Berlin statt.
1936 - Maria Steiner ist Eigentümerin des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9
München-Maxvorstadt * Die Witwe Maria Steiner ist Eigentümerin des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9.
1936 - Die „Diakonissinnen“ kündigen aus „rassischen Gründen“ ihren Dienst auf
München-Maxvorstadt * Die „Diakonissinnen“, die seit 25 Jahren in der „Privatklinik Dr. Alfred Haas“ als Krankenschwestern tätig waren, kündigen aus „rassischen Gründen“ ihren Dienst auf.
Die katholischen Nonnen der „Kogregation der Franziskanerinnen vom Erlenbach“ springen ein und übernehmen den Pflegedienst.
1936 - Heinrich Himmler bestimmt die Aufgaben des „Lebensborn e.V.“
Berlin * Heinrich Himmler bestimmt die Aufgaben des „Lebensborn e.V.“ im Detail.
Mindestens vier Kinder sollen in jeder SS-Familie aufwachsen, da die „Frage vieler Kinder [...] nicht Privatangelegenheit des einzelnen, sondern Pflicht gegenüber seinen Ahnen und unserem Volk“ ist. „Falls unglückliche Schicksalsumstände der Ehe eigene Kinder versagen, soll jeder SS-Führer rassisch und erbgesundheitlich wertvolle Kinder annehmen und sie im Sinne des Nationalsozialismus erziehen [...]“.
Punkt 2 bestimmt als Aufgabe des Vereins: „Rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers [...] anzunehmen ist, daß gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen“.
Wenn schwangere Frauen nachweisen können, dass unter ihren Vorfahren keine „Juden“ sind, und wenn ihnen zudem „SS-Ärzte“ ihre so genannte „erbbiologische Gesundheit“ bestätigen, wird ihnen - um eine Abtreibung zu verhindern - die Aufnahme in ein „Entbindungsheim“ des „Lebensborn e.V.“ versprochen.
Die Verwirklichung der rassischen Komponente der NS-Weltanschauung zielt auf die Ablösung der alten Führungsschichten durch eine neue, biologisch geformte nationalsozialistische Elite.
1936 - Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz
München-Haidhausen * „Rüstungsminister“ Albert Speer, ein enger Vertrauter und schon aus diesem Grund ganz bestimmt kein Kritiker des als „Führer“ bezeichneten „Parteivorsitzenden“, „Reichskanzlers“ und „Reichspräsidenten“ Adolf Hitler, beschreibt dessen Neun-Zimmer-Wohnung am Prinzregentenplatz 16 folgendermaßen:
„Ich wurde zunächst in einen Vorraum eingelassen, der mit Andenken oder Geschenken niedrigen Niveaus vollgestellt war.
Auch die Möblierung zeugt von schlechtem Geschmack. [...] Hitlers Wohnung war die eines Privatmannes von mittleren Einkommen, etwa eines Studienrats, des Filialleiters einer Depositenkasse, eines kleinen Geschäftsmannes.
Die Einrichtung war von kleinbürgerlichem Zuschnitt. Reichgeschnitzte, massiv eichene Herrenzimmermöbel, Bücher hinter Glastüren, gestickte Kissen mit zärtlichen Inschriften oder kräftigen Parteiwünschen. In einer Zimmerecke stand eine Richard-Wagner-Büste, an den Wänden hingen, in breiten Goldrahmen, idyllische Malwerke der Münchner Schule.
Nichts verriet, daß der Inhaber dieser Wohnung seit drei Jahren deutscher Reichskanzler war. [...]“
1936 - Das „Kassenhäuserl“ vom „Schyrenbad“
München-Untergiesing * Das Gebäude am „Schyrenbad“ mit dem „Uhrenturm“ wird zum „Kassenhäuserl“ umgebaut.
Es ist die ehemalige „Heuwaage“, die allerdings sehr ungenau gewesen sein muss, denn das Sprichwort von „der Uhr, die nach der Giesinger Heuwaag' geht“, hält sich hartnäckig.
1 1936 - Pater Rupert Mayer muss sich wegen seiner Predigten rechtfertigen
München-Maxvorstadt * Pater Rupert Mayer muss sich wegen seiner Predigten bei der „Gestapo“ rechtfertigen.
1 1936 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt geben ein Gastspiel in Berlin
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt geben ein Gastspiel im Berliner „Kabarett der Komiker“.
Sie spielen: „Im Photoatelier“, „Im Senderaum“ und „Theater in der Vorstadt“ (= „Tingeltangel“).
2 1936 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Beim Rechtsanwalt“ entsteht im „Arri-Atelier“
München * Der Film „Beim Rechtsanwalt“, nach einer Originalszene von Karl Valentin und Liesl Karlstadt entsteht im „Arri-Atelier“.
Valentin spielt einen Bauern, die Karlstadt seine Tochter. Den Rechtsanwalt stellt Reinhold Bernt dar.
2 1936 - Dr. Hermann Schülein und Frau verlassen Deutschland in Richtung Schweiz
München - Schweiz * Dr. Hermann Schülein und seine Frau verlassen Deutschland zunächst in Richtung Schweiz.
Dazu müssen sie zuvor ein „Auswanderersperrkonto“ bei der „Deutschen Bank“ einrichten.
Ihr Privatbesitz kann in Deutschland eingemauert werden und überdauert so die restlichen Jahre des „Tausendjährigen Reiches“ unbeschadet.
21. 2 1936 - Karl Valentins Schwiegersohn wird aus der Schutzhaft entlassen
Dachau * Ludwig Freilinger, Karl Valentins Schwiegersohn, wird aus der Schutzhaft aus dem KZ Dachau entlassen. Und zwar Monate vor seinen ebenfalls inhaftierten Freunden.
26. 2 1936 - Der Valentin-Film „Die karierte Weste“ wird gedreht
München-Geiselgasteig * Dreharbeiten zu dem 17 Minuten langen Film „Die karierte Weste“ mit Karl Valentin als Trödler und Liesl Karlstadt als seine Frau in den Hauptrollen. Regie führt Erich Engels.
27. 2 1936 - Dreharbeiten für den Valentin-Film „Beim Nervenarzt/Kalte Füße“
München-Geiselgasteig * Der 19 Minuten lange Streifen „Beim Nervenarzt/Kalte Füße“ entsteht. Als Darsteller treten in dem Film auf: Karl Valentin als Herr Meier, Liesl Karlstadt als Nervenarzt, Bäcker und Ober sowie Reinhold Bernt als Bäckergeselle. Regie führt Erich Engels.
3 1936 - Der Valentin-Karlstadt-Kurzfilm „Das verhängnisvolle Geigensolo“ entsteht
München-Geiselgasteig * Unter der Regie von Ralf Raffé entsteht nach der gleichnamigen Originalszene der Kurzfilm „Das verhängnisvolle Geigensolo“.
In dem 20-Minuten-Streifen spielt Karl Valentin den Solisten und Liesl Karlstadt den Gerichtsvollzieher.
4 1936 - Dreharbeiten zu Valentins „Straßenmusik“ und „Die Erbschaft“
München-Geiselgasteig * Dreharbeiten zu den Valentin-Karlstadt-Filmen „Straßenmusik“ und „Die Erbschaft“.
23. 4 1936 - Roy Orbison kommt in Vernon, Texas, zur Welt
Vernon * Roy Orbison kommt in Vernon, Texas, zur Welt.
Nach dem 24. 4 1936 - Uraufführung des Kurzfilms „Das verhängnisvolle Geigensolo“
München * Der Kurzfilm „Das verhängnisvolle Geigensolo“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt in den Hauptrollen wird uraufgeführt.
5 1936 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Die Erbschaft“ wird gedreht
München-Geiselgasteig * In den „Bavaria-Filmstudios“ in Geiselgasteig entsteht der 21 minütige Film „Die Erbschaft“ nach der gleichnamigen Originalszene von Karl Valentin und Liesl Karlstadt.
Regie führt Jacob Geis.
Nach dem 8. 5 1936 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Beim Rechtsanwalt“
München * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films „Beim Rechtsanwalt“.
8. 5 1936 - Pater Rupert Mayer wird vom Staatsanwalt verwarnt
München * Pater Rupert Mayer wird wegen seiner Predigten vom Staatsanwalt verwarnt.
16. 5 1936 - Das Kuratorium für das Braune Band von Deutschland
München * NS-Ratsherr Christian Weber reicht die Satzung des aus dem Kuratorium für das Braune Band von Deutschland hervorgegangenen Verein Das Braune Band von Deutschland beim Registergericht München ein.
19. 5 1936 - Premiere des Valentin-Karlstadt-Films „Die karierte Weste“
München * Der Valentin-Karlstadt-Film „Die karierte Weste“ hat Premiere.
Um den 6 1936 - Franz von Stucks „Amazone“ wird vor der Villa aufgestellt
München-Haidhausen * Franz von Stucks „Amazone“ wird vor der Villa aufgestellt.
7. 6 1936 - Ein Vaterunser für das Leben des Führers
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber schließt seine Predigt in der Münchner Frauenkirche mit den Worten „Katholische Männer, wir beten jetzt zusammen ein Vaterunser für das Leben des Führers.“
12. 6 1936 - „Das Braune Band von Deutschland“ wird zur Reichsorganisation
München-Maxvorstadt * Dem Verein „Das Braune Band von Deutschland“ wird der Charakter einer Reichsorganisation verliehen. Er bekommt damit einen quasi-öffentlich-rechtlichen Status.
Nach dem 18. 6 1936 - Uraufführung des Valentin-Kurzfilms „Beim Nervenarzt/Kalte Füße“
München * Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Kurzfilms „Beim Nervenarzt/Kalte Füße“. Der Film läuft zeitweise im Beiprogramm zu „Drei tolle Tage“.
7 1936 - Dreharbeiten an dem Valentin-Karlstadt-Film „Musik zu Zweien“
München * Dreharbeiten an dem 16-Minuten Valentin-Karlstadt-Film „Musik zu Zweien“ im „Arri-Atelier“.
Der Film wurde während der NS-Zeit nicht öffentlich aufgeführt. Er lag auch nie der Zensur vor.
7 1936 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Der Bittsteller“ wird gedreht
München * Karl Valentin spielt den Herrn Brandstetter, Liesl Karlstadt den Kommerzienrat in dem 15-Minuten-Film „Der Bittsteller“.
Die Regie führt Erich Engels. Gedreht wird der Streifen im „Arri-Atelier“.
7 1936 - Das „Franz-von-Stuck-Museum“ wird eröffnet
München-Haidhausen * Das „Franz-von-Stuck-Museum“ wird eröffnet.
Wegen fehlendem Interesse wird es bald wieder geschlossen.
10. 7 1936 - Uraufführung des Valentin-Karlstadt-Films Straßenmusik
München-Hackenviertel * Uraufführung des Films „Straßenmusik“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Ufa-Theater Sendlingertor-Lichtspiele.
21. 7 1936 - Warnung vor dem Zuzug nach München wegen Wohnungsknappheit
München * In den Münchner Neuesten Nachrichten erscheint ein Artikel, der wegen der Wohnungsknappheit vor dem Zuzug nach München warnt. Im Reichsinnenministerium diskutiert man einen Gesetzesentwurf für „eine Beschränkung unerwünschten Zuzugs“.
8 1936 - Der Erich-Engels-Spielfilm „Donner, Blitz und Sonnenschein“ entsteht
Berlin-Marienfelde * Im „Terra-Atelier“ in Berlin-Marienfelde entsteht der Erich-Engels-Spielfilm „Donner, Blitz und Sonnenschein“ unter Beteiligung von Karl Valentin als Schneidermeister Huckebein und Liesl Karlstadt in der Rolle seiner Frau Barbara.
8 1936 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Die Erbschaft“ wird von der Zensur verboten
Berlin * Der Valentin-Karlstadt-Film „Die Erbschaft“ wird von der NS-Filmzensur wegen „Elendstendenzen“ verboten.
15. 8 1936 - Das erste Entbindungsheim des Lebensborn e.V. in Steinhöring
Steinhöring * Das erste Entbindungsheim des Lebensborn e.V. wird in Steinhöring bei Ebersberg eingeweiht und als Musterheim „Hochland“ bezeichnet. Der Verein kauft das ehemalige Caritas-Kinderheim für 55.000 Reichsmark vom Bayerischen Staat und baut es später um 540.000 RM aus und um.
9 1936 - Verordnete Hakenkreuzfahnen wehen auf der Wiesn
München-Theresienwiese * Der NS-Stadtrat ordnet die einheitliche Beflaggung der „Theresienwiese“ mit „Hakenkreuzfahnen“ an.
Weiß-blaue Landesfahnen und schwarz-gelbe Stadtfahnen werden untersagt.
9 1936 - Der „Einzug der Wiesnwirte“ wird zur Pflicht
München-Theresienwiese * Der „Einzug der Wiesnwirte“ wird den Brauereien als Pflichtaufgabe auferlegt.
Ein „Windhunderennen“ ist die Neuigkeit des „Oktoberfestes“ 1936.
9 1936 - Georg Heide wird „Festwirt“ der „Pschorr-Bräurösl“
München-Theresienwiese * Georg Heide wird „Festwirt“ der „Pschorr-Bräurösl“.
21. 9 1936 - Der Valentin-Karlstadt-Kurzfilm „Die Erbschaft“ wird verboten
Berlin • Der Valentin-Karlstadt-Kurzfilm „Die Erbschaft“ wird von der nationalsozialistischen Zensur wegen „Elendstendenzen“ verboten.
30. 9 1936 - Das gesamte Stadtgebiet wird von einer Hagelwalze zugeschüttet
München * Das gesamte Stadtgebiet wird von einer Hagelwalze zugeschüttet.
4. 10 1936 - Der Übertritt von Juden zum Christentum hat rassisch keine Bedeutung
Berlin * Der Übertritt von Juden zum Christentum hat laut Erlass des Reichsinnenministeriums keine Bedeutung für die Rassenfrage.
23. 10 1936 - „Nuntius“ Alberto Vassallo di Torregrossa verlässt München
München * Der ehemalige päpstliche Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa verlässt München.
24. 10 1936 - Bill Wyman, der Bassist der Rolling Stones, wird geboren
Penge/Kent * Bill Wyman, der spätere Bassist der Rolling Stones, wird als William George Perks in Penge in der Grafschaft Kent in Großbritannien geboren.
30. 10 1936 - Uraufführung des Spielfilms „Donner, Blitz und Sonnenschein“
München * Uraufführung des abendfüllenden Spielfilms „Donner, Blitz und Sonnenschein“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Münchner Atlantik-Filmpalast am Isartor.
11 1936 - Dr. Hermann Schülein lebt in New York
New York * Dr. Hermann Schülein lebt in New York, wo er zunächst im „Hotel Dorset“, dann in „New York City, 1136 Fifth Avenue“ wohnt.
4. 11 1936 - Faulhabers Unterredung mit Adolf Hitler
Obersalzberg * Kardinal Michael von Faulhaber ist ein Leben lang stolz auf seine Aussagen vom Deutschen Katholikentag. Er brüstet sich sogar damit noch bei seiner - problematischen - dreistündigen Unterredung mit Adolf Hitler auf dem Obersalzberg: „1922 habe ich den marxistischen Umsturz von 1918 und 1919 als ‚Meineid und Hochverrat‘ bezeichnet und trotz aller Bedrohungen das Wort nicht zurückgenommen.“
Nach seinem selbst verfassten Protokoll trat er Adolf Hitler mit folgenden Worten gegenüber: „Sie sind als das Oberhaupt des Deutschen Reiches für uns gottgewollte Autorität, rechtmäßige Obrigkeit, der wir im Gewissen Ehrfurcht und Gehorsamkeit schulden.“
24. 11 1936 - Faulhaber berichtet über die Harmonie am Obersalzberg
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber erstattet seinen Amtsbrüdern auf der Bayerischen Bischofskonferenz Bericht über das Treffen mit Adolf Hitler und schwärmt ihnen von der „Harmonie am Obersalzberg“ vor. Daraufhin beschließen sie, ihre „loyale und positive Einstellung gegenüber der heutigen Staatsform und gegenüber dem Führer zum Ausdruck zu bringen“.
30. 12 1936 - Faulhabers Unterstützung im Abwehrkampf gegen den Bolschewismus
München-Kreuzviertel * In dem von Kardinal Michael von Faulhaber selbst verfassten Hirtenbrief schreibt er: „Der Führer möge versichert sein, dass wir Bischöfe ihn in seinem weltgeschichtlichen Abwehrkampf gegen den Bolschewismus mit moralischen Mitteln in jeder Weise unterstützen.“
30. 12 1936 - Das ehemalige Vereinsheim des TSV München-Ost wird verkauft
München-Obergiesing * Die NS-Stadtverwaltung verkauft das ehemalige Vereinsheim des Turn- und Sportvereins München-Ost mit allem Grund und Boden an die Optischen Werke C.A. Steinheil Söhne GmbH München, die in unmittelbarer Nähe eine Rüstungsfabrik betreibt.
1937 - Die „Kaulbach-Villa“ wird vom „Gauleiter“ Adolf Wagner bewohnt
München-Maxvorstadt * Die „Kaulbach-Villa“ in der Kaulbachstraße 15 wird vom „Gauleiter“ und „Innenminister“ Adolf Wagner bewohnt.
Ende 1937 - In der Zentrale des „Lebensborn e.V.“ werden 23 Angestellte beschäftigt
München * In der Zentrale des „Lebensborn e.V.“ werden 23 Angestellte beschäftigt.
1937 - Die jüdischem Geschäftsanteile der „Cenovis-Werke“ werden reduziert
München-Au * Die in jüdischem Besitz befindlichen Geschäftsanteile der „Cenovis-Werke“ werden auf 48,47 Prozent reduziert.
Damit wird zunächst die „Anerkennung als nichtjüdischer Betrieb“ erreicht.
1937 - Der „Bund Deutscher Mädchen - BDM“ in der Richard-Wagner-Straße 3
München-Maxvorstadt * Zwischen 1937 und 1940 ist der „Bund Deutscher Mädchen - BDM“ in der Richard-Wagner-Straße 3 untergebracht.
1937 - Auf Befehl Adolf Hitlers werden 289 Bäume des „Englischen Gartens“ gefällt
München-Maxvorstadt * Auf Befehl Adolf Hitlers wird die Königinstraße zwischen der Von-der-Thann-Straße und der Veterinärstraße von 10 auf 30 Meter erweitert.
289 Bäume des „Englischen Gartens“ müssen deshalb gefällt werden.
1937 - Eine „Lastenstraße“ durchquert den „Englischen Garten“
München-Englischer Garten * Eine „Lastenstraße“ zur Durchquerung des „Englischen Gartens“ in Ost-West-Richtung wird gebaut.
Daraus entwickelt sich der heutige „Isarring“.
1937 - Die Studentenverbindung „Danubia“ kann den Kredit nicht bedienen
München-Haidhausen * Nachdem die Studentenverbindung „Danubia“ die Zinsen für den Kredit nicht aufbringen kann, kommt die ehemalige „Grützner-Villa“ in Haidhausen zwangsweise unter den Hammer und geht daraufhin in den Besitz von Grützners Sohn Karl Eduard über, der dort mit seiner Frau Gisela lebt.
1937 - Die Nationalsozialisten feiern den „Rückgang der Viel-Leserei“
München * Die Nationalsozialisten feiern den „Rückgang der Viel-Leserei“.
Die Buchentleihungen und die Zahl der Lesesaal-Besucher ist seit der Machtübernahme um mehr als 30 Prozent zurückgegangen.
1937 - Die Firma „Rohde & Schwarz“ lässt sich am Tassiloplatz nieder
München-Au * Die Firma „Rohde & Schwarz“ lässt sich mit seinen inzwischen 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Tassiloplatz, auf dem ehemaligen „Konsumgelände“ nieder.
1937 - Der umfangreiche „Amtliche Führer Residenz München“ erscheint
München-Graggenau * Der umfangreiche „Amtliche Führer Residenz München“ erscheint.
Er beinhaltet die Baugeschichte und die ausführliche Beschreibung der zu besichtigenden Räume.
Der Führer dokumentiert ein letztes Mal das Erscheinungsbild der „Residenz“ vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs.
Ab 1 1937 - Pater Rupert Mayer predigt gegen die Nationalsozialisten
München * Pater Rupert Mayer predigt
- gegen den „Schulkampf“ der Nazis,
- gegen die „Ausschlachtung“ der Sittlichkeits- und Devisenprozesse gegen Ordensleute,
- gegen die nationalsozialistischen Presseerzeugnisse und vor allem
- gegen die „Entkonfessionalisierung“.
22. 1 1937 - IHK: Cenovis-Werke ist keine arische Firma
München-Au * Das Stammkapital der Cenovis-Werke beträgt 1,5 Millionen Reichsmark. Davon befinden sich Geschäftsanteile in Höhe von 815.000 RM in jüdischer Hand. Von den fünf Aufsichtsräten sind zwei Juden, von den zwei Vorsitzenden Einer. Die Industrie- und Handelskammer - IHK München stellt deshalb fest:
- „Bei dem Unternehmen kann daher sowohl nach Besitz wie auch nach Führung nicht von einer arischen Firma gesprochen werden.
- Diese Tatsache schließt unseres Erachtens eine Berücksichtigung bei Heereslieferungen aus.“
24. 1 1937 - Rupert Mayer: „Die Zeiten sind vorbei, wo wir geglaubt haben.“
München-Kreuzviertel * Während einer Predigt führt Pater Rupert Mayer in der Sankt-Michaels-Kirche aus:
- „Die Zeiten sind vorbei, wo wir geglaubt haben, was in der Zeitung steht!
- Glaubt überhaupt keiner Zeitung, wenn sie sich mit sittlichreligiösen Dingen befaßt! Hört nicht darauf! Lest keine Zeitungen!
- Und jetzt, wenn ihr hinausgeht, dann möchte ich, daß eine religiöse Welle von der Kirche aus sich auf die Straße ergießt und von der Straße aus in die einzelnen Häuser!“
2 1937 - Karl Valentin schmückt einen Festwagen für den „Faschingszug“
München * Karl Valentin schmückt einen Festwagen für den „Münchner Faschingszug“.
Darauf türmt sich ein Verkehrsschilderchaos.
Darunter steht geschrieben: „I kenn mi nimmer aus“.
Mitten zwischen den Verbots- und Gebotsschildern steht ein einsamer Wegweiser: „Nach Dachau“.
14. 2 1937 - Mit dem Konkordat der Nazi-Regierung das Vertrauen ausgesprochen
München-Kreuzviertel * In einer Predigt in der „Michaelskirche“ schätzt „Kardinal“ Michael von Faulhaber den Konkordatsabschluss folgendermaßen ein:
„Zu einer Zeit da die Oberhäupter der Weltreiche in kühler Reserve und mehr oder minder voll Mißtrauen dem neuen Deutschen Reiche gegenüberstanden, hat die katholische Kirche, die höchste sittliche Macht auf Erden, mit dem Konkordat der neuen deutschen Regierung ihr Vertrauen ausgesprochen“.
Für das Ansehen der nationalsozialistischen Regierung im Ausland war diese Aussage eine Tat von unschätzbarer Tragweite.
7. 4 1937 - Pater Rupert Mayer erhält Redeverbot für das gesamte Reichsgebiet
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Pater Rupert Mayer erhält Redeverbot für das gesamte Reichsgebiet wegen <em>„staatsabträglichen Reden“</em> durch das Reichssicherheitshauptamt in Berlin.</p>
28. 4 1937 - Mögliche Emigranten sind bei der Finanzbehörde anzuzeigen
Berlin * Die Polizeidienststellen werden verpflichtet, Personen, die einer geplanten Emigration verdächtigt werden, der Finanzbehörde anzuzeigen.
1. 5 1937 - Der „Scharfrichter“ Johann Reichhart wird Mitglied der NSDAP
München * Der „Scharfrichter“ Johann Reichhart wird Mitglied der NSDAP.
5. 6 1937 - Rupert Mayer wird wegen Nichtbeachtung des Redeverbots inhaftiert
München * Pater Rupert Mayer wird wegen „Nichtbeachtung des Redeverbots“ in der Gestapo-Zentrale im Wittelsbacher Palais, dann im Corneliusgefängnis und schließlich im Gefängnis Stadelheim inhaftiert.
Die Anklage vom 7. Juli wird ihm vorgeworfen: „[...] fortgesetzt öffentlich hetzerische Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates und deren Anordnungen gemacht zu haben, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben“.
12. 6 1937 - Jüdische Rasseschänder müssen ins Konzentrationslager
Berlin * Durch einen Geheimerlass des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich, werden „jüdische Rasseschänder“ und Partnerinnen in „rassenschänderischen Beziehungen“ nach Verbüßung der Haftstrafe in ein Konzentrationslager eingewiesen.
16. 6 1937 - Max Levien wird in der UdSSR erschossen
UdSSR * Max Levien wird im Zuge der stalinistischen Säuberungsaktionen erschossen.
18. 6 1937 - Karl Valentins Panoptikum im Färbergraben 33
München-Hackenviertel * Karl Valentins Panoptikum ist umgezogen und befindet sich jetzt im Färbergraben 33.
1. 7 1937 - Liesl Karlstadt wird aus Psychiatrischen Klinik entlassen
<p> <strong><em>München-Ludwigsvorstadt - Lenggries</em></strong> • Liesl Karlstadt wird als <em>„gebessert, aber arbeitsunfähig“</em> aus der Psychiatrischen Klinik an der Nussbaumstraße entlassen. Sie fährt mit ihrer Schwester Amalie zur Erholung nach Lenggries.</p>
18. 7 1937 - Der Festumzug Zweitausend Jahre deutsche Kultur
München-Lehel - München * Knapp vier Jahre nach der Grundsteinlegung wird das Haus der Deutschen Kunst mit der ersten Großen Deutschen Kunstausstellung eröffnet. Höhepunkt des drei Tage währenden „Tages der Deutschen Kunst“ ist der Festumzug „Zweitausend Jahre deutsche Kultur“.
22. 7 1937 - Kanzelmissbrauch und Heimtückegesetz
München * Am 22. und 23. Juli 1937 findet die Hauptverhandlung vor dem Sondergericht München statt. Pater Rupert Mayer wird wegen Kanzelmissbrauchs und Verstoß gegen das Heimtückegesetz zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Haftstrafe muss der Verurteilte nicht absitzen, weil er sich laut Urteilsbegründung, „im Felde äußerst tapfer benommen hat“ sowie „schwer kriegsbeschädigt ist“.
Obwohl Rupert Mayer als Überzeugungstäter eingestuft wird („... sich der Angeklagte bewußt war, daß das Kirchenvolk seinen Äußerungen eine weit stärkere Bedeutung beimaß als den Äußerungen irgendeines mehr oder weniger bekannten Geistlichen.“), zögert der NS-Staat, wegen dessen Popularität und der Machtstellung der katholischen Kirche noch härter gegen den Priester vorzugehen.
25. 7 1937 - Karl Valentin greift Heinz Rühmann persönlich an
München * Karl Valentin beklagt sich in einem Brief an Hans H. Zerlett, dem Regisseur des Films Im Schallplattenladen, über seine eigene finanzielle Lage. Darin greift er Heinz Rühmann an:
„Herr Rühmann (bitte um Diskretion) spielt jährlich mindestens drei Filme á 20.000.- Mark. Seine Frau soll nicht arischer Abstammung sein. Warum hat [...] dieser Mann den Vorzug? Soll ich mich noch scheiden lassen und eine andersrassige Dame heiraten?“
31. 7 1937 - Liesl Karlstadt wieder in München
<p><em><strong>Lenggries - München</strong></em> • Liesl Karlstadt kehrt von Lenggries nach München zurück. </p>
20. 8 1937 - Schallplattenaufnahmen im Reichssender München
<p><em><strong>München</strong></em> • Liesl Karlstadt und Karl Valentin treffen sich zu Schallplattenaufnahmen in den Räumen des <em>„Reichsenders München“</em>. </p>
25. 8 1937 - Die Zuständigkeiten der Scharfrichter werden neu festgelegt
Berlin * Die Zuständigkeiten der Scharfrichter im Deutschen Reich werden neu festgelegt. Es gibt reichsweit drei Scharfrichter.
9 1937 - Mehrere „Pferderennen“ finden auf der „Theresienwiese“ statt
München-Theresienwiese * Mehrere „Pferderennen“ finden auf der „Theresienwiese“ statt:
- ein „Xaver-Krenkl-Rennen“,
- ein „August-Schichtl-Trabfahren“ und
- ein „Winzerer-Fähndl-Hürdenrennen“.
Als Attraktion fahren die „Wiesnbesucher“ in Hugo Haases „See-Scouter“ in Motorbooten „zu den gefährlichsten Karambolagen, während hilfsbereite Matrosen in hohen Wasserstiefeln mit langen Stangen für die nötige Ordnung“ sorgen.
11 1937 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Ewig Dein“ entsteht in Geiselgasteig
München-Geiselgasteig * Erich Engels führt Regie in dem 20-Minuten-Film „Ewig Dein“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt.
Gedreht wird in Geiselgasteig.
Der Film ist bis auf ein 58 Meter langes Fragment verschollen.
11 1937 - Die Genossenschaft der Münchner Droschkenunternehmer GmbH
München * Die „Ein- und Verkaufsgenossenschaft für das Droschkengewerbe Münchens, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung“ wird in „Genossenschaft der Münchner Droschkenunternehmer GmbH“ umbenannt.
8. 11 1937 - Die Ausstellung „Der ewige Jude“ wird eröffnet
München-Isarvorstadt * Im Bibliotheksbau des Deutschen Museums wird die Ausstellung „Der ewige Jude“ eröffnet. Sie hilft die folgenden antisemitischen Pogrome vorzubereiten.
11. 11 1937 - Die Thomas-Mann-Villa wird dem Lebensborn übergeben
München-Bogenhausen * Die ehemalige Thomas-Mann-Villa in der Poschingerstraße 1 (heute: Thomas-Mann-Allee 10) wird dem Lebensborn zur Verfügung gestellt. Dieser richtet hier seine Zentrale ein, nachdem der Vereinssitz von Berlin nach München verlegt wird.
12 1937 - Der Werbefilm „Braunkohlesyndikat“ mit Valentin/Karlstadt entsteht
München * Im „Arri-Atelier“ entsteht der Werbefilm „Braunkohlesyndikat“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt.
Der Film ist verschollen.
Um den 12 1937 - Der „Bugatti Royale“ auf einem Schrottplatz in der New Yorker Bronx
München-Au - New York * Der von Ludwig Weinberger gestaltete „Bugatti Royale“ erleidet infolge eines eingefrorenen Kühlsystems einen kapitalen Motorschaden.
Schließlich gelangt der Wagen auf einen Schrottplatz in der Bronx.
23. 12 1937 - Towia Axelrod wird in der UdSSR verhaftet
UdSSR * Towia Axelrod (Tobias Akselrod) wird im Zuge der stalinistischen Säuberungsaktionen wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer konterrevolutionären terroristischen Organisation verhaftet.
26. 12 1937 - Pater Rupert Mayer beginnt wieder zu predigen
München * Pater Rupert Mayer beginnt - trotz seines Verbotes - wieder zu predigen. Er setzt seine Predigten am 1. und 2. Januar 1938 fort.
Um 1938 - Der Valentin-Karlstadt-Kurzfilm „Der Antennendraht/Im Senderaum“
München-Geiselgasteig * Nicht sicher ist der Entstehungszeitpunkt des Valentin-Karlstadt-Kurzfilms „Der Antennendraht/Im Senderaum“.
Regie führt Joe Stöckl.
Er könnte aber bereits 1937 entstanden sein.
1938 - Mit „Architekt Sachlich“ kritisiert Karl Valentin die NS-Monumentalarchitektur
München * Mit dem Stück „Architekt Sachlich“ kritisiert Karl Valentin die Monumental-Architektur der Nationalsozialisten.
Um 1938 - Der Valentin-Karlstadt-Kurzfilm „Der Antennendraht/Im Senderaum“
München * Nicht sicher ist der Entstehungszeitpunkt des Valentin-Karlstadt-Kurzfilms „Der Antennendraht/Im Senderaum“.
Regie führte Joe Stöckl.
Der könnte bereits 1937 entstanden sein.
Um 1938 - 3-Minuten-Werbefilme „Selbst Valentin macht mit“ und „Nur nicht drängeln“
München-Geiselgasteig * Im Auftrag des „Deutschen Sparkassen- und Giroverbands“ entstehen die 3-Minuten-Werbefilme „Selbst Valentin macht mit“ und „Nur nicht drängeln“ mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt in den Hauptrollen.
1938 - Arisierung der Villa des Bankdirektoren-Ehepaares Aufhäuser
München-Bogenhausen * Die Villa des Bankdirektoren-Ehepaares Auguste und Martin Aufhäuser in der Maria-Theresia-Straße 28 wird „arisiert“ und geht in den Besitz des „NS-Reichskolonialbundes“ über.
1938 - Die Firma „Transhand Transport- und Handels AG, vormals Falk & Fey“
München-Neuhausen * Die Firma „Transhand Transport- und Handels AG, vormals Falk & Fey“ wird in eine „oHG“ (offene Handelsgesellschaft) umgewandelt.
1938 - Die „Villa Freundlich“ an der Brienner Straße 43
München-Maxvorstadt * Rudolf Ritter und Edller von Pauer ist Eigentümer der „Villa Freundlich“ an der Brienner Straße 43.
1938 - Die „Akademie für angewandte Kunst“
München-Maxvorstadt * Die „Staatsschule für angewandte Kunst“ wird in „Akademie für angewandte Kunst“ umbenannt.
1938 - Die Richard-Wagner-Straße 9 gehört Josephine Pongratz-Steiner
München-Maxvorstadt * Die „Generalmajorswitwe“ Josephine Pongratz-Steiner ist Eigentümerin des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9.
1938 - Die Zahl der sogenannten „Rassejuden“ liegt in München bei etwa 6.350
München * Die Zahl der sogenannten „Rassejuden“ liegt in München bei etwa 6.350.
1938 - Das „Bezirksamt am Lilienberg“ wird in „Landratsamt“ umbenannt
München-Au * Das „Bezirksamt am Lilienberg“ wird in „Landratsamt“ umbenannt.
1938 - Der „Deutsche und österreichische Alpenverein - DuOeAV“ wird umbenannt
München - Wien - München-Lehel * Nachdem Österreich als „Ostmark“ dem Deutschen Reich „angeschlossen“ worden war, wird der „Deutsche und österreichische Alpenverein - DuOeAV“ in „Deutscher Alpenverein - DAV“ umbenannt.
Das „Alpine Museum“ auf der „Praterinsel“ erhält den Namen „Alpines Museum des DAV“.
1938 - Die Südhälfte der „Theresienwiese“ wird als „Pferderennplatz“ ausgebaut
München-Theresienwiese * Die Südhälfte der „Theresienwiese“ wird ganz als „Pferderennplatz“ ausgebaut und die „Budenstadt“ auf den Nordteil beschränkt.
Sämtliche Straßen der „Budenstadt“ werden geteert.
1938 - Das „Herzog-Max-Palais“ wird abgerissen
München-Maxvorstadt * Das „Herzog-Max-Palais“ wird von den Nazis für den Neubau der „Reichshauptbankstelle“ abgerissen.
Damals nimmt man die von Robert von Langer geschaffenen Fresken im Empfangssaal ab und transportiert sie in das „Haus des Deutschen Rechts“.
Noch vor den ersten Bombenangriffen verkleidet man die Fresken aus Angst vor Zerstörung.
Dabei geraten sie in Vergessenheit.
1938 - Das „Schyrenbad“ wird zum „Familienbad“ umgestaltet
München-Untergiesing * Nach mehreren Erweiterungen wird das „Schyrenbad“ zum „Familienbad“ umgestaltet.
1938 - Die „Winterhalter-Villa“ an der Birkenleiten 35 gehört der Stadt
München-Untergiesing * Die ehemalige „Winterhalter-Villa“ an der Birkenleiten 35, die sich im Besitz des „Gutsbesitzers“ Simon Eckart befindet, geht in das Eigentum der „Landeshauptstadt München“ über.
1938 - Neben der „Bäcker-Kunstmühle“ wird ein Getreide-Silo errichtet
München-Untergiesing * Neben der „Bäcker-Kunstmühle“ wird ein 4.500 Tonnen fassender Getreide-Silo errichtet.
1938 - Der „Cowboy Club München Süd“ dreht seinen Film „Pecos Kid“
München-Großhesselohe * Mitglieder des „Cowboy Clubs München Süd“ drehen ihren eigenen Film mit dem Titel „Pecos Kid“.
Regie führt Kurt Ulrich.
1 1938 - Der „Lebensborn e.V.“ bezieht die ehemalige „Thomas-Mann-Villa“
München-Bogenhausen * Der „Lebensborn e.V.“ bezieht die ehemalige „Thomas-Mann-Villa“ in der Poschingerstraße 1.
Er muss keine Miete bezahlen und einzig für die laufenden Kosten und Unterhaltskosten aufkommen.
5. 1 1938 - Pater Rupert Mayer wird erneut verhaftet
München * Pater Rupert Mayer wird erneut wegen Nichtbeachtung des Predigtverbots verhaftet.
15. 1 1938 - Pater Rupert Mayer im Gefängnis Stadelheim inhaftiert
München-Obergiesing * Pater Rupert Mayer wird zwei Tage im Gefängnis Stadelheim inhaftiert.
17. 1 1938 - Pater Rupert Mayer wird ins Gefängnis in Landsberg eingeliefert
Landsberg * Pater Rupert Mayer wird auf Druck der Gestapo ins Gefängnis in Landsberg am Lech als Strafgefangener Nr. 9.469 eingeliefert.
22. 1 1938 - Sonderbaubehörde Ausbau der Hauptstadt der Bewegung
München * Die Stadt richtet die Sonderbaubehörde Ausbau der Hauptstadt der Bewegung ein. Stadtbaurat Hermann Alker leitet die Behörde.
Nach dem 22. 1 1938 - Vertrauliche Verhandlungen über den Abbruch der Matthäuskirche
München-Ludwigsvorstadt * Vertrauliche Verhandlungen zwischen der Sonderbaubehörde Ausbau der Hauptstadt der Bewegung und der evangelischen Landesküche über den Abbruch der Matthäuskirche aus verkehrstechnischen Gründen beginnen.
14. 2 1938 - Hitlers Vorstellungen zum „Haus der Deutschen Architektur“
München-Lehel * Adolf Hitler entwickelt im Atelier des Münchner Stadtbaurates Hermann Reinhard Alker die Vorstellungen zum „Haus der Deutschen Architektur“.
Dieses Ausstellungsgebäude sollte genau gegenüber dem „Haus der Deutschen Kunst“ entstehen, aber keineswegs „ähnlich concipiert“, wenn auch gleichartig in Stein und Farbe und mit 21 Säulen.
Nach einer vorliegenden Projektskizze hätte der Baukunsttempel noch einige Meter breiter werden sollen als der Synchronbau auf der anderen Straßenseite.
Auf zwei hohen Sockeln sollten „Sphinxe“ wachen wie vor den „Pyramiden von Gizeh“.
15. 2 1938 - General Eugen Ritter von Schobert kommandiert den Wehrkreis VII
München * Walter von Reichenau übergibt das Kommando im Wehrkreis VII an General Eugen Ritter von Schobert.
3 1938 - Kein Jude darf im Aufsichtsrat tätig sein
Berlin * In einem „Erlaß des Reichswirtschaftsministeriums“ heißt es:
Zur „Voraussetzung für die Anerkennung als nichtjüdischer Gewerbebetrieb [ist] grundsätzlich zu verlangen, dass auch im Aufsichtsrat kein jüdisches Mitglied mehr vorhanden ist und dass bezüglich des Gesellschafterkapitals eine Dreiviertelmehrheit der nichtjüdischen Gesellschafter besteht“.
10. 3 1938 - Towia Axelrod wird hingerichtet
<p><em><strong>Kommunarka</strong></em> * Towia Axelrod (Tobias Akselrod) wird im Zuge der stalinistischen Säuberungsaktionen zum Tode verurteilt und noch am selben Tag erschossen. </p>
22. 3 1938 - Willi Budrich wird in der UdSSR hingerichtet
<p><em><strong>UdSSR</strong></em> * Willi Budrich wird im Zuge der stalinistischen Säuberungsaktionen zum Tode verurteilt und noch am selben Tag erschossen. </p>
1. 4 1938 - Großhadern und Kleinhadern werden eingemeindet
<p><em><strong>München-Großhadern</strong></em> * Die selbstständige Gemeinde Großhadern mit den Gemeindeteilen Großhadern und Kleinhadern wird nach München eingemeindet. </p>
4. 4 1938 - Der Valentin-Karlstadt-Film „Der Bittsteller“ liegt der Zensur vor
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Valentin-Karlstadt-Film <em>„Der Bittsteller“</em> liegt erst zwei Jahre nach seiner Entstehung der Zensur vor. Obwohl der Film nicht verboten wird, kommt er nicht zur öffentlichen Aufführung.</p>
28. 4 1938 - Die geplanten Bauten auf der Theresienwiese werden weggelassen
Berlin - München-Theresienwiese * In einer Anordnung Adolf Hitlers sollen bei der Bekanntgabe der Bauvorhaben für München „die nur für eine gewisse Zeit, nämlich für Ausstellungszwecke zu erstellenden Baulichkeiten auf der Wiese im Planbild weggelassen werden“, denn die „Wiese (gemeint ist natürlich das Oktoberfest) ist für den Münchener etwas Heiliges, mit ihr verbindet sich eine alte Tradition und an sie darf nicht getastet werden“.
5 1938 - Verhandlungen zwischen „Cenovis“ und der „Maggi Gesellschaft mbH“ Berlin
München-Au - Berlin * Verhandlungen zwischen der „Cenovis-Werke“ und der „Maggi Gesellschaft mbH“ in Berlin über den Verkauf der in jüdischen Händen befindlichen Anteile der Firma beginnen.
Ab 1. 5 1938 - Valentin und Karlstadt mit „Der Umzug“ im Deutschen Theater
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> • Vom 1. bis 31. Mai 1938 steht im Deutschen Theater das Varieté Programm <em>„Lachen, Leistung, Schöne Frauen“</em> auf dem Spielplan. Es besteht aus zwei Teilen, im ersten Teil wirbelten Akrobatik-Künstler, der zweite Teil beginnt mit komischen Lichtbildern von Karl Valentin und darauf folgt die Szene <em>„Der Umzug“</em> mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt. </p> <p>Das NS-System zensiert den ursprünglichen Schluss des Stücks, als ein Abrissbagger auf die Bühne rollt. Das Stück wird insgesamt 78 Mal aufgeführt. </p>
5. 5 1938 - Pater Rupert Mayer wird vorzeitig entlassen
Landsberg * Pater Rupert Mayer wird aufgrund der „Österreich-Amnestie“ - anlässlich der Eingliederung Österreichs in das „Deutsche Reich“ - vorzeitig aus der Haft entlassen.
10. 6 1938 - Die Cenovis-Werke geraten unter Druck
München * Die IHK München setzt die Cenovis-Werke unter Druck und verlangt, dass das Unternehmen bis zum 31. Juli 1938 nach dem Erlass des Reichswirtschaftsministeriums vom März 1938 „umzustellen“ ist. Ansonsten wird die Gesellschaft aus dem Verzeichnis der nichtjüdischen Betriebe gestrichen.
Zusätzlich fordert die Hauptvereinigung der deutschen Brauwirtschaft eine Bestätigung des Gauwirtschaftsberaters, wonach die Firma „in jeder Hinsicht als ein rein arisches Unternehmen angesehen werden kann“. Bis zur Erfüllung der Forderung lehnt der Brauwirtschaftsverband ab, Malzabholscheine bei den Cenovis-Werken einzulösen.
10. 6 1938 - Trotz Verhandlungen eine Abrissfirma beauftragt
München - München-Ludwigsvorstadt * Am Vormittag beschäftigt sich der Landeskirchenrat mit den Abrissplanungen der Matthäuskirche und bestätigt und ergänzt die Beschlüsse der Kirchenverwaltung der Matthäuskirche. In einer Besprechung im Innenministerium um 13 Uhr werden die Beschlüsse dargelegt.
Am Abend wird die evangelische Gemeinde benachrichtigt, dass das Innenministerium bereits eine Abrissfirma beauftragt hat. Die Abbrucharbeiten sollen am 13. Juni beginnen.
11. 6 1938 - Landesbischof Meiser interveniert gegen den Abriss der Matthäuskirche
München-Ludwigsvorstadt * Der evangelische Landesbischof Dr. Hans Meiser interveniert am Vormittag gegen den Abriss der evangelischen Matthäuskirche. Da Meiser unter den gegebenen Umständen sich weiteren Verhandlungen verweigert, zieht das Innenministerium den Auftrag an die Baufirma vorläufig zurück.
Um 16 Uhr erklärt sich Gauleiter Adolf Wagner bereit, auf die vom Landeskirchenrat erarbeiteten Forderungen einzugehen. Als vorläufiger Versammlungsraum wird der Matthäus-Kirchengemeinde der Weiße Saal in der ehemaligen Augustinerkirche, der inzwischen zum Polizeipräsidium gehört, zugesichert.
12. 6 1938 - Erster Abschiedsgottesdienst in der Matthäuskirche
München-Ludwigsvorstadt * Am Abend findet ein Abschiedsgottesdienst der evangelischen Gesamtgemeinde in der Matthäuskirche statt. Der evangelische Landesbischof Dr. Hans Meiser hält die Predigt.
13. 6 1938 - Zweiter Abschiedsgottesdienst in der Matthäuskirche
München-Ludwigsvorstadt * Um 20 Uhr wird der Abschiedsgottesdienst für die evangelische Matthäus-Kirchengemeinde mit einer Predigt des Pfarrers Friedrich Loy abgehalten. Noch während des Gottesdienstes werden die Abbruchgerüste aufgebaut.
14. 6 1938 - Die Abrissarbeiten an der evangelischen Matthäuskirche beginnen
München-Ludwigsvorstadt * Die Kult- und Kunstgegenstände werden aus der evangelischen Matthäuskirche entfernt. Die Abrissarbeiten beginnen.
21. 6 1938 - Anteile der Cenovis-Werke gehen an die Maggi GmbH Berlin
München - Berlin * Die in jüdischen Händen befindlichen Anteile der Cenovis-Werke gehen an die Maggi GmbH Berlin über.
26. 6 1938 - Erste Planungen für eine neue Matthäuskirche
München-Ludwigsvorstadt * Die evangelische Matthäus-Kirchengemeinde erfährt davon, dass der Architekt German Bestelmeyer mit Planungen für eine neue Matthäuskirche beauftragt worden ist.
27. 6 1938 - Das Dach der der evangelischen Matthäuskirche ist abgedeckt
München-Ludwigsvorstadt * Das Dach der der evangelischen Matthäuskirche ist abgedeckt.
8. 7 1938 - Martin Bormann verlangt die Erfassung jüdischer Wohnsituationen
München * Martin Bormann, Stabsleiter im Braunen Haus, verlangt die genaue
- Erfassung jüdischer Hauseigentümer,
- an Nicht-Juden vermietete Wohnungen von jüdischen Hauseigentümern,
- an Juden vermietete Wohnungen,
- eigenen Wohnraum und leerstehende Wohnungen,
- um so eine planmäßige Lösung von Mietverhältnissen mit Juden möglich zu machen,
- eine Einengung zu erreichen,
- mehrere Familien in größere jüdische Wohnungen zusammenzulegen,
- Juden von Nicht-Juden zu trennen und
- dabei möglichst keine Ghettobildung zuzulassen“.
13. 7 1938 - Die Cenovis ist in rein arischem Besitz
München-Au * Die Cenovis-Werke schreiben an die IHK München die Zeilen: „[…] teilen wir Ihnen hierdurch mit, dass die Gesamtanteile an unserer Gesellschaft nunmehr in arischen Besitz übergegangen sind.
Die Cenovis-Werke GmbH in München sind infolgedessen sowohl in personeller wie auch in kapitalmässiger Hinsicht eine reine arische Unternehmung“. Dann folgte das obligatorische „Heil Hitler“ und die Unterschrift „Altenrath“.
Dr. Julius Schülein kann gerade noch rechtzeitig vor der sogenannten Reichs-Kristallnacht in die USA emigrieren.
Ab 9. 8 1938 -
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> • Vom 9. August bis 15. September spielen Karl Valentin und Liesl Karlstadt ihre Szene <em>„Im Photoatelier“</em>. </p>
17. 8 1938 - Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Berlin * Die „Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ tritt in Kraft. Die Verordnung beinhaltet eine „Richtlinie über die Führung von Vornamen“. Darin dürfen neugeborene Juden nur solche jüdische Vornamen führen, die in einer Liste aufgeführt werden. Juden, die keinen typisch jüdischen Vornamen tragen, müssen einen zusätzlichen Vornamen annehmen - „Sara“ oder „Israel“.
18. 8 1938 - Vertreibung der Juden aus arischen Wohnhäusern
Halle * Das Amtsgericht Halle fällt ein Urteil zur Vertreibung der Juden aus „arischen“ Wohnhäusern. Darin heißt es unter anderem:
- „Auch in der Hausgemeinschaft können eigennützige Interessen der einzelnen keinen Bestand haben. Eine wahre Hausgemeinschaft im Sinne dieses Denkens kann aber nur von gleichgesinnten, deutsch denkenden Personen und Hausbewohnern arischer Abstammung gebildet und gepflegt werden; sie ist mit Personen jüdischer Herkunft wegen des bestehenden Rassenunterschiedes schlechterdings unmöglich.
- Da der nationalsozialistische Staat aber auf das Bestehen und die Pflege einer wahren Hausgemeinschaft einen besonderen Wert legt und von jedem Volksgenossen diese Einstellung im Sinne der Hausgemeinschaft fordert, so kann dem Vermieter und den Mietern arischer Abstammung im Interesse der Erhaltung dieser Hausgemeinschaft nicht zugemutet werden, diese mit Mietern jüdischer Abstammung zu bilden und zu pflegen und mit diesen in derselben Hausgemeinschaft zu leben.
- Dem Vermieter muß deshalb das Recht zugesprochen werden, Mieter jüdischer Abstammung aus dieser Hausgemeinschaft auszuschließen und von diesen Räumung ihrer Wohnung zu fordern.
- Leistet ein solcher Mieter jüdischer Abstammung dem Räumungsverlangen des Vermieters keine Folge oder lehnen die Mieter arischer Abstammung eine Hausgemeinschaft mit ihnen ab, so stört er damit die zwischen dem Vermieter und den anderen Mietern arischer Abstammung bestehende Hausgemeinschaft und macht sich durch sein weiteres Wohnenbleiben diesen gegenüber einer erheblichen Belästigung im Sinn des § 2 Mieterschutzgesetz schuldig“.
28. 8 1938 - Jenny Zeckendorf stirbt
München-Maxvorstadt * Jenny Zeckendorf, Eigentümerin des Anwesens Richard-Wagner-Straße 11, stirbt. Das Haus geht in den Besitz der Kinder Dr. Walter und Nelly Zeckendorf über, die aber bereits nach New York emigriert sind. Sie bleiben offizielle Besitzer bis zum Jahr 1941.
9. 9 1938 - Der Haidhauser Brauereigründer Joseph Schülein stirbt
München-Maxvorstadt * Der Haidhauser Brauereigründer Joseph Schülein stirbt.
Ab 16. 9 1938 - Liesl Karlstadts Krankenhaus-Odysee
München-Ludwigsvorstadt - Höllriegelskreuth - Bad Tölz - Wegscheid • Nach dem Gastspiel im Deutschen Theater ist Liesl Karlstadt vom 16. September 1938 bis zum Jahresende krank.
- Zuerst begibt sie sich nach Höllriegelskreuth bei Pullach ins Biologische Krankenhaus zur Erholung, von dort wieder in die Psychiatrische Klinik in der Nussbaumstraße.
- Nach ihrer Entlassung lässt sie sich in das Städtische Krankenhaus Bad Tölz einweisen, in dem Kurat Jakob Ostler als Krankenhauspfarrer tätig ist. Bei dessen Familie war sie im Jahr zuvor in Wegscheid, heimisch geworden.
17. 9 1938 - Die neue Postwiese wird mit einem Kinderfest eröffnet
München-Haidhausen * Mit einem Kinderfest wird die fast 4 Tagwerk große neue Postwiese eröffnet, die sich seitdem bei alt und Jung großer Beliebtheit erfreut. Die Stadtverwaltung hat die Grube auffüllen und den Platz zu einem Spielplatz und zu einer Erholungsstätte für die Bevölkerung umgewandelt.
- Die Postwiese wird als erster ausschließlich für das Spielen eingerichteter Platz errichtet.
- Er ist die erste große Anlage mit einer räumlichen Gliederung in einzelne Spiel- und Aufenthaltsbereiche.
- Die Bepflanzung ist - gemessen an der Fläche von 11.720 Quadratmetern - eher spärlich.
- Drei Straßenseiten werden durch Hecken unter einer Lindenallee abgeschirmt, an der vierten Seite befinden sich vor den Häusern stattliche Säulenpappeln.
10 1938 - Die „Reichsfluchtsteuer“ für die Familie Haas wird auf 125.000 RM festgesetzt
München * Nachdem die Familie Haas ihren „Antrag auf Ausreise“ gestellt hat, wird die „Reichsfluchtsteuer“ auf 125.000 RM festgesetzt.
Das entspricht dem Wert des Immobilienbesitzes.
Als es dann im Oktober 1938 zum Verkauf an die „Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands, Landesstelle München“ kommt, wird der Wert der Häuser von den staatlichen Prüfern auf nur mehr 45.000 RM festgesetzt.
Damit geht der Kauf für ein Butterbrot über die Bühne.
Die finanziellen Belastungen der „Reichsfluchtsteuer“ bleiben dennoch bestehen.
Daneben werden der Familie Hass noch alle wertvollen Gegenstände abgenommen.
5. 10 1938 - Die Ausweise der Juden müssen mit einem roten „J“ versehen werden
Berlin * Die Ausweise der Juden müssen mit einem roten „J“ versehen werden.
27. 10 1938 - Das Deutsche Reich lässt 17.000 Juden verhaften
Deutschland - Polen * Das Deutsche Reich lässt 17.000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit verhaften und an die polnische Grenze transportieren. Da der polnische Staat zunächst die Einreise seiner Staatsbürger verweigert, vegetieren die Menschen im Grenzgebiet in der Zwischenzeit dahin.
Unter den 17.000 befinden sich auch die Eltern des Herschel Gryspan, der wenige Tage später - wegen homosexueller Beziehungen - den Legationssekretär Ernst vom Rath an der Deutschen Botschaft in Paris schwer verletzen wird.
31. 10 1938 - Der Valentin-Film „Der Antennendraht/Im Senderaum“ und die Zensur
München * Der Valentin-Karlstadt-Film „Der Antennendraht/Im Senderaum“ liegt der Zensur vor. Laut Karl Valentin wurde der Film während der Nazi-Zeit nicht öffentlich aufgeführt.
11 1938 - Ein Bauplatz für den Neubau der evangelischen „Matthäuskirche“
Berlin - München-Ludwigsvorstadt * Adolf Hitler ordnet von Berlin aus den Bauplatz für den Neubau der evangelischen „Matthäuskirche“ am Sendlinger-Tor-Platz an.
7. 11 1938 - Herschel Grynspan verletzt in Paris Ernst vom Rath schwer
Paris * In den Morgenstunden dieses Tages verletzt der 17-jährige Herschel Grynspan in Paris den an der Deutschen Botschaft beschäftigten Ernst vom Rath mit fünf Kugeln schwer.
8. 11 1938 - Gryspans Bluttat zum politisch motivierten Mordanschlag hochstilisiert
München * Die nationalsozialistische Propaganda stilisiert Herschel Gryspans Bluttat zum politisch motivierten Mordanschlag aus Hass an den Deutschen hoch. Die Münchner Neuesten Nachrichten schreiben:
„Wenn die internationale Judenschaft glaubt, mit Meuchelmorden das Judenproblem in Deutschland lösen zu können, dann nimmt Deutschland diese Herausforderung an und wird nicht zögern, sie so zu beantworten, wie sie Elementen gegenüber notwendig ist, die den Mord aus dem Hinterhalt als politische Waffe betrachten.“
9. 11 1938 - Die Reichskristallnacht nimmt ihren Anfang
München-Graggenau * Im Alten Rathaus treffen sich Hitler, Goebbels, Göring, Himmler und der Rest der NSDAP-Führungselite zu einem „geselligen Beisammensein“, als die Nachricht vom Tode des deutschen Legationssekretärs Ernst vom Rath eintrifft.
Da der Täter jüdischer Abstammung ist, liefert Raths Tod den Vorwand für eine groß angelegte jüdische Kampagne, die als Reichskristallnacht in die Geschichte eingehen wird.
9. 11 1938 - Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung
München * Noch in der Nacht finden - unter passiver Anteilnahme sehr vieler Schaulustiger - die seit längerer Zeit geplanten Ausschreitungen gegen die Juden statt.
- In München werden ein Jude ermordet sowie 900 Menschen verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gebracht.
- Rund 700 Geschäfte und Betriebe werden demoliert und die Synagogen in der Herzog-Rudolf-Straße und in der Reichenbachstraße zerstört.
- Die Münchner Hauptsynagoge war bereits im Juni 1938 abgerissen worden.
Die Bilanz dieser später auch noch beschönigend „Reichskristallnacht“ genannten Juden-Pogrome bedeutet für Deutschland:
- 91 Ermordete, zahllose Verletzte, Misshandelte und Vergewaltigte,
- 191 zerstörte Synagogen,
- 7.500 zerstörte und ausgeraubte Geschäfte,
- Verwüstung unzähliger Wohnungen und
- fast aller jüdischer Friedhöfe,
- rund 30.000 Einlieferungen in Konzentrationslager.
Die reichsweit organisierten antijüdischen Ausschreitungen dauern auch noch am 10. November an.
9. 11 1938 - Die Ohel-Jakob-Synagoge geht in Flammen auf
München-Lehel * Die Ohel-Jakob-Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße geht in der Reichskristallnacht in Flammen auf.
10. 11 1938 - Propagandaminister Joseph Goebbels erlässt einen „Aufruf an Alle!“
Berlin * Propagandaminister Joseph Goebbels erlässt einen „Aufruf an Alle!“. Er lautet:
- „Die berechtigte und verständliche Empörung des deutschen Volkes über den feigen jüdischen Meuchelmord an einem deutschen Diplomaten in Paris hat sich in der vergangenen Nacht in umfangreichem Maße Luft verschafft.
- In zahlreichen Städten und Orten wurden Vergeltungsaktionen gegen jüdische Gebäude und Geschäfte vorgenommen.
- Es ergeht nunmehr an die gesamte Bevölkerung die strenge Aufforderung, von allen weiteren Demonstrationen und Aktionen gegen das Judentum, gleichgültig welcher Art, sofort abzusehen.
- Die endgültige Antwort auf das jüdische Attentat in Paris wird auf dem Wege der Gesetzgebung beziehungsweise der Verordnung dem Judentum erteilt werden.“
12. 11 1938 - Hermann Göring erlässt eine Sühneverordnung für Juden
Berlin * Hermann Göring, der Beauftragte für den Vierjahresplan zur Kriegsvorbereitung, erlässt eine Sühneverordnung, die zur Finanzierung der Aufrüstung gedacht ist.
- Die Juden deutscher Staatsangehörigkeit müssen zusammen eine Milliarde Reichsmark wegen „ihrer feindlichen Haltung gegenüber dem deutschen Volk und Reich“ zahlen.
- Weiterhin werden alle Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben ausgeschaltet.
- Und schließlich gibt es die Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes.
- Sie besagt: „Alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes über die Hetze des internationalen Judentums gegen das nationalsozialistische Deutschland an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jüdischen Inhaber oder jüdischen Gewerbetreibenden sofort zu beseitigen.
- Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen jüdischen Gewerbebetriebe und Wohnungen. Versicherungsansprüche von Juden deutscher Staatsangehörigkeit werden zugunsten des Reiches beschlagnahmt.“
In München wird eine eigene Arisierungsstelle in der Widenmayerstraße 27 eingerichtet, die die Enteignung und Gettoisierung der jüdischen Bevölkerung durchführen soll.
15. 11 1938 - Karl Valentin und die Nacht der Amazonen
<p><em><strong>München-Geiselgasteig </strong></em>• In dem Kultfilm <em>„München 1938“</em> tritt Karl Valentin im Zusammenhang mit der <em>„Nacht der Amazonen“</em> in einer kurzen Szene auf. Die Dreharbeiten finden am 15. November 1938 statt. Sein Auftritt ist ohne Gage. In Abwandlung seines Dialogs aus dem <em>„Bittsteller“</em> erhält er auf die Frage: <em>„Sie Herr Festaufseher, was kriegt so a Amazone für eine Nacht?“</em>, die Antwort: <em>„Zwei Mark.“</em> Darauf folgt Valentins Feststellung <em>„Zwei Mark, fürs ganze Jahr. Da heißt‘s einteilen.“</em></p> <p> </p>
18. 11 1938 - Die Israelitische Kultusgemeinde muss Nazi-Maßnahmen durchsetzen
München * Innerhalb des isolierten jüdischen Lebensbereiches wird die Israelitische Kultusgemeinde gezwungen, die staatlichen Terror-Maßnahmen durchzusetzen und zu organisieren. So kündigt der Völkische Beobachter an:
„Die Israelitische Kultusgemeinde richtet im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen ab sofort eigene Verkaufsstellen ein, in denen die in München ansässigen Juden ihren notwendigen Bedarf decken können. Zutritt zu diesen Verkaufsstellen haben nur Juden.“
22. 11 1938 - Vertreibung der Juden aus arischen Wohnhäusern
München * Der Völkische Beobachter begründet die Vertreibung der Juden aus arischen Wohnhäusern so:
- „Es besteht ein dringender Bedarf an Wohnraum, und es ist nicht einzusehen, dass arbeitende deutsche Menschen ohne Unterkunft sind oder sich auf primitivste Weise behelfen müssen.
- Deshalb müssen die ausgewiesenen Juden ihre Wohnungen vorher auf eigene Kosten renovieren und ihren Hausrat und ihre Möbel zurücklassen.“
Die auf diese Weise freigewordenen, voll eingerichteten Wohnungen werden in der Regel von verdienten Parteigenossen bezogen.
23. 11 1938 - Die kommunale Selbstständigkeit der Feuerwehren endet
München - Mit dem Gesetz über das Feuerlöschwesen endet die kommunale Selbstständigkeit der Feuerwehren. Die Münchner Berufsfeuerwehr wird in die unter Reichsverwaltung stehende Feuerschutzpolizei integriert. Ab sofort sind die Uniformen und die Fahrzeuge grün.
28. 11 1938 - Anweisung zur Erfassung der jüdischen Wohnungen
München * Eine Berliner Anweisung zur Erfassung der jüdischen Wohnungen wird in München unverzüglich umgesetzt. Man ordnet an, eine Namens- und Adressenliste der noch ansässigen jüdischen Mieter zu erstellen und verpflichtet Hausbesitzer, keine Neuvermietungen an jüdische Personen ohne städtische Genehmigung abzuschließen.
12 1938 - Die letzte Gastspielreise von Valentin/Karlstadt nach Berlin
Berlin * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten letztmals eine Gastspielreise nach Berlin an.
Sie treten wieder im „Kabarett der Komiker“ auf.
12 1938 - Das Anwesen Cuvilliésstraße 22 wird arisiert
München-Bogenhausen * Das Anwesen Cuvilliésstraße 22 gehört der jüdischen Mitbürgerin Rosa Wassermann und ihrem Sohn Rudolf.
Weil den Juden der eigenständige Handel mit Immobilien verboten ist, müssen sie das Grundstück für 36.900 RM an die „Vermögensverwertung München GmbH“ übertragen.
20. 12 1938 - Dr. med. Alfred Haas flüchtet nach London
München-Maxvorstadt - London * Dr. med. Alfred Haas, Betreiber der Privatklinik in der Richard-Wagner-Straße 17 und 19 flüchtet nach London. Seine Frau Elsa folgt ihm bald nach.
1939 - Oberbürgermeister Fiehler macht die „Rosipal-Stiftung“ rückgängig
München-Graggenau * Nachdem bekannt wurde, dass der verstorbene Geschäftsmann Karl Rosipal, der „Stifter des Glockenspiels“ am Neuen Rathaus, „nicht ganz arischer Herkunft“ war, schreckt der antisemitische Oberbürgermeister Fiehler nicht davor zurück, die „Stiftung“ rückgängig zu machen und die gestiftete Summe den Erben zurückzuzahlen.
1939 - Das „Haus des Deutschen Rechts“ wird seinem Zweck übergeben.
München-Maxvorstadt * Das „Haus des Deutschen Rechts“ in der Ludwigstraße 28 wird seinem Zweck übergeben.
Hans Frank will das Justizwesen zu einer „Waffe von ungeheuerer Bedeutung für das deutsche Volk“ umgestalten.
Um 1939 - Die „Villa Benno Becker“ wird arisiert
München-Bogenhausen * Die „Villa Benno Becker“ in der Möhlstraße wird arisiert.
Der „Reichsleiter der NSDAP“, Martin Bormann, bezieht mit seiner elfköpfigen Familie die Immobilie.
1939 - Karl Freiherr von Eberstein bezieht die Villa in der Maria-Theresia-Straße 17
München-Bogenhausen * Karl Freiherr von Eberstein, der Münchner „Polizeipräsident“ und damit „Gerichtsherr über die SS-Wachmannschaften im KZ Dachau“, bezieht die Villa in der Maria-Theresia-Straße 17.
1939 - Zwangseinquartierungen jüdischer Menschen
München-Maxvorstadt * Obwohl Dr. Walter und Nelly Zeckendorf die offiziellen Besitzer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 11 sind, darf die Parterrewohnung und der erste Stock, in dem die verstorbene Jenny Zeckendorf bewohnt hat, nicht mehr vermietet werden.
Sie werden sofort für Zwangseinquartierungen jüdischer Menschen genutzt.
Ab 1939 - Das „Judenhaus“ in der Richard-Wagner-Straße 11
München-Maxvorstadt * Zwischen 1939 und 1941 lassen sich in dem Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 insgesamt 22 jüdische Menschen nachweisen, die hier untergeracht worden sind.
Es handelt sich ausnahmslos um Personen, die aus ihren eigenen Wohnungen vertrieben worden sind und von der Richard-Wagner-Straße 11 aus entweder ins Altenheim wechselten oder ins „Sammellager Milbertshofen“ an der Knorrstarße gebracht werden.
1939 - Gerhard Haas kommt als „Deutscher Kriegsfeind“ in ein „Internierungslager“
England * Zu Kriegsbeginn wird Gerhard Haas, der Enkel Joseph Schüleins, als „Deutscher Kriegsfeind“ in einem „Internierungslager“ gefangen gehalten.
Das Lager wird nach Kanada verlegt, von wo aus Gerhard Haas nach Cuba fliehen kann.
Dort wartet er bis 1941 mit vielen tausend Flüchtlingen aus Deutschland auf sein Visa für die Einreise in die USA.
1939 - Das Alpine Museum zählt 400.000 Besucher
München-Lehel - Praterinsel * Das Alpine Museum des DAV zählt 400.000 Besucher. Der Besuch des Alpinen Museums wird in München-Führern besonders empfohlen.
1939 - Zahl der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung in Bayern gesunken
Bayern * Die Zahl der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung in Bayern ist auf rund zwei Millionen, bei 500.000 Betrieben, gesunken.
Die Gesamtbevölkerung Bayerns ist aber in der Zwischenzeit auf 8,5 Millionen angestiegen, was den Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung auf 25 Prozent drückt.
1939 - Das „Sckell-Denkmal“ wird durch eine Kopie ersetzt
München-Englischer Garten - Schwabing * Das im Jahr 1932 beseitigte „Sckell-Denkmal“ am Südufer des „Kleinhesseloher Sees“ wird durch eine Kopie von Georg Petzold aus „Kalktuff“ ersetzt.
1939 - Die Villa in der Cuvilliésstraße 22 geht an den „Lebensborn e.V.“
München-Bogenhausen * Die Villa in der Cuvilliésstraße 22 wird durch einen Treuhänder um 61.000 RM an den „Reichsfiskus“ (Luftfahrt) verkauft.
Dieser stellt die Bogenhausener Villa dem „Lebensborn e.V.“ ab 1940 zur Verfügung.
1939 - Das Untergiesinger „Brausen- und Wannenbad“ wird abgerissen
München-Untergiesing * Das „Brausen- und Wannenbad“ an der Pilgersheimerstraße 5, das sogenannte „Untergiesinger Tröpferlbad“, wird wegen der geplanten Erweiterung des Bahnstrecke abgebrochen.
1939 - In der „Bäcker-Kunstmühle“ sind insgesamt 31 Personen beschäftigt
München-Untergiesing * In der „Bäcker-Kunstmühle“ sind insgesamt 31 Personen beschäftigt, davon 14 gelernte „Müller“ und zwölf Fahrer.
1939 - München hat 840.586 Einwohner
München * München hat 840.586 Einwohner.
1. 1 1939 - Juden müssen die zusätzlichen Vornamen „Sara“ oder „Israel“ führen
Berlin * Alle deutschen Juden mussten als zweiten Vornamen „Sara“ oder „Israel“ annehmen und in ihre Ausweise eintragen lassen. Ab diesem Zeitpunkt mussten sie ihre Briefe mit dem diskriminierenden Vornamen unterzeichnen, Briefköpfe, Praxisschilder und ähnliches ändern und ergänzen. Verstöße werden mit Gefängnishaft bestraft.
1. 1 1939 - Einführung des Arbeitspflichtdienstes für alle Mädchen
Berlin * Der Arbeitspflichtdienst für alle Mädchen unter 25 Jahren wird eingeführt.
24. 1 1939 - Vorbereitung der Endlösung der Judenfrage
Berlin * Gestapo-Chef Reinhard Heydrich erhält den Auftrag, die „Endlösung der Judenfrage“ vorzubereiten.
2. 2 1939 - Vermeidung aller christlichen Redewendungen und Begriffe
München-Maxvorstadt * Martin Bormann, Leiter der Partei-Kanzlei der NSDAP, gibt die vertrauliche Anweisung, in Reden der Partei alle christlichen Redewendungen und Begriffe zu vermeiden.
10. 2 1939 - Papst Pius XI. stirbt
Rom-Vatikan * Papst Pius XI. stirbt. Sein Nachfolger wird der langjährige Nuntius in München, Eugenio Pacelli, als Pius XII..
2. 3 1939 - Eugenio Pacelli wird zum Papst Pius XII. gekrönt
Rom-Vatikan * Eugenio Pacelli, der langjährige Nuntius in München, wird zum Papst Pius XII. gekrönt.
9. 3 1939 - Probleme bei der Finanzierung des „Hauses der Deutschen Architektur“
München-Lehel * In einer Vormerkung an Oberbürgermeister Fiehler wird neben den Problemen der Finanzierung des Hauses der Deutschen Architektur auch die Räumung der Wohnungen und Unterbringung der Mieter angesprochen. „Durch Zusammenlegung der Juden [Münchens] in insgesamt 800 Wohnungen würden 1000 Wohnungen frei“, lautet die Empfehlung für die Entmietung, die nach Anordnung Hitlers ohne Härte [!] vor sich gehen sollte.
15. 3 1939 - Deutsche Truppen marschieren in Böhmen und Mähren ein
<p><strong><em>Prag</em></strong> * Deutsche Truppen marschieren in das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren ein. </p>
4 1939 - Der Zweite Weltkrieg verhindert die Grundsteinlegung
München-Lehel * „Reichskanzler“ Adolf Hitler legt die Grundsteinlegung für das „Haus der Deutschen Architektur“ für den „Tag der Deutschen Kunst 1940“ fest.
Der inzwischen begonnene Krieg verhindert die Errichtung dieses Ausstellungsgebäudes.
Ab 16. 4 1939 - Valentin-Karlstadt im Augsburger Apollotheater
<p><strong><em>Augsburg</em></strong> • Ab dem 16. April 1939 treten Karl Valentin und Liesl Karlstadt im Apollotheater in Augsburg auf. <em>„Es war ein großer Kampf, weil Augsburg für Herrn Valentin eine Weltreise bedeutet. Ich hab fast heimlich abgeschlossen und da hat er dann doch die Mühen auf sich genommen und ist zu den Augsburgern gefahren.“</em> </p> <p>Und weiter: <em>„Das Publikum, das schon an den Lichtbildern Karl Valentins gehörigen Spaß hat, geht herrlich mit und kommt zum Schluß nicht mehr aus dem Lachen. Es gibt begeisterten Beifall für Karl Valentin und Liesl Karlstadt.“</em></p>
17. 4 1939 - 95 Prozent aller Deutschen sind „Angehörige einer christlichen Kirche“
Deutsches Reich * Bei einer Volkszählung bezeichnen sich 95 Prozent aller Deutschen als „Angehörige einer christlichen Kirche“.
20. 4 1939 - Glückwünsche der Münchner evangelischen Gemeinde
München * Unter „herzlichem und dankbarem Gedenken“ - auch der Münchner evangelischen Gemeinde - begeht Adolf Hitler seinen 50. Geburtstag.
21. 4 1939 - Nutzung des „Weißen Saales“ in der ehemaligen Augustinerkirche
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der evangelischen Matthäus-Kirchengemeinde wird die Nutzung des Weißen Saales in der ehemaligen Augustinerkirche - rückwirkend zum 15. Juni 1938 - vertraglich zugesprochen. Die Unterhalts- und etwaige Instandsetzungskosten gehen zu Lasten der Kirchengemeinde. </p>
23. 4 1939 - Liesl Karlstadt bricht während der Vorstellung zusammen
Augsburg * Während eines Gastspiels mit Karl Valentin im „Apollotheater“ in Augsburg bricht Liesl Karlstadt zusammen.
Daraufhin zieht sie sich von der Bühne zurück.
Karl Valentin lässt umgehend Annemarie Fischer aus München kommen und besetzt die Karlstadt-Rolle bis zur Beendigung des Engagements am 30. April mit ihr.
28. 4 1939 - Hitler kündigt den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt
Berlin * Adolf Hitler kündigt den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt.
30. 4 1939 - Juden müssen in „Judenhäuser“ ziehen
München * Juden müssen „arische“ Wohnhäuser verlassen und in „Judenhäuser“ ziehen.
5 1939 - Sämtliche „Rundfunkgottesdienste“ werden eingestellt
München * Sämtliche „Rundfunkgottesdienste“ werden eingestellt.
14. 5 1939 - Am Muttertag gibt’s den „Karnickelorden“
Berlin * Aus Anlass der Muttertagsfeiern werden erstmals „Ehrenkreuze der deutschen Mutter“ an kinderreiche Frauen verliehen. Frauen mit vier bis fünf Kindern erhalten den Mutterorden in Bronze, für mehr als sechs Kinder gibt‘s den Orden in Silber, und für mehr als acht Kinder wird das Mutterkreuz in Gold vergeben. Die Orden hängen an einem blauen Band mit der Aufschrift: „Das Kind adelt die Mutter“.
Hinter vorgehaltener Hand wird das Mutterkreuz auch als „Karnickelorden“ bezeichnet. Nationalsozialistische Politik drängt die Frauen zurück an Herd und Kinderbett. Außerhalb des Hauses gelten Frauen nur wenig.
Reichspropagandaminister Joseph Goeppels meint zur Rolle der Frau: „Die Frau hat die Aufgabe, schön zu sein und Kinder zur Welt zu bringen. [...] Die Vogelfrau putzt sich für den Mann und brütet für ihn die Eier aus.“
16. 5 1939 - Liesl Karlstadt als Frau Betty Neubauer im Volkstheater
<p><strong><em>München - Augsburg</em></strong> • Viel Zeit zur Erholung hatte Liesl Karlstadt nicht. Bereits Anfang Mai hatte sie Proben im Münchner Volkstheater. Am 16. Mai 1939 war dann die Uraufführung des Theaterstücks <em>„Glück im Spiel, Glück in der Liebe“</em>, einer Wiener Komödie, die ins Münchner Mileu verpflanzt wurde. Liesl Karlstadt wurde die Hauptrolle der Frau Betty Neubauer quasi auf den Leib geschrieben. </p> <p>Sofort nach dem Gastspiel im Volkstheater begibt sich Liesl Karlstadt wieder ins Augsburger Krankenhaus. Die Angina vom April 1939 ist nicht ausgeheilt und verursacht eine massive Blutvergiftung mit sehr großen Entzündungen in beiden Oberschenkeln. Beinahe hätte das rechte Bein amputiert werden müssen.</p>
22. 5 1939 - Der „Stahlpakt“, ein Militär-Bündnis mit Italien
Berlin - Rom * Ein Militärbündnis mit Italien wird abgeschlossen, der sogenannte „Stahlpakt“.
22. 5 1939 - Ernst Toller begeht in New York Selbstmord
New York * Ernst Toller begeht im Bad seines Hotelzimmers in New York Selbstmord.
24. 5 1939 - Der Dokumentarfilm „München 1938“ wird von Hitler verboten
München * Der Dokumentarfilm „München 1938“ erlebt im Phoebus-Palast seine Premiere. Das ist auch die einzige Vorführung, da er auf persönlichen Wunsch Adolf Hitlers verboten werden wird.
1. 6 1939 - 17 Monate Leiden für Liesl Karlstadt
Augsburg - München-Hackenviertel • Eine 17-monatige Leidenszeit liegt vor Liesl Karlstadt. Vom 1. Juni bis 18. September ist sie im Städtischen Krankenhaus in Augsburg. Daraufhin zieht sie sich endgültig von der Zusammenarbeit mit Karl Valentin zurück.
Mit seiner neuen Auftrittsstätte, der „Ritterspelunke“ am Färbergraben, hat sie nichts mehr zu tun. Valentin tritt hier mit seiner neuen Partnerin Annemarie Fischer auf. Einzig Aufnahmen von Sketchen für den Rundfunk machen sie noch gemeinsam.
9. 6 1939 - Pater Rupert Mayer gibt bei der Gestapo eine Erklärung ab
München-Maxvorstadt * Pater Rupert Mayer gibt anlässlich einer Vorladung bei der Gestapo folgende schriftliche Erklärung ab:
- „Ich erkläre, daß ich im Falle meiner Freilassung trotz des gegen mich verhängten Redeverbotes nach wie voraus grundsätzlichen Erwägungen heraus predigen werde.
- Ich werde auch weiterhin in der von mir bisher geübten Art und Weise predigen, selbst dann, wenn die staatlichen Behörden, die Polizei und die Gerichte meine Kanzelreden als strafbare Handlungen und als Kanzelmißbrauch bewerten sollten.“
Ab dem 11. 6 1939 - Karl Valentin als Radfahrer im Gärtnerplatz-Theater
München-Isarvorstadt * Karl Valentin tritt in Eduard Künneckes „Glückliche Reise“ im Theater am Gärtnerplatz als Radfahrer auf.
Um 7 1939 - Das „Corpshaus der Suevia“ geht an die Stadt München
München-Bogenhausen * Mit der „Gleichschaltung“ der Studentenverbindungen verliert das „Corpshaus der Suevia“ in Bogenhausen seinen Zweck.
Es wird um 350.000 Reichsmark an die Stadt München zur Unterbringung der „Meisterschule für Mode“ verkauft.
17. 7 1939 - Zum Verlassen kann der Ausgang genutzt werden
<p><strong><em>München-Hackenviertel</em></strong> * Karl Valentin hat seinem <em>„Panoptikum“</em> im Färbergraben 33 einen neuen Spielort für seine Stücke hinzugefügt. Die <em>„Ritterspelunke“</em> vereinigt das Panoptikum, eine Künstlerkneipe und den Theaterbetrieb.</p> <p><em>„Zum Verlassen des Panoptikums kann der Ausgang kostenlos genützt werden, dagegen ist der Eintritt von 60 Rpf. am Eingang zu bezahlen.“ </em></p>
17. 7 1939 - Die Beziehung Valentin - Karlstadt verändert sich grundlegend
<p><em><strong>München</strong></em> • Zwei Ereignisse im Jahr 1939 haben die Beziehung Valentin-Karlstadt grundlegend verändert. Mit der Schließung des<em> „Kabarett Benz“</em> gibt es für die beiden in München keine Möglichkeit mehr regelmäßig aufzutreten.</p> <ul> <li>Liesl Karlstadt kann Engagements im sogenannten <em>„normalen“</em> Theater annehmen, für Valentin kommt das nicht in Frage.</li> <li>Da es für ihn kein Theater mehr gibt, wo er hätte spielen können, eröffnet er am 17. Juli 1939 sein eigenes, die <em>„Ritterspelunke“</em>.</li> <li>Da seine gewohnte Partnerin Liesl Karlstadt aufgrund ihrer Blutvergiftung für Monate nicht zur Verfügung steht, braucht er neue Mitspieler.</li> <li>Valentin greift hierbei auch nicht auf bewährte klassische Valentinstücke zurück, wofür er Liesl Karlstadt gebraucht hätte, sondern entwickelt etwas völlig neues, den <em>„Ritter Unkenstein“</em>. </li> </ul>
23. 8 1939 - Abschluss des Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes
Berlin - Moskau * Abschluss des geheim gehaltenen Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes und Einigung über die Aufteilung Polens.
25. 8 1939 - Englisch-polnischer Beistandspakt
England - Polen * England schließt mit Polen einen Beistandspakt.
28. 8 1939 - Karl Valentin verkauft seine umfangreiche Fotosammlung
München * Karl Valentin verkauft um 20.000 Mark seine umfangreiche Fotosammlung an das Münchner Stadtarchiv.
9 1939 - Die „Luftschutzrettungsstelle“ zieht in die ehemalige „Lauer-Villa“
München-Bogenhausen * Nach dem Kriegsbeginn zieht in die ehemalige „Lauer-Villa“ in der Neuberghausener Straße 11 eine „Luftschutzrettungsstelle“ für Bogenhausen ein.
Weitere Militäteinrichtungen, darunter die „Luftschutzschule“, folgen.
9 1939 - Das „Oktoberfest“ fällt zum fünfzehnten Mal aus
München-Theresienwiese * Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt zum fünfzehnten Mal aus.
9 1939 - 16 stramme Ochsen stehen schon für den Verzehr auf der „Wiesn“ bereit.
München-Theresienwiese * Willy Heide erinnert sich: 16 stramme Ochsen stehen schon für den Verzehr auf der „Wiesn“ bereit.
Doch dann bricht der Zweite Weltkrieg aus.
„Der Papaa hat alle schlachten lassen miassn und in Büchsen einmachen.
Da hat‘s lang a Stammessen geb‘n im Heide-Volm“.
1. 9 1939 - Adolf Hitler erlässt den Euthanasiebefehl
Berlin * Der Euthanasiebefehl Hitlers, wird zwar erst Ende Oktober 1939 geschrieben, aber auf den 1. September 1939 rückdatiert. „Träger minderwertigen Erbgutes“ (siehe 14. Juli 1933) gelten den Nazis als „lebensunwertes Leben“. Das geheime Ermächtigungsschreiben Adolf Hitlers hat die planmäßige Tötung von 100.000 Erwachsenen und 20.000 Kindern zur Folge.
Die Verwirklichung des Euthanasieprogramms soll vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden, weshalb die unmittelbar Hitler unterstellte Kanzlei des Führers der NSDAP mit der Vorbereitung und Durchführung der Tötungsmaßnahmen beauftragt wird. Die Euthanasie-Aktion wird inoffiziell als Aktion T 4 bezeichnet, nach dem Sitz der zuständigen Dienststelle in der Berliner Tiergartenstraße 4.
Um keinen Verdacht zu erregen, werden in den Tötungsanstalten eigene Standesämter zur Ausstellung der Todesurkunden eingerichtet. Die Angehörigen erhalten eine Mitteilung, dass der Kranke „unerwartet an einer Krankheit“ gestorben und bereits eingeäschert worden ist.
1. 9 1939 - Der Beginn des Zweiten Weltkrieges
Deutsches Reich - Polen * Deutschland überfällt Polen ohne Kriegserklärung. Damit beginnt der Zweite Weltkrieg.
2. 9 1939 - Die evangelische Kirche steht hinter Hitlers Krieg mit Polen
München * Mit einem Aufruf des Geistlichen Verwaltungsrates stellt sich die evangelische Kirche hinter Hitler und seinen Krieg mit Polen.
3. 9 1939 - Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland den Krieg
London - Paris - Berlin * England und Frankreich erklären Deutschland den Krieg.
5. 9 1939 - Eine Verordnung gegen Volksschädlinge wird erlassen
Berlin * Wenige Tage nach dem Kriegsbeginn wird eine Verordnung gegen Volksschädlinge erlassen. Sie bildet eine weitere rechtliche Grundlage für Todesurteile. Die Verordnung räumt ausdrücklich auch die Todesstrafe durch Erhängen ein.
19. 9 1939 - .Liesl Karlstadt begibt sich ins Erholungsheim in Ried
Augsburg - Ried • Am 19. September 1939 verlässt Liesl Karlstadt Augsburg und zieht ins Erholungsheim St. Vinzenz in Ried bei Pfronten. Hier verbringt sie die Zeit bis Weihnachten.
20. 9 1939 - Juden müssen die Radioapparate abliefern
Berlin * Juden müssen sämtliche Radioapparate abliefern.
28. 9 1939 - Die Arisierungsstelle nimmt ihre Tätigkeit auf
München-Lehel * Die Arisierungsstelle in der Widenmayerstraße 27 nimmt ihre Tätigkeit auf.
Ab 10 1939 - In der „Volksschule am Kolumbusplatz“ wird ein Lazarett eingerichtet
München-Untergiesing * Auch im Zweiten Weltkrieg wird in der „Volksschule am Kolumbusplatz“ ein Lazarett eingerichtet.
Es steht immer schlecht ums Land, wenn aus Schulen Krankenhäuser werden.
1. 10 1939 - Die Schack-Galerie wird in das Eigentum Bayerns überführt
München-Lehel * Die Schack-Galerie wird in das Eigentum Bayerns überführt. Die Gemälde werden kurz nach Kriegsbeginn in Klöstern und Schlössern im bayerischen Oberland in Sicherheit gebracht.
1. 10 1939 - Für die Ernte auf den polnischen Schlachtfeldern wird Gott gedankt
München * Zum Erntedankfest wird in den evangelischen Kirchen eine „Kanzelabkündigung des Geistlichen Vertrauensrates“ verlesen. Darin wird für „die Ernte auf den polnischen Schlachtfeldern Gott gedankt“.
3. 10 1939 - Glockengeläut nach dem Einmarsch in Warschau
München * Auf Anordnung des Landeskirchenrates der evangelischen Kirche werden nach dem Einmarsch in Warschau die Kirchenglocken sieben Tage lang von 12 bis 13 Uhr geläutet.
6. 10 1939 - Nach Beendigung der Kämpfe wird Polen Generalgouvernement
Polen * Kämpfe in Polen werden beendet. Polen wird Generalgouvernement.
18. 10 1939 - Versand kirchlicher Druckschriften an Wehrmachtssoldaten verboten
München * Ein Verbot der Versendung kirchlicher Druckschriften an Wehrmachtssoldaten wird erlassen.
3. 11 1939 - Pater Ruppert Mayer wird verhaftet und gefangen gehalten
München-Maxvorstadt * Pater Rupert Mayer wird wegen „Wahrung des Beichtgeheimnisses“ und dem Verdacht konspirativer Kontakte zur Widerstandsgruppe der Monarchistischen Bewegung verhaftet. Er wird zwei Monate im Wittelsbacher-Palais gefangen gehalten.
Nach dem 8. 11 1939 - Faulhaber beglückwünscht Hitler zu seiner „glücklichen Rettung“
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber schreibt nach dem Attentat von Georg Elser auf Adolf Hitler im Bürgerbräukeller diesem ein Telegramm und beglückwünscht ihn zu seiner „glücklichen Rettung“. Zudem bittet er Gott, „er möge auch ferner seinen schützenden Arm über Sie halten“.
9. 11 1939 - Das besondere Walten der Vorsehung
München * Nach dem Attentat auf Hitler im Bürgerbräukeller wird die kirchliche Presse angewiesen, das „besondere Walten der Vorsehung“ hervorzuheben.
19. 11 1939 - Dankgebet für die Bewahrung Adolf Hitlers
München * Das Evangelische Gemeindeblatt druckt ein „Dankgebet für die Bewahrung Adolf Hitlers“ beim Attentat im Bürgerbräukeller ab.
6. 12 1939 - Der „Ritter Unkenstein“ erlebt seine Uraufführung
München-Hackenviertel * Die Karl-Valentin-Szenenfolge „Ritter Unkenstein“ erlebt in der Ritterspelunke am Färbergraben 33 ihre Premiere. Valentins neue Partnerin ist die junge Schauspielerin Annemarie Fischer. Das Stück wird über einhundert Mal aufgeführt.
21. 12 1939 - Hermann Giesler wird Generalbaurat für die Hauptstadt der Bewegung
Berlin * Mit einem Führererlass wird der Architekt Hermann Giesler zum Generalbaurat für die Hauptstadt der Bewegung ernannt.
23. 12 1939 - Pater Rupert Mayer erhält im KZ Sachsenhausen-Oranienburg Einzelhaft
Sachsenhausen-Oranienburg * Pater Rupert Mayer wird in das KZ Sachsenhausen-Oranienburg bei Berlin überführt und erhält Einzelhaft. Dort verschlechtert sich sein Gesundheitszustand infolge von Hunger und seiner Kriegsverletzung, sodass die Behörden befürchten, der Pater werde als Märtyrer sterben.
31. 12 1939 - Das Lehel wird von 22.000 Menschen bewohnt
München-Lehel * Das Lehel wird von 22.000 Menschen bewohnt.
1940 - Karl Valentin hat die Rechte an seiner Sammlung verloren
München * Als Karl Valentin im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung einige seiner dem Stadtarchiv München verkauften Dias zeigen will, erklärt man ihm unmissverständlich, dass er mit dem Verkauf jegliche Rechte an seinen Fotos verloren hat.
1940 - Eine Lebensborn-Dienststelle ist in der Cuvilliésstraße 22
München-Bogenhausen * Eine Dienststelle des Lebensborn e.V. ist in der Cuvilliésstraße 22 untergebracht. Vorteilhaft ist die Nähe zur Bürgermeister-Villa in der Ismaninger Straße 95, die ab 1941 ebenfalls als Lebensborn-Dienststelle genutzt wird.
Um 1940 - „Entbindungsheime“ und „Kinderheime“ des „Lebensborn e.V.“
Europa * Im „Deutschen Reich“ (einschließlich Österreich) besitzt der „Lebensborn e.V.“ neun „Entbindungsheime“ und zwei „Kinderheime“.
Für die Geburt unehelich gezeugter Kinder deutscher Besatzungstruppen eröffnet der „Lebensborn e.V.“ in Belgien, Frankreich, Luxemburg und Norwegen insgesamt zwölf „Entbindungsheime“.
Alleine in Norwegen kommen 8.000 bis 9.000 Kinder zur Welt.
Jedes „Lebensborn-Heim“ besitzt ein eigenes „Standesamt“ und eine „polizeiliche Meldestelle“.
1940 - Die Stadt München konfisziert das Haus in der Richard-Wagner-Straße 7
München-Maxvorstadt * Die Stadt München konfisziert das Haus in der Richard-Wagner-Straße 7 und übergibt es bald darauf an das Kuratorium für das Braune Band von Deutschland.
1940 - Die Familie Haas leidet unter der fremdenfeindlichen englischen Politik
Großbritannien * Wie viele Emigranten hatte auch die Familie Haas unter der fremdenfeindlichen englischen Politik zu leiden.
- Es werden keine Arbeitserlaubnis für deutsche Ärzte erteilt.
- Hinzu kommt eine unverblümt antisemitische Stimmung.
Dr. Alfred Haas gibt seine Bemühungen auf und emigriert mit seiner Frau in die USA.
Ab 1940 - Das „Schyrenbad“ als „Sammelstelle zur Möbelbergung“
München-Untergiesing * Im Zweiten Weltkrieg missbraucht man das „Schyrenbad“ als „Sammelstelle zur Möbelbergung“ für die ausgebombten Untergiesinger Bürger.
Ab 1940 - 2.805 Todesurteile in der NS-Zeit vollstreckt
Deutsches Reich * In der Zeit des Nationalsozialismus von 1940 bis 1945 vollstreckt der Scharfrichter Johann Reichhart 2.805 Todesurteile.
1940 - Der Seidenbau ist wünschenswert
Deutsches Reich * Der Seidenbau ist aus „volkswirtschaftlichen, medizinischen und wehrpolitischen Gesichtspunkten besonders wünschenswert“.
1. 1 1940 - Das Lebensbornheim Hochland in Steinhöring bietet mehr Platz
Steinhöring * Nach dem Umbau des Lebensbornheims Hochland in Steinhöring bietet es jetzt Platz für 50 statt für 30 Mütter. Die Kinderbettenzahl ist von 55 auf 109 aufgestockt worden.
15. 1 1940 - Umzug der Lebensborn-Zentrale
München-Kreuzviertel * Der ebenfalls geplante Abriss des jüdischen Gemeindehauses in der Herzog- Max-Straße 3-5 kommt nicht zur Ausführung. Die Gebäude werden daraufhin dem Rasse- und Siedlungs-Hauptamt der SS zur Verfügung gestellt. Daraufhin verlegt die Zentrale des Lebensborn e.V. ihren Sitz von der Poschinger Straße 1 in die Herzog-Max-Straße 3-7.
18. 1 1940 - Die ersten 25 Haar-Eglfinger Patienten werden ermordet
Haar-Eglfing * Die ersten 25 Patienten werden aus der Heilanstalt in Haar-Eglfing in Bussen in die Tötungsanstalt Grafeneck bei Münsingen im Landkreis Reutlingen gebracht. Noch am selben Tag werden sie dort ermordet.
2 1940 - Karl Valentin soll seinen Requisitenkeller im „Kolosseum“ räumen
München-Isarvorstadt * Karl Valentin wird behördlicherseits aufgefordert, seinen Requisitenkeller im „Kolosseum“ zu räumen, da dort ein Luftschutzkeller eingerichtet werden soll.
Aus Wut und Verzweiflung zerstört oder verschenkt er daraufhin seinen gesamten Bühnenfundus.
Kurz darauf wird ihm mitgeteilt, dass er den Raum nun doch weiterhin nutzen kann.
3 1940 - Karl Valentin tritt als „Frosch“ am „Gärtnerplatz-Theater“ auf
München-Isarvorstadt * Karl Valentin tritt als „Frosch“ in der „Fledermaus“ am „Gärtnerplatz-Theater“ auf.
4 1940 - Karl Valentin kündigt seine Mitgliedschaft in der „Reichsfachschaft Film“
München - Berlin * Karl Valentin kündigt seine Mitgliedschaft in der „Reichsfachschaft Film“.
Ab dem 29. 5 1940 - 1.440 Kubikmeter Wasser in der Sekunde durch das Isar-Flussbett
München * Am 29. und 30. Mai 1940 regnete es in Strömen und ununterbrochen. Beim gewaltigsten Hochwasser der Isar stürzen 1.440 Kubikmeter Wasser in der Sekunde durch das Flussbett.
4. 6 1940 - Der erste Luftangriff auf München
München * Der erste Luftangriff auf München. München wird von sechs Luftangriffen heimgesucht. Diese bringen aber nur geringe Zerstörungen. Noch kursiert hier der Kinderreim: „Bomben auf Berlin / Rosen auf Wien / München wollen wir schonen / da wollen wir später wohnen“. Von einem Krisenbewusstsein ist nichts zu spüren und die zunehmende Mobilisierung für Luftschutzübungen werden von der Einwohnerschaft häufig nur als lästige Beeinträchtigung des gewohnten Lebensablaufes empfunden.
Noch immer glauben die Münchner dem Propagandaminister Dr. Joseph Goebbels und dem Reichs-Luftmarschall Hermann Göring, die dem Volk versprochen haben, dass kein feindliches Flugzeug nach Deutschland durchkommen wird.
Göring, der der Zivilbevölkerung den absoluten Schutz vor Bombenangriffen garantiert hat, will sogar „Meier“ heißen, sobald ein feindliches Flugzeug deutsches Territorium überfliegen würde. Kein Wunder, dass der Oberbefehlshaber der Luftwaffe im Volksmund bald nur noch der „Herr Meier“ war. Auch der Name Tengelmann ist für ihn geläufig, „hatte er ja schließlich in jeder größeren Stadt Deutschlands eine Niederlage“.
Die Münchner Stadtverwaltung macht sich dagegen mehr Gedanken und Sorgen, weil sie für München als Hauptstadt der Bewegung eine erhöhte Bombengefährdung sieht.
5. 6 1940 - Die letzte Vorstellung von Karl Valentins Ritter Unkenstein
München-Hackenviertel * Die letzte Vorstellung von Karl Valentins „Ritter Unkenstein“ in der Ritterspelunke am Färbergraben.
17. 6 1940 - Else Eisner-Belli nimmt sich das Leben
Frankreich * Die vor den Nazis nach Frankreich geflüchtete Else Eisner-Belli nimmt sich das Leben.
22. 6 1940 - Josephine Baker im Widerstand
<p><strong><em>Paris</em></strong> • Nach dem Waffenstillstand von Compiègne vom 22. Juni 1940 arbeitet Josephine Baker für die Résistance, der Widerstandbewegung gegen die nationalsozialistische Herrschaft in Frankreich. Auf ihrem Schloss Les Milandes, das einige Zeit in der unbesetzten Zone lag, versteckt sie Flüchtlinge, die von den Nationalsozialisten gesucht werden: Mitglieder der Résistance und Juden.</p> <p>Zudem wird sie Mitarbeiterin des französischen Nachrichtendienstes, wo sie als Kurier zum Einsatz kommt. Um die transportierten Geheiminformationen zu verstecken, werden diese zum Teil in unsichtbarer Tinte auf den Partituren Bakers notiert. Einige Dokumente versteckt sie auch in ihrer Unterwäsche, da ihr als Berühmtheit nicht die Gefahr einer Leibesvisitation droht. </p>
7. 7 1940 - Ringo Starr kommt in Liverpool zur Welt
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Ringo Starr, der Schlagzeuger der Beatles, kommt als Richard Starkey in Liverpool zur Welt. </p>
19. 7 1940 - Den Juden werden die Telefonanschlüsse gekündigt
Berlin * Den jüdischen Mitbürgern werden aufgrund der nationalsozialistischen Rassepolitik von der Reichspost die Telefonanschlüsse gekündigt.
8 1940 - Karl Valentin mit „Theater in der Vorstadt“ im Deutschen Theater
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> • Als Liesl Karlstadt wieder einsatzfähig ist, tritt sie wieder gemeinsam mit Karl Valentin auf. Erst im August 1940 wagt sich Liesl Karlstadt wieder auf die Bühne. Gemeinsam mit Karl Valentin spielt sie im August und September 1940 die Szene <em>„Theater in der Vorstadt“</em> im Deutschen Theater. </p> <p> </p>
Ab 8 1940 -
<p><em><strong>München-Ludwigsvorstadt</strong></em> • Als Liesl Karlstadt wieder einsatzfähig ist, tritt sie wieder gemeinsam mit Karl Valentin auf. Erst im August 1940 wagt sich Liesl Karlstadt wieder auf die Bühne. Gemeinsam mit Karl Valentin spielt sie im August und September 1940 die Szene <em>„Vorstadttheater“</em> im Deutschen Theater. </p>
7. 8 1940 - Pater Rupert Mayer wird ins Kloster Ettal verbannt
Ettal * Pater Rupert Mayer wird wegen seines bedrohlichen Gesundheitszustandes und auf Anordnung des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, für den Rest des Krieges ins Kloster Ettal verbannt. Er muss im Kloster leben, darf das Klostergelände nicht verlassen und keine Messen in der Öffentlichkeit zelebrieren.
20. 8 1940 - Der 67 Hektar große Hirschauer Forst kommt zum Englischen Garten
München-Englischer Garten - Hirschau * Der 67 Hektar große Hirschauer Forst wird dem Englischen Garten gegen eine Bezahlung von 100.000 Mark übergeben.
9 1940 - Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt aus.
5. 10 1940 - Lion Feuchtwanger trifft in New York ein
New York * Lion Feuchtwanger trifft in New York ein.
9. 10 1940 - John Lennon erblickt in Liverpool das Licht der Welt
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * John (Winston) Lennon, Sänger, Gitarrist und Songwriter der Beatles, wird in Liverpool geboren. </p>
11 1940 - Karl Valentin mit „Der Theaterbesuch“ im „Deutschen Theater“
München-Ludwigsvorstadt * Karl Valentin tritt mit „Der Theaterbesuch“ im „Deutschen Theater“ auf.
30. 11 1940 - Karl Valentins Panoptikum in der Ritterspelunke schließt für immer
München-Hackenviertel * Karl Valentins „Panoptikum“ in der Ritterspelunke am Färbergraben 33 schließt für immer.
12 1940 - Liesl Karlstadt spielt in der Revue „Münchner G‘schicht‘n“
München-Graggenau * Liesl Karlstadt spielt - äußerst erfolgreich - in der Revue „Münchner G‘schicht‘n“ in Adolf Gondrells „Bonbonniere“.
Anfang ??? 1941 - Liesl Karlstadt schließt sich den Soldaten eines „Gebirgsjägertrupps“ an
Ehrwald * Nach einer neuerlichen Krankheit sucht Liesl Karlstadt Erholung bei einem Bekannten in Ehrwald.
Hier freundet sie sich mit den Soldaten eines „Gebirgsjägertrupps“ an, der auf der „Ehrwalder Alm“ stationiert ist. Besonders die Maultiere, die „Mulis“, haben es ihr angetan.
Die Soldaten nehmen Liesl Karlstadt in ihre Gemeinschaft auf, geben ihr den Namen „Gustav“ und ernennen sie zum „Obergefreiten“.
Ab 1941 - Der „Lebensborn e.V.“ lässt „rassisch wertvolle“ Kinder entführen
Berlin * Der „Lebensborn e.V.“ wirkt bei der Eindeutschung „rassisch wertvoller“ Kinder aus den besetzten Gebieten mit.
Mehrere hundert Kinder im Alter von wenigen Monaten bis 17 Jahren werden - gegen den Willen oder ohne Wissen der Eltern - aus Norwegen, Polen, dem früheren Jugoslawien oder der ehemaligen Tschechoslowakei nach Deutschland geschickt.
Der „Lebensborn e.V.“ gibt ihnen deutsche Namen, erzieht sie in seinen Heimen ausschließlich in deutscher Sprache zu deutscher Lebensweise und vermittelt sie in deutsche Pflege- oder Adoptionsfamilien.
Die äußeren Merkmale der Kinder müssen sie als „reinrassisch“ und zur Vermehrung des „guten Blutes“ geeignet erscheinen lassen, denn - so hat Heinrich Himmler SS-Führern im besetzten Polen erklärt: „Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen“.
Frühjahr ??? 1941 - Beginn der „Zwangsevakuierung“ von Juden
München * Die „Zwangsevakuierung“ von Juden in sogenannte „Judenhäuser“ und „Judenwohnungen“ beginnt.
1941 - Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 17 wird arisiert
München-Maxvorstadt * Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 17, dessen Besitzer Dr. med. Alfred Haas emigrieren musste, wird „arisiert“ und geht an das „Deutsche Reich“ über.
1941 - Dr. med. Alfred Haas eröffnet in Manhattan eine Praxis
New York * Dr. med. Alfred Haas eröffnet in Manhattan, in der Lexington Avenue, eine Praxis.
1941 - Dr. Ludwig Gilmer übernimmt die „Haas-Klinik“
München-Maxvorstadt * Dr. Ludwig Gilmer, ebenso „Facharzt für Chirurgie“ wie Dr. Alfred Haas, übernimmt von der „Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands, Landesstelle München“ beziehungsweise vom „Deutschen Reich“ die Häuser Richard-Wagner-Straße 17 und 19.
Er betreibt dort eine „Entbindungsanstalt“.
Die „Franziskanerinnen“ werden durch sogenannte „Braune Schwestern“ ersetzt.
1941 - Der Untergiesinger „Hochbunker“
München-Untergiesing * An der Claude-Lorrain-Straße wird ein achteckiger, fensterloser „Hochbunker“ gebaut, dessen Wände aus 2,40 Metern dicken Betonmauern bestehen, der nur über wenige Luftschlitze verfügt und in dem 450 „Schutzsuchende“ Platz finden können.
Der Münchner Stadtverwaltung ist inzwischen mehrfach bewiesen worden, dass das „Abwehrfeuer“ aus den „Fliegerabwehrkanonen“, kurz „Flak“ genannt, die alliierten Luftverbände nicht von den Bombenabwürfen abhalten kann.
Deshalb setzt man jetzt auf „Luftschutzräume“, die angeblich Schutz vor jeder erdenklichen Gefahr bieten - so gegen Splitter detonierender Bomben und Geschosse sowie gegen den Einsturz eines Hauses.
Als der sicherste Ort galt bei einem Luftangriff der Keller, dem angeblich auch „Sprengbomben“ nichts anhaben können.
Aber was macht man in einem Stadtviertel, in dem nicht jedes Haus über einen massiv gebauten Keller mit „Luftschutzraum“ verfügt und durch seine Nähe zur Isar kein Keller sein konnte?
Die Antwort sind die übers Stadtgebiet verteilten „Hochbunker“.
Im Erbauungsjahr des Untergiesinger „Hochbunkers“ - 1941 - werden keine Bombenabwürfe vermeldet.
1941 - Die „Bäcker-Kunstmühle“ wird in eine „Genossenschaft“ umgewandelt
München-Untergiesing * Die „Bäcker-Kunstmühle“ wird in eine „Genossenschaft“ umgewandelt, da die „Bäcker-Innung“ nach den seinerzeit geltenden Gesetzen keine wirtschaftlichen Einrichtungen betreiben darf.
Die „Bäcker-Kunstmühle“ wird von den in der „Genossenschaft“ zusammengeschlossenen „Bäckermeistern“ gemeinschaftlich betrieben und dient ausschließlich zur „Förderung der Wirtschaft“ der Mitglieder.
24. 1 1941 - Karl Valentins „Soldatenmarschlied“ wird gesperrt
München * Das von Karl Valentin an diesem Tag aufgenommene „Soldatenmarschlied“ wird von der nationalsozialistischen Zensur für jede Ausstrahlung gesperrt. In dem Lied überzeichnet der den Soldatenalltag aus Sicht der Machthaber zu ironisch und desillusionierend.
4 1941 - Liste für die „Wiedervermietungen freigewordener Judenwohnungen“
München * Im „Stadtbauamt“ wird eine Liste für „Wiedervermietungen freigewordener Judenwohnungen“ erstellt.
Die Neuvermietung im Haus Richard-Wagner-Straße 11 wird schon Monate zuvor geplant, bevor die letzten Juden aus dem Haus in die „Deportationslager“ abtransportiert sind.
4 1941 - Nazis zeigen gegenüber Graf Arco ein großes Entgegenkommen
München * Mitten im Zweiten Weltkrieg zeigen die Nazis nochmals großes Entgegenkommen für Anton Graf von Arco auf Valley.
Der „Reichsjustizminister“ ordnet an, dass die Verurteilung Arcos wegen Mordes aus der Strafliste zu streichen ist.
Auch das Delikt einer Autofahrt im Zustand der Volltrunkenheit wird vom „Reichsjustizministerium“ gnadenhalber nicht verfolgt.
Offenbar benötigt Arco wieder einen Führerschein, wozu ein blütenweißer Strafregisterauszug notwendig ist.
4 1941 - „Kultusminister“ Wagner lässt „Kruzifixe“ aus den Schulräumen entfernen
München * „Kultusminister“ Adolf Wagner lässt die „Kruzifixe“ aus den Schulräumen entfernen und durch „zeitgemäßen Wandschmuck“ ersetzen.
Die Verordnung führt zu massiven Elternprotesten.
24. 5 1941 - Bob Dylan wird als Robert Allen Zimmerman geboren
Duluth-Minnesota * Bob Dylan wird als Robert Allen Zimmerman in Duluth, Minnesota, geboren. Er wird sich zu einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts entwickeln.
Ab 29. 5 1941 - Dreharbeiten zum Valentin-Karlstadt-Film „In der Apotheke“
München • Am 29. und 30. Mai 1941 dreht Liesl Karlstadt mit Karl Valentin die Szene „In der Apotheke“ für die Tobis-Trichter-Filmreihe „Volkshumor in deutschen Gauen“ den Beitrag zum Münchner Humor.
6 1941 - Filmaufnahmen für „Der Tobis-Trichter - Volkstum aus deutschen Gauen“
München-Geiselgasteig * Hans Albin führt Regie für den 17-Minuten-Film „Der Tobis-Trichter - Volkstum aus deutschen Gauen“.
Der Film enthält neben Auftritten von Adolf Gondrell, Weiß-Ferdl und anderen den Valentin-Karlstadt-Sketch „In der Apotheke“.
2. 6 1941 - Charlie Watts, der Schlagzeuger der Rolling Stones, wird geboren
London * Charlie Watts, der spätere Schlagzeuger der Rolling Stones, wird als Charles Robert Watts in Islington, London, England geboren.
4. 6 1941 - Ex-Kaiser Wilhelm II. stirbt im holländischen Doorn
Doorn * Der sich im holländischen Exil aufhaltende ehemalige Deutsche Kaiser und preußische König Wilhelm II. stirbt in Doorn.
16. 6 1941 - Der Jesuitenpater Alfred Delp beginnt seine Tätigkeit als Seelsorger
München-Bogenhausen * Der Jesuitenpater Alfred Delp beginnt seine Tätigkeit als Seelsorger in der Bogenhausener Pfarrei Heilig Blut und als Kirchenrektor an der Sankt-Georgs-Kirche.
24. 6 1941 - Der Lebensborn e.V. erwirbt die Bürgermeister-Villa in Bogenhausen
München-Bogenhausen * Der Lebensborn e.V. erwirbt die Bürgermeister-Villa in der Ismaninger Straße 95 in Bogenhausen. Zu diesem Zweck genehmigt Heinrich Himmler die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 750.000 RM. Die Villa wird zur Unterbringung von Lebensborn-Dienststellen gebraucht, die in der Herzog-Max-Straße 3-7 keinen Platz mehr haben. So zum Beispiel die Krankenkassenabteilung.
In einem Rundschreiben vom 24. Juni 1941 wird die Eröffnung der Verwaltungsstellen als „Dienststelle Ismaningerstraße 95“ bekannt gegeben. Unter der Anschrift Ismaninger Straße 95 findet sich die einzige offizielle Eintragung des Lebensborn e.V. in einem Münchner Adressbuch.
18. 7 1941 - Die Heimanlage für Juden in Berg am Laim wird geöffnet
München-Berg am Laim * Das als Heimanlage für Juden bezeichnete Sammellager an der Clemens-August-Straße 9 in Berg am Laim wird geöffnet.
8 1941 - Hitler lässt den „Euthanasiebefehl“ einstellen
Berlin * Hitler lässt die Tötungsaktionen aus dem „Euthanasiebefehl“ einstellen, weil trotz strengster Geheimhaltung Tatsachenberichte an die Öffentlichkeit dringen.
Dennoch fallen bis 1945 noch Tausende von Menschen in den „Heilanstalten“ der „Euthanasie“ zum Opfer.
8 1941 - Flugblätter und Klebezettel mit Aufrufen zum Widerstand
München * Das „Reichssicherheitshauptamt“ stellt fest, dass in München und Umgebung verstärkt Flugblätter und Klebezettel mit Aufrufen zum Widerstand gegen das NS-Regime in Umlauf sind.
Darin tauchen Angriffe wie „Bluthund Hitler verrecke!“ oder „Vernichtet den Faschismus!“ auf.
18. 8 1941 - Elisabeth und Rosa Braun kommen in die „Heimanlage für Juden“
München-Bogenhausen - München-Berg am Laim * Elisabeth und Rosa Braun und einige Mitbewohner des Hauses Maria-Theresia-Straße 23 werden in die sogenannte „Heimanlage für Juden“ in Berg am Laim, im Kloster der Barmherzigen Schwestern, eingewiesen.
19. 8 1941 - Uraufführung des Films „Der Tobis-Trichter“
Berlin * Der Film „Der Tobis-Trichter - Volkstum aus deutschen Gauen“ wird im Berliner Tauentzien-Palast uraufgeführt. Der Film enthält neben Auftritten von Adolf Gondrell, Weiß-Ferdl und anderen den Valentin-Karlstadt-Sketch „In der Apotheke“. Hans Albin führt Regie für den 17-Minuten-Film.
9 1941 - Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt aus.
1. 9 1941 - Alle jüdischen Bürger müssen den gelben Judenstern tragen
München * Alle jüdischen Bürger müssen ab dem 6. Lebensjahr den gelben Judenstern sichtbar tragen.
28. 9 1941 - Edmund Stoiber wird in Oberaudorf geboren
Oberaudorf * Edmund Stoiber, der spätere Bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, wird in Oberaudorf geboren.
23. 10 1941 - Die Verhinderung der Auswanderung jüdischer Menschen angeordnet
Berlin * Heinrich Himmler lässt allen Polizeidienststellen im Reich mitteilen, das die „Verhinderung der Auswanderung jüdischer Menschen“ angeordnet ist. Damit ist auch keine Flucht mehr möglich.
16. 11 1941 - Karl Valentin tritt in einer Winterhilfswerk-Veranstaltung auf
München-Maxvorstadt * Karl Valentin tritt im Rahmen der Winterhilfswerk-Veranstaltung „Heiterkeit und Fröhlichkeit in der Manege“ im Zirkus Krone auf. Die Veranstaltung wird am 23. November wiederholt.
20. 11 1941 - Elisabeth „Sara“ Braun wird in Kaunas gebracht und ermordet
Kaunas/Litauen * Die 54-jährige Elisabeth „Sara“ Braun wird nach Kaunas in Litauen gebracht und mit etwa 3.000 anderen Juden aus dem Hinterhalt mit Maschinengewehren niedergeschossen.
20. 11 1941 - Der erste Transport von 1.000 Münchner Juden nach Kaunas
Kaunas/Litauen * Der erste Transport von 1.000 Münchner Juden nach Kaunas.
20. 11 1941 - Betty Landauer wird nach Kaunas deportiert
München - Kaunas * Betty Landauer wird nach Kaunas deportiert.
25. 11 1941 - Betty Landauer wird in Kaunas ermordet
Kaunas * Betty Landauer wird im Fort IX in Kaunas ermordet.
30. 11 1941 - Josef Staimer wird im KZ Flossenbürg ermordet
Flossenbürg * Josef Staimer wird im KZ Flossenbürg ermordet.
1. 12 1941 - Die Gestapo verbietet Juden die Verwertung ihres mobilen Eigentums
Berlin * Die Gestapo verbietet Juden den Verkauf, die Vermietung, die Verpachtung oder das Verschenken ihres mobilen Eigentums.
11. 12 1941 - Hitler erklärt Amerika den Krieg
Berlin * Reichskanzler Adolf Hitler erklärt Amerika den Krieg.
12. 12 1941 - Juden dürfen öffentliche Telefone nicht mehr benutzen
Berlin * Juden dürfen öffentliche Telefone nicht mehr benutzen.
16. 12 1941 - Das Sommerhaus der Familie Haas in Bernried wird arisiert
Bernried * Das Sommerhaus der Familie Haas in Bernried wird arisiert. Neuer Besitzer ist das „Deutsche Reich, vertreten durch den Oberfinanzpräsidenten in Berlin, erworben kraft Verfallserklärung infolge Ausbürgerung“.
1942 - Der „Lebensborn e.V.“ beschäftigt in seiner Zentrale 220 Personen
Berlin * Der „Lebensborn e.V.“ beschäftigt in seiner Zentrale 220 Personen.
Bei Kriegsende werden es insgesamt 700 Angestellte sein.
1942 - Richard-Wagner-Straße 11 wird arisiert
München-Maxvorstadt * Nach Beendigung der Deportation der Münchner Juden geht das Haus in der Richard-Wagner-Straße 11 in den Besitz des Arztes Dr. Wilhelm Holz über.
Nun können die neuen „arischen“ Mieter einziehen.
1942 - Das „Gesundheitsamt am Lilienberg“ wird umbenannt
München-Au * Das „Gesundheitsamt am Lilienberg“ wird in „Staatliches Gesundheitsamt München-Land“ umbenannt.
1942 - Erstmals gelingt die Zucht eines „Wanderfalkens“ in Gefangenschaft
Deutsches Reich * Erstmals gelingt die Zucht eines „Wanderfalkens“ in Gefangenschaft.
1942 - Lion Feuchtwanger arbeitet mit Berthold Brecht zusammen
München * Lion Feuchtwanger arbeitet zusammen mit Berthold Brecht an dem Drama „Die Geschichte der Simone Marchand“.
1 1942 - Die „Ritterspelunke“ wird an einen Herrn Reintjes vermietet
München-Hackenviertel * Die „Ritterspelunke“ von Karl,Valentin wird an einen Herrn Reintjes vermietet.
26. 1 1942 - Walter Klingenbeck wird verhaftet
München-Maxvorstadt * Walter Klingenbeck wird verhaftet.
- Er ist Mitglied einer kleinen oppositionellen katholischen Jugendgruppe, die Rundfunksender bastelt und damit oppositionelle Nachrichten verbreitet.
- Außerdem verteilten sie Flugblätter und brachten Parolen an Gebäuden an.
2 1942 - Alfred Delp nimmt Verbindungen zum „Kreisauer-Kreis“ auf
München-Bogenhausen * Im Auftrag des „Jesuiten-Ordensprovinzials“ August Rösch nimmt Alfred Delp - als Experte für Fragen der Katholischen Soziallehre, insbesondere der Arbeiterfrage - Verbindungen zum „Kreisauer-Kreis“ auf, um die Erneuerung des Staates auf der Grundlage der christlichen Soziallehre nach dem absehbaren Zusammenbruch des Dritten Reiches zu bewirken.
Die Gruppierung um Graf James von Moltke gewinnt bis 1944 an Breite.
Neben Priestern beiderlei Konfession, Offizieren, Adeligen und meist konservativen Politikern arbeiten auch Sozialdemokraten mit.
28. 2 1942 - Brian Jones, der Lead-Gitarrist der Rolling Stones, kommt zur Welt
Großbritannien * Brian Jones, der spätere Lead-Gitarrist der Rolling Stones kommt als Lewis Brian Hopkin Jones zur Welt.
3 1942 - Alfred Delp trifft sich mit Graf James von Moltke
München-Bogenhausen * Alfred Delp trifft sich zum ersten Mal mit Graf James von Moltke, dem Kopf des „Kreisauer Kreises“.
2. 4 1942 - Das Sommerhaus der Familie Haas wird arisiert
<p><strong><em>Bernried</em></strong> * Das ehemalige Sommerhaus der Familie Haas in Bernried wird an den <em>„getreuen Parteigenossen“</em> Martin Grünwald, seiner Frau und seinen vier Kindern vermietet. Der Hausrat wird anhand einer Inventarliste <em>„sichergestellt“</em>.</p>
9. 4 1942 - Der Valentin-Film „Der Sonderling“ wird von der NS-Zensur verboten
Berlin * Der Valentin-Karlstadt-Stummfilm „Der Sonderling“ aus dem Jahr 1929 wird von der NS-Zensur wegen „Verletzung des künstlerischen Empfindens“ verboten.
24. 4 1942 - Verbot der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Juden
München * Juden wird die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel verboten.
3. 5 1942 - Das „Freikorps-Denkmal“ wird an der Westseite der Ichoschule enthüllt
München-Obergiesing * Das „Freikorps-Denkmal“, ein zehn Meter hohes monumentales Monstrum, wird an der Westseite der Ichoschule enthüllt.
Es zeigt einen nackten Freikorpssoldaten, der der „Schlange der Revolution“ den Kopf zerquetscht.
Enttäuscht müssen die Machthaber feststellen, dass nur wenige Giesinger an der feierlichen Enthüllung dieses „Nackerten Lackls” oder „Schlangenkopfquetschers” teilnehmen.
15. 5 1942 - Verbot der Haustierhaltung für Juden
Berlin * Verbot der Haustierhaltung für Juden.
Ab 22. 5 1942 - Die erste Kreisauer Tagung findet statt
Kreisau * Die erste Kreisauer Tagung findet noch ohne Alfred Delp statt.
28. 5 1942 - Das Vermögen des Schülein ist dem Reich verfallen
Berlin * In der Vollstreckungsurkunde IV wird gemeldet: „Das Vermögen des Schülein ist auf Grund der elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 dem Reich verfallen.“
4. 6 1942 - Karl Valentin feiert im Ketterl seinen 60. Geburtstag
München-Lehel * Karl Valentin feiert im Ketterl seinen 60. Geburtstag. Liesl Karlstadt schreibt ihre eher unpersönlich gehaltenen Geburtstagsgrüße auf eine Autogrammkarte:
„Zum 60. Geburtstag gratuliere ich und wünsche dir alles Gute - Gesundheit und noch viele schöne Jahre. Möge dir alles in Erfüllung gehen, was du dir selbst wünscht.
Deine Partnerin Liesl Karlstadt“
9. 6 1942 - Juden müssen alle entbehrlichen Kleidungsstücke abgeben
Berlin * Juden müssen alle entbehrlichen Kleidungsstücke abgeben. Außerdem sind alle optischen und elektrischen Geräte wie Ferngläser, Fotoapparate und Kochplatten abzuliefern.
18. 6 1942 - Paul McCartney wird in Liverpool geboren
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * (James) Paul McCartney, Sänger, Bassist und Songwriter der Beatles, kommt in Liverpool zur Welt. </p>
1. 7 1942 - Rosa Braun wird nach Theresienstadt gebracht und dort ermordet
Theresienstadt * Rosa Braun aus der Maria-Theresia-Straße 23 kommt nach Theresienstadt, wo sie am 4. März 1945 umgebracht wird.
1. 7 1942 - Schulunterricht für Juden verboten
München * Jüdische Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mehr in öffentlichen Schulen unterrichtet werden.
10. 7 1942 - Der Zwickelerlass wird außer Kraft gesetzt
Berlin * Der „Zwickelerlass“ wird mit der Polizeiordnung zur Regelung des Badewesens außer Kraft gesetzt.
20. 7 1942 - Die Endlösung der Judenfrage wird beschlossen
Berlin * Auf der Wannsee-Konferenz wird die „Endlösung der Judenfrage“ beschlossen.
Ende 8 1942 - Hitlers Wohnhaus am Prinzregenten Platz 16 wird leicht beschädigt
München-Haidhausen * Bei einem Fliegerangriff wird Hitlers Wohnhaus am Prinzregenten Platz 16 leicht beschädigt.
Damals wird - unter Verwendung von 4,7 Tonnen Stahl - ein weitläufiger „Luftschutzbunker“ im Keller eingerichtet.
Ende 8 1942 - Die alliierten Angriffe aus der Luft beginnen erneut
München * Die alliierten Angriffe aus der Luft beginnen erneut.
9. 8 1942 - Edith Stein wird im Konzentrationslager Auschwitz ermordet
Auschwitz * Edith Stein, die konvertierte Dominikanerinnen-Klosterschwester Teresa Benedicta a Cruce wird im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.
29. 8 1942 - Die ersten wirklich schweren Luftangriffe über München
München * In dieser Nacht kommt es zu den ersten wirklich schweren Luftangriffen über München.
18. 9 1942 - Juden erhalten keine Fleisch-, Milch-, Raucher- und Weißbrotmarken mehr
Berlin * Juden erhalten keine Fleisch-, Milch-, Raucher- und Weißbrotmarken mehr.
20. 9 1942 - Der achte Luftangriff auf München
München * Der achte Luftangriff setzt bereits 6.000 obdachlose Menschen auf die Straße, nachdem das Bombardement ihre Wohnungen zerstört hat.
24. 9 1942 - Walter Klingenbeck wird zum Tode verurteilt
München * Walter Klingenbeck wird durch den Volksgerichtshof zum Tode verurteilt.
10 1942 - Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus.
9. 10 1942 - Juden wird der Kauf von Büchern verboten
Berlin * Juden wird der Kauf von Büchern verboten.
Ab 16. 10 1942 - Der Kreisauer Kreis beschäftigt sich mit Staat, Kirche, sozialen Fragen
Kreisau * Die 2. Kreisauer Tagung dauert bis 18. Oktober und beschäftigt sich mit den Themen: Staat, Kirche und sozialen Fragen. Dieses Mal ist der Jesuitenpater Alfred Delp dabei.
Um 11 1942 - Verbindungen zwischen dem „Kreisauer Kreis“ und dem „Sperr-Kreis“
München-Bogenhausen * Alfred Delp stellt Verbindungen zwischen dem „Kreisauer Kreis“ und dem „Sperr-Kreis“ her.
12. 11 1942 - Dr. Hermann Joseph Wehrle wird Kaplan in Bogenhausen
München-Bogenhausen * Dr. Hermann Joseph Wehrle wird Kaplan in der Pfarrei Bogenhausen.
27. 11 1942 - James Marshall „Jimi“ Hendrix wird in Seattle geboren
Seattle - Washington * James Marshall „Jimi“ Hendrix, der spätere Gitarrist und Songwriter, wird in Seattle - Washington geboren.
30. 11 1942 - In ganz Bayern leben noch 1.390 „Rassejuden“
München * Bruno Finkenscherer, der letzte Rabbiner der jüdischen Gemeinde in München schreibt: „In ganz Bayern leben noch 1.390 „Rassejuden“, davon etwa 630 in München, von denen 171 in Berg am Laim in der Heimanlage Clemens-August-Straße Nr. 9 untergebracht sind. An Glaubensjuden gibt es in München noch etwa 300.“
18. 12 1942 - Der Lebensborn in der Bürgermeistervilla
München-Bogenhausen * Dr. med. Gregor Ebner, der Geschäftsführende Vorstand des Lebensborn e.V. und ärztlicher Leiter sämtlicher Lebensborn-Heime, wohnt mit seiner Frau und den beiden jüngeren Töchtern bis zum 4. April 1943 im ersten Obergeschoss der Villa an der Ismaninger Straße 95.
Weitere Bewohner der Villa sind die Lebensborn-Mitarbeiter Ueberschaar, Taubenheim und Pröll. Die Erdgeschosswohnung nutzt der Leiter der Rechtsabteilung des Lebensborn e.V., Günther Tesch.
1943 - Die Braunauer Eisenbahnbrücke wird durch Bomben beschädigt
München-Untergiesing * Die Braunauer Eisenbahnbrücke wird durch Bomben beschädigt.
1943 - Das Einkommen des Scharfrichters Johann Reichhart ist massiv gestiegen
München * Das Einkommen des Scharfrichters Johann Reichhart ist aufgrund der zahlreichen Todesurteile innerhalb weniger Jahre in die Höhe geschnellt. Im abgelaufenen Jahr erhält der Henker zu seinem jährlichen Grundgehalt von 3.720 RM noch Sondervergütungen in Höhe von 41.748 RM zu. Alleine die Sondervergütungen für die 764 Enthauptungen betragen 35.790 RM, der Rest sind Fahrkosten und Aufwandsenschädigungen.
1943 - Charles Chayne erwirbt den Bugatti Royale vom Schrottplatz in der Bronx
New York * Der General-Motors-Ingenieur Charles Chayne erwirbt den Bugatti Royale vom Schrottplatz in der New Yorker Bronx.
1943 - Bomben zerstören das Gebäude der Kreislehrerinnenbildungsanstalt
München-Au * Das ehemalige Gebäude der Kreislehrerinnenbildungsanstalt für Oberbayern in der Frühlingstraße [heute: Eduard-Schmid-Straße] wird durch Bomben zerstört.
1943 - Der Seidenbau ist von kriegsentscheidender Bedeutung
Deutsches Reich * Der Seidenbau ist von kriegsentscheidender Bedeutung, denn: „Naturseide lässt sich nur durch Kunstseide ersetzen, wenn es sich um die Herstellung von Luxusgegenständen (Bekleidungsstücke) handelt. Sie ist unersetzlich für technische Zwecke und für den Bedarf des Heeres (Fallschirme).“
27. 1 1943 - Wilhelm Heppert wird durch den Scharfrichter hingerichtet
München-Obergiesing * Wilhelm Heppert, der die Kassiererin der Museum-Lichtspiele überfallen und die Kasse um 150 Mark erleichtert hat, wird im Strafgefängnis München-Stadelheim durch den Scharfrichter hingerichtet. Sein Leichnam wird dem Anatomischen Institut zur Verfügung gestellt.
15. 2 1943 - Das sechste Flugblatt der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“
München * Das sechste Flugblatt der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ wird fertiggestellt und versandt. Es beinhaltet den Aufruf zum „Sturz des NS-Regimes“ und fordert die Errichtung eines „neuen geistigen Europas“.
Das Flugblatt wird später in England nachgedruckt und von britischen Flugzeugen über Deutschland abgeworfen. Außerdem wird der Inhalt durch den Sender British Broadcast Corporation - BBC verbreitet.
16. 2 1943 - Der „Totale Krieg“ bringt verstärkt Bombardements
Berlin * Reichspropagandaminister Dr. Joseph Goeppels ruft im Berliner Sportpalast den „Totalen Krieg“ aus. Nun muss die Münchner Zivilbevölkerung erfahren, was Krieg wirklich bedeutet. Bis dahin gab es neun Bombenangriffe auf München. Ab diesem Zeitpunkt - bis zum 17. April 1945 - folgen noch weitere 49 Luftangriffe über der Stadt.
- So stehen bereits am 10. März 1943, nach dem zehnten Angriff, 9.000 Menschen auf der Straße,
- am 25. April 1944, dem 18. Angriff, haben schon 70.000 ihre Wohnung verloren und
- nach dem 28. Angriff sind bereits 200.000 Münchner ohne Dach über dem Kopf.
18. 2 1943 - Die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ verteilt Flugblätter in der Universität
München-Maxvorstadt * Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ verteilen etwa 1.700 Flugblätter in der Münchener Universität. Der Hausmeister, der die ganze Aktion beobachtet hat, meldet sie bei der Gestapo. Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst werden verhaftet und ins Wittelsbacher Palais gebracht.
22. 2 1943 - Todesurteile gegen Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst
München - München-Obergiesing * Nach dem dreitägigen Verhör bei der Gestapo folgt der Prozess gegen die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ vor dem Volksgerichtshof unter dem Vorsitz des eigens aus Berlin angereisten Dr. Roland Freisler.
Hans und Sophie Scholl werden gemeinsam mit Christoph Probst zum Tod verurteilt. Das Urteil wird noch am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim durch den Scharfrichter Johann Reichhart vollstreckt.
25. 2 1943 - George Harrison kommt in Liverpool zur Welt
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * George Harrison, der spätere Sänger, Leadgitarrist und Songwriter der Beatles, wird in Liverpool geboren. </p>
8. 3 1943 - Die Münchner Sinti und Roma werden verhaftet
<p><strong><em>München</em></strong> * Nach einem Erlass von Innenminister Heinrich Himmler marschieren Polizeibeamte los, um die Häuser der Sinti und Roma zu umstellen und die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen in Gefängnisse zu bringen. In München ist dies das Gefängnis der Polizei in der Ettstraße. Fünf Tage später rollen die Deportationszüge vom Güterbahnhof los.</p>
13. 3 1943 - Münchner Sinti und Roma werden nach Auschwitz-Birkenau deportiert
<p><strong><em>München - Auschwitz-Birhenau</em></strong> * 141 Münchner Sinti und Roma werden ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht: Frauen, Männer und viele Kinder. Die jüngste der Münchner Deportierten ist sechs Monate alt.</p>
23. 4 1943 - Juden wird die „deutsche Staatsangehörigkeit“ entzogen
Berlin * Juden wird die „deutsche Staatsangehörigkeit“ entzogen.
6 1943 - In München gibt es nur mehr 483 Juden
München * In München gibt es nur mehr 483 Juden.
1. 7 1943 - Deutsche Juden werden dem Polizeirecht unterstellt
Berlin * Deutsche Juden werden dem Polizeirecht unterstellt. Damit verbunden ist die Aufhebung jeglichen Rechtsschutzes. Im Todesfall eines Juden verfällt dessen Vermögen automatisch dem Deutschen Reich.
13. 7 1943 - Alexander Schmorell und Kurt Huber in Stadelheim hingerichtet
München-Obergiesing * Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber, Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, sterben im Gefängnis München-Stadelheim unter der Guillotine von Johann Reichhart.
26. 7 1943 - Mick Jagger wird geboren
Dartford * Mick Jagger, der spätere Frontmann und Sänger der Rolling Stones, wird in Dartford in der Grafschaft Kent in England, geboren.
26. 7 1943 -
31. 7 1943 - Lida Gustava Heymann stirbt in Zürich
New York * Lida Gustava Heymann stirbt in Zürich.
Um 8 1943 - Das Luftgaukommando wird nach Grünwald verlegt
München-Lehel - Grünwald * Das Luftgaukommando wird im Sommer 1943 von der Prinzregentenstraße nach Grünwald verlegt, weshalb die Gäste des Schlosshotels ausquartiert werden. Darunter auch Karl Valentin.
5. 8 1943 - Walter Klingenbeck wird in Stadelheim hingerichtet
München-Obergiesing * Walter Klingenbeck wird im Alter von 19 Jahren im Gefängnis Stadelheim hingerichtet bzw. ermordet.
7. 9 1943 - Die Obergiesinger Martin-Luther-Kirche wird von Bomben zerstört
München-Obergiesing * Die Bomben des Zweiten Weltkriegs vernichteten die Obergiesinger Martin-Luther-Kirche bis auf den Turm und die Außenmauern.
27. 9 1943 - Die Vermögenswerte der Familiengruppe Schülein sind an Berlin abzuliefern
München * Das Oberfinanzpräsidium München bestimmt, „dass zufolge Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 13.2.40 sämtliche Vermögenswerte der Familiengruppe Schülein an Berlin abzuliefern sind“.
10 1943 - Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus.
2. 10 1943 - Das Bogenhausener Schulgebäude wird durch Bomben total zerstört
München-Bogenhausen * In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober wird das Schulgebäude am Kirchplatz 3 in Bogenhausen durch Bomben total zerstört. Das Seminar und der Kindergarten wird in die Gebeleschule verlegt.
11 1943 - Karl Valentin lehnt ein Angebot des „Generalgouverneurs für Polen“ ab
München * Karl Valentin erhält von Dr. Hans Frank, dem „Generalgouverneur für Polen“ eine Einladung vor bayerisch-österreichischen Soldaten in Krakau aufzutreten.
Karl Valentin lehnt dies mit mit Hinweis auf seinen schlechten Gesundheitszustand ab.
19. 11 1943 - Der Staat erwirbt das circa 30 Hektar große Maffei-Gelände
München-Englischer Garten - Hirschau * Der Staat erwirbt auf Druck der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen das circa 30 Hektar große Maffei-Gelände um 2,5 Millionen Mark.
22. 11 1943 - Jörg Hube kommt in Neuruppin zur Welt
Neuruppin * Jörg Hube, der spätere Schauspieler, Regisseur und Kabarettist, wird in Neuruppin in Brandenburg geboren.
13. 12 1943 - Gewissensbisse zum Tyrannenmord
München-Bogenhausen * Der Wehrmachtsoffizier Ludwig Freiherr von Leonrod sucht seinen Beichtvater Dr. Hermann Wehrle in der Bogenhausener Georgs-Kirche auf. Ihn plagen Gewissensbisse, seit er von Claus Graf Schenk von Stauffenberg in die Attentatspläne auf Hitler eingeweiht worden ist. Er will wissen, wie die katholische Kirche zum „Tyrannenmord“ steht.
17. 12 1943 - Cirkus-Krone-Bau durch Bomben zerstört
München-Maxvorstadt * Gegen 21:40 Uhr wird der Zirkusbau an der Marsstraße durch Bomben zerstört und vollständig eingeäschert.
18. 12 1943 - Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones, wird geboren
Dartford * Keith Richards, Gitarrist und Songwriter der Rolling Stones, wird in Dartford in der Grafschaft Kent in England, geboren.
20. 12 1943 - Anita Augspurg stirbt in Zürich
New York * Anita Augspurg stirbt in Zürich.
Bombennächte 1944 - Der „Ostbahnhof“ wird nahezu vollständig zerstört
München-Haidhausen * Das vom Architekten Friedrich von Bürklein projektierte Gebäude des „Ostbahnhofs“ wird in den Bombennächten des Jahres 1944 nahezu vollständig zerstört und nach dem Krieg nur mehr behelfsmäßig wieder nutzbar gemacht.
1944 - Die „Ludwigskirche“ erhält schwere Bombenschäden
München-Maxvorstadt * Die „Ludwigskirche“ erhält schwere Bombenschäden.
1944 - „Gauleiter“ Paul Giesler übernimmt die Dienstvilla in der Kaulbachstraße 15
München-Maxvorstadt * Paul Giesler übernimmt nach Adolf Wagners Tod dessen Dienstvilla in der Kaulbachstraße 15 und seine Funktionen als „Gauleiter“ und Innenminister“.
1944 - Die Gebäude der „Beamten-Relikten-Anstalt“ werden zerstört
München-Bogenhausen * Die Gebäude der „Beamten-Relikten-Anstalt“, einem „Königlichen Damenstift“, wird von Bomben dem Erdboden gleich gemacht.
1944 - Die Richard-Wagner-Straße 9 geht an die Erben Pongratz
München-Maxvorstadt * Das Anwesen in der Richard-Wagner-Straße 9 gehört den Erben Pongratz.
1944 - Der gefährliche Seeweg zwischen England und USA
England - USA * Charlotte Haas schafft den gefährlichen Seeweg zwischen England und Amerika während des U-Boot-Krieges.
1944 - Eine Fliegerbombe zerstört das obere Stockwerk der Reichenbachstraße 13
München-Isarvorstadt * Eine Fliegerbombe zerstört das obere Stockwerk des Hauses in der Reichenbachstraße 13, in dem sich die „Deutsche Eiche“ befindet.
Sommer 1944 - Die „Bürgermeister-Villa“ wird so zerstört, dass sie völlig unbewohnbar ist
München-Bogenhausen * Bei einem Bombenangriff wird die „Bürgermeister-Villa“ in der Ismaninger Straße 95 in Bogenhausen soweit zerstört, dass sie völlig unbewohnbar ist.
Das „KZ-Außenkommando“ errichtet im Garten Baracken als Dienstgebäude.
Sommer 1944 - Der „Lebensborn e.V.“ muss nach Steinhöring verlagert werden
München-Kreuzviertel - Steinhöring * Der Gebäudekomplex in der Herzog-Max-Straße 3-7 wird durch Bomben so schwer beschädigt, dass der „Lebensborn e.V.“ nach Steinhöring verlagern muss.
1944 - Bei einem Bombenangriff wird das „Siegestor“ zerstört
München-Maxvorstadt - München-Schwabing * Bei einem Bombenangriff wird das „Siegestor“ zerstört.
1944 - Das alte „Schloss Biederstein“ wird durch Bomben zerstört
München-Schwabing * Das alte „Schloss Biederstein“ wird durch Bomben größtenteils zerstört.
Ab dem 1. 1 1944 - Keine Bestattungen mehr auf dem Alten Südlichen Friedhof
München-Isarvorstadt * Auf dem Alten Südlichen Friedhof dürfen keine Bestattungen mehr durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auf
- dem älteren Teil: 13.066 Gräber und 95 Grüfte,
- dem neueren Teil: 5.022 Gräber und 175 Grüfte.
14. 1 1944 - James Graf von Moltke wird verhaftet
Kreisau ? * James Graf von Moltke wird verhaftet. Dem Kreisauer Kreis fehlt seither sein Kopf.
7. 4 1944 - Gerhard Schröder wird in Blomberg geboren
Blomberg * Gerhard Schröder, der spätere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und SPD-Vorsitzende, wird in Blomberg geboren.
15. 4 1944 - Die Residenzpost wird bei Luftangriffen schwer beschädigt
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Die Residenzpost wird - mit Ausnahme von Klenzes Bogenhalle - bei Luftangriffen schwer beschädigt und brennt aus. Nur die Fassade am Max-Joseph-Platz und die barocke Hausfront an der Residenzstraße bleiben erhalten. Das Innere, samt dem <em>„schönsten Münchner Treppenhaus des Spätrokoko“</em> wird zerstört.</p>
17. 4 1944 - Ein Staatsbegräbnis für den Gauleiter Adolf Wagner
München * Zum Staatsbegräbnis von Gauleiter Adolf Wagner kommt Adolf Hitler zum letzten Mal nach München.
24. 4 1944 - Die Volksschule am Kolumbusplatz wird zerbombt
München-Au * Die Volksschule am Kolumbusplatz wird in der Nacht vom 24. zum 25. April 1944 von englischen Bombern total zerstört und danach auch nicht wieder aufgebaut.
24. 4 1944 - Die Villa Stuck wird durch weitere Bombentreffer stark beschädigt
München-Haidhausen * In der Nacht vom 24. zum 25. April wird die Villa Stuck durch weitere Bombentreffer stark beschädigt.
24. 4 1944 - Starke Zerstörungen der Anna-Klosterkirche durch Luftangriffe
München-Lehel * Bei einem Bombardement der alliierten Streitkräfte in der Nacht vom 24. auf den 25. April 1944 wird die Anna-Klosterkirche ein Raub der Flammen. Ein mehrere Tage andauernder Brand zerstört fast die gesamte Inneneinrichtung, einschließlich der Stuckaturen und der Fresken. Lediglich die Außenmauern und das Gewölbe bleiben erhalten.
Das bedeutet, dass das heutige eindrucksvolle Aussehen des Kircheninneren lediglich einen Neubau aus der Zeit zwischen 1967 und 1979 darstellt.
25. 4 1944 - Die „Bürgersaalkirche“ wird bei einem Bombenangriff zerstört
München-Kreuzviertel * Die „Bürgersaalkirche“ wird bei einem Bombenangriff zerstört.
20. 5 1944 - Joe Cocker wird in Sheffield (Großbritannien) geboren
Sheffield * Joe - eigentlich John Robert - Cocker wird in Sheffield (Großbritannien) geboren.
6 1944 - Eine Sprengbombe beschädigt den Westturm des „Reichsfinanzhofs“
München-Bogenhausen * Eine Sprengbombe beschädigt den Westturm des „Reichsfinanzhofs“ an der Ismaninger Straße.
12. 6 1944 - Eine Brandbombe zerstört das Haus Richard-Wagner-Straße 13
München-Maxvorstadt * Eine Brandbombe zerstört den Dachstuhl des Hauses Richard-Wagner-Straße 13.
Ende 7 1944 - „Scharfrichter“ Johann Reichhart muss für Hinrichtungen nach Berlin
Berlin * Um die vielen Hinrichtungen im Zusammenhang mit dem „Attentat vom 20. Juli“ vollstrecken zu können, wird der „Scharfrichter“ Johann Reichhart nach Berlin beordert.
An einem Tag erfolgen so viele Hinrichtungen, dass Reichhart und seine Gehilfen bis zum Knöchel im Blut waten.
Im Gegensatz zu Reichhart, der seine Todeskandidaten mit der „Guillotine“ hinrichtet, erhängt sein „Kollege“ Ernst Reichel, der berüchtigte „Henker und Schlächter von Berlin“, die Widerständler in Berlin-Plötzensee - auf Befehl Hitlers - an Fleischerhaken auf.
7 1944 - Das „Hotel Frankfurter Hof“ wird von Bomben schwer beschädigt
München-Ludwigsvorstadt * Das „Hotel Frankfurter Hof“ wird von Bomben schwer beschädigt, später abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.
20. 7 1944 - Ein Attentat auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier Wolfsschanze
Wolfsschanze * Das Attentat auf Reichskanzler Adolf Hitler im Führerhauptquartier Wolfsschanze und der Umsturzversuch durch Stauffenberg und seine Mitverschwörer in Berlin scheitern. Die Geheime Staatspolizei - Gestapo wird dadurch auch auf die Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis aufmerksam.
28. 7 1944 - Gestapo-Agenten nehmen Pater Alfred Delp fest
München-Bogenhausen * Gestapo-Agenten nehmen Pater Alfred Delp nach der Frühmesse in der Bogenhausener Georgskirche fest und bringen ihn ins Wittelsbacher Palais.
18. 8 1944 - „Kaplan“ Dr. Hermann Joseph Wehrle wird von der „Gestapo“ verhaftet
München-Bogenhausen - Berlin * „Kaplan“ Dr. Hermann Joseph Wehrle wird im Bogenhausener Pfarrhof von der „Gestapo“ verhaftet und im Nachtzug nach Berlin gebracht.
21. 8 1944 - Freiherrn Ludwig von Leonrod wird zum Tode verurteilt
Berlin * In der Hauptverhandlung gegen Freiherrn Ludwig von Leonrod wird Dr. Hermann Wehrle als Zeuge dem Angeklagten gegenüber gestellt. Ludwig von Leonrod wird zum Tode verurteilt.
26. 8 1944 - Freiherr von Leonrod wird hingerichtet
Berlin * Freiherr von Leonrod wird hingerichtet. In einem Gnadengesuch hat er kurz zuvor dargelegt, dass er sich „nicht an den Vorbereitungen zum 20. Juli beteiligt hätte, wenn ich durch meinen Beichtvater anders beraten worden wäre [...]. Wahrscheinlich hätte schon ein anderer Beichtvater genügt. Mein Unglück ist eben, daß ich an diesen geraten war“.
Nach dem 26. 8 1944 - Faulhabers Treueverhältnis gegenüber dem Führer
München-Kreuzviertel * Das Attentat vom 20. Juli 1944 bezeichnet Kardinal Michael von Faulhaber als „furchtbares Verbrechen“. In seiner Vernehmung vom 26. August „überschlug er sich geradezu in der Ablehnung und Verurteilung des Anschlags [...] und in seinem Treueverhältnis gegenüber dem Führer“.
13. 9 1944 - Kaplan Dr. Hermann Joseph Wehrle wird in akute Gefahr gebracht
Berlin * Das Gnadengesuch des Freiherrn von Leonrod bringt Kaplan Dr. Hermann Joseph Wehrle in akute Gefahr. Im Hauptverfahren gegen ihn wird er zum Tode verurteilt. Das Urteil wird umgehend vollstreckt.
19. 9 1944 - München erlebt den schwersten Luftangriff
München * München erlebt den schwersten Luftangriff. Er hat 7.105 Brände zur Folge.
10 1944 - Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt zum zwanzigsten Mal aus
München-Theresienwiese * Zweiter Weltkrieg. Das „Oktoberfest“ fällt zum zwanzigsten Mal aus.
11 1944 - Bomben zerstören das Gebäude des „Marianums“
München-Untergiesing * Bomben zerstören das Gebäude des „Marianums“ bis auf die Grundmauern.
Ein Teil der Arbeiterinnen kommen nach Zell bei Ebenhausen. Die Zentrale bleibt im Keller des ausgebombten Gebäudes.
Deshalb muss der Transport der Waren und Nahrungsmittel ins 22 Kilometer entfernte Zell täglich zu Fuß mit dem Leiterwagen erfolgen.
2. 11 1944 - Keith Emerson, Keyboarder und Pianist, wird geboren
Todmorden * Keith Emerson, Keyboarder und Pianist von Nice und Emerson, Lake and Palmer, wird in Todmorden, England, geboren.
22. 11 1944 - Erste Bomben treffen die Frauenkirche
München-Kreuzviertel * Erste Bomben treffen die Frauenkirche.
17. 12 1944 - Bomben beschädigen das Alpine Museum auf der Praterinsel
München-Lehel * Bomben beschädigen das Alpine Museum auf der Praterinsel.
Nach 1945 - Die Brüder Hopp strengen einen Prozess zur Auflösung der oHG an
München * Die Brüder Hopp strengen einen Prozess zur Firmenauseinandersetzung und Auflösung der „oHG“ an. Daraus entsteht für jeden eine Firma:
- Das Transhand-Möbelhaus, Inhaber Christian Hopp und
- die Transhand, Transport und Lagerei, vormals Falk & Fey, Inhaber Robert Hopp.
1945 - Ella und Toni Reichenbach werden Wirtinnen der „Deutschen Eiche“
München-Isarvorstadt * Ella und Toni Reichenbach werden Wirtinnen der „Deutschen Eiche“.
1945 - In den „Lebensborn-Heimen“ wurden etwa 8.000 Kinder geboren
Deutsches Reich und Ausland * In den „Lebensborn-Heimen“ sollen etwa 8.000 Kinder geboren worden sein, davon vor 1940 etwa 80 Prozent, nach 1940 etwa 50 Prozent „unehelich“.
Fast alle Akten und Unterlagen des „Lebensborn e.V.“ wurden vernichtet, sodass genaue Einzelheiten nur schwer festzustellen sind.
Nach 1945 - Die vereinfachten „Talare“ des „Professoren-Kollegiums“
München-Maxvorstadt * Die „Talare“ des „Professoren-Kollegiums“ an der „Akademie der Bildenden Künste“ werden nur noch in vereinfachter Form hergestellt.
Bis 1945 - Der „Schwabinger Bach“ wird zum „Eisbach“ - und umgekehrt
München-Englischer Garten - Lehel * Der Zusammenfluss aller äußeren Stadtbäche wird - bis zur Kreuzung mit dem „Eisbach“ - als „Schwabinger Bach“ bezeichnet.
Dieser Bachabschnitt wird seither „Eisbach“ genannt.
Er beginnt unter der Prinzregentenstraße mit der Vereinigung des „Stadtmühlbachs“ und des „Stadtsägmühlbachs“.
Genau umgekehrt ist es beim jetzigen „Schwabinger Bach“.
Er heißt bis 1945 „Eisbach“.
So heißt der Bachabschnitt ab der Galeriestraße nach dem Zusammenfluss von „Kögelmühlbach“ und „Kainzmühlbach“.
Ab der Kreuzung zwischen „Eisbach“ und „Schwabinger Bach“ besteht wieder die alte Namensgebung.
1945 - Die Einwohnerzahl im „Lehel“ hat sich auf 4.000 reduziert
München-Lehel * Die Einwohnerzahl im „Lehel“ hat sich auf 4.000 reduziert.
1945 - München hat 479.000 Einwohner
München * München hat 479.000 Einwohner.
7. 1 1945 - Wohnhäuser in der Richard-Wagner-Straße werden durch Bomben zerstört
München-Maxvorstadt * Die Wohnhäuser in der Richard-Wagner-Straße 1 und 3 werden in der Nacht zum 8. Januar durch Bomben zerstört. Hausnummer 5 wird beschädigt.
7. 1 1945 - Die Villa Freundlich und die Villa Klopfer durch Bomben zerstört
München-Maxvorstadt * In der Bombennacht zum 8. Januar werden die Villa Freundlich an der Brienner Straße 43 und die Villa Klopfer an der Brienner Straße 41 zerstört.
7. 1 1945 - Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 16 wird durch Bomben zerstört
München-Maxvorstadt * Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 16 wird durch Bomben zerstört, das Nebengebäude Richard-Wagner-Straße 18 erhält nur leichtere Schäden. Danach wird das geräumte Ruinengrundstück als Parkplatz benutzt.
7. 1 1945 - Das Kaufhaus Oberpollinger brennt vollkommen aus
München-Kreuzviertel * Nach mehreren Treffern brennt das Kaufhaus Oberpollinger in der Nacht zum 8. Januar vollkommen aus. Was nicht durch die Bomben zerstört ist, wird gestohlen.
Ab 9. 1 1945 - Die Hauptverhandlung gegen Alfred Delp in Berlin beginnt
Berlin * Die Hauptverhandlung gegen Alfred Delp vor dem Volksgerichtshof in Berlin beginnt. „Hitlers Blutrichter“, der Präsident des Volksgerichtshofs, Dr. Roland Freisler, führt die Verhandlung und beschimpft den Angeklagten mit den Worten:
„Sie Jämmerling, Sie pfäffisches Würstchen - und so etwas erdreistet sich, unserem geliebten Führer ans Leben zu wollen. [...] Eine Ratte - austreten, zertreten sollte man so was.“
11. 1 1945 - Alfred Delp wird zum Tode verurteilt
Berlin * Der Jesuitenpater und Pfarrer von Bogenhausen, Alfred Delp, wird wegen Hochverrats zum Tode verurteilt.
11. 1 1945 - Die Hauptverhandlung gegen Franz Sperr beginnt
Berlin * Die Hauptverhandlung vor dem Volksgerichtshof gegen Franz Sperr beginnt. Er kam durch Aussagen und Unterlagen von Mitgliedern des Kreisauer Kreises nach dem misslungenen Attentat auf Hitler in die Fänge der Gestapo.
15. 1 1945 - Arbeitsfähige Juden sollen in das Ghetto Theresienstadt
München * Alle die in einer sogenannten „Mischehe“ lebenden arbeitsfähigen Juden sollen bis zum 15. Februar per Sammeltransport in das Ghetto Theresienstadt deportiert werden.
23. 1 1945 - Franz Sperr wird hingerichtet
Berlin * Der wegen „verräterischen Unterlassens“ in einem Ringen des Reiches „um Sein und Nichtsein“ zum Tode verurteilte Franz Sperr wird hingerichtet.
27. 1 1945 - Sowjetische Truppen befreien das Konzentrationslager Auschwitz
Auschwitz * Sowjetische Truppen befreien das Konzentrationslager Auschwitz.
2. 2 1945 - Der Jesuitenpater Alfred Delp wird in Berlin-Plötzensee gehängt
Berlin * Der 37-jährige Jesuitenpater Alfred Delp wird in Berlin-Plötzensee gehängt. Seine Asche wird auf den Berliner Rieselfeldern, auf denen man die Abwässer der Metropole versickern lässt, verstreut.
19. 3 1945 - Münchens Isarbrücken sollen gesprengt werden
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Reichskanzler Adolf Hitler befiehlt: <em>„Alle militärischen, Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören“</em>. Und weiter: <em>„Entgegenstehende Weisungen sind ungültig“</em>. Für Gauleiter Paul Giesler ist nun der Zeitpunkt gekommen, alle Isarbrücken Münchens zu sprengen.</p>
20. 3 1945 - Erhard Auer stirbt auf einem Transport
Giengen * Erhard Auer stirbt auf einem Transport in Giengen an der Brenz.
30. 3 1945 - Eric Clapton wird geboren
<p><strong><em>Ripley</em></strong> * Eric Patrick Clapton wird in Ripley, Borough of Guildford, in Großbritannien geboren. Der englische Blues- und Rock-Gitarrist und -Sänger ist 20-facher <em>„Grammy“</em>-Gewinner und als einziger Musiker dreifaches Mitglied der<em> „Rock and Roll Hall of Fame“</em>. </p> <p>Clapton prägte mit seinen Bands Yardbird und Cream sowie als Solo-Musiker die Entwicklung des Bluesrocks seit den 1960er Jahren wesentlich mit. Er gilt als einer der bedeutendsten Gitarristen. </p>
Ende 4 1945 - Die „Wehrmacht“ bleibt Herr im Haus des ehemaligen „Kriegsministeriums“
München-Maxvorstadt * Die „Wehrmacht“ bleibt bis Kriegsende Herr im Haus des ehemaligen „Kriegsministeriums“, dem „Wehrkreiskommando VII“.
4 1945 - Schwere Verluste nach den Luftangriffen
München-Neuhausen * Nach fünf Luftangriffen ist von der Firma „Transhand Transport- und Handels oHG, vormals Falk & Fey“ nur mehr ein „Tempo-Dreirad-Lieferwagen“ und zwei Lagerhäuser übrig geblieben.
Ende 4 1945 - Die „Museum-Lichtspiele“ müssen kriegsbedingt schließen
München-Au * Die „Museum-Lichtspiele“ müssen kriegsbedingt schließen.
Um 4 1945 - Die Stadelheimer „Guillotine“ wird nach Straubing transportiert
Straubing * Die „Guillotine“ wird aus dem „Gefängnis München-Stadelheim“ nach Straubing transportiert.
Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner wird die Köpfmaschine - angeblich - in den Fluten der Donau versenkt - und nie gehoben.
Das Mordinstrument von Johann Reichhart soll sich nach den neuesten Recherchen im Depot der Bayerischen Nationalmuseums befinden.
Bis Ende 4 1945 - „Scharfrichter“ Johann Reichhart vollstreckt 3.009 Todesurteile
Deutsches Reich * In der Zeit von 1924 bis 1945 vollstreckt alleine der „Scharfrichter“ Johann Reichhart die Todesurteile an 3.009 Personen, darunter an 250 Frauen.
17. 4 1945 - Der 73. und letzte Luftangriff auf München
München * Der letzte und zugleich 73. Luftangriff der alliierten Bomber auf München findet statt. Bei den Luftangriffen der alliierten Truppen sind insgesamt
- 6.632 in München lebende Personen ums Leben gekommen,
- 15.800 werden verwundet.
- Rund 300.000 Münchner sind obdachlos geworden.
- Die Bevölkerungszahl Münchens geht von 824.000 im Jahr 1939 auf 479.000 im Jahr 1945 zurück.
24. 4 1945 - Bormann: „Verteidigen Sie Ihren Gau mit Rücksichtslosigkeit und Schärfe!“
Berlin - München * Reichsleiter Martin Bormann schreibt an den Münchner Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Paul Giesler ein Telegramm mit dem Inhalt: „Verteidigen Sie Ihren Gau mit Rücksichtslosigkeit und Schärfe!“
Aus München sollte ein „positives Stalingrad“ werden.
25. 4 1945 - Das Haus in Richard-Wagner-Straße 11 erhält einen Volltreffer
München-Maxvorstadt * Das Haus in Richard-Wagner-Straße 11 erhält einen Volltreffer eines späten Bombardements und muss vorübergehend vollständig geräumt werden.
Das HsNr. 13 erhält Schäden durch den Luftdruck.
29. 4 1945 - Die Wehrmacht will die Ludwigsbrücke und andere Brücken zerstören
München * Nur wenige Stunden bevor die amerikanischen Soldaten München besetzen, will ein Sprengkommando der Wehrmacht die Ludwigsbrücke zerstören.
Ihre Erhaltung verdanken wir den Überredungskünsten des Kommissars der Landespolizei, Jakob Eder.
Ungehorsame Zivilisten retten durch ihren Einsatz die Großhesseloher Brücke und Bogenhausener Brücke.
Die Grünwalder Brücke, diejenige bei Föhring und die strategisch völlig unbedeutende Bosch-Brücke am Deutschen Museum fliegen aber dennoch in die Luft.
29. 4 1945 - Das Konzentrationslager Dachau wird befreit
Dachau * Am späten Nachmittag befreien die 45. und 42. Infanterie-Division der US-Armee rund 32.000 Insassen aus 31 Nationen aus den überfüllten Baracken des Konzentrationslagers Dachau.
30. 4 1945 - Amerikanische Truppen befreien München von den Nazis
München * Auf ihrem Vormarsch gegen die „Alpenfestung“ befreien amerikanische Truppen München.
Die „Rainbow Division“ besetzt Hitlers Wohnung am Prinzregenten Platz 16.
Im Geldschrank finden die Amerikaner zwölf Exemplare der ersten Ausgabe von „Mein Kampf“ mit Autogramm, jedoch keinerlei Wertsachen und Dokumente.
30. 4 1945 - 6.000 Bombentote, 82.000 zerstörte Wohnungen, 5 Millionen Kubikmeter Schutt
<p><strong><em>München</em></strong> * Die <em>„Befreiung Münchens“</em>.</p> <p>Amerikanische Truppen marschieren in der bayerischen Landeshauptstadt ein. Die Situation der Münchner folgendermaßen dar: </p> <ul> <li>Es gibt mehr als 6.000 Bombentote.</li> <li>82.000 zerstörte Wohnungen.</li> <li>5 Millionen Kubikmeter Schutt mit einem Gesamtgewicht von 7 Millionen Tonnen. </li> <li>In 9 Stadtbezirken sind mehr als die Hälfte der Häuser zerstört.</li> <li>Hunderttausende Münchnerinnen und Münchner sind obdachlos.</li> <li>Die Münchner Straßen sind von 3.500 Bombeneinschlägen verwüstet.</li> <li>Die Gas-, Wasser-, Strom- und Telefonleitungen sind unterbrochen.</li> <li>90 Prozent der Bahnanlagen sind zerstört.</li> <li>Die Münchner Straßenbahn ist die am schwersten beschädigte in allen drei Westzonen. </li> </ul>
5 1945 - Das „Neue Rathaus“ ist ein „Hauptsitz der amerikanischen Militärregierung“
München-Graggenau * Das „Neue Rathaus“ ist ein „Hauptsitz der amerikanischen Militärregierung“.
5 1945 - Die Amerikaner finden in München nur noch 84 Juden vor
München * Als die Amerikaner Ende April 1945 München besetzen, finden sie nur noch 84 Juden vor.
Nach 5 1945 - Nach dem Krieg wird das „Marianum“ wieder aufgebaut
München-Untergiesing * Nach dem Krieg wird das „Marianum“ in der heutigen, stark bereingten Form wieder aufgebaut.
5 1945 - Müllentsorgung in in Bombentrichtern, Geländemulden und Kiesgruben
München-Untergiesing * Von den 1.350 „Harritschwägen“, die im Jahr 1939 im Dienst der „Müllabfuhr“ standen, sind bei Kriegsende fünfzig Prozent vernichtet, der Pferdebestand ist sogar um siebzig Prozent gesunken.
Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, behilft sich die Stadt mit Holzvergaser-Autos und alten Wehrmachtsfahrzeugen. Die Arbeitskräfte kommen aus anderen städtischen Stellen.
Da es sonst keine Entsorgungsmöglichkeiten gibt, lässt man den „Müll“ einfach in Bombentrichtern, Geländemulden und Kiesgruben verschwinden, die bei späteren Bauvorhaben als teuere „Altlasten“ wieder zum Vorschein kommen.
Nach 5 1945 - Die „Bäcker-Kunstmühle“ wird wieder aufgebaut
München-Untergiesing * Nach massiven Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wird die „Bäcker-Kunstmühle“ wieder aufgebaut und in das Eigentum der „Bäcker-Innung“ zurückgeführt.
Nach 5 1945 - Der „Hundemarkt“ im Obergiesinger Gasthaus „Schweizer Wirt“
München-Obergiesing * Nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert sich im Obergiesinger Gasthaus „Schweizer Wirt“ der „Hundemarkt“, auf dem nicht nur die Hunde ihren Besitzer wechseln, sondern auch illegal arbeitende Hundemetzger ihre Opfer erstehen.
Im geräumigen, viereckigen Hof der Wirtschaft gibt es Hunde aller Größen und Rassen.
Am Boden liegen Lattenroste, damit die Hunde trocken sitzen können.
Je nach Temperament - schwanzwedelnd oder phlegmatisch - erwarteten sie ihr Schicksal.
Kleinere Hunde sind in Körben untergebracht.
Trotz des warnenden Schildes „Annähern und Füttern der Hunde verboten, die Vereinsleitung übernimmt keine Haftung“, wird jedes lebende Ausstellungsstück gestreichelt.
Und die Ware informiert sich schnuppernd über die Kundschaft.
Jeden Samstag, zwischen 13 und 16 Uhr, herrscht hier ein ohrenzerreißendes Gekläffe und Gewinsel.
Hier kann hier jeder seinen „Zamperl“ verkaufen.
Man muss nur die Platzgebühr - 30 Pfennig für einen jungen, 50 Pfennig für einen Hund über sechs Monaten - bezahlen können.
Veranstalter ist der „Verein Hundebörse“, der das Geschäft bereits seit dem Jahr 1898 betreibt.
Ab 5 1945 - „Scharfrichter“ Johann Reichhart muss für die US-Militärregierung arbeiten
Bayern - Amerikanische Besatzungszone * Nach dem Einmarsch der Amerikaner in München holt man den „Scharfrichter“ Johann Reichhart aus seinem Haus im Gleißental.
Er muss jetzt für die Besatzungsmacht arbeiten und auf Befehl der amerikanischen Militärregierung bis 1947 weitere 156 Hinrichtungen vollziehen.
Den „Mastersergant“ Hazel Woods hat er in der „Kunst des schnellen Tötens am Galgen“ einzuweisen.
Woods erhängt die im „Nürnberger Prozess“ verurteilten „Hauptkriegsverbrecher“.
Ab 5 1945 - Bei der Schutträumung haben die Verkehrswege Vorrang
München * Bei der Schutträumung haben die Verkehrswege Vorrang, sodass bereits erste Straßenbahnen ihren Betrieb wieder aufnehmen können.
Die ersten Straßen werden von kriegsgefangenen deutschen Soldaten freigelegt. Diese werden unterstützt von NSDAP-Mitgliedern, die von den US-Besatzern zur Mitarbeit gezwungen werden. Ohne ihre Mithilfe bekommen sie keine Marken für Lebensmittel.
Das Münchner Stadtarchiv zählt nicht mehr als 1.500 Menschen, die sich in nennenswertem Umfang am Schutträumen beteiligt haben. Davon waren etwa 1.300 Männer und 200 Frauen.
Von diesen waren wiederum 90 Prozent zuvor in nationalsozialistischen Organisationen tätig gewesen.
2. 5 1945 - Die US-Militärregierung gliedert die „Berufsfeuerwehr“ aus der Polizei aus
München * Die amerikanische Militärregierung gliedert die „Berufsfeuerwehr“ aus der Polizei aus.
4. 5 1945 - Karl Scharnagel [CSU] wird Münchner Oberbürgermeister
München • Karl Scharnagel [CSU] wird von der amerikanischen Besatzungsmacht als Münchner Oberbürgermeister eingesetzt.
8. 5 1945 - Tag der bedingungslosen Kapitulation
Deutschland * Der Tag der bedingungslosen Kapitulation oder Tag der Befreiung vom Nazi-Terror. Der Zweite Weltkrieg ist für Deutschland verloren.
8. 5 1945 - Nur noch 64 überlebende Juden in München
München * Nur noch 64 Juden können von den US-Truppen bei Kriegsende in München „befreit“ werden.
8. 5 1945 - Rudolf von Sebottendorff ertränkt sich im Bosporus
Istanbul * Rudolf von Sebottendorff, der Führer der Thule-Gesellschaft, ertränkt sich im Bosporus, nachdem er die Nachricht von der deutschen Kapitulation erhalten hat.
11. 5 1945 - Pater Rupert Mayer kehrt nach Sankt Michael zurück
Kloster Ettal - München-Kreuzviertel * Pater Rupert Mayer kehrt nach fast fünfjähriger Abwesenheit nach Sankt Michael zurück.
12. 5 1945 - Radio München geht auf Sendung
München-Maxvorstadt * Radio München geht - von der US-Militärregierung betrieben und kontrolliert - auf Sendung.
28. 5 1945 - Fritz Schäffer wird von den Amerikanern als Ministerpräsident eingesetzt
München * Als erster Bayerischer Ministerpräsident wird auf ' Vorschlag von Kardinal Michael von Faulhaber der vorletzte Vorsitzende der Bayerischen Volkspartei - BVP, Fritz Schäffer, von den Amerikanern eingesetzt. Die Amerikaner haben den Kardinal gebeten, ihnen einen geeigneten Mann für dieses Amt zu nennen.
- Fritz Schäffer gehört zu den Gründern der Christlich-Sozialen Union - CSU, die sich als Nachfolgerin der katholischen Bayerischen Volkspartei versteht. Mit der CSU“erhält die Kirche eine politische Organisation, die ihre Belange durchsetzen hilft.
- Der Verbindungsmann zwischen Kirche und Partei ist Prälat Georg Meixner, der als Vorsitzender des kulturpolitischen Ausschusses der CSU fungiert.
Nach 6 1945 - Der „Englische Garten“ wird intensiv landwirtschaftlich genutzt
München-Englischer Garten * Der „Englische Garten“ wird noch lange Zeit nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs intensiv landwirtschaftlich genutzt.
Auf dem „Hirschanger“ werden 93.000 Kubikmeter Schutt gelagert.
Die „Schönfeldwiese“ ist von „Splitterschutzgräben“ durchzogen.
680 Bombentrichter hat der Bombenkrieg alleine im „Englischen Garten“ hinterlassen.
29. 6 1945 - Anton Graf Arco auf Valley stirbt bei einem Autounfall
Salzburg * Das Leben des Grafen Arco endet ebenso abrupt, wie sein Ruhm begonnen hat: Nach Kriegsende stirbt Anton Graf Arco auf Valley mit seinem Auto - für damalige Zeiten ein Zeichen seltenen Wohlstands - bei einem Verkehrsunfall. Kurz hinter Salzburg überholt er mit seinem Wagen ein Pferdefuhrwerk und stößt bei diesem Manöver mit einem entgegenkommenden Fahrzeug der amerikanischen Armee zusammen.
14. 7 1945 - Protest gegen Soldateneinsatz zur Trümmerbeseitigung
<p><em><strong>München</strong></em> • In einer Leserzuschrift empört sich Alfred Schwingenstein darüber, dass bei den Trümmerbeseitigungen kriegsgefangene deutsche Soldaten eingesetzt werden, während heute noch ehemalige NSDAP-Parteifunktionäre frei durch die Straßen der Stadt gehen. </p>
Um 8 1945 - Die Familie Heilmann-Stuck bezieht Dachzimmer in der „Villa Stuck“
München-Haidhausen * Die Familie Heilmann-Stuck bezieht den von den Bombardierungen verschonten Teil der Dachzimmer in der „Villa Stuck“.
7. 8 1945 - Straßen in Berg am Laim werden wieder umbenannt
München-Berg am Laim * Die Berg am Laimer Halserspitzstraße und Halserspitzplatz werden wieder in Schüleinstraße und Schüleinplatz zurück benannt.
18. 9 1945 - Wilhelm Hoegner (SPD) wird zum Ministerpräsidenten ernannt
München * Die mangelnden Bemühungen bei der Entnazifizierung führen zur Absetzung des Ministerpräsidenten Fritz Schäffer. Gleichzeitig wird Wilhelm Hoegner von der SPD zum Ministerpräsidenten ernannt.
19. 9 1945 - Bayern wird wieder zum Staat
München * Die amerikanische Militärregierung verfügt mit der Proklamation Nr. 2 die Bildung der Verwaltungsgebiete Groß-Hessen, Württemberg-Baden und Bayern, „die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden“. Die von den Amerikanern im Rahmen ihrer Demokratisierungsbestrebungen eingesetzten bayerischen Staatsregierungen stehen aber unter der Oberhoheit der US-Militärregierung für Bayern.
US-General Clay, erst stellvertretender, später oberster Militärgouverneur, schreibt später in seinen Memoiren: „Rückblickend meine ich, dass wir diese Aufgabe sicher als hoffnungslos angesehen hätten, wenn wir das chaotische Durcheinander voll überblickt hätten.“
20. 9 1945 - In der US-Besatzungszone werden politische Parteien zugelassen
München * In der amerikanischen Besatzungszone werden politische Parteien zugelassen.
10 1945 - Das „Oktoberfest“ fällt kriegsbedingt aus
München-Theresienwiese * Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs lassen die Durchführung des „Oktoberfestes“ nicht zu.
Um 10 1945 - „Galerie für Werke des 20. Jahrhunderts“ in der „Villa Stuck“
München-Haidhausen * Günther Franke richtet im ehemaligen „Bildhauer-Atelier“ der „Villa Stuck“ eine „Galerie für Werke des 20. Jahrhunderts“ ein.
3. 10 1945 - Pater Rupert Mayer gibt die Marinaische Männerkongregation ab
München-Kreuzviertel * Pater Rupert Mayer wird auf eigenem Wunsch von Kardinal Faulhaber von den Aufgaben als Präses der Marinaischen Männerkongregation entbunden.
6. 10 1945 - Die Süddeutsche Zeitung erscheint zum ersten Mal
München * Die Süddeutsche Zeitung erscheint zum ersten Mal, als erste Zeitung im Nachkriegs-Bayern. Sie umfasst acht Seiten und kostet 20 Pfennige.
16. 10 1945 - Der Turn- und Sportverein München-Ost wird neu gegründet
München-Haidhausen * Die ehemaligen Vereinsmitglieder des Turn- und Sportvereins München-Ost gründen in der Gaststätte Sedan in Haidhausen und gründeten den Verein neu. Nur wenige Monate später zählte der Verein bereits über elfhundert Mitglieder.
1. 11 1945 - Pater Rupert Mayer erleidet während der Messe einen Schlaganfall
München-Kreuzviertel * Pater Rupert Mayer erleidet während der Messe in der nicht zerstörten Kreuzkapelle in der Michaels-Kirche einen Schlaganfall, dem er wenige Stunden später im Krankenhaus Josephinum erliegt. Da ihn seine Beinprothese aufrecht stehend hält, prägen die Münchner daraufhin das Wort: „Selbst im Tod ist Pater Mayer nicht umgefallen.“
Ab 20. 11 1945 - Liesl Karlstadt spielt in dem Stück „Sturm im Wasserglas“
München * Liesl Karlstadt spielt im Volkstheater in dem Stück „Sturm im Wasserglas“.
20. 11 1945 - Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess beginnt
Nürnberg * Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess beginnt. 24 Mitglieder der NS-Führung werden von den Alliierten für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Es ist ein Medienspektakel ersten Ranges, aber kein Tribunal.
Um 12 1945 - Karl Valentin träumt von der Errichtung eines eigenen Filmateliers
Planegg * Karl Valentin träumt von der Errichtung eines eigenen Filmateliers.
Es bleibt beim Träumen.
3. 12 1945 - Johannes Timm stirbt in München
München * Johannes Timm stirbt in München.
23. 12 1945 - Provisorischer Zirkusbau an der Marsstraße eröffnet
München-Maxvorstadt * Ida Krone eröffnet einen neuen provisorischen Zirkusbau an der Marsstraße.
1946 - Den Nazigrößen wird die „Münchner Ehrenbürgerwürde“ aberkannt
München * Paul von Hindenburg, Franz Ritter von Epp, Franz Xaver Schwarz, Adolf Hitler und Hermann Göring werden die „Münchner Ehrenbürgerwürde“ aberkannt.
1946 - Die „Staatsschule für angewandte Kunst“ wird Teil der „Kunst-Akademie“
München-Maxvorstadt * Die „Staatsschule für angewandte Kunst“ wird in die „Akademie der Bildenden Künste“ eingegliedert.
1946 - Die Hörfunkserie „Es dreht sich um Karl Valentin“ wird eingestellt
München * Die Hörfunkserie des Bayerischen Rundfunks „Es dreht sich um Karl Valentin“ wird nach Protestbriefen aus Hörerkreisen nach der fünften Folge wieder eingestellt.
Nach 1946 - Die Richard-Wagner-Straße 7 geht an die „Erbengemeinschaft Schülein“
München-Maxvorstadt * Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 7 wird an die „Erbengemeinschaft Schülein“ zurückgegeben.
Um 1946 - Aus dem „Ausflugslokal Hirschau“ wird das „Parkrestaurant Hirschau“
München-Englischer Garten - Hirschau * Aus dem „Ausflugslokal Hirschau“ wird das „Parkrestaurant Hirschau“.
Auf der großen Wiese vor dem Lokal entsteht der „Luna-Park“, mit Schiffsschaukeln, Karussells und einem großen Tanzplatz.
Ab dem 1946 - Der „Bugatti Royale“ wird von Charles Chayne restauriert
München-Au - USA * Der von Ludwig Weinberger gestaltete „Bugatti Royale“ wird vom „General-Motors-Ingenieur“ Charles Chayne restauriert.
Dabei werden zahlreiche Änderungen und Eingriffe vorgenommen.
Technisch gehört dazu
- der Ersatz des einzelnen „Schebler-Vergasers“ durch eine Anlage mit vier „Strombergvergasern“ und
- die Umrüstung von mechanischen auf hydraulische Bremsen.
- Der Umbau der Bremsen erfordert andere Felgen, denn Bugatti hat die Trommelbremsen des Originals in die aus Guss-Aluminium gefertigten Felgen integriert, um die ungefederten Massen zu reduzieren.
- Charles Chayne setzt auf die neuen Stahl-Felgen eigens angefertigte, verchromte Radkappen.
Zu den äußerlichen Veränderungen gehört eine Umlackierung auf perlmutt-weiß mit schwarzen Akzenten, schwarzem Verdeck und ebensolchem Koffer.
Auch den Innenraum überarbeitet Charles Chayne nach seinen Vorstellungen.
Ab 2 1946 - Liesl Karlstadt spielt eine Rolle in dem Stück „Das schwedische Zündholz“
München * Liesl Karlstadt hat eine Rolle in dem Stück „Das schwedische Zündholz“ übernommen.
Es wird im „Volkstheater“ aufgeführt.
8. 2 1946 - Wilhelm Hoegner erhält den Auftrag für eine neue Bayerische Verfassung
<p><strong><em>München</em></strong><em> * </em>Ministerpräsident Wilhelm Hoegner, SPD, erhält den Auftrag, einen Entwurf für einen neue Bayerische Verfassung zu erarbeiten. </p> <p>Im Sitzungssaal der ehemaligen Preußischen Gesandtschaft in der Prinzregentenstraße 9 trifft sich der 21-köpfige <em>„Verfassungsausschuss der Verfassungsgebenden Landesversammlung“</em> zu insgesamt 32 Sitzungen.</p>
23. 2 1946 - Adenauer: „Die Bischöfe hätten viel verhindern können“
Bonn * Konrad Adenauer, ein entschiedener Katholik und späterer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, schreibt an Pastor Bernhard Custodis in Bonn über die Bischöfe im Dritten Reich die nachfolgenden Zeilen:
„Ich glaube, dass, wenn die Bischöfe alle miteinander an einem bestimmten Tage öffentlich von den Kanzeln aus dagegen Stellung genommen hätten, sie vieles hätten verhüten können.
Das ist nicht geschehen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Wenn die Bischöfe dadurch ins Gefängnis oder in Konzentrationslager gekommen wären, so wäre das keine Schande, im Gegenteil.
Alles das ist nicht geschehen und darum schweigt man besser.“
Ab 3 1946 - Der Gebäudeschutt wird - professionell und systematisch - geräumt
München * Der Gebäudeschutt wird - professionell und systematisch - geräumt.
Mit Baggern und Flaschenzügen werden Mauerreste zum Einsturz gebracht, Sprengfirmen und das Sprengkommando der städtischen Feuerwehr sind im Einsatz, komplizierte Manöver plant die städtische „Bauwacht“.
Mit einem Netz aus Kleinbahnen mit Dampflokomotiven und Kipploren werden die Trümmer beseitigt. Mit der „Bockerlbahn“ wird der Schutt nach Sendling, zum Luitpoldpark und aufs Oberwiesenfeld gebracht, wo die großen „Schuttberge“ entstehen.
5. 3 1946 - Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus
Amerikanische Besatzungszone * Auf Initiative des amerikanischen Militärgouverneirs Lucius D. Clay wird das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ vom Länderrat des amerikanischen Besatzungsgebiets verabschiedet. Das Gesetz regelt die Spruchkammerverfahren [= Entnazifizierungsverfahren] in Bayern, Groß-Hessen und Württemberg-Baden.
Im Laufe des Jahres 1946 wird das sogenannte „Befreiungsgesetz“ auch auf die anderen Besatzungszonen übertragen.
20. 3 1946 - Hochschule für Bildende Künste eröffnet
<p><strong><em>München</em></strong> * Das Kultusministerium erklärt die Akademie der Bildenden Künste für aufgelöst und verfügt die Eröffnung einer Hochschule für Bildende Künste. </p>
26. 3 1946 - Der Platz der Opfer des Nationalsozialismus entsteht
München-Maxvorstadt * Knapp zehn Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Zusammenbruchs des Dritten Reichs. - gibt Oberbürgermeister Karl Scharnagel - anlässlich des „Tages der Opfer des Faschismus“ - bekannt, dass das Rondell zwischen Brienner Straße und Maximiliansplatz künftig den Namen „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ tragen wird.
Seine Lage inmitten der Stadt und „vor allem die Tatsache, dass das Denkmal des großen deutschen Dichters Friedrich von Schiller trägt, der Freiheit und Menschenwürde in seinen Werken feierte“, lassen diesen Ort „als Erinnerungsstätte besonders geeignet erscheinen“.
Der Standort wird allerdings bewusst gewählt, denn schräg gegenüber - im 1944 zerstörten ehemaligen Wittelsbacher Palais an der Brienner Straße 50 - befand sich das gefürchtete Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei. Das war das Zentrum der politischen Verfolgung.
Die Länge des Platznamens macht sein Aussprechen zwar praktisch unmöglich. Doch das macht nichts, denn der Platz dient nicht als Adresse. Er ist einfach ein Verkehrsknoten mit Grünfläche. Der Form halber hat er aber trotzdem eine Postleitzahl erhalten: 80333.
11. 4 1946 - Aufruf zur freiwilligen Räumhilfe
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Stadt München ruft die Bewohner zur freiwilligen Räumhilfe auf. 4.943 Personen melden sich. Doch den Großteil der Räumarbeiten erledigen beauftragte sowie bezahlte Profis und keine Freiwilligen, auch keine <em>„Trümmerfrauen“</em>. </p>
30. 4 1946 - Die Stadt begeht den ersten „Jahrestag der Befreiung Münchens“
München * Die Stadt begeht den ersten „Jahrestag der Befreiung Münchens“.
2. 5 1946 - „Platz der Opfer demokratischer Menschenverdummung“
München-Maxvorstadt * Die Benennung des „Platzes der Opfer des Nationalsozialismus“ sorgt bei Münchnerinnen und Münchner, denen die „Befreiung“ offensichtlich als Niederlage erscheint, für Unmut.
In der Nacht zum 2. Mai wird eines der neuen Namensschilder abgeschraubt und an seiner Stelle eines mit dem Namen „Platz der Opfer demokratischer Menschenverdummung“ angebracht.
Doch nicht nur die ehemaligen Täter - auch viele andere wollen keine Diskussion über die Verbrechen.
Oberst James Kelly, „Vorsitzender der US-Verwaltung“, wünscht keine Aufarbeitung der Vergangenheit.
Obwohl seine Aufgabe die Erziehung der Münchnerinnen und Münchner hin zur Demokratie ist, meint er, es ist angebracht, von der vergangenen Zeit überhaupt nicht mehr zu sprechen und sie und ihre Ereignisse nicht mehr dauernd zu erwähnen.
Die Vorbehalte bleiben bis in die heutige Zeit.
Dennoch wird der Platz zunehmend dazu genutzt, eine Gedenkkultur in München zu etablieren.
16. 5 1946 - Uraufführung des Musicals „Annie Get Your Gun“ in New York
New York * Zu Buffalo Bills Stars gehört die gefeierte und exzellente Meisterschützin Annie Oakley. Ihr wird später das weltberühmte Musical „Annie Get Your Gun“ gewidmet. Es hat in New York Uraufführung.
6 1946 - Die „Akademie der Tonkunst“ soll in die „Villa Stuck
München-Haidhausen * Die „Akademie der Tonkunst“ soll in der „Villa Stuck" ihren Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen.
Nach einem kurzen Intermezzo im „Maximilianeum“ wird ihr die „Villa Stuck“ als neue Wirkungsstätte zugewiesen.
6. 6 1946 - Der erste frei gewählte Münchner Stadtrat der Nachkriegszeit
München-Graggenau * Der erste frei gewählte Münchner Stadtrat der Nachkriegszeit kommt im provisorisch eingerichteten Großen Sitzungssaal zusammen.
12. 6 1946 - Die Museum-Lichtspiele können wieder eröffnet werden
München-Au * Die Museum-Lichtspiele können mit dem Alfred-Hitchcock-Film „Im Schatten des Zweifels“ wieder eröffnet werden.
26. 6 1946 - Liesl Karlstadt tourt durch 56 bayerische Städte
Freistaat Bayern * Bis 30. September 1946 unternimmt Liesl Karlstadt mit dem Stück „Das schwedische Zündholz“ eine ausgedehnte Tournee durch 56 bayerische Städte.
30. 6 1946 - In Bayern finden wieder demokratische Wahlen statt
Freistaat Bayern - München-Maxvorstadt * Erstmals nach der Nazi-Diktatur finden in Bayern wieder demokratische Wahlen statt. Die CSU wird mit 109 Abgeordneten stärkste Fraktion. Der Landtag wird in der Aula der Ludwig-Maximilians-Universität tagen.
7. 8 1946 - Umbenennung in Staatliche Hochschule für Musik
München * Die Akademie der Tonkunst wird in Staatliche Hochschule für Musik umbenannt.
8. 8 1946 - Die Musikhochschule bezieht die Villa Stuck
München-Haidhausen * Die Studenten der Staatlichen Hochschule für Musik übernehmen die Villa Stuck für ihre Studienzwecke. Zeitweise sind hier bis zu 316 Studierende eingeschrieben, darunter auch - ab Oktober 1946 - Wolfgang Sawallisch.
5. 9 1946 - Freddie Mercury wird als Farrokh Bulsara in Sansibar-Stadt geboren
<p><strong><em>Sanisbar-Stadt</em></strong> * Freddie Mercury, der spätere Leadsänger und Komponist von The Queen, wird als Farrokh Bulsara in Sansibar-Stadt, im heutigen Tansania, geboren. </p>
14. 9 1946 - Auf der Theresienwiese wird ein Herbstfest eröffnet
München-Theresienwiese * Vertreter der Stadt und der Militärregierung eröffnen auf der Theresienwiese - statt des Oktoberfestes - ein Herbstfest. Statt des Märzenbieres gibt es Dünnbier. Gegen Abgabe bestimmter Marken gibt es Brote, Wurst oder Backwaren. Die nicht mehr zeitgemäßen Schießbuden sind durch Ring- und Ballwurfbuden ersetzt worden. Wiesn-Musik gibt es nur in einem der zwei Bierzelte.
Das Herbstfest ist noch kein Oktoberfest, aber der Anfang ist gemacht. Für die Landeshauptstadt ist des Herbstfest ein finanzieller Erfolg.
20. 9 1946 - Zustimmung der Verfassungsgebenden Landesversammlung
München - Freistaat Bayern • Die Verfassunggebende Landesversammlung nimmt den im Verfassungsausschuss entworfenen Text mit den Stimmen von CSU und SPD an.
21. 9 1946 - Als Ersatz für das Oktoberfest wird ein Herbstfest durchgeführt
München-Theresienwiese • Als Ersatz für das Oktoberfest wird ein Herbstfest durchgeführt.
Um 10 1946 - In die ehemalige „Lauer-Villa“ wird eine „Synagoge“ eingebaut
München-Bogenhausen * In den „Festsaal“ der ehemaligen „Lauer-Villa“ wird eine „Synagoge“ eingebaut.
Sie ist das erste jüdische Gotteshaus in München nach dem Zweiten Weltkrieg.
15. 10 1946 - Reichsmarschall Hermann Göring begeht Selbstmord
Nürnberg * Reichsmarschall Hermann Göring entzieht sich seiner Hinrichtung durch Selbstmord.
16. 10 1946 - Neun Hauptkriegsverbrecher werden hingerichtet
Nürnberg * Der Mastersergant Hazel Woods legt neun Hauptkriegsverbrechern die Schlinge um den Hals. Es sind dies
- der Außenminister Joachim von Ribbentrop;
- der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Wilhelm Keitel;
- der Chef der Sicherheitspolizei Ernst Kaltenbrunner;
- der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Rosenberg;
- der Generalgouverneur von Polen Hans Frank;
- der Innenminister Wilhelm Frick;
- der Herausgeber der antisemitischen Zeitung Der Stürmer Julius Streicher;
- der Gauleiter von Thüringen Fritz Sauckel;
- Generaloberst Alfred Jodl und
- der Reichskommissar für die Niederlande Arthur Seyss-Inquart.
Reichsmarschall Hermann Göring hat sich mit einer Zyankali-Kapsel am 15. Oktober 1946 seiner Hinrichtung durch Selbstmord entzogen.
17. 10 1946 - Liesl Karlstadt nimmt die Zusammenarbeit mit Karl Valentin wieder auf
München * Liesl Karlstadt nimmt die Zusammenarbeit mit Karl Valentin wieder auf. Zuerst mit gemeinsamen Rundfunkaufnahmen.
17. 10 1946 - Die Hauptkriegsverbrecher werden im Ostfriedhof eingeäschert
München-Obergiesing * In aller Frühe fahren Lastwagen der US-Armee am Krematorium des Ostfriedhofes vor. Ihre Fracht besteht aus zwölf Särgen, von denen zwei leer sind. Angeblich befinden sich darin die Leichen von zwölf in einem Krankenhaus verstorbenen US-Soldaten, die nun unter der Aufsicht von Offizieren eingeäschert werden sollen. Tatsächlich enthalten die Särge die Leichen von neun in Nürnberg am Tag zuvor hingerichteten Hauptkriegsverbrechern: Es sind dies:
- der Außenminister Joachim von Ribbentrop;
- der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel;
- der Chef der Sicherheitspolizei, Ernst Kaltenbrunner;
- der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg;
- der Generalgouverneur von Polen, Hans Frank;
- der Innenminister Wilhelm Frick;
- der Herausgeber der antisemitischen Zeitung Der Stürmer, Julius Streicher;
- der Gauleiter von Thüringen, Fritz Sauckel;
- der Generaloberst Alfred Jodl und
- der Reichskommissar für die Niederlande, Arthur Seyss-Inquart.
Der zehnte Tote ist der Reichsmarschall Hermann Göring, der sich am 15. Oktober 1946 seiner Hinrichtung durch Selbstmord entzogen hatte. In der Amtssprache hieß das: „Die Leiche Hermann Wilhelm Görings ist zusammen mit den Leichen der Kriegsverbrecher, die gemäß dem Urteil des Internationalen Gerichtshofes am 16. Oktober in Nürnberg hingerichtet worden sind, verbrannt und die Asche im geheimen in alle Winde verstreut worden.“
24. 10 1946 - Die Genehmigung für die Bayerische Verfassung wird erteilt
München - Freistaat Bayern * General Lucius D. Clay von der US-Army, der Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland, teilt dem Präsidenten der Landesversammlung mit, dass die Genehmigung für die Verfassung erteilt wird.
1. 12 1946 - Ein Volksentscheid über die neue Bayerische Verfassung
München * In einem Volksentscheid wird über die neue Bayerische Verfassung abgestimmt. Mit 70,6 Prozent der abgegebenen Stimmen nimmt das bayerische Volk das Gesetzeswerk an.
1. 12 1946 - Die erste Nachkriegswahl zum Bayerischen Landtag
Freistaat Bayern * Bei der ersten Wahl zum Bayerischen Landtag erhält die CSU 104 Sitze, die SPD erringt 54, die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung - WAV 13 und die FDP 9 Sitze. Dadurch kann Ministerpräsident Hans Ehard ein reines CSU-Kabinett leiten.
1. 12 1946 - Das Volk stimmt der Bayerischen Verfassung zu
München - Freistaat Bayern * In einer Volksabstimmung wird die unter der Führung des SPD-Politikers Wilhelm Hoegner ausgearbeitete Bayerische Verfassung mit einer Mehrheit von 70,6 Prozent angenommen. Die Verfassung des Freistaates Bayern regelt die Selbstständigkeit des Freistaates als Land der Bundesrepublik Deutschland.
2. 12 1946 - Das Konkordat wird in der Bayerischen Verfassung abgesichert
München * Das bayerische Konkordat aus dem Jahr 1924 wird in der Bayerischen Verfassung abgesichert.
2. 12 1946 - Wilhelm Hoegner [SPD] fertigt die Verfassungsurkunde aus
München - Freistaat Bayern * Ministerpräsident Wilhelm Hoegner [SPD] fertigt die Verfassungsurkunde aus.
4. 12 1946 - Der Ministerrat beschließt die Bayerische Verfassung
München - Freistaat Bayern * Die Bayerische Verfassung wird nach der Volksabstimmung und der Ausfertigung der Verfassungsurkunde durch Ministerpräsident Wilhelm Hoegner [SPD] im Ministerrat beschlossen.
8. 12 1946 - Die Verfassung des Freistaats Bayern tritt in Kraft
München - Freistaat Bayern * Die Bayerische Verfassung tritt mit ihrer Veröffentlichung im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft.
21. 12 1946 - Hans Ehard wird Ministerpräsident des Freistaats Bayern
München-Lehel * Hans Ehard von der Christlich Sozialen Union - CSU wird zum ersten demokratisch legitimierten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern der Nachkriegszeit gewählt. Er richtet seine Staatskanzlei in der Prinzregentenstraße 9 ein.
26. 110 1946 - Die Landesversammlung beschließt die Bayerische Verfassung
München - Freistaat Bayern * Die Bayerische Verfassung wird von der Landesversammlung mit 136 Stimmen von CSU und SPD, bei 14 Gegenstimmen von KPD, WAV und FDP beschlossen. Nun kann das bayerische Volk am 1. Dezember über die Verfassung entscheiden.
1947 - Der Theologiestudent Joseph Ratzinger studiert im Georgianum
München-Maxvorstadt * Der 22-jährige, aus Marktl am Inn stammende Theologiestudent Joseph Ratzinger beginnt im Georgianum seine Laufbahn.
1947 - In den Räumen der „Lauer-Villa“ werden „jüdische Schulen“ eingebaut
München-Bogenhausen * In den Räumen der Bogenhausener „Lauer-Villa“ wird eine „jüdische Volksschule“ und ein „hebräisches Gymnasium“ eingebaut.
Das Wohngebäude dient daneben als Wohngebäude für jüdische „Displaced Persons“.
1947 - Eine Ulmen-Krankheit vernichtet 6.000 Bäume
München-Englischer Garten * Eine Ulmen-Krankheit vernichtet im Englischen Garten 6.000 Bäume.
1947 - Den „freien Samstagnachmittag“ für Verkäufer/innen vereinbart
München * In München existiert eine Vereinbarung, die den „freien Samstagnachmittag“ für Verkäufer/innen festlegt.
Auf Bundesebene gilt noch immer die „Arbeitszeitverordnung“ aus dem Jahr 1938, die zum Samstagnachmittag keine Aussagen macht.
1947 - Bei „Oberpollinger“ wird die Verkaufsfläche erweitert
München-Kreuzviertel * Im Erdgeschoss des „Kaufhauses Oberpollinger“ sind inzwischen 600 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder hergerichtet.
Langsam werden auch die oberen Stockwerke ausgebaut.
1947 - Roderich Fick errichtet ein Gebäude für den „Beck-Verlag“
München-Schwabing * An Stelle des neuen „Schlosses Biederstein“ wird durch den Architekten Roderich Fick ein Gebäude für den „Beck-Verlag“ errichtet.
8. 1 1947 - David Bowie wird als David Robert Jones in Brixton/London geboren
Brixton * David Bowie wird als David Robert Jones in Brixton/London geboren.
14. 1 1947 - Umbenennungen von Straßen mit kolonialgeschichtlichem Hintergrund
München-Graggenau - München-Waldtrudering * Im Zuge der „Entnazifizierung der Straßennamen“ werden in München etwa 200 Straßen umbenannt. Darunter befinden sich auch Straßen mit „kolonialem Bezug“. So werden in Waldtrudering die Admiral-Hipper-Straße in Dresselstraße und die Maerckerstraße in Adelmannstraße umbenannt.
Zudem ändert man die Namenserläuterungen der Iltisstraße, der Möwestraße und der Niobestraße. Sie beziehen sich nun nicht mehr auf Kanonenboote sondern auf Tiere und Sagen.
23. 3 1947 - Die evangelische Matthäus-Notkirche wird eingeweiht
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Die evangelische Matthäus-Notkirche - Ecke Nußbaum- und Ziemssenstraße vor dem Krankenaus - wird eingeweiht. Das provisorische Gotteshaus ist eine Holzbaracke. </p>
27. 3 1947 - Der Gründungskongress des Bayerischen Gewerkschaftsbundes - BGB
München-Ramersdorf * Unter dem Motto „In der vereinten Kraft muss unsere Stärke liegen“ findet vom 27. bis 29. März 1947 in einer Großküche in der Rosenheimer Straße in München der „Gründungskongress des Bayerischen Gewerkschaftsbundes - BGB“ statt. Der „BGB“ bildet den Dachverband für insgesamt 13 Gewerkschaften.
Als Lehre aus den Erfahrungen in der Weimarer Republik ist das Prinzip der Einheitsgewerkschaft zentral: Überkonfessionell, parteipolitisch ungebunden, „ein Betrieb, eine Gewerkschaft“.
4 1947 - Aus den „Müllkutschern“ werden „Kraftfahrer“
München * Der Münchner Stadtrat beschließt, einen Teil des Fuhrparks zu motorisieren.
Die „Müllkutscher“ stellen ihre Peitsche in die Ecke; an ihre Stelle treten „Kraftfahrer“.
Bis 4 1947 - „Henker“ Johann Reichhart hat insgesamt 3.165 Todesurteile vollstreckt
München * Der „Scharfrichter“ Johann Reichhart hat seit seinem Amtsantritt am 1. April 1924 bis 1947 an insgesamt 3.165 Menschen die Todesurteile vollstreckt.
9. 4 1947 - Der später als „Tiger Willi“ bekannte Künstler wird geboren
Steinebach am Wörthsee * Wilhelm Raabe, der später unter seinem Künstlernamen „Tiger Willi“ bekannt gewordene Liedermacher wird in Steinebach am Wörthsee geboren.
11. 4 1947 - Die Bayerische Badeverordnung regelt das öffentliche Badewesen
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Bayerische Badeverordnung regelt das öffentliche Badewesen. </p>
5 1947 - Johann Reichhart wird in das „Internierungslager Moosburg“ gebracht
Moosburg * Der „Scharfrichter“ Johann Reichhart wird in das „Internierungslager Moosburg“ gebracht, wo er im Kreis der Nazi-Prominenz auf sein Verfahren warten muss.
Diese sieht in ihm einen „amerikanischen Henkersknecht“, der als „Vaterlandsverräter und Volksschädling“ den Tod verdient.
Reichhart schneidet sich die Pulsadern auf, wird gerettet und von den Nazi-Bonzen erneut verfolgt. Die Ärzte retten wieder sein Leben.
15. 5 1947 - Kardinal Michael von Faulhaber weiht die St.-Wolfgangs-Notkirche
München-Au * Kardinal Michael von Faulhaber weiht die St.-Wolfgangs-Notkirche für die Pfarrei ein, die die Brüder der Salesianer Don Boscos übernommen haben.
1. 6 1947 - Ron Wood, Gitarrist bei den Rolling Stones, wird geboren
Hillingdon * Ron Wood, späterer Gitarrist bei den Rolling Stones, wird als Ronald David Wood in Hillingdon, London geboren.
7. 6 1947 - Hedwig Kämpfer stirbt in Paris
Paris * Die Frauenrechtlerin Hedwig Kämpfer stirbt in Paris. Der Todestag ist nicht sicher. Er kann auch der 8. Juni gewesen sein.
21. 6 1947 - Karl Valentin lobt die Gstanzl vom Roider Jackl
Planegg - Weihmichl * Karl Valentin schreibt an den Roider Jackl: „Es ist nicht damit abgetan, Ihre Verse mit ‚gescherte Gstanzl‘ zu betiteln - sie sind sogar tiefe Philosophie, unterlegt mit einer bäuerlichen Melodie - und so ist es richtig.“
7 1947 - In einem Monat 112.650 Kubikmeter Schutt bewegt
München * Das Münchner „Wiederaufbaureferat“ meldet einen Rekord:
In diesem Monat werden 112.650 Kubikmeter Kriegsschutt bewegt, so viel wie noch nie.
31. 7 1947 - 112.650 Kubikmeter beseitigter Schutt
<p> <strong><em>München</em></strong> • Im Juli 1947 erreicht die Schutträumung ihren vorläufigen Höhepunkt mit 112.650 Kubikmeter beseitigtem Bombenschutt. </p>
6. 9 1947 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten wieder gemeinsam auf
München-Pasing * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten nach siebenjähriger Pause anlässlich einer geschlossenen Veranstaltung in Pasing erstmals wieder gemeinsam auf.
10 1947 - Als Ersatz für das „Oktoberfest“ wird ein „Herbstfest“ durchgeführt
München-Theresienwiese * Als Ersatz für das „Oktoberfest“ wird ein „Herbstfest“ durchgeführt.
20. 10 1947 - Der Prozess gegen den Lebensborn e.V. beginnt
Nürnberg * Der Lebensborn e.V. gilt nach dem Zweiten Weltkrieg für lange Zeit als eine der mysteriösesten Institutionen der NS-Herrschaft. Dass sein Geheimnis während des Dritten Reichs mit Erfolg gehütet werden konnte, erregt nach dem Jahr 1945 die besondere Neugier der Öffentlichkeit. Von seiner Existenz erfährt sie zum ersten Mal während des Nürnberger Prozesses gegen den SS-Gruppenführer Ulrich Greifelt, dem Chef des Stabshauptamtes beim Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, und seinen Mitangeklagten.
Der als Fall VIII aufgerufene Prozess begann am 20. Oktober 1947 und endete am 10. März 1948 mit der Verkündung des Urteils.
10. 11 1947 - Greg Lake, Sänger von Emerson, Lake & Palmer, wird geboren
Pool * Greg Lake, der spätere Bassist, Leadgitarrist, Sänger und Songwriter von Emerson, Lake and Palmer, wird in Pool, England, geboren.
11. 12 1947 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt gastieren im Bunten Würfel
München-Haidhausen * Karl Valentin und Liesl Karlstadt gastieren bis 15. Dezember im „Bunten Würfel“ in Haidhausen.
1948 - Hannes König und die „Gewerkschaft der geistig und kulturell Schaffenden“
München * Der Zeichner und Bühnenbildner für Theater und Film, Hannes König, übernimmt den Landesvorsitz der „Gewerkschaft der geistig und kulturell Schaffenden“.
1948 - Die Trümmergrundstücke der „Amper-Werke“ werden geräumt
München-Maxvorstadt * Die Trümmergrundstücke, die sich im Eigentum der „Amper-Werke“ an der Brienner Straße befinden, werden auf eigene Initiative geräumt.
1948 - Dr. Alfred Haas will sein Sommerhauses in Bernried zurück
Bernried * Dr. med. Alfred Haas stellt den „Antrag auf Rückerstattung seines Anwesens und Sommerhauses in Bernried“.
Doch die Verhandlungen mit dem „Gemeinderat“ und dem „Landratsamt“ ziehen sich über acht Jahre hin.
1948 - Der „Deutsche Alpenverein“ darf die „Praterinsel“ weiterhin mietfrei nutzen
München-Lehel - Praterinsel * Nach einem Beschluss des Münchner Stadtrats darf der „Deutsche Alpenverein - DAV“ das Gebäude des zerstörten „Alpinen Museums“ auf der „Praterinsel“ weiterhin mietfrei nutzen.
Um 1948 - Die Wiese vor dem „Parkrestaurant Hirschau“ wird zubetoniert
München-Englischer Garten - Hirschau * Die Wiese vor dem „Parkrestaurant Hirschau“ wird zubetoniert und damit in eine riesige „Parktanzfläche“ umgewandelt, wo Big-Bands aufspielten.
Herbst 1948 - Die Turbine im wieder instandgesetzten „Maffei-Kraftwerk“ geht in Betrieb
München-Englischer Garten - Hirschau * Die erste Turbine im wieder instandgesetzten „Maffei-Kraftwerk“ geht in Betrieb und liefert Strom für die Getreidemühlen der „Kunstmühle Tivoli“.
Langsam überträgt sich der Name „Tivoli“ auf das ehemalige „Maffei-Kraftwerk“.
1948 - Das „Freikorps-Denkmal“ wird sang- und klanglos abgebrochen
München-Obergiesing * Nach dem Weltkrieg wird das „Freikorps-Denkmal“ von Unbekannten sang- und klanglos abgebrochen und wahrscheinlich zerstört.
1. 1 1948 - Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten im „Simpl“ auf
München-Maxvorstadt * Karl Valentin und Liesl Karlstadt treten bis 12. Januar gemeinsam im „Simpl“ auf.
22. 1 1948 - Valentin-Karlstadt-Gastspiel im Bunten Würfel
München-Haidhausen * Karl Valentin und Liesl Karlstadt geben bis 31. Januar ein Gastspiel im Bunten Würfel an der Preysingstraße 42.
9. 2 1948 - Karl Valentin stirbt in seinem Haus in Planegg
Planegg * (Rosenmontag) Karl Valentin stirbt im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in Planegg.
11. 2 1948 - Karl Valentin wird in Planegg beerdigt
Planegg * (Aschermittwoch) Karl Valentin wird auf dem Friedhof in Planegg beigesetzt.
10. 3 1948 - Der Prozess gegen den Lebensborn e.V. endet
<p><strong><em>Nürnberg</em></strong> * Der Prozess gegen den Lebensborn e.V. endet mit der Verkündigung des Urteils. In den Prozessen konnte die Anklage den Beweis nicht erhärten, dass im Lebensborn e.V. die „gelenkte Fortpflanzung“ betrieben worden sei.</p> <p>Die Richter sprechen den Verein sogar von der Beteiligung an Verbrechen frei und bestätigten ihm seinen gemeinnützigen Zweck, wonach es Heinrich Himmler und der Lebensborn-Führung darum ging, die <em>„ledige Mutter und ihr Kind“</em> vor der Diffamierung durch die Gesellschaft zu schützen.<br /> <em>„Angestrebt wurde vielmehr, die soziale Stellung der Mutter und ihres Kindes zu erleichtern“</em>.</p>
29. 3 1948 - Die Bayernpartei - BP erhält ihre Lizenz
<p><strong><em>München</em></strong> * Mit der Lizenzierung der Bayernpartei - BP am 29. März 1948 erwächst der CSU in Bayern eine nicht ganz ungefährliche Konkurrenz. Unter der Führung von Joseph Baumgartner, der von 1945 bis 1947 der CSU angehört hatte, kämpft die Bayernpartei</p> <ul> <li>für einen selbstständigen bayerischen Staat,</li> <li>bekämpft den Bonner Zentralismus und</li> <li>lehnt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ab.</li> </ul>
5 1948 - „Solidaritäts-Kundgebungen“ für den „Staat Israel“
München-Bogenhausen * Im Garten der Bogenhausener „Lauer-Villa“ finden „Solidaritäts-Kundgebungen“ für den im Entstehen begriffenen „Staat Israel“ statt.
12. 5 1948 - Steve Winwood, Multi-Instrumentalist, wird geboren
Handsworth * Steve Winwood, Multi-Instrumentalist, Songwriter und Sänger, wird als Stephan Lawrence Winwood in Handsworth, Birmingham, England geboren.
23. 5 1948 - Pater Rupert Mayers Gebeine werden in die Bürgersaalkirche überführt
Pullach - München-Kreuzviertel * Die sterblichen Überreste von Pater Rupert Mayer werden vom Ordensfriedhof der Jesuiten in Pullach in die Bürgersaalkirche überführt und dort beigesetzt.
Nach 6 1948 - Baufirmen beseitigen in München die Trümmer
München * Die Stadt München beauftragt Baufirmen mit dem Beseitigen der Trümmer.
Bezahlt wird nach geräumter Schuttmenge und nicht nach Arbeitszeit.
6 1948 - Der „TSV München Ost“ bekommt einen Platz an der Sieboldstraße
München-Au * Nach längeren Verhandlungen stellte die Stadt München dem Traditions-Sportverein „TSV München Ost“ einen Platz an der Sieboldstraße in der Hochau zur Verfügung.
30. 6 1948 - Die Amtszeit von OB Karl Scharnagel [CSU] endet
München • Die Amtszeit von Karl Scharnagel [CSU] als Münchner Oberbürgermeister endet.
1. 7 1948 - Der Auftrag für eine Verfassungsgebende Versammlung
Frankfurt am Main * Im Verwaltungsgebäude der I.G. Farbenindustrie in Frankfurt am Main, dem Sitz des US-amerikanischen Hauptquartiers, treffen sich auf Anweisung der drei Militärgouverneure der westlichen Siegermächte die elf westdeutschen Ministerpräsidenten.
Ihnen wird - wie Befehlsempfänger - der Auftrag erteilt, bis zum 1. September 1948 eine „Verfassungsgebende Versammlung“ für die künftige Bundesrepublik Deutschland einzuberufen. Diese muss eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten schafft.
1. 7 1948 - Thomas „Dammerl“ Wimmer [SPD] wird Oberbürgermeister
München • Thomas „Dammerl“ Wimmer [SPD] wird Münchner Oberbürgermeister.
9 1948 - Als Ersatz für das „Oktoberfest“ wird ein „Herbstfest“ durchgeführt
München-Theresienwiese * Als Ersatz für das „Oktoberfest“ wird ein „Herbstfest“ durchgeführt.
Damit ist das „Oktoberfest“ seit seiner Gründung 24 Mal ausgefallen.
1. 9 1948 - Der Parlamentarische Rat nimmt seine Arbeit auf
Bonn * Der Parlamentarische Rat beginnt im Museum Alexander Koenig in Bonn mit der Formulierung des Grundgesetzes. Den elf westdeutschen Ministerpräsidenten war am 1. Juli 1948 von den drei Militärgouverneuren der westlichen Siegermächte der Auftrag für eine Verfassungsgebende Versammlung für die künftige Bundesrepublik Deutschland erteilt worden.
1. 10 1948 - Das Bayerische Rundfunkgesetz tritt in Kraft
Freistaat Bayern * Das Bayerische Rundfunkgesetz tritt in Kraft. Zwei Ziele standen bei den amerikanischen Überlegungen zur Rundfunkpolitik nach amerikanischem Vorbild im Vordergrund:
- Vermeidung von staatlicher Einflussnahme
- Dezentralisierung.
Als Vermächtnis dieser Politik vereint die ARD heute neun Rundfunkanstalten unter ihrem Dach.
15. 10 1948 - Adolf Hitlers Nachlass wird vor der Spruchkammer München geregelt
München * Um Hitlers Nachlass zu regeln, wird ein Verfahren vor der Spruchkammer München eingeleitet. Rechtsanwalt Otto Gritschneder übernimmt pro forma die Verteidigung des Ehepaares Adolf und Eva Hitler, geborene Braun, „in absentia“.
Dabei wird der „Führer“ als Hauptschuldiger eingestuft und sein gesamtes Vermögen zugunsten des Landes Bayern eingezogen. Dazu zählen auch die Autorenrechte für „Mein Kampf“.
Ein Antrag von Adolf Hitlers Schwester, Paula Wolf, auf Auszahlung des ihr im Testament des Bruders zugedachten Erbteiles wird vom Gericht abgelehnt und das Testament selbst für ungültig erklärt.
31. 10 1948 - Enthüllung der Gedenktafel an der Bogenhausener Georgskirche
München-Bogenhausen * Die Gedenktafel an Alfred Delp, Dr. Hermann Joseph Wehrle, Ludwig Freiherr von Leonrod und Franz Sperr an der Bogenhausener Georgskirche wird enthüllt.
13. 12 1948 - Der Prozess gegen den Scharfrichter Johann Reichhart beginnt
München * Der Prozess gegen den Scharfrichter Johann Reichhart vor der Spruchkammer IV beginnt. Er wird als Hauptschuldiger angeklagt und nach zweitägiger Verhandlung als „belastet“ eingestuft und verurteilt.
1949 - Keine 10.000 Mark für den Nachlass von Karl Valentin
München * Der extrem sparsame Münchner Oberbürgermeister Thomas Wimmer weigert sich für Karl Valentins Nachlass 10.000 Mark an die Witwe Gisela Fey zu zahlen.
1949 - Volkssänger-Auftritte in den Fußball-Halbzeitpausen gefordert
München * Hannes König regt an, bei Fußballspielen in der Halbzeit "Volkssänger" auftreten zu lassen.
1949 - Das „Schlossgut Kaltenberg“ wird an die Schüleins zurückgegeben
Kaltenberg * Das „Schlossgut Kaltenberg“, das mit der „Arisierung“ an die „Regierung von Oberbayern“ fiel, wird an die „Erbengemeinschaft Schülein“ zurückgegeben.
1949 - Die „Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle für den Landkreis München-Land“
München-Au * Im „Landratsamt am Lilienberg“ wird die „Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle für den Landkreis München-Land“ eröffnet.
Die rasch anwachsende Motorisierung führt zu katastrophalen Zuständen in der kurzen und schmalen Sackgasse „Am Lilienberg“.
1949 - Die Ära der „Harritschwägen“ endet endgültig
München-Untergiesing * Die Ära der „Harritschwägen“ endet endgültig.
1949 - München ist zu achtzig Prozent vom Schutt befreit
München * München ist die am besten vom Schutt befreite Großstadt in Westdeutschland.
Von 5 Millionen Kubikmetern Kriegsschutt sind bereits 4 Millionen beseitigt.
1949 - Die Umsätze des „Kaufhauses Oberpollinger“ steigen unaufhörlich
München-Kreuzviertel * Die Umsätze des „Kaufhauses Oberpollinger“ haben bereits die Umsätze der Vorkriegsjahre überschritten.
17. 1 1949 - Mick Taylor, Sologitarrist bei den Rolling Stones, wird geboren
Welwyn Garden City * Mick Taylor, der spätere Sologitarrist bei den Rolling Stones, wird als Michael Kevin Taylor in Welwyn Garden City, England, geboren.
25. 1 1949 - Die Gründung des Bayerischen Rundfunks
München * Die Gründung des Bayerischen Rundfunks - BR erfolgt durch die Übergabe einer Lizenzurkunde durch den Direktor der US-Militärregierung, Murray Van Wagoner, an den bayerischen Schriftsteller Johannes Lippl und an Rudolf von Scholtz, dem Nachkriegsbürgermeister von Passau und zugleich ersten Intendanten des Bayerischen Rundfunks.
Mit diesem offiziellem Akt wird das Ende von Radio München als einem Sender der US-Besatzungsmacht formaljuristisch besiegelt. Der Bayerische Rundfunk besitzt damit eine eigenständige Sendelizenz und kann dadurch relativ frei über Sendungsinhalte und Personalpolitik bestimmen.
28. 2 1949 - BR, der erste europäische Sender auf UKW
München * Der Bayerische Rundfunk - BR geht als erster Sender in Europa über UKW auf Sendung.
5. 3 1949 - Michael von Faulhaber erhält die Münchner Ehrenbürgerschaft
München * Die bayerische Landeshauptstadt München verleiht Kardinal Michael von Faulhaber aus Anlass seines achtzigsten Geburtstags die Ehrenbürgerschaft. Schon damals sprechen alle vom Widerstand des Erzbischofs von München und Freising. Und Landtagspräsident Michael Horlacher von der CSU schwärmt in seiner Rede vor den Abgeordneten sogar von Michael von Faulhabers „immerwährenden Eintreten für den Völkerfrieden“.
Bis 5 1949 - Etwa 750 Personen wegen Verbrechen unter dem NS-System hingerichtet
Westdeutschland * In Westdeutschland werden durch die Alliierten etwa 750 Personen wegen Verbrechen unter dem nationalsozialistischem System hingerichtet.
8. 5 1949 - Der Parlamentarische Rat beschließt die Vorlage des Grundgesetzes
Bonn * Der Parlamentarische Rat in Bonn beschließt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Es wird in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 zur Zustimmung den Volksvertretungen der beteiligten deutschen Länder vorgelegt.
20. 5 1949 - Der bayerische Landtag und die CSU lehnen das Grundgesetz ab
München - Freistaat Bayern * Nach mehr als vierzehn Stunden heftiger und leidenschaftlicher Diskussion beschließen die Abgeordneten des Bayerischen Landtags die Ablehnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Von den 174 Abgeordneten stimmen
- 64 mit „Ja“,
- 101 mit „Nein“,
- 9 „enthalten“ sich.
Die Ablehnung erfolgt aufgrund einer Empfehlung der bayerischen Staatsregierung. Große Teile der regierenden CSU empfinden das Grundgesetz in seiner vorliegenden Fassung als Angriff auf die Eigenständigkeit Bayerns.
23. 5 1949 - Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird verkündet
Bonn - Bundesrepublik Deutschland * Der Parlamentarische Rat stellt in öffentlicher Sitzung fest, dass das am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von mehr als Zweidritteln der beteiligten deutschen Länder angenommen worden ist.
Das Grundgesetz wird - nach der Ratifizierung durch alle anderen Bundesländer - in einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates verkündet. Es tritt mit Ablauf des Tages in Kraft.
24. 5 1949 - Das Grundgesetz schafft in der BRD die Todesstrafe ab
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Die Todesstrafe wird durch das Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland mit Artikel 102 abgeschafft. Zwischen 1946 bis zur Verabschiedung des Grundgesetzes werden 125 Todesurteile gefällt und davon 24 vollstreckt.
24. 5 1949 - Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland tritt in Kraft
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Seit 0:00 Uhr ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland rechtskräftig.
4. 7 1949 - Horst Seehofer wird in Ingolstadt geboren
Ingolstadt * Horst Seehofer, der spätere Bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, wird in Ingolstadt geboren.
14. 8 1949 - Ergebnis der ersten Bundestagswahl 1949
Bundesrepublik Deutschland -Bonn * Bei der Wahl zum 1. Deutschen Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem Bundeskanzler-Kandidaten Konrad Adenauer 31,0 Prozent und 139 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Kurt Schumacher erringt 29,2 Prozent der Stimmen und 131 Sitze.
- Die FDP bekommt 11,9 Prozent und 52 Sitze.
- Die DKP kommt auf 5,7 Prozent und 15 Sitze.
Insgesamt sind zehn Parteien im Deutschen Bundestag mit Abgeordneten vertreten. Konrad Adenauer [CDU] wird Bundeskanzler einer Koalition aus CDU/CSU, FDP und DP.
Seit 9 1949 - Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet nur noch alle zwei Jahre statt
München-Theresienwiese * Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet auf Wunsch des „Bauernverbandes“ nur noch im zweijährigem Rhythmus statt.
8. 9 1949 - Richard Strauss stirbt in Garmisch-Partenkirchen
Garmisch-Partenkirchen * Der Komponist und Dirigent Richard Strauss stirbt in Garmisch-Partenkirchen.
14. 9 1949 - Die Internationale Jugendbibliothek öffnet seine Pforten
München-Maxvorstadt * Die Internationale Jugendbibliothek in der Kaulbachstraße 11 öffnet seine Pforten. Sie ist das Werk der Kinderbuchautorin und Journalistin Jella Lepmann, die als Jüdin 1936 Deutschland verlassen muss.
17. 9 1949 - Der Fischgroßhändler Karl Winter erhält die Konzession für das Oktoberfest
München-Theresienwiese * Der Münchner Fischgroßhändler Karl Winter erhält die Konzession für das Oktoberfest. Er kauft von Josef Pravida den Namen Fischer-Vroni um 20.000 DMark ab. In seinem Zelt finden 250 Personen Platz.
17. 9 1949 - Ein aus Sperrholz ausgesägter Löwe ziert das Löwenbräu-Festzelt
München-Theresienwiese * Ein aus Sperrholz ausgesägter Löwe ziert das Löwenbräu-Festzelt und brüllt in kurzem Abstand: „Löööwenbrooiiii“. Max Baumeister singt das Gebrüll ein und erhält dafür 100 Mark.
17. 9 1949 - Auf der ersten Nachkriegs-Wiesn kostet die Mass Wiesn-Bier 1,70 DMark
München-Theresienwiese * Auf der ersten Nachkriegs-Wiesn kostet die Mass Wiesn-Bier 1,70 DMark. 1,5 Millionen Mass werden ausgeschenkt.
12. 10 1949 - Der Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes
München-Isarvorstadt - Museumsinsel * Mit einem Gründungskongress im Deutschen Museum wird der Deutsche Gewerkschaftsbund - DGB von 16 Branchengewerkschaften ins Leben gerufen. Der Bayerische Gewerkschaftsbund - BGB löst sich zuvor als Landesorganisation auf und geht in den DGB-Bezirk Bayern über. Das „Parlament der Arbeit“ wählt den 74-jährigen Hans Böckler zu seinen Vorsitzenden.
Mit der Gründung des DGB wird auch die politische Spaltung der Arbeiterbewegung aus der Weimarer Republik überwunden. Nun gilt das Prinzip der Einheitsgewerkschaft, also einer parteipolitisch neutralen Organisation, die sich ausschließlich um Fragen der Arbeitnehmer*innen widmet.
29. 10 1949 - Das große „Rama Dama“
München * Auf Anregung der amerikanischen Besatzungsmacht findet der „Tag der freiwilligen Mitarbeit der Bürger“ für eine konzertierte Schutträumaktion statt. Unter Leitung des Münchner Oberbürgermeisters Thomas Wimmer sollen alle Schutthaufen, die bei den behördlich organisierten Räumungsaktionen bis dahin übersehen worden waren, entfernt werden.
Rund 7.000 Münchner helfen mit. Die Freiwilligen räumen etwa 15.000 Kubikmeter Schutt weg. Das liegt jedoch hinter der Leistung, die täglich von den Profis beseitigt werden. Die Aktion geht als „Rama Dama“ (wir räumen auf) in die Geschichte ein.
11 1949 - Das Urteil gegen Johann Reichhart wird abgemildert
München * Das Urteil gegen den ehemaligen „Scharfrichter“ Johann Reichhart wird abgemildert.
10. 11 1949 - Kirchenpfleger Huber wird von einem Rippenstück erschlagen
München-Haidhausen * Der Kirchenpfleger Huber wird in der neuen Sankt-Johann-Baptist-Kirche in Haidhausen von einem herabfallenden Rippenstück erschlagen.
1950 - Beim „Togalwerk“ wird der 100. Mitarbeiter eingestellt
München-Bogenhausen * Beim „Togalwerk“ wird der 100. Mitarbeiter eingestellt.
1950 - Aus dem Gasthaus „Zum Ellwanger“ wird „Zu den vier goldenen Äpfeln“
München-Haidhausen * Das ehemalige Gasthaus „Zum Ellwanger“ in der Kirchenstraße in Haidhausen wird in „Zu den vier goldenen Äpfeln“ umbenannt.
Seit 1950 - Dr. Hermann Schülein besucht jeden Sommer „seine Heimatstadt München“
München * Zwischen 1950 und 1970 besucht Dr. Hermann Schülein jeden Sommer „seine Heimatstadt München“ und pflegt seinen großen Freundeskreis.
1950 - Die „Paläontologische Staatssammlung“ in der Richard-Wagner-Straße 10
München-Maxvorstadt * Das Gebäude an der Richard-Wagner-Straße 10 wird neuer Sitz der - in der „Alten Akademie“ ausgebombten - „Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie“ sowie einiger „Institute der Ludwig-Maximilian-Universität München“.
1950 - Die „Nicolai-Kirche“ am Gasteig wird Außen renoviert
München-Haidhausen * Die „Nicolai-Kirche“ am Gasteig wird Außen renoviert.
1950 - Der bundesdeutsche Pro-Kopf-Verbrauch an Bier liegt bei 36 Liter
Bundesrepublik Deutschland * Der bundesdeutsche Pro-Kopf-Verbrauch an Bier liegt bei 36 Liter.
1950 - Der „Hofblumen-Treibgarten“ wird aufgelöst
München-Lehel - Englischer Garten * Der „Hofblumen-Treibgarten“ an der Oettingenstraße wird aufgelöst.
1950 - Der Sohn des „Scharfrichters“ Johann Reichhart nimmt sich das Leben
München * Hans Reichhart, der 23-jährige Sohn des „Scharfrichters“ Johann Reichhart, nimmt sich das Leben.
Die Demütigungen die er ertragen musste und die Schande, die der Beruf des Vaters über die Familie gebracht hat, haben ihn verzweifeln lassen.
Ab 1950 - Dieter Hildebrandt studiert München
München-Maxvorstadt * Dieter Hildebrandt kommt nach München, um hier an der „Ludwigs-Maximilian-Universität“ Literatur- und Theaterwissenschaften sowie Kunstgeschichte zu studieren.
1950 - München hat 831.937 Einwohner
München * München hat 831.937 Einwohner.
7 1950 - Das Gebäude in der Richard-Wagner-Straße 5 wird restauriert
München-Maxvorstadt * Das Gebäude in der Richard-Wagner-Straße 5 wird entsprechend der Bauform von 1900 restauriert.
7 1950 - Der Neubau für die „Amper-Werke Elektrizitäts AG“ an der Brienner Straße
München-Maxvorstadt * Der Neubau für die „Amper-Werke Elektrizitäts AG“ an der Brienner Straße/Ecke Richard-Wagner-Straße wird in Angriff genommen.
Architekt ist Heinz Schilling.
2. 8 1950 - Die Schack-Galerie kann wieder geöffnet werden
München-Lehel * Da die ehemalige Preußische Gesandtschaft im Zweiten Weltkrieg glimpflich davon gekommen war, kann die Schack-Galerie als eines der ersten Museen Münchens wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden.
9 1950 - Der Querbau im „Kaiserhof“ für den „Wintergarten
München-Graggenau * Der Querbau im „Kaiserhof“ der Residenz, der für den „Königlichen Wintergarten“ Ludwigs II. erbaut worden war, wird abgerissen.
16. 9 1950 - „Der Zauber des Wilden Westens“ auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese * „Der Zauber des Wilden Westens“ setzt die Tradition der Völkerschauen auf dem Oktoberfest fort.
16. 9 1950 - Oberbürgermeister Thomas Wimmer zapft das erste Wiesn-Fass an
München-Theresienwiese * Oberbürgermeister Thomas Wimmer zapft in der Schottenhamel-Festhalle das erste Wiesn-Fass an. Er braucht dazu 17 Schläge. Es gibt hier übrigens - bis 1952 - Hofbräuhaus-Bier.
16. 9 1950 - Der Gummi-Masskrug vor dem Winzerer-Fähndl-Festzelt
München-Theresienwiese * Der Gummi-Masskrug vor dem Winzerer-Fähndl-Festzelt ist mit Helium gefüllt.
16. 9 1950 - Die Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl bezieht ein Bierzelt
München-Theresienwiese * Die Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl bezieht ein mit eigenem Geld finanziertes Bierzelt, das rund 500 Plätze fasst. Das Bierlieferungsrecht erhält die Paulaner-Thomas-Brauerei.
20. 10 1950 - Thomas Earl „Tom“ Petty wird in Gainesville in Florida geboren
Gainesville * Thomas Earl Petty, der spätere Frontman von Tom Petty & The Heartbreakers, wird in Gainesville in Florida geboren.
1. 11 1950 - Papst Pius XII. verkündet das vierte und bisher letzte Marianische Dogma
Vatikan * Der frühere päpstliche Nuntius in München, Eugenio Pacelli, verkündet als Papst Pius XII. das vierte und bisher letzte Marktnische Dogma. Es lautet: „Maria wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen.“
26. 11 1950 - Die CSU muss eine verheerende Niederlage hinnehmen
Freistaat Bayern * Bei der Landtagswahl am 26. November 1950 muss die CSU eine verheerende Niederlage hinnehmen:
- Nur 27,4 Prozent der Stimmen entfallen auf die CSU, während die Bayernpartei 17,9 Prozent erhält.
- Die SPD wird mit 28 Prozent der Stimmen zur stärksten Partei.
- Obwohl sie 60.000 Stimmen mehr als die CSU erhält, bleiben die Christsozialen aufgrund von Überhangmandaten trotzdem die stärkste Fraktion.
Hans Ehard bildet eine Koalitionsregierung aus CSU, SPD und dem rechts stehenden Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten - BHE.
12. 12 1950 - Die Familie Schülein verzichtet auf ihre Grundstücke
München-Berg am Laim * Die Familie Schülein verzichtet vor der Wiedergutmachungsbehörde Oberbayern offiziell auf die Rückgabe ihrer Grundstücke in Berg am Laim.
14. 12 1950 - Hitlers persönliche Habe wird entdeckt
München-Haidhausen * Hitlers persönliche Habe wird entdeckt, nachdem seine Haushälterin Anni Winter die persönliche Hinterlassenschaft ihres Arbeitgebers für 180.000 DMark zum Kauf anbietet. Einer der Kaufinteressenten ist jedoch ein getarnter Beamter der Kriminalpolizei.
17. 12 1950 - Die Arbeit des Zentralkommitees der befreiten Juden wird eingestellt
München * Die Arbeit des Zentralkommitees der befreiten Juden wird eingestellt.
28. 12 1950 - Der US-Landeskommissar George Schuster ehrt Faulhaber
München * Der US-Landeskommissar George Schuster gibt einen Empfang zu Ehren des Kardinals und erklärt, dass Michael von Faulhaber in seinen Predigten „seine kompromißlose Opposition gegen dieses Regime verkündet und vielen Deutschen auf diese Weise neue Kraft für ihren Kampf gegeben“ habe.
1951 - Das „Bayerische Landesinstitut für Arbeitsschutz“ an der Pfarrstraße
München-Lehel * Umbenennung des „Sozialen Landesmuseums“ an der Pfarrstraße in „Bayerisches Landesinstitut für Arbeitsschutz“.
1951 - Der „ADAC“ spricht sich gegen Geschwindigkeitskontrollen aus
München * Der „ADAC“ spricht sich gegen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei und die Verfolgung der Raser aus.
1951 - Gisela Fey verkauft Teile ihres Planegger Grundstücks
Planegg * Gisela Fey verkauft Teile ihres Planegger Grundstücks an den Bauunternehmer Leonhard Rupp, als sie nach Karl Valentins Tod in finanzielle Not geraten war.
1951 - „Die Jugendstreiche des Knaben Karl“ erscheinen
<p><strong><em>München</em></strong> * Gerhard Pallmann gibt eine Zusammenstellung aus Karl Valentins Nachlass unter dem Titel <em>„Die Jugendstreiche des Knaben Karl“ </em>heraus.</p>
1951 - Das „Gesetz über Wohnungseigentum“ ermöglicht Eigentumswohnungen
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Das „Gesetz über das Wohnungseigentum“ ermöglicht den Wunsch nach einer „dinglichen Sicherung von Wohnräumen für den Wohnungsinhaber“.
Damit besteht erneut die Möglichkeit der Teilung von Gebäuden in „Brucheigentum“.
1951 - Das „Ruinengrundstück“ der ehemaligen „Klopfer-Villa“
München-Maxvorstadt * Das „Ruinengrundstück“ der ehemaligen „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41 gehört dem „Freistaat Bayern“.
1951 - Der „Franziskusverein“ eröffnet die „Privatklinik Dr. Haas“
München-Maxvorstadt * Nachdem die Familie Dr. Alfred Haas nach dem Krieg ihr Eigentum wieder zurückbekommen hat, verkaufen sie die Klinik in der Richard-Wagner-Straße 17 und 19 an den „Franziskus-Verein“ aus Wil in der Schweiz.
Die „Franziskanerinnen“ betreiben das Krankenhaus unter dem Namen „Privatklinik Dr. Haas“.
Die Schwestern wohnen im obersten Stockwerk des Hauses Richard-Wagner-Straße 15.
1951 - „Radio Free Europa“ sendet aus dem ehemaligen „Hofblumen-Treibgarten“
München-Lehel - Englischer Garten * „Radio Free Europa“ sendet aus dem ehemaligen „Hofblumen-Treibgarten“ an der Oettingenstraße.
1951 - Auflassung der „Hofbaumschule“ an der Königinstraße
München-Lehel - Englischer Garten * Auflassung der „Hofbaumschule“ an der Königinstraße.
Ab dem Jahr 1951 - Studentenwohnheime mit amerikanischen Spenden
München-Schwabing * An der Stelle des alten „Schlosses Biederstein“ entstehen - durch amerikanische Spenden - Studentenwohnheime.
Seit etwa 1951 - Der „Cowboy Club München Süd“ besitzt seine eigenen Pferde
München * Der „Cowboy Club München Süd“ besitzt seine eigenen Pferde.
1951 - Josephine Baker gegen Rassendiskreminierung
<p><strong><em>Florida</em></strong> • Josephine Baker kehrt trotz heftigen, rassistischen Anfeindungen regelmässig in ihre alte Heimat auf der anderen Seite des Atlantiks zurück.</p> <p>1951 gelingt es ihr, die Türen eines der berühmtesten Nachtklubs von Florida, des <em>„Copa City“</em>, auch für ein schwarzes Publikum zu öffnen: Baker besteht darauf, nur aufzutreten, wenn es keine Rassendiskriminierung beim Publikum mehr gibt - und öffnete damit erstmals einen weißen Nachtklub für alle Amerikaner. </p>
28. 1 1951 - Das neue Residenztheater wird eröffnet
<p><strong>München-Graggenau</strong> * Das neue Residenztheater wird feierlich eröffnet. </p>
14. 2 1951 - Der Papst verbietet „Das Kapital“
<p><strong><em>Rom</em></strong> * Der Vatikan verbietet allen katholischen Christen, <em>„Das Kapital“</em> von Karl Marx zu lesen.</p>
8. 5 1951 - Rudolf Hartbrunner wird geboren
13. 6 1951 - Kardinal Michael von Faulhaber eröffnet Anna-Klosterkirche wieder
München-Lehel * Nachdem die Anna-Klosterkirche „für den praktischen Gebrauch“ weiß getüncht worden ist, kann sie Kardinal Michael von Faulhaber feierlich wiedereröffnen.
2. 7 1951 - Professor Dr. Ernst Ferdinand Sauerbruch stirbt in Berlin
Berlin * Professor Dr. Ernst Ferdinand Sauerbruch stirbt in Berlin.
12. 7 1951 - Gründung des Vereins zum Wiederaufbau des Chinesischen Turms
München - Englischer Garten * Gründung des „Vereins zum Wiederaufbau des Chinesischen Turms“.
22. 9 1951 - Die Augustiner-Brauerei schenkt ihren Edelstoff aus
München-Theresienwiese • Bis 1951 ist das Märzenbier das ausschließliche Wiesnbier, bis die traditionsbewusste Augustiner-Brauerei ihren Edelstoff ausschenkt. Das höher vergorene, schlankere und süffigere Getränk erobert - in haustypischer Abwandlung der jeweiligen Brauerei - ein Wiesnzelt nach dem anderen.
22. 9 1951 - Die Bräurosl bekommt ein neues Zuhause
München-Theresienwiese • Die Bräurosl bekommt ein neues Zuhause.
22. 9 1951 - Das Winzerer-Fähndl-Festzelt bekommt einen Turm
München-Theresienwiese • Das Winzerer-Fähndl-Festzelt bekommt einen Turm.
17. 12 1951 - Die Feuerwache 5 an der Anzinger Straße wird bezogen
München-Berg am Laim * Die Feuerwache 5 an der Anzinger Straße wird bezogen.
21. 12 1951 - Das Deutsche Theater wird provisorisch wiedereröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Das Deutsche Theater wird nach seinem provisorischen Wiederaufbau als eine Mischung aus Unterhaltungstheater und Festsaal wiedereröffnet. Es steht inzwischen unter städtischer Aufsicht. Neuer Theaterleiter ist Paul Wolz.
1952 - Das „Kindergärtnerinnen-Seminar“ zieht in die Räume der „Lauer-Villa“
München-Bogenhausen * Das „Kindergärtnerinnen-Seminar“ zieht in die Räume der ehemaligen „Lauer-Villa“ in Bogenhausen.
1952 - Karl Pilotys Monumentalgemälde „Monachia“ entfernt
München-Graggenau * Karl Pilotys Monumentalgemälde „Monachia“ im „Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses“ wird wegen technischer Umbauarbeiten abgehängt und durch einen historischen Gobelin ersetzt.
1952 - Liesl Karlstadt als „Mutter Brandl“ in einer BR-Sendereihe
München * Der Bayerische Rundfunk startet unter dem Titel „Der Haushaltslehrling“ eine neue Sendereihe mit Liesl Karlstadt als „Mutter Brandl“.
Die Sendung läuft jeden Donnerstag und wird ein Riesenerfolg.
1952 - Die „Haidhauser Klause“ in der Kirchenstraße
München-Haidhausen * Das Gasthaus „Zu den vier goldenen Äpfeln“ in der Haidhauser Kirchenstraße heißt jetzt „Haidhauser Klause“.
Später wird daraus das „Birdland“, eine Soul-Kneipe mit Live-Bands.
1952 - Die „Propyläen am Königsplatz“ werden grundlegend renoviert
München-Maxvorstadt * Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg werden die „Propyläen am Königsplatz“ 1952 und 1960 grundlegend renoviert.
1952 - Ein weltweit gültiges „Welturheberrechtsabkommen
Welt * Weltweit werden Urheberrechte durch ein „Welturheberrechtsabkommen" geschützt.
1952 - Der „Schwabinger Bach
München-Englischer Garten - Schwabing * Wegen der Erweiterung der „Tierärztlichen Fakultät" muss der „Schwabinger Bach" im „Englischen Garten" verlegt werden.
1952 - Gründung des „Vereins Brauerei-Museum“
München * Der „Verein Brauerei-Museum“ wird gegründet.
Bis ihm das „Münchner Stadtmuseum“ im Jahr 1963 den Platz zur Verfügung stellen kann, sammelt der Verein Anschauungsmaterial, Geräte, Modelle, Pläne, Fachliteratur, Urkunden und eine Vielzahl bildlicher Darstellungen.
27. 3 1952 - Attentat auf Bundeskanzler Konrad Adenauer
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Im Polizeipräsidium an der Ettstraße explodiert ein an Bundeskanzler Konrad Adenauer [CDU] adressiertes Päckchen. Dabei wird der Polizeibeamte Karl Reichert getötet. </p>
12. 6 1952 - Kardinal Michael von Faulhaber stirbt
München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber stirbt. Der Tod der nicht unumstrittenen Persönlichkeit ruft bei den Gläubigen Münchens nicht nur Bestürzung hervor.
Nach dem 12. 6 1952 - Die Münchner Jüdische Zeitung würdigt Faulhabers Eintreten
München * Es ist und bleibt ein ewiges Rätsel, warum ausgerechnet die Münchner Jüdische Zeitung zum Schluss kommt, dass Kardinal Michael von Faulhaber an dem denkwürdigen 3. Dezember 1933 „gegen den Rassenwahn der nationalsozialistischen Machthaber so furchtlos Stellung nahm“.
8. 7 1952 - Der erste Zebrastreifen Deutschlands in der Neuhauser Straße
München-Kreuzviertel * Straßenarbeiter bringen in der Neuhauser Straße den ersten Zebrastreifen Deutschlands auf die Fahrbahn.
23. 7 1952 - Das Maffei-Gelände wird in den Englischen Garten einbezogen
München-Englischer Garten - Hirschau * Das 30 Hektar große Maffei-Gelände wird in den Englischen Garten einbezogen.
8 1952 - Nur die „Münchner Großbrauereien“ sollen zum Oktoberfest
München-Theresienwiese * Im Zusammenhang mit der geplanten Eintragung der Bezeichnung „Wiesen-Bier“, „Wiesen-Märzen“ und „Münchner Oktoberfestbier“ als geschütztes Warenzeichen beim Patentamt bemüht sich der „Verein Münchener Brauereien e.V.“, dass zum „Oktoberfest“ nur die „Münchner Großbrauereien“ zugelassen werden.
9. 8 1952 - Joseph Wendel zum 9. Erzbischof von München und Freising ernannt
Rom-Vatikan * Papst Pius XII. ernennt Bischof Joseph Wendel zu Michael von Faulhabers Nachfolger als 9. Erzbischof von München und Freising. Joseph Wendel gilt als ein gemäßigter Konservativer.
20. 9 1952 - Das Hofbräuhaus-Festzelt ist erstmals auf der Wiesn
München-Theresienwiese * Das Hofbräuhaus-Festzelt ist erstmals auf der Wiesn.
20. 9 1952 - Der Löwenbräu-Löwe erhält einen Maulkorb
München-Theresienwiese * Der Oktoberfestausschuss des Münchner Stadtrats erteilt dem Löwen auf dem Löwenbräu-Festzelt einen Maulkorb, nachdem die sieben großen Wiesnbrauereien vereinbarten, dass akustische Brauerei-Reklame unzulässig sei. Der Löwe bleibt daraufhin stumm und wird von der Löwenbrauerei mit einem gigantischen Schloss hinter einer Glasscheibe dekoriert.
Seit 20. 9 1952 - Der Oberbürgermeister als Mitfahrer und mit eigener Kutsche
München-Theresienwiese * Der Münchner Oberbürgermeister fährt beim Wiesn-Einzug der Festwirte und Brauereien in der Kutsche der Festwirtsfamilie Schottenhamel mit. Beim Trachtenumzug fährt er dagegen in einer eigenen Kutsche mit.
1953 - Karl Valentins Nachlass kommt ins „Theatermuseum im Schloss Wahn“
Köln-Wahn * Karl Valentins Nachlass kommt in das „Theatermuseum im Schloss Wahn“ bei Köln.
Mit Recht spotten die Kölner noch heute über das „engstirnige und kleinkarierte Verhalten“ der „Münchner Kulturbeauftragten und Stadtoberen“.
1953 - Jella Lepmann und ihre „Jugendbibliothek“ in der Kaulbachstraße 11
München-Maxvorstadt * Jella Lepmann eröffnet in ihrer „Jugendbibliothek“ in der Kaulbachstraße 11 eine Ausstellung von Kinderzeichnungen aus Israel.
1953 - Dr. Hermann Schülein und die „Liebermann-Rheingold-Brauerei“ in New York
New York * Dr. Hermann Schülein, der ehemalige „Generaldirektor der Löwenbräu AG“, übernahm in New York die Funktion des „managing directors“ der „Liebermann-Rheingold-Brauerei“.
Ihr Bierausstoß liegt im Jahr 1953 bei 3,5 Millionen Hektoliter und hat „Löwenbräu“ weit überflügelt.
1953 - Die Familie Bernheimer verkauft ihr Grundstück an der Friedenstraße 40
München-Berg am Laim * Die Familie Bernheimer verkauft ihr Grundstück an der Friedenstraße 40 an die private „Milchhof München GmbH“.
Das Areal war in der NS-Zeit „arisiert“ und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben worden.
1953 - Der „Schuttberg am Hirschanger“ ist abgetragen
München-Englischer Garten * Der „Schuttberg am Hirschanger“ ist abgetragen.
1953 - Verheiratete Frauen dürfen ein Bankkonto eröffnen
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Verheiratete Frauen dürfen ein Bankkonto eröffnen.
1953 - Dieter Hildebrandt legt am „Residenztheater“ die Prüfung ab
München-Graggenau * Dieter Hildebrandt legt am Münchner „Residenztheater“ die Prüfung der Schauspieler-Genossenschaft ab.
1953 - Aufbau eines zukunftsorientierten internationalen Fernmeldenetzes
Bundesrepublik Deutschland * Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es an den Aufbau eines zukunftsorientierten internationalen Fernmeldenetzes.
Ein wichtiger Schritt dazu ist das „Edelmetall-Motordrehwähler-System“ der Firma „Siemens“.
Dem elektromagnetischen folgt das „Elektronische Wählsystem“, das zum digitalen System führt.
12. 1 1953 - Joseph Wendel wird zum Kardinal ernannt
Rom-Vatikan - München-Kreuzviertel * Erzbischof Joseph Wendel erhält die Kardinalswürde übertragen.
Vor dem 24. 4 1953 - Gegen die Öffnung der Läden auch am Samstagsnachmittag
München * Einige Münchner Firmen, darunter C&A Brenninkmeyer und Salamander, wollen ihre Läden auch am Samstagsnachmittag nach 14:00 Uhr offen halten. Dagegen wehren sich die Gewerkschaften und rufen zu Protesten auf.
25. 4 1953 - Tausende demonstrieren vor dem Münchner Gewerkschaftshaus
München-Ludwigsvorstadt * Mehrere tausend Verkäuferinnen und Verkäufer demonstrieren vor dem Münchner Gewerkschaftshaus für einen „freien Samstagsnachmittag“.
1. 5 1953 - Protestzug mit Transparenten zum „freien Samstagsnachmittag“
München-Maxvorstadt * Im Anschluss an die „Mai-Kundgebung“ des „Deutschen Gewerkschaftsbundes - DGB“ auf dem Königsplatz bewegt sich ein Protestzug mit Transparenten zum „freien Samstagsnachmittag“ durch die Luisenstraße in Richtung Bahnhofsplatz.
Da sich der Protestzug nach der polizeilichen Aufforderung nicht auflöst, greift die Staatsmacht auf der Höhe des „Luisenbunkers“ mithilfe eines „Wasserwerfers“ ein.
Die mit Stahlhelm und Karabiner bewaffnete „Bereitschaftspolizei“ löst mit Kolbenhieben den Protestzug auf.
Vom Wasserwerfer gejagt bricht der 59-jährige Bahnangestellte Georg Bachl an der Ecke Luisen-/Prielmayerstraße tot zusammen.
13. 6 1953 - Kundgebung für den Samstag-Nachmittag-Ladenschluss
München * Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen - HBV und die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft - DAG haben zur Kundgebung für den Samstag-Nachmittag-Ladenschluss aufgerufen.
Der Protestmarsch bewegt sich vom Arbeitsamt in der Maistraße über den Sendlinger-Tor-Platz zum Stachus und von dort weiter in die Altstadt, wo er sich in der Kaufingerstraße vor C&A Brenninkmeyer staut. Demonstranten blockieren im Inneren des Geschäfts die neumodernen Rolltreppen.
20. 6 1953 - 10.000 Münchner protestieren gegen die Samstagsöffnung
München * Die Firmen C&A Brenninkmeyer und Salamander halten ihre Geschäfte - wie angekündigt - auch an diesem Samstag bis 17:00 Uhr offen. Etwa 10.000 Münchner protestieren gegen diese Maßnahme. Es kommt zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen.
Vier Hundertschaften der Bayerischen Bereitschaftspolizei - wieder mit Stahlhelm und Karabiner bewaffnet - versuchen unter Zuhilfenahme eines Wasserwerfers die Aufständischen zu vertreiben. Die Protestierer flüchten zwar beim Anblick des Wasserwerfers, doch wenn dieser nach fünf Minuten wieder zum Befüllen der Wassertanks in die Ettstraße fahren muss, sind die Demonstranten schon wieder da.
Nach Auffassung der Polizei ist der Wasserwerfer „das humanste Zwangsmittel der Polizei, er schafft keine Märtyrer, wie das vielleicht beim Gebrauch des Gummiknüppels der Fall wäre, sondern er macht lächerliche Gestalten aus den Demonstranten“.
6. 9 1953 - Ergebnis der Bundestagswahl 1953
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 2. Deutschen Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Konrad Adenauer 45,2 Prozent [+ 14,2] und 249 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Erich Ollenhauer erringt 29,8 Prozent der Stimmen [- 0,4] und 162 Sitze.
- Die FDP bekommt 9,5 Prozent [- 2,4] und 53 Sitze.
- Die DKP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde.
- Der Gesamtdeutsche Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten - GB/BHE zieht mit 5,9 Prozent und 27 Sitzen in den Deutschen Bundestag ein.
Unter den 487 Abgeordneten befinden sich 129 ehemalige Mitglieder der NSDAP.
Konrad Adenauer [CDU] wird Bundeskanzler einer Koalition aus CDU/CSU und FDP.
19. 9 1953 - Der Löwe auf dem Löwenbräu-Festzelt darf wieder brüllen
München-Theresienwiese * Der 4,50 Meter große Löwe auf dem Löwenbräu-Festzelt darf wieder brüllen. Die Öffentlichkeit hatte für die Maulkorb-Maßnahme des Stadtrats kein Verständnis gezeigt. Im Gegenteil, der brüllende Löwe war zu einem Wahrzeichen des Oktoberfestes geworden. Gemeinsam mit der Löwenbrauerei protestierten die Wiesnbesucher gegen den Maulkorb.
19. 9 1953 - Ludwig und Berta Hagn übernehmen das Schützenzelt
München-Theresienwiese * Ludwig und Berta Hagn sen. übernehmen das Schützenzelt unterhalb der Bavaria.
18. 10 1953 - Der Weiß-Ferdl-Brunnen wird in Betrieb genommen
München-Angerviertel * Der Weiß-Ferdl-Brunnen am Viktualienmarkt wird in Betrieb genommen.
1954 - Dr. Fritz Schülein verkauft das „Schlossgut Kaltenberg“
Kaltenberg * Dr. Fritz Schülein verkauft das „Schlossgut Kaltenberg“ an Prinz Heinrich von Bayern und dessen Schwester Irmingard.
1954 - Dr. Hermann Schülein erhält das „Große Verdienstkreuz“
Bonn * Dr. Hermann Schülein erhält das „Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland“.
1954 - Richard-Wagner-Straße 7 gehört dem „Katholischen Werkvolk“
München-Maxvorstadt * Das Haus in der Richard-Wagner-Straße 7 gehört dem „Katholischen Werkvolk, Diözesanverband München-Freising“.
Ab 1954 - Der Sylvensteinspeicher zähmt die reißende Isar
Fall * Die Arbeiten am Sylvensteinspeicher beginnen. Die Arbeiten dauern bis 1957 an. Ein Hochwasser führt dazu, dass der Damm um zwei Meter höher ausgeführt wird, als ursprünglich geplant. Damit kann die reißende Isar gezähmt werden.
1954 - Sep Ruf baut die teilweise zerstörte „Karmeliten-Kirche“ um
München-Kreuzviertel * Die im Krieg teilweise zerstörte „Karmeliten-Kirche“ wird bis 1957 von dem Architekten Sep Ruf zu einem modernen Versammlungs- und Vortragssaal sowie zu einer Kapelle und einer Bibliothek umgebaut.
Die vom „Erzbischöflichen Ordinariat“ genutzten Gebäudeteile des vollkommen zerstörten Klosters werden abgetragen und im Stil der Zeit neu erbaut.
1954 - Eine Gedenktafel am Geburtshaus des großen Komikers
München-Au * Am „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der Zeppelinstraße 41 wird eine Gedenktafel für den großen Komiker angebracht und von seiner langjährigen Partnerin Liesl Karlstadt eingeweiht.
Anwesend ist auch Schorsch Blädel und viele Fahnenabordnungen.
Die Tafel ist eine Stiftung der „Freunde des Nationaltheaters“ unter Federführung der Süddeutschen Zeitung.
Anlass ist die 100-jährige Eingemeindung der Au, Haidhausens und Giesings nach München.
1954 - Oberpollinger: „Außen im vertrauten Kleid - Innen nach der neuen Zeit“
München-Kreuzviertel * 2.000 Mitarbeiter kümmern sich im neugestalteten und renovierten „Kaufhaus Oberpollinger“ um die Kundschaft.
Der Werbeslogan bringt es auf den Punkt: „Außen im vertrauten Kleid - Innen nach der neuen Zeit“.
13. 2 1954 - „C&A Brenninkmeyer“ und „Salamander“ wollen Samstags bis 17 Uhr öffnen
München * Die Münchner Einzelhandelsgeschäfte sind mit den Gewerkschaften einig, dass die Geschäfte am Samstagnachmittag - mit Ausnahme des ersten Samstags im Monat - um 14:00 Uhr schließen.
Nur die Firmen „C&A Brenninkmeyer“ und „Salamander“ wollen ihre Geschäfte jeden Samstag bis 17:00 Uhr geöffnet halten.
20. 2 1954 - Die Polizei räumt die Kaufingerstraße
München * Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen - HBV und die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft - DAG haben wieder ihre Mitglieder mobilisiert. Ab 14 Uhr halten etwa 1.000 Demonstrant*innen die Zugänge der Filialen der Firmen C&A Brenninkmeyer und Salamander besetzt.
Gegen 16 Uhr wird die Kaufingerstraße von einer Hundertschaft der Polizei mit vorgehaltenem Karabiner, berittener Polizei und dem Wasserwerfer geräumt. Sechs Demonstranten werden verhaftet.
27. 3 1954 - Protestmarsch gegen das „Kaufhaus C&A Brenninkmeyer“
München * Der DGB und die Einzelgewerkschaften haben zu einem neuen Protestmarsch mobilisiert, den das Verwaltungsgericht wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung auf Antrag des „Kaufhauses C&A Brenninkmeyer“ verbietet.
Unabhängig davon setzt sich der Protestmarsch mit rund 2.000 Demonstranten von der Herzog-Wilhelm-Straße aus in Bewegung.
Es kommt zur Eskalation mit der „martialisch auftretenden“ Polizei, nachdem etwa fünfzig berittene Polizisten versuchen, die Demonstranten und Passanten in die Seitenstraßen abzudrängen.
Mehrere hundert Polizisten gehen mit ihren Karabinern gegen die Menschen vor, schlagen zum Teil auf diese ein und nehmen 53 Demonstranten fest.
Schaufensterscheiben gehen durch Polizeipferde zu Bruch.
Der berühmt-berüchtigte Wasserwerfer steht bereit.
Einige Demonstrantinnen und Demonstranten werden schwer verletzt, der Verkehr ist für Stunden unterbrochen, das normale Leben setzt erst in den Abendstunden wieder ein.
10. 4 1954 - Demonstration für den Ladenschluss
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Firmen C&A Brenninkmeyer, Salamander und Woolworth halten ihre Geschäfte wieder offen. 5.000 Gewerkschafter demonstrieren durch die Neuhauser- und Kaufingerstraße zum Jakobsplatz. Sie ziehen an den geöffneten Geschäften lediglich vorbei und rufen dabei ihre Parolen.</p>
12. 4 1954 - Bill Haley nimmt „Rock Around the Clock“ auf
<p><strong><em>USA</em></strong> * Bill Haley nimmt <em>„Rock Around the Clock“</em> als B-Seite von <em>„Thirteen Women“</em> auf. Der Song verschwindet nach einer Woche in den Top 30 wieder aus den Hitlisten.</p>
5 1954 - Die „Großanlage für Müllverwertung“ in Großlappen geht in Betrieb
München-Großlappen * Nach nur viermonatiger Bauzeit wird in Großlappen eine „Großanlage für Müllverwertung“ in Betrieb genommen.
Sie ist für eine Jahreskapazität von 500.000 Kubikmetern ausgelegt und soll die Abfallentsorgung und Verwertung für die kommenden Jahrzehnte sicherstellen.
Das Kernstück der Anlage ist eine „Sortierhalle“, in der Magnete das Eisen aus dem „Müll“ fischen. Die anderen zur Verwertung geeigneten Altstoffe wie Buntmetalle, Papier, Textilien, Bettfedern, Glas und Schweinefutter - es gibt eine eigene „Schweinemästerei“ - werden von Hand aussortiert.
Damit kann die in der „Deponie Großlappen“ endgültig auszulagernde Restmüllmenge beachtlich reduziert werden.
Um den 5 1954 - Münchens Städtepartnerschaft wird mit Edinburgh
Edinburgh * Münchens erste Städtepartnerschaft wird mit der schottischen Hafenstadt Edinburgh geschlossen.
Es beginnt ganz klassisch mit einem Schüleraustausch.
1. 5 1954 - Forderungen zur Einführung der „Fünf-Tage-Woche“
München * Der „Deutsche Gewerkschaftsbund - DGB“ fordert die Einführung der „Fünf-Tage-Woche“ und eine „Wochenarbeitszeit von 40 Stunden“.
An den Litfaßsäulen hängen Plakate mit der Aufschrift „Samstags gehört Vati mir“.
Anfang 6 1954 - Die Gewerkschaften schließen mit „C&A Brenninkmeyer“ einen Vergleich
München * Die Gewerkschaften schließen mit „C&A Brenninkmeyer“ einen Vergleich.
Die Firma verzichtet auf eine Entschädigung von 250.000 DMark und die Gewerkschaften entschuldigen sich für die Beleidigungen in einem Flugblatt vom 20. Februar 1954.
Und nachdem sich viele andere Groß- und Mittelbetriebe für Samstagnachmittags-Öffnungszeiten nach 14 Uhr aussprechen, bricht der Widerstand zusammen.
Der „Ladenschluss-Krieg“ ist damit beendet.
7. 6 1954 - „Shake, Rattle and Roll“ von Bill Haley wird veröffentlicht
USA * „Shake, Rattle and Roll“ von Bill Haley erscheint und wird seine erste Goldene Schallplatte.
11. 7 1954 - Der im Krieg schwer zerstörte Fischbrunnen sprudelt wieder
München-Graggenau * Der im Krieg schwer zerstörte Fischbrunnen wird unter Verwendung erhaltener Figuren neu gestaltet und wieder zum Fließen gebracht.
17. 7 1954 - Angela Merkel wird in Hamburg geboren
Hamburg * Angela Merkel, die spätere Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und CDU-Vorsitzende, wird in Hamburg geboren.
18. 9 1954 - Das Bräurosl-Festzelt erhält eine neue Fassade
München-Theresienwiese * Das Bräurosl-Festzelt erhält eine neue Fassade, die an ein oberbayerisches Bauernhaus im Bundwerkstil erinnert. Die Fassade prägt bis heute das Gesicht der Bräurosl.
1. 10 1954 - 100. Jahrestag der Eingemeindung der Au, Giesings und Haidhausens
München * Dr. Hermann Schülein nimmt an den Feierlichkeiten aus Anlass des 100. Jahrestages der Eingemeindung der Au, Giesings und Haidhausens nach München teil.
14. 10 1954 - Das Kindergeld ab dem 3. Kind wird eingeführt
Bonn - Bundesrepublik Deutschland * Das Kindergeld wird in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Es beträgt 25.- DM pro Monat und wird ab dem dritten Kind bezahlt.
28. 11 1954 - Viererkoalition unter Wilhelm Hoegner (SPD)
Freistaat Bayern * Bei der Landtagswahl Wahl bleibt die CSU zwar stärkste Fraktion. Doch der SPD-Vorsitzende Waldemar von Knoeringen verständigt sich mit dem Bayernpartei-Vorsitzenden Joseph Baumgartner. Nach dem Motto „Es geht auch ohne CSU“ kommen noch die FDP und der BHE dazu, womit die Viererkoalition perfekt ist.
Wilhelm Hoegner, SPD, wird Ministerpräsident, Joseph Baumgartner, BP, sein Stellvertreter.
1955 - Das „Französische Konsulat“ zieht in die Widenmayerstraße 51
München-Maxvorstadt - München-Lehel * Das „Französische Konsulat“ zieht von der Kaulbachstraße 13 in die Widenmayerstraße 51 im Lehel.
Um 1955 - In der „Kunst-Akademie“ bildet sich die „Künstlergruppe SPUR“
München-Maxvorstadt * In der „Akademie der Bildenden Künste“ bildet sich die „Künstlergruppe SPUR“.
1955 - Die „Isar-Amper-Werke AG“ entstehen durch Fusion
München-Maxvorstadt * Die „Amper-Werke“ und die „Isar-Werke GmbH“ fusionieren zu den „Isar-Amper-Werken AG“.
Damit endet für die „Isarwerke GmbH“, als sie dieses zunächst auf die „Isarwerke AG“ übertrug, die Teilnahme am operativen Geschäft.
Fortan halten die drei Familienstämme August und Wilhelm von Finck und Wilhelm Winterstein vom „Bankhaus Merck Finck“ zusammen etwa 90 Prozent der Anteile an einer „GmbH“, die als „Holdinggesellschaft“ der „Isar-Amper-Werke“ auftritt und auch Betreiber des „Atomkraftwerks Isar“ ist.
1955 - Die „Isar-Amper-Werke AG“ in der Brienner Straße
München-Maxvorstadt * Die „Isar-Amper-Werke AG“ verfügen über das Anwesen Ecke Brienner Straße 41 und Richard-Wagner-Straße 3 und 5.
1955 - „Ich würde genau wieder so leben wollen. Ich bereue nichts“
München-Lehel - Praterinsel * Bei Eduard Pichls Beerdigung werden dessen letzten Grüße verlesen:
„Ich würde genau wieder so leben wollen. Ich bereue nichts“.
1955 - Die „Altöttinger-Kapelle“ kann neu eröffnet werden
München-Haidhausen * Nach ihrer Wiederherstellung kann die „Altöttinger-Kapelle“ neu eröffnet werden.
Ab 1955 - Der „Hirschauer Forst“ wird in den „Englischen Garten“ einbezogen
München-Englischer Garten - Hirschau * Der „Hirschauer Forst“ wird bis zum Jahr 1962 in den „Englischen Garten“ einbezogen.
Seit 1955 - Die „Stadtgärtner“ erproben im „Rosengarten“ neue „Rosensorten“
München-Untergiesing * Die „Stadtgärtner“ erproben im „Rosengarten“ auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern neue „Rosensorten“.
Ob sie das Münchner Klima vertragen, müssen die Pflanzen erst einmal zeigen.
Sind sie robust genug, pflanzen sie die Gärtner in großen Stückzahlen in die städtischen Blumenbeete ein.
1955 - Der 1. Mai als Festtag „Joseph der Arbeiter“
Rom-Vatikan * Papst Pius XII. bestimmt den 1. Mai als Festtag „Joseph der Arbeiter“ und gibt damit dem „Tag der Arbeit“ seine christliche Weihe.
1955 - Dieter Hildebrandt gründet das Kabarett „Die Namenlosen“
München * Dieter Hildebrandt bricht seine Arbeiten an der Dissertation zur Erlangung des Doktortitels ohne Abschluss ab.
Dafür gründet er das Kabarett „Die Namenlosen“ und hat damit erste Erfolge.
1955 - Die Zahl der Einwohner im „Lehel“ hat sich auf 23.000 erhöht
München-Lehel * Die Zahl der Einwohner im „Lehel“ hat sich auf 23.000 erhöht.
Um 1955 - Eine naturgetreue Kopie des Denkmals für die „Toten der Revolution - 1919“
<p><strong><em>München-Obergiesing</em></strong> * Der Giesinger Bildhauer Konstantin Frick erschafft im Ostfriedhof eine naturgetreue Kopie des Denkmals für die <em>„Toten der Revolution - 1919“</em>. </p>
1955 - Aus dem „Linzer Stüberl“ wird die „Weinstube zum Wienerwald“
München-Maxvorstadt * In der Amalienstraße 23 eröffnet der frühere Oberkellner Friedrich Jahn das „Linzer Stüberl“.
Der anfängliche Publikumsrenner „Hühnersuppe mit Nudeln“ wird bald vom „Grillhendl“ abgelöst, weshalb das Lokal in „Weinstube zum Wienerwald“ umbenannt wird.
Bald heißt der Slogan: „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald“.
2. 2 1955 - Wir sind die Cowboys von der Nockher-Ranch
München-Au * Der Cowboy Club München Süd bittet um Baugenehmigung für ein Behelfsclubheim. Auf dem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Grundstück von Frau Ida Krone, „da dadurch das bisher durch Lausbubenstücke und von lichtscheuen Elementen heimgesuchte Gelände unter schärfere Kontrolle fällt und der Rasen und Baumbestand gepflegt wird. Korrektes und ruhiges Verhalten wird die Nachbarschaft nicht belästigen“. In einer Ranch will der Verein einen Clubraum, einen Museumsraum für die wertvolle Sammlung und einen Bibliotheksraum verwirklichen.
Die Cirkus-Krone-Verwaltung genehmigt dem Cowboy-Club die Grundstücksnutzung für seine sportlichen und ideellen Zwecke, bis zum beabsichtigten Verkauf des Areals. Seither beherrschen Winnetou und Old Shatterhand den ehemaligen Schmederer-Garten. Eine alte Wehrmachtsbaracke wird mit Hilfe der Pschorrbrauerei und hoher Eigenleistung zur Ranch umgebaut. „Jeden Samstag und Sonntag sind 15 bis 20 Mann ganztägig da. Rund 2.000 Arbeitsstunden werden freiwillig und gern von den Clubmitgliedern geleistet.“
In der Ranch befindet sich der kostbarste Besitz des C.C.M.S., das Indianermuseum. In ihm ist alles Zubehör und Kleidung zu finden, die einen Indianer ausmachen. Köcher aus Büffelleder, Federhauben, Friedens-Pfeifen, Brautmokassins, mit perlenbestickten, bunten Schuhsohlen, sowie Kriegsbeilen, wie sie wirklich waren: schlicht und einfach. In einem eigenen lateinamerikanischen Glaskasten befindet sich ein Schrumpfkopf.
3 1955 - „Rock around the clock“ kommt in die Kinos
München * Der Film „Rock around the clock“ kommt in die Kinos.
Damit wird der Titelsong von Bill Haley und seiner Band „Comets“ zur „Hymne der Jugend“.
2. 8 1955 - Ex-Kronprinz Rupprecht stirbt auf Schloss Leutstetten
Leutstetten * Der bayerische Ex-Kronprinz Rupprecht stirbt auf Schloss Leutstetten.
6. 8 1955 - Ex-Kronprinz Rupprecht wird in der Theatinerkirche beigesetzt
München-Kreuzviertel * Der bayerische Ex-Kronprinz Rupprecht wird als letzter Wittelsbacher im Rahmen eines Staatsbegräbnisses - mit allen königlichen Ehren - in der Theatinerkirche beigesetzt.
Bis 1918 lautete sein vollständiger Titel: Seine Königliche Hoheit Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand Kronprinz von Bayern, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben, Pfalzgraf bei Rhein.
10 1955 - Mit dem Bau der „Elisabeth-Kirche“ wird begonnen
München-Haidhausen * Mit dem Bau der „Elisabethkirche“ in der Breisacher Straße wird begonnen.
Dazu treten die „Frauen vom guten Hirten“ einen Teil des Klostergartens ab.
Wegen der Beschränktheit des Bauplatzes steht die Kirche etwas zurückgesetzt von der Straße.
Nur der schlanke freistehende Turm wird zur Straße vorgeschoben, womit die beabsichtigte gute Sichtbarkeit erreicht wird.
Der Turm nimmt auch die „Transformatorenstation“ der Stadtwerke München auf.
Die Hallenkirche hat eine Länge von 32 und eine Breite von 25 Metern und besitzt am Altar eine Höhe von 17 Metern.
20. 12 1955 - Anwerbeabkommen mit Italien
Bundesrepubklik Deutschland - Italien * Zwischen Italien und der Bundesrepublik Deutschland wird ein Abkommen zur Anwerbung italienischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt abgeschlossen.
Nach dem 21. 12 1955 - Die ersten Italiener treffen als Gastarbeiter am Hauptbahnhof ein
München * Die ersten Italiener treffen als Gastarbeiter auf Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof ein. In einem ehemaligen Luftschutzbunker befindet sich die „Weiterleitungsstelle“.
Die Neuankömmlinge sollen „möglichst schnell vom Bahnsteig verschwinden, um nicht den Eindruck des Sklavenhandels“ entstehen zu lassen.
Ab dem Jahr 1956 - Hörspielserie „Familie Brandl“ mit Liesl Karlstadt im Radio
München * Jeden zweiten Samstag ist Liesl Karlstadt um 16:40 Uhr als „Frau Brandl“ in der Hörspielserie „Familie Brandl“ im Radio zu hören.
1956 - Das „Französische Konsulat“ zieht in die Möhlstraße 10
München-Lehel - München-Bogenhausen * Das „Französische Konsulat“ zieht von der Widenmayerstraße 51 in die Möhlstraße 10.
1956 - Michael Bauernschmidt erwirbt das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11
München-Maxvorstadt * Der „Kaufmann“ Michael Bauernschmidt erwirbt das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 von den Erben.
1956 - Die Familie Haas verkauft ihren „arisierten“ Besitz
Bernried * Die Familie Haas verkauft ihren „arisierten“ Besitz samt „Sommerhaus“ in Bernried an den „Aufzugsfabrikanten“ Vester.
1956 - Das „Landratsamt München“ zieht an den Mariahilf-Platz
München-Au - München-Kreuzviertel * Nach dem Umzug des „Amtsgerichts München II“ in die „Maxburg“ wird das ehemalige Gerichtsgebäude am Mariahilf-Platz zum Sitz des „Landratsamtes München“.
Nun kann auch die „Kraftfahrzeugzulassungsstelle für den Landkreis München-Land“ vom „Lilienberg“ an den Mariahilfplatz ziehen.
Bis 1956 - Die Ruine der „Residenzpost“ wird durch einen Neubau ersetzt
München-Graggenau * Nachdem die Ruine der „Residenzpost“ weitgehend abgetragen ist, lässt die „Oberpostdirektion“ bis zum Jahr 1956 einen modernen Neubau errichten, in den die restaurierte „Loggia“ am Max-Joseph-Platz integriert wird.
Das Portal an der Residenzstraße wird abgetragen und ins Innere der „Schalterhalle“ verlegt.
In die neue, langweilige Fassade in der Residenzstraße presst man noch ein drittes Stockwerk hinein.
Die „Schokoladenseite“ mit der „Kolonnade“ kann hingegen nach Klenzes Plänen relativ preiswert restauriert werden.
1956 - Der Stadtrat beauftragt die Instandsetzung des „Siegestores“
München-Maxvorstadt - München-Schwabing * Der Stadtrat beauftragt die Architekten Otto Roth und Josef Wiedemann mit der Instandsetzung des „Siegestores“.
1956 - Dieter Hildebrandt gründet die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“
München-Schwabing * Dieter Hildebrandt gründet gemeinsam mit Sammy Drechsel die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“.
Das erste Programm trägt den Titel „Denn sie müssen nicht, was sie tun“.
Ihm folgen noch weitere 19.
23. 1 1956 - Die Vereinigung Münchner Kraftdroschken- und Mietwagenunternehmen
München * Die Vereinigung Münchner Kraftdroschken- und Mietwagenunternehmen wird gegründet.
10. 2 1956 - Elvis Presleys Song „Heartbreak Hotel“ erscheint
USA * Elvis Presley bringt seinen Song „Heartbreak Hotel“ in die Plattenläden.
3. 5 1956 - Der Karl-Valentin-Erfinder Ludwig Greiner stirbt
<p><em><strong>München</strong></em> * Ludwig Greiner, der <em>„Erfinder“</em> von Karl Valentin stirbt. Der Münchner Grafiker, Bühnenbildner und Theatermaler schuf zu fast allen Szenen Valentins Plakate und Zeichnungen. Sein Humor war höchst inspirierend. Zu allen Ideen Valentins hatte er die passenden Einfälle. Ein Leben lang befruchteten sich die beiden gegenseitig.</p>
6 1956 - Paul McCartney wird Mitglied der „Quarrymen“
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Paul McCartney wird Mitglied von John Lennons Gruppe <em>„The Quarrymen“</em>. </p>
13. 6 1956 - Forderungen für ein neues Ludwig-II.-Denkmal
Schloss Nymphenburg - München-Isarvorstadt * Die Statue von König Ludwig II. auf der Corneliusbrücke ist im Mai 1942 ein Opfer der Kriegsindustrie geworden. Da sich bisher keine offizielle Stelle um die Wiederkehr eines König-Ludwig-Standbildes bemüht, bildet sich an Ludwigs 70. Todestag in Schloss Nymphenburg ein Komitee, das den Freistaat und die Stadt auf den leeren Platz an der Isarbrücke hinweisen will.
18. 8 1956 - Die Räume am Lilienbergmgehen an die Regierung von Oberbayern
München-Au * Das Landratsamt München übergibt ihre Räume am Lilienbergman die Regierung von Oberbayern, die in dem Haus die Verwaltung des Auswandererlagers unterbringt.
22. 9 1956 - Wiggerl Hagn startet als Gehilfe seiner Mutter im Schützenzelt
München-Theresienwiese • Ludwig Wiggerl Hagn startet als Gehilfe seiner Mutter, die Wirtin vom Schützenzelt, im Alter von 17 Jahren seine Wiesn-Karriere.
22. 9 1956 - Willy Heide übernimmt das Pschorr-Bräurösl-Festzelt
München-Theresienwiese • Willy Heide übernimmt das Pschorr-Bräurösl-Festzelt.
18. 11 1956 - Kardinal Joseph Wendel weiht die Elisabethkirche ein
München-Haidhausen * Kardinal Joseph Wendel weiht die Elisabethkirche in der Breisacher Straße ein. Gleichzeitig bestimmt er abgegrenzte Teile der Pfarrei St.-Johann-Baptist und der Pfarrei St.-Gabriel als Pfarrkuratie St. Elisabeth. Sie umfasst rund 7.000 Seelen.
28. 11 1956 - Das Gesetz über den Ladenschluss verabschiedet
Bonn * Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über den Ladenschluss. Demnach dürfen Geschäfte nur noch montags bis freitags von 7.00 bis 18.30 Uhr und samstags bis 14.00 Uhr geöffnet sein. Die Gesamtstundenzahl der Ladenöffnungszeiten pro Woche liegt bei 63,5 Stunden.
1957 - Von den „Moriskentänzern“ werden Kopien gefertigt
München-Graggenau * Von den „Moriskentänzern“ werden Kopien gefertigt und im „Alten Rathaus“ aufgestellt.
1957 - Die höhere Besteuerung von berufstätigen Frauen wird abgeschafft
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Die Steuervorschrift, wonach berufstätige Ehefrauen höher besteuert - und damit „ins Haus zurückgeführt“ werden, wird aufgehoben.
1957 - Ferdinand Schmid leitet den „Verein Münchener Brauereien“
München * Ferdinand Schmid wird Geschäftsführer des „Vereins Münchener Brauereien“.
Seither träumt er von einem „Biermuseum“, in dem man die „Fertigung und Kulturgeschichte unseres Volksgetränks demonstriert, das man in Bayern auch das fünfte Element nennt“.
Dieser Traum wird sich erst im September 2005 mit dem „Bier & Oktoberfestmuseum“ realisieren lassen.
3. 5 1957 - Mann und Frau sind in der BRD gleichberechtigt
<p><strong><em>Bonn</em></strong> * Der Deutsche Bundestag beschließt das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. </p>
17. 6 1957 - Ein Bundesgesetz erweitert die Ladensöffnungszeiten
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Ein Bundesgesetz erweitert die Ladensöffnungszeiten am ersten Samstag im Monat bis 18.00 Uhr.
13. 7 1957 - Am Karolinenplatz 3 wird das Münchner Amerikahaus eröffnet
München-Maxvorstadt * Am Karolinenplatz 3 wird das Münchner Amerikahaus eröffnet.
15. 9 1957 - Ergebnis der Bundestagswahl 1957
Bundesrepublik Deutschland -Bonn * Bei der Wahl zum 3. Deutschen Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Konrad Adenauer 50,2 Prozent [+ 5,0] und 277 Sitze.
- Die CSU kommt in Bayern auf 57,2 Prozent.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Erich Ollenhauer erringt 31,8 Prozent der Stimmen [+ 3,0] und 181 Sitze.
- Die FDP bekommt 7,7 Prozent [- 1,8] und 43 Sitze.
Die DKP tritt nicht zur Wahl an. Sie wurde im Vorjahr verboten.
Konrad Adenauer [CDU] wird Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er kann mit der CDU/CSU mit absoluter Mehrheit regieren.
Seit 21. 9 1957 - Im Hippodrom findet der Oktoberfest-Gottesdienst statt
München-Theresienwiese • Im Hippodrom findet am ersten Wiesn-Donnerstag der Oktoberfest-Gottesdienst statt. Hierin wird den verstorbenen Schaustellern, Marktkaufleuten und Wiesn-Wirten gedacht, es werden Kinder getauft und Ehen geschlossen.
21. 9 1957 - Zum letzten Mal wird auf den Vogelbaum geschossen
München-Theresienwiese • Zum letzten Mal wird auf dem Oktoberfest auf den Vogelbaum geschossen. Diese Form des Wettbewerbs wird aus Sicherheitsgründen eingestellt. Der Vogelbaum wird nach Lochhausen verlegt.
Um 10 1957 - Die „Musikhochschule“ zieht an die Arcisstraße
München-Haidhausen - München-Maxvorstadt * Die „Staatliche Hochschule für Musik“ zieht aus der „Villa Stuck“ in ihr neues Domizil im ehemaligen „Führerbau“ in der Arcisstraße um.
8. 10 1957 - Die Bayernpartei tritt aus der Viererkoalition aus
München * Die kleineren Koalitionspartner der Viererkoalition bekommen es mit der Angst zu tun, weshalb die Bayernpartei am 8. Oktober aus der Viererkoalition austritt und sie damit beendet.
17. 10 1957 - Hanns Seidel (CSU) bildet eine neue Koalitionsregierung
München * Der CSU-Politiker Hanns Seidel, seit 22. Januar 1955 neuer CSU-Landesvorsitzender, bildet eine neue Koalitionsregierung, bestehend aus CSU, BHE und FDP. Sein Stellvertreter wird Walter Stain vom GB/BHE. SPD und Bayernpartei - BP können seither in Bayern kein Regierungsamt mehr ausüben.
11 1957 - „Verein für die Wiedererrichtung eines Denkmals für Ludwig II.“ gegründet
München * Um den Druck für ein Denkmal für den „Märchenkönig“ zu erhöhen wird der „Verein für die Wiedererrichtung eines Denkmals für König Ludwig II. von Bayern“ gegründet.
15. 12 1957 - Der 1.000.000ste Münchner wird geboren
München-Pasing * Mit dem Pasinger Thomas Seehaus kommt der 1.000.000ste Münchner Bürger in der Frauenklinik Dr. Wilhelm Krüsmann zur Welt. München wird damit Millionenstadt.
1958 - Ein Neubau für die „Sozialpädagogische Fachschule“
München-Bogenhausen * Ein Neubau für die „Sozialpädagogische Fachschule“ am Bogenhausener Kirchplatz 3 entsteht.
1958 - Das neue Haus der „Studentenverbindung Teutonia“
München-Maxvorstadt * Das Haus in der Richard-Wagner-Straße 7 gehört der „Studentenverbindung Teutonia“.
1958 - Ehefrauen dürfen ihren Wohnort erstmals selbst bestimmen
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Ehefrauen dürfen ihren Wohnort erstmals selbst bestimmen.
Bis dahin hat der Ehemann dieses Vorrecht.
1958 - Eine mahnende Inschrift am wiederhergestellten „Siegestor“
München-Maxvorstadt - München-Schwabing * Nach einer heftig kontrovers geführten Diskussion wird das „Siegestor“ zu einem „Mahnmal gegen den Krieg“.
Seine Inschrift lautet jetzt: „DEM SIEG GEWEIHT * VOM KRIEG ZERSTÖRT * ZUM FRIEDEN MAHNEND“.
1958 - Der „Weinberger-Bugatti Royale“ kommt ins „Henry Ford Museum“
Dearborn * Der „General-Motors-Ingenieur“ Charles Chayne schenkt den restaurierten „Bugatti Royale“ dem „Henry Ford Museum“ in Dearborn, wo er noch bis heute eine der größten Attraktionen darstellt.
Er befindet sich noch immer in dem modifizierten Zustand, in dem ihn das Museum erhalten hat.
1958 - Der „Cowboy Club München von 1913 e.V.“ wird ein Verein
München * Der „Cowboy Club München von 1913 e.V.“ wird in das „Vereinsregister“ eingetragen.
6. 2 1958 - George Harrison wird Mitglied der „Quarrymen“
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * George Harrison wird Mitglied der Lennon-McCartney-Gruppe <em>„The Quarrymen“</em>, die sich bald darauf in „<em>Johnny & The Moondogs“</em> umbenennt. </p>
6. 2 1958 - Flugzeugabsturz in Riem
München-Riem * Nach einem misslungenem Startversuch eines Flugzeugs kommen in Riem 23 der 43 Flugzeuginsassen ums Leben. Unter den Toten befindet sich die Halbe Fußball-Mannschaft von Manchester United.
4 1958 - Das „Generalkonsulat der USA“ bezieht seinen Neubau
München-Maxvorstadt * Das „Generalkonsulat der USA“ bezieht seinen Neubau in der Königinstraße 5.
10. 5 1958 - Aus „The Quarrymen“ werden „The Beatles“
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Aus <em>„The Quarrymen“</em> werden <em>„The Beatles“</em>. </p>
6 1958 - Dr. Hermann Schülein kommt mit den „Rheingold-Girls“ zur 800-Jahr-Feier
München * Zur „800-Jahr-Feier Münchens“ trifft Dr. Hermann Schülein mit den „Rheingold-Girls“ in München ein.
Die „Rheingold-Girls“ bestehen aus einer Gruppe amerikanischer „Schönheitsköniginnen“, die auf der jährlich von der „Rheingold-Brauerei“ ausgerichteten Konkurrenz ausgewählt werden.
18. 6 1958 - Hannes König eröffnet die Karl-Valentingedächtnisausstellung
München-Maxvorstadt * „800 Jahre und 5 Tage nach der Gründung der Stadt München“ wird im Pavillon im Alten Botanischen Garten die „Karl-Valentingedächtnisausstellung“ eröffnet.
- Gezeigt wird der Stummfilm „Der neue Schreibtisch“.
- Außerdem spielt Hannes König auf Karl Valentins Zither.
- Professor Carl Niessen, der im Jahr 1953 den Nachlass von Karl Valentin für das Institut Theaterwissenschaft der Universität Köln erworben hat, stellt Originale für die Ausstellung zur Verfügung.
30. 6 1958 - Fred Sommer vom Cowboy Club München stirbt um Alter von 70 Jahren
München * Fred Sommer, das letzte Gründungsmitglied des Cowboy Clubs München 1913 e.V. stirbt um Alter von 70 Jahren. Sein Sohn, der Journalist Sigi Sommer, setzt ihm als „Häuptling Abendwind“ ein literarisches Denkmal.
29. 8 1958 - Michael Joseph Jackson wird in Gary im US-Staat Indiana geboren
Gary * Der spätere Sänger, Songwriter und Tänzer Michael Joseph Jackson wird in Gary im US-Staat Indiana geboren.
20. 9 1958 - Philippine wird Wiesnwirtin nach dem Tod ihres Ehemannes Karl
München-Theresienwiese * Nachdem Karl Winter verstorben war, wird seine Witwe Philippine Wiesnwirtin der Fischer-Vroni, danach deren inzwischen verheirateten Töchter Eva Stadtmüller (Jahrgang 1935) und Anita Schmid (Jahrgang 1932). Die Beiden teilen sich die Aufgaben auf dem Oktoberfest auf. Eva kümmert sich um die Verwaltungsangelegenheiten, Anita steht in der Küche und überwacht jeden Teller, dass er sauber und vor allem ordentlich portioniert aus der Küche geht.
20. 9 1958 - Es wird kaum noch Märzenbier auf der Wiesn ausgeschenkt
München-Theresienwiese * Es wird kaum noch Märzenbier auf der Wiesn ausgeschenkt.
20. 9 1958 - Wiesnwirt Richard Süßmeier wird Letzter beim Einzug der Wiesnwirte
München-Theresienwiese * Richard Süßmeier betreibt in einer ehemaligen Reichsarbeitsdienstbaracke das Kleine Winzerer Fähndl auf der Wiesn. Beim Einzug der Wiesnwirte zieht der Wirt vom Straubinger Hof zieht mit einem Eselskarren in seine kleine Festhalle ein.
„Ich hab‘ mir gedacht: Ich mit dem kleinsten Zelt, mit dieser Baracke - dazu passt doch keine Pferdekutsche beim Einzug.“ Also spannt er zwei Esel vor einen Leiterwagen. In der Sonnenstraße setzen sich die Esel einfach hin und stehen nicht mehr auf. Damit ist er der Letzte beim Wiesnwirte-Einzug. Hinter ihm nur noch die Polizei und die Straßenreinigung.
Seitdem dürfen sich keine Esel mehr am Einzug der Wiesnwirte beteiligen. (Wohlgemerkt vierhaxige!)
20. 9 1958 - Die Armbrustschützengilde richtet die Deutschen Meisterschaften aus
München-Theresienwiese- Lochhausen * Die Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl richtet im Auftrag des Bayerischen Sportschützenbundes und des Deutschen Sportschützenbundes die Deutschen Meisterschaften aus. Die Scheibenschießwettbewerbe finden auf der Wiesn, die Adler- und Sternwettbewerbe in der Vogelanlage des Winzerer Fähndls in Lochhausen statt.
10 1958 - Hannes König präsentiert „Die Karl-Valentin-Ausstellung 2. Teil“
München-Au * Auf der Auer „Herbstdult“ präsentiert Hannes König in einem Zelt „Die Karl-Valentin-Ausstellung 2. Teil“.
Die Ausstellung ist so erfolgreich, dass Hannes König dem Münchner Zweiten Bürgermeister Adolf Hieber von der „Bayern-Partei“ einen Scheck über die erwirtschafteten Überschüsse überreichen kann.
Er erhält ihn sofort - als Startkapital für den Ausbau des „Isartor-Turmes“ - zurück.
9. 10 1958 - Papst Pius XII. stirbt in Castel Gandolfo
Castel Gandolfo * Papst Pius XII. stirbt in Castel Gandolfo.
28. 10 1958 - Angelo Giuseppe Roncalli wird als Papst Johannes XXIII. gewählt
Rom-Vatikan * Angelo Giuseppe Roncalli wird als Papst Johannes XXIII. zum Nachfolger von Papst Pius XII. als Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt.
23. 11 1958 - Es bleibt bei der Dreierkoalition aus CSU, GB/BHE und FDP
Freistaat Bayern * Bei der Wahl zum Bayerischen Landtag ist die CSU die eindeutige Wahlgewinnerin.
- Die CSU kann ihren Stimmenanteil von 38,4 auf 45,6 Prozent erhöhen.
- Die SPD verbessert ihr Ergebnis um 2,7 Prozent auf 30,8 Prozent.
- Die Bayernpartei - BP, der Gesamtdeutsche Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten - GB/BHE sowie die FDP fallen nach zum Teil massiven Verlusten unter die Zehnprozent-Marke.
Der Trend zum Zweiparteien-System schält sich schon bei dieser Wahl deutlich heraus.
Obwohl die CSU mit 101 Sitzen fast die absolute Mehrheit erreicht hat, bleibt es bei der Dreierkoalition aus CSU, GB/BHE und FDP.
Zum Ministerpräsidenten wird Hanns Seidel gewählt. Sein Stellvertreter, Rudolf Eberhard, gehört aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse nun auch der Christlich Sozialen Union an.
21. 12 1958 - Lion Feuchtwanger stirbt in Los Angeles
Los Angeles * Lion Feuchtwanger stirbt im Mount Sinai Hospital in Los Angeles.
1959 - Der „Coulmiersplatz“ wird in „Haidenauplatz“ umbenannt
München-Haidhausen * Der „Coulmiersplatz“ in Haidhausen wird in „Haidenauplatz“ umbenannt.
1959 - Das „Letztenscheidungsrecht“ des Vaters wird aufgehoben
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Das „Letztenscheidungsrecht“ des Vaters über die Kindererziehung wird aufgehoben.
Bis 1959 - Die „Poststraßenbahn“ bedient auch das „Postamt 1“
München * Die bis zum Jahr 1959 verkehrende „Poststraßenbahn“ bedient auch das „Postamt 1“.
1959 - Hannes König gründet die „Münchner Volkssänger-Bühne“
München-Schwabing * Hannes König gründet die „Münchner Volkssänger-Bühne“.
Nach verschiedenen Spielorten findet sie in der „Max-Emanuel-Brauerei“ ihren festen Auftrittsort.
Hannes König führt Regie, schreibt Stücke neu oder um und entwirft sowie gestaltet die Bühnenbilder.
Um 2 1959 - Hannes König will ein „Volkssänger- und Valentin-Museum“ einrichten
München-Graggenau - München-Angerviertel * Hannes König überzeugt Oberbürgermeister Thomas Wimmer vom Sinn und Zweck eines „Volkssänger- und Valentin-Museums“.
Er erhält den südlichen Isartorturm, der damals noch eine Ruine war, zur mietfreien Nutzung.
3. 3 1959 - Elvis Presley hält sich privat in München auf
München * Elvis Presley, der 18 Monate lang im hessischen Friedberg als GI stationiert ist, besucht Bayern privat. Mit Vera Tschechova schaut er sich zwei Filme an, isst in den Bavaria Filmstudios, fährt zum Schifferlfahren zum Starnberger See. Am Abend besucht er zwei Wäschemodenschauen im Nachtclub Moulin Rouge in der Herzogspitalstraße. Dazwischen ist noch Zeit, um im Hof des Hotels Bayerischer Hof für Fotoaufnahmen mit Reinigungsfrauen zu posieren.
Um den 28. 5 1959 - Das Beamtenhaus im Dorf Fall wird gesprengt
Fall * Das sogenannte Beamtenhaus im Dorf Fall wird gesprengt. Darin hatte sich zuvor der letzte Bewohner von Fall verschanzt. Damit kann der Sylvenstein-Stausee in Betrieb genommen werden.
10. 6 1959 - Die Kreuzigungsgruppe vor dem Leprosenhaus wird aufgestellt
München-Haidhausen * Die aus zwei Marmorfiguren und einem Bronze-Kruzifix bestehende Kreuzigungsgruppe wird in der Grünanlage nahe dem ehemaligen Leprosenhaus aufgestellt. Sein ursprünglicher Standort befand sich zuvor auf der gegenüberliegenden Straßenseite, beim heutigen Kulturzentrum.
Ab 12. 6 1959 - Der Sylvensteinspeicher wird erstmals aufgestaut
Fall * Der Sylvensteinspeicher wird erstmals aufgestaut. Ergiebige Niederschläge füllen den Speichersee bis zum 16. Juni mit einem Spitzenzufluss von 626 Kubikmetern Wasser in der Sekunde.
Das übertrifft das auf 600 Kubikmeter festgelegte sogenannte „Katastrophenereignis“ um 26 Kubikmeter. Zum Glück hat man die Höhe des Damms um zwei Meter höher ausgeführt als ursprünglich geplant. Dadurch kann Bad Tölz und München vor größeren Schäden bewahrt werden.
19. 9 1959 - Hannes König eröffnet das Valentin-Musäum
München-Graggenau - München-Angerviertel * Um 11:01 Uhr eröffnet Hannes König im südlichen Turm des Isartores das Valentin-Musäum.
19. 9 1959 - Rudolf Mrkva übernimmt die Ochsenbraterei
München-Theresienwiese * Rudolf Mrkva übernimmt die Ochsenbraterei. Damit verbunden ist die Tradition, den Namen des schmorenden Ochsen und das Gewicht auf einer Tafel neben dem Bratapparat zu vermerken.
19. 9 1959 - Die Mass Wiesn-Bier kostet 1,80 DMark
München-Theresienwiese * Die Mass Wiesn-Bier kostet 1,80 DMark. 2,9 Millionen Mass werden ausgeschenkt.
10 1959 - Die „Turmschreiber“ werden im „Turmstüberl des Isartores“ gegründet
München-Graggenau - München-Angerviertel * Im „Turmstüberl des Isartores“ gründet eine Handvoll Erzähler, Historiker und Lyriker um Hanns Vogel, der im städtischen „Kulturreferat“ arbeitet, einen „literarischen Stammtisch“.
Sie nennen sich die „Turmschreiber“ und wollen die „süddeutsche Denk- und Lebensart und das bayerische Wesen“ hochhalten“.
1. 10 1959 - Das Armbrustschützenzelt muss erneuert werden
München-Theresienwiese * Das Kleine Winzerer Fähndl, das Armbrustschützenzelt, ist in einem derart maroden Zustand, dass die Stadt in einem Bescheid deutlich macht, dass einer Aufstellung im kommenden Jahr aus Sicherheitsgründen selbst dann nicht zugestimmt werden kann, wenn Teile der Konstruktion erneuert würden.
1960 - Erbstreitigkeiten bei „Togal“
München-Bogenhausen * Nach dem Tod des „Togal“-Firmengründers Gerhard Friedrich Schmidt streiten sich die drei Söhne um das attraktive Erbe.
Der jüngste der Brüder, Günther J. Schmidt, siegt nach einem erbitterten Rechtsstreit.
1960 - Das eher zwielichtige Lokal „Blauer Engel“ wird eröffnet
München-Haidhausen * In der ehemaligen Wirtschaft „Zum kleinen Wirth“ eröffnet das eher zwielichtige Lokal „Blauer Engel“.
Die berühmt-berüchtigte Kneipe gehört allerdings - trotz Verärgerung der Anwohner - nicht zu den „störenden Gewerbebetrieben“.
1960 - Die „Nicolai-Kirche“ am Gasteig wird im Inneren restauriert
München-Haidhausen * Die „Nicolai-Kirche“ am Gasteig wird im Inneren restauriert.
Dabei werden die drei vorhandenen Aläre entfernt und durch einen frühbarocken Altar aus dem Jahr 1691 ersetzt.
Er stammt ursprünglich aus einer Kirche in Garmisch.
1960 - Richard Süßmeier lässt das „Armbrustschützen-Zelt“ erweitern
München-Theresienwiese * Richard Süßmeier lässt auf eigene Kosten die „Oktoberfesthalle der Armbrustschützen“ von 500 auf 1.500 Plätze ausgebauen und die markante Fassade gestalten.
Ab 1960 - Der „Aumeister“ wird umgebaut und erweitert
München-Englischer Garten * Der „Aumeister“ wird umgebaut und erweitert.
1 1960 - Hans Ehard wird „Bayerischer Ministerpräsident“
München * Nachdem Hanns Seidel aus Gesundheitsgründen zurücktreten muss, übernimmt erneut der inzwischen 72-jährige Hans Ehard das Amt des „Bayerischen Ministerpräsidenten“.
Ansonsten ändert sich an der personellen Besetzung nichts.
11. 2 1960 - Victor Klemperer stirbt in Dresden
Dresden * Victor Klemperer stirbt in Dresden.
17. 3 1960 - Münchens Städtepartnerschaft mit Verona
<p><strong><em>München - Verona</em></strong> * Die Städtepartnerschaft zwischen dem oberitalienischen Verona und München wird gegründet. München erhält zwei <em>„Julia-Statuen“</em>.</p> <ul> <li>Eine Figur steht - häufig blumengeschmückt und am Busen abgewetzt - am Alten Rathaus. </li> <li>Das andere Standbild befindet sich in Bogenhausen am Shakespeare-Platz. </li> </ul>
29. 3 1960 - „Anwerbeabkommen“ für spanische Arbeitskräfte
Bundesrepublik Deutschland - Spanien * Zwischen Spanien und der Bundesrepublik Deutschland wird ein „Abkommen zur Anwerbung spanischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
30. 3 1960 - „Anwerbeabkommen“ für griechische Arbeitskräfte
Bundesrepublik Deutschland - Griechenland * Zwischen Griechenland und der Bundesrepublik Deutschland wird ein „Abkommen zur Anwerbung griechischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
4 1960 - Der „Franziskus-Brunnen“ am Mariahilfplatz geht in Betrieb
München-Au * Der „Heilige-Franziskus-Brunnen“ am Mariahilfplatz/Ecke Ohlmüllerstraße geht in Betrieb.
3. 5 1960 - Die Amtszeit von OB Thomas Wimmer [SPD] endet
München • Die Amtszeit von Thomas „Dammerl“ Wimmer [SPD] als Münchner Oberbürgermeister endet.
3. 5 1960 - Hans-Jochen Vogel [SPD] wird Münchner Oberbürgermeister
<p><strong><em>München</em></strong> • Hans-Jochen Vogel [SPD] wird Münchner Oberbürgermeister. </p>
19. 5 1960 - Der 1.000.000ste USA-Auswanderer seit 1949
München-Riem * Der 999.999ste und der 1.000.000ste Auswanderer seit 1949 besteigt am Flughafen München Riem ein Charterflugzeug nach Amerika, dem Land der - erhofften - unendlichen Möglichkeiten.
20. 5 1960 - Als The Silver Beetles durch Schottland
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Die erneut umbenannte Gruppe nennt sich jetzt <em>„The Silver Beetles“</em>. Sie begleiten Johnny Gentle auf seiner Tournee vom 20. bis 28. Mai durch Schottland. Für die Beatles ist das die erste Tournee. Bassgitarre spielt Stuart Sutcliffe, am Schlagzeug sitzt Tommy Moore.</p>
29. 5 1960 - Das Kavallerie-Denkmal vor dem Hauptstaatsarchiv wird enthüllt
München-Maxvorstadt * Das Kavallerie-Denkmal vor dem Hauptstaatsarchiv wird enthüllt. Der Wehrmachtsgeneral a.D. Dietrich von Saucken lobt dabei die Eigenschaft der „Deutschen Soldatenpferde“ und die sich daraus ergebenden Charaktereigenschaften: „Fromm, willig und ausdauernd bis zum letzten Atemzug“, lautet seine Analyse.
Der Entwurf zu dem überlebensgroßen, ungesattelten Bronzepferd stammt von dem Bildhauer Bernhard Bleeker, der schon den toten Soldaten im Kriegerdenkmal im Hofgarten geschaffen hat.
7 1960 - Norman Chapman, Schlagzeuger der „Silver Beatles“
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Norman Chapman spielt das Schlagzeug bei den <em>„Silver Beatles“</em>. </p>
1. 7 1960 - Die Pfarrkuratie St. Elisabeth wird zur Stadtpfarrei
München-Haidhausen * Kardinal Joseph Wendel erhebt die Pfarrkuratie zur Stadtpfarrei St. Elisabeth.
27. 7 1960 - Liesl Karlstadt stirbt im Alter von 68 Jahren
Garmisch * Liesl Karlstadt stirbt im Alter von 68 Jahren während einer Urlaubsreise in Garmisch.
30. 7 1960 - Liesl Karlstadt wird am Ostfriedhof ausgesegnet
München-Obergiesing - München-Bogenhausen * Liesl Karlstadt wird unter größter Anteilnahme der Münchner Bevölkerung am Ostfriedhof ausgesegnet. Ihr Grab befindet sich auf dem Bogenhausener Prominentenfriedhof.
Ab 31. 7 1960 - Der 37. Eucharistische Weltkongress tagt in München
München * Bis 7. August 1960 tagt in München der 37. Eucharistische Weltkongress.
9. 8 1960 - Das Jugendarbeitsschutzgesetz verbietet die Kinderarbeit
<p>Bonn * Kinderarbeit wird in der Bundesrepublik Deutschland durch das <em>„Jugendarbeitsschutzgesetz“</em> generell verboten, indem es </p> <ul> <li>das Mindestalter für die Beschäftigung Jugendlicher auf 14 Jahre festlegt. </li> <li>Akkord- und Fließbandarbeit werden strikt untersagt. </li> </ul> <p> </p>
12. 8 1960 - Pete Best, neuer Schlagzeuger der Beatles
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * In Liverpool wird Pete Best der neue <em>Drummer</em> der <em>Beatles</em>. </p>
17. 8 1960 - Die Beatles spielen im Indra auf der Reeperbahn
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Die Beatles beginnen ihre Hamburger Gastspiele im Indra, einem ursprünglichen Striptease-Lokal auf der Reeperbahn, in dem zur Eröffnung als Musikkneipe die Band aus Liverpool auftritt. Das Lokal, das gerade mal Platz für sechzig Leute hat, wird von Bruno Koschmider geführt.</p> <p>48 Nächte werden die Beatles an sieben Tagen in der Woche für eine Tagesgage von 30 bis 40 DMark pro Mann spielen. Ihre Musik kommt nicht sonderlich gut an, denn die Besucher wollen eigentlich keine Rockmusik hören, sondern Striptease sehen. </p>
3. 10 1960 - Letzter Beatles-Auftritt im Indra
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Die Beatles spielen letztmals im Hamburger Indra. Nachbarn beschweren sich über den Lärm. </p>
Ab 4. 10 1960 - Die Beatles spielen im Kaiserkeller
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Die Beatles spielen im Kaiserkeller, nachdem Bruno Koschmider den Musikbetrieb im Indra wegen Lärmbelästigung einstellen muss. Im Kaiserkeller lernen sie auch Ringo Starr kennen, der bei Rory Storm and The Hurricans am Schlagzeug sitzt. Langsam erreichen sie die Anerkennung des Hamburger Publikums. Zu ihren Fans gehören der Grafiker Klaus Voormann und die Fotografin Astrid Kirchherr. </p>
30. 10 1960 - Der Top Ten Club auf der Reeperbahn
Hamburg * Der Top Ten Club auf der Reeperbahn 136 wird in Konkurrenz zum Indra und zum Kaiserkeller eröffnet. Zwischendurch treten die Beatles dort - illegal - mit Tony Sheridan auf.
1. 11 1960 - Kündigung des Vertrags mit den Beatles
Hamburg * Bruno Koschmider kündigt den Vertrag mit den Beatles zum 30. November mit der Begründung, dass George Harrison erst 17 Jahre alt sei.
21. 11 1960 - George Harrison wird ausgewiesen
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * George Harrison von den Beatles muss aufgrund seines jungen Lebensalters Deutschland verlassen. </p>
30. 11 1960 - Der Top Ten Club verpflichtet die Beatles
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Der Geschäftsführer des Top Ten Clubs, Peter Eckhorn, verpflichtet die Beatles ab April 1961 zum Auftritt in seinem Lokal. </p>
12 1960 - An den vier Adventssamstagen öffnen die Läden bis 18.00 Uhr
München * An den vier Adventssamstagen wird eine Ladenöffnungszeit bis 18.00 Uhr erlaubt.
5. 12 1960 - Paul McCartney wird ausgewiesen
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Paul McCartney und Pete Best werden wegen fehlender Arbeitserlaubnisse und Arbeitsgenehmigungen sowie <em>„Brandstiftung“</em> aus Deutschland ausgewiesen.</p> <p>Stuart Sutcliffe hat sich inzwischen mit Astrid Kirchherr verlobt und bleibt bis Mitte Februar 1961 in Hamburg. </p>
Bis um den 10. 12 1960 - John Lennon spielt mit Tony Sheridan im Top Ten Club
<p><strong><em>Hamburg - Liverpool</em></strong> * John Lennon spielt mit Tony Sheridan im Top Ten Club und kehrt dann ebenfalls nach Liverpool zurück. </p>
27. 12 1960 - Auftritt der Beatles in Liverpool
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Die Beatles treten erstmals wieder in Liverpool auf. <em>„In Hamburg haben wir uns wirklich entwickelt, dort mussten wir alles versuchen, was uns nur einfiel. Erst nach unserer Rückkehr aus Deutschland wurden wir uns über den Unterschied klar.“</em> </p>
31. 12 1960 - Joseph Wendel stirbt nach der Silvester-Andacht
München-Kreuzviertel * Kardinal Joseph Wendel stirbt nach der Silvester-Andacht auf dem Weg zum Erzbischöflichen Palais.
1961 - Dr. Hermann Schülein erhält den Bayerischen Verdienstorden
München * Dr. Hermann Schülein erhält den Bayerischen Verdienstorden.
1961 - Der Stadtrat setzt jetzt auf Müllverbrennung
München-Großlappen * Schon wenige Jahre nach der Inbetriebnahme der Großanlage für Müllverwertung in Großlappen ist die Anlage zu klein.
Der Stadtrat setzt jetzt auf die Müllverbrennung.
1961 - Kurt Plapperer wird 2. Geschäftsführer des „Deutschen Theaters“
München-Ludwigsvorstadt * Kurt Plapperer wird stellvertretender Geschäftsführer des „Deutschen Theaters“.
1961 - Die Turmschreiber vergeben ihren Poetentaler
München-Graggenau - München-Angerviertel * Die Turmschreiber vergeben im Turmstüberl des Valentin-Musäums erstmals ihren Poetentaler.
1961 - München hat 1.084.500 Einwohner
München * München hat 1.084.500 Einwohner.
1 1961 - Im „Bürgerbräukeller“ findet der Faschingsball „Karneval in Texas“ statt
München-Haidhausen * Im „Bürgerbräukeller“ findet der traditionelle Faschingsball „Karneval in Texas“ des „Cowboy-Clubs München 1913“ statt.
Die Feierabend-Rothäute und Freizeit-Cowboys von der „Nockher-Ranch“ lassen ihre Colts sprechen, springen durch Lassos und stellen ihre Squaws und Cowgirls an die Bretterwand, um sie dann mit Pfeilen und brennenden Wurfmessern einzurahmen.
9. 2 1961 - Nachmittags-Konzert im „Cavern Club“
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Die Beatles geben ihr erstes (Nachmittags-) Konzert im <em>„Cavern Club“</em> in Liverpool. </p>
18. 3 1961 - Franz Josef Strauß ist neuer CSU-Vorsitzender
<p><strong><em>München</em></strong> * Franz Josef Strauß ist neuer CSU-Vorsitzender.</p>
21. 3 1961 - Die Beatles im Liverpooler Cavern Club
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Erster Abendauftritt der Beatles im Cavern Club in Liverpool. Mit Unterbrechungen bleiben sie der Musikkneipe bis 3. August 1963 treu. </p>
27. 3 1961 - Die Beatles wieder in Hamburg
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Die Beatles kehren mit einer ein Jahr gültigen Aufenthaltsgenehmigung nach Hamburg zurück. </p>
Um 4 1961 - Der „Cowboy Club München 1913“ muss den Nockherberg verlassen
München-Au * Der „Cowboy Club München 1913“ will auf dem „Nockherberg“ eine neue „Club-Ranch“ und einen neuen Pferdestall erbauen und damit die vereinseigenen Pferde auf die „Nockher-Ranch“ holen.
Anfangs sind die Pferde des „Cowboy Clubs München“ in einer Lackiererei an der Lilienstraße, später in einem Holzhaus nahe der „Schinderbrücke“ beim „Flaucher“ untergebracht.
Doch als Frau Ida Krone stirbt, müssen die Westernfreunde ihre „Ranch am Nockherberg“ räumen, nachdem die Zirkusfamilie Krone das Gelände an der Marsstraße im Tausch mit dem „Nockherberg-Areal“ erhalten kann.
1. 4 1961 - De Beatles sieben Tage in der Woche im Top Ten Club auf
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Bis zum 1. Juli 1961 treten die Beatles sieben Tage in der Woche im Top Ten Club auf. Pro Abend und Mann gibt‘s schon 40 DMark. Stuart Sutcliffe verlässt die Gruppe, um sich auf sein Kunststudium zu konzentrieren. </p>
22. 6 1961 - Tony Sheridan and The Beatles
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Gemeinsam mit Tony Sheridan nehmen die Beatles „<em>The Saints (When The Saints Go Marching in)</em>“, produziert von Bert Kaempfert, auf Single auf. Die B-Seite der Single heißt „<em>My Bonnie (Lies Over The Ocean)</em>“ und handelt von Bonnie Prince Charles, der anno 1745 in Schottland landet und von dort einen Aufstand gegen die britische Krone beginnt.</p>
2. 7 1961 - Die Beatles sind wieder zurück in Liverpool
<p><strong><em>Liverpool - Hamburg</em></strong> * Die Beatles kehren nach Liverpool zurück. Stuart Sutcliffe bleibt in Hamburg bei Astrid Kirchherr. </p>
3. 7 1961 - Kardinal Julius Döpfner wird 10. Erzbischof von München und Freising
Rom-Vatikan - München-Kreuzviertel * Kardinal Julius Döpfner wird zum 10. Erzbischof von München und Freising ernannt.
5. 7 1961 - Mary Heilmann-Stuck stirbt
München * Mary Heilmann-Stuck, die einzige Tochter des Malerfürsten, stirbt.
22. 7 1961 - Stadtoberhäuptling Hans-Jochen Vogel im Reservat
München-Thalkirchen * Mit Cowboyhut auf dem Kopf legt Münchens Stadtoberhäuptling Dr. Hans-Jochen Vogel anno 1961 den Grundstein zur neuen Ranch des Cowboy Clubs München von 1913 auf einem 4.000 Quadratmeter großes Gelände an der Floßlände in Thalkirchen.
Doch da sind Bombentrichter und Urwald, die mit Hilfe von Bulldozern der amerikanischen Armee bearbeitet werden müssen.
28. 7 1961 - Der Liesl-Karlstadt-Brunnen am Viktualienmarkt wird aufgedreht
München-Angerviertel * Der Liesl-Karlstadt-Brunnen am Viktualienmarkt wird erstmals aufgedreht. Hans Osel formte die Bronzefigur der langjährigen Partnerin von Karl Valentin.
18. 9 1961 - Ergebnis der Bundestagswahl 1961
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 4. Deutschen Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Konrad Adenauer 45,3 Prozent [- 4,9] und 251 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Willy Brandt erringt 36,2 Prozent der Stimmen [+ 4,4] und 203 Sitze.
- Die FDP bekommt 12,8 Prozent [+ 5,1] und 67 Sitze.
Konrad Adenauer [CDU] wird Bundeskanzler einer Koalition aus CDU/CSU und FDP.
23. 9 1961 - Wiggerl Hagn übernimmt das Schützenzelt von seiner Mutter
München-Theresienwiese • Ludwig Wiggerl Hagn übernimmt das Schützenzelt von seiner Mutter.
30. 9 1961 - Kardinal Julius Döpfner wird inthronisiert
München-Kreuzviertel * Kardinal Julius Döpfner wird als Erzbischof von München und Freising inthronisiert. Er gehört - neben Papst Johannes XXIII. - zu den vier leitenden Persönlichkeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils und bemüht sich um eine Annäherung an die SPD.
Um 10 1961 - „The Saints/My Bonnie“ erscheint in Deutschland
<p><strong><em>Bundesrepublik Deutschland</em></strong> * Die Single <em>„The Saints/My Bonnie“</em> erscheint in Deutschland unter dem Interpretennamen Tony Sheridan & The Beat Brothers.</p>
31. 10 1961 - Anwerbeabkommen mit der Türkei
Bundesrepublik Deutschland-Bonn - Ankara * Zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland wird das „Abkommen zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
9. 11 1961 - Brian Epstein hört erstmals die Beatles
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Brian Epstein besucht den Liverpooler Cavern Club und hört dort erstmals die Beatles. </p>
3. 12 1961 - Brian Epstein wird Manager der Beatles
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * Brian Epstein bittet die Beatles in sein Büro. Er will ihr Manager werden. </p>
1962 - In 14 Münchner „Ziegeleien“ werden 100 Millionen Steine gebrannt
München * In 14 Münchner „Ziegeleien“ werden 100 Millionen Steine gebrannt.
Um 1962 - Vor dem Restaurant „Hirschau“ entsteht eine „Rollschuhbahn“
München-Englischer Garten - Hirschau * Aus der „Parktanzfläche“ vor dem Restaurant „Hirschau“ entsteht eine „Rollschuhbahn“.
1962 - Aus dem Falkenhof wird das italienische Restaurant Il Falco
München-Au * In dem im Jahr 1962 erstellten Neubau wird wieder eine Wirtschaft mit dem klassischen Namen Falkenhof eingerichtet.
Heute führt das dort etablierte italienische Restaurant den Namen Il Falco.
1962 - Goldene Schallplatte für „My Bonnie“
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Tony Sherdan erhält eine Goldene Schallplatte für <em>„My Bonnie (lies over the ocean)“</em>.</p>
1962 - Die erste „Münchner Wehrkundetagung“
München-Maxvorstadt * Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin lädt zur ersten „Münchner Wehrkundetagung“ in die Räume der Münchner „Industrie- und Handelskammer - IHK“ ein.
Bis 1962 - Das „Gasthaus Schweizer Wirt“ in Obergiesing
München-Obergiesing * An der Stelle des ehemaligen Kaufhauses „Karstadt“, heute „Woolworth“, an der Tegernseer-Land-Straße befindet sich der „Schweizer Wirt“.
In der Wirtschaft findet die „Giesinger Kirta“ statt.
Außerdem dient sie dem „Giesinger Faschingsverein“ als Hauptquartier.
1. 1 1962 - Die Beatles spielen - erfolglos - bei Decca Records vor
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Beatles spielen - erfolglos - bei Decca Records in London vor. Obwohl sie keinen Vertrag erhalten, schickt Brian Epstein die Aufnahmen als Demo zu EMI. </p>
5. 1 1962 - „The Saints/My Bonnie“ erscheint in Großbritannien
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Single <em>„The Saints / My Bonnie“</em> erscheint nun auch in Großbritannien. Jetzt bereits unter dem Interpretennamen Tony Sheridan & The Beatles.</p>
23. 1 1962 - Absage der Beatles für den Hamburger Top-Ten-Club
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Der Beatles-Manager Brian Epstein gibt dem Hamburger Top-Ten-Club-Geschäftsführer Peter Eckhorn eine Absage. Dieser wollte die Beatles erneut verpflichten. </p>
24. 1 1962 - Brian Epstein, der fünfte Beatle
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Beatles unterzeichnen den Managervertrag mit Brian Epstein. </p>
2. 2 1962 - ADAC fordert: „Weg mit diesem Mördern am Straßenrand“
München * In einem Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung klagt der Allgemeine Deutsche Automobilclub - ADAC die „wahren Schuldigen am Massensterben auf den Straßen“ an: die Alleebäume. Der ADAC fordert: „Weg mit diesem Mördern am Straßenrand.“
4 1962 - EP mit Tony Sheridan & The Beatles
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * In England erscheint eine EP mit Tony Sheridan & The Beatles mit den Titel <em>„My Bonnie“, „Why“, „Cry For A Shadow“</em> und <em>„The Saints (When The Saints Go Marching In)“</em>.</p>
10. 4 1962 - Stuart Sutcliffe stirbt um Alter von 21 Jahren.
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Stuart Sutcliffe, der ehemalige Bassist der Beatles, stirbt im Alter von 21 Jahren in Hamburg. </p>
13. 4 1962 - Die Beatles spielen im Hamburger „Star Club“
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Der <em>„Star Club“</em> in Hamburg wird mit den Beatles eröffnet. Sie spielen dort bis 31. Mai insgesamt 48 Konzerte. </p>
9. 5 1962 - Brian Epstein handelt einen Vertrag mit Parlophone Records aus
<p><strong><em>Hamburg - London</em></strong> * Während die Beatles im Hamburger <em>„Star-Club“ </em>spielen, handelt Brian Epstein, ihr Manager, einen Vertrag mit Parlophone Records aus. </p>
Um den 3. 6 1962 - Der Slogan: „München - Weltstadt mit Herz“
München * Das Ergebnis eines vom Münchner Verkehrsverein ausgeschriebenen Wettbewerbs für ein neues München-Image steht fest. Der Slogan lautet: „München - Weltstadt mit Herz.“
5. 6 1962 - Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und rund 2.000 Personen
München-Maxvorstadt * Im Anschluss an ein Jazzkonzert kommt es an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und rund 2.000 Personen, als nach dem Ende des Konzerts in der Aula der Universität zahlreiche Konzertbesucher die Musiker auffordern, auf dem Geschwister-Scholl-Platz weiterzuspielen.
Als die mit Buhrufen begrüßte Polizei eintrifft, kommt es zu Rangeleien und zwei Festnahmen. Die Polizei wird von den Protestierern durch eine Blockade am Wegfahren gehindert. Dabei werden auch die Reifen des Einsatzwagens zerstochen.
Die bedrängten Polizisten rufen Verstärkung, die mit zwei Funkstreifenwagen, dem Kleinen und Großen Überfallkommando sowie dem Bereitschaftszug der Stadtpolizeischule am Ort der Auseinandersetzung eintrifft. Der Polizeimacht gelingt es an diesem Abend die Menge zu zerstreuen. Es kommt zu weiteren sieben Festnahmen. Die so Festgesetzten werden alle wegen Auflauf und Landfriedensbruch angezeigt.
Dieses Geplänkel geht als „Unikrawall“ in die Geschichte ein.
6. 6 1962 - Erste Plattenaufnahmen der Beatles in den Abbey Road Studios
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Beatles beginnen ihre Plattenaufnahmen in den Abbey Road Studios der EMI. Am Schlagzeug sitzt noch Pete Best. </p>
20. 6 1962 - Der Polizeieinsatz am Wedekind-Brunnen
München-Schwabing * Der nächste Polizeieinsatz, der letztlich zu den Schwabinger Krawallen führen wird, erfolgt am Wedekindplatz. Am späten Abend schreiten die Ordnungshüter gegen eine Gruppe Gitarristen und deren rund 150 Zuhörer ein, weil sie „ruhestörenden Lärm verursachten, indem sie musizierten, sangen, in die Hände klatschten, zum Teil auch tanzten und grundlos grölten“.
Weil die Beamten mit Pfeifen und Buhrufen empfangen werden, rufen sie umgehend das Kleine Überfallkommando herbei. Nach einer dreimaligen über Lautsprecher verbreiteten Aufforderung den Platz zu verlassen, räumen die Zuschauer - ohne nennenswerten Widerstand - den Wedekindplatz.
21. 6 1962 - Die Schwabinger Krawalle beginnen
München-Schwabing * An Fronleichnam, einem katholischen Feiertag in Bayern, beginnen die sogenannten „Schwabinger Krawalle“. Das erste Aufeinandertreffen zwischen Polizei und etwa 50 Zuhörern von drei Gitarrenspielern erfolgt gegen 21:45 Uhr - weit weg von jedem Wohnblock - im Englischen Garten am Monopteros. Doch es läuft glimpflich ab, denn die Jugendlichen folgen der Aufforderung der Polizei und gehen auseinander.
Eine knappe halbe Stunde später löst am Wedekindplatz eine andere Streifenwagenbesatzung - ebenfalls ohne größere Probleme - eine aus etwa 150 Personen bestehende Ansammlung auf, die sich um drei Gitarristen gruppiert hat.
Um 22:35 Uhr kommt es an der Leopold-/Ecke Martiusstraße zum dritten Polizeieinsatz und daraus resultierend zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer aus etwa 200 Personen bestehenden Gruppe, die sich um fünf Gitarristen gebildet hat. Die Band besteht aus den Gymnasiasten Michael Erber und Klaus Olbrich, den Lehrlingen Wolfram Kunkel und Hans (Sitka) Wunderlich und dem jungen Schreiner Rüdiger Herzfeldt. Sie singen und spielen russische Volkslieder.
Nachdem sich einige Anwohner über die Störung der Nachtruhe bei der Polizei beschwert haben, treffen zwei Beamte am „Tatort“ ein und fordern die jungen Gitarrespieler zum Einsteigen in den Funkstreifenwagen auf. Das Einschreiten der Polizei gegen die Musiker wird von den Zuhörern - „spontan und ohne vorherige Planung“ - als Festnahme gedeutet.
Diese artikulieren daraufhin ihren Unmut ziemlich laut und unmissverständlich. Es kommt zu Rangeleien mit den Ordnungshütern, die nun ihrerseits Verstärkung anfordern, nachdem die Randalierer die Luft aus den Reifen des Polizeiautos lassen. Mit einem ersten Gummiknüppeleinsatz kann die Polizei die auf mehrere hundert Menschen angewachsenen Protestierer vom Schauplatz abdrängen. Kaum dass die Polizisten abgerückt sind, läuft eine noch größere Menschenmenge als zuvor (Schätzungen sprechen von 5.000 Personen) auf die Leopoldstraße und blockiert den Auto- und Straßenbahn-Verkehr mit Stühlen und indem sie sich selbst auf der Straße niederlassen.
Erst nach der zweimaligen Räumung der Straße und der Festnahme von 41 Personen erklärt die Polizei um 1:40 Uhr den Einsatz für beendet. Laut Polizeibericht kommen 90 Beamte zum Einsatz. Zwei Protestierer werden nachträglich zur Anzeige gebracht.
22. 6 1962 - Die Schwabinger Krawalle gehen weiter
München-Schwabing * Freitag. Die Schwabinger Krawalle gehen weiter. Ab 21 Uhr laufen „unzählige junge Leute [...] immer weiter in die Fahrbahn hinein“ und blockieren damit die Leopoldstraße. Nach Beschwerdeanrufen trifft die Polizei ein.
Der Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und der Polizeipräsident Manfred Schreiber sprechen mit den Protestierenden. Letztlich werden sie aber von den 10.000 Anwesenden niedergeschrieen und ausgepfiffen, weshalb es zur zweiten gewaltsamen Räumung der Leopoldstraße kommt.
Die Auseinandersetzungen dauern bis in die frühen Morgenstunden an. Laut Polizeibericht kommen über 100 Polizisten zum Einsatz, die 24 Protestierer festnehmen und vier weitere nachträglich zur Anzeige bringen.
23. 6 1962 - Bei einer Straßenschlacht werden 14 Randalierer schwer verletzt
München-Schwabing * Samstag. Wieder versammeln sich bis zu 10.000 Protestierer auf der Leopoldstraße und erstellen Straßenblockaden. Mit Feuerwerkskörpern versuchen sie die Pferde der berittenen Polizei scheu zu machen. Flaschen und Steine fliegen in Richtung der Polizei. Dabei werden drei Beamte verletzt.
Bei einer regelrechten Straßenschlacht, bei der die Polizei vom massiven Schlagstockeinsatz gebrauch macht, werden 14 Randalierer schwer verletzt. Der Student Georg Friz schwebt nach einem Leberriss in Lebensgefahr. Nach Ansicht von Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel haben an diesem Samstag weniger die Studenten als „vor allem der Pöbel aller Stadtviertel“ in Schwabing ihr Unwesen getrieben.
Laut Polizeibericht kommen über 150 Polizisten zum Einsatz. 16 Protestierer werden festgenommen und neun nachträglich zur Anzeige gebracht.
24. 6 1962 - Wieder beginnen die Straßenblockaden
München-Schwabing * Sonntag. Die Proteste der Schwabinger Krawalle lassen zwar nach, doch Pressebeobachter zählen immer noch 3.000 Teilnehmer. Sogar Studentengruppen wenden sich nun gegen die Fortsetzung des Protests. Wieder beginnen die Straßenblockaden. Es kommt zu den „härtesten Auseinandersetzungen“, die sich auch an der besonders hohen Zahl von Festnahmen ablesen lässt.
Man schiebt die Gewalttätigkeit der Halbstarken-Szene zu. Doch spätere Untersuchungen können diese Mutmaßung nicht bestätigen. Der Anteil der Studenten an den Protestveranstaltungen hat sich gegenüber dem Vortag prozentual sogar erhöht. Laut Polizeibericht kommen über 450 Polizisten zum Einsatz, die 85 Protestierer festnehmen und 13 nachträglich zur Anzeige bringen.
25. 6 1962 - Rund 2.500 Protestierer versammeln sich an der Leopoldstraße
München-Schwabing * Montag. Rund 2.500 Protestierer versammeln sich an der Leopoldstraße. Mehrere hundert Jugendliche blockieren erneut den Verkehrauf dem Boulevard. Gegen 1 Uhr räumt die Polizei die Straße. Rund 200 Protestierer werden „eingekesselt“ und anschließend festgenommen, darunter auch der spätere RAF-Terrorist Andreas Baader. Damit enden die Schwabinger Krawalle. Laut Polizeibericht kommen an diesem Tag rund 360 Polizisten zum Einsatz. 35 Protestierer werden festgenommen, sieben nachträglich zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus werden über 200 Anwesende zur Personalienfeststellung kurzfristig in Gewahrsam genommen.
Dass die Stadtpolizei an allen Tagen keine Wasserwerfer einsetzt, liegt an der in der Leopoldstraße verkehrenden Straßenbahn. Man hätte nämlich aus Sicherheitsgründen die Strom führenden Oberleitungen außer Betrieb nehmen müssen. Außerdem befürchtet man angesichts der sommerlichen Temperaturen, dass ein Wasserwerfer zur weiteren „Erheiterung“ der Protestierenden beigetragen hätte.
Fazit: Gegen 248 Personen werden Ermittlungen wegen der Beteiligung an den Schwabinger Krawallen aufgenommen. Darunter finden sich lediglich 13 Frauen. Fast drei Viertel der Verfahren werden eingestellt. 54 Angeklagte werden verurteilt; es gibt 13 Freisprüche. Das Durchschnittsalter der Verurteilten liegt bei 22 Jahren.
Von den jungen Berufstätigen werden auffällig viele verurteilt. Während aus dem akademischen Nachwuchs nur jeder Zehnte eine Strafe erhält, ist es bei den Nichtakademikern nahezu jeder Zweite. Es werden sechs Gefängnisstrafen zwischen drei und dreizehn Monaten ausgesprochen, wovon fünf auf Nichtakademikern fallen. Die Geldstrafen liegen zwischen 40 und 1.000 DMark. Die Jungakademiker kommen mit Geldbußen und Strafen auf Bewährung davon.
Gegen Angehörige der Stadtpolizei werden 143 Verfahren eröffnet. Lediglich 14 Polizisten werden aber mit Anklagen konfrontiert. Vier Ordnungshüter werden rechtskräftig verurteilt. Darunter ist nur ein Stadtpolizist, der an den Einsätzen vor Ort beteiligt war. Die drei Anderen sind als Aufseher in der Polizeihaftanstalt tätig.
Der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann protestiert in einer Resolution gegen die Ausschreitungen, die das „Machwerk verantwortungsloser, ortsfremder Elemente“ gewesen sei und bedankt sich ausdrücklich bei der Münchner Polizei für das mutige und tatkräftige Einschreiten.
26. 6 1962 - 250 Demonstranten treffen sich am Monopteros
München-Lehel - Englischer Garten * Am Monopteros im Englischen Garten treffen sich rund 250 Protestierer zu einer vom Ortnungsamt verbotenen Kundgebung. Doch statt der Protestkundgebung wird über die Ereignisse der Schwabinger Krawalle diskutiert und in einer Resolution eine genaue Überprüfung der Vorfälle und die Kennzeichnung der Polizisten mit Dienstnummern gefordert. Die Versammlung wird aufmerksam von der Polizei beobachtet.
Der Allgemeine Studenten-Ausschuss der Ludwig-Maximilians-Universität distanziert sich per Flugblatt von den Protesten.
27. 6 1962 - Die Mitglieder des Stadtrats stellen sich hinter die Münchner Stadtpolizei
München-Graggenau * In einer Interfraktionellen Erklärung stellen sich nahezu alle Mitglieder des Stadtrats hinter die Münchner Stadtpolizei.
29. 6 1962 - Das Studentenparlament missbilligt das Verhalten der Protestierer
München-Maxvorstadt * Das Studentenparlament der Ludwig-Maximilians-Universität missbilligt das „teilweise kriminelle Verhalten“ einzelner Protestierer. Es schreibt aber die Hauptschuld an den Ausschreitungen bei den Schwabinger Krawallen dem „unklugen und rücksichtslosen Vorgehen der Polizei“ zu.
12. 7 1962 - Die Rolling Stones geben ihr Livedebüt
London * Die Rolling Stones geben im Londoner Marquee Club ihr Livedebüt. Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards und Pianist Ian Stewart sowie Bassist Dick Taylor [später bei The Pretty Things] und Drummer Mick Avory [später bei The Kinks] treten erstmals auf.
Das Repertoire der Rolling Stones besteht aus Blues-Standards wie Kansas City, Hoochie Coochie Man oder Bright Lights.
5. 8 1962 - Die Schauspielerin Marilyn Monroe stirbt in Los Angeles
<p><em><strong>Los Angeles</strong></em> * Die Schauspielerin Marilyn Monroe stirbt in Los Angeles an noch immer nicht geklärten Ursachen. </p>
15. 8 1962 - Ringo Starr wird Schlagzeuger der Beatles
<p><strong><em>London</em></strong> * Ringo Starr wird Schlagzeuger der Beatles, weil George Martin mit der Leistung von Pete Best auf diesem Instrument nicht zufrieden ist.</p>
16. 8 1962 - Pete Best wird bei den Beatles gekündigt
<p><strong><em>London</em></strong> * Da George Martin mit dem Schlagzeugspiel von Pete Best nicht zufrieden ist, muss ihm Brian Epstein die Nachricht überbringen, dass er nicht mehr den Beatles angehört. </p>
18. 8 1962 - Erster gemeinsamer Liveauftritt der Beatles mit Ringo Starr
<p><strong><em>Port Sunlight</em></strong> * Ringo Starr spielt zum ersten Mal bei einem Liveauftritt der Beatles in der Hulme Hall in Port Sunlight. </p>
23. 8 1962 - John Lennon heiratet Cynthia Powell
<p><strong><em>Liverpool</em></strong> * John Lennon heiratet die schwangere Cynthia Powell in Liverpool. </p>
1. 9 1962 - Der AStA veröffentlicht seinen Untersuchungsbericht zu den Krawallen
München-Maxvorstadt * Der Allgemeine Studenten-Ausschuss der Ludwig-Maximilians-Universität veröffentlicht seinen Untersuchungsbericht zu den Schwabinger Krawallen. Er stellt fest, dass es sich dabei insgesamt um keine Studentenunruhen gehandelt hat. Nur an den ersten Protestabenden waren Studenten führend beteiligt. Der Stadtpolizei wird ein „taktisch unkluges Vorgehen“ bescheinigt.
4. 9 1962 - Erste Aufnahmen der Beatles von „Love Me Do“ mit Ringo
<p><strong><em>London</em></strong> * Erste Aufnahmen der Beatles von <em>„Love Me Do“</em><em> </em>mit Ringo Starr am Schlagzeug. </p>
11. 9 1962 - Erneute Aufnahme von „Love Me Do“
<p><strong><em>London</em></strong> * Erneute Aufnahme der Beatles von <em>„Love Me Do“. </em>Das Schlagzeug spielt jetzt Andy White, Ringo Starr unterstützt ihn nur mit dem Tamburin. </p>
Lange vor dem 22. 9 1962 - Bürgermeister Albert Bayerle will die Wirtsbudenstraße auflösen
München-Theresienwiese • Bürgermeister Albert Bayerle will die Wirtsbudenstraße auflösen. Alle Festzelte sollen mit Notausgängen nach außen rings um den Festplatz verteilt und Karusells und Schaustellungen ins Innere des großen Runds gelegt werden. Das würde bei Notfällen eine reibungslose Räumung der Riesenhallen erlauben. Die Planungen scheitern an den Kosten und den Brauereien.
1. 10 1962 - Brian Epstein und die Beatles binden sich vertraglich
<p><strong><em>London</em></strong> * Brian Epstein unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag mit den Beatles. </p>
5. 10 1962 - Die erste Beatles-Single „Love Me Do“ erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Mit <em>„Love Me Do / P.S. I Love You“</em> erscheint die erste Single der Beatles.</p>
13. 10 1962 - Franz Halmanseger, der Rekommandeur vor dem Hippodrom, stirbt
München - München-Theresienwiese * Franz Halmanseger, der Rekommandeur vor dem Hippodrom, stirbt - sechs Tage nach dem Wiesn-Ende - im Alter von 78 Jahren. Bekannt war er auch wegen seiner Sprüche: „Treten Sie ein, Herr Baron, die Pferde sind gesattelt. Alles Glück auf der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“
17. 10 1962 - Erster Fernsehauftritt der Beatles
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Erster Fernsehauftritt der Beatles im Regionalfernsehen. </p>
26. 10 1962 - Eine widerrechtliche Polizeiaktion gegen das Magazin „Der Spiegel“
Bonn * Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß veranlasst eine widerrechtliche Polizeiaktion gegen das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Es ist zu erwarten, dass sich diese Aktion negativ auf das Wahlergebnis in Bayern auswirken würde. Doch genau das Gegenteil ist der Fall.
25. 11 1962 - Absolute Mehrheit für die CSU
Freistaat Bayern * Mit der Wahl vom 25. November 1962 werden endgültig die Weichen für die späteren Regierungsverhältnisse in Bayern gestellt. Seither führen die der CSU angehörenden Bayerischen Ministerpräsidenten - Alfons Goppel, Franz Josef Strauß und Max Streibl - von der Staatskanzlei an der Prinzregentenstraße 9 aus nur noch reine CSU-Kabinette.
Mit satten 47,5 Prozent der Stimmen kann die CSU ihren Stimmenanteil erneut um fast zwei Prozent erhöhen. Das Ergebnis reicht für die absolute Mehrheit der Landtags-Mandate aus.
26. 11 1962 - Die Beatles nehmen „Please Please Me“ auf
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Beatles nehmen ihre zweite Single <em>„Please Please Me“ </em>auf. </p>
30. 11 1962 - Franz Josef Strauß muss zurücktreten
Bonn * Franz Joseph Strauß muss aufgrund der „Spiegel-Affäre“ sein Amt als Bundesverteidigungsminister niederlegen.
Um den 10. 12 1962 - Bill Wyman wird Bassist bei den Rolling Stones
London * Bill Wyman ersetzt Dick Taylor als Bassist bei den Rolling Stones.
1963 - Umbenennung des „Pfälzer Weinkellers“ in „Der Weinschenk im Weinstadel“
München-Graggenau * Der neue Besitzer des „Pfälzer Weinkellers“ in der Burgstraße nennt diesen in „Der Weinschenk im Weinstadel“ um.
1963 - Das Verwaltungsgebäude des „Studentenwerks“ und die „Mensa“
München-Schwabing * Bis 1970 werden im Nordostteil des „Leopoldparks“ Verwaltungsgebäude des „Studentenwerks“ und die „Mensa“ für täglich 10.000 Essen konzipiert.
Ende 1963 - Der „Sitz des Exarchen der unierten unkrainischen Katholiken“
München-Hackenviertel * Der „Sitz des Exarchen der unierten unkrainischen Katholiken“ wird in der „Allerheiligenkirche am Kreuz“, kurz gesagt, der „Kreuzkirche“ nahe dem „Sendlinger-Tor-Platz“, untergebarcht.
1963 - Die „Wiedereinführung der Todesstrafe“ wird diskutiert
Köln * Die „Wiedereinführung der Todesstrafe“ wird diskutiert.
Der gewesene „Scharfrichter“ Johann Reichhart meldet sich zu Wort und wird vom in Köln gegründeten „Verein zur Wiedereinführung der Todesstrafe e.V.“ zum Ehrenmitglied ernannt.
1963 - Die „Münchner Wehrkundetagung“ erstmals im „Hotel Bayerischer Hof“
München-Kreuzviertel * Die „Münchner Wehrkundetagung“ wird erstmals im „Hotel Bayerischer Hof“ abgehalten.
Sie hat sich seitdem zu einer der wichtigsten europäischen Konferenzen für außen- und sicherheitspolitische Fragen entwickelt.
1963 - Ein „Anwerbeabkommen“ mit Marokko abgeschlossen
Bundesrepublik Deutschland - Marokko * Zwischen Marokko und der Bundesrepublik Deutschland wird ein „Abkommen zur Anwerbung marokkanischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
Ab 3. 1 1963 - Schottland-Tournee der Beatles
<p><em><strong>Schottland</strong></em> * Die Beatles unternehmen eine viertägige Schottland-Tournee.</p>
12. 1 1963 - Die zweite Beatles-Single „Please Please Me“ und „Ask Me Why“
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die zweite Single der <em>Beatles</em> kommt in die Plattenläden. Sie enthält die Titel <em>„Please Please Me“</em> und <em>„Ask Me Why“</em>. </p>
12. 1 1963 - Charlie Watts wird zum Rolling Stone
London * Charlie Watts wird fester Drummer bei The Rolling Stones.
Ab 2. 2 1963 - Helen-Shapiro-Tournee mit den Beatles
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles unternehmen bis 3. März eine Tournee mit der 17-jährigen Helen Shapiro. </p>
11. 2 1963 - Aufnahme der ersten Beatles-LP „Please Please Me“
<p><em><strong>London</strong></em> * Die Beatles nehmen in den Abbey Road Studios ihre erste LP<em> </em><em>„Please Please Me“</em> auf. Zehn der vierzehn Songs werden an einem Tag in neun Stunden und 45 Minuten aufgenommen. Jeder der vier Beatles bekommt dafür 14 £ und 10 Shilling. </p>
5. 3 1963 - Die Aufnahmen für „From Me To You“ entstehen
<p><em><strong>London</strong></em> * Die Beatles nehmen <em>„From Me To You“</em> auf.</p>
8. 3 1963 - „Dinner for One“ erstmals im Fernsehen
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Der Sketch <em>„Dinner for One“</em> wird erstmals mit großem Erfolg im Fernsehen ausgestrahlt. </p>
Ab 9. 3 1963 - Die Beatles treten bis 31. März als Vorgruppe auf
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles treten bis 31. März als Vorgruppe bei den Tourneen von Tommy Roe und Chris Montez auf.</p>
5. 4 1963 - Mit „Please Please Me“ erscheint die erste Langspielplatte der Beatles
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em><em> * „Please Please Me“</em>, die erste Langspielplatte der Beatles, kommt in die Schallplattenläden. Die LP enthält acht eigene Songs, so viel hatte noch nie eine Band zuvor auf einem Album, dazu sechs Cover-Versionen. </p>
8. 4 1963 - Julian Lennon kommt zur Welt
Großbritannien * John Lennons Sohn Julian wird geboren.
12. 4 1963 - „From Me To You“, die 3. Beatles-Single
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles veröffentlichen ihre dritte Single mit den Titeln <em>„From Me To You“</em> und <em>„Thank You Girl“</em>. </p>
3. 5 1963 - Das Deutsche Brauereimuseum im Münchner Stadtmuseum
<p><em><strong>München-Angerviertel</strong></em> * Das Deutsche Brauereimuseum, ein Vorläufer des Bier & Oktoberfestmuseums, wird in den Räumen des Münchner Stadtmuseums eröffnet. </p>
4. 5 1963 - Die Beatles-LP „Please, Please Me“ auf dem 1. Platz
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles-LP<em> „Please, Please Me“</em> steht auf dem ersten Platz der Britischen Charts. Neben dem Titelsong enthält die Langspielplatte Songs wie <em>„Love Me Do“</em> und <em>„Twist And Shout“</em>.</p>
Ab 18. 5 1963 - Die Beatles treten als Vorband bei Roy Orbison auf
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Bis 9. Juni treten die Beatles als Vorband bei Roy Orbison auf. </p>
3. 6 1963 - Papst Johannes XXIII. stirbt im Vatikan
Vatikan * Papst Johannes XXIII. stirbt im Vatikan.
21. 6 1963 - Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini wird als Papst Paul VI. gewählt
Vatikan * Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini wird im fünften Wahlgang als Papst Paul VI. zum Nachfolger von Papst Johannes XXIII. gewählt.
1. 7 1963 - „She Loves You“ wird auf Tonträger aufgenommen
<p><em><strong>London</strong></em> * Die Beatles nehmen in den Abbey-Road-Studios <em>„She Loves You“</em> auf.</p>
7. 7 1963 - Die Rolling Stones veröffentlichen ihre erste Single
Großbritannien * Die Rolling Stones veröffentlichen ihre erste Single mit „Come On“ von Chuck Berry als A-Seite. Die B-Seite trägt den Titel „I Want To Be Loved“ und stammt von Willie Dixon.
12. 7 1963 - Die erste EP der Beatles erscheint
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die erste EP der <em>Beatles</em> erscheint mit den Songs <em>Twist And Shout, A Taste Of Honey, Do You Want To Know A Secret</em> und <em>There‘s A Place</em>.</p>
18. 7 1963 - Die Beatles nehmen „I Wanna Be Your Man“ auf
<p><em><strong>London</strong></em> * Die Beatles nehmen <em>„I Wanna Be Your Man“ </em>auf. Der Titel erscheint auf der LP <em>„With The Beatles“ </em>im November 1963.</p>
3. 8 1963 - Letztes Konzert der Beatles im Cavern Club
<p><em><strong>Liverpool</strong></em> • Die Beatles geben ihr letztes Konzert im Loverpooler Cavern Club. Seit dem 9. Februar 1961 spielten sie in dem Lokal insgesamt 262 Mal. </p>
10. 8 1963 - Die „Ranch“ des „Cowboy Clubs München 1913“ kann eröffnet werden
München-Thalkirchen * 50 Jahre nach der Vereinsgründung kann die „Ranch“ des „Cowboy Clubs München 1913“ - mit großen persönlichen und finanziellen Opfern der Mitglieder - eröffnet werden.
23. 8 1963 - Veröffentlichung der 4. Beatles-Single „She Loves You“
Großbritannien * Die Single „She Loves You / I‘ll Get You“ von den Beatles kommt in die Plattenläden. Es ist ihre vierte Single.
24. 8 1963 - Die Fußball-Bundesliga startet
Bundesrepublik Deutschland * Die Fußball-Bundesliga, die höchste Spielklasse des deutschen Fußballs, startet.
28. 8 1963 - Martin Luther King: „I have a Dream“
<p><em><strong>Washington D.C.</strong></em> * Der Baptistenprediger Martin Luther King spricht vor 250.000 Menschen in Washington D.C., um für seine afroamerikanischen Mitbürger <em>„Freiheit, Gleichheit und Arbeitsplätze“</em> zu fordern. Die Rede beginnt mit den Worten <em>„I have a Dream“</em>. </p> <p>Er träumt darin davon,<em> „dass meine Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden“</em>. Er hebt hervor, dass <em>„der Schwarze auf einer einsamen Insel der Armut inmitten eines weiten Ozeans des materiellen Wohlstands“</em> lebt, ja, er lebt <em>„in seinem eigenen Lande im Exil“</em>. </p> <p>Unter den Zuhörern befindet sich auch Bob Dylan. Präsident John F. Kennedy wollte die Demonstration bis zuletzt verhindern.</p>
28. 8 1963 - Josephine Baker und Martin Luther King
<p><strong><em>Washington D.C.</em></strong> * Josefine Baker schreitet an der Seite des Baptistenprediger Martin Luther King auf Washington und träumt mit ihm den Traum eines gleichen und freien Amerika.</p> <p>So wird aus Baker, der erfolgreichen Tänzerin, eine Kämpferin für den Frieden, eine Galionsfigur der Bürgerrechtsbewegung und - weil sie ihre Bisexualität stets offen gelebt hatte und bewusst an der Seite homosexueller Künstler aufgetreten ist - bis heute auch eine Ikone der LGBT-Bewegung. </p>
29. 8 1963 - Das erste Rock-Konzert im Cirkus Krone
München-Maxvorstadt * Das erste Rock-Konzert im Cirkus Krone - mit Chubby Checker, Tony Sheridan, Manuela und anderen. Die Konzerte beginnen um 19:00 Uhr sowie um 21:30 Uhr und sind ausverkauft.
12. 9 1963 - Erster Platz der britischen Charts für die Beatles
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles stürmen mit <em>„She Loves You“</em> auf den ersten Platz der britischen Charts. Der Song hält sich vier Wochen.</p>
21. 9 1963 - Thomas Wimmer zapft letztmals das erste Wiesn-Fass an
München-Theresienwiese * Thomas Wimmer zapft letztmals das erste Wiesn-Fass im Schottenhamel-Festzelt an, obwohl Hans-Jochen Vogel schon im Jahr 1960 zum Oberbürgermeister gewählt worden ist.
Ab 5. 10 1963 - Tournee der Beatles durch Schottland
<p><em><strong>Schottland</strong></em> * Die Tournee der Beatles durch Schottland beginnt. Sie dauert bis zum 7. Oktober 1963. </p>
11. 10 1963 - Die Beatles erhalten ihre erste Goldene Schallplatte
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles erhalten ihre erste Goldene Schallplatte für eine Million verkaufter Exemplare der Single <em>„She Loves You“</em>.</p>
15. 10 1963 - Konrad Adenauer [CDU] tritt als Bundeskanzler zurück
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Konrad Adenauer [CDU] tritt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zurück.
16. 10 1963 - Ludwig Erhard wird neuer Bundeskanzler
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Ludwig Erhard [CDU] wird zum neuen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
17. 10 1963 - Die Beatles nehmen „I Want To Hold Your Hand“ auf
<p><em><strong>London</strong></em> * Die Beatles nehmen <em>„I Want To Hold Your Hand“</em> auf. Erstmals wird ein Vier-Spur-Aufnahmegerät verwendet.</p>
Ab 24. 10 1963 - Die Tournee der Beatles durch Schweden
<p><em><strong>Schweden</strong></em> * Die Tournee der Beatles durch Schweden dauert bis zum 29. Oktober.</p>
1. 11 1963 - Die zweite Single der Rolling Stones erscheint
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die <em>Rolling Stones</em> bringen mit dem Lennon/McCartney-Song <em>„I Wanna Be Your Man“</em> und <em>„Stoned“</em> von Nanker/Phelge ihre zweite Single auf den Markt. Nanker/Phelge ist ein Pseudonym der frühen Jahre. Es umfasst zum Teil die ganze Band. </p>
Ab 1. 11 1963 - Tournee der Beatles durch Großbritannien
Großbritannien * Tournee der Beatles durch Großbritannien bis 13. Dezember.
4. 11 1963 - Mit den Juwelen klappern
<p><em><strong>London</strong></em> * Auf der Royal Variety Performance im Londoner Prince of Wales Theatere lässt John Lennon vor <em>„Twist And Shout“</em> seinen berühmt gewordenen Spruch los. Die Leute auf den billigen Plätzen können ja mitklatschen, während der Rest mit den Juwelen klappern soll.</p>
6. 11 1963 - Manfred Schreiber ist neuer Polizeipräsident
München * Manfred Schreiber wird neuer Polizeipräsident. Er zieht praktische Konsequenzen aus den polizeilichen Fehlern der „Schwabinger Krawalle“ und entwickelt - unterstützt von Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel - ein flexibleres Polizeikonzept bei Großeinsätzen, das unter der Bezeichnung „Münchner Linie“ bekannt wird.
10. 11 1963 - 26 Millionen sehen Beatles-Konzert am TV
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * 26 Millionen Menschen sehen die Aufzeichnung der Beatles-Show aus der <em>„Royal Variety Performance“</em> im Fernsehen. </p>
12. 11 1963 - Die zweite Beatles-LP erscheint in Deutschland
Deutschland * Die zweite Beatles-LP „With the Beatles“ erscheint in Deutschland.
22. 11 1963 - Die zweite Beatles-LP „With The Beatles“ erscheint in Großbritannien
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die zweite Beatles-LP<em> „With The Beatles“</em> erscheint in Großbritannien. Sie wird sich als erste Beatles-LP über eine Million Mal verkaufen. </p> <p>Wieder erhält die LP acht Beatles-Kompositionen, darunter mit <em>„Don‘t Bother Me“</em> der erste George-Harrison-Song, und sechs Cover-Versionen. Hierauf findet sich mit <em>„It Won‘t Be Long“</em> auch der zweite YEAH-Song.</p>
22. 11 1963 - Präsident John F. Kennedy wird in Dallas/Texas ermordet
Dallas/Texas * Der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy wird in Dallas/Texas ermordet.
28. 11 1963 - „She Loves You“ erobert die britische Hitparade zum zweiten Mal
<p><em><strong>Großbritannien</strong></em> * Die Beatles erobern mit <em>„She Loves You“</em> die britische Hitparade zum zweiten Mal - für zwei Wochen.</p>
29. 11 1963 - Die 5. Beatles-Single „I Want To Hold Your Hand“
Großbritannien - USA * Die fünfte Beatles-Single „I Want To Hold Your Hand“ (Rückseite: „This Boy“) erscheint. Sie wird zum ersten Nummer-1-Hit der Beatles in den USA. Die Single verkauft sich weltweit über 15 Millionen Mal.
16. 12 1963 - Ein Anwerbeabkommen mit [Süd-] Korea abgeschlossen
Bundesrepublik Deutschland - Seoul * Zwischen [Süd-] Korea und der Bundesrepublik Deutschland wird ein Abkommen zur Anwerbung koreanischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt abgeschlossen. In der Vereinbarung wird die vorübergehende Beschäftigung von koreanischen Bergarbeitern im westdeutschen Steinkohlenbergbau geregelt.
Ziel der Beschäftigung ist es, „die beruflichen Kenntnisse der koreanischen Bergarbeiter zu erweitern und zu vervollkommnen“.
18. 12 1963 - Isarring und John-F.-Kennedy-Brücke
München-Englischer Garten * Der Isarring und die John-F.-Kennedy-Brücke wird dem Verkehr übergeben. Die stark befahrene Straße zerteilt den Englischen Garten am Herzstück des Parks, dem Kleinhesseloher See und entwertet dadurch den Bereich entscheidend.
Ab 18. 12 1963 - Auftritte der Beatles im Hamburger Star Club
<p><em><strong>Hamburg</strong></em> * Die Beatles geben im Hamburger Star Club 13 Konzerte. Für drei Stunden spielen gibt es 100 DMark pro Mann und Abend plus Spesen und Hotel.</p>
Ab 31. 12 1963 - „Schimpf vor zwölf“
München-Schwabing * Zwischen 1963 und 1971 tritt Dieter Hildebrandt mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft im zweijährigen Abstand mit „Schimpf vor zwölf“ live im Silvesterprogramm der ARD auf. Das macht die Kabarettisten-Gruppe einer breiten Öffentlichkeit bekannt.
1964 - Zurechtgerückt: Das „Kaiser-Ludwig-der-Baier-Monument“
München-Kreuzviertel * Das „Kaiser-Ludwig-der-Baier-Monument“ in der „Frauenkirche“ kommt an seinen heutigen Platz.
1964 - Hannes König und Gudrun Köhl gründen die „Münchner Volkssängerbühne
München * Hannes König gründet zusammen mit Gurdun Köhl die „Münchner Volkssängerbühne".
1964 - Das „Schyrenbad“ wird als Trainingsstätte für die „Olympiade 1972“ renoviert
München-Untergiesing * Das „Schyrenbad“ wird erneut renoviert.
Aufbereitetes Trinkwasser löst das Nass der Isar ab.
Später will man das „Schyrenbad“ für die „Olympiade 1972“ als Trainingsstätte für die Schwimmer herrichten.
1964 - Hildebrandts Drehbuch zu „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“
München * Dieter Hildebrandt schreibt das Drehbuch zum Film „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ nach einer Erzählung von Heinrich Böll.
Hildebrandt spielt darin auch die Hauptrolle.
1964 - „Anwerbeabkommen“ mit Portugal
Bundesrepublik Deutschland - Portugal * Zwischen Portugal und der Bundesrepublik Deutschland wird ein „Abkommen zur Anwerbung portugisischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
1964 - Friedrich Jahn übernimmt das „Hofgarten-Café Annast“
München-Maxvorstadt * Friedrich Jahn übernimmt das „Hofgarten-Café Annast“.
1964 - Die katholische Kirche gibt das Einverständnis für die „Feuerbestattung“
München * Die katholische Kirche gibt den Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft das Einverständnis für die „Feuerbestattung“.
Ab 15. 1 1964 - Die Beatles gastieren in Versailles
<p><strong><em>Versailles</em></strong> * Die Beatles treten mit Trini Lopez und Sylvie Vartan bis 4. Februar im Cinéma Cyrano in Versailles auf. </p>
29. 1 1964 - Beatles-Single: „Sie liebt Dich“ und „Komm gib mir Deine Hand“
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Die Beatles nehmen in den Pariser <em>„Pathé Marconi Sudios“</em> ihren Hit <em>„She Loves You“</em> in deutscher Sprache unter dem Titel<em> „Sie liebt Dich“ </em>auf. Da das Band mit der englischsprachigen Originalaufnahme nicht mehr vorhanden war, musste der Song völlig neu aufgenommen werden. Bis das Lied <em>„im Kasten“</em> war, waren 14 Takes notwendig. Elf Takes brauchen sie, bis die deutsche Fassung von <em>„I Want </em><em>To Hold Your Ha</em><em>nd“, „Komm gib mir Deine Hand“</em>, aufgenommen haben. </p>
3. 2 1964 - Die Beatles erhalten ihre erste Goldene Schallplatte in den USA
<p><strong><em>USA</em></strong> * Die Beatles erhalten ihre erste Goldene Schallplatte in den USA. Bis zum Ende des Jahres werden es sieben sein.</p>
9. 2 1964 - Die Beatles in der „Ed-Sullivan-Show“
<p><strong><em>USA</em></strong> * Die Beatles treten in der <em>„Ed-Sullivan-Show“</em> in den USA auf. </p>
11. 2 1964 - Auftritt der Beatles im Coliseum in Washington D.C.
<p><strong><em>Washington D.C.</em></strong> * Auftritt der Beatles im Coliseum in Washington D.C.. </p>
12. 2 1964 - Auftritt der Beatles in der New Yorker Carnegie Hall
<p><strong><em>New York</em></strong> * Auftritt der Beatles in der Carnegie Hall in New York.</p>
21. 2 1964 - Die dritte Single der Rolling Stones erscheint
Großbritannien * Mit „Not Fade Away / Little By Little“ veröffentlichen die Rolling Stones ihre dritte Single. Die Songs stammen von Norman Petty/Charles Hardin beziehungsweise werden unter dem Pseudonym von Nanker/Phelge veröffentlicht.
2. 3 1964 - Drehbeginn für den Beatles-Film „A Hard Day‘s Night“
London * Die Dreharbeiten für den Beatles-Film „A Hard Day‘s Night“ beginnen in Paddington Stadion in London.
5. 3 1964 - Die einzige deutschsprachige Single der Beatles erscheint
<p><strong><em>Bundesrepublik Deutschland</em></strong> * Die deutschsprachige Single <em>„Sie liebt Dich“</em> und <em>„Komm gib mir Deine Hand“ der </em>Beatles wird veröffentlicht.</p>
20. 3 1964 - 6. Beatles-Single
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die 6. Single der Beatles mit den Liedern <em>„Can‘t Buy Me Love / You Can‘t Do That“</em> wird veröffentlicht. </p>
1. 4 1964 - Die Feuerwache 5 erhält eine neue Adresse
<p><strong><em>München-Berg am Laim</em></strong> * Die Adresse der Feuerwache 5 wird in Anzinger Straße 41 umbenannt.</p>
16. 4 1964 - Der Beatles-Song „A Hard Day‘s Night“ wird aufgenommen
<p><strong><em>London</em></strong> * Der Beatles-Song <em>„A Hard Day‘s Night“</em> mit dem berühmten Eröffnungsakkord wird aufgenommen. </p>
18. 4 1964 - Der „Friedrich-von-Gärtner-Brunnen“ geht in Betrieb
München-Maxvorstadt * Der „Friedrich-von-Gärtner-Brunnen“ an der Ludwigstraße, in den Arkaden bei der „Ludwigskirche“ wird in Betrieb genommen.
24. 4 1964 - Die Dreharbeiten für den Film „A Hard Day‘s Night“ sind beendet
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Dreharbeiten für den Beatles-Film <em>„A Hard Day‘s Night“</em> sind abgeschlossen. </p>
12. 5 1964 - Cliff Richards & The Shadows im Cirkus Krone
München-Maxvorstadt * Cliff Richards & The Shadows treten im Cirkus Krone auf.
Im Vorprogramm spielt Dravi Deutscher.
29. 5 1964 - Louis Armstrong im Cirkus Krone
München-Maxvorstadt * Louis Armstrong begeistert die Münchner im Cirkus Krone an der Marsstraße.
30. 5 1964 - München geht eine Städtepartnerschaft mit Bordeaux ein
München - München-Haidhausen - Bordeaux * München geht eine Städtepartnerschaft mit der südwestfranzösischen Stadt Bordeaux ein. Beide Städte widmen im Laufe ihrer Beziehungen der jeweiligen Partnerstadt eine Straße oder einen Platz.
Bordeaux benennt an der repräsentativen Esplanade des Quinconces in zentraler Lage die Allée de Munich. Bayerns Landeshauptstadt München wählt einen völlig anderen Weg und stellt im Jahr 1976 am Forum der Wörthstraße einfach neue Tafeln mit dem Namen Bordeauxplatz auf.
Mit dem Forum wird ganz bestimmt einer der ansprechendsten Plätze in Haidhausen gefunden, auch wenn die Wörthstraße an eine der blutigsten Schlachten erinnert. Ob es aber amtliche Befürchtungen sind, die den Münchnern die möglicherweise schwierige Schreibweise der Partnerstadt nicht zutrauen oder nur einfach die Angst vor allzu viel Veränderung, ist nicht überliefert.
Jedenfalls besitzt der Bordeauxplatz bis heute keine Hausnummer, weshalb auch an eine solche Anschrift kein Brief zugestellt werden kann. Die den Platz säumenden Häuser führen auch weiterhin die fortlaufenden Hausnummern der Wörthstraße.
Ab 4. 6 1964 - Die Beatles sind auf Tournee in Australien und Neuseeland
<p><strong><em>Australien - Neuseeland</em></strong> * Die Beatles sind bis 30. Juni auf Tournee in Australien und Neuseeland.</p>
16. 6 1964 - Das Müllverbrennungs-Kraftwerk München Nord nimmt ihren Betrieb auf
München-Unterföhring * Das Müllverbrennungs-Kraftwerk München Nord nimmt seinen Betrieb auf.
19. 6 1964 - Die Beatles veröffentlichen ihre fünfte EP „Long Tall Sally“
Großbritannien * Die Beatles veröffentlichen ihre fünfte EP „Long Tall Sally“. Sie ist die erste EP, die neue Songs enthält. Diese sind „I Call Your Name“, „Slow Down“, „Long Tall Sally“ und „Matchbox“.
26. 6 1964 - Die instrumentale Filmmusik des Beatles-Films „A Hard Day‘s Night“
<p><strong><em>USA</em></strong> * Das Original-Soundtrack-Album des Beatles-Films <em>„A Hard Day‘s Night“</em> erscheint in den USA. Es enthält die instrumentale Filmmusik von George Martin. </p>
26. 6 1964 - Die vierte Single der Rolling Stones wird veröffentlicht
Großbritannien * Die Rolling Stones veröffentlichen ihre vierte Single mit dem Bobby & Shirley Womack-Titel „It‘s All Over Now“ und „Good Times, Bad Times“ von Jagger/Richards.
6. 7 1964 - Weltpremiere des Beatles-Films „A Hard Day‘s Night“ in London
<p><strong><em>London</em></strong> * Die <em>Royal World Premiere</em> des Beatles-Films <em>„A Hard Day‘s Night“</em> findet im <em>London Pavilion</em> statt. </p>
10. 7 1964 - Die 3. Beatles-LP „A Hard Day‘s Night“ erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * <em>„A Hard Day‘s Night“</em>, die dritte LP der Beatles erscheint. Alle 13 Lieder stammen aus der Feder von John Lennon und Paul McCartney. Daneben gibt es als Auskoppelung die 7. Beatles-Single mit <em>„A Hard Day‘s Night“ </em>und m <em>„I Should Have Know Better“</em>. Gleichzeitig hat der Beatles-Film <em>„A Hard Day‘s Night“</em> im Liverpooler Odeon Cinema seine Nord-Premiere. </p>
13. 7 1964 - Uraufführung des Beatles-Films „A Hard Day‘s Night“ in den USA
<p><strong><em>USA</em></strong> * Der Beatles-Film Films <em>„A Hard Day‘s Night“</em> erlebt in den USA seine Uraufführung.</p>
23. 7 1964 - A hard day‘s night kommt in Deutschland in die Kinos
Bundesrepublik Deutschland * Der synchronisierte Beatles-Film A hard day‘s night kommt in Deutschland unter dem Titel Yeah, Yeah, Yeah in die Kinos.
24. 7 1964 - Der Beatles-Film Yeah, Yeah, Yeah im City-Palast
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Die <em>Abendzeitung</em> kauft alle Eintrittskarten für die Aufführung des Beatles-Filmes <em>Yeah, Yeah, Yeah</em> im <em>City-Palast</em> an der Sonnenstraße auf und verschenkt sie an <em>Beatles-Fans</em>. Dabei ist das Interesse so gewaltig, dass sich die ersten Liebhaber bereits in aller Frühe einfinden, obwohl die Kartenverteilung erst um zwölf Uhr Mittag beginnt.</p> <p>Polizisten in Zivil mischen sich unter die Jugendlichen, um nötigenfalls ordnend einzugreifen. Das Verhalten der adrett und brav gekleideten weiblichen und der - mit den damals modischen, eng geknoteten Krawatten ausstaffierten - männlichen Jugendlichen macht dies aber nicht notwendig. Sollte es zu einem gefährlichen Gedränge kommen, würde ein Lautsprecherwagen bereitstehen, über den man - vom Stadtjugendamt ausgeliehene - Beatles-Platten abspielt, um die Fans vom Kinoeingang wegzulocken.</p> <p>Man will sie dann zur Theresienwiese lotsen, wo genügend Platz zur Umsetzung von Musik in Bewegung vorhanden wäre. So weit kommt es allerdings nicht. </p> <p>Doch als die Beatles schließlich auf der Leinwand erschienen, kennt die Begeisterung keine Grenzen; Tränen fließen, Schreie ertönen, es wird gestampft, geklatscht und mitgesungen. </p> <p>Die <em>„Beatles“</em> sind einfach die Größten. </p>
28. 7 1964 - Die Beatles geben zwei Konzerte in Schweden
<p><strong><em>Schweden</em></strong> * Am 28. und 29. Juli geben die Beatles zwei Konzerte in Schweden. </p>
8 1964 - Ein Sturm entwurzelt 450 alte Bäume im „Englischen Garten“
München-Englischer Garten * Ein Sturm entwurzelt 450 alte Bäume im „Englischen Garten“.
Ab 19. 8 1964 - 22.441 Meilen während der Amerika-Tournee der Beatles
<p><strong><em>USA</em></strong> * Die Beatles unternehmen bis 20. September eine Tournee durch die USA. Sie legen dabei 22.441 Meilen zurück. </p>
19. 9 1964 - Vom Anzapfen des ersten Wiesn-Fasses im Schottenhamel-Festzelt
München-Theresienwiese * Obwohl Hans-Jochen Vogel schon im Jahr 1960 zum Oberbürgermeister gewählt worden war, überlässt er das Anzapfen des ersten Wiesn-Fasses im Schottenhamel-Festzelt noch bis 1963 seinem Vorgänger Thomas Wimmer. Erst im September 1964 kommt er auch diesen Pflichten nach.
19. 9 1964 - Das Kleine-Winzerer-Fähndl-Festzelt wird zum Armbrustschützenzelt
München-Theresienwiese * Das Kleine Winzerer Fähndl wird in Armbrustschützenzelt - Winzerer Fähndl umbenannt.
23. 9 1964 - Spiegel-Titel: München - Deutschlands heimliche Hauptstadt
München • Der Spruch „München - Deutschlands heimliche Hauptstadt“ geht auf eine Titelgeschichte des Magazins Der Spiegel zurück.
6. 10 1964 - Aufnahmen für den Beatles-Song „Eight Days A Week“
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Beatles nehmen am 6. und 18. Oktober den Song <em>„Eight Days A Week“</em> auf. </p>
Ab 9. 10 1964 - Tournee der Beatles durch Großbritannien
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Tournee der Beatles durch Großbritannien beginnt. Sie dauert bis 10. November.</p>
6. 11 1964 - Beatles sprechen sich gegen Rassentrennung aus
<p><strong><em>USA</em></strong> * In einer Presseerklärung verkündeten die Beatles: <em>„Wir werden nirgendwo auftreten, wo Schwarzen nicht erlaubt ist, dort zu sitzen, wo sie wollen.“</em> Damit sind sie die erste Band, die sich in den USA gegen die Rassentrennung wendet, was damals schon eine Menge Mut erfordert. Die vier Musiker haben erfahren, dass <em>„schwarze Fans“</em> bei Konzerten nur in den oberen Rängen sitzen durften.</p> <p>Die <em>„rassistisch motivierte zwangsweise Trennung von Menschen biologisch unterschiedlicher Menschengruppen“</em>, auch Rassen genannt, im Bereich des täglichen Lebens war in den Südstaaten der USA bis in die späten 1960er-Jahre verbreitet, in Südafrika als Apartheid sogar bis 1990. Dabei gibt es gar keine menschlichen Rassen. </p>
8. 11 1964 - Der Grundstein für die Wolfgangskirche wird gelegt
München-Au * Der Grundstein für die wesentlich kleinere Wolfgangskirche in der Oberen Au wird gelegt. Sie entsteht neben dem alten freistehenden Turm.
13. 11 1964 - Die fünfte Rolling Stones-Single wird veröffentlicht
Großbritannien * Die fünfte Rolling Stones-Single wird veröffentlicht. „Little Red Rooster“ und „Off The Hook“ bilden die Titel.
21. 11 1964 - Toni Sheridan tritt im Cirkus Krone auf
München-Maxvorstadt * Toni Sheridan zeigt erneut sein Können im Cirkus Krone.
23. 11 1964 - Die 8. Beatles-Single erscheint
Großbritannien * Die Beatles veröffentlichen ihre achte Single mit den Titeln „I Feel Fine / She‘s A Woman“.
27. 11 1964 - „Beatles For Sale“ wird veröffentlicht
Bundesrepublik Deutschland * „Beatles For Sale“ wird rechtzeitig vor Weihnachten in Deutschland zum Kauf angeboten. Sie enthält acht Lennon/McCartney-Songs und sechs Cover-Versionen
4. 12 1964 - „Beatles For Sale“ als vierte LP der Band aus Liverpool
Großbritannien * „Beatles For Sale“ erscheint als vierte Langspielplatte der Band aus Liverpool.
1965 - Die „Frauen des Ordens vom guten Hirten“ ziehen nach Solln
München-Haidhausen - München-Solln * Die „Frauen des Ordens vom guten Hirten“ ziehen nach Solln.
Ab 1965 - Ein neues Werk für die „Farbenfabrik Huber“ in Heimstätten
München-Haidhausen - Heimstätten * In Heimstätten entsteht ein neues Werk für die „Farbenfabrik Huber“.
Um 1965 - Eine eigene Kuh für die Beschäftigten des „Englischen Gartens“
München-Englischer Garten * Bis zur Mitte der 1960er Jahre wird für die Milchversorgung der Beschäftigten des „Englischen Gartens“ eine eigene Kuh gehalten.
1965 - Der „Biedersteiner Tunnel“ entsteht bis 1966
München-Englischer Garten - Schwabing * Der „Biedersteiner Tunnel“ im Gebiet des „Biedersteiner Sees“ entsteht bis 1966.
1965 - Ein „Anwerbeabkommen“ mit Tunesien abgeschlossen
Tunis - Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Zwischen Tunesien und der Bundesrepublik Deutschland wird ein „Abkommen zur Anwerbung tunesischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
1. 2 1965 - Der erste Spatenstich für die Münchner U-Bahn
München-Schwabing * Die Bauarbeiten für die Münchner U-Bahn beginnen in der Ungererstraße am Bahnhof Schenkendorfstraße, heute: Nordfriedhof.
23. 2 1965 - Die Dreharbeiten zu dem Beatles-Film „Help!“ beginnen
<p><strong><em>Bahamas</em></strong> * Die Dreharbeiten zu dem Beatles-Film „Help!“ beginnen auf den Bahamas und dauern bis zum 9. März an. </p>
26. 2 1965 - Die sechste Single der Rolling Stones
Großbritannien - USA * Die Rolling Stones veröffentlichen mit „The Last Time“ und „Play With Fire“ ihre sechste Single. „The Last Time“ schafft es in England auf Platz 1, in USA auf Platz 9.
2. 3 1965 - Lawinenunglück in Obertauern mit 37 Toten
<p><strong><em>Obertauern</em></strong> * Am Faschingsdienstag reißt zwischen Ober- und Untertauern eine Schneelawine einen Autobus mit 37 jungen schwedischen und finnischen Jugendlichen in den Abgrund.</p> <p><em>„Die Wagenkarosserie wurde im rückwärtigen Drittel aufgefetzt, Schneemassen wurden mit ungeheuerlicher Wucht in das Innere des Wagens gepresst und die unglücklichen Insassen buchstäblich einbetoniert. Man musste sie zum Teil mit Schweißbrennern aus ihrem Schneegrab befreien. Sie waren allesamt erstickt“</em>, berichtet das <em>„Salzburger Volksblatt“</em>. </p>
10. 3 1965 - Jugendgefährdend: „Die Memoiren der Fanny Hill“
<p><strong><em>Bonn</em></strong> * Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften setzt <em>„Die Memoiren der Fanny Hill“</em> auf den Index. </p>
13. 3 1965 - Die Beatles landen zu Filmaufnahmen in Salzburg
<p><strong><em>Salzburg</em></strong> * Die Beatles landen zusammen mit der 66 Mann starken Filmcrew am Salzburger Flughafen Maxglan. Beim Verlassen des Flugzeugs schallt den <em>„Fab Four“</em> von viertausend begeisterten Fans, die zum Teil aus dem benachbarten Bayern in Sonderbussen angereist waren, ein tausendfaches „Yeah, yeah, yeah!“ entgegen. </p> <p>Unter die Beatles-Verehrer*innen mischen sich vierzig bis fünfzig Schüler*innen, die Transparente hochhalten, auf denen zu lesen ist: <em>„Beatles go home“, „Verstärkung für den Alpenzoo“</em> oder <em>„Hoch dem Eunuchen-Chor“</em>. Geschmacklos ist angesichts des wenige Tage zuvor geschehenen Unglücks die Aussage <em>„Lawinen, marsch!“</em>. </p> <p>Die Fans bewerfen die Kritiker mit Schneebällen, sodass diese - begleitet von Blasmusik-Klängen - abziehen. </p>
14. 3 1965 - Die Ski-Szenen zum Beatles-Film „Help!“ beginnen
<p><strong><em>Obertauern</em></strong> * Die Dreharbeiten zum Beatles-Film <em>„Help!“</em> in Obertauern, in den österreichischen Alpen, beginnen. Sie dauern bis zum 20. März an. </p>
15. 3 1965 - Erste Napalm-Bomben in Vietnam
<p><strong><em>Vietnam</em></strong> * Die USA werfen erstmals Napalm-Brandbomben im Vietnam-Krieg ab. </p>
16. 3 1965 - „Beatles-Häuptling John Lennon stochert in seinen Zähnen“
<p><strong><em>Österreich</em></strong> * Die <em>„Arbeiter-Zeitung“</em> schreibt im Zusammenhang mit einem in Obertauern aufgenommenen Foto von John Lennon: <em>„Beatles-Häuptling John Lennon stochert in seinen Zähnen. Das und Nasenbohren sind die Lieblingsbeschäftigungen der Beatles in Obertauern. Womit man Millionen verdient.“</em> Da war die Rede von <em>„Zottelköpfen“</em>, von <em>„komischen ungepflegten Frisuren dieser Paradeidole“</em> oder von den <em>„Schreihälsen aus Liverpool“</em>. </p>
17. 3 1965 - Der Titel „Help“ für den neuen Beatles-Film ist schon vergeben
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Das baldige Erscheinen des Beatles-Films <em>„Eight Arms to Hold You“</em> [= <em>„Acht Arme, um dich festzuhalten“</em>] wird verkündet. Der Titel bezieht sich auf die achtarmige indische Statue, die als Filmrequisite verwendet wird, aber auch auf die vier Liverpooler Musiker mit ihren acht Armen und Händen. Man arbeitete mit diesem Arbeitstitel, obwohl <em>„Help“</em> als Filmtitel schon längere Zeit im Gespräch war, aber die Rechte bereits vergeben und damit urheberrechtlich geschützt waren. </p> <p>Zum Glück kommt man später auf die Idee, hinter das Wort <em>„Help“</em> noch ein Ausrufezeichen zu setzen. Damit ist das bestehende Filmrecht ausgehebelt und das Copyright für den neuen Namen <em>„Help!“</em> errungen.</p>
20. 3 1965 - Die Beatles beenden ihre Dreharbeiten in Obertauern
<p><strong><em>Salzburg - London</em></strong> * Nach Beendigung der Dreharbeiten für den Beatles-Film <em>„Help!“</em> in Obertauern reisen die <em>„Fab Four“</em> wieder nach London ab. </p>
24. 3 1965 - Die Dreharbeiten zum Beatles-Film „Help!“ werden in London fortgesetzt
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Arbeiten zum Beatles-Film <em>„Help!“</em> werden in den Twickenham Filmstudios in London fortgesetzt.</p>
9. 4 1965 - Die 9. Beatles-Single
Großbritannien * Mit „Ticket to right/Yes it is“ kommt die neunte Beatles-Single auf den Markt.
13. 4 1965 - Die Beatles nehmen den Song „Help!“ auf
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Beatles nehmen den Song <em>„Help!“</em> auf. </p>
21. 5 1965 - Mit der „Bayern-Hymne“ knapp an der Staatskrise vorbei
München * Wegen der „Bayern-Hymne“ schlittert die Bundesrepublik Deutschland beinahe in eine Staatskrise. Auf Veranlassung des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel spielt die Blaskapelle beim Ankommen des Sonderzuges der britischen Königin Elisabeth die Bayerische Nationalhymne, obwohl dies Bundespräsident Heinrich Lübke der Staatsregierung zuvor ausdrücklich untersagt hatte.
Die Gäste müssen sich alle Strophen anhören. Verwundert bemerkt Prinz Philip: „Oh, ein ganzes Konzert“. Und Bundespräsident Heinrich Lübke tobt.
21. 5 1965 - Die Queen in München
<p><em><strong>München</strong></em> * Die englische Königin und ihr Ehemann Prinz Philip treffen im Rahmen ihrer Deutschlandreise bei eher kühlem Frühlingswetter in München ein. Ihr Aufenthalt dauert 14 Stunden. Lange genug, um in den Straßen der Landeshauptstadt eine wahre Volksfeststimmung herrschen zu lassen. Hunderttausende säumten die Straßen und bereiteten der freundlich lächelnden und jugendlich wirkenden Queen bei ihrer Fahrt im offenen Wagen frenetische Ovationen. Ministerpräsident Alfons Goppel drückte diese Stimmung mit den Worten aus: <em>„Die Herzen des bayerischen Volkes schlagen Eurer Majestät entgegen!“</em></p> <p>Die Bayern widersetzten sich allen von oben erlassenen Anordnungen zum Aufenthalt der Queen und gestalteten den Besuch weitgehend nach ihrem eigenen Willen. Die Staatsregierung reizte mal wieder alle Möglichkeiten aus, um vor der Weltöffentlichkeit ihr ausgeprägtes weiß-blaues Staatsbewusstsein zu zelebrieren und mithilfe von Zeremoniell und Symbolik souveräne Staatlichkeit zu beweisen. </p> <p>Auf Veranlassung des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel spielt die Blaskapelle beim Ankommen des Sonderzuges der britischen Königin Elisabeth die Bayerische Nationalhymne, obwohl der Bundespräsident Heinrich Lübke dies der Staatsregierung zuvor ausdrücklich untersagt hatte. </p> <p>Die königlichen Gäste von der Insel mussten sich alle Strophen der <em>„Bayern-Hymne“</em> anhören, was Prinz Philip zur Bemerkung hinreißen lässt: <em>„Oh, ein ganzes Konzert.“ </em></p> <p>Wegen der <em>„Bayern-Hymne“</em> schlitterte die Bundesrepublik Deutschland beinahe in eine Staatskrise. Der bayerische Ministerpräsident riskierte wegen seines Trotzes ein Verfahren wegen <em>„separatistischer Machenschaften“</em>. Letztlich stärkte der Queen-Besuch nicht nur den Freistaat Bayern, sondern auch die Popularität des Ministerpräsidenten Alfons Goppel.</p>
24. 5 1965 - Der Brunnen im Hof des Hauses des Rechts
München-Maxvorstadt * Das Hauptwerk des Dichters Dante Alighieri heißt „La Divina Commedia - Die göttliche Komödie“. Den gleichen Namen trägt der neu gestaltete Brunnen im Hof des Hauses des Rechts in der Veterinärstraße 1.
Ab 20. 6 1965 - Die Beatles beginnen ihre Tournee durch Frankreich, Italien und Spanien
<p><strong><em>Frankreich - Italien - Spanien</em></strong> * Die Beatles begeben sich bis 3. Juli auf eine Tournee durch Frankreich, Italien und Spanien. </p>
Um den 25. 6 1965 - In USA erscheint „(I Can’t Get No) Satisfaction“ von den Rolling-Stones
London - USA * Die London Records bringen in den USA die siebte Rolling-Stones-Single „(I Can’t Get No) Satisfaction“ mit der B-Seite „The Under Assistant West Coast Promotion Man“ heraus. Die Band befindet sich noch immer noch auf Tournee in den USA und ist zur Veröffentlichung überhaupt nicht gefragt worden.
10. 7 1965 - (I can‘t get no) Satisfaction wird Nummer 1 in USA
USA * „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ erreicht die Nummer 1-Position in den US-Charts und gibt diese Position vier Wochen lang nicht mehr ab.
19. 7 1965 - Mit „Help! / I‘m down“ erscheint die 10. Beatles-Single
Großbritannien * Die 10. Beatles-Single „Help!“ (Rückseite: „I‘m Down“) kommt in die Plattenläden.
29. 7 1965 - Weltpremiere des Beatles-Films „Help!“
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Weltpremiere für den Beatles-Film <em>„Help!“</em> findet im London Pavilion am Picadilly Circus in London statt. In Deutschlands Kinos läuft der synchronisierte Film unter dem Titel <em>„Hi-Hi-Hilfe!“</em>. Der Film ist <em>„hochachtungsvoll dem Andenken an Mr. Elias Howe gewidmet, der 1846 die Nähmaschine erfunden hat“</em>. </p>
6. 8 1965 - Help! von den Beatles erscheint als LP
Großbritannien * Die fünfte Langspielplatte der Beatles erscheint unter dem Titel Help!. Sie enthält acht Lennon/McCartney-Kompositionen, zwei Harrison-Songs und zwei Cover-Versionen.
Ab 15. 8 1965 - Beginn der zweiten Beatles-Tournee durch die USA
<p><strong><em>New York</em></strong> * Beginn der zweiten Beatles-Tournee durch die USA im Shea Stadium in New York vor 55.600 Zuschauer. Das Gastspiel endet am 31. August.</p>
19. 8 1965 - Die Auschwitz-Prozess-Urteile werden verkündet
<p><strong><em>Frankfurt am Main</em></strong> * Die Urteile im Auschwitz-Prozess werden verkündet. Der Prozess stellt einen wichtigen Schritt bei der Vergangenheitsbewältigung dar und löst in der Bevölkerung, der Justiz und im Parlament eine Verjährungsdebatte über Mord aus. </p>
20. 8 1965 - „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ erscheint auch in England
Großbritannien * Erst jetzt wird „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ in England mit der B-Seite „The Spider And The Fly“ veröffentlicht.
9. 9 1965 - Das Gesetz über das Urheberrecht wird erlassen
Bonn * Das Gesetz über das Urheberrecht und Verwandte Schutzrechte wird erlassen. Es löst das Urheberrecht aus der Zeit des Nationalsozialismus ab, das dem Urheber nur mehr als „Treuhänder des Werks für die Volksgemeinschaft“ betrachtet hatte.
9. 9 1965 - „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ erklimmt Platz 1 der englischen Charts
Großbritannien * Der Rolling-Stones-Hit „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ erklimmt in den englischen Charts den Platz 1 für zwei Wochen.
14. 9 1965 - Die Rolling Stones im Cirkus-Krone-Bau
München-Maxvorstadt * Die Rolling Stones spielen erstmals in Münchens größter Rock-Arena, im Cirkus-Krone-Bau. Der Eintritt kostet 6,90 DMark.
14. 9 1965 - Brian Jones und Anita Pallenberg sind ein Paar
München * Brian Jones von den Rolling Stones lernt in München auf einer After-Show-Party die als Fotomodell und Schauspielerin tätige Anita Pallenberg kennen. Auch Mick Jagger und Keith Richards begehrten diese Frau, doch Brian Jones gewinnt - vorerst.
18. 9 1965 - Richard Süßmeiers Armbrustschützenzelt ist die größte Festhalle
München-Theresienwiese * Richard Süßmeiers Armbrustschützenzelt ist die größte Festhalle auf der Wiesn. Am Einzug der Wiesnwirte beteiligt er sich als Ritter auf einem Karussellpferd.
19. 9 1965 - Ergebnis der Bundestagswahl 1965
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 5. Deutschen Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Ludwig Erhard 47,6 Prozent [+ 2,3] und 251 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Willy Brandt erringt 39,3 Prozent der Stimmen [+ 3,1] und 217 Sitze.
- Die FDP bekommt 9,5 Prozent [- 3,3] und 50 Sitze.
Ludwig Erhard [CDU] wird Bundeskanzler einer Koalition aus CDU/CSU und FDP.
25. 9 1965 - Der erste „Beat-Club“ wird ausgestrahlt
<p><strong><em>Bremen</em></strong> * Radio Bremen strahlt mit dem <em>„Beat Club“</em>die erste Musiksendung mit englischsprachigen Interpreten im deutschen Fernsehen aus. </p> <p> </p>
26. 9 1965 - Der Beatles-Film „Help!“ gewinnt den Großen Preis
<p><strong><em>Rio de Janeiro</em></strong> * Der Beatles-Film <em>"Help!"</em><em> </em>gewinnt beim Filmfestival in Rio de Janeiro den Großen Preis.</p>
22. 10 1965 - Die achte Single der Rolling Stones erscheint
Großbritannien * Die Rolling Stones bringen mit „Get Off Of My Cloud“ und „The Singer Not The Song“ ihre achte Single auf den Markt.
26. 10 1965 - Die Beatles erhalten den Orden Member of the British Empire
London * Im Buckingham Palace erhalten die Beatles um 11:10 Uhr im Great Throne Room aus der Hand der Queen Elizabeth den Orden Member of the British Empire verliehen.
28. 10 1965 - Münchens Olympia-Bewerbung
München * Das IOC-Mitglied Willy Daume frägt den Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel: „Warum bewirbt sich München nicht um die Olympischen Spiele?“ Jetzt muss schnell gehandelt werden, denn spätestens am 1. Dezember 1965 muss die Bewerbung beim IOC in Lausanne vorliegen.
3. 12 1965 - „Rubber Soul“ von den Beatles erscheint
Großbritannien * Mit „Rubber Soul“ kommt die sechste Beatles-LP in die Plattenläden. Auf ihr finden sich zwölf Lennon/McCartnes-Songs. Zwei Lieder stammen aus der Feder von George Harrison.
Am gleichen Tag wie die Beatles-LP „Rubber Soul“ erscheint die 11. Beatles-Single mit zwei A-Seiten: „Day Tripper/We Can Work It Out“.
Ab 3. 12 1965 - Die Tournee der Beatles durch Großbritannien beginnt
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Tournee der Beatles durch Großbritannien bis 12. Dezember.</p>
16. 12 1965 - Die deutsche Uraufführung des Beatles-Films „Hi-Hi-Hilfe!“
<p><strong><em>Bundesrepublik Deutschland</em></strong> * Der Beatles-Film <em>„Help!“</em> startete unter dem Titel <em>„Hi-Hi-Hilfe!“</em> in den deutschen Kinos.</p>
Ab 1966 - Der „Fischbrunnen“ am Marienplatz wird abgetragen
München-Graggenau * Wegen des U-Bahn-Baus wird der „Fischbrunnen“ am Marienplatz abgetragen.
1966 - Die Turmhelme der „Johann-Baptist-Kirche“ werden abgetragen
München-Haidhausen * Die drei zierlich durchbrochenen Turmhelme der neuen „Johann-Baptist-Kirche“ werden abgetragen und stark vereinfacht wieder ersetzt.
Die Haidhauser bezeichnen die neuen kupfergedeckten Hauben jedoch nur als „Kasperlmützen“.
Außerdem büßt der Hauptturm 4,10 Meter ein.
Statt 95 Meter ist er nur mehr 90,90 Meter hoch.
1966 - Der „Bund Naturschutz“ wildert Biber in Bayern aus
Freistaat Bayern * Der „Bund Naturschutz“ wildert die ersten Biber wieder in Bayern aus.
1966 - Der zweite Block des „Müllverbrennungs-Kraftwerks Nord“ geht in Betrieb
Unterföhring * Der zweite Block des „Müllverbrennungs-Kraftwerks München Nord“ geht in Betrieb.
1966 - Kurt Plapperer übernimmt die Leitung des „Deutschen Theaters“
München-Ludwigsvorstadt * Kurt Plapperer übernimmt die Leitung des „Deutschen Theaters“.
Er und sein Sohn Heiko Plapperer-Lüthgard verändern das Programm stark in Richtung internationale Musicals.
1966 - Das „Lehel“ wird zum „Kerngebiet“ erklärt
München-Lehel * Das „Lehel“ wird zum „Kerngebiet“ erklärt.
Damit ist es ein Viertel, das vor allem der gewerblichen Nutzung vorbehalten sein soll.
4. 3 1966 - John Lennon: Die Beatles sind „populärer als Christus“
<p><strong><em>London</em></strong> * Im Evening Standard erscheint das Interview von John Lennon, in dem sagt, die Beatles sind <em>„populärer als Christus“</em>. </p>
26. 4 1966 - „The Games are awarded to - Munich“
Rom * Der IOC-Präsident Avery Brundage verkündet in Rom München als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1972. Weitere Bewerber waren Detroit, Madrid und Montreal.
28. 5 1966 - Der TSV 1860 München wird Deutscher Fußballmeister
München * Der TSV 1860 München wird erstmals - und bislang zum einzigen Mal - Deutscher Fußballmeister. Mit der Meisterschaft sind Namen wie Rudi Brunnenmeier, Friedhelm „Timo“ Konietzka und Petar „Radi“ Radenkovic verbunden.
Der FC Bayern München wird Dritter, der 1. FC Nürnberg belegt den sechsten Platz in der Bundesliga-Tabelle.
10. 6 1966 - Die 12. Beatles-Single
Großbritannien * Mit „Paperback Writer / Rain“ wird die 12. Single der Beatles veröffentlicht.
21. 6 1966 - Die Beatles schließen ihre Arbeit an der LP „Revolver“ ab
<p><strong><em>London</em></strong> * Die Beatles schließen ihre Arbeit an der LP <em>„Revolver“</em> ab</p>
23. 6 1966 - Beat-Veranstaltungen sind vergnügungssteuerpflichtig
München * Das Münchner Verwaltungsgericht verfügt, dass Beat-Veranstaltungen auch künftig vergnügungssteuerpflichtig sind, selbst wenn „durch die elektrische Tonverstärkung das Dargebotene nur als Lärm erscheint“.
23. 6 1966 - Die Beatles kommen nach München
<p><strong><em>London - München</em></strong> * Um 11:20 Uhr heben die Beatles mit dem Flug BE502 mit der BEA-Linienmaschine Comet IV vom Londoner Flughafen ab, um um 12:56 Uhr in München-Riem zu landen. Endlich sind sie da. George Harrison, Paul McCartney, John Lennon und Ringo Starr treffen erstmals und höchstpersönlich in München ein.</p> <p>Und als <em>„die vier Sängerknaben mit der Mädchenfrisur“</em> das Flugzeug verlassen, werden sie <em>„von lustigen Teenagern zumeist“ </em>begeistert empfangen. Man hat sie bis zur Landung des Flugzeugs mit Beatmusik bei Laune gehalten. Die Mädchen tragen Pony, die Haare hochtoupiert, sowie bonbonfarbene, schenkelkurze Op-Art-Kleidchen und Pumps. Die Burschen bekleiden sich mit hautengen Jeans und schwarzen T-Shirts oder geblümten Hemden. Ihre Haare bedecken zwar die Ohren, reichen aber noch nicht bis zur Schulter. Dazwischen sind auch <em>„einige wüstere Typen mit verfilztem, schulterlangem Haar, im obligatorischen Snow Coat mit aufgemalten Atomwaffengegner-Abzeichen“</em>, schreibt die Süddeutsche Zeitung.</p> <p>Die Mädchen halten bemalte Schilder hoch und alles sieht friedlich aus. Doch es muss schon ein sehr trügerischer Friede sein, denn auf je fünf Fans kommt ein Polizist. 200 Staatliche Ordnungskräfte sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Außerdem ist die Straße rechts vom Hauptgebäude auf einer Länge von fast einhundert Metern abgesperrt worden. </p> <p>Noch auf der Rolltreppe werden die Fab Four mit extrem saublöden Fragen interviewt. Ringo Starr antwortet auf dem Flughafen auf die Frage eines Reporters: <em>„Warum stehen Sie immer so spät auf?“</em> mit der Gegenfrage: <em>„Wollen Sie schon in aller Frühe unseren Lärm hören?“</em> Total unverständlich findet der Münchner Merkur die Popularität der Beatles, da die Vier doch nur Nachteile vorzuweisen hätten: <em>„Der kurzsichtige John Lennon, der Linkshänder Paul McCartney, George Harrison mit den abstehenden Ohren und Ringo Starr mit der übergroßen Nase.“</em> </p> <p>Außerdem überreicht man ihnen Lederhosen mit Hirschknöpfen und weiße leinene Trachtenhemden. Schon während des Flugs hat man ihnen einen Tirolerhut übergeben, den der <em>„großnasige“</em> Ringo beim Verlassen des Flugzeugs zu seiner braunen Lederjacke trägt. </p> <p><em>„Machen Sie Platz für die Beatles!“</em>. Die Ampeln sind für die vier Musiker auf Grün gestellt. So fahren sie über die Prinzregentenstraße, vorbei an den Vieltausenden, Fähnchen schwenkenden, <em>„Yeah-yeah-yeah!“</em> kreischenden Münchner Beatles-Fans. Es herrscht einfach eine freundliche Stimmung an diesem 23. Juni 1966. </p> <p>In dem Auto mit dem Kennzeichen M-TX 107 sitzen die Beatles. Um den wartenden Fans zu entkommen, fährt der Mercedes die Tiefgarage von hinten an, sodass die Gruppe um 13:45 Uhr das Hotel durch den Lieferanteneingang betreten kann. Während die Musiker durch den Hintereingang verschwinden, warten auf dem Promenadeplatz etwa 3.000 Fans und Neugierige mit Transparenten. Neun Hausdiener und eine Handvoll Polizisten sollen den Bayerischen Hof gegen den Ansturm der Beatles-Fans verteidigen. <em>„Die Scheiben sind vorsorglich beim Glaser bestellt“</em>, diktiert Hotelchef Falk Volkhardt einem Reporter in den Block. </p> <p>Nichts passiert. Nur junge Frauen und Männer warten auf dem Promenadeplatz sehnsüchtig auf den Augenblick, dass sich ihre Idole an einem der Fenster zeigen. Oben im fünften Stock tun diese den Fans ein einziges Mal den Gefallen und treten ans Fenster, um ein paar Autogramme auf die Straße zu werfen. </p> <p>Für 16:00 Uhr ist im Nachtclub des Hotels Bayerischer Hof eine Pressekonferenz anberaumt. Diese beginnt 20 Minuten später, weil der Fahrstuhl stecken bleibt. Statt der erlaubten 10 haben sich 15 Personen in den Aufzug gequetscht. Zuerst werden Fotos der Fab Four geschossen, danach dürfen die Journalisten die Beatles 13 Minuten befragen. Dazwischen bekommen sie noch den <em>„Goldenen BRAVO Otto“</em> in der Kategorie Beste Beatband überreicht. </p> <p>Zur gleichen Zeit tagt im Polizeipräsidium an der Ettstraße ein Krisenstab, denn den deutschen Behörden und der Polizei waren Popstars samt den kreischenden Fans ausgesprochen befremdlich. Aus Anlass des Beatles-Gastspiels richtet man in München einen Krisenstab ein, dem der Polizeipräsident, zwei Einsatzleiter und ein erst kurz zuvor installierter psychologischer Fachmann angehören. Deeskalation fordert der Psychologe, was natürlich umfangreiche polizeiliche Vorbereitungen notwendig macht, um Massenaufläufe möglichst zu verhindern oder zumindest unter Kontrolle zu halten. </p> <p><em>So bekommen die Beatles die Kehrseite ihres Ruhmes zu spüren. Ihnen wird ein abendlicher Schwabing-Bummel aus Sicherheitsgründen verboten, weshalb sie die ganze Zeit ihres München-Aufenthaltes im Bayerischen Hof verbringen müssen. Die Abendzeitung schreibt beschwichtigend: </em><em>„Die Herren tragen zwar unorthodoxe Haartracht und veranstalten einen für musikalische Ohren beschwerlichen Lärm, aber im Grunde sind sie harmlos und übermütig, und in ihren Liedern kommt nichts Unanständiges vor.“</em> Die Polizei hat eine Fälscherbande hochgenommen, die 125 gefälschte Eintrittskarten für die Beatles-Konzerte zu Horror-Preisen verkauft hat. </p> <p>Am frühen Abend machen die Beatles eine Generalprobe auf ihrem Zimmer, da sie bis zum 21. Juni 1966 jeden Tag mit den Aufnahmen zur LP <em>„Revolver“ </em>beschäftigt waren. Gegen 21:30 Uhr betreten die vier Beatmusiker das 16 Meter lange Schwimmbad auf dem Dach des Hotels Bayerischer Hof, das extra für die Beatles reserviert und eigens für diesen Zweck mit neuem Wasser gefüllt worden war. Der einzige Schwimmer ist Paul, der sich mit einer geliehenen Badehose in die Fluten stürzt, während die drei anderen <em>„kühles Nass aus Whiskeyflaschen“</em> vorziehen. </p> <p>Fortsetzung folgt !</p>
24. 6 1966 - Die neue „Münchner Linie“ wird bei den Beatles-Konzerten eingesetzt
<p><strong><em>München</em></strong> * Die neue <em>„Münchner Linie“</em>, erarbeitet nach den sogenannten <em>„Schwabinger Krawallen“</em>, wird bei den Beatles-Konzerten eingesetzt</p>
24. 6 1966 - Auftritte der Beatles im Cirkus Krone
<p><strong><em>München</em></strong> * Für 17:15 Uhr ist das erste und für 21 Uhr das zweite Beatles-Konzert im Circus Krone angesetzt. Die Süddeutsche Zeitung informiert ihre Leser fürsorglich über die gesundheitliche Gefährlichkeit dieser Musik: <em>„Wenn die Gitarren ihren harten Rhythmus beginnen, wird der Lärm so stark, dass es vom ärztlichen Standpunkt aus ratsam erscheint, das Weite zu suchen. Das halbe Dutzend großer Verstärker verwandelt selbst das Laufgeräusch einer Ameise in das Donnern einer aufgescheuchten Elefantenherde: Sie haben zusammen 800 Watt.“</em></p> <p>Die 6.200 Eintrittskarten für die Beatles-Konzerte sind schon lange vorher verkauft worden, 2.000 davon nach auswärts. Vier Sonderzüge treffen mit diesen Fans in München ein:</p> <ul> <li>aus Stuttgart Der Rasende John,</li> <li>aus Innsbruck Der Fliegende Paul,</li> <li>aus Würzburg Der Schnelle George und</li> <li>aus Ulm Der Rollende Ringo. </li> </ul> <p>Am Einlass zum Cirkus-Krone-Bau brechen Teenager vor Enttäuschung in Tränen aus. Sie sind von einer Fälscherbande mit gezinkten Tickets betrogen worden.</p> <p>Um 16:30 Uhr werden die Türen zum Circus-Krone-Bau für die Fans geöffnet und um 17:15 Uhr beginnt das erste Beatles-Konzert vor 3.500 Zuschauern mit dem Vorprogramm. Die Sicherheitsvorkehrungen sind beträchtlich: 250 Polizeibeamte sind im Einsatz. Im Hof der Deroy-Schule parkt ein Wasserwerfer. Im Publikum verteilen sich ausgewählte junge Beamte. Bei einem Stimmungsüberschlag will man den Cirkus-Krone-Bau schlagartig in gleißend weißes Licht tauchen. Doch noch vor Konzertbeginn sorgt ein Gewitterregen für Abkühlung.</p> <p>Die Stimmung sinkt noch tiefer, als sich die erste Vorgruppe mit dem aufreizenden Namen Cliff Bennet and the Rebel Rousers auf der Münchner Bühne abmüht. Erst den Rattles, einer Band aus Hamburg, gelingt es, die Emotionen auf beatlesgemäßes Niveau zu steigern. Im Anschluss tritt noch das Duo Peter & Gordon auf. Danach schaltet die Regie eine künstliche Pause, nach der - in dem atemlos stillen Krone-Saal - die Beatles angekündigt werden.</p> <p>Als die vier Ausnahmemusiker urplötzlich auf die Bühne springen, entlädt sich ein Orkan. Unter ihren - für die damaligen Verhältnisse - skandalös langhaarigen Köpfen tragen sie dunkelgrüne Jägeranzüge mit hellen Kragenaufschlägen. Ihre ebenfalls uniformen gelben Hemden sind mit Krawatten zugebunden. </p> <p>Die Beatles spielen zwar nur elf Lieder. Doch mit jedem Song steigert sich die frenetische Begeisterung des Münchner Publikums. Die Songfolge ist folgendermaßen:</p> <ul> <li>Rock and Roll Music</li> <li>She‘s a woman</li> <li>If I needed someone</li> <li>Babys in black</li> <li>Day tripper</li> <li>I feel fine</li> <li>Yesterday</li> <li>I wanna be your man </li> <li>Nowhere man </li> <li>Paperback writer</li> <li>I‘m down</li> </ul> <p>Begeisterte, schluchzende und enthemmte Jugendliche branden gegen die Bühne an, ausgebremst von einer Hundertschaft Polizisten, die auf Empfehlung des Psychologen in Zivil gekommen sind. Papierkugeln und Damenschuhe fliegen durch die Luft - bevorzugt zu Paul McCartney, dem damals noch einzigen Junggesellen. Nach jeder Nummer verbeugen sich die „Pilzköpfe“ artig und lächeln lieb. Das Jubelgeschrei wird noch lauter und noch stärker, sodass hinterher keiner der Anwesenden mit Bestimmtheit sagen kann, welche Songs die Beatles tatsächlich gespielt haben.</p> <p>Bereits nach 25 Minuten verschwinden die - wie sie die Münchner Presse gerne nennt - <em>„vier Liverpooler Sängerknaben“</em> - genauso schnell wieder von der Bühne, wie sie gekommen sind, und hinterlassen ein erschüttertes Publikum und eine erleichterte Polizei. Immerhin ist es zu keinen Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen. <em>„Es ging alles friedlich vonstatten“</em>, wurde gebetsmühlenartig wiederholt. </p>
25. 6 1966 - Die Beatles sind auf dem Weg nach Essen
<p><strong><em>München - Essen</em></strong> * Die Beatles verlassen um 8:25 Uhr auf Gleis 11 den Münchner Hauptbahnhof. Sie benutzen dazu den gleichen Vier-Waggon-Sonderzug, mit dem ein Jahr zuvor Königin Elisabeth und Prinz Philipp die Bundesrepublik bereist hatten. Beatles-Manager Brian Epstein hätte den Zug beinahe verpasst.</p> <p>Rund dreihundert Fans haben sich hinter den Absperrungen im Bahnhof versammelt, um ihre <em>„plüschhaarigen Lieblinge“</em> ein letztes Mal zu sehen. <em>„Schaurig hallte das Kreischen der Teenager durch die Bahnhofshalle“</em> - und dann sind sie weg. Langsam kann die <em>„Münchner Bierruhe“</em> wieder zurückkehren.</p> <p>Um 16:32 Uhr sind die Beatles in Mülheim/Ruhr. Von dort fahren sie direkt zur Gruga-Halle in Essen, wo sie ebenfalls zwei Konzerte vor insgesamt 16.000 Fans geben sollen. </p>
26. 6 1966 - Die Hamburger Beatles-Konzerte
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Die Beatles treffen um 5:30 Uhr auf dem Hamburger Bahnhof Ahrensburg ein. Nach zwei Shows in der Ernst-Merck-Halle vor jeweils 5.600 Zuschauern bricht der Verkehr zusammen. Vier Stunden nach dem zweiten Konzert meldet der Polizeifunk: <em>„Durchbruch der Fans auf breiter Front.“</em> </p> <p>600 Polizeibeamte sind im Einsatz und 117 Fans werden inhaftiert. Unterdessen entwischen die Beatles ihren Bewachern und feiern mit ihren alten Freunden von der Reeperbahn bis um vier Uhr in der Frühe. Damit endet das Gastspiel der <em>„weltbesten Beatband“</em> in Deutschland. </p>
27. 6 1966 - Die Beatles brechen von Hamburg in Richtung Japan auf
<p><strong><em>Hamburg</em></strong> * Die Beatles brechen von Hamburg in Richtung Japan auf.</p>
Ab 30. 6 1966 - Die Beatles treten bis 2. Juli in Tokyo auf
<p><strong><em>Tokyo</em></strong> * Die Beatles treten bis 2. Juli in Tokyo auf.</p>
4. 7 1966 - Steine und Tintenfässer fliegen gegen das US-Generalkonsulat
München-Maxvorstadt * Am amerikanischen Unabhängigkeitstag demonstrieren Kriegsgegner gegen den Vietnamkrieg, in den Amerika 1963 militärisch eingegriffen hat. Steine und Tintenfässer fliegen gegen das Gebäude. Das Generalkonsulat in München wird zum Symbol eines US-Imperialismus und damit zur Zielscheibe zahlreicher Protestaktionen.
4. 7 1966 - Die Beatles geben ein Konzert in Manila
<p><strong><em>Manila</em></strong> * Die Beatles geben ein Konzert in Manila.</p>
31. 7 1966 - Beatles-Schallplatten öffentlich verbrannt
<p><strong><em>USA</em></strong> * Aufgrund der John-Lennon-Aussage, die Beatles seien <em>„populärer als Christus“</em> verzichten Radiosender im amerikanischen Bible Belt auf die Ausstrahlung von Beatles-Liedern. Beatles-Schallplatten und Fanartikel werden als Reaktion daraufhin öffentlich verbrannt.</p>
5. 8 1966 - Revolver, die 7. LP der Beatles & die 13. Single
Großbritannien * Revolver, die siebte Langspielplatte der Beatles, wird in den Schallplattenläden angeboten.
Die Platte ist das erste Gesamtkunstwerk der Fab Four. Als Auskoppelung der LP erscheint die 13. Beatles-Single mit den Titeln Eleanor Rigby/Yellow Submarine.
Ab 12. 8 1966 - Die Beatles beenden ihre Live-Karriere
<p><strong><em>Kanada - USA</em></strong> * Die <em>Beatles</em> beginnen eine Tournee durch Kanada und die USA. Sie dauert bis 29. August. Das ist das Ende der gemeinsamen Live-Karriere der <em>Fab Four</em>. </p>
2. 9 1966 - Bayern und der Vatikan schließen Hochschul-Verträge
München - Rom-Vatikan - Freising - Regensburg * Kultusminister Ludwig Huber und Nuntius Corrado Bafile unterzeichnen in München die Verträge über
- die Ausbildung an der Katholischen Hochschule Freising sowie
- die Errichtung einer Katholischen Fakultät an der Universität Regensburg.
17. 9 1966 - Die erste Folge des Raumschiffes Orion wird ausgestrahlt
München - Bundesrepublik Deutschland * Um 20:15 Uhr sendet das Erste deutsche Fernsehen die erste Folge von „Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“. Ab dann können die Bundesbürger dieses „Märchen von übermorgen“ jeden zweiten Samstag bewundern.
Der Start der Orion ist der Höhepunkt der Tricktechnik. Er wird auf den noch mit Granitplatten belegten Königsplatz gedreht und anschließend verfälscht.
27. 10 1966 - Ludwig Erhard bildet eine CDU/CSU-Minderheitsregierung
Bonn * Die FDP zieht nach einer Auseinandersetzung über den Bundeshaushalt ihre vier Minister aus der Regierung Erhard zurück. Bundeskanzler Ludwig Erhard [CDU] bildet daraufhin eine Minderheitsregierung aus CDU und CSU.
2. 11 1966 - „Eheliche Zuneigung und Opferbereitschaft“
Karlsruhe * In einem Urteil des Bundesgerichtshofs heißt es: „Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt.
Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.“
9. 11 1966 - Jimmy Hendrix tritt im Big Apple Club auf
München-Schwabing * Vom 8. bis 11. November spielt Jimi Hendrix und seine Band Experience im Big Apple Club in der Leopoldstraße als Vorgruppe zu einer Soul-Revue.
Am 9. November wird Jimi von übermütigen Fans in die Menge gezogen. Beim Zurückspringen auf die Bühne zerbricht seine Gitarre. Der Musiker flippt aus und schlägt die Gitarre zu Kleinholz. Jetzt tobt das Publikum vor Begeisterung, weshalb Jimi Hendrix künftig immer eine Gitarre auf der Bühne zerdeppern muss.
9. 11 1966 - John Lennon und Yoko Ono lernen sich in London kennen
<p><strong><em>London</em></strong> * John Lennon und Yoko Ono lernen sich in London kennen.</p>
10. 11 1966 - Kurt Georg Kiesinger wird Kanzlerkandidat der CDU
Bonn * Kurt Georg Kiesinger [CDU] setzt sich im dritten Wahlgang gegen seine Konkurrenten - Bundesaußenminister Gerhard Schröder [CDU] und den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel - als Kanzlerkandidat der CDU durch. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier hat zuvor zugunsten Kiesingers verzichtet.
20. 11 1966 - Alfons Goppel leitet ein CSU-Kabinett
München * Das Kabinett unter Alfons Goppel setzt sich nur noch aus CSU-Mitgliedern zusammen. Während Goppels Amtszeit kann die CSU ihren Stimmenanteil beständig steigern. So erreicht sie am 20. November 1966 48,1 Prozent.
25. 11 1966 - Kiesingers Verhandlungen mit der FDP scheitern
Bonn * Die Verhandlungen Kurt Georg Kiesingers [CDU] mit der FDP zur erneuten Regierungsbildung scheitern.
26. 11 1966 - CDU/CSU und SPD vereinbaren eine Große Koalition
Bonn * Zwischen dem Kanzerkandidaten der CDU, Kurt Georg Kiesinger, und dem oppositionellen Kanzerkandidaten der SPD, Willy Brandt, wird eine Große Koalition vereinbart.
30. 11 1966 - Ludwig Erhard [CDU] tritt als Bundeskanzler zurück
Bonn * Ludwig Erhard [CDU] tritt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zurück.
1. 12 1966 - Kurt Georg Kiesinger wird Bundeskanzler einer Großen Koalition
Bonn * Kurt Georg Kiesinger wird Bundeskanzler der ersten Großen Koalition auf Bundesebene.
9. 12 1966 - 8. Beatles-LP „A Collection of Beatles Oldies“
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * In Großbritannien erscheint die achte Beatles-LP <em>„A Collection of Beatles Oldies“</em>. Sie ist eine für das Weihnachtsgeschäft geschaffene Zusammenstellung von Beatles-Singles. Das einzige neue Lied ist <em>„Bad Boy“</em>. Die Langspielplatte erreicht erstmals nicht den 1. Platz in den Britischen Charts, sondern kommt nur auf Platz 6.</p>
1967 - Das „Hauptstaatsarchiv“ kann ihren Betrieb aufnehmen
München-Maxvorstadt * Das „Hauptstaatsarchiv“ kann in ihren heutigen Räumen den Betrieb aufnehmen.
1967 - Die „Evangelisch-lutherische Landeskirche“ verkauft
München-Bogenhausen * Die „Evangelisch-lutherische Landeskirche“ verkauft das Anwesen in der Maria-Theresia-Straße 23 für 630.000 Mark an den „Generalkonsul“ Heckelmann.
1967 - Die „Bayerische Staatsregierung“ nutzt Räume der „Schack-Galerie“
München-Lehel * Der größte Raum der „Schack-Galerie“, der „Lenbach-Saal“ und nachmalige „Feuerbach-Saal“, steht nicht mehr als Ausstellungsraum zur Verfügung, da er als Sitzungszimmer der „Bayerischen Staatsregierung“ genutzt wird.
1967 - Der Einlass für den „Fabrikbach“ wird gebaut
München-Lehel * Der Einlass für den „Fabrikbach“ nördlich der „Mariannenbrücke“ gebaut.
Durch die Verbreiterung der Kaimauern verliert die „Mariannenbrücke“ viel an Eleganz.
1967 - Eingliederung des restlichen „Maffei-Geländes“ in den „Englischen Garten“
München-Englischer Garten - Hirschau * Eingliederung des restlichen „Maffei-Geländes“ in den „Englischen Garten“.
1967 - Letztmaliges Auftreten des „Professoren-Kollegiums“ im Talar
München-Maxvorstadt * Letztmals treten die „Talare“ des „Professoren-Kollegiums“ an der „Akademie der Bildenden Künste“ bei der „Jahresfeier 1967“ in Erscheinung.
1967 - Ein neues Ludwig-II.-Denkmal in den Maximiliansanlagen
München-Haidhausen * In den Maximiliansanlagen, zwischen dem Maximilianeum und dem Friedensengel, an der Stelle, an der König Ludwig II. - eigens für die Werke seines verehrten Musikeridols Richard Wagner - ein Festspielhaus errichten lassen wollte, wird eine 2,60 Meter hohe Bronzestatue zu Ehren des bayerischen Märchenkönigs erstellt.
1967 - Die „Bäcker-Innung“ steigt auf die Barrikaden
München-Untergiesing * Die „Bäcker-Innung“ steigt auf die Barrikaden, nachdem sie die Hangauffahrt des „Mittleren Ringes“ zu überrollen droht.
Um Platz für die Hochstraße zu schaffen, musst damals ein Drittel des Bürotraktes der „Bäcker-Kunstmühle“ geopfert werden.
Ein Argument, mit dem sich die „Bäcker-Innung“ damals gegen die städtischen Straßenplaner wehrt, ist, dass die Versorgung der Münchner Bevölkerung mit Brot gefährdet sei.
Vor Gericht wird ihr eine Entschädigungssumme von 800.000 DMark zugesprochen, die anschließend zur Modernisierung in den Betrieb gesteckt wird.
Doch diese Investition ist zum Fenster rausgeschmissen.
1967 - DDR-Todesurteile werden mit der „Guillotine“ vollstreckt
Deutsche Demokratische Republik - DDR * In der „Deutschen Demokratischen Republik - DDR“ werden Todesurteile mit der „Guillotine“ vollstreckt.
1967 - Ferdinand Schmid ist für die Münchener „Löwenbrauerei“ tätig
München-Maxvorstadt * Ferdinand Schmid ist bis 1970 für die Münchener „Löwenbrauerei“ tätig.
1967 - Die „Mariensäule“ wird abgetragen. Dabei zerbricht der Säulenschaft
München-Graggenau * Bedingt durch den Bau der U- und S-Bahn wird die „Mariensäule“ abgetragen, wobei der früher schon erneuerte Säulenschaft zerbricht.
Sie wird durch eine Kopie in „Adneter Marmor“ ersetzt.
1967 - Das „Valentin-Musäum“ vergibt den „Blödsinnstaler“
München-Graggenau - München-Angerviertel * Das „Valentin-Musäum“ vergibt den „Blödsinnstaler“.
Prämiert wird der „größte Blödsinn des Jahres“.
1. 1 1967 - Die Innenstadtbezirke werden zum Stadtbezirk 1 - Altstadt
München * Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs werden alle vier Innenstadtbezirke zum Stadtbezirk 1 - Altstadt zusammengefasst.
17. 2 1967 - Die 15. Single der Beatles erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em> </strong>* Die ursprünglich für die Beatles-LP <em>„Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“</em> aufgenommenen Titel <em>„Penny Lane“</em> und <em>„Strawberry Fields Forever“</em> erscheinen auf der 15. Single. Manager Brian Epstein plädierte für die Veröffentlichung, weil die Beatles schon so lange nicht mehr in den Charts gewesen sind.</p>
19. 4 1967 - Konrad Adenauer stirbt im Alter von 91 Jahren in Bad Honnef
Bad Honnef * Der ehemalige Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer [CDU] stirbt im Alter von 91 Jahren in Bad Honnef.
5. 5 1967 - Hans Joachim und Amélie Ziersch verschenken die „Villa Stuck“
München-Haidhausen * Hans Joachim und Amélie Ziersch schenken die „Villa Stuck“, das dazugehörige Grundstück und ihre umfangreiche Sammlung dem von ihnen gegründeten „Stuck-Jugendstil-Verein“.
23. 5 1967 - Ernst Niekisch stirbt in West-Berlin
Berlin * Ernst Niekisch stirbt in West-Berlin.
1. 6 1967 - Die Beatles-LP „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Als neunte Langspielplatte der Beatles erscheint <em>„Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“</em>. </p>
25. 6 1967 - 400 Millionen sehen „All You Need Is Love“
<p><strong><em>Londdon</em></strong> * Die Beatles treten mit der Friedenshymne <em>„All You Need Is Love“</em> in der per Satellit weltweit übertragenen BBC-Fernsehsendung Our World Live auf. Die Sendung wird weltweit von 400 Millionen Zuschauern gesehen. Zu den Gästen in den Abbey-Road-Studios gehören Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon und Marianne Faithfull. </p>
28. 6 1967 - Oskar Maria Graf stirbt in New York
New York * Oskar Maria Graf stirbt in New York.
Ab 7 1967 - Der Zeichentrickfilm „Yellow Submarine“ entsteht
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * 126 Zeichner beginnen mit den Arbeiten für den Zeichentrickfilm <em>„Yellow Submarine“</em>, für den die Beatles die Musik schreiben werden. </p>
7. 7 1967 - Die Beatles-Single „All You Need Is Love“ erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Single <em>„All You Need Is Love / Baby Your A Rich Man“</em> wird veröffentlicht. Sie bringt die Beatles diesseits und jenseits des Atlantiks an die Spitze der Hitparaden. </p>
9 1967 - Das „Edith-Stein-Gymnasium“ startet mit 80 Schülerinnen
München-Haidhausen * Die „Dominikanerinnen aus Niederviehbach“ starten mit achtzig Schülerinnen auf dem ehemaligen Areal der „Frauen vom guten Hirten“ ins erste Schuljahr des „Edith-Stein-Gymnasium“.
In dem „Katholischen Zentrum“ befinden sich neben dem „Mädchengymnasium“ ein „Internat“, eine „Fachoberschule für Sozialberufe“, die „Fachhochschule für Sozialpädagogik“, ein „Schwesternhaus“ und eine „Mensa“.
9 1967 - Drehbeginn für den Beatles-TV-Film „Magical Mystery Tour“
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Drehbeginn für den Beatles-TV-Film <em>„Magical Mystery Tour“</em>. </p>
15. 9 1967 - Der Zierbrunnen im Alten Hof wird wieder in Betrieb gesetzt
München-Graggenau * Der Zierbrunnen im Alten Hof wird wieder in Betrieb gesetzt.
14. 11 1967 - Die 16. Beatles-Single wird veröffentlicht
Großbritannien * Mit „Hello Goodbye/I Am The Walrus“ kommt die 16. Beatles-Single in die Schallplattengeschäfte.
1. 12 1967 - Der erste bayerische Verfassungstag findet statt
München - Freistaat Bayern • Erstmals findet der bayerische Verfassungstag statt. Er erinnert daran, dass sich das bayerische Volk am 1. Dezember 1946 selber eine Verfassung gegeben hat.
8. 12 1967 - „Magical Mystery Tour“ als Doppel-EP
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Eine Doppel-EP mit einem 28-seitigen Comic-Buch, das die Story erzählt, erscheint die Musik zu dem Beatles-TV-Film <em>„Magical Mystery Tour“</em>. </p>
26. 12 1967 - „Magical Mystery Tour“ wird in Schwarzweiß ausgestrahlt.
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Der Beatles-TV-Film <em>„Magical Mystery Tour“</em> wird in BBC 1 TV in Schwarzweiß ausgestrahlt. </p>
1968 - Auf ganze 0,85 Hektar wird „Baierwein“ kultiviert
Freistaat Bayern * Auf ganze 0,85 Hektar wird „Baierwein“ kultiviert.
1968 - In der „Kunst-Akademie“ werden Stücke des „Anti-Theaters“ gezeigt
München-Maxvorstadt * In der „Akademie der Bildenden Künste“ werden mehrere Stücke des „Anti-Theaters“ um Rainer Werner Fassbinder aufgeführt.
1968 - Die „Deutsche Bundespost“ kauft das „Farben-Huber“-Anwesen
München-Haidhausen * Die „Deutsche Bundespost“ kauft das „Farben-Huber“-Anwesen in Haidhausen.
In die frei gewordenen Räumlichkeiten zieht das Postamt 80 (V) und Dienststellen des Fernmeldewesens.
1968 - Der „Eisbach“ erhält 32 Kubikmeter Isarwasser in der Sekunde
München-Lehel * Der „Schwabinger Bach“ im Bereich des „Hauses der Kunst“ wird aufgelassen.
Dafür erhält der „Eisbach“ nun 32 Kubikmeter Isarwasser in der Sekunde.
1968 - Die „Studentenrevolte“ greift das „Professoren-Kollegium“ an
München-Maxvorstadt * Die „Studentenrevolte“ greift die „Talare“ des „Professoren-Kollegiums“ an der „Akademie der Bildenden Künste“ als Repräsentationsmerkmal medienwirksam an.
„Unter den Talaren - der Mief von tausend Jahren!“ lautet ein griffiger Slogan studentischer Agitation gegen das „Establishment“.
1968 - „Anwerbeabkommen“ mit Jugoslawien
Bundesrepublik Deutschland - Jugoslawien * Zwischen Jugoslawien und der Bundesrepublik Deutschland wird ein „Abkommen zur Anwerbung jugoslawischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ abgeschlossen.
4. 1 1968 - Die Komödie „Zur Sache, Schätzchen“ wird uraufgeführt
München * Die Komödie „Zur Sache, Schätzchen“ der Regisseurin May Spils wird uraufgeführt. Der Streifen mit Uschi Glas und Werner Enke in den Hauptrollen erreicht bald Kultstatus.
5. 1 1968 - „Magical Mystery Tour“ wird in Farbe wiederholt
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Der Beatles-TV-Film <em>„Magical Mystery Tour“</em> wird in BBC 2 in Farbe wiederholt. </p>
15. 2 1968 - Transzendale Meditation in Indien
Rishikesh * George und Pattie Harrison sowie John und Cynthia Lennon reisen nach Rishikesh in Indien, um dort für drei Monate beim Maharishi transzendale Meditation zu üben.
9. 3 1968 - Das Museum Villa Stuck wird wieder eröffnet
München-Haidhausen * Das Museum Villa Stuck wird nach zweijähriger Umbauzeit mit einer Ausstellung über den Malerfürsten eröffnet.
15. 3 1968 - 17. Beatles-Single
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Beatles veröffentlichen ihre 17. Single mit den Titeln <em>„Lady Madonna“</em> und George Harrisons <em>„The inner Light“</em>. </p>
19. 3 1968 - Der „Josefi-Tag“ ist letztmals in Bayern ein Feiertag
<p><strong><em>München</em></strong> * Der <em>„Josefi-Tag“</em> ist letztmals in Bayern ein Feiertag. Er wird in der Amtszeit des Ministerpräsidenten“ Alfons Goppel abgeschafft. </p>
4. 4 1968 - Martin Luther King wird von einem rassistischen Attentäter ermordet
Memphis * Martin Luther King wird von einem rassistischen Attentäter - womöglich mit Wissen des FBI, aber ganz gewiss nicht ohne die Zustimmung jener „schweigenden Mehrheit“, für die die Rassenungleichheit Teil einer göttlichen Weltordnung ist - ermordet.
7. 4 1968 - Rainer Werner Fassbinders Drama „Katzelmacher“ wird uraufgeführt
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * Im Münchner <em>„Action-Theater“</em> in der Müllerstraße wird Rainer Werner Fassbinders sozialkritisches Drama <em>„Katzelmacher“</em> uraufgeführt. Im Mittelpunkt steht ein griechischer Gastarbeiter in einem bayerischen Dorf. </p>
22. 5 1968 - Erstmals zu Zweit
London * Erster gemeinsamer Auftritt von John Lennon und Yoko Ono.
17. 7 1968 - Welturaufführung des Zeichentrickfilms „Yellow Submarine“
<p><strong><em>London</em></strong> * Der von den Beatles unterstützte Zeichentrickfilm <em>„Yellow Submarine“</em> hat seine Welturaufführung im London Pavilon am Piccadilly Circus. </p>
30. 8 1968 - Die 18. Beatles-Single: „Hey Jude“ und „Revolution“
Großbritannien * Die 18. Beatles-Single kommt in die Plattenläden. Sie beinhaltet die Titel „Hey Jude“ und „Revolution“.
24. 10 1968 - Deutsche Uraufführung des Hippie-Musicals „Haare“
München-Maxvorstadt * Das Hippie-Musicals „Haare“ [= „Hair“] erlebt im Theater an der Brienner Straße seine deutsche Uraufführung. Für die jungen Schauspieler und Sänger Reiner Schöne, Ron Williams, Jürgen Marcus und die 19-jährige Donna Summer wird Haare zum Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere.
25. 10 1968 - Yoko Ono schwanger
Großbritannien * In einer Pressekonferenz berichten John Lennon und Yoko Ono von Yokos Schwangerschaft.
1. 11 1968 - George Harrisons Solo-LP „Wanderwall Music“ erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * George Harrisons Solo-LP <em>„Wanderwall Music“</em> erscheint. Es ist das erste Solo-Album eines Beatle und enthält die eigens komponierte Instrumenal-Musik für den britischen Film <em>„Wanderwall“</em>. </p>
7. 11 1968 - Beate Klarsfeld ohrfeigt Bundeskanzler Kiesinger
Berlin * Beate Klarsfeld verschafft sich mit einer Pressekarte Zugang zum CDU-Parteitag in der Berliner Kongresshalle und ohrfeigt den deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der der NSDAP seit 1933 angehört hatte, wegen seiner Nazi-Vergangenheit.
Beate Klarsfeld wird noch an demselben Tag zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Strafe wird jedoch zur Bewährung ausgesetzt. „Es war eine symbolische Aktion der jungen Generation, der Nazi-Kinder gegen die Nazi-Väter“, sagt Beate Klarsfeld.
8. 11 1968 - John und Cynthia Lennon: Scheidung
London - Liverpool * John und Cynthia Lennon werden geschieden.
21. 11 1968 - Yoko Onos Fehlgeburt
London * Yoko Ono erleidet eine Fehlgeburt.
22. 11 1968 - Das „White Album“ der Beatles erscheint
Großbritannien * Die erste Doppel-LP der Beatles, die Zehnte ihrer Schaffensphase, die wegen ihres weißen Covers auch „White Album“ genannt wird, erscheint in den Plattenläden.
25 Songs stammen aus der Feder von John Lennon & Paul McCartney, vier hat George Harrison und einen hat Ringo Starr geschrieben.
28. 11 1968 - John Lennon wird wegen Cannabis-Besitz verurteilt
Großbritannien * John Lennon wird wegen Cannabis-Besitz zu einer Strafe von 150 Pfund verurteilt.
29. 11 1968 - John Lennons und Yoko Onos erste LP „Unfished Music No. 1 - Two Virgins“
Großbritannien * John Lennons und Yoko Onos erste gemeinsame Langspielplatte „Unfished Music No. 1 - Two Virgins“ erscheint.
Ab 1969 - Die Georgs-Kirche in Bogenhausen wird renoviert
München-Bogenhausen * Die Sankt-Georgs-Kirche in Bogenhausen wird renoviert und dabei Veränderungen aus dem Jahr 1866 zurückgenommen.
1969 - Die „Villa Benno Becker“ wird abgerissen
München-Bogenhausen * Die „Villa Benno Becker“ in der Maria-Theresia-Straße 26 wird abgerissen und durch einen zeittypischen Neubau ersetzt.
1969 - Die „Raulino Treuhand- und Verwaltungs AG“ kauft die „Hildebrand-Villa“
München-Bogenhausen * Die „Raulino Treuhand- und Verwaltungs AG“ kauft die ehemalige „Hildebrand-Villa“ in der Maria-Theresia-Straße 23 für 1,6 Millionen DMark.
1969 - Die Gebäude am Lilienberg werden umfangreich renoviert
München-Au * Die ehemaligen Gebäude des „Landratsamtes am Lilienberg“ werden umfangreich saniert.
1969 - Das „Müllverbrennungswerk Süd“ geht in Betrieb
München-Thalkirchen * Das „Müllverbrennungswerk Süd“ geht in Betrieb.
1969 - Falk Volkhardt kauft das Montgelas-Palais
München-Kreuzviertel * Falk Volkhardt, der Besitzer des benachbarten Hotels Bayerischer Hof kauft das Montgelas-Palais - und richtet dort eine Dependance ein. Im Keller befindet sich das Lokal „Palais Keller“.
Ab dem Jahr 1969 - Die Straßenbahn fährt über den Weißenburg Platz
München-Haidhausen * Während der Zeit des S-Bahn-Baus fahren die Straßenbahn-Linien 19, 29 und 39 über die Lothringer Straße und den Weißenburger Platz.
3. 1 1969 - 30.000 Exemplare der LP „Unfished Music No. 1 - Two Virgins“ beschlagnahmt
Großbritannien * 30.000 Exemplare der Langspielplatte „Unfished Music No. 1 - Two Virgins“ von John Lennon und Yoko Ono werden wegen des Coverfotos als Pornographie beschlagnahmt.
10. 1 1969 - George Harrison verlässt die Film- und Plattenaufnahmen
<p><strong><em>London</em></strong> * George Harrison verlässt nach einem erbitterten Streit mit John Lennon die Film- und Plattenaufnahmen von <em>„Let It Be“</em>, nachdem es zuvor schon Auseinandersetzungen mit Paul McCartney gab. Erst nach zwei klärenden Gesprächen aller vier Beatles können die Aufnahmen am 21. Januar fortgeführt werden. Der Bruch ist aber unwiderruflich eingetreten. </p>
13. 1 1969 - Beatles-LP „Yellow Submarine“
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die elfte Beatles-LP <em>„Yellow Submarine“</em> wird veröffentlicht. Sie beinhaltet neben dem Titelsong von 1966 die vier für den Film neu geschriebenen Songs und die Orchestermusik von George Martin.</p>
14. 1 1969 - Schwierige Benennung von zwei Straßen in Neu-Perlach
München * Im Stadtrat geht es um die Benennung von zwei Straßen in Neu-Perlach nach Karl Marx und Kurt Eisner. Während Marx der CSU-Fraktion „nicht problematisch“ erscheint, entzündet sich die Diskussion an Kurt Eisner. Denn: „München hat keine Veranlassung Eisner zu ehren. Sein Name ist in der Bevölkerung mit viel Unheil verbunden, auch wegen der Ereignisse nach [!] seinem Tod.“
30. 1 1969 - Das letzte öffentliche Konzert der Beatles
<p><strong><em>London</em></strong> * Das letzte öffentliche Konzert der Beatles findet auf dem Dach des Apple-Gebäudes statt.</p>
2. 2 1969 - Yoko Ono wird geschieden
New York * Yoko Ono wird von Anthony Cox geschieden.
3. 2 1969 - Allen Klein wird Finanzberater der Beatles
<p><strong><em>London</em></strong> * Gegen den Willen von Paul McCartney wird Allen Klein von den restlichen Beatles zum Finanzberater bestellt. </p>
23. 2 1969 - Brand in der U-Bahn-Baustelle am Marienplatz. Drei Tote
München * Bei einem Brand der Baustelle im Tunnel der U-Bahn unter dem Marienplatz kommen drei Arbeiter ums Leben.
20. 3 1969 - Yoko Ono und John Lennon heiraten auf Gibraltar
<p><strong><em>Gibraltar</em> </strong>* Yoko Ono und John Lennon heiraten im <em>„Britischen Konsulat“</em> auf Gibraltar.</p>
25. 3 1969 - John Lennon und Yoko Ono erstes „Bed-in“
<p><strong><em>Amsterdam</em></strong> * Im Amsterdamer Hilton Hotel beginnen John Lennon und Yoko Ono ihr erstes <em>„Bed-in“</em>. </p>
12. 4 1969 - Die 19. Single der Beatles
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Beatles veröffentlichen ihre 19. Single mit den Titeln <em>„Get Back“ </em>und <em>„Don‘t Let Me Down“</em>. </p>
22. 4 1969 - John Lennon ändert seinen Namen in John Ono Lennon
<p><strong><em>London</em></strong> * John Lennon ändert in einer offiziellen Zeremonie auf dem Dach des <em>"Apple-Gebäudes"</em> seinen Namen in John Ono Lennon. </p>
9. 5 1969 - Die George-Harrison-LP „Electronic Sound“ erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die George-Harrison-LP <em>„Electronic Sound“</em> erscheint. </p>
9. 5 1969 - Die zweite LP von John Lennon und Yoko Ono wird veröffentlicht
Großbritannien * „Unfished Music No. 2 - Life with the lions“, die zweite LP von John Lennon und Yoko Ono, wird veröffentlicht.
16. 5 1969 - John Lennons Visumantrag für die USA wird abgelehnt
London - USA * Wegen seines Drogenprozesses vom November 1968 wird John Lennons Visumantrag für die USA abgelehnt.
26. 5 1969 - Zweites „Bed-in“ von John Lennon und Yoko Ono
Montreal * John Lennon und Yoko Ono veranstalten im „Queen Elizabeth Hotel“ von Montreal ihr zweites „Bed-in“.
30. 5 1969 - Die 20. Beatles-Single erscheint
Großbritannien * Mit „The Ballad of John and Yoko“ und „Old Brown Shoe“ veröffentlichen die Beatles ihre 20. Single.
1. 6 1969 - „Give Peace a Chance“ entsteht während dem zweiten „Bed-in“
Montreal * Die Aufnahmen zu „Give Peace a Chance“ von John Lennon und Yoko Ono entstehen während des zweiten „Bed-in“ in Montreal.
9. 6 1969 - Brian Jones und die Rolling Stones trennen sich
London * Brian Jones, Lead-Gitarrist und Mitbegründer der Rolling Stones, trennt sich von der Band. Jones akzeptiert einen Abfindungsvertrag, der ihm eine einmalige Abfindungszahlung vom 100.000 Pfund sowie 20.000 Pfund jährlich, so lange die Rolling Stones existieren.
2. 7 1969 - Das Hippie-Festival in Woodstock wird verhindert
Saugerties * Eine Bürgerinitiative der Kleinstadt Saugerties im US-Bundesstaat New York verhinderte die Ausrichtung des Woodstock-Festivals im 15 Kilometer entfernten Woodstock mit einem lokalen Gesetzerlass. Die Kleinstädter befürchten den zu erwartenden Ansturm der Hippies.
Deshalb wird das geplante Festival ins 70 Kilometer südwestlich von Woodstock gelegene White Lake verlegt.
3. 7 1969 - Brian Jones, der Ex-Lead-Gitarrist der Rolling Stones, stirbt
Hartfield * Brian Jones, der Ex-Lead-Gitarrist der Rolling Stones, stirbt in Hartfield, Sussex.
4. 7 1969 - Das John Lennon/Yoko Ono-Bandprojekt Plastic Ono Band
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Mit <em>„Give Peace A Chance“</em> und <em>„Remember Love“</em> erscheint die erste Single des John Lennon/Yoko Ono-Bandprojekts Plastic Ono Band. </p>
5. 7 1969 - Mick Taylor tritt erstmals mit den Rolling Stones auf
London * Mick Taylor tritt erstmals als offizielles Band-Mitglied der Rolling Stones beim Konzert im Londoner Hyde-Park vor etwa 500.000 Menschen auf. Das Konzert ist Brian Jones - aufgrund des plötzlichen Todes - gewidmet.
15. 8 1969 - Woodstock - Das große Flower-Power-Open-Air-Musikfestival
Woodstock - White Lake * Vom 15. bis zum 18. August findet auf einem Weideland in White Lake bei Bethel im US-Bundesstaat New York das große Flower-Power-Open-Air-Musikfestival statt. Rund 400.000 Musikbegeisterte sind anwesend und verfolgen die Darbietungen der 32 Bands und Einzelkünstler.
In dem Namengebenden Woodstock sollte das Festival ursprünglich abgehalten werden, doch eine Bürgerinitiative der Kleinstadt Saugerties verhinderte die Ausrichtung des Festivals. Deshalb wird der Veranstaltungsort ins 70 Kilometer südwestlich von Woodstock gelegene White Lake verlegt.
22. 8 1969 - Das letzte gemeinsame Foto der Beatles entsteht
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Das letzte gemeinsame Foto der Beatles wird in John Lennons Anwesen Tittenhurst Park geschossen. </p>
26. 9 1969 - Abbey Road von den Beatles erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die zwölfte LP "<em>Abbey Road"</em> der Beatles wird veröffentlicht. 14 Songs stammen von dem Team Lennon/McCartney, zwei Lieder hat George Harrison, eines Ringo Starr geschrieben. </p>
28. 9 1969 - Ergebnis der Bundestagswahl 1969
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger 46,1 Prozent [- 1,5] und 250 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Willy Brandt erringt 42,7 Prozent der Stimmen [+ 3,4] und 237 Sitze.
- Die FDP bekommt 6,8 Prozent [- 3,7] und 31 Sitze.
- Die NPD scheitert mit 4,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde.
Willy Brandt [ SPD] wird Bundeskanzler einer Koalition aus SPD und FDP.
20. 10 1969 - Die zweite Single der Plastic Ono Band erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die zweite Single der Plastic Ono Band mit den Titeln <em>„Cold Turkey“</em> und „<em>Don‘t Worry Kyoko (Mummy‘s Only Looking For A Hand In The Snow)“</em> erscheint. Produziert wurde die Platte von John Lennon und Yoko Ono. </p>
24. 10 1969 - Die John-Lennon-Single „Cold Turkey“ erscheint
Großbritannien * Die John-Lennon-Single „Cold Turkey“ von der „Plastic Ono Band“ erscheint.
31. 10 1969 - 21. Single der Beatles: Something
Großbritannien * Mit „Something“ erscheint erstmals ein George-Harrison-Song auf der A-Seite einer Beatles-Single. Auf der Rückseite befindet sich „Come Together“. Die Lieder auf dieser 21. Single sind Auskoppelungen aus der LP Abbey Road.
25. 11 1969 - John Lennon gibt aus Protest seinen MBE-Orden zurück
London * John Lennon schickt seinen Orden Member of the British Empire zurück, um damit gegen die britische Nigeria-Politik und den Vietnam-Krieg zu protestieren.
12. 12 1969 - Die LP „The Plastic Ono Band - Live Peace in Toronto 1969“
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die LP <em>„The Plastic Ono Band - Live Peace in Toronto 1969“</em> kommt in die Plattenläden. Das Konzert ist am 13. September aufgezeichnet worden. </p>
15. 12 1969 - John Lennon und Yoko Ono: „War Is Over! - If You Want It“
<p><strong><em>Welt</em></strong> * John Lennon und Yoko Ono verbreiten im Rahmen einer Friedenskampagne Plakate mit der Aufschrift <em>„War Is Over!“ </em>Darunter steht in kleinerer Schrift: <em>„If You Want It. Happy Christmas from John & Yoko.“</em> </p> <p>Die Plakataktion beginnt am 15. Dezember in zwölf Städten: Athen, Berlin, Hongkong, London, Los Angeles, Montreal, New York, Paris, Port-of-Spain (Trinidad), Rom, Tokyo und Toronto. In Deutschland steht auf den Plakaten und Handzetteln <em>„Der Krieg ist aus!“</em>. </p>
1970 - Eine „Bürgerinitiative“ bekämpft weitere Baumaßnahmen im „Leopoldpark“
München-Schwabing * Eine „Bürgerinitiative“, die weitere Baumaßnahmen im „Leopoldpark“ und die Vernichtung stadtnahen Grüns bekämpft, entsteht.
1970 - Das „Üblackerhäusl“ wird wegen Baufälligkeit gesperrt
München-Haidhausen * Das „Üblackerhäusl“ an der Preysingstraße muss wegen Baufälligkeit gesperrt werden.
Es steht danach fast ein Jahrzehnt leer.
1970 - Letztmalig liefert ein Pferdefuhrwerk Bierfässer aus
München-Ludwigsvorstadt - Schwanthalerhöhe * Letztmalig liefert ein Pferdefuhrwerk auf der Schwanthalerhöhe Bierfässer aus.
1970 - Gründung der „Tivoli Handels- und Grundstücks AG“
München-Englischer Garten - Tivoli * Aus der „Kunstmühle Tivoli Aktiengesellschaft“ geht die „Tivoli Handels- und Grundstücks AG“ hervor.
1970 - Letzte Reste der Ludwig-II.-Denkmal-Anlage abgetragen
München-Au - München-Isarvorstadt * Die noch vorhandene Denkmal-Anlage auf der „Corneliusbrücke“ für König Ludwig II. wird - gegen Proteste der Bevölkerung - abgetragen.
1970 - „Persönlich haftender Gesellschafter“ der „Augustiner-Brauerei“
München-Ludwigsvorstadt - Schwanthalerhöhe * Ferdinand Schmid wechselt in die Geschäftsleitung der „Augustiner-Bräu Wagner K.G.“, wo er bis 1991 „persönlich haftender Gesellschafter“ ist.
1970 - Der Hochaltar der „Anna-Klosterkirche“ wird rekonstruiert
München-Lehel * Der Hochaltar der „Anna-Klosterkirche“, ein Werk der Gebrüder Asam, wird rekonstruiert.
- Nur dessen Herzstück, der Tabernakelbau von Johann Baptist Straub, und die beiden großen, den Altar flankierenden Stuckfiguren haben den Brand von 1944 überstanden.
- Die restliche Ausstattung des Hauptaltars muss neu gestaltet werden, wobei die Rekonstruktion des Hochaltarbildes bis ins Jahr 1975 hinein andauert.
- Auch dieses Bild war eine völlige Neuschöpfung, da nur ein Schwarz-Weiß-Foto zur Rekonstruktion vorliegt.
1970 - Das „Lehel“ wird wieder zum Wohngebiet
München-Lehel * Der Stadtratsbeschluss von 1966, wonach das „Lehel“ vor allem der gewerblichen Nutzung vorbehalten sein soll, wird revidiert.
Das „Lehel“ wird wieder zum Wohngebiet.
1970 - München hat 1.293.590 Einwohner
München * München hat 1.293.590 Einwohner.
1. 1 1970 - Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Arbeiter wird eingeführt
<p><strong><em>Bundesrepublik Deutschland</em></strong> • Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Arbeiter wird eingeführt. </p>
2 1970 - Die Gebäude der
München-Haidhausen * Die von der "Firma Stahlgruber" gemieteten Räume der ehemaligen "Eberl-Faber-Aktiengesellschaft" an der Rosenheimer Straße werden nach dem Umzug des Unternehmens in die Einsteinstraße abgerissen.
2 1970 - Das Fest „Maria - Patronin Bayerns“ wird auf den 1. Mai festgelegt
Freising * Die „Freisinger Bischofskonferenz“ legt den Termin des Festes „Maria - Patronin Bayerns“ auf den 1. Mai fest.
Er bildet so den Auftakt zum „Marienmonat“.
6. 2 1970 - John Lennon veröffentlich seine Single „Instant Karma! (We All Shine On)“
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die Single <em>„Instant Karma! (We All Shine On)“</em> und <em>„Who Has Seen The Wind?“</em> von John Ono Lennon with The Plastic Ono Band erscheint. </p>
8. 3 1970 - 22. Single der Beatles
Großbritannien * Auf der 22. Single der Beatles sind die Lieder „Let It Be“ und „You Know My Name“ aufgenommen.
10. 4 1970 - Das Ende der Zusammenarbeit der Beatles
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Paul McCartney will aus musikalischen, persönlichen und geschäftlichen Gründen nicht mehr mit den Beatles zusammenarbeiten. </p> <p>Das ist das Ende der Beatles. </p>
23. 4 1970 - „Urschrei-Therapie“
Los Angeles * John Lennon und Yoko Ono beginnen eine „Urschrei-Therapie“ in Los Angeles.
8. 5 1970 - Die letzte Langspielplatte der Beatles
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die 13. und letzte Langspielplatte "<em>Let It Be"</em> der Beatles wird veröffentlicht.</p> <ul> <li>Neun Lieder stammen aus der Feder des Komponistenteams John Lennon und Paul McCartney.</li> <li>Zwei Songs hat George Harrison beigesteuert. </li> </ul>
11. 5 1970 - 23. Beatles-Single
Großbritannien * Die 23. Single der Beatles ist eine Auskoppelung aus der LP „Let It Be“. Sie umfasst die Lieder „The Long And Winding Road“ und „For You Blue“.
20. 5 1970 - Premiere des Beatles-Films „Let It Be“
<p><strong><em>New York</em></strong> * Premiere des Beatles-Films <em>„Let It Be“</em> in New York. Keiner der Fab Four nimmt daran teil. </p>
8. 6 1970 - „Self Portrait“: Die zehnte LP von Bob Dylan
USA * Die zehnte LP von Bob Dylan ist ein Doppelalbum und trägt den Titel „Self Portrait“. Es wird sein erster Fehltritt.
31. 7 1970 - Das aktive Wahlrecht wird von 21 auf 18 Jahre gesenkt
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Durch eine Änderung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird das aktive Wahlrecht für die Bundestagswahl von 21 auf 18 Jahre gesenkt.
18. 9 1970 - Jimi Hendrix stirbt in London
London * Der Gitarrist und Songwriter James Marshall „Jimi“ Hendrix stirbt in London.
19. 9 1970 - Der Verband zur Bekämpfung betrügerischen Einschenkens
München-Theresienwiese * Mit dem Kampfruf „Mass - voll!“ gehen die Mitglieder auf die Pirsch nach schlecht einschenkenden Schankkellnern.
19. 9 1970 - Die Mass Wiesn-Bier kostet 2,65 DMark
München-Theresienwiese * Die Mass Wiesn-Bier kostet 2,65 DMark. 4 Millionen Mass werden ausgeschenkt.
19. 9 1970 - Günter Steinberg betreibt das Wienerwald-Zelt auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese * Günter Steinberg betreibt das 430 Plätze fassende Wienerwald-Zelt auf dem Oktoberfest.
19. 9 1970 - Richard Süßmeier wird Sprecher der Wiesnwirte
München-Theresienwiese * Richard Süßmeier wird Sprecher der Wiesnwirte - bis 1984.
7. 10 1970 - Nationalpark Bayerischer Wald eröffnet.
Bayerischer Wald • Der erste deutsche Nationalparks wird im Bayerischen Wald eröffnet.
19. 10 1970 - Bob Dylan zu seiner alten Klasse zurück
USA * Mit der LP „New Morning“ kehrt Bob Dylan zu seiner alten Klasse zurück.
31. 10 1970 - Die Auflösung der Gesellschaft Beatles & Co eingeklagt
Großbritannien * Paul McCartney reicht eine Klage ein, um die Auflösung der Gesellschaft Beatles & Co zu erwirken.
31. 10 1970 - Frauenfußball wird erlaubt.
Frankfurt am Main • Der Deutsche Fußballbund - DFB hebt das seit 1955 bestehende Verbot des Frauenfußballs auf. Stollenschuhe sind verboten. Ein Spiel dauert 60 Minuten
22. 11 1970 - Die CSU erreicht bei der „Landtagswahl“ 56,4 Prozent
Freistaat Bayern * Die CSU erreicht bei der Landtagswahl 56,4 Prozent der Stimmen.
23. 11 1970 - George Harrisons erste Single erscheint in den USA
USA * In den USA erscheint George Harrisons erste Single mit den Liedern „My Sweet Lord“ und „Isn‘t It A Pity“.
29. 11 1970 - Der erste „Tatort“
Bundesrepublik Deutschland • Der erste „Tatort“-Krimi wird im ARD gezeigt. Es ist der Hamburger Fall „Taxi nach Leipzig“.
30. 11 1970 - George Harrisons dreifach LP „All Things Must Pass“ erscheint
Großbritannien * Die dreifach LP „All Things Must Pass“ von George Harrison erscheint in den Plattenläden.
8. 12 1970 - Kardinal Julius Döpfner weiht die wieder aufgerichtete Mariensäule ein
München-Graggenau * Kardinal Julius Döpfner weiht die auf leicht verschobenem Standort wieder aufgerichtete Mariensäule ein.
11. 12 1970 - John Lennons erstes Solo-Album erscheint
Großbritannien * John Lennons erstes Solo-Album „John Lennon/Plastic Ono Band“ ist in den Plattenläden zu erhalten.
14. 12 1970 - Dr. Hermann Schülein stirbt in New York
New York * Dr. Hermann Schülein stirbt im Alter von 86 Jahren in New York.
Im Jahr 1971 - Der „Glaspalast-Brunnen“ am „Ostbahnhof“ muss dem S-Bahn-Bau weichen
München-Haidhausen * Der „Glaspalast-Brunnen“ vor dem „Ostbahnhof“ muss dem S-Bahn-Bau weichen.
1971 - Die „Georgskirche“ erhält einen rosaroten Außenanstrich
München-Bogenhausen * Die Bogenhausener „Georgskirche“ erhält einen rosaroten Außenanstrich.
1971 - In Mühldorf/Inn wird ein 10 Millionen Jahre altes Skelett gefunden
Mühldorf am Inn * In Mühldorf am Inn wird das vollständig erhaltene Skelett eines 10 Millionen Jahre alten Elefanten-Verwandten aus der Gruppe „Mastodon“ gefunden.
Es wird in der „Paläontologischen Sammlung“ in der Richard-Wagner-Straße 10 ausgestellt.
1971 - An der Stelle der „Tivoli-Kunstmühle“ steht jetzt das „Hilton-Hotel“
München-Englischer Garten - Tivoli * Dort, wo sich die „Tivoli-Kunstmühle“ befand, steht jetzt das „Hilton-Hotel“.
Von der ganzen ehemaligen Anlage blieb nur noch der Name „Tivoli“.
Ende 1971 - Ein zweiter Block für das Müllverbrennungswerk Süd
München-Thalkirchen * Das Müllverbrennungswerk Süd erhält einen zweiten Block. Mit diesen Kapazitäten lässt sich damals der gesamte Abfall verbrennen. Sogar Gemeinden aus dem Landkreis München liefern ihren Müll an.Damit erzeugen die Kraftwerke Strom und Fernwärme - aber auch giftige Abgase, weshalb die Müllverbrennung immer umstritten war.
1971 - Der „Alte Rathausturm“ ist wieder aufgebaut
München-Graggenau * Der an das „Alte Rathaus“ anschließende Turm wird nach dem Aussehen von 1462 rekonstruiert.
Im Turm befindet sich heute das „Spielzeugmuseum“.
15. 1 1971 - George Harrisons Single „My Sweet Lord“ veröffentlicht
Großbritannien * George Harrison veröffentlicht in Großbritannien seine Single „My Sweet Lord“ und „What Is Life“.
19. 2 1971 - Der Auflösungs-Prozess der Gesellschaft Beatles & Co beginnt
<p><strong><em>London</em></strong> * Der Prozess zur Auflösung der Gesellschaft Beatles & Co beginnt in London. </p>
12. 3 1971 - John Lennon & Yoko Ono: „Power To The People“
Großbritannien * John Lennons und Yoko Onos Single „Power To The People“ und „Open Your Box“ erscheint.
31. 3 1971 - John Lennons Visum für die USA
USA * John Lennon erhält ein neunmonatiges Visum für die USA.
1. 4 1971 - Neues Programm für den Bayerischen Rundfunk
<p><strong><em>München</em></strong> * Der Bayerische Rundfunk startet seines neues Programm <em>„Bayern 3“</em>. Es ist Deutschlands erste Servicewelle, die auf der Frequenz des früheren Gastarbeiterprogramms gesendet wird.</p>
20. 7 1971 - Grundsteinlegung fürs Motorama
München-Au * Der Grundstein für das neue Auto- und Einkaufszentrum an der Rosenheimer Straße wird gelegt. Bauherrn des inzwischen auf 100 Millionen DMark bezifferten Projekts sind die Treuhandgesellschaft mbH & Co KG Berlin-München und die Europaen Hotel Company.
30. 7 1971 - George Harrison veröffentlicht seine Single Bangla Desh
Großbritannien * George Harrison veröffentlicht seine Single Bangla Desh und Deep Blue.
31. 7 1971 - „The Concert for Bangla Desh“
New York * George Harrisons „The Concert for Bangla Desh“ wird aufgenommen.
30. 8 1971 - Hans Unterleitner stirbt in New York
New York * Hans Unterleitner stirbt in New York.
3. 9 1971 - John Lennon und Yoko Ono reisen nach New York
New York * Lennon und Yoko Ono besuchen New York. Aus dem Besuch wird ein dauerhafter Aufenthalt.
18. 9 1971 - Die Mass Wiesn-Bier kostet 2,95 DMark
München-Theresienwiese * Die Mass Wiesn-Bier kostet 2,95 DMark.
29. 9 1971 - Die BRD erhält ihr erstes Umweltprogramm
Bonn * Die Bundesrepublik Deutschland erhält ihr erstes Umweltprogramm. Bundeskanzler Willy Brandt spricht von „Existenzfragen der Menschheit“. Damit wird der Grundstein gelegt für nahezu alle großen Umweltgesetze,
- von der Luftreinhaltung über die Klärung von Abwässern bis hin zum Umgang mit wachsenden Abfallmengen.
- Das Verursacherprinzip findet Eingang in die deutsche Gesetzgebung, es lässt diejenigen für Umweltschäden haften, die sie verbockt haben.
- Fuß fasst auch das Vorsorgeprinzip, demzufolge der Staat einschreiten muss, ehe Probleme entstehen.
8. 10 1971 - John Lennons LP „Imagine“ erscheint
Großbritannien * Die LP „Imagine“ von John Lennon wird veröffentlicht.
19. 10 1971 - Die erste U-Bahn-Strecke [U 6] wird eröffnet
München * Die U-Bahn-Strecke [U 6] zwischen Kieferngarten und Goetheplatz wird eröffnet.
1. 12 1971 - Der Lennon-Song „Happy Xmas (War Is Over)“ erscheint in den USA
USA * Der Song „Happy Xmas (War Is Over)“ von John Lennon und Yoko Ono wird in den USA als Single veröffentlicht.
1972 - Dr. Soshitsu Sen stiftet das „Japanische Teehaus“
München-Englischer Garten - Lehel * Im Olympiajahr stiftet Dr. Soshitsu Sen, der Großmeister der „Urasenke Teeschule“ aus Kyoto/Japan, das „Japanische Teehaus“, verbunden mit der Auflage, dass dort die japanische Teezeremonie unterrichtet und vorgeführt wird.
1972 - Ein „Bibliotheksgebäude“ für den „Bundesfinanzhof“ wird erbaut
München-Bogenhausen * Zur Montgelasstraße hin wird ein „Bibliotheksgebäude“ für den „Bundesfinanzhof“ erbaut.
1972 - Die „Löwen-Quadriga mit der Bavaria“ kommt wieder auf das „Siegestor“
München-Maxvorstadt - München-Schwabing * Nach einer umfassenden Restaurierung wird die „Löwen-Quadriga mit der Bavaria“ wieder auf dem „Siegestor“ aufgestellt.
Die Bavaria und der Wagen mussten neu gegossen werden; nur die vier Löwen sind original.
1972 - Erneute Erweiterung des „Englischen Gartens“
München-Englischer Garten * Das 3,6 Hektar große „Rattenhuber-Grundstück“ wird als Parkfläche im „Englischen Garten“ angelegt.
1972 - Die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“ löst sich als Ensemble auf
München-Schwabing * Die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“ löst sich als Ensemble auf.
1972 - Die neue Schalterhalle im „Ostbahnhof“ geht in Betrieb
München-Haidhausen * Mit der Eröffnung der „S-Bahn“ nimmt die neue Schalterhalle im „Ostbahnhof“ neben dem alten Bahnhofsgelände ihren Betrieb auf.
Um das Jahr 1972 - Der „Kriechbaumhof“ ist noch bis Anfang der 1970er Jahre bewohnt
München-Haidhausen * Der „Kriechbaumhof“ steht noch an seinem ursprünglichen Standort im Hinterhof auf dem Gelände zwischen der Wolfgang-, Walser- und Jugendstraße.
Er ist noch bis Anfang der 1970er Jahre bewohnt.
1972 - Hannes König erhält den „Poetentaler“ der „Turmschreiber“
München-Graggenau - München-Angerviertel * Hannes König, der „Direktor des Valentin-Musäums“, erhält den „Poetentaler“ der „Turmschreiber“.
10. 1 1972 - Eine weitere dreifach LP: „The Concert for Bangla Desh“
Großbritannien * Die dreifach LP „The Concert for Bangla Desh“ von George Harrison kommt in die Plattenläden. Das Konzert war unter Beteiligung von Ravi Shankar, Eric Clapton, Badfinger, Jim Keltner, Billy Preston, Ringo Starr, Leon Russel, Bob Dylan und vielen anderen am 31. Juli 1971 aufgenommen worden.
16. 3 1972 - John Lennon soll die USA verlassen
USA * John Lennon wird aufgrund seiner Verurteilung wegen Drogenbesitzes im Jahr 1968 zum Verlassen der USA aufgefordert.
23. 3 1972 - „The Concert for Bangla Desh“, der Film
New York * Der George-Harrison-Film „The Concert for Bangla Desh“ wird in New York uraufgeführt.
4 1972 - Auf einer Insel im See entsteht das „Japanische Teehaus“
München-Englischer Garten - Lehel * Hinter dem „Haus der Kunst“ entsteht auf einer Insel im See das „Japanische Teehaus“.
26. 4 1972 - Der Scharfrichter Johann Reichhart stirbt
München - München-Obergiesing * Der Scharfrichter Johann Reichhart stirbt. Sein Grab befindet sich auf dem Münchner Ostfriedhof.
8. 5 1972 - Die U-Bahn-Strecke [U 3] zum Olympiazentrum wird eröffnet
München-Schwabing * Die U-Bahn-Strecke [U 3] zwischen Münchner Freiheit und Olympiazentrum wird eröffnet.
10. 6 1972 - Hans-Jochen Vogel [SPD] beenddet seine Amtszeit als Münchner OB
München • Die Amtszeit von Hans-Jochen Vogel [SPD] als Münchner Oberbürgermeister endet.
11. 6 1972 - Georg Kronawitter [SPD] wird Münchner Oberbürgermeister
München • Georg Kronawitter [SPD] wird erstmals Münchner Oberbürgermeister.
12. 6 1972 - Lennons „Sometime in New York City“ erscheint
USA * Das Doppelalbum von John Lennon und Yoko Ono, „Sometime in New York City“ erscheint.
30. 6 1972 - Zwei neue Brunnen vor der Frauenkirche
München-Kreuzviertel * Ein Brunnen mit der technokratischen Bezeichnung „Schwerer Granit und zarte Wasserglocken“ wird im Schatten der Türme der Frauenkirche in Betrieb genommen. Die Wasserglocken werden 1980 durch Bronzepilze ersetzt.
Gleichzeitig wird auch der Bennobrunnen aufgestellt und angeschlossen.
30. 6 1972 - Eröffnung der Münchner Fußgängerzone
<p><strong><em>München</em></strong> * Trotz der bis heute andauernden Argumentation gegen die Abschaffung des Autoverkehrs in der Innenstadt eröffnet Oberbürgermeister Hans Jochen Vogel - rechtzeitig vor dem Beginn der Olympischen Spiele - die Münchner Fußgängerzone. Tausende Gäste sind geladen, es gibt 2.100 Mass Freibier und 10.000 Gratisbrezn. </p>
28. 8 1972 - Münchens Städtepartnerschaft mit Sapporo
Sapporo - München * Weil beide Städte im selben Jahr Veranstalter der Olympischen Spiele sind, gehen Sapporo und München eine Städtepartnerschaft ein. Das Japanische Teehaus im Englischen Garten [1972] und der Japanische Garten im Westpark zur Internationalen Gartenschau 1983 sind Gastgeschenke der Partnerstadt.
5. 9 1972 - Palästinensische Terroristen nehmen israelische Sportler als Geiseln
München * Fünf palästinensische Terroristen nehmen elf israelische Sportler als Geiseln. Sie alle und ein deutscher Polizist werden sterben.
Ab dem 7. 9 1972 - Das olympische Bogenschießen auf der Werneckwiese
München-Englischer Garten - Schwabing * Auf der Werneckwiese im Englischen Garten finden zwischen dem 7. und dem 10. September 1972 die olympischen Wettbewerbe im Bogenschießen statt.
23. 9 1972 - Gerd Käfer betreibt die Käfer Wies‘nschänke auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese • Gerd Käfer betreibt seine Käfer Wies‘nschänke als die kleinste der 14 Festhallen auf dem Oktoberfest.
19. 11 1972 - Ergebnis der Bundestagswahl 1972
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 7. Deutschen Bundestag erhält
- die SPD mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Willy Brandt 45,8 Prozent [+ 3,1] und 242 Sitze.
- Die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Rainer Barzel erringt 44,9 Prozent der Stimmen [- 1,2] und 234 Sitze.
- Die FDP bekommt 8,4 Prozent [+ 2,6] und 42 Sitze.
Willy Brandt [SPD] wird Bundeskanzler einer Koalition aus SPD und FDP.
24. 11 1972 - Ein Protestsong wird zu einem beliebten Weihnachtslied
Großbritannien * Der John Lennon/Yoko Ono-Song „Happy Xmas (War Is Over)“ erscheint jetzt auch in Großbritannien. Auf der B-Seite befindet sich „Listen, The Snow Is Falling“, eine Komposition von Yoko Ono.
Das Protestlied gegen den Vietnamkrieg hat sich inzwischen zu einem klassischen Weihnachtslied entwickelt, das es sogar unter die ersten zehn Plätze der beliebtesten Weihnachtslieder geschafft hat.
1973 - Die Urkundefälschung der „Kloster-Weltenburg-Mönche“ wird aufgedeckt
Weltenburg * Die Urkundefälschung der Benediktinermönche des „Klosters Weltenburg“ aus dem frühen 17. Jahrhundert wird aufgedeckt.
1973 - Das „Muffatwerk“ wird wegen Unwirtschaftlichkeit aufgelassen
München-Haidhausen * Das „Muffatwerk“ wird wegen Unwirtschaftlichkeit aufgelassen.
Bis 1973 - 38 Masttiere werden in den Ställen der „Ökonomiegebäude“ gehalten
München-Englischer Garten - Lehel * 38 Masttiere werden in den Ställen der „Ökonomiegebäude“ beim „Chinesischen Turm“ gehalten.
1973 - Den Kopf des „Ludwig-II.-Monuments“ an der „Corneliusbrücke“ aufgestellt
München-Isarvorstadt * Ein Abguss des Kopfes der „König-Ludwig-II.-Monuments“ wird im „Rosengarten“ an der „Corneliusbrücke“ aufgestellt.
1973 - Planungen für eine Gleisüberbauung über den „Ostbahnhof“
München-Berg am Laim - München-Haidhausen * Noch plant man die in den 1930er Jahren schon avisierte Gleisüberbauung über den „Ostbahnhof“, die zusätzliche 37.000 Quadratmeter Nutzfläche bringen soll.
1973 - Die Restaurierung der Seitenaltäre der „Anna-Klosterkirche“ beginnt
München-Lehel * Die Restaurierung der beiden Seitenaltäre der „Anna-Klosterkirche“ beginnt.
Der sich auf der linken Seite befindliche „Paula-Altar“ und der ihm gegenüberliegende „Hieronymus-Altar“.
Die Altarblätter stammen von Cosmas Damian Asam und sind die einzigen Originalgemälde in der „Anna-Kirche“.
Sie konnten nur durch rechtzeitige Evakuierung und Auslagerung vor den Flammen gerettet werden.
2 1973 - Stadtrat Siegmar Geiselberger regt die „Errichtung einer Gedenktafel“ an
München * Stadtrat Siegmar Geiselberger, damals noch Mitglied der SPD, nimmt den anstehenden „55. Todestag“ Kurt Eisners zum Anlass, die „Errichtung einer Gedenktafel“ anzuregen.
23. 3 1973 - John Lennon zum Verlassen der USA aufgefordert
USA * Während Yoko Ono ihre dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhält, wird John Lennon zum Verlassen der USA innerhalb von 60 Tagen aufgefordert.
24. 3 1973 - John Lennon erhebt Einspruch gegen seine Ausweisung
USA * John Lennon erhebt Einspruch gegen die Aufforderung zum Verlassen der USA.
22. 6 1973 - George Harrison: „Living in Material World“ wird veröffentlicht
Großbritannien * Die George-Harrison-LP „Living in Material World“ wird veröffentlicht
13. 7 1973 - Die Bob-Dylan-LP Pat Garrett & Billy the kid
USA * Die Bob-Dylan-LP Pat Garrett & Billy the kid ist der Soundtrack für den Film Pat Garrett jagt Billy the kid. Es gibt auf der Platte nur ein Lied mit Text: Knockin‘ on Heaven‘s Gate.
26. 8 1973 - Start der Satiresendung „Notizen aus der Provinz“
München * Start der Satiresendung „Notizen aus der Provinz“ im ZDF mit Dieter Hildebrandt.
22. 9 1973 - Erich Hochreiter betreibt eine Wurstbude neben dem Bräurosl-Festzelt
München-Theresienwiese • Die Familie Christl und Erich Hochreiter ist mit einer kleinen Wurstbude neben dem Bräurosl-Festzelt auf der Wiesn vertreten.
10 1973 - John Lennon und Yoko Ono trennen sich für ein Jahr
USA * John Lennon und Yoko Ono trennen sich für über ein Jahr.
John zieht mit May Pang durch Los Angeles und frönt zusammen mit Ringo Starr und Keith Moon dem exzessiven Drogen- und Alkoholkonsum.
1. 10 1973 - Das bayerische Denkmalschutz-Gesetz tritt in Kraft
München * Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler des Freistaats Bayern tritt in Kraft. Es bildet die gesetzliche Grundlage für den Denkmalschutz.
24. 10 1973 - John Lennon verklagt die US-Regierung
USA * Weil der vom FBI beschattet wird, verklagt John Lennon die US-Regierung.
2. 11 1973 - John Lennon: „Mind Games“
USA * John Lennon veröffentlicht seine LP „Mind Games“ und die Auskoppelung „Mind Games“ und „Meat City“ als Single.
2. 11 1973 - Klage gegen Allen Klein wegen falscher Abrechnungen
USA * John Lennon, George Harrison und Ringo Starr verklagen Allen Klein wegen falscher Abrechnungen. Klein reicht umgehend Gegenklage ein.
Um den 13. 12 1973 - Der Ältestenrat spricht sich für eine Eisner-Gedenktafel aus
München-Graggenau * Der Ältestenrat der Stadt München spricht sich für eine Gedenktafel für den ermordeten Ministerpräsidenten Kurt Eisner aus.
1974 - Umbenennung in „Fachakademie für Sozalpädagogik
München-Bogenhausen * Umbenennung der „Sozialpädagogischen Fachschule“ in „Fachakademie für Sozalpädagogik“.
1974 - Der „Chinesische Turm“ erhält eine neue Schindelbedeckung
München-Englischer Garten - Lehel * Der „Chinesische Turm“ erhält eine neue Schindelbedeckung.
1974 - Rainer Werner Fassbinder und die „Deutsche Eiche“
München-Isarvorstadt * Rainer Werner Fassbinder, das Enfant terrible der deutschen Filmszene, gesellt sich zu der bunten Gesellschaft der „Deutschen Eiche“.
Er verliebt sich unsterblich in den Schankkellner Armin Meier und bezieht mit ihm eine Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Reichenbachstraße.
1974 - Die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt auch für Kinder deutscher Mütter
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Kinder deutscher Mütter können jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.
Bis dahin konnten das nur Kinder deutscher Väter. Erkannte zum Beispiel ein amerikanischer Soldat das Kind mit seiner deutschen Freundin nicht an, war das Kind „staatenlos“.
1974 - Dieter Hildebrandt tritt gemeinsam mit Werner Schneyder auf
München * Dieter Hildebrandt tritt gemeinsam mit Werner Schneyder auf.
1974 - De „Bayerische Landesbank“ kauft das ehemalige „Wittelsbacher Palais“
München-Maxvorstadt * Das Gelände des ehemaligen „Wittelsbacher Palais“, an der Brienner Straße 50, kauft die „Bayerische Landesbank“, die darauf ihre „Verwaltungszentrale“ errichtet.
Der zu erwartende Erlös von 50 Millionen DMark soll als Grundstock für ein später zu errichtendes „Kulturhaus“ zu verwenden. Dabei soll dann auch das „Mahnmal für die Opfer des NS-Terrors“ mit verwirklicht werden.
Damit sind die Gemüter vorerst beruhigt und so kann das Projekt eines „Mahnmals“ am Ort der „Gestapo-Zentrale“ ebenso zu den Akten gelegt werden, wie die Planungen für ein „Kultur- und Volksbildungshaus“.
1974 - Die Kanzel der „Anna-Klosterkirche“ wird wiederhergestellt
München-Lehel * Die Kanzel der „Anna-Klosterkirche“ - aus der Werkstatt von Johann Baptist Straub - wird wiederhergestellt.
Die Kirchen-Restauratoren geben ihr das Aussehen wieder, das sie vor dem Krieg hatte.
Um 1 1974 - Die „Eisner-Gedenktafel“ soll am „Montgelas-Palais“ angebracht werden
München-Graggenau * Der „Ältestenrat“ der Stadt München einigt sich auf den Entwurf des „Baureferats“, die „Gedenktafel“ für Kurt Eisner direkt an der Mordstelle am „Montgelas-Palais“, der früheren „Staatskanzlei“, anzubringen.
2. 4 1974 - Das Betteln wird deutschlandweit erlaubt
<p><strong><em>Bundesrepublik Deutschland - Bonn</em></strong> * Der Paragraf 361 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches wird gestrichen und damit das Betteln deutschlandweit erlaubt. Bis dahin wird, <em>„wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder ausschickt“</em> mit 500 Mark oder einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verurteilt. </p>
6. 5 1974 - Willy Brandt erklärt seinen Rücktritt als Bundeskanzler
Bonn * Willy Brandt erklärt seinen Rücktritt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Grund ist die Enttarnung des DDR-Spions Günter Guillaume, der als Referent für Parteiangelegenheiten einer der engsten Mitarbeiter von Willy Brandt gewesen ist.
Dies ist auf eine Fahrlässigkeit innerhalb der Bundesregierung zurückzuführen. Denn Guillaume stand bereits seit über einem Jahr im Verdacht, Spionage zu betreiben.
16. 5 1974 - Helmut Schmidt wird 5. Bundeskanzler der BRD
Bonn * Nach dem Rücktritt von Willy Brandt wird Helmut Schmidt [SPD] zum 5. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Die größten Herausforderungen während seiner Amtszeit sind die weltweite Wirtschaftsrezession und die Ölkrisen der 1970er Jahre, die die Bundesrepublik unter seiner Führung besser überstand als die meisten anderen Industriestaaten.
17. 7 1974 - John Lennon soll erneut die USA innerhalb von 60 Tagen verlassen
USA * John Lennon wird erneut aufgefordert die USA innerhalb von 60 Tagen zu verlassen.
15. 8 1974 - Die Bäcker-Kunstmühle wird stillgelegt
München-Untergiesing * „Der Wettbewerb unter den Mühlenbetrieben wurde in den folgenden Jahren so hart, dass die von der Einkaufs- und Liefergenossenschaft als Pächterin betriebene Mühle immer stärker in die roten Zahlen geriet“, erklärt der Obermeister der Bäckerinnung, der damalige Stadtrat Heinrich Traublinger. Jetzt flattert die schwarze Fahne auf dem Dach des traditionsreichen Mühlenbetriebs.
Die Bäcker-Kunstmühle wird in diesem Jahr aufgrund eines Gesetzes „Zum Abbau von Überkapazitäten im Mühlengewerbe“ - für die Entschädigungssumme von 1,7 Millionen DMark - eingestellt. Das Grundstück wird an das Ingenieurbüro Obermayer vergeben, dass das heute an dieser Stelle stehende Bürohochhaus erbaut.
23. 9 1974 - Lennons erster Nummer-1-Hit seiner Solo-Karriere
USA • Die Single von John Lennon, "Whatever Gets You Through The Night" und "Beef Jerky" wird veröffentlicht. Mit dem Lied erreicht hat er seinen ersten Nummer-1-Hit seiner Solokarriere in den USA.
26. 9 1974 - John Lennon: Walls and Bridges
USA * Die LP "Walls and Bridges" von John Lennon ist in den Plattenläden erhältlich.
17. 10 1974 - In Eching eröffnet das erste deutschlandweite IKEA-Einrichtungshaus
Eching * In Eching eröffnet auf 32.000 Quadratmetern das erste deutschlandweite IKEA-Einrichtungshaus.
27. 10 1974 - Die CSU kann sich auf 62,1 Prozent verbessern
Freistaat Bayern * Die CSU kann sich bei der Landtagswahl erneut um 5,7 Prozent steigern und sich so auf phantastische 62,1 Prozent verbessern.
28. 10 1974 - Allen Klein verliert den Prozess
Großbritannien * Allen Klein verliert den Prozess gegen John Lennon, George Harrison und Ringo Starr.
Um den 10. 12 1974 - Mick Taylor verlässt die Rolling Stones
Großbritannien * Mick Taylor verlässt die Rolling Stones nach fünf Jahren.
20. 12 1974 - George Harrison: „Dark Horse“
Großbritannien * George Harrison veröffentlicht seine LP „Dark Horse“.
1975 - Die „Isar-Amper-Werke Elektrizitäts AG“ schließen die letzte Baulücke
München-Maxvorstadt * Die „Isar-Amper-Werke Elektrizitäts AG“ schließen die letzte Baulücke an der Richard-Wagner-Straße 1.
1975 - Die „Museum-Lichtspiele“ werden in drei Kinos aufgeteilt
München-Au * Die „Museum-Lichtspiele“ werden in drei Kinos aufgeteilt.
1975 - Mit einem „Italo-Western“ werden die „Museum-Lichtspiele“ geschlossen
München-Au * Mit einem „Italo-Western“ werden die inzwischen als „Revolver-Kino“ bezeichneten „Museum-Lichtspiele“ an der Lilienstraße 2 geschlossen.
Ab 1975 - Der „Antonius-Altar“ wird vollkommen neu konzipiert
München-Lehel * In den Jahren 1975 und 1976 befasst man sich mit den beiden Haupt-Seitenaltären in der Kirchenmitte der „Anna-Klosterkirche“.
Der „Antonius-Altar“ wird vollkommen neu konzipiert.
Er war ursprünglich ein „Nepomuk-Altar“, der später in einen „Ludwigs-Altar“ umgewandelt wurde.
Jetzt erhält er die Bestimmung eines „Antonius-Altars“.
Der Heilige gilt als Patron der bayerischen „Franziskaner“.
Seine „Oberarm-Reliquie“, die Kaiser Ludwig der Baier anno 1330 den Münchner „Franziskanern“ schenkte, wurde anno 1480 in einem spätgotischen „Reliquiar“ gefasst und in einem barocken Schrein ausgestellt.
Sie befindet sich seit dem Jahr 1827 in der „Anna-Kirche“.
Angeblich rettete ein „Franziskaner-Mönch“ die kostbare „Reliquie“ nach dem Bombardement aus dem brennenden Gotteshaus.
Die am Altar aufgebaute „Antonius-Statue“ aus dem Jahr 1682 wird von kleinen, „modernen“ Bildtafeln eingerahmt.
1975 - Im „Lehel“ leben 16.000 Einwohner
München-Lehel * Im „Lehel“ leben 16.000 Einwohner.
1975 - Das Kindergeld gibt‘s jetzt auch fürs erste Kind
Bonn - Bundesrepublik Deutschland * Das Kindergeld gibt‘s jetzt auch fürs erste Kind.
Es beträgt je 194.- DM für das erste und zweite Kind, 200.- DM für das dritte und 225.- DM für jedes weitere Kind.
1975 - München hat 1.317.700 Einwohner
München * München hat 1.317.700 Einwohner.
1 1975 - John Lennon kehrt zu Yoko Ono zurück
USA * John Lennon kehrt zu Yoko Ono zurück.
17. 2 1975 - John Lennon: „Rock‘n‘Roll“
USA * Die LP „Rock‘n‘Roll“ von John Lennon erscheint.
Bis 4. 4 1975 - Die zentrale Desinfektionsanstalt Biebl & Söhne
<p><strong><em>München-Untergiesing</em></strong> * In der Sachsenstraße 25 existiert seit 1924 auch die zentrale <em>„Desinfektionsanstalt Biebl & Söhne“</em>. Dort werden nicht nur Geräte keimfrei gemacht, sondern bei Bedarf auch Münchner Schulkinder von Läusen und Heiligenfiguren von Holzwürmern befreit.</p>
8. 4 1975 - Josephine Baker feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum
<p><em><strong>Paris</strong></em> * Die 68-jährige Josephine Baker feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Im Publikum sitzen unter vielen anderen Alain Delon, Mick Jagger, Sophia Loren und Jeanne Moreau. Kurze Zeit später erleidet die Tänzerin, Sängerin und Entertainerin eine Gehirnblutung, an deren Folgen sie vier Tage später, am 12. April 1975, in Paris stirbt. </p>
10. 4 1975 - Josephine Baker erleidet einen Schlaganfall
<p><strong><em>Paris</em></strong> • Wenige Stunden vor ihrem abendlichen Auftritt erleidet Josefine Baker einen Schlaganfall und stirbt zwei Tage später im Hôpital de la Salpêtrière in Paris. </p>
12. 4 1975 - Joséphine Baker stirbt in Paris
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Josephine Baker stirbt an einer Gehirnblutung in Paris. </p>
15. 4 1975 - Joséphine Baker erhält ein Staatsbegräbnis
<p><strong><em>Paris</em></strong> * 20.000 Menschen säumen die Straßen von Paris, als Joséphine Baker mit einem militärischen Staatsbegräbnis geehrt wird. </p>
15. 4 1975 - Josephine Baker wird mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt
<p><strong><em>Paris</em></strong> • 20.000 Menschen säumen die Straßen von Paris, als Josephine Baker mit einem militärischen Staatsbegräbnis geehrt wird.</p>
4. 5 1975 - Glassteine aus dem Schrein der Munditia gestohlen
München-Angerviertel * Die Einbrecher kommen in der Nacht, schlagen das Fenster ein, klettern in die Kapelle im nördlichen Seitenschiff der Peterskirche. Dann zerschlagen sie den Schrein der heiligen Munditia. Sie stehlen bunte Glassteine, mit denen die Gebeine der Heiligen geschmückt sind, da sie diese für Edelsteine halten.
Auch Dummheit ist eine Gabe Gottes.
30. 5 1975 - Die letzte Straßenbahnfahrt mit einem Schaffner
<p><strong><em>München</em></strong> * Zum letzten Mal fährt eine Trambahn mit einem Schaffner im Wagen. Die letzte Schaffnerfahrt hat einen volksfestartigen Charakter. Die Fahrgäste stürmen die blumengeschmückte Tram der Linie 29, die um 18.18 Uhr vom Lorettoplatz aufbricht. Sonderfahrscheine werden ausgegeben. Der letzte Schaffner war der 56-jährige Martin Gerum. </p>
1. 6 1975 - Ron Wood begleitet die Rolling Stones auf ihrer USA-Tournee
USA * Ron Wood wird die Rolling Stones - vorübergehend - als Gitarrist auf der bis 8. August 1975 andauernden Tournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika begleiten. Das Engagement wird nach der Tournee - unbefristet - verlängert. Vollwertiges Mitglied der Band wird er allerdings erst 1993.
14. 8 1975 - Uraufführung des Films „The Rocky Horror Pictures Show“
<p><strong><em>London</em></strong> * Der Film <em>„The Rocky Horror Pictures Show“</em> erlebt seine Welturaufführung in London. Der Film läuft anfangs miserabel und ist weltweit ein Flop. </p> <p> </p>
9 1975 - Die „Rocky Horror Pictures Show“ wird in New York uraufgeführt
New York * Die „Rocky Horror Pictures Show“ wird in New York uraufgeführt.
Seit 20. 9 1975 - Das Zentral-Landwirtschaftsfest findet nur mehr alle drei Jahre statt
München-Theresienwiese * Das Zentral-Landwirtschaftsfest findet nur mehr alle drei Jahre statt.
20. 9 1975 - Erste Diskussionen ums Containerbier auf der Wiesn
München-Theresienwiese * Erstmals wird die Einführung des sogenannten Containerbiers auf dem Oktoberfest in Erwägung gezogen.
23. 9 1975 - Die Ausweisung John Lennons wird ausgesetzt
USA • Yoko Ono ist schwanger. Aus diesem Grund wird die Ausweisung aus den USA von John Lennons ausgesetzt.
3. 10 1975 - George Harrison: „Extra Texture (Read All About It)“
Großbritannien * Mit „Extra Texture (Read All About It)“ erscheint ein neues Album von George Harrison in den Plattenläden.
7. 10 1975 - John Lennons Ausweisung wird zurückgenommen
New York * Die Ausweisung John Lennons wird vom Senat des Staates New York zurückgenommen.
9. 10 1975 - Sean Taro Ono Lennon wird geboren
New York * Sean Taro Ono Lennon wird an Johns 35. Geburtstag geboren. John Lennon gibt bekannt, dass er sich in den nächsten fünf Jahren ausschließlich der Kindererziehung widmen wird, während Yoko Ono weiterarbeitet.
24. 10 1975 - John Lennon: „Working Class Hero“
Großbritannien * „Working Class Hero“ von John Lennon erscheint als Single.
22. 11 1975 - Die Verlängerung der U-Bahn zum Harras wird eröffnet
München * Die Verlängerung der U-Bahn-Strecke [U 3/6] bis zum Harras wird eröffnet.
12 1975 - Hartmut Hinrichs übernimmt die „Museum-Lichtspiele“
München-Au * Hartmut Hinrichs übernimmt die „Museum-Lichtspiele“ und wandelt es zu einem „Spezialkino für Musicalfilme“ um.
1976 - Der „Kriechbaumhof“ wird wegen Baufälligkeit abgetragen
München-Haidhausen * Der „Kriechbaumhof“ wird wegen Baufälligkeit an seinem ursprünglichen Standort zwischen der Wolfgang-, Walser- und Jugendstraße abgetragen und in einem „Städtischen Bauhof“ eingelagert.
Ab 1976 - In der Kirchenstraße wird ein „Regenauslass“ erbaut
München-Haidhausen * Zwischen 1976 und 1979 wird in der Haidhausener Kirchenstraße ein „Regenauslass“ erbaut.
Er hat eine Länge von 1,6 Kilometer und mündet nördlich des „Maximilianeums“ in die Isar.
In der Kirchenstraße muss das Wasser einen Höhenunterschied von 9 Metern überwinden.
1976 - Das Erdbeben im Friaul zerstört auch die Kirche in Avilla di Buia
Avia di Buia - München-Haidhausen * Das große Erdbeben, das den Friaul heimsuchte, zerstört auch die Kirche in Avilla di Buia, in der die aus Haidhauser Lehm geformte Madonna Aufstellung fand.
Wie durch ein Wunder bleibt jedoch die „Madonna della Saluta“ nahezu unbeschädigt erhalten.
1976 - Ein Haidhauser „Muster-Sanierungsblock“ wird ausgewählt
München-Haidhausen * Der kleine dreieckige Block zwischen Wolfgang-, Leonhard- und Preysingstraße wird als „Muster-Sanierungsblock“ ausgewählt.
Unter der Bezeichnung „Block 15“ soll hier - erstmals in einer mit den Bewohnern abgestimmten Aktion - Einigung über das weitere Vorgehen erzielt werden.
Gewerbe soll verpflanzt und Mieter vorübergehend in andere Wohnungen umgesetzt werden, um sie anschließend in verbesserte Wohnräume zurückkehren zu lassen.
Das Baureferat der Landeshauptstadt richtet dazu extra eine Bürgerberatungsstelle in der Milchstraße ein und führte für dieses Vorhaben genaue strukturelle und soziale Untersuchung durch.
In dem Block wohnen über 150 Bewohner in siebzig Haushalten.
Durch die Neubauten kann die Umsetzung der Mieter innerhalb desselben Blocks geschehen.
Ein Gewerbebetrieb - eine kleine Kohlenhandlung - muss umziehen, womit Schmutz und Lärm aus dem Viertel verlagert werden kann, doch nun ist es andererseits den Haidhausern nicht mehr möglich, einen geringen Brennstoff-Bedarf durch Selbstabholung zu decken.
Umweltfreundlichkeit wird groß geschrieben.
- Eine Kastanie wird mit einem finanziellen Aufwand in Höhe von 15.000 DMark gerettet,
- eine kleine Tiefgarage gebaut,
- die Höfe begrünt und
- die Leonhardstraße in eine kleine Fußgängerzone umgewandelt.
1976 - Die „Drahtfabrik Bucher“ wird in eine GmbH umgewandelt
München-Au * Die „Drahtfabrik Bucher“ wird in eine GmbH umgewandelt.
1976 - In den „Museum-Lichtspielen“ wird ein „Kino 2“ mit 35 Plätzen eingerichtet
München-Au * Weil das reine Musikprogramm nicht im gewünschten Umfang läuft, kommt in den „Museum-Lichtspielen“ ein „Kino 2“ mit 35 Plätzen dazu.
Das „Intime Theater“ wird mit anspruchsvollen Filmen für Erwachsene bespielt. Die Filme stammen alle aus der Produktion von Beate Uhse oder sind von ihr angekauft.
1976 - Die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“ wird wieder gegründet
München-Schwabing * Die „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“ wird wieder gegründet und tritt in wechselnden Besetzungen auf.
1976 - Der „Bordeauxplatz“ erhält seinen Namen
München-Haidhausen * Der „Bordeauxplatz“ erhält seinen Namen.
Ursprünglich bezeichnet man die die Wörthstraße teilende Grünanlage „Forum in der Wörthstraße“.
1976 - Die „Badeverordnung“ sieht ein generelles Badeverbot vor
München * Die für München geltende „Badeverordnung“ sieht ein generelles Badeverbot „außerhalb der Badeanstalten in fließenden oberirdischen Gewässern“ vor.
Ausgenommen sind mehrere Abschnitte am Ostufer der Isar - vor allem im Süden der Stadt.
1976 - Der Stadtrat beschließt das „Anbringen einer Gedenktafel für Kurt Eisner“
München-Graggenau * Der Stadtrat beschließt das „Anbringen einer Gedenktafel für Kurt Eisner“ an der Kardinal-Faulhaber-Straße.
Der „Hausbesitzer“ Falk Volkhardt weiß die Anbringung der „Erinnerungsplatte“ an der Fassade des „Montgelas-Palais“, das inzwischen zum „Hotel Bayerischer Hof“ gehört, zu verhindern.
Er verweigert die Anbringung der „Gedenktafel“ mit seinen Bedenken, dass sich diese „geschäftsschädigend“ auswirken und die Tafel möglicherweise Sprengstoffanschläge und Beschädigungen provozieren könnte.
Dieses Risiko will natürlich keiner der Verantwortlichen tragen.
25. 1 1976 - Mal Evens von US-Polizei erschossen
<p><strong><em>Los Angeles</em></strong> * Die Polizei erschießt Mal Evans, den ehemaligen Tour-Manager der Beatles, in Los Angeles. </p>
26. 1 1976 - Plattenvertrag der Beatles mit EMI läuft aus
<p><strong><em>London</em></strong> * Der Plattenvertrag der Beatles mit EMI läuft aus. Nur Paul McCartney bleibt dem Unternehmen treu. </p>
4 1976 - Der Film „Rocky Horror Pictures Show“ zieht die Menschen nur so an
New York * Die New Yorker stürmen die Kinokassen.
Der Film „Rocky Horror Pictures Show“ zieht die Menschen nur so an. Sie Kinobesuch mit Netzstrümpfen und Korsagen.
Sie sprechen die Texte und singen die Lieder mit. Die Fans tanzen synchron mit den Stars auf der Leinwand und machen den Film durch ihr eigenes Einbringen und Zutun noch immer zum absoluten Hit.
Deshalb gehört es auch zum Ritual, sich an der Kinokasse ein Set mit Utensilien zu kaufen, das Reis, Luftschlangen, „Wunderkerzen“ und anderes beinhaltet.
Während der Trauungsszene werfen die Fans mit Reis; wenn Janet und Brad durchs Unwetter stapfen, halten sie sich eine Zeitung über den Kopf und zum Song „There’s a Light“ schwenken sie rhythmisch die „Wunderkerzen“.
4. 5 1976 - In der Kaulbachstraße 15 explodiert ein Sprengkörper
München-Maxvorstadt * Auf dem Grundstück Kaulbachstraße 15 explodiert ein Sprengkörper, der - außer dass er seinen Urheber schwer verletzt - keinen Schaden anrichtet.
16. 5 1976 - Uraufführung mit 40 Jahren Verspätung
München-Angerviertel * 40 Jahre nach Entstehen des von der Nazi-Zensur verbotenen Valentin-Karlstadt-Kurzfilms „Die Erbschaft“ wird dieser im Münchner Stadtmuseum uraufgeführt.
24. 7 1976 - Kardinal Julius Döpfner stirbt vollkommen unerwartet
München-Kreuzviertel * Kardinal Julius Döpfner stirbt vollkommen unerwartet im Pförtnerzimmer des Erzbischöflichen Palais an einem Herzinfarkt.
27. 7 1976 - John Lennon erhält seine Green Card
USA * John Lennon erhält seine Green Card für den zeitlich unbeschränkten Aufenthalt in den USA.
Um den 8 1976 - Die CSU wirbt mit dem Slogan: „Freiheit oder Sozialismus“
Bundesrepublik Deutschland - Freistaat Bayern * Bei der „Bundestagswahl 1976“ steht die Parole „Freiheit statt Sozialismus“ bei der CDU im Vordergrund.
Die CSU ändert den Slogan in „Freiheit oder Sozialismus“ ab.
18. 9 1976 - Der Verein Münchner Oktoberfestmuseum wird gegründet
München-Theresienwiese * Im Pschorr-Festzelt der Ochsenbraterei wird der Verein Münchner Oktoberfestmuseum e.V. gegründet. Sämtliche Wiesnwirte, der Verein Münchner Brauereien, die Schaustellerverbände und Vertreter der Stadt München sind daran beteiligt.
Zum 1. Vorsitzenden wird Xaver Heilmannseder gewählt. Ferdinand Schmid, der 1. Vorstand der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung ist ein engagierten Mitstreiter der Oktoberfestmuseums-Idee. Weitergepflegt wird diese Idee von den nächsten Vereinsvorständen Richard Süßmeier, Heinz Strobl und Willy Heide.
3. 10 1976 - Ergebnis der Bundestagswahl 1976
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 8. Deutschen Bundestag erhält
- die SPD mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt 42,6 Prozent [- 3,2] und 224 Sitze.
- Die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Helmut Kohl erringt 48,6 Prozent der Stimmen [+ 3,7] und 254 Sitze.
- Die FDP bekommt 7,9 Prozent [-0,5] und 40 Sitze.
Die CSU erringt in Bayern 60,0 Prozent der Stimmen und trägt damit 10,6 Prozent zum Gesamtergebnis der Union (48,6 Prozent) bei.
CDU und CSU sind mit insgesamt 243 Sitzen die stärkste Fraktion im Bundestag, doch die sozialliberale Koalition aus SPD und FDP kann mit einer Mehrheit von zehn Sitzen weiter regieren.
Helmut Schmidt [SPD] wird Bundeskanzler einer Koalition aus SPD und FDP.
4. 10 1976 - Die „Rocky Horror Pictures Show“ läuft in den Museum-Lichtspielen an
München-Au * Bevor die Museum-Lichtspiele in der Lilienstraße 2 endgültig zum Pornokino verkommen, läuft die „Rocky-Horror-Picture-Show“ an. Ein Kino wird eigens dafür umgebaut. Es ist damit das erste Kino der Welt, dessen Inneneinrichtung für einen einzigen Film gestaltet worden ist.
18. 11 1976 - Die CSU kündigt in Wildbad Kreuth die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU
Wildbad Kreuth * Mit 30 gegen 18 Stimmen bei einer Enthaltung beschließt die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag auf ihrer Klausurtagung am 18. und 19. November in Wildbad Kreuth, die Fraktionsgemeinschaft mit der Christlich Demokratischen Union - CDU im Deutschen Bundestag aufzukündigen und im 8. Deutschen Bundestag eine selbstständige Fraktion zu bilden.
Der Beschluss bedeutet eine tiefe Zäsur im traditionell schwierigen Bündnisverhältnis zwischen CDU und Christlich Sozialer Union - CSU. Aktueller Anlass für den einseitigen Trennungsbeschluss waren das Ergebnis und die Folgen der Bundestagswahl vom 3. Oktober 1976.
19. 11 1976 - George Harrison: „Thirty-Three And A Third“
Großbritannien * Die LP „Thirty-Three And A Third“ von George Harrison erscheint.
29. 11 1976 - CDU droht mit der Gründung eines Landesverbands in Bayern
Bonn * Der CDU-Bundesvorstand fordert die CSU-Führung auf, bis zum Tag der konstituierenden Sitzung des 8. Deutschen Bundestages die Fraktionsgemeinschaft wieder herzustellen. Andernfalls wird die CDU in Bayern einen Landesverband gründen.
1. 12 1976 - Helmut Kohl wird CDU-Fraktions-Vorsitzender
Bonn * Der Rheinland-Pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl wird zum Vorsitzenden der künftigen CDU-Bundestagsfraktion gewählt.
Um den 2. 12 1976 - Die CSU-Führung knickt ein
München * Die CSU-Führung beginnt einzulenken. In Bayern ruft der Trennungsbeschluss von Kreuth vor allem an der fränkischen und schwäbischen CSU-Basis Unmut und Widerspruch hervor.
Drei CSU-Bezirksverbände fordern einen Sonderparteitag. Sie befürchten, dass die Gründung eines CDU-Landesverbandes der bayerischen Regierungspartei und damit der Gesamtunion gravierend schaden können.
9. 12 1976 - Der Trennungsbeschluss von Wildbad Kreuth wird aufgeweicht
Bonn * Franz Josef Strauß bietet nach einer Sitzung des CSU-Landesvorstandes und der CSU-Landesgruppe der CDU neue Gespräche an. Der Trennungsbeschluss von Wildbad Kreuth ist zwar nicht aufgehoben, aber „durch neue Vorschläge“ überlagert worden.
12. 12 1976 - Politische Parität zwischen CDU und CSU geregelt
Bonn * CDU und CSU vereinbaren, die Fraktionsgemeinschaft der CDU/CSU auf der Grundlage neuer Abmachungen fortzusetzen. In umfangreichen schriftlichen Vereinbarungen werden neue Verfahren der Konfliktregelung im Sinne einer politischen Parität beider Parteien festgelegt. Die CSU bahnt mit diesen Vereinbarungen zugleich die Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß im Bundestagswahlkampf 1980 an.
1977 - Der Westteil des „Leopoldparks“ wird der Stadt München als Park überlassen
München * Der Landtag beschließt, dass der Westteil des „Leopoldparks“ der Stadt München als Park überlassen wird.
Die Ostseite an der Leopoldstraße wird bebaut.
1977 - Die Pflicht der Ehefrau, „den Haushalt zu führen“, entfällt.
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Die Pflicht der Ehefrau, „den Haushalt zu führen“, entfällt.
1977 - Ehefrauen können erstmals selbst entscheiden, ob sie arbeiten wollen
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Ehefrauen können erstmals selbst entscheiden, ob sie arbeiten wollen.
Bis dahin musste der Ehemann diesem Wunsch zustimmen. Voraussetzung war, dass sie ihre „häuslichen Pflichten“ nicht vernachlässigte.
24. 3 1977 - Joseph Ratzinger wird Erzbischof von München und Freising
Vatikan * Papst Paul VI. ernennt Joseph Ratzinger zum 11. Erzbischof von München und Freising.
5. 5 1977 - Ludwig Erhard stirbt in Bonn
Bonn * Ludwig Erhard, der ehemalige Wirtschaftsminister und Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sowie CDU-Vorsitzende, stirbt in Bonn.
28. 5 1977 - Joseph Ratzinger empfängt die Bischofsweihe
München-Kreuzviertel * Joseph Ratzinger empfängt die Bischofsweihe durch den Bischof von Würzburg, Josef Stangl, in der Münchner Frauenkirche.
27. 6 1977 - Joseph Ratzinger wird Kardinal
Vatikan * Münchens Erzbischof Joseph Ratzinger wird in das Kardinalskollegium aufgenommen.
16. 8 1977 - Elvis Presley stirbt in Memphis/Tennessee
Memphis * Elvis Presley stirbt - vermutlich an seiner Tabletten- und Drogensucht - in Memphis/Tennessee.
10 1977 - Das „Haidhausen-Museum“ in der Kirchenstraße öffnet seine Pforten
München-Haidhausen * Das „Haidhausen-Museum“ in der Kirchenstraße öffnet seine Pforten.
1978 - Der „Bürgermeistergarten“ wird der Öffentlichkeit übergeben
München-Bogenhausen * Der „Bürgermeistergarten“ wird der Öffentlichkeit übergeben.
1978 - Das „Herbergenhaus an der Kreppe“ wird restauriert
München-Haidhausen * Das „Herbergenhaus an der Kreppe“ wird restauriert, zum Teil rekonstruiert und darin eine „Jugendhilfe-Einrichtung“ untergebracht.
??? 1978 - Hans Osel's „Ziegelbrenner-Brunnen“ am Preysingplatz
Haidhausen * Hans Osel schafft den aus Muschelkalk hergestellten „Ziegelbrenner-Brunnen“ am Haidhauser Preysingplatz.
1978 - Das „Deutsche Theater“ wird bis 1982 generalsaniert
München-Ludwigsvorstadt * Das „Deutsche Theater“, erbaut 1896, im Krieg stark zerstört und in den 1950er Jahren relativ einfach wieder aufgebaut, wird für 54 Millionen DMark generalsaniert.
Die Arbeiten werden bis 1982 andauern.
1978 - Eine überdachte Holzbrücke über die Isar
München-Englischer Garten - Isarinsel Oberföhring * Eine überdachte Holzbrücke über die Isar verbindet den „Englischen Garten“ mit der 22 Hektar großen „Isarinsel Oberföhring“.
1978 - Frauen können in Bundesländern „Schutzpolizistinnen“ werden
Bundesrepublik Deutschland * Frauen können in den ersten Bundesländern „Schutzpolizistinnen“ werden.
??? 1978 - George Harrison finanziert „Das Leben des Brian“
Großbritannien * Zwei Tage vor Drehbeginn drehen die Produzenten den „Monty Python‘s“ plötzlich den Geldhahn für den Film „Das Leben des Brian“ zu.
Der Ex-Beatle George Harrison investiert kurzerhand 4 Millionen Dollar in das Projekt, indem er kurzerhand die Produktionsfirma „HandMade Films“ gründet und so den Film vor dem „Aus“ bewahrt – „offenbar nur deshalb, weil er den Film sehen wollte“.
4. 3 1978 - Die erste Amtszeit von Georg Kronawitter [SPD] als Münchner OB endet
München • Die erste Amtszeit von Georg Kronawitter [SPD] als Münchner Oberbürgermeister endet.
5. 3 1978 - Erich Kiesl [CSU] wird Münchner Oberbürgermeister
München • Erich Kiesl [CSU] wird Münchner Oberbürgermeister.
28. 5 1978 - Der U-Bahn-Bahnhof Poccistraße geht in Betrieb
München * Der U-Bahn-Bahnhof Poccistraße wird bei laufendem Betrieb in den bestehenden Streckentunnel eingefügt.
10. 7 1978 - Das Bayerische Kultusministerium schließt die Schack-Galerie
München-Lehel * Das Bayerische Kultusministerium schließt die Schack-Galerie. Die besten Stücke der Sammlung sollen in die Neue Pinakothek wandern, der Rest im Depot Aufnahme finden. „Angesichts der jüngsten Terroranschläge“, so die Begründung, sei „die Sicherheit der benachbarten Staatskanzlei“ nicht mehr garantiert.
Erst der Protest von Museumsfachleuten, Fachverbänden und der Presse beendete das, wie sich die Süddeutsche Zeitung ausdrückt, das „Münchner Trauerspiel“.
1. 8 1978 - Der Nationalpark Berchtesgaden wird gegründet
München - Berchtesgaden * Der Nationalpark Berchtesgaden wird gegründet. Das 210 Quadratkilometer große Schutzgebiet im äußersten Südostzipfel Bayerns ist der einzige Alpen-Nationalpark Deutschlands.
Hier befindet sich mit dem 2.713 Metern hohe Watzmann auch der zweithöchste Berg Deutschlands. Der Königssee mit der berühmten Wallfahrtskirche Sankt Batholomä liegt tiefeingeschnitten zwischen Felsen und urwüchsigen Wäldern.
6. 8 1978 - Papst Paul VI. stirbt auf Castel Gandolfo
Castel Gandolfo * Papst Paul VI. stirbt auf Castel Gandolfo an den Folgen eines Herzinfarkts.
26. 8 1978 - Albino Luciani wird zum Papst Johannes Paul I. gewählt
Rom-Vatikan * Albino Luciani wird in einem eintägigen Konklave im vierten Wahlgang zum Nachfolger von Papst Paul VI. gewählt. Sein Gegenkandidat ist der konservative Guiseppe Siri, der bereits im Jahr 1958 als „zum Papst geeignet“ bezeichnet wurde.
Er nimmt als Papst den Namen Johannes Paul I. an. Beide Namen erinnern an seine Vorgänger, die Päpste Johannes XXIII. und Paul VI.. Als erster Papst trägt er einen Doppelnamen.
16. 9 1978 - CSU-Oberbürgermeister Münchens Erich Kiesl vergisst „Ozapft is!“
München-Theresienwiese * Der erste und bislang einzige CSU-Oberbürgermeister Münchens, Erich Kiesl, zapft im Schottenhamel-Festzelt das erste Wiesn-Fass an und veranstaltet ein derartiges Bierbad, dass er vor lauter Aufregung den wichtigsten Satz - „Ozapft is!“ - vergisst.
28. 9 1978 - Papst Johannes Paul I. stirbt nach 33 Tagen im Amt
Rom-Vatikan * Papst Johannes Paul I. stirbt nach 33 Tagen im Vatikan. Eine Obduktion des Leichnams wird von der seiner Familie und vom Vatikan verweigert. Kein Wunder, dass dadurch zahlreiche Verschwörungstheorien entstehen. Damit geht das Jahr als Dreipäpstejahr in die Geschichte ein.
15. 10 1978 - Bei der Landtagswahl erhält die CSU 59,1 Prozent
Freistaat Bayern - München * Für die Landtagswahl gibt es mit Franz Josef Strauß einen neuen Kandidaten für das Amt des Bayerischen Ministerpräsidenten.
Seine CSU bringt es auf 59,1 Prozent und erreicht damit ihr zweitbestes Ergebnis seit 1946, obwohl die Christsozialen drei Prozent verlieren. Auf Nachfragen der Journalisten reagiert der designierte Ministerpräsident unwirsch mit den Worten: „I mag diese Miesmacherei net“.
18. 10 1978 - Karol Józef Wojtyla wird als Papst Johannes Paul II. gewählt
Rom-Vatikan * Karol Józef Wojtyla wird als Papst Johannes Paul II. zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. Er folgt auf den 33-Tage-Papst Johannes Paul I..
1979 - Weitere 6,6 Hektar Grünflächen können angelegt werden
München-Englischer Garten - München-Schwabing * Nach der Verlagerung von „Hochschulsportplätzen“ können weitere 6,6 Hektar Grünflächen angelegt werden.
Sie werden als „Schwabinger Bucht“ dem „Englischen Garten“ einverleibt.
Im Bereich der „Schwabinger Bucht“ werden im gleichen Jahr noch zwei neue Brücken errichtet.
1979 - Die Raumprobleme durch den Bau eines Glockenturmes lösen
München-Untergiesing * Bei einem Besuch des bayerischen „Ministerpräsidenten“ Alfons Goppel wird die Problematik der beengten Raumverhältnisse im Untergiesinger „Templer-Kloster“ angesprochen.
Die einbezogene staatliche Beamtenschaft schlägt vor, die Raumprobleme durch den Bau eines Glockenturmes zu lösen. Denn auf einen Glockenturm hat eine „Religionsgemeinschaft“ sogar einen Rechtsanspruch.
Mit dem achtstöckigen Bauwerk kann die dringend benötigte Nutzfläche von über vierhundert Quadratmetern erzeugt werden. Der Turm besitzt eine Gesamthöhe von 87 Metern, bei einer Diagonale von elf Metern.
Die Turmzwiebel umfasst alleine eine Höhe von 18 Metern. Und damit ragt dieser Turm natürlich weithin sichtbar über das Untergiesinger Wohnungsneubaugebiet und die sich in dieser Gegend befindende „Kleingartenanlage“.
Schon dadurch gibt der Turm der „Ordensgemeinschaft“ ein weithin sichtbares Symbol.
1979 - Günter Tremmel will die Turbinen der „Bäcker-Kunstmühle“ wieder aktivieren
München-Untergiesing * Nachdem die Turbinen der ehemaligen „Bäcker-Kunstmühle“ mehrere Jahre stillstanden, erweckt sie der Kfz-Mechanikermeister Günter Tremmel - mit viel Geld, Engagement, Überzeugungskraft und noch mehr Eigenarbeit - zu neuem Leben.
Diese Fähigkeiten sind die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass der aus Bad Feilnbach stammende Techniker sein Ziel erreichen kann.
1979 - „Ensembleschutz“ für das alte Haidhausen
München-Haidhausen * Die verbliebenen Reste des alten Haidhausens werden unter „Ensembleschutz“ gestellt.
1979 - Die Renovierung der „Anna-Klosterkirche“ ist abgeschlossen
München-Lehel * Mit der Erneuerung des letzten Seitenaltars endet die Renovierung der „Anna-Klosterkirche“.
23. 2 1979 - „George Harrison“ von George Harrison
Großbritannien * George Harrisons neu veröffentlichtes Album heißt einfach nur „George Harrison“.
24. 5 1979 - Franz Josef Strauß gibt seine Kanzlerkandidatur bekannt
München * Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß gibt seine Kanzlerkandidatur bekannt.
28. 5 1979 - Der CDU-Bundesvorstand kürt Ernst Albrecht zum Kanzlerkandidaten
Bonn * Der CDU-Bundesvorstand benennt den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht zum Kanzlerkandidaten. Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl hatte zuvor auf eine erneute Kandidatur verzichtet.
2. 7 1979 - Franz Josef Strauß wird Kanzlerkandidat der Unionsparteien
Bonn * Franz Josef Strauß wird von der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages als erster Kanzlerkandidat der CSU für die Unionsparteien nominiert. Er erhält 135 Stimmen der 237 anwesenden Abgeordneten (57 Prozent). 102 Abgeordnete stimmen für Ernst Albrecht (43 Prozent).
Die Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß ist von großer Bedeutung für die Unionsparteien, weil sich die CDU als größere Schwesterpartei der Fraktionsgemeinschaft seit der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer ein gewohnheitsmäßiges erstes Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur gesichert hatte. Die Kanzlerkandidatur eines CSU-Politikers gilt als Ausnahme, da ein Erfolg eines bayerischen Politikers auf Bundesebene als nur wenig wahrscheinlich angesehen wird.
24. 7 1979 - Naherholungsgebiet Isarinsel Oberföhring eröffnet
München-Oberföhring * Das ausgebaute Naherholungsgebiet Isarinsel Oberföhring wird der Bevölkerung übergeben.
17. 8 1979 - Premiere des Monty-Python-Films „Das Leben des Brian“
New York * Der Monty-Python-Film „Das Leben des Brian“ wird im New Yorker Cinema One uraufgeführt. Der Film ist bereits vor seiner Veröffentlichung wegen „Religionsbeleidigung“ umstritten. Freigegeben ist der Film für Jugendliche ab 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.
22. 9 1979 - Der Eintrittspreis im Hippodrom wird abgeschafft
München-Theresienwiese • Der Eintrittspreis im Hippodrom wird abgeschafft. Damit geht allerdings die exklusive Club-Atmosphäre verloren.
Ab dem 22. 9 1979 - 36 Ochsen drehen sich am Spieß der Ochsenbraterei
München-Theresienwiese • 36 Ochsen drehen sich am Spieß der Ochsenbraterei.
22. 9 1979 - Wiggerl und Christa Hagn übernehmen das Löwenbräu-Festzelt
München-Theresienwiese • Das Wirteehepaar Ludwig Wiggerl und Christa Hagn übernimmt das Löwenbräu-Festzelt.
Vor dem 22. 9 1979 - Die Spatenbrauerei erhält die Ochsenbraterei
München-Theresienwiese • Paulaner will die bis dahin als Wirtezelt geführte Ochsenbraterei kaufen. Den Zuschlag erhält aber nicht Paulaner sondern die Spatenbrauerei, die bis dahin kein eigenes Festzelt hat.
22. 9 1979 - Oberbürgermeister Erich Kiesl ruft „I‘zapft os!“
München-Theresienwiese • Bei Oberbürgermeister Erich Kiesl klappt es dieses Mal zwar mit dem Anzapfen. Dafür blamiert er sich dann mit seinem Ausruf: „I‘zapft os!“.
3. 10 1979 - Nach der Sanierung wird die Schack-Galerie wieder eröffnet
München-Lehel * Nach den Sanierungsarbeiten wird die Schack-Galerie der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt. Das Interesse an den Schätzen der Schack-Galerie flaut jedoch ab. Nur zwischen 8.000 bis 10.000 Besucher kommen im Jahr. Oft stehen die Säle leer, weshalb ein München-Führer die Galerie sogar als „stillen Winkel“ für Ruhe suchende Kunstfreunde empfiehlt.
8. 11 1979 - Demonstrationen wegen dem Film „Das Leben des Brian“
London * Uraufführung des Films „Das Leben des Brian“ für Großbritannien findet im Plaza Cinema in London statt. Vor dem Kino finden sich Demonstranten ein und singen Kirchenlieder.
9. 11 1979 - Kirchenproteste gegen den Film „Das Leben des Brian“
York * Der Erzbischof von York ruft alle Christen und besorgten Bürger auf, die zuständigen Gremien vor dem Film „Das Leben des Brian“ zu warnen, „so wie in anderen Fällen, wo es schien, dass ein Film den Wert des Menschen missachtet […]“.
Wie viele andere religiöse Kritiker hat auch er den Film zuvor nicht gesehen.
22. 11 1979 - 66 Folgen von Dieter Hildebrandts „Notizen aus der Provinz“ im ZDF
München * Zwischen 1973 und 1979 werden im ZDF 66 Folgen von Dieter Hildebrandts „Notizen aus der Provinz“ ausgestrahlt.
1980 - Das „Togalwerk“ ist Markenführer im Bereich „Fußpflege“
München-Bogenhausen * Mit „efasit“, das das „Togalwerk“ seit dem Jahr 1938 herstellt, wird die Münchner Firma an der Ismaninger Straße zum Markenführer im Bereich „Fußpflege“.
Nach 1980 - Freddie Mercury wird Stammgast in der „Deutschen Eiche“
München-Isarvorstadt * Freddie Mercury kommt nach München, wo er im Studio „Musicland“ von Giorgio Moroder mit seiner Gruppe „The Queen“ Schallplatten produziert.
Schnell wird er Stammgast in der „Deutschen Eiche“.
1980 - Der durchschnittliche Bierverbrauch liegt in Deutschland bei 145,9 Liter
Deutschland * Der durchschnittliche Bierverbrauch liegt in Deutschland bei 145,9 Liter.
1980 - Ein neues „Bewerbungsverfahren“ für die Vergabe der „Wiesn-Zelte“
München-Theresienwiese * Ein neues „Bewerbungsverfahren“ für die Vergabe der „Wiesn-Zelte“ wird eingeführt.
Es enthält 13 Bewertungskriterien, die in drei Blöcken zusammengefasst sind:
Mit je bis zu elf Punkten und mit dem Faktor zwei multipliziert werden die Kriterien
- Vertragserfüllung
- Volksfesterfahrung
- Sachkenntnis
- Durchführung und die Frage,
- wie lange ist der Bewerber schon auf dem „Oktoberfest“?
Ein weiterer Block mit jeweils bis zu elf Punkten, die mit dem Faktor vier multipliziert werden, gibt es für den Zeltbetrieb mit den Kriterien
- Ausstattung
- Technischer Stand
- Anziehungskraft
- Tradition und
- Platzbedarf
Im dritten Block gibt es bis zu elf Punkte, die wieder mit dem Faktor zwei multipliziert werden, für die Kriterien
- Ortsansässigkeit
- Alleineigentum und
- Ökologie.
1980 - Die „Wasserglocken“ werden durch „Bronzepilze“ ersetzt
München-Kreuzviertel * Die „Wasserglocken“ des Brunnens mit der technokratischen Bezeichnung „Schwerer Granit und zarte Wasserglocken“ werden durch „Bronzepilze“ ersetzt.
1980 - München hat 1.298.000 Einwohner
München * München hat 1.298.000 Einwohner.
30. 1 1980 - Wehrsportgruppe Hoffmann als terroristische Organisation verboten
Bonn * Bundesinnenminister Gerhard Baum verbietet die Wehrsportgruppe Hoffmann als terroristische Organisation.
Um den 20. 3 1980 - Verniedlichung der Wehrsportgruppe Hoffmann
<p><strong>München</strong> * Franz Josef Strauß echauffiert sich noch zwei Monate nach dem Verbot der <em>„Wehrsportgruppe Hoffmann“ </em>folgendermaßen: <em>„Mein Gott, wenn sich ein Mann vergnügen will, indem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack und einem mit Koppel geschlossenen Battledress spazieren geht, dann sollte man ihn in Ruhe lassen.“ </em></p>
12. 6 1980 - Dieter Hildebrandts Satiresendung „Der Scheibenwischer“ startet
Berlin * Im Jahr der Bundestagswahl verordnet der ZDF-Programmdirektor Dieter Stolte dem Dieter-Hildebrand-Magazin Notizen aus der Provinz eine „Denkpause“. Das führt zum Wechsel Hildebrandts zur ARD. Im Sender Freies Berlin - SFB startet Dieter Hildebrandt die Satiresendung „Der Scheibenwischer“.
4. 8 1980 - John Lennon und Yoko Ono beginnen an einem neuen Album zu arbeiten
New York * John Lennon und Yoko Ono beginnen im Studio an einem neuen Album zu arbeiten.
20. 9 1980 - Günter und Margot Steinberg betreiben das Hofbräuhaus-Festzelt
München-Theresienwiese * Das Wirtsleuteehepaar Günter und Margot Steinberg betreibt das Hofbräuhaus-Festzelt auf der Theresienwiese.
20. 9 1980 - Hermann und Anneliese Haberl betreiben die Ochsenbraterei
München-Theresienwiese * Die Ochsenbraterei geht in den Besitz der Spaten-Franziskaner-Brauerei über. Gleichzeitig werden Hermann und Anneliese Haberl die Wirtsleute der Spatenbräu-Festhalle und Ochsenbraterei.
23. 9 1980 - Franz Josef Strauß lässt Demonstranten umzingeln
München-Graggenau • Der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, Franz Josef Strauß, will vor seiner Rede auf dem Marienplatz von der Polizei Demonstranten entfernen lassen, die auf Transparenten Stoppt Strauß fordern und durch Sprechchöre auf sich aufmerksam machen.
Da der Einsatzleiter dazu keine rechtliche Grundlage sieht, wird auf der Stelle von Strauß (jetzt in seiner Eigenschaft als bayerischer Ministerpräsident) abgesetzt. Die Demonstranten sehen sich kurz darauf von einem großen Polizeiaufgebot umzingelt.
26. 9 1980 - Das Oktoberfest-Attentat
München-Theresienwiese * Freitag, 22:19 Uhr: Am Haupteingang der Wiesn explodiert ein Sprengsatz. Der Feuerball unterbricht die ausgelassene Volksfeststimmung auf dem Oktoberfest und tötet 13 Menschen. 211 Personen werden verletzt, davon 68 schwer. „Menschen wirbeln durch die Luft, Blut spritzt, zerfetzte Gliedmaßen, unglaubliche Schmerzen und verzweifelte Schreie, die nur die hörten, denen nicht gleich das Trommelfell platzte“. Einer der Toten ist der Geologiestudent Gundolf Köhler (21). Als die Rettungskräfte am Tatort eintreffen, finden sie in einem Umkreis von bis zu 23 Metern Verletzte und Tote verstreut auf der Straße liegen. Die die Detonation begleitende Druckwelle ist gewaltig gewesen.
Noch in der Nacht stehen für die Bayerische Staatsregierung die Schuldigen fest: Die RAF und linke Terroristen müssen für das Massaker verantwortlich sein. Ministerpräsident Franz Josef Strauß steht mitten im Wahlkampf. Er will Helmut Schmidt (SPD) als Bundeskanzler ablösen und hat sich selbst als starker Law-and-Order-Mann positioniert.
Nun sieht Franz Josef Strauß seine Stunde gekommen. Er greift Innenminister Gerhard Baum (FDP) an, der für das Nachrichtenmagazin Spiegel eine Diskussion mit dem RAF-Anwalt und Ex-Terroristen Horst Mahler geführt hat. Strauß macht Baum für das Attentat mitverantwortlich, weil er den Terrorismus quasi salonfähig gemacht hat. Strauß fordert, dass sofort Flugblätter produziert werden, die Baum im Gespräch mit Mahler zeigen. Doch die Attacke gegen Links wird sich bald als Bumerang erweisen.
Auf den Verdacht hin, dass es sich um einen Terrorakt handelte, leitet Generalbundesanwalt Kurt Rebmann zusätzlich ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Die Untersuchung liegt damit federführend beim Bund.
Nach intensiven Beratungen mit Politikern, dem Polizeipräsidenten und den Veranstaltern entscheidet Oberbürgermeister Erich Kiesl noch mitten in der Nacht, das Oktoberfest nicht abzubrechen, sondern nur einen Trauertag zu veranstalten. Man wolle und dürfe sich dem Terror, gleich von welcher Seite, nicht beugen. Bei dieser nicht unumstrittenen Entscheidung hat man auch das Beispiel der XX. Olympischen Spiele in München vor Augen, die trotz eines Terroranschlages zu Ende geführt worden waren.
27. 9 1980 - So, als sei nichts gewesen
München-Theresienwiese * Am Tag nach dem Wiesn-Attentat öffnet das Oktoberfest ganz normal seine Pforten, so, als sei nichts gewesen. Die Kapellen spielen auf, die Fahrgeschäfte drehen sich. Nur ein paar Blumen erinnern an das Grauen, das am Vorabend über die Wiesnbummler hereingebrochen war.
27. 9 1980 - Der politisch rechts orientierten Gundolf Köhler war der Attentäter
Theresienwiese - Kreuzviertel * Die Sonderkommission Theresienwiese identifiziert den 21-jährigen, politisch rechtsorientierten Geologiestudenten Gundolf Köhler als Attentäter. Er ist eines der dreizehn Todesopfer.
Zeugen haben ihn unmittelbar vor der Explosion am Tatort gesehen. Die Verletzungsmerkmale an Köhlers Leiche untermaueren die Aussagen der Zeugen und lassen keinen Zweifel an einer Täterschaft Köhlers.
27. 9 1980 - Abendzeitung: „Eine Spur führt direkt zu den Neo-Nazis“
Theresienwiese - München * Die Abendzeitung erscheint am Tag nach dem Wiesn-Attentat mit einer Sonderausgabe und der Nachricht, dass eine Spur direkt zu den Neo-Nazis führt. Doch Ministerpräsident Franz Josef Strauß beharrt darauf, die Schuld linken Terroristen zu geben.
28. 9 1980 - Gewerkschaften, Kirchen und Politiker rufen zu mehr Toleranz auf
München * Am „Tag des ausländischen Arbeitnehmers“ rufen Gewerkschaften, Kirchen und Politiker zu mehr Toleranz gegenüber den in Deutschland lebenden Ausländern auf. Man appelIiert an die Bevölkerung, der von neonazistischen Kräften geschürten Ausländerfeindlichkeit entgegenzutreten.
Um den 28. 9 1980 - Die verbotene paramilitärische Wehrsportgruppe Hoffmann im Verdacht
München * Die Ermittlungen der ersten Tage nach dem Oktoberfest-Attentat konzentrieren sich auf die verbotene paramilitärische Wehrsportgruppe Hoffmann. Selbst Generalbundesanwalt Kurt Rebmann verkündet, dass Gundolf Köhler keinesfalls allein für das Attentat verantwortlich sein kann.
30. 9 1980 - Das Oktoberfest wird für einen Tag geschlossen
München-Theresienwiese * Erst vier Tage nach dem Wiesn-Attentat wird das Oktoberfest für einen Tag geschlossen. Das lange Zaudern des CSU-Oberbürgermeisters Erich Kiesl zu diesem Schritt stößt nicht nur bei vielen Münchnern auf Unverständnis.
10 1980 - Die wiederaufgebaute Kirche in Avilla di Buia wird eingeweiht
Avilla di Buia * Die wiederaufgebaute Kirche in Avilla di Buia wird eingeweiht - mit der „Madonna della Saluta“ im Mittelpunkt.
Ein großes Glasbild zeigt unter anderem das Dorf Haidhausen.
5. 10 1980 - Ergebnis der Bundestagswahl 1980
Bundesrepublik Deutschland * In dem sehr emotionsgeladenen Wahlkampf [„Stoppt Strauß“] konzentrieren sich die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Kanzlerkandidaten Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß. Bei der Wahl zum 9. Deutschen Bundestag erhält
- die SPD mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt 42,9 Prozent der Stimmen [+ 0,3] und 228 Sitze.
- Die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß erhält 44,5 Prozent [- 4,1] und 237 Sitze.
- Die FDP bekommt 10,6 Prozent [+ 2,7] und 54 Sitze.
- DIE GRÜNEN, die erstmals bei einer Bundestagswahl antreten, kommen aber nur auf 1,5 Prozent der abgegebenen Stimmen.
Helmut Schmidt [SPD] wird Bundeskanzler einer Koalition aus SPD und FDP.
27. 10 1980 - John Lennon: „(Just Like) Starting Over“
USA * John Lennons und Yoko Onos Single „(Just Like) Starting Over“ und „Kiss, Kiss, Kiss“ erscheint.
30. 10 1980 - Gegen den Todesflughafen im Erdinger Nebelloch
München * Das Verwaltungsgericht entscheidet nach einem zwölfjährigen Widerstand gegen den „Todesflughafen im Erdinger Nebelloch“ für den sofortigen Vollzug des Baubeginns von München II im Erdinger Moos.
2. 11 1980 - Demonstration gegen den neuen Flughafen
München * Einen Tag vor Baubeginn des Flughafens München II im Erdinger Moos demonstrieren rund 150 GegnerInnen in der Münchner Innenstadt. Der Flughafen wird als ein „Jahrhundert-Projekt bayerischen Größenwahns“ bezeichnet.
4. 11 1980 - Demonstrieren im Erdinger Moos gegen den neuen Flughafen
München-Flughafen MUC * Rund 2.000 Menschen demonstrieren im Erdinger Moos gegen den neuen Flughafen. Hinterher veranstalten sie einen Autocorso durch die Region.
5. 11 1980 - Helmut Schmidt wird Kanzler einer SPD/FDP-Koalition
Bonn * Der 9. Deutsche Bundestag wählt Helmut Schmidt [SPD] zum Bundeskanzler. Er führt eine Koalition bestehend aus SPD und FDP.
6. 11 1980 - 2.000 Rekruten legen auf dem Königsplatz ihr Feierliches Gelöbnis ab
München-Maxvorstadt * Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Bundeswehr legen 2.000 Rekruten auf dem Königsplatz ihr Feierliches Gelöbnis ab. Generalmajor Wolfgang Kessler und Ministerpräsident Franz Josef Strauß sprechen dabei von der „Erhaltung des Friedens durch Abschreckung“.
Die Vereidigung auf dem Königsplatz ruft Erinnerungen an die Aufmärsche während der NS-Zeit wach, weshalb parallel zur Gelöbnisfeier eine Protestveranstaltung der Münchner Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung stattfindet. Transparente mit der Aufschrift „Auf Hitlers Plattenmeer gelobt nunmehr die Bundeswehr“ werden von den Demonstranten mitgetragen.
15. 11 1980 - Demonstration gegen den Baubeginn des Flughafens im Erdinger Moos
München-Maxvorstadt * Am Königsplatz findet eine Demonstration gegen den Baubeginn des Flughafens im Erdinger Moos mit mehr als 2.000 TeilnehmerInnen statt.
17. 11 1980 - John Lennon und Yoko Ono: „Double Fantasy“
USA * Das Doppel-Album „Double Fantasy“ von John Lennon und Yoko Ono wird veröffentlicht.
8. 12 1980 - John Lennon wird in New York ermordet
New York * John Lennon wird um 23:07 Uhr vor seinem Wohnsitz im Dakota House in New York von Mark David Chapman erschossen.
14. 12 1980 - Weltweit eine zehnminütige Schweigeminute für John Lennon
Welt * Weltweit wird eine zehnminütige Schweigeminute zum Ableben von John Lennon abgehalten.
1981 - „Filmtheater-Prämien“ für herausragende Programmgestaltung
Freistaat Bayern - München * Der „Freistaat Bayern“ vergibt als erstes Bundesland neben Zuschüssen für Modernisierung eigene „Filmtheater-Prämien“ für herausragende Programmgestaltung.
1981 - Carl Amery: „Es gehört zu den Merkwürdigkeiten Bayerns ...“
München * Carl Amery schreibt die folgenden Zeilen:
„Es gehört zu den Merkwürdigkeiten Bayerns, dass der Geburtstag eines Staatsnamens, dessen sich die weißblauen Regierenden bis zum letzten Überdruss bedienen, niemals festlich begangen wurde - und wohl auch nie begangen werden wird“.
12. 1 1981 - John-Lennon-Single: „Woman“ und „Beautiful Boy“
USA * Die John-Lennon-Single „Woman“ und „Beautiful Boy“ erscheint.
9. 2 1981 - Bill Haley stirbt
Harlingen * Bill Haley stirbt in Harlingen, Texas.
13. 3 1981 - John Lennon: „Watching the Wheels“
<p><strong><em>USA</em></strong> * Die Single <em>„Watching the Wheels“</em> und <em>„Yes I‘m your Angel“</em> von John Lennon ist in den Plattenläden erhältlich. </p>
11. 5 1981 - George Harrisons Tribute-Single „All Those Yaers Ago“
Großbritannien * George Harrisons Tribute-Single „All Those Yaers Ago“, an der auch Ringo Starr und Paul McCartney beteiligt sind, wird veröffentlicht.
13. 5 1981 - SoKo Theresienwiese: Gundolf Köhler dürfte als Alleintäter gehandelt haben
München * Nach acht Monaten stellt die Sonderkommission Theresienwiese ihre Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat ein und präsentiert den 187-seitigen vorläufigen Abschlussbericht.
- 860 Spuren wurden verfolgt und in die puzzleartige Rekonstruktion der Tat eingepasst.
- Die Beamten haben 1.800 Zeugen vernommen und 1.500 Asservate begutachtet.
Die Quintessenz lautet:
„Gundolf Köhler dürfte als Alleintäter gehandelt haben.
Für eine Mittäterschaft oder auch nur Mitwisserschaft anderer an dem Sprengstoffanschlag auf das Münchner Oktoberfest ließen sich keine konkreten Anhaltspunkte erkennen“.
Seine rechtsextremistische Einstellung wird durch Nachforschungen bestätigt.
Ebenso, dass er in den Jahren 1975/76 an Übungen der am 30. Januar 1980 verbotenen „Wehrsportgruppe Hoffmann“ teilgenommen hat.
Die These vom verwirrten Einzeltäter ist seitdem die offizielle Version.
5. 6 1981 - George Harrison: „Somewhere in England“ wird veröffentlicht
Großbritannien * George Harrisons LP „Somewhere in England“ kommt in die Schallplattenläden.
18. 9 1981 - Ein Mahnmal für die Opfer des Wiesn-Attentats
München-Theresienwiese * Einen Tag vor Eröffnung des Oktoberfestes 1981 wird am Haupteingang zur Festwiese das Mahnmal für die Opfer des Bombenanschlags enthüllt. Oberbürgermeister Erich Kiesl ruft dazu auf, Lehren aus dem feigen Anschlag zu ziehen und Gewalt in jeder Form zu ächten.
Das Mahnmal - geschaffen von Friedrich Koller - besteht aus einer 2,70 Meter hohen Bronzestele und trägt die Inschrift: „Zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags vom 26. September 1980.“
19. 9 1981 - Das Märzenbier gibt es nur noch in zwei Festzelten
München-Theresienwiese * In nur noch zwei Bierzelten auf dem Oktoberfest wird das Märzenbier zusätzlich zum hellen Edelstoff ausgeschenkt.
19. 9 1981 - Die Mass Wiesn-Bier kostet 5,25 DMark
München-Theresienwiese * Die Mass Wiesn-Bier kostet 5,25 DMark. 5 Millionen Mass werden ausgeschenkt. Jeder Wiesn-Besucher trinkt im Durchschnitt 0,75 Liter Bier.
19. 9 1981 - Im Hofbräuhaus-Festzelt gibt es für ein paar Stunden Paulaner-Bier
München-Theresienwiese * Im Hofbräuhaus-Festzelt gibt es für ein paar Stunden Paulaner-Bier. Dem Wirt ist das Bier ausgegangen, weshalb Richard Süßmeier, der Wirt des Armbrustschützenzeltes, mit mehreren Hirschen [= 200-Liter-Fässer] aushilft.
19. 9 1981 - Das Containerbier erregt die Gemüter
München-Theresienwiese * Das Containerbier lässt die Volksseele kochen. Oberbürgermeister Erich Kiesl und Ministerpräsident Franz Josef Strauß ergreifen in offenen Briefen an die Brauereien Partei für das traditionelle Holzfass. Die Brauereien ihrerseits erklären, die Beschaffung von Holzfässern ist „in Zukunft fast nicht mehr zu lösen“. Für dieses Jahr kann der Einzug des Containerbieres auf dem Oktoberfest noch einmal gestoppt werden.
19. 9 1981 - Das Hotelier-Ehepaar Weinfurtner übernimmt das Hippodrom
München-Theresienwiese * Das Hotelier-Ehepaar Marianne und Anton Weinfurtner übernimmt das Hippodrom.
26. 9 1981 - Der erste Jahrestag des Wiesn-Attentats
München-Ludwigsvorstadt * Am Jahrestag des Wiesn-Attentats wird in der Pauls-Kirche ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten.
25. 11 1981 - Ratzinger wird Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre
Rom-Vatikan * Kardinal Joseph Ratzinger wird von Papst Johannes Paul II. zum Kurienkardinal und Präfekten der römischen Kongregation für die Glaubenslehre ernannt.
1982 - Die Landeshauptstadt erwirbt Teile des „Milchhofs München“
München-Berg am Laim * Die Landeshauptstadt München erwirbt den größten Teil des Areals an der Friedenstraße, auf dem sich die „Milchhof München GmbH“ befindet.
1982 - Der bundesdeutsche Pro-Kopf-Verbrauch an Bier liegt bei 148 Liter
Bundesrepublik Deutschland * Der bundesdeutsche Pro-Kopf-Verbrauch an Bier liegt bei 148 Liter.
1982 - Eine hohe Brauereiendichte in Bayern
Freistaat Bayern - Europa * Alle Brauereien in Bayern haben einen durchschnittlichen Ausstoß von 29.700 Hektolitern.
Das liegt an der hohen Brauereiendichte in Bayern.
Im Vergleich: die Bundesrepublik Deutschland hat einen Durchschnittsausstoß von 73.000 hl, Dänemark 352.000 hl, Frankreich 378.000 hl, Großbritannien 443.000 hl und die Niederlande 735.500 Hektoliter.
Bis 1982 - Pferdehaltung zur Bewirtschaftung der „Baumschule“
München-Englischer Garten * Zur Bewirtschaftung der „Baumschule“ und zum Einsammeln von Abfällen werden im „Englischen Garten“ Pferde gehalten.
Um 1982 - Die „Wiederverwertbarkeit von Rohstoffen“ aus dem Müll fördern
München * Es gibt Überlegungen, ein drittes „Müllverbrennungs-Kraftwerk“ zu bauen.
Es gibt aber auch „grünen“ Widerstand, der fordert, die „Verbrennungsanlagen“ zu entgiften und die „Wiederverwertbarkeit von Rohstoffen“ zu fördern.
1982 - Sepp Krätz übernimmt die „Waldwirtschaft“ in Großhesselohe
München-Großhesselohe * Sepp Krätz übernimmt die „Waldwirtschaft“ in Großhesselohe.
Um den 20. 1 1982 - Strauß bezeichnet „Scheibenwischer“ als politische Giftmischerei
München * Während sich Dieter Hildebrandt in seiner Satiresendung „Scheibenwischer“ über den Rhein-Main-Donau-Kanal lustig macht, geifert Franz Josef Strauß von „politischer Giftmischerei“.
1. 3 1982 - Kardinal Joseph Ratzinger trifft in Rom ein
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong><em> * </em>Kardinal Joseph Ratzinger tritt seine neue Aufgabe als Kurienkardinal und Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre in Rom an. Damit ist Ratzinger der oberste Glaubenswächter der katholischen Kirche. Während dieser Zeit gibt es heftige Auseinandersetzungen. </p>
17. 9 1982 - Schmidts Aufforderung für ein Konstruktives Misstrauensvotum
Bonn * Bundeskanzler Helmut Schmidt fordert die Opposition nach dem Kabinettsrückzug der FDP zur Durchführung eines Konstruktiven Misstrauensvotums auf.
18. 9 1982 - Das Container-Bier hält Einzug auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese * Mit einjähriger Verzögerung hält das Container-Bier Einzug auf dem Oktoberfest.
1. 10 1982 - Helmut Kohl wird Bundeskanzler
Bonn * Helmut Kohl wird durch ein Konstruktives Misstrauensvotum zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er leitet eine Koalition bestehend aus CDU/CSU und FDP.
8. 10 1982 - Das Deutsche Theater nach 5-jähriger Sanierung wiedereröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Das Deutsche Theater kann nach Abschluss der fast fünfjährigen Generalsanierung unter der Leitung von Reinhard Riemerschmid, wieder feierlich eröffnet werden. Die Kosten sind explodiert. Aus den ursprünglich angesetzten drei Millionen sind 54 Millionen geworden. Bei der Eröffnung spricht „Loriot“ vom „schönsten Theater in der Schwanthalerstraße“. Das ist aber kein Wunder, denn es gibt ja nur eines.
Die Landeshauptstadt München hat das Deutsche Theater übernommen, nachdem sich kein privater Betreiber finden lässt.
10. 10 1982 - Ergebnis der Landtagswahl 1982
Freistaat Bayern * Bei der Landtagswahl erhält
- die CSU 58,3,
- die SPD 31,9 Prozent.
Erstmals in der Nachkriegsgeschichte ist der Bayerische Landtag ein Zweiparteienparlament.
- Die FDP erhält lediglich 3,5 Prozent.
- Die Grünen kommen auf 4,6 Prozent und scheiterten damit knapp an der Fünf-Prozent-Klausel.
28. 10 1982 - Friedrich Wetter wird 12. Erzbischof von München und Freising
Rom-Vatikan - München * Friedrich Wetter wird von Papst Johannes Paul II. zum 12. Erzbischof von München und Freising ernannt, nachdem Kardinal Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom berufen worden war.
5. 11 1982 - George Harrison: „Gone Troppo“
Großbritannien * George Harrison veröffentlich sein Album „Gone Troppo“.
12 1982 - Der „Generalbundesanwalt“ stellt Ermittlungen zum „Wiesn-Attentat“ ein
Karlsruhe * „Generalbundesanwalt“ Kurt Rebmann lässt die Ermittlungen zum „Wiesn-Attentat“ offiziell einstellen.
Er schließt sich der „Einzeltätertheorie“ vorbehaltlos an.
Köhler hat nicht aus politischen Motiven gehandelt, sondern sei „getrieben gewesen von sozialer Vereinsamung und sexueller Frustration“.
17. 12 1982 - Auf vorgezogene Neuwahlen verständigt
Bonn - Bundesrepublik Deutschland * Durch eine bewusst verlorene Vertrauensfrage werden Neuwahlen für den Deutschen Bundestag ausgelöst. CDU/CSU und FDP hatten sich schon zuvor auf die Durchführung von vorgezogenen Neuwahlen verständigt.
31. 12 1982 - Das Lehel hat nur noch 14.551 Einwohner
München-Lehel * Das Lehel hat nur noch 14.551 Einwohner.
1983 - Die „Jugendbibliothek“ zieht nach „Schloss Blutenburg“ um
München-Maxvorstadt - München-Menzing * Jella Lepmanns „Jugendbibliothek“ zieht von der Kaulbachstraße 11 nach „Schloss Blutenburg“ um.
1983 - Der Gebrauch der im Jahr 1897 eingeführten „Mülltonne
München * Der Gebrauch der im Jahr 1897 eingeführten „Mülltonne" wird eingestellt.
1983 - Gerhard Polt und Dieter Hildebrandt spielen in „Kehraus“
München * Dieter Hildebrandt übernimmt im Gerhard-Polt-Film „Kehraus“ eine Schauspielrolle.
1983 - Der Stadtrat beschließt den Entwurf für ein neues „Mahnmals“
München-Maxvorstadt * Nachdem vermehrt Einwände gegen die provisorische Lösung auf dem „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ laut geworden sind, beschließen im Jahr 1983 die Fraktionen des Münchner Stadtrats, einen Wettbewerb für den Entwurf eines neuen „Mahnmals“ ausloben zu lassen.
1983 - Der „Turmschreiber-Kalender“ erscheint jährlich
München * Der „Turmschreiber-Kalender“ erscheint jährlich.
7. 2 1983 - Pershing II-Rakete statt Friedensengel
München-Bogenhausen * Die Initiative für die totale Nachrüstung setzt eine Attrappe einer Pershing II-Rakete auf den leeren Sockel des Friedensengels.
6. 3 1983 - Helmut Kohl bleibt Bundeskanzler einer CDU/CSU/FDP-Koalition
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 10. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl 48,8 Prozent der Stimmen [+ 4,3] und 255 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Hans-Jochen Vogel erringt 38,2 Prozent [- 4,7] und 202 Sitze.
- Die FDP bekommt 7,0 Prozent [- 3,6] und 35 Sitze.
- Die Grünen kommen mit 5,6 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 4,1] und 28 Sitzen erstmals in den Deutschen Bundestag.
Helmut Kohl wird Bundeskanzler einer Koalition bestehend aus CDU/CSU und FDP.
16. 4 1983 - Die U 3/6 wird nach Holzapfelskreuth verlängert
München * Die Streckenverlängerung der U-Bahn [U 3/6] nach Holzapfelskreuth zur Internationalen Gartenbauausstellung - IGA wird eröffnet.
5. 5 1983 - München startet einen Modellversuch mit „bleifreiem Benzin“.
München * Die Stadtverwaltung startet mit 40 eigenen Fahrzeugen einen Modellversuch mit „bleifreiem Benzin“.
28. 5 1983 - Der U-Bahn-Streckenabschnitt zum Rotkreuzplatz geht in Betrieb
München * Der U-Bahn-Streckenabschnitt [U 1] zum Rotkreuzplatz geht in Betrieb.
7. 11 1983 - Die erste kommerzielle Bleifrei-Zapfsäule Europas
München-Untermenzing * Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann nimmt die erste kommerzielle Bleifrei-Zapfsäule Europas in der Allguth-Tankstelle in der Untermenzinger Von-Kahr-Straße in Betrieb. Der Liter Bleifrei kostet 1,389 DMark.
1984 - Die „Fachakademie für Sozialpädagogik“ zieht nach Obergiesing um
München-Obergiesing - München-Bogenhausen * Die „Fachakademie für Sozialpädagogik“ zieht in das „Anton-Fingerle-Zentrum“ in Giesing um.
In den aufgelassenen Räumen in Bogenhausen findet die „Berufsschule für Jungarbeiterinnen und Jungarbeiter“ Unterkunft.
1984 - In der Gyslingstraße wird ein neuer „Kiosk“ gebaut
München-Englischer Garten - Hirschau * In der Gyslingstraße in der „Hirschau“ wird ein neuer „Kiosk“ gebaut.
1984 - Wiederaufnahme des Verfahrens zum „Wiesn-Attenat“ verweigert
Karlsruhe * Die „Generalbundesanwaltschaft“ verweigert eine Wiederaufnahme des Verfahrens zum „Wiesn-Attenat“.
1984 - Die Madonna auf der „Mariensäule“ ist nun „ölvergoldet“
München-Graggenau * Die Madonna auf der „Mariensäule“ ist nun „ölvergoldet“ und damit hochglänzend.
7. 1 1984 - Rechtsradikaler Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Zwei rechtsextreme Täter, ein Münchner und ein Italiener, werfen zwei Benzinkanister in den Eingang der Diskothek Liverpool an der Schillerstraße 11a. Das Feuer verletzt die 20-Jährige Corinna Tartarotti so schwer, dass sie drei Monate später stirbt.</p>
16. 1 1984 - Die bundesweit erste Regionalgruppe der Aids-Hilfe gegründet
München-Angerviertel * Im Vollmar-Haus wird die bundesweit erste Regionalgruppe der Aids-Hilfe gegründet. Die Gründung des Vereins ist „eine politische Reaktion auf eine noch nicht sichtbare Bedrohung“. Die Berichterstattung in Deutschland über Aids stellt einen Angriff auf die Münchner Schwulenszene und deren Lebensstil dar.
10. 3 1984 - Der U-Bahn-Streckenabschnitt zur Westendstraße wird eröffnet
München * Der U-Bahn-Streckenabschnitt [U 5] zwischen Stachus und Westendstraße wird eröffnet.
17. 3 1984 - Die Amtszeit von Erich Kiesl [CSU] als OB endet
München • Die Amtszeit von Erich Kiesl [CSU] als Münchner Oberbürgermeister endet.
18. 3 1984 - Georg Kronawitter [SPD] wird erneut Münchner Oberbürgermeister
München • Georg Kronawitter [SPD] wird erneut Münchner Oberbürgermeister.
12. 7 1984 - Ein Unwetter hinterlässt eine Schneise der Verwüstung
München * Ein Unwetter zieht über den Münchner Osten und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Gegen 20:05 Uhr fallen Hagelkörner, zum Teil so groß wie Tennisbälle, auf die Erde. Sie durchschlagen Dachplatten und Fassadenverkleidungen. Aus Pflanzen und Gemüse wird in wenigen Minuten Matsch.
- 400 Menschen werden so stark verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen,
- Drei Menschen sterben vor Aufregung.
- Rund 70.000 Wohngebäude werden zum Teil erheblich beschädigt,
- ebenso 1.000 Gewerbebetriebe, darunter viele Gärtnereibetriebe, deren Gewächshäuser zu Bruch gehen.
- 20.000 Hektar landwirtschaftlicher Flächen werden durch den Hagel umgepflügt,
- 150 Flugzeuge werden von den Hagelkörnern demoliert,
- über 200.000 Autos werden zerbeult.
Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Doch das hat gereicht. Das Unwetter richtet den bisher größten Schaden in Deutschland an. Die Versicherungen müssen insgesamt 1,5 Milliarden DMark an Entschädigungen zahlen.
22. 9 1984 - Im Hofbräuhaus-Festzelt kann nachgeschenkt werden
München-Theresienwiese • Der Chef des Hofbräuhaus-Festzeltes, Günter Steinberg, öffnet eine eigene Schänke, bei der sich die Gäste ihren Masskrug auffüllen lassen können, wenn er zu schlecht eingeschenkt ist.
22. 9 1984 - Forderung nach 73 Jahren endlich erfüllt
München-Theresienwiese • Die aus dem Jahr 1911 stammende Forderung des Verbands zur Bekämpfung betrügerischen Einschenkens nach Erhöhung des Schaumraumes in den Krügen oberhalb des Eichstrichs auf 4 Zentimeter wird nach 73 Jahren endlich umgesetzt.
22. 9 1984 - Das Weinzelt wird als völlig neues Zelt eröffnet
München-Theresienwiese • Die Gastronomen-Familie Roland und Doris Kuffler übernimmt den Weinausschank im Nymphenburg-Sekt-Zelt ‚Zum Weinwirt‘, wie der Betrieb offiziell heißt. Das Weinzelt wird als völlig neues Zelt eröffnet.
Um den 25. 9 1984 - Zwei kleine Männer rasen wie ungebremste Lokomotiven aufeinander
München-Theresienwiese * Günter Jauch, Journalist beim Bayerischen Rundfunk, findet heraus, dass in Richard Süßmeiers Armbrustschützenzelt aus einem Hirschen (200-Liter-Fass) 289 Mass Wiesnbier ausgeschenkt werden. Süßmeier nimmt das Ganze auf die leichte Schulter und macht sich darüber lustig. Peter Gauweiler, CSU-Stadtrat und Kreisverwaltungsreferent, geht gegen Süßmeier wegen Betrügerischen Einschenkens vor.
Der Wiesnwirt beruft daraufhin eine Pressekonferenz ein, verkleidet sich als Gauweiler und hängt Gauweiler-Plakate mit dem Schriftzug „Gauweiler sieht Dich!“, „Gauweiler paßt auf!“ und „Gauweiler is watching you!“ an die Zeltwände. Sein Schankkellner Biwi Wallner zeigt schließlich noch, wie man aus einem ganzen Hendl drei halbe Hendl machen kann. Dass er zuvor eine Hälfte hatte einnähen lassen, finden nicht Alle lustig. Allen voran Peter Gauweiler.
Bei der darauf folgenden einer Razzia in Süßmeiers Armbrustschützenzelt werden 23 „Verstöße gegen das Ausländerrecht“ festgestellt. Einige Hilfskräfte haben illegal gearbeitet. Süßmeiers Beteuerungen, er habe davon nichts gewusst, glaubt die Gegenseite natürlich nicht - und handelt: Gauweiler entzieht Süßmeier die Festzeltkonzession.
Zwei Tage später wird mit Helmut Huber ein neuer Wirt eingesetzt.
12. 10 1984 - Der Kreisjugendring gegen Alkoholmissbrauch
München-Theresienwiese * Der Kreisjugendring startet in der tz einen Aufruf. In diesem heißt es: „Wir suchen Beweise! Fotos, Berichte, Statistiken - alles, was beweist, dass das Oktoberfest für viele weniger Gaudi und mehr Alkohol ist. Jugendliche sind Hauptopfer dieser Alkohol-Alleinherrschaft!“
11 1984 - Der „AFN“ zieht in die Kaulbachstraße 45
München-Maxvorstadt * Der „AFN“ zieht von der Kaulbachstraße 15 ein paar Häuser weiter in die Kaulbachstraße 45.
1985 - Der - von den Studenten umgangssprachlich genannte - „Schweinchenbau“
München-Schwabing * Das wegen seiner Außenfarbe Rosa von den Studenten umgangssprachlich „Schweinchenbau“ genannte Seminargebäude beherbergt die Fächer Pädagogik, Psychologie, Musik- und Kunsterziehung.
1985 - Der „Erfolgs-Regisseur“ Joseph Vilsmeier kauft das sogenannte „Pesthaus“
München-Au * Der „Erfolgs-Regisseur“ Joseph Vilsmeier kauft das inzwischen ziemlich heruntergekommene „Pesthaus“ in der Auer Franz-Prüller-Straße um 300.000 DMark.
1985 - Die Giebelskulpturen der „Propyläen“ werden durch Kopien ersetzt
München-Maxvorstadt * Die Giebelskulpturen der „Propyläen am Königsplatz“ werden abgenommen und durch Kopien ersetzt.
Die Originale befinden sich im „U-Bahnhof Königsplatz“.
1985 - Das heutige „Seehaus am Kleinhesseloher See“ wird errichtet
München-Englischer Garten - Schwabing * Das heutige „Seehaus am Kleinhesseloher See“ wird von den Architekten Ernst Hürlimann und Ludwig Wiedemann errichtet.
1985 - Das „Tivoli-Kraftwerk“ wird in die „Denkmalschutzliste“ aufgenommen
München-Englischer Garten - Hirschau * Das „Maffei-Kraftwerk“ am Eisbach, heute „Tivoli-Kraftwerk“, wird in die „Denkmalschutzliste“ der Stadt München aufgenommen.
1985 - Die Stadt München kauft die „Villa Stuck“
München-Haidhausen * Die Landeshauptstadt München kauft den „Atelier- und Wohntrakt“ der „Villa Stuck“ an der Ismaninger Straße und überlässt ihn dem „Jugendstil-Verein“.
Gleichzeitig erhöht die Stadt ihren jährlichen Zuschuss von 99.000 auf 180.000 DMark.
1985 - Die Landeshauptstadt München fördert die „Münchner Aids-Hilfe“
München-Isarvorstadt * Die Landeshauptstadt München fördert die neu gegründete Regionalgruppe der „Münchner Aids-Hilfe“.
1985 - Der „Daphne-Brunnen“ vom Orleansplatz muss dem U-Bahn-Bau weichen
München-Haidhausen * Der „Daphne-Brunnen“ vom Orleansplatz muss dem U-Bahn-Bau weichen uns sein Dasein in einem städtischen Bauhof fristen.
1985 - München hat 1.266.100 Einwohner
München * München hat 1.266.100 Einwohner.
25. 5 1985 - Friedrich Wetter wird zum Kardinal erhoben
Rom-Vatikan - München-Kreuzviertel * Der München-Freisinger Erzbischof Friedrich Wetter wird in das Kardinalskollegium aufgenommen.
14. 6 1985 - Die Hypo-Kunsthalle wird eröffnet
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Mit einer Präsentationsfläche von 600 Quadratmetern wird die Hypo-Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in der Theatinerstraße mit der Ausstellung <em>„Deutsche Romantiker – Bildthemen der Zeit von 1800 bis 1850“</em> eröffnet. </p>
17. 7 1985 - Abriss des Karl-Valentin-Geburtshauses abgelehnt
München - München-Au * Der Planungsausschuss des Stadtrats lehnt den Antrag auf Abriss des „Karl-Valentin-Geburtshaues“ in der Zeppelinstraße 41 ab und tritt mit den Eigentümern, Bernhard Sprenger und Evelyn Hofer, in Verkaufsverhandlungen ein.
20. 8 1985 - Ein Antrag für eine würdige Gestaltung eines Denkmals für Kurt Eisner
München-Graggenau * Der SPD-Stadtrat Alfred Lottmann stellt - aus Anlass des drei Jahre später bevorstehenden 70. Jahrestage der Revolution und der Ermordung Kurt Eisners - an Oberbürgermeister Georg Kronawitter den Antrag für eine „Würdige Gestaltung eines Denkmals für Kurt Eisner“ und kritisiert dabei entschieden die im Jahr 1976 gefundene Lösung. Lottmann regt eine Veränderung der Straßenführung in der heutigen Kardinal-Faulhaber-Straße an, um dort den Platz für eine „Säule oder ähnliches“ zu schaffen.
16. 9 1985 - Der Bezirksausschuss will kein Kurt-Eisner-Denkmal errichten
München-Kreuzviertel * Der Bezirksausschuss des 1. Münchner Stadtbezirks spricht sich - unter dem eigenwillig betitelten Tagesordnungspunkt „Denkmal für einen Bürgerschreck“ - gegen die Errichtung eines Kurt-Eisner-Denkmals aus.
21. 9 1985 - Das Tourismusamt legt die Schreibweise „Wiesn“ ohne Apostroph fest
München-Theresienwiese • Das Tourismusamt legt die Schreibweise „Wiesn“ ohne Apostroph fest. Einzig die Firma Käfer zeigt sich beratungsresistent und schreibt ihre „Käfer Wies'n-Schänke“ bis zum heutigen Tag noch mit Apostroph.
21. 9 1985 - Das Container-Bier beginnt sich auf der Wiesn durchzusetzen
München-Theresienwiese • Das Container-Bier beginnt sich auf der Wiesn durchzusetzen, auch wenn der Stadtrat nur einen „rückholbaren Versuch“ genehmigen will, weil „eine auf der Welt einzigartige Tradition nicht einfach beendet werden kann“. Selbst der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß beklagt, dass hier „die Axt ans Eichenfass“ gelegt und dadurch „ein Stück bayerischer Tradition zu Grabe getragen“ werde.
21. 9 1985 - Manfred Schauer übernimmt den Schichtl
München-Theresienwiese • Manfred Schauer übernimmt den Schichtl auf dem Oktoberfest.
Seit 22. 9 1985 - Am ersten Wiesnsonntag findet in der Bräurosl der Gay Sunday statt
München-Theresienwiese • Am ersten Wiesnsonntag findet in der Bräurosl unter dem Motto: „Bayerisch feiern - International schnacksln“ der Gay Sunday statt.
6. 10 1985 - 5.454.200 Mass Wiesnbier werden an 7.140.000 Besucher ausgeschenkt
München-Theresienwiese * 5.454.200 Mass Wiesnbier werden auf dem Oktoberfest 1985 an 7.140.000 Besucher ausgeschenkt.
30. 10 1985 - Für ein würdiges Eisner-Denkmal in der Kardinal-Faulhaber-Straße
München-Graggenau * In der Vollversammlung des Münchner Stadtrates legt Stadtrat Alfred Lottmann ein weiteres Motiv für seine Initiative dar:
- Es sei dringend an der Zeit, Verleumdungen über Kurt Eisner den Boden zu entziehen, die diesen einerseits als galizischen Ostjuden oder andererseits als verantwortlich für die Opfer der Revolution in der Zeit nach dem Februar 1919 hinstellten.
- Das adäquate Mittel für eine Rehabilitation Eisners sieht Lottmann in seiner Denkmalinitiative und der dadurch ausgelösten öffentlichen Debatte.
Gegen die Stimmen von CSU und FDP wird dem Antrag, Kurt Eisner ein „würdiges Denkmal in der Kardinal-Faulhaber-Straße“ errichten zu lassen, stattgegeben. Doch eine neuerliche Ablehnung des Denkmals im Bauausschuss zeichnet sich ab.
8. 11 1985 - Georg Kronawitter enthüllt ein würdiges Denkmal
München-Maxvorstadt * Oberbürgermeister Georg Kronawitter enthüllt auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus ein „würdiges Denkmal“, das den provisorischen Gedenkstein ersetzt. Der Bildhauer Andreas Sobeck hat einen sechs Meter hoher symbolischer Kerker aus südafrikanischen Impalagestein geschaffen, in dem eine ewige Flamme an die Verfolgten erinnern soll.
Das Denkmal trägt die Inschrift: „Den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“
Nach dem 8. 11 1985 - Der alte Gedenkstein kommt auf den Platz der Freiheit in Neuhausen
München-Maxvorstadt - München-Neuhausen * Der alte Gedenkstein vom Platz der Opfer des Nationalsozialismus wird - mit neuer Inschrift versehen und zur „Erinnerung an die Opfer des Widerstands gegen den Nationalsozialismus“ auf dem Platz der Freiheit in Neuhausen aufgestellt.
10. 11 1985 - Die Gasteig-Philharmonie wird feierlich eröffnet
München-Haidhausen * Die Philharmonie im Gasteig-Kulturzentrum wird feierlich eröffnet.
29. 11 1985 - Bürgerversammlung gegen die Errichtung eines Kurt-Eisner-Denkmals
München * Eine Bürgerversammlung spricht sich gegen die Errichtung eines Kurt-Eisner-Denkmals in der Kardinal-Faulhaber-Straße aus. Rasch wird offensichtlich, dass sich die Debatte weniger um den Ort für das angeregte Denkmal dreht, als vielmehr zu einer grundsätzlichen politischen Auseinandersetzung um Kurt Eisner und die Revolution von 1918/19 entwickelt.
1986 - Der „Ratskeller“ wird von den Familien Wieser und Winkelhofer betrieben
München-Graggenau * Der „Ratskeller“ wird von den Familien Wieser und Winkelhofer betrieben.
Um das Jahr 1986 - Der „Kriechbaumhof“ wird mit viel neuem Holz wieder aufgebaut
München-Haidhausen * Der „Kriechbaumhof“ wird an der Ecke Wolfgang-/Preysingstraße - mit einem Kostenaufwand von 1,1 Millionen Mark - originalgetreu, aber mit viel neuem Holz - wieder aufgebaut.
Ab 1986 - Der „Rosengarten“ wird umgestaltet und erweitert
München-Untergiesing * Von 1986 bis 1989 hat das „Baureferat“ den „Rosengarten“ umgestaltet und erweitert, um allen interessierten Hobbygärtnern zu zeigen, wie Profis Rosen arrangieren und verwenden.
Die „Rose“, die gerne als die „Königin der Blumen“ bezeichnet wird, veranstaltet jedes Jahr im „Rosengarten“ ein Feuerwerk der Farben.
Im Juni und Juli blühen über 8.500 Rosen.
Die rund zweihundert verschiedenen Sorten sorgen für Formen- und Farbenvielfalt.
1986 - Die TV-Serie „Kir Royal“ mit Franz Xaver Kroetz und Dieter Hildebrandt
München * Dieter Hildebrandt spielt in Helmut Dietls TV-Serie „Kir Royal“ an der Seite von Franz Xaver Kroetz den schmierigen Klatschfotografen Herbie Fried.
16. 1 1986 - Aufnahme des Umweltschutzes im Grundgesetz scheitert
<p><em><strong>Bonn</strong></em> * Nach der Katastrophe von Tschernobyl beantragen die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE GRÜNEN, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen. Der Vorstoß scheitert an der Haltung von CDU/CSU. Dadurch wird die notwendige verfassungsändernde Mehrheit nicht erreicht. </p> <p>Die verfassungsrechtliche Verankerung erfolgte schließlich 1994 durch die Einführung des Art. 20a Grundgesetz.</p>
21. 2 1986 - „Das andere Bayern“ setzt „Das unsichtbare Denkmal“ für Kurt Eisner
München-Kreuzviertel * Um 10 Uhr Ortszeit, ziehen die Aktivisten des Vereins „Das andere Bayern“ ein 2,50 Meter hohes, grell gelb-grünes Gemälde Kurt Eisners auf Plastikfolie auf, das der Kunstmaler Eckart Zylla geschaffen hatte. Zylla malt eine rote Zielscheibe auf das Bild und signiert es.
Danach wird eine Gehsteigplatte zerschlagen, das Bild zusammengefaltet und anschließend das Plastikbild in dem „Denkloch“ vergraben. Mit der Kunst-Aktion Kurt Eisner will der Verein auf die Lächerlichkeit dieser bis ins Unerträgliche verzögerten Denkmal-Diskussion aufmerksam machen.
27. 2 1986 - Der Bauausschuss lehnt ein Kurt-Eisner-Denkmal ab
München * Der Bauausschuss lehnt ein Denkmal für Kurt Eisner in der Kardinal-Faulhaber-Straße ab, nachdem im zuständigen Bezirksausschuss darüber gestritten worden war, ob der Gehweg an dieser Stelle verbreitert werden sollte und man damit auf zehn Parkplätze verzichtet werden müsse.
1. 3 1986 - Verknüpfung der U 3/6 mit der U 5 am Odeonsplatz
München-Graggenau * Der U-Bahnhof Odeonsplatz für die U 5 wird eröffnet. Er verknüpft die Strecken der U 5 mit der der U 3/6.
5. 3 1986 - Die Kommission Kunst am Bau beschäftigt sich mit dem Eisner-Denkmal
München-Graggenau * In der Stadtratssitzung werden die Planungen für das „Denkmal für Kurt Eisner in der Kardinal-Faulhaber-Straße“ verworfen. Nun beschäftigt sich die Kommission Kunst am Bau in neun Sitzungen mit dem Problem eines Eisner-Denkmals.
26. 4 1986 - Die Katastrophe von Tschernobyl führt zum Umdenken
München-Untergiesing * Ein Wasserkraftwerk an der Bäcker-Kunstmühle entsteht. Die Verhandlungen zwischen Günter Tremmel und der Landeshauptstadt München ziehen sich bereits sieben Jahre hin, bis sich schließlich die Katastrophe im Kernkraftwerk von Tschernobyl ereignet. Diese führt dazu, dass sich erstmals breite Gesellschaftsschichten mit den Gefahren der Kernkraft konfrontiert sehen.
Die bislang nur in kleinen Gesprächszirkeln diskutierten Fragen nach alternativen Energie- und Technologieformen erfasst nun auch das Interesse der Öffentlichkeit und führen zum Umdenken. Nicht mehr einzelne Energieformen sind gefragt, sondern ein Mix aus einer Vielzahl von alternativen und wieder erneuerbaren Energien werden das Ziel, Forderungen nach einem Ausstieg aus der Atomkraft werden erstmals laut formuliert.
22. 5 1986 - Der Bayerische Rundfunk blendet sich aus
München * Der Bayerische Rundfunk blendet sich aus Dieter Hildebrandts „Scheibenwischer“-Sendung über den Reaktorunfall in Tschernobyl aus und macht sich damit bundesweit lächerlich.
Um den 8 1986 - Papst Johannes Paul II. bekräftigt die Existenz des Satans
Rom-Vatikan * Papst Johannes Paul II. bekräftigt die Existenz des Satans.
„Hexenangst“ ist aber beileibe keine rein katholische Angelegenheit.
„Hexenglauben“ findet sich auch unter Protestanten.
Vor allem pietistisch geprägte Richtungen innerhalb der protestantischen Konfession bejahen eine angstbesetzte Vorstellung vom „Teufel“.
20. 9 1986 - Konstantin Wecker: „Sogar die Wiesn is ma no ned zwida ...“.
München-Theresienwiese * Konstantin Wecker dichtet und singt:
„Sogar die Wiesn is ma no ned zwida
do nimm i ma jeds Jahr a paar Tag frei
do triff i hoid de oidn Freinderl wieda
natürlich Augustiner, Schenke 2“.
Der Text stammt von seiner CD „Wieder dahoam“.
10 1986 - Tschernobyl beschleunigt die zähen Verhandlungen mit der Stadt
München-Untergiesing * Tschernobyl beschleunigt auch die zähen Verhandlungen mit der Stadt, sodass ein auf dreißig Jahre befristeter Pachtvertrag unterschrieben werden kann.
12. 10 1986 - Ergebnis der Landtagswahl 1986
Freistaat Bayern - München * Franz Joseph Strauß wird zum dritten Mal Ministerpräsident und kann
- mit 128 CSU-Abgeordneten
- gegen 61 SPD- und
- 15 Grüne-Abgeordnete regieren.
Die SPD büßt 4,4 Prozent ein, die CSU 2,5 Prozent. Die Grünen schaffen mit 7,5 Prozent den Einzug in den Bayerischen Landtag ohne Schwierigkeiten.
1987 - Die „Kaulbach-Villa“ wird vom „Freisstaat Bayern“ renoviert
München-Maxvorstadt * Die „Kaulbach-Villa“ wird vom „Freisstaat Bayern“ renoviert.
1987 - Die Landeshauptstadt München kauft das Karl-Valentin-Geburtshaus
München-Au * Weinbergers Familienbesitz in der Zeppelinstraße 41 geht an die Landeshauptstadt München über.
1987 - Die „Milchhof München GmbH“ wird liquidiert
München-Berg am Laim * Die „Milchhof München GmbH“ wird liquidiert.
An dem Grundstück zeigen sich die Firmen Siemens und Bosch interessiert, ziehen sich aber aufgrund des Preises wieder zurück.
1987 - In der „DDR“ wird die Todesstrafe abgeschafft
Deutsche Demokratische Republik - DDR * In der „Deutschen Demokratischen Republik - DDR“ wird die Todesstrafe abgeschafft.
Bis dahin wurden etwa 200 Todesurteile ausgesprochen und davon circa 130 vollstreckt.
1987 - Aids als „Symptom einer maroden Gesellschaft“ bezeichnet
München * Kultusminister Hans Zehetmair greift zum Vokabular des Herrenmenschen:
- Aids ist das „Symptom einer maroden Gesellschaft“.
- Homosexualität gehört in den „Randbereich der Entartung“.
- „Das Umfeld der ethischen Werte muss wiederentdeckt werden, um diese Entartung auszudünnen“.
- „Es geht darum, dass dies contra naturam ist - naturwidrig“.
- „Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden!“
1987 - München hat 1.185.421 Einwohner
München * München hat 1.185.421 Einwohner.
25. 1 1987 - Ergebnis der Bundestagswahl 1987
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 11. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl 44,3 Prozent [- 4,5] und 234 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Johannes Rau erringt 37,0 Prozent der Stimmen [- 1,2] und 193 Sitze.
- Die FDP bekommt 9,1 Prozent [+ 2,1] und 48 Sitze.
- Die Grünen kommen mit 8,3 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 2,7] und 44 Sitzen in den Deutschen Bundestag.
Helmut Kohl wird Bundeskanzler einer Koalition bestehend aus CDU/CSU und FDP.
26. 2 1987 - Peter Gauweilers Anti-Aids-Regelungen
München * Peter Gauweiler, CSU-Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, setzt sich für scharfe Anti-Aids-Regelungen in Bayern ein - mit Zwangstests für Prostituierte, Drogenabhängige und angehende Beamte. Er bezeichnet an Aids erkrankte Personen als Aussätzige.
26. 2 1987 - Horst Seehofer will Aids-Kranke „konzentrieren“
Bonn * Horst Seehofer, aufstrebender CSU-Bundestagsabgeordneter, wird im Stern zitiert, dass er Aidskranke „in speziellen Heimen“ sammeln, sogar „konzentrieren“ will.
Später lässt Seehofer übrigens ausrichten, dass man damals in der Aids-Politik noch auf der „Suche nach dem richtigen Weg“ gewesen sei. Der damalige Weg wäre inzwischen „längst überholt“.
12. 3 1987 - Der Europäische Gerichtshof entscheidet für die Importfreiheit
Luxemburg * Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheidet für die Importfreiheit. Damit darf Bier aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft auch in die BRD gebracht und vertrieben werden. Auch dann, wenn es dem Bayerischen Reinheitsgebot nicht entspricht.
6. 4 1987 - Die Mälzerei des Hofbräukellers brennt ab
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * Die denkmalgeschützte Mälzerei des Hofbräukellers brennt ab. Der Sachschaden wird mit 14 Millionen DMark beziffert.</p>
1. 5 1987 - Papst Johannes Paul II. spricht Edith Stein in Köln „selig“
Köln * Papst Johannes Paul II. spricht Edith Stein in Köln „selig“.
3. 5 1987 - Papst Johannes Paul II. spricht Pater Rupert Mayer „selig“
München - Oberwiesenfeld * Papst Johannes Paul II. spricht Pater Rupert Mayer im Münchner Olympiastadion „selig“.
Er besucht zuvor die „Bürgersaalkirche“.
19. 5 1987 - Bayern beschließt einen Anti-Aids-Maßnahmenkatalog
München * Auf Betreiben von Peter Gauweiler, CSU-Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, beschließt Bayerns Regierung unter der Führung von Franz Josef Strauß einen umstrittenen, bundesweit einmaligen Anti-Aids-Maßnahmenkatalog. Damit soll Bayern zum Vorbild eines „europäischen Hygienekreises“ werden (Franz Josef Strauß).
19. 9 1987 - Stephanie Spendler beginnt auf der Wiesn zu arbeiten
München-Theresienwiese * Stephanie Spendler, die Tochter von Christa und Wiggerl Hagn, beginnt auf der Wiesn zu arbeiten.
19. 9 1987 - Es darf nur Münchner Bier ausgeschenkt werden
München-Theresienwiese * Nachdem sich in den 1980er-Jahren mit der „Prinz Luitpolds Weisse Bräu GmbH“ aus Kaltenberg eine weitere Brauerei auf der Wiesn etablieren wollte, ergänzt der Verein Münchner Brauereien e.V. seine Betriebsvorschriften für das Oktoberfest:
„Das Oktoberfest ist das traditionelle Münchner Volksfest mit Münchner Gastlichkeit und Münchner Bier. Diese Tradition gilt es weiter zu wahren. An Wies‘n-Besucher darf deshalb nur Münchner Bier der leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsunternehmen ausgeschenkt werden“.
1. 10 1987 - Die Landeshauptstadt München kauft das Karl-Valentin-Geburtshaus
München-Au * Die Landeshauptstadt München [Kulturreferat] kauft das Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 um 1,6 Millionen DMark und lässt es sofort unter Denkmalschutz stellen.
Ab 11 1987 - Günter Tremmel baut am Auer Mühlbach ein Kleinkraftwerk
München-Untergiesing * Günter Tremmel baut bis zum Frühjahr 1988 ein damals einzigartiges, wasserbetriebenes Kleinkraftwerk, das mit seinen zwei Turbinen jährlich circa 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt, die in das Netz der „Stadtwerke“ eingespeist werden.
Mit dieser privaten Initiative erreicht der Mechanikermeister, dass etwa 620 Münchner Haushalte mit elektrischer Energie versorgt werden können. Die 850.000 DMark teuere Investition benötige rund fünfzehn Jahre, bis sie schwarze Zahlen schreibt.
Doch Günter Tremmel sieht in dem Kraftwerk mehr die Verwirklichung eines privaten Traumes und eine energiepolitische Zeichensetzung, als eine wirtschaftliche Investition.
An der Südseite des Kleinkraftwerkes finden sich deshalb folgende Zeilen:
„Untätig war des Wassers Lauf -
und niemand achtete darauf
Hier war die Wasserkraft vergessen,
weil von Atomkraft man besessen
Was doch des Menschen stolzer Wahn
in der Natur zerstören kann
Das möge man bedenken;
in Zukunft sollte die Vernunft uns lenken
Vergeßt nicht unsere Wasserkraft
und laßt sie uns erhalten -
Das mahnten schon die Alten.“
2. 11 1987 - George Harrison: „Cloud Nine“
Großbritannien * Mit „Cloud Nine“ kommt eine neue George-Harrison-Platte auf den Markt.
16. 12 1987 - Erich Riedl will Aids-Kranke „absondern“
<p><em><strong>Bonn</strong></em> * Der CSU-Politiker Erich Riedl spricht in der Münchner Abendzeitung im Zusammenhang mit Aids-Erkrankten von <em>„absondern“</em>. </p>
1988 - Der neubarock ummantelte Kamin des Muffatwerks wird renoviert
München-Haidhausen * Der neubarock ummantelte Kamin des Muffatwerks wird für fast 2 Millionen DMark renoviert.
1988 - Georg Welsch entdeckt den Vertragsbruch des Deutschen Alpenvereins
München-Lehel - Praterinsel * Kommunalreferent Georg Welsch entdeckt den Vertragsbruch des Deutschen Alpenvereins, der auf der Praterinsel statt eines Alpinen Museums die Hauptverwaltung des DAV eingerichtet hat. Welsch droht dem Verein mit der ortsüblichen Miete.
1988 - Die Museum-Lichtspiele kommen in den Genuss der Filmtheater-Prämie
München-Au * Die Museum-Lichtspiele kommen - neben weiteren Münchner Filmtheatern - in den Genuss der Filmtheater-Prämie in Höhe von 10.000 DMark. Oberbürgermeister Georg Kronawitter kann den Preis übergeben.
Bundesweit werden 98 Kinos ausgezeichnet. Doch an keinen Ort gehen mehr Auszeichnungen wie an München.
1988 - Eine umfassende Generalsanierung der Heilig-Kreuz-Kirche beginnt
München-Obergiesing * Eine umfassende Generalsanierung der Heilig-Kreuz-Kirche beginnt. Sie wird erst 27 Jahre später [November 2015] abgeschlossen sein.
1988 - Polt - Schneeberger - Hildebrandt: „Man spricht deutsh“
München * Dieter Hildebrand spielt an der Seite von Gerhard Polt und Gisela Schneeberger in dem Film „Man spricht deutsh“.
1988 - Die Zahl der Einwohner im Lehel hat sich auf 13.479 reduziert
München-Lehel * Die Zahl der Einwohner im Lehel hat sich auf 13.479 reduziert.
21. 2 1988 - Ein Gedenkstein für den Freistaat-Gründer
München-Kreuzviertel * Um das sich hinziehende Verfahren zu beschleunigen, greifen die Aktivisten des Vereins „Das andere Bayern“ erneut ein und führen wiederholt eine Kunst-Aktion Kurt Eisner durch. Sie setzen einen eigens gestalteten Gedenkstein in die Mitte des Gehwegs an der Kardinal-Faulhaber-Straße. Wieder an der Ermordungsstelle Kurt Eisner, also am authentischen Ort.
Der Gedenkstein wird von der Polizei als Beweismittel beschlagnahmt. Daraufhin schenken ihn die Aktivisten der Landeshauptstadt München. Er befindet sich seither in der städtischen Asservatenkammer.
8. 3 1988 - Neue Beatles-Langspielplatten mit alten Hits
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong><em> * „Past Masters Vol. 1 & 2“</em> ist in den Schallplattenläden erhältlich. Die LPs enthalten in nahezu chronologischer Reihenfolge die nur auf Singles erschienenen Songs der Beatles. </p>
9. 3 1988 - Kurt Georg Kiesinger stirbt in Tübingen
Tübingen * Kurt Georg Kiesinger, der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, stirbt in Tübingen.
24. 3 1988 - Die U 5 wird bis zum Laimer Platz verlängert
München * Die U 5 wird bis zum Laimer Platz verlängert.
24. 7 1988 - Ein bisher noch nie erlebter Verlust von Altbäumen
München-Englischer Garten * Ein Gewittersturm und das große Ulmen-Sterben fordert im Englischen Garten einen bisher noch nie erlebten Verlust von Altbäumen. Die Abendzeitung ruft anschließend zu einer Baumspendeaktion auf. Damit können über 4.000 Bäume gepflanzt werden.
17. 9 1988 - Franz Josef Strauß verzichtet auf die Teilnehme beim Wiesn-Anzapfen
München-Theresienwiese * Ministerpräsident Franz Josef Strauß verzichtet auf die Teilnehme beim Oktoberfest-Anzapfen im Schottenhamel-Festzelt und eröffnet dafür lieber einen Korbmarkt im oberfränkischen Lichtenfels. Strauß hat sicher bemerkt, dass ihm bei dieser Prozedur nur eine Statistenrolle zugewiesen ist.
17. 9 1988 - Manfred Vollmer übernimmt die Augustiner-Festhalle
München-Theresienwiese * Manfred Vollmer übernimmt die Augustiner-Festhalle auf der Wiesn.
17. 9 1988 - Erstmals heißts auf der Wiesn: Wegen Überfüllung geschlossen
München-Theresienwiese * Erstmals werden auf dem Oktoberfest die Türen der Festzelte „Wegen Überfüllung geschlossen“.
3. 10 1988 - Ministerpräsident Franz Josef Strauß stirbt in Regensburg
Regensburg * Während der Legislaturperiode stirbt Ministerpräsident Franz Josef Strauß an den Folgen eines Kreislaufkollapses, den er zwei Tage zuvor bei einem Jagdausflug erlitten hat. Sein Nachfolger wird Finanzminister Max Streibl.
Um den 3. 10 1988 - Das Kurt-Eisner-Denkmal von Erika Maria Lankes wird akzeptiert
München * Im Bauausschuss einigt man sich, den Entwurf der Münchner Künstlerin Erika Maria Lankes für ein Kurt-Eisner-Denkmal zur Annahme zu empfehlen. Die prinzipiellen Bedenken gegen ein „Denkmal für einen Bürgerschreck“ sind in der Zwischenzeit offensichtlich überwunden.
Herausgekommen ist ein für Bayern typischer politischer Kuhhandel: ein ebenerdiges Bodendenkmal, eine lebensgroße in Eisen gegossene Umrisszeichnung des erschossenen Ministerpräsidenten auf dem Gehweg. Damals ist noch nichts von dem Hauptargument der Verhinderer der Stolpersteine zu hören, dass Antidemokraten und Faschisten ihre Springerstiefeln an dem ermordeten jüdischen Sozialdemokraten abwischen könnten.
21. 10 1988 - Die Traveling Wilburys veröffentlichen ihre erste CD
Großbritannien * Die Traveling Wilburys veröffentlichen ihre erste CD. Die Bandmitglieder verbergen sich hinter Pseudnymen:
- George Harrison als Nelson Wilbury,
- Bob Dylan als Lucky Wilbury,
- Jeff Lynne als Otis Wilbury,
- Tom Petty als Charlie T. Jnr. Wilbury und
- Roy Orbison, der nur bei der ersten CD teilnimmt, als Lefty Wilbury.
27. 10 1988 - U 5 zum Innsbrucker Ring. U 4 zum Arabellapark
München-Berg am Laim - München-Bogenhausen * Die U 5 fährt jetzt bis zum Innsbrucker Ring. Die neue Linie U 4 bindet den Arabellapark an.
6. 12 1988 - Der Rockstar Roy Orbison stirbt
Hendersonville * Der Rockstar Roy Orbison stirbt im Alter von 52 Jahren.
31. 12 1988 - Der Englische Garten hat eine Größe von 373,44 Hektar
München-Englischer Garten * Der Englische Garten hat eine Größe von 373,44 Hektar. Zum Vergleich:
- Central-Park in New York = 335 Hektar,
- Hyde-Park in London = 125 Hektar.
1989 - Beginn der Sanierung des „Blockhauses“ am „Am Mühlbach 4a“
München-Untergiesing * Alfons Scharf beginnt mit der Sanierung seines in „Blockbauweise“ erbauten Hauses „Am Mühlbach 4a“ aus dem Jahr 1860.
1989 - Das „Tivoli-Kraftwerk“ speist in das öffentliche Stromnetz ein
München-Englischer Garten - Hirschau * Das „Tivoli-Kraftwerk“ speist 690 Kilowattstunden in das öffentliche Stromnetz ein.
2. 2 1989 - Der Bauausschuss stimmt dem ebenerdigen Bodendenkmal zu
München * Der Bauausschuss stimmt dem ebenerdigen Bodendenkmal für den ermordeten Ministerpräsidenten Kurt Eisner am authentischen Ort zu. Die vorgebrachten Argumente, dass die Bürger Kurt Eisner nun mit ihren Füßen treten und ihn einfach „übergehen“ können, zählen noch sehr wenig. Wichtig ist, dass sich eine Änderung der Straßenführung erübrigt und keine Parkplätze wegfallen.
1. 5 1989 - Das „Revolutions-Denkmal“ erhält seine Inschrift zurück
München-Obergiesing * Der im „Ostfriedhof“ befindliche Gedenksteins in Würfelform stellt das Denkmal für die „Toten der Revolution - 1919“ dar.
Es trägt nun am Sockel auch wieder den Vers von Ernst Toller, auf den nach der Wiederherstellung in den 1950er Jahren zunächst verzichtet worden war.
Er heißt: „Wer die Pfade bereitet, stirbt an der Schwelle, doch es neigt sich vor ihm in Ehrfurcht der Tod“.
6 1989 - Den „Herbergenhof“ beziehen vier Künstlerinnen
München-Haidhausen * Die für 2,3 Millionen DMark renovierten Herbergshäuser an der Preysingstraße stammen aus dem Jahr 1840.
Im „Herbergenhof“ leben derzeit vier Künstlerinnen.
16. 7 1989 - Wiederbelebung des Kocherlballs am Chinesischen Turm
München-Englischer Garten - Lehel * Zur 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens wird die Tradition des Kocherlballs am Chinesischen Turm wiederbelebt. An jedem dritten Sonntag im Juli, um 6 Uhr früh, treffen sich Münchner Traditionalisten und sonstiges Partyvolk zum Tanz bei Volksmusikklängen. Um 10 Uhr endet die Veranstaltung.
16. 9 1989 - Toni und Christl Roiderer übernehmen das Hacker-Festzelt
München-Theresienwiese * Toni und Christl Roiderer übernehmen das Hacker-Festzelt.
16. 9 1989 - Richard Süßmeier bewirbt sich - erfolglos - um das Hacker-Festzelt
München-Theresienwiese * Richard Süßmeier bewirbt sich um das Hacker-Festzelt, doch CSU und SPD stimmengeschlossen gegen ihn. Und das, obwohl ihn ein Gericht
- vom Vorwurf des Schankbetrugs frei spricht und
- das Verfahren wegen illegaler Beschäftigung mit einer freiwilligen Geldbuße in Höhe von 100.000 DMark endet.
Seit 18. 9 1989 - Regine Sixt lädt prominente Frauen in die Löwenbräu-Festhalle
München-Theresienwiese * Regine Sixt lädt jedes Jahr prominente Frauen in die Löwenbräu-Festhalle.
18. 9 1989 - Münchens Städtepartnerschaft mit Cincinnati
München - Cincinnati * Die amerikanische Stadt Cincinnati wird zur Münchner Partnerstadt erwählt. In Cincinnati findet jährlich rund um den Davidson-Brunnen das größte Oktoberfest der Vereinigten Staaten statt.
10 1989 - Der „Dienstleistungsabend“ wird eingeführt
München * Als „Dienstleistungsabend“ wird der lange Donnerstag bis 20.30 Uhr eingeführt.
Die betroffenen Beschäftigten sprechen vom „SchlaDo“ [Scheiß langer Donnerstag].
6. 10 1989 - Münchens Städtepartnerschaft mit Kiew
München - Kiew * Zwischen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und München wird eine Städtepartnerschaft gegründet. Bei der Auswahl geht es dem Stadtrat um eine politische Entspannung und die Ost-West-Annäherung.
11. 10 1989 - Hannes König, der Gründer des Valentin-Musäums, stirbt
München * Hannes König, der Gründer des Valentin-Musäums, stirbt. An seinem Grab spielt man die Internationale. Gudrun Köhl leitet das Valentin-Karlstadt-Musäum bis zum 1. November 2004 weiter.
23. 10 1989 - George Harrison: „The Best of Dark Horse 1976 - 1989“
Großbritannien * Die LP „The Best of Dark Horse 1976 - 1989“ von George Harrison wird veröffentlich. Neben bereits Bekanntem sind einige neue Lieder auf der LP.
28. 10 1989 - Die U 3 fährt nun zur Forstenrieder Allee
München * Die U 3 fährt nun von der Implerstraße zur Forstenrieder Allee.
7. 11 1989 - Das Kurt-Eisner-Denkmal in der Kardinal-Faulhaber-Straße wird eingeweiht
München-Kreuzviertel * Das Kurt-Eisner-Denkmal in der Kardinal-Faulhaber-Straße wird eingeweiht. Die Festrede hält Bürgermeister Dr. Klaus Hahnzog [SPD].
9. 11 1989 - Die Berliner Mauer fällt
Berlin * Die Berliner Mauer fällt.
1990 - Neue „Wirtsleute“ im „Paulaner am Nockherberg“
München-Au * Peter und Arabella Pongraz werden „Wirtsleute“ im „Paulaner am Nockherberg“.
1990 - Der „Müll“ hat sich gegenüber 1970 verdoppelt
München * Der „Müll“, der an die „Verbrennungsanlagen“ und „Deponien“ angeliefert wird, hat sich gegenüber 1970 verdoppelt.
17. 1 1990 - Landgericht München: „Das Oktoberfest ein Fest des Münchner Bieres“
München - München-Theresienwiese * Prinz Luitpold von der Kaltenberger Brauerei richtet im Bamberger Haus in München eine Hausbrauerei ein, um dort Münchner Bier zu brauen und über diesen Weg auf die Wiesn zu kommen. Seine Klage vor dem Landgericht München wird jedoch abgewiesen. In der Urteilsbegründung heißt es ausdrücklich, dass „das Oktoberfest ein Fest des Münchner Bieres ist“.
28. 2 1990 - Der Orkan Wiebke wütet über Deutschland
Deutschland - Schweiz - Österreich - München-Englischer Garten * Der Orkan „Wiebke“ wütet über Deutschland, Teilen der Schweiz und Österreichs. In der Folge fallen rund 70 Millionen Festmeter Sturmholz an, was ungefähr der doppelten Holzmenge entspricht, die üblicher Weise im normalen Holzeinschlag erarbeitet wird. Auch der Baumbestand im Englischen Garten ist stark betroffen.
18. 4 1990 - Emil Karl Maenner stirbt in Wien
Wien * Emil Karl Maenner stirbt in Wien.
14. 7 1990 - Walter Sedlmayr wird ermordet in seiner Wohnung gefunden
München * Walter Sedlmayr wird blutüberströmt in seiner Wohnung gefunden. Er ist mit einem Hammer erschlagen und mit einem Küchenmesser erstochen worden.
Schnell stehen seine homosexuellen Neigungen im Vordergrund des Interesses. Nach aufwändigen Ermittlungen werden Sedlmayrs Freund und Geschäftspartner Wolfgang W. und dessen Bruder Manfred L. verhaftet und in einem Indizienprozess verurteilt.
9 1990 - Die „Parkanlage am Tassiloplatz“ ist mit Schwermetallen verseucht
München-Au * Als die „Parkanlage am Tassiloplatz“ erneuert werden soll, stellt man fest, dass im Erdreich Altablagerungen unbekannter Ausdehnung vorhanden sind.
Die Ablagerungen erstrecken sich bis in eine Tiefe von 5,70 Metern und umfassen den gesamten Tassiloplatz.
Im Krieg wurde aus dem Loch Kies für die Erweiterung des Ostbahnhofs entnommen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Loch als Mülldeponie.
Dort wurden auf einer Fläche von 9.000 Quadratmetern Bauschutt, Metall- und Teerreste sowie Schlackereste und Hausmüll abgelagert.
Die chemische Analyse erbringt unter anderem die Schwermetalle Zink, Blei und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in grenzüberschreitenden Konzentrationen zutage, die eine akute Gefahr für das Grundwasser, aber auch für Kinder und Erwachsene, darstellt.
Die Anwohner der Hochau und die Betreiber der umliegenden Kindergärten befürchten das „Aus“ für den viel besuchten und einzigen Spielplatz der Oberen Au.
Wohl auch deshalb haben Anwohner am versperrten Eingang an der Welfenstraße das Schild: „Wegen Sanierung geschlossen” überklebt und erbost darüber geschrieben: „Vor den Anwohnern geschützt”.
22. 9 1990 - Peter Inselkammer wird Wiesnwirt im Armbrustschützenzelt
München-Theresienwiese • Peter Inselkammer wird Wiesnwirt im Armbrustschützenzelt. Er hat sich 18 Jahre um eine Konzession beworben. Peter Pongraz kommt zwar auch in die Endauswahl, kann sich aber nicht durchsetzen.
3. 10 1990 - Die deutsche Wiedervereinigung
Bundesrepublik Deutschland * Die deutsche Wiedervereinigung.
14. 10 1990 - Bei der Landtagswahl erhält die CSU 54,9 Prozent
Freistaat Bayern * Bei der Landtagswahl erhält die CSU 54,9 Prozent.
6. 11 1990 - Das zweite Album der Traveling Wilburys
Großbritannien * Das zweite Album der Traveling Wilburys kommt als „Vol. 3“ in die Plattenläden. Wieder verbergen sich die Bandmitglieder hinter Pseudonymen: diesmal George Harrison als Spike Wilbury, Bob Dylan als Boo Wilbury, Jeff Lynne als Clayton Wilbury, Tom Petty als Muddy Wilbury. Das Album ist dem verstorbenen Lefty Wilbury (Roy Orbison) gewidmet.
2. 12 1990 - Ergebnis der Bundestagswahl 1990
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Die Bundestagswahl 1990 steht massiv unter dem Eindruck der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.
Bei der Wahl zum 12. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl 43,8 Prozent [- 0,5] und 319 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine erringt 33,5 Prozent der Stimmen [- 3,5] und 239 Sitze.
- Die FDP bekommt 11,0 Prozent [+ 1,9] und 79 Sitze.
- Die Grünen kommen auf 3,8 Prozent der abgegebenen Stimmen [- 4,5] und ziehen deshalb nicht in den Deutschen Bundestag ein.
- Die PDS erkämpft nur 2,4 Prozent der Stimmen und verfehlt damit bundesweit die Fünf-Prozent-Hürde. Es ist aber vor der Wahl vereinbart worden, dass es genügt, nur in einem der beiden Wahlgebiete diese Klausel zu überspringen. Und das gelingt der PDS in den neuen Bundesländern unproblematisch. Die Partei erhält dadurch 17 Sitze.
- Das Gleiche gilt für die nur in der ehemaligen DDR antretendem Bündnis 90. Es erhält nur 1,2 Prozent vom Stimmenanteil, zieht aber mit acht Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Helmut Kohl wird Bundeskanzler einer Koalition bestehend aus CDU/CSU und FDP.
3. 12 1990 - Die Grünen und das Bündnis 90 schließen sich zusammen
Bundesrepublik Deutschland * Die westdeutschen Grünen und das ostdeutsche Bündnis 90 schließen sich zum Bündnis 90/DIE GRÜNEN zusammen.
1991 - Der „Sitz des Templer-Ordens“ ist in Jerusalem
Jerusalem * Der „Sitz des Templer-Ordens“ ist in Jerusalem.
1991 - Direktor Ferdinand Schmid geht in den Ruhestand
München * Ferdinand Schmid, der Direktor der „Augustiner-Bräu Wagner K.G.“, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
1991 - Umbenennung in „Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik (MSK)“
München-Kreuzviertel * Umbenennung der „Münchner Wehrkundetagung“ in „Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik (MSK)“.
1991 - Ein „Bugatti Royale Typ 41“ für über 10 Millionen US-Dollar versteigert
Atlanta * Bei einer Auktion in Atlanta (USA) überschreitet die Bietersumme für einen „Bugatti Royale Typ 41“ die Marke von 10 Millionen US-Dollar.
Ein nicht genannter Japaner erhält den Zuschlag.
Den „Bugatti Royale“ verehren Liebhaber noch heute als „das schönste Auto der Welt“.
6. 5 1991 - Der Bayerische Rundfunk startet sein Programm B5 aktuell
München * Der Bayerische Rundfunk startet sein Programm „B5 aktuell“. Es ist die erste bundesdeutsche Informationswelle.
21. 9 1991 - Die Mass Wiesn-Bier kostet stattliche 8,55 DMark
München-Theresienwiese • Die Mass Wiesn-Bier kostet stattliche 8,55 DMark.
4. 10 1991 - Die Rocky Horror Pictures Show im Guiness-Buch der Rekorde
München-Au * 15 Jahre nachdem der Film Rocky Horror Pictures Show in den Museum-Lichtspielen angelaufen war, feiern die Fans den Kino-Weltrekord im Guiness-Buch der Rekorde.
24. 11 1991 - Freddie Mercury, Leadsänger von „The Queen“, stirbt an Aids
<p><strong><em>London</em></strong> * Freddie Mercury, der Leadsänger und Komponist von <em>„The Queen“</em>, stirbt in Kensington, London, an Aids. </p>
20. 12 1991 - Der Jugendstil-Verein wird aufgelöst
München-Haidhausen * Der Stuck-Jugendstil-Verein wird aufgelöst. Hans Joachim und Amélie Ziersch schenken die Villa Stuck an die Landeshauptstadt München. Zudem stellen sie eine beträchtliche Geldsumme als „Zustiftung Ziersch“ zur Verfügung. Mit deren jährlichen Zinsen sollen Ankäufe von Kunstwerke ermöglicht werden.
Ab 1992 - Der „Bundesfinanzhof“ bekommt einen Erweiterungsbau
München-Bogenhausen * Errichtung eines Erweiterungsbaues zur Unterbringung der Bibliothek und der Dokumentationsstelle des „Bundesfinanzhofs“ in der Ismaninger Straße.
??? 1992 - In Berg am Laim werden „Bio- und Papiertonnen“ aufgestellt.
München-Berg am Laim * In Berg am Laim werden - als Modellversuch - „Bio- und Papiertonnen“ aufgestellt.
??? 1992 - Der „Kögelmühlbach“ wird wiederbelebt
München-Graggenau * Mit dem Bau der „Bayerischen Staatskanzlei“ wird der „Kögelmühlbach“ wiederbelebt.
??? 1992 - Dieter Hildebrandt erhält die Medaille „München leuchtet“ in Gold
München * Dieter Hildebrandt erhält die Medaille „München leuchtet“ in Gold.
23. 1 1992 - Das Karl-Valentin-Geburtshaus soll verkauft werden
München - München-Au * Weil die Sanierung des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 nicht finanziert werden kann, beschließt der zuständige Kultur-Ausschuss den Verkauf des Anwesens.
14. 2 1992 - Der „AFN“ stellt seinen Betrieb in der Kaulbachstraße 45 ein
München-Maxvorstadt * Der „AFN“ stellt nach dem endgültigen Abzug der US-Streitkräfte seinen Betrieb in der Kaulbachstraße 45 ein.
1. 3 1992 - Instandsetzungs- und Erweiterungsplanungen für die Villa Stuck
München-Haidhausen * Die Planungen der Instandsetzung und Erweiterung der Villa Stuck beginnen.
4. 3 1992 - SPD-Landesvorsitzende Renate Schmidt als Krampfhenne verunglimpft
Passau * Ministerpräsident Max Streibl bezeichnet die SPD-Landesvorsitzende Renate Schmidt beim Politischen Aschermittwoch in Passau als „Krampfhenne“.
2. 4 1992 - Sanierung des „Karl-Valentin-Geburtshauses“ nicht finanzierbar
<p><strong><em>München-Au</em></strong> * Der Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 wird beschlossen, nachdem man den Sanierungsbedarf berechnet hat. Er ist mit 6 Millionen DMark für die Stadt München nicht finanzierbar. </p>
18. 4 1992 - Verkaufsinserat für das „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der SZ abgedruckt
München-Au * Ein Verkaufsinserat für das „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der Zeppelinstraße 41 wird in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt.
24. 4 1992 - Bayern hat die meisten Hexengläubigen
München * Die Münchner Abendzeitung meldet, dass 16 Prozent der erwachsenen Bundesbürger an die reale Existenz von Hexen glauben. Bayern steht mit der höchsten Zahl von Hexengläubigen an der Spitze.
11. 6 1992 - Antrag zu den zur Sanierung anstehenden Herbergshäuser
München-Haidhausen - München-Au - München-Giesing * Die Haidhauser Bezirksausschussvorsitzende und Münchner Stadträtin, Adelheid Dietz-Will, stellt den Antrag, dass die zur Sanierung anstehenden Herbergshäuser bevorzugt an Haidhauser Handwerker vergeben werden. Oberbürgermeister Christian Ude setzt den sogenannten Herbergen-Beschluss im Jahr 1994 um.
13. 7 1992 - George-Harrison-LP: Live in Japan
Großbritannien * Die George-Harrison-LP Live in Japan, die er mit Eric Clapton und dessen Band auf der Tournee aufgenommen hat, kommt in die Plattenläden.
1. 9 1992 - Der neue 1. Stadtbezirk - Altstadt-Lehel
München-Graggenau - München-Angervierteil - München Kreuzvierzel - München-Hackenviertel - München-Lehel * Der Stadtbezirk 1 - Altstadt wird mit dem Stadtbezirk 13 - Lehel zum neuen 1. Stadtbezirk - Altstadt-Lehel vereinigt.
1. 10 1992 - Das Valentin-Geburtshaus soll an Rudolph Moshammer verkauft werden
München-Au * In einer Beschlussvorlage des Stadtrats wird der Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 an den Modemacher Rudolph Mooshammer vorgeschlagen, wenn der zuständige Bezirksausschuss dem Vorhaben zustimmt.
8. 10 1992 - Willy Brandt stirbt in Unkel
Unkel * Willy Brandt, der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin und Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sowie SPD-Vorsitzende, stirbt in Unkel.
23. 10 1992 - Bezirksausschuss lehnt Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses ab
München-Au * Der Bezirksausschuss Au-Haidhausen lehnt den Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 ab und beantragt die Erstellung eines Sanierungsgutachtens durch die Münchner Gesellschaft für Stadtsanierung - MGS. Bis zur Erstellung des Gutachtens sind alle Verkaufsabsichten zu stoppen.
6. 12 1992 - Lichterkette gegen Ausländerhass
München * 400.000 Münchnerinnen und Münchner protestieren mit Kerzen und Fackeln gegen brutale Übergriffe auf Ausländer.
1993 - Umzug der „Bayerischen Staatskanzlei“ an den „Hofgarten“.
München-Lehel - München-Graggenau * Umzug der „Bayerischen Staatskanzlei“ von der Prinzregentenstraße 9 in die Gebäude am „Hofgarten“.
Die „Bayerische Staatskanzlei“ ist mit 8.800 qm wesentlich größer als das „Weiße Haus“ in Washington (4.800 qm).
1993 - „Senator“ Gratzl ist Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 17/19
München-Maxvorstadt * „Senator“ Gratzl ist Eigentümer der Anwesen Richard-Wagner-Straße 17 und 19.
1993 - Nach Auszug der „Staatskanzlei“ kann die „Schack-Galerie“ Räume nutzen
München-Lehel * Nach dem Auszug der „Bayerischen Staatskanzlei“ kann der ehemalige „Sitzungssaal der Bayerischen Staatsregierung“, von dem aus die Geschicke Bayerns regiert wurden, als „Saal der Altmeister-Kopien“ eingerichtet werden.
1993 - Das „Motorama“ an der Rosenheimer Straße wird eröffnet
München-Au * Das „Motorama“ an der Rosenheimer Straße wird eröffnet.
1993 - Ein Wettbewerb für das Technische Rathaus
München-Berg am Laim * Ein Wettbewerb für ein Verwaltungsgebäude der Landeshauptstadt München an der Friedenstraße 40 wird ausgeschrieben.
1993 - Die „Deutsche Eiche“ soll „entkernt“ und gewinnbringend genutzt werden
München-Isarvorstadt * Das Haus in der Reichenbachstraße 13, in dem sich die „Deutsche Eiche“ befindet, soll „entkernt“ und gewerblich gewinnbringend gestaltet werden.
Nach weltweiten Protesten trennt sich die Grund- und Hausbesitzerin „Monachia“ von der „problematischen Immobilie“.
Dietmar Holzapfel, sein Vater Nicki Holzapfel und Dietmars Partner Josef Sattler kaufen gemeinsam die heruntergekommene und renovieungsbedürftige „Deutsche Eiche“.
1993 - Der „Turmschreiber-Verlag“ wird gegründet
München * Der „Turmschreiber-Verlag“ wird gegründet.
1. 2 1993 - Hinweis auf ein fünf Jahre leerstehendes Anwesen
München-Au * Der Dipl.-Ing. Klaus Schmidt wendet sich an die Stadtbaurätin Christiane Thalgott und macht auf das verwahrloste, seit über fünf Jahren leerstehende Anwesen in der Zeppelinstraße 41 aufmerksam. Die Stadtbaurätin hatte zuvor aufgerufen, dem Planungsamt „verwahrloste Wohnhäuser“ zu benennen.
22. 2 1993 - Beibehaltung des Straßennamens der „Von-Trotha-Straße“ beschlossen
München-Graggenau - München-Trudering * Die Beibehaltung des Straßennamens der „Von-Trotha-Straße“ wird im Stadtrat beschlossen. Die zugehörige Namenserläuterung wird aber derart geändert, dass diese nicht mehr dem General Lothar von Trotha, sondern dem gesamten Adelsgeschlecht der von Trotha gewidmet ist.
5. 4 1993 - Die Münchner Gesellschaft für Stadtsanierung legt ihr Gutachten vor
<p><strong><em>München-Au</em></strong> * Das Sanierungsgutachten der Münchner Gesellschaft für Stadtsanierung - MGS listet die Kosten für die weitere Vorgehensweise mit dem Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 auf. </p> <ul> <li>Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes würde 6 Millionen DMark kosten,</li> <li>ein Teilabbruch und Sanierung kämen auf 5,5 Millionen DMark,</li> <li>ein Abbruch und anschließender Neubau würde mit 5 Millionen DMark zu Buche schlagen. </li> </ul>
27. 4 1993 - Schwierigkeiten mit dem „Karl-Valentin-Geburtshaus“ werden dargelegt
München-Au * Die „Stadtbaurätin“ Christiane Thalgott teilt dem Dipl.-Ing. Klaus Schmidt die Schwierigkeiten mit dem „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der Zeppelinstraße 41 mit.
27. 5 1993 - Ministerpräsident Max Streibl muss wegen der Amigo-Affäre zurücktreten
München-Graggenau * Ministerpräsident Max Streibl muss wegen der sogenannten „Amigo-Affäre“ zurücktreten. Den Ministerpräsidenten-Sessel übernimmt sein Parteifreund Edmund Stoiber.
1. 6 1993 - Über die Ausziehtechniken im Blauen Engel
München-Haidhausen * Die Münchner Abendzeitung schreibt über den soeben geschlossenen Blauen Engel in der Wolfgangstraße in Haidhausen folgende Zeilen:
„Die Ausziehtechniken im Blauen Engel (Marlene Dietrich dreht sich im Grabe um) waren selten ausgereifter als im ‚bumsfidelen Mädchenpensionat‘. Dafür kostete der Eintritt auch nur fünf Mark. Für drei Mark bekam man von der Kathie ein müdes Bier serviert, bevor sie zur Miß Kate mutiert auf der Bühne ihre Version vom Alpensex zeigte. Tja, nun nicht mehr. Gott sei Dank, werden die einen denken, die in der Prolo-Fleischbeschau nichts Lustiges finden konnten. Schade, so die anderen, die angereiste Bekannte mit dem Dirndl-Sex schocken konnten.“
Das Gebäude an der Wolfgangstraße wird anschließend saniert und darin eine andere Gastwirtschaft eröffnet: das Wasserwerk.
7. 6 1993 - Gesuch für eine Abbruchgenehmigung für das Karl-Valentin-Geburtshaus
München-Au * Beim Planungsreferat wird um eine Abbruchgenehmigung für das Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 ersucht.
30. 6 1993 - Der Dipl.-Ing. Klaus Schmidt will die Verkaufskonditionen wissen
München-Au * Der Dipl.-Ing. Klaus Schmidt tritt an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung heran, um die Konditionen für einen möglichen Erwerb des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 zu erfahren.
30. 6 1993 - Die zweite Amtszeit von Georg Kronawitter [SPD] als OB endet
München • Die zweite Amtszeit von Georg Kronawitter [SPD] als Münchner Oberbürgermeister endet.
1. 7 1993 - Die Muffathalle wird als Kultur-Projekt betrieben
München-Haidhausen * Die Muffathalle wird als Kultur-Projekt betrieben.
13. 8 1993 - Der Heimatpfleger fordert den Erhalt des Karl-Valentin-Geburtshauses
München-Au * Der Heimatpfleger fordert den Erhalt des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41.
12. 9 1993 - Christian Ude [SPD] wird Münchner Oberbürgermeister
München • Christian Ude [SPD] wird Münchner Oberbürgermeister.
18. 9 1993 - Oberbürgermeister Christian Ude zapft erstmals beim Wiesn-Anstich an
München-Theresienwiese * Oberbürgermeister Christian Ude sticht erstmals zum Oktoberfest-Beginn im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass Wiesnbier an. Alles steht bereit. Die Reporter und die Fernsehkameras sind positioniert. Da ruft der BR-Radioreporter Michael Stiegler plötzlich: „Hoit, des is ja a Linker.“
Damit meint er aber nicht die politische Heimat des Oberbürgermeisters. Christian Ude ist Linkshänder, und deshalb stehen die Medienvertreter alle auf der falschen Seite. Nachdem sich alle umorientiert haben, kann der oberste Stadtrepräsentant seiner Aufgabe nachgehen. Er braucht dazu sieben Schläge.
25. 9 1993 - In der Fischer-Vroni wird der Prosecco-Montag abgehalten
<p><strong><em>München-Theresienwiese</em></strong> * In der Fischer-Vroni wird am zweiten Wiesn-Montag der <em>„Prosecco-Montag“</em> abgehalten. Wolfgang Rachel, der Inhaber der Prosecco-Bar in der Theklastraße, hat den Event ins Leben gerufen. Er reserviert im ersten Jahr vier Tische für seine schwulen Stammgäste. Inzwischen gehört den Homosexuellen am zweiten Wiesn-Montag das ganze Fischer-Vroni-Zelt.</p>
Um 11 1993 - Sechs verschollen geglaubte Fresken wieder entdeckt
München-Maxvorstadt * Im Rahmen der Renovierung werden vier von sechs bereits verschollen geglaubte Fresken im „Lesesaal“ der „Juristischen Fakultät“ der „Ludwig-Maximilians-Universität“ an der Ludwigstraße wiederentdeckt.
Es sind die im Jahr 1938 aus dem „Herzog-Max-Palais“ entfernten und in das „Haus des Deutschen Rechts“ verlegten Fresken von Robert von Langer.
8. 11 1993 - Der CSU-Vorsitzende Theo Waigel drückt sich beim Festakt
München * Der CSU-Vorsitzende Theo Waigel drückt sich am 75. Jahrestag der Revolution und der Freistaatgründung an der Teilnahme eines Festaktes, da er „die Geburtsstunde des demokratisch verfassten Bayern nicht mit der Ausrufung der Räterepublik durch Kurt Eisner in Verbindung zu bringen vermag“.
Zur Ausrufung der Räterepublik kam es allerdings erst nach einer verlorenen Wahl und der Ermordung Kurt Eisners durch den rechtsradikalen Anton Graf Arco auf Valley. Unter Eisners Revolutionsregierung gab es lediglich provisorische Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte.
16. 11 1993 - „... Bayern einen Winter lang vor dem totalen Chaos bewahrt“
München * Klaus Warnecke, Landtagsabgeordneter der SPD schreibt in der Süddeutschen Zeitung einen Leserbrief und bringt darin folgende Meinung zum Ausdruck:
„[...] Die Hindenburgs, Ludendorffs und ihre monarchistischen Attrappen hatten das Volk im Reichsdurchschnitt im Herbst 1918 auf 500 bis 600 Kalorien pro Tag und Nase heruntergehungert. [...] 200.000 bayerische Soldaten waren gefallen. [...]
Während sich die Monarchie von dannen stahl und die Generäle an der Dolchstoß-Legende zu stricken begannen, gab es in München eine einzige Kraft, die halbwegs Ordnung in das Chaos zu bringen versuchte und den Umständen entsprechend auch brachte: die von den Konservativen und Reaktionären aller Richtungen bisher aus jeder politischen Verantwortung ferngehaltenen Sozialdemokraten und deren linkspazifistische Absplitterung die USPD mit Eisner an der Spitze. [...]
Der totale politisch/militärisch/soziale Scherbenhaufen des Winters 1918/19 war das Erbe des Großmachtwahns der Feldmarschälle und Monarchen.
Das Kabinett unter Ministerpräsident Kurt Eisner mit dem Innenminister Erhard Auer und Albert Roßhaupter, die sich auf den eigentlichen Ordnungsfaktor in München, die Arbeiterräte, stützen konnte, hat Bayern einen Winter lang vor dem totalen Chaos bewahrt.
Das wahre Chaos begann erst, als der rechtsradikale Offizier Graf Arco den Pazifisten Kurt Eisner am 21. Februar 1919 auf offener Straße ermordete. [...].“
20. 11 1993 - Die U 2 fährt nun bis zur Dülferstraße
München * Die U 2 zweigt nun vom Scheidplatz zur Dülferstraße ab.
1994 - Pater Anselm Bilgri bietet Sepp Krätz den „Andechser am Dom“ an
München-Kreuzviertel * Der „Prior vom Kloster Andechs“, Pater Anselm Bilgri, bietet Sepp Krätz den „Andechser am Dom“ an.
1994 - Der Gebissersatz Marke Seehofer erhält den Blödsinnstaler
München-Graggenau - München-Angerviertel * Im Valentin-Musäum wird wieder einmal der Blödsinnstaler für den größten Blödsinn des Jahres vergeben. Es ist der „Gebissersatz Marke Seehofer“ - ein Fleischwolf, der die Speisen so zerkleinert, dass sie auch ohne Zähne verspeist werden können.
21. 7 1994 - Der Stadtrat beschließt den Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses
München-Au * Der Stadtrat beschließt mit schwarz-grüner Mehrheit den Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 an Rudolph Moshammer. Sein Konzept sieht folgendermaßen aus: Moshammer will im Valentin-Haus die „längste Theke Münchens“ einrichten. Eine Gaststätte im Vorderhaus mit etwas Wohnraum darüber, ein weiteres Lokal im Bistrostil samt Terrasse, ein Kino oder Theaterraum im Rückgebäude.
8 1994 - Das Wiesnwirte-Ehepaar Weinfurtner verkauft das „Hippodrom“
München-Theresienwiese * Das „Hippodrom“-Wiesnwirte-Ehepaar Marianne und Anton Weinfurtner wird wegen „Steuerhinterziehung“ inhaftiert.
Aus der Zelle heraus verkaufen sie ihr „Wirtezelt“ an die „Vinzenzmurr-Erbin“ Evi Brandl.
Fünf Tage später, kaum dass die Tinte unter dem Vertrag trocken ist, steht auch die „Wurstkönigin“ Evi Brandl unter dem Verdacht des „Steuerbetrugs“.
Sie muss die Geschäftsführung Anton Fichtel überlassen und 500.000 Mark Bußgeld bezahlen.
Ab dem 12. 8 1994 - Das Woodstock-Erinnerungsfestival
Saugerties * In Saugerties, im US-Bundesstaat New York findet zum 25. Jubiläum des Musikfastivals in Woodstock eine Erinnerungsveranstaltung mit etwa 350.000 Teilnehmern statt. Sie dauert bis zum 14. August.
9 1994 - Evi Brandl bietet Sepp Krätz das „Hippodrom“ an
München-Theresienwiese * Evi Brandl, Enkelin des „Vinzenzmurr-Unternehmensgründers“, bietet das „Hippodrom“ Sepp Krätz an.
9 1994 - Siegfried Able betreibt einen „Verzehr-Stand“ auf der „Wiesn“
München-Theresienwiese * Nachdem er zuvor schon in der „Ochsenbraterei“ tätig war, beginnt Siegfried Able seine „Wiesn-Karriere“ mit einem „Verzehr-Stand“.
Gleich gibt es Ärger, weil er sich die dort verkaufte „Ochsensemmel“ umgehend patentieren lässt.
Sicher weis er, dass diese - wenn schon, dann - eine Erfindung des Wirtes der „Ochsenbraterei“, Hermann Haberl, ist.
1. 9 1994 - Die Isar-Amper-Werke werden von der Bayernwerk AG übernommen
München-Maxvorstadt * Die Isar-Amper-Werke werden von der Bayernwerk AG, die damals zur VIAG-Gruppe gehört, übernommen. Finanzanalysten schätzen den Wert auf weit über eine Milliarde DMark.
7. 9 1994 - Der Vertragsentwurf geht an den Modeschöpfer Rudolph Moshammer
München-Au * Der Vertragsentwurf für den Verkauf des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 geht an den Modeschöpfer Rudolph Moshammer.
30. 9 1994 - Bürgerversammlung fordert Räume für die Freunde der Vorstadt Au
München-Au * In der Bürgerversammlung des Bezirksausschusses Au-Haidhausen werden Räume für die Freunde der Vorstadt Au gefordert.
16. 10 1994 - Ergebnis der Bundestagswahl 1994
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 13. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl 41,4 Prozent [- 2,4] und 294 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Rudolf Scharping erringt 36,4 Prozent der Stimmen [+ 2,9] und 253 Sitze.
- Die FDP bekommt 6,9 Prozent [- 4,1] und 47 Sitze.
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN kommen auf 7,3 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 2,2].
- Die PDS erkämpft nur 4,4 Prozent der Stimmen und verfehlt damit bundesweit die Fünf-Prozent-Hürde. Aufgrund der Grundmandatsklausel zieht die Partei trotzdem mit 30 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Helmut Kohl wird erneut Bundeskanzler einer Koalition bestehend aus CDU/CSU und FDP.
1. 12 1994 - Moshammer mit der Unterbringung der Freunde der Au einverstanden
München-Au * Der Modeschöpfer Rudolph Moshammer erklärt sich mit der Unterbringung der Freunde der Vorstadt Au in den Räumen des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 einverstanden. Der Passus wird in dem Vertrag aufgenommen.
1995 - Im Bauhof werden „Trümmer“ des „Siegestores“ entdeckt
München-Maxvorstadt - München-Schwabing - München-Angerviertel * In einem städtischen Bauhof werden die zerstörten „Trümmer“ des „Siegestores“ entdeckt.
Sie sind heute in einem „Lapidarium“, einem kleinen historischen Freilichtmuseum in der Nieserstraße beim Stadtmuseum ausgestellt.
1995 - Das „Badehaus“ der „Deutschen Eiche“ kann eröffnet werden
München-Isarvorstadt * Sonja Reichenbach, die Wirtin der „Deutschen Eiche“ in der Reichenbachstraße 13, gibt auf.
Das Lokal wird geschlossen.
Die neuen Besitzer, Dietmar Holzapfel und Josef Sattler, bauen die Immobilie behutsam um.
Das „Badehaus“ der „Deutschen Eiche“, eine der schönsten und größten Schwulensaunen der Welt, kann eröffnet werden.
Münchens Kreisverwaltungsreferent Hans-Peter Uhl lässt eine Woche vor der Eröffnung der „Schwulensauna“ eine andere schließen.
Auch sein Vorgänger Peter Gauweiler wollte die „Münchner Homo-Szene“ ausmerzen.
1995 - Durch die „Mülltrennung“ hat sich die „Müllmenge“ Münchens fast halbiert
München * Durch die „Mülltrennung“ hat sich die „Müllmenge“ Münchens nahezu halbiert.
1995 - Ein zusätzlicher Kinoraum wird in den „Museum-Lichtspielen“ eingerichtet
München-Au * Ein zusätzlicher Kinoraum wird in den „Museum-Lichtspielen“ eingerichtet.
Damit stehen vier Kinosäle zur Verfügung.
Um 1995 - Das „Postamt 1“ wird Eigentum der „Deutschen Telekom AG“
München-Graggenau * Nach der Privatisierung der „Deutschen Bundespost“ in den 1990er-Jahren wird das „Postamt 1“ Eigentum der „Deutschen Telekom AG“.
Nachdem man die Telefontechnik in einer neuen und platzsparenden Variante in einem Neubau in der Seitzstraße untergebracht hat, verkauft die „Deutsche Telekom Immobilien“ das wohl wertvollste Grundstück Münchens an einen Investor.
1995 - Frauen dürfen erstmals als „Feuerwehrleute“ tätig werden
München * Frauen dürfen erstmals als „Feuerwehrleute“ tätig werden.
1995 - Ein Mahnmal speziell für die Opfer der Sinti und Roma
München-Maxvorstadt * Der Künstler Toni Preis installiert auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus ein Mahnmal speziell für die Opfer der Sinti und Roma.
Ab 1995 - Nachrüstungsarbeiten am Sylvensteinspeicher beginnen
Fall * In den 1970er Jahren beginnenden Diskussionen über den zu erwartenden Klimawandel führen ab dem Jahr 1995 zu Nachrüstungen des Sylvensteinspeichers. Zur zusätzlichen Hochwasserentlastung wird der Damm um weitere drei Meter erhöht.
Um 3 1995 - Sepp Krätz kauft das „Hippodrom-Festzelt“
München-Theresienwiese * Sepp Krätz kauft das „Hippodrom-Festzelt“ der „Vinzenzmurr-Chefin“ Evi Brandl ab, weil diese Probleme mit dem Fiscus hat.
5 1995 - Die „Spatenbrauerei“ beliefert Gaststätten mit Pferdefuhrwerken
München-Neuhausen * Die „Spatenbrauerei“ beliefert Gaststätten in Neuhausen und am Olympiasee mit Pferdefuhrwerken.
5. 5 1995 - „Löwenbräu“ will sich am „Karl-Valentin-Geburtshaus“ beteiligen
München-Au * „Löwenbräu“ will sich am Projekt „Karl-Valentin-Geburtshaus“ in der Zeppelinstraße 41 beteiligen, wenn die Stadt die Gaststättennutzung genehmigt.
12. 5 1995 - Die erste bayerische Biergarten-Revolution
München * Die „Erste bayerische Biergarten-Revolution“ findet am Marienplatz mit rund 25.000 Unterstützern statt.
Der von der Obrigkeit genehmigte Aufstand war allerdings nichts anderes als eine Demonstration.
9 1995 - Sepp Krätz übernimmt das „Hippodrom“ auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese * Sepp Krätz, der Wirt der „Waldwirtschaft“ in Großhesselohe, übernimmt das „Hippodrom“ auf dem Oktoberfest.
Krätz‘ „Wiesn-Festzelt“ hatte keinen Ruf mehr zu verlieren - höchstens einen schlechten.
Selbst der damalige „Kreisverwaltungsreferent“ Hans-Peter Uhl stellte fest, dass dort „1000 Jahre Zuchthaus vereint und Zuhälter ein- und ausgegangen“ sind.
Sepp Krätz muss - auch im Sinne der Stadtverwaltung - für „Ordnung“ sorgen.
Er macht das, indem er seine Wachleute mit Dobermännern und Feuerlöschern auf eine randalierende Meute losgehen lässt, die betrunken Einlass ins Zelt begehrt.
Das aber führt erstmals zu einer Auseinandersetzung mit Oberbürgermeister Christian Ude.
Der frisch gekürte „Wiesnwirt“ führt in seinem „Wirtezelt“ ein neues Reservierungs-System ein:
Gäste, die mit einer Reservierung ins Zelt kommen, erhalten ein grünes Bändchen um den Arm, mit dem der Wiedereinlass garantiert ist, wenn sie mal das Zelt verlassen.
Und dann gibt es noch die goldenen Armbändchen, die zu jeder Zeit den Gang ins „Hippodrom“ sicherstellen.
Es entzündet sich eine große Aufregung um diese „Drei-Klassen-Wiesn“.
Sepp Krätz ist auch der erste „Wiesnwirt“, der in seinem Zelt eine Band statt einer Blaskapelle auftreten lässt.
Und er ist einer der ersten, der dem ewigen Hendl-Schweinswürstl-Leberkäs eine hochwertige Küche entgegensetzt.
Um den 10. 9 1995 - Der Dipl.-Ing. Klaus Schmidt reicht ein Angebot ein
München -München-Au * Die Bewerbung von Dipl.-Ing. Klaus Schmidt für das Karl-Valentin-Geburtshaus wird eingereicht. Er erhöht sein Kaufangebot von damals 800.000 DMark auf die valentieske Summe von 888.888,88 DMark.
23. 9 1995 - Kardinal Wetter heizt die Stimmung gegen das Intoleranzedikt an
München-Graggenau • Bei der an der Feldherrnhalle stattfindenden Demonstration gegen das Karlsruher Kruzifix-Urteil unterzieht sich Kardinal Friedrich Wetter nicht der Mühe, die Debatte zu versachlichen. Im Gegenteil, er heizt die emotional eh schon aufgeheizte Stimmung gegen das vermeintliche Karlsruher Intoleranzedikt noch an.
3. 10 1995 - 80 Ochsen drehen sich am Spieß der Ochsenbraterei
München-Theresienwiese * 80 Ochsen haben sich am Spieß der Ochsenbraterei gedreht.
13. 10 1995 - Zusätzliche Probleme tauchen auf
München-Au * Probleme der Stellplatzablöse, der baurechtlichen Genehmigungen einer Hofüberdachung und des Umfangs der Gaststättennutzung tauchen auf. Inzwischen will der Modemacher Rudolf Moshammer in dem Projekt Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 auch eine Schule für männliche Mannequins unterbringen. Einen konkreten, greifbaren Plan legt Rudolph Moshammer - trotz mehrerer Aufforderungen - nie vor.
28. 10 1995 - U-Bahn-Erweiterungsstrecke nach Garching-Hochbrück
Garching-Hochbrück * Die U-Bahn-Erweiterungsstrecke der U 6 nach Garching-Hochbrück geht in Betrieb. Erstmals überschreitet die U-Bahn die Stadtgrenze.
21. 11 1995 - „The Beatles Anthology“ Teil 1 erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die erste Doppel-CD <em>„The Beatles Anthology“</em> erscheint. Darauf ist der Titel <em>„Free As A Bird“</em>, den John Lennon begonnen und die übrigen Beatles-Mitglieder fertiggeschrieben haben. </p>
12 1995 - Das „Siegestor“ wird bis März 1999 generalsaniert
München-Maxvorstadt - München-Schwabing * Das „Siegestor“ wird bis März 1999 generalsaniert.
vor 1996 - Im „Valentin-Haus“ soll „Münchens längste Theke“ entstehen
München-Au * Rudolph Mooshammer will im „Valentin-Haus“ in der Zeppelinstraße 41 „Münchens längste Theke“ unterbringen.
Die Haidhausen-Auer Stadtteilpolitiker laufen gegen das Projekt Sturm.
Winter 1996 - Der Umbau der E.ON-Verwaltung an der Brienner Straße beginnt
München-Maxvorstadt * Ein umfassender Umbau des Verwaltungsbau-Komplexes der E.ON an der Brienner-/Ecke Richard-Wagner-Straße beginnt.
Nach Abbrucharbeiten entsteht ein neues viergeschossiges Bürogebäude, das diagonal auf eine erdgeschossige „Hofplatte“ gestellt wird. Durch die Schrägstellung des Gebäudes entstehen zwei Freiräume.
Ein überdachter ganzjährig nutzbarer, 950 qm großer Innenhof, die sogenannte „Piazza“. Auf der anderen Seite des Gebäudes entsteht ein Garten.
Unter der „Hofplatte“ liegen die „Tiefgarage“, das „Archiv“ und die „Technikräume“.
Seit 1996 - Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet im 4-Jahres-Turnus statt
München-Theresienwiese * Das „Zentral-Landwirtschaftsfest“ findet im 4-Jahres-Turnus statt.
1996 - Richard Süßmeier zieht sich als aktiver Wirt zurück
München - Grünwald * Richard Süßmeier zieht sich als aktiver Wirt zurück.
1996 - Alle Hotelzimmer der „Deutschen Eiche“ werden aufwändig renoviert
München-Isarvorstadt * Alle Hotelzimmer der „Deutschen Eiche“ in der Reichenbachstraße 13 werden aufwändig renoviert.
1996 - Die Zahl der „Falkner“ in Deutschland liegt bei etwa 2.000
Bundesrepublik Deutschland * Die Zahl der „Falkner“ in Deutschland liegt bei etwa 2.000.
1996 - Das „Internationale Generalsekretariat“ des „Templer-Ritterordens“ in Köln
Köln * Der „Templer-Ritterorden“ nennt sich jetzt „Ordo Militiae Templi Hierosolymitani“ - „Christlicher Ritterorden vom Tempel zu Jerusalem“.
Der Sitz des „Internationalen Generalsekretariats“ ist Köln.
- Der „Orden“ hat circa fünftausend Mitglieder und ist in dreißig „Priorate“ gegliedert.
- An der Spitze der Ordensleitung steht ein „Großmeister“.
- Männer und - inzwischen auch - Frauen können ab dem 18. Lebensjahr „Ordensritter“ und „Ordensdamen“ werden.
- „Ziele des Ordens“, der auch „karitativ tätig“ ist und Einrichtungen in Palästina und Israel unterstützt, sind die „Förderung der Einheit aller Christen“ und der „Erhalt der christlichen Kultur des Abendlandes“.
1996 - Edith Haberland stirbt - Die „Augustiner-Brauerei“ wird eine Stiftung
München * Edith Haberland, die letzte Erbin der „Augustiner-Dynastie“, stirbt.
Zuvor hat sie in ihrem Testament festgelegt, dass die „Augustiner-Brauerei“ in eine Stiftung umgewandelt werden soll.
Chef der „Edith-Haberland-Wagner-Stiftung“ wird der seit 1991 in den Ruhestand versetzte Ferdinand Schmid.
1996 - Die Sanierung der „Parkanlage am Tassiloplatz“ ist abgeschlossen
München-Au * Die Erneuerung und Sanierung der „Parkanlage am Tassiloplatz“ hat - neben einem hohen Finanzaufwand - über fünf Jahre Zeit in Anspruch genommen.
Nach der Sanierung der Park- und Spielanlage muss die gesamte Anlage mit einem halben Meter unbelasteten Mutterboden aufgeschüttet werden.
Damit kann allerdings jede Gefährdung der Kinder und Erwachsenen ausgeschlossen werden.
1. 1 1996 - Adressenänderung der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr
München-Hackenviertel * Der Standort der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr wird von Blumenstraße 34 in An der Hauptfeuerwache 8 umbenannt.
27. 1 1996 - Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Berlin * Bundespräsident Roman Herzog ernennt den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.
4. 3 1996 - „The Beatles Anthology“ Teil 2 erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die zweite Doppel-CD <em>„The Beatles Anthology“</em> erscheint. Darauf ist der Titel <em>„Real Love“</em>, ebenfalls eine Komposition von John Lennon, die die übrigen Beatles-Mitglieder fertiggeschrieben haben.</p>
1. 4 1996 - Münchens Städtepartnerschaft mit Harare
Harare - München * Die in Simbabwe gelegene Stadt Harare geht eine Städtepartnerschaft mit München ein.
Um den 5. 7 1996 - Spitzengespräch beim Oberbürgermeister Christian Ude
München-Au * Die letzten Hürden für das Projekt Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 sollen in einem Gespräch zwischen dem Dipl.-Ing. Klaus Schmidt, Oberbürgermeister Christian Ude und der Stadtspitze beseitigt werden.
Der Au-Haidhauser Bezirksausschuss-Vorsitzende Hermann Wilhelm fordert „alles Nötige zu unternehmen, damit der schon zugesagte Verkauf des Valentinhauses an das Architekturbüro Klaus Schmidt noch vor der Sommerpause notariell abgeschlossen werden kann“.
Um den 1. 9 1996 - Die Verkaufsverhandlungen sind kurz vorm scheitern
München-Au * Beinahe wären die Verkaufsverhandlungen für das Projekt Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 gescheitert. Dipl.-Ing. Klaus Schmidt: „Ich war schon kurz vor dem Hinschmeißen - wegen der Auflagen und der Kosten“.
Nun scheint alles perfekt. Und höchste Zeit ist es geworden. Das Gebäude ist schon 20 Zentimeter in den sandigen Kiesboden eingesackt. Risse durchziehen die Wände. Damit das Haus nicht auseinander fällt, mussten von außen Quer- und Stützbalken angebracht werden.
13. 9 1996 - Der Kunstpark Ost wird eröffnet
München-Berg am Laim * Auf dem 80.000 Quadratmeter umfassenden ehemaligen Pfanni-Gelände an der Grafinger-/Ecke Friedensstraße öffnet der Kunstpark Ost seine Tore. Nach nur kurzer Zeit gilt der Kunstpark als Europas größter Partyzone.
In über dreißig Clubs, Hallen und Kneipen steht der Jugend der Stadt und des Umlands ein Areal für Konzerte, aber auch zum Feiern und Partymachen zur Verfügung. Die Initiative für das Münchner Vergnügungsviertel ging von dem Hallenmogul Wolfgang Nöth aus.
28. 10 1996 - „The Beatles Anthology“ Teil 3 erscheint
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die dritte Doppel-CD der Reihe <em>„The Beatles Anthology“</em> wird veröffentlicht.</p>
1. 11 1996 - Die Ladenöffnungszeiten werden erneut gelockert
München * Die Ladenöffnungszeiten werden erneut gelockert. Während der Woche darf jetzt zwischen 6.00 und 20.00 Uhr, am Samstag bis 16.00 Uhr geöffnet werden. Der „lange Donnerstag“ entfällt.
1997 - Alfons Scharf erhält auch die „Bayerische Denkmalschutzmedaille“
München-Untergiesing* Neben dem „Fassadenpreis“ erhält Alfons Scharf auch die „Bayerische Denkmalschutzmedaille“ für sein Haus „Am Mühlbach 4a“.
1997 - Das „Badehaus“ der „Deutschen Eiche“ wird erweiter
München-Isarvorstadt * Das „Badehaus“ der „Deutschen Eiche“ wird erweitert.
Auf vier Etagen und 1.400 Quadratmeter finden sich eine finnische Sauna, Salzsauna, Whirlpool, ein großes Dampfbad, Duschbereich, Massageräume, Solarium, Dachgarten, Wintergarten, TV-Räume, Einzel- und Exklusivkabinen und ein gemütlicher Bewirtungsbereich.
Im Keller geht es zur Sache. Es gibt „Darkrooms“, in denen sich Paarungswillige vergnügen können.
In einer Ecke gibt es eine Wand mit Löchern, sogenannte „glory holes“, für „Oralverkehr“ - und vieles mehr.
1997 - Das „Kraftwerk Süd“ wird aus wirtschaftlichen Gründen abgestellt
München-Thalkirchen * Das „Kraftwerk Süd“ wird aus wirtschaftlichen Gründen abgestellt.
1997 - Der Dachreiterturm auf der „Heilig-Kreuz-Kirche“ wird neu hochgezogen
München-Obergiesing * Der kleine Dachreiterturm auf der „Heilig-Kreuz-Kirche“ wird neu hochgezogen.
Er beherbergt eine Bronzeglocke, die in einem Stahlglockenstuhl aufgehängt ist.
1997 - Die letzten Asservate des „Wiesn-Attentats“ vernichtet
Karlsruhe * Die letzten Asservate des „Wiesn-Attentats“, wie Bombensplitter und Körperteile, die sich keinem Opfer zuweisen lassen, werden vernichtet.
Bei geklärten Fällen ist das gängige Praxis.
1997 - München hat 1.216.500 Einwohner
München * München hat 1.216.500 Einwohner.
17. 1 1997 - Antrag auf Sanierung des Karl-Valentin-Geburtshauses
München-Au * Der Dipl. Ing. Klaus Schmidt stellt den Antrag auf Sanierung des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41.
24. 2 1997 - In der Rathaus-Galerie wird die Wehrmachtsausstellung eröffnet
München-Graggenau * In der Rathaus-Galerie wird die „Wehrmachtsausstellung“ eröffnet. 90.000 Münchnerinnen und Münchner werden die Ausstellung besuchen.
Peter Gauweiler, der Münchner CSU-Vorsitzende, verschickt an alle Münchner Haushalte einen Brief, in dem er schreibt: „Den Ausstellern wird vorgeworfen, dass sie deutsche Soldaten [...] generell herabwürdigen und faktisch auf eine Stufe mit Kriegsverbrechern stellen.
[...] Eine pauschale Verurteilung ist ein Schlag von Millionen Familien, die im Krieg ihren Vater, Bruder, Sohn oder Ehemann verloren haben und eine späte absichtsvolle Demütigung zahlloser Männer, die ehrenhaft gekämpft hatten.“
Statt an der Eröffnungsfeier der „Wehrmachtsausstellung“ teilzunehmen, legt Peter Gauweiler mit Gleichgesinnten am Grabmal des Unbekannten Soldaten im Hofgarten einen Kranz nieder.
21. 4 1997 - Die Fundamentierungsarbeiten am Karl-Valentin-Geburtshaus beginnen
<p><strong><em>München-Au</em></strong> * Beginn der Fundamentierungsarbeiten am Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41. </p>
19. 6 1997 - Baugenehmigung für das Karl-Valentin-Geburtshaus
München-Au * Die Baugenehmigung des Referats für Stadtplanung für das Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41 liegt vor.
10 1997 - Das Berliner „Kulturkaufhaus Dussmann“ umgeht das „Ladenschlussgesetz“
Berlin * Das Berliner „Kulturkaufhaus Dussmann“ umgeht mit der „Prokuristenregel“ das „Ladenschlussgesetz“.
„Leitende Angestellte“ dürfen in der Hauptstadt auch außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten arbeiten. Dussmann hat fortan wochentags bis 22.00 Uhr sowie an sechs Sonntagen im Jahr geöffnet.
9. 11 1997 - Eröffnung der U-Bahn zum Mangfallplatz
München-Giesing * Eröffnung der südlichen U-Bahn-Streckenverlängerung der U 1 zum Mangfallplatz.
1998 - Die Anwesen Richard-Wagner-Straße 17/19 werden Eigentumswohnungen
München-Maxvorstadt * Die Anwesen Richard-Wagner-Straße 17 und 19 werden in Eigentumswohnungen umgewandelt.
1998 - „Laptop und Lederhose
Berlin * Der aus Bayern stammende Bundespräsident Roman Herzog stellt mit dem Bild „Laptop und Lederhose" die Verbindung von Tradition und Moderne her.
Das Zitat wird seither inflationär verwendet.
1998 - Das Restaurant der „Deutschen Eiche“ erhält ein neues Aussehen
München-Isarvorstadt * Das Restaurant der „Deutschen Eiche“ erhält ein neues Aussehen.
Die Küche wird erweitert und auf den neuesten technischen Stand gebracht.
1998 - Das „Marianum“ ist eine Behinderteneinrichtung der „Caritas“
München-Untergiesing * Inzwischen ist das „Marianum“ eine Behinderteneinrichtung der „Caritas“, in der 42 geistig oder mehrfach behinderte Menschen leben.
1998 - Das „Abfallkonzept“ räumt der „Verwertung wertvoller Stoffe“ Vorrang ein
München * Das neue „Abfallkonzept“ räumt der „Verwertung wertvoller Stoffe“ Vorrang ein.
Zur Durchsetzung dieser Ziele wird bis September 1989 das „Amt für Abfallwirtschaft“ eingerichtet.
1998 - Beginn der Renovierungs- und Umbauarbeiten an der „Villa Stuck“
München-Haidhausen * Beginn der Renovierungs- und Umbauarbeiten an der „Villa Stuck“.
1998 - Die „Schaustellerstraße“ auf der „Theresienwiese“ wird saniert
München-Theresienwiese * Die „Schaustellerstraße“ auf der „Theresienwiese“ wird saniert.
2 1998 - Am „Schlosshotel Grünwald“ wird eine Valentin-Gedenktafel angebracht
Grünwald * Aus Anlass des 50. Todestages von Karl Valentin wird am „Schlosshotel“ in Grünwald eine Gedenktafel angebracht, die auf den fast zweijährigen Aufenthalt des Komikers in den Jahren 1942/43 hinweist.
20. 2 1998 - Im Freistaat Bayern wird die Todesstrafe offiziell abgeschafft
München * Im Freistaat Bayern wird die Todesstrafe abgeschafft. Bis dahin heißt es im Artikel 47 der Bayerischen Verfassung: „Der Vollzug der Todesstrafe bedarf der Bestätigung der Staatsregierung.“ Zum Glück hat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland die Todesstrafe bereits im Jahr 1949 beseitigt.
1. 5 1998 - Aufstellung des ersten Berg am Laimer „Maibaumes“
München-Berg am Laim * Aufstellung des ersten Berg am Laimer „Maibaumes“.
4. 5 1998 - Der Kranzgeldparagraph wird gestrichen.
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Der sogenannte „Kranzgeldparagraph“ wird gestrichen. Als „Kranzgeld“ bezeichnet man bis dahin eine finanzielle Entschädigung, die eine Frau von ihrem ehemaligen Verlobten fordern kann, wenn sie auf Grund eines Eheversprechens ihre Jungfräulichkeit verloren hat, und er anschließend das Verlöbnis löst. Gleiches gilt übrigens auch für neuverlobte Witwen.
23. 5 1998 - Eröffnung der U-Bahn zum Waldfriedhof
München * Eröffnung der nördlichen U-Bahn-Streckenverlängerung der U 1 zum Waldfriedhof.
7 1998 - Das „Klenze-Denkmal“ wird mit Spenden der „Deutschen Eiche“ aufgestellt
München-Isarvorstadt * Das wiederentdeckte alte „Klenze-Denkmal“ wird mit Spenden der „Deutschen Eiche“ in der Reichenbachstraße 13 aufgestellt.
19. 9 1998 - Die Fischer-Vroni zieht an ihren neuen Standort um
München-Theresienwiese * Aus Sicherheitsgründen muss die Fischer-Vroni von ihrem alten Platz umziehen. Zum Ausgleich erhält sie an neuer Stelle 700 Plätze mehr.
23. 9 1998 - Der Bordeauxplatz wird wieder der Öffentlichkeit übergeben
München-Haidhausen • Nach einer ausgiebigen Schönheitskur wird der Brunnen am Bordeauxplatz wieder der Öffentlichkeit übergeben.
27. 9 1998 - Ergebnis der Bundestagswahl 1998
Bundesrepublik Deutschland - Bonn * Bei der Wahl zum 14. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl 35,1 Prozent [- 6,3] und 245 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder erringt 40,9 Prozent der Stimmen [+ 4,5] und 298 Sitze.
- Die FDP bekommt 6,2 Prozent [- 0,7] und 43 Sitze.
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN kommen auf 6,7 Prozent der abgegebenen Stimmen [- 0,6].
- Die PDS erkämpft 5,1 Prozent der Stimmen [+ 0,7] und mit 36 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Gerhard Schröder wird Bundeskanzler einer Koalition bestehend aus SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN.
8. 11 1998 - Oberbürgermeister Ude enthüllt die Gedenktafel an die Reichskristallnacht
München-Graggenau * Oberbürgermeister Christian Ude enthüllt anlässlich des 60. Jahrestages des Pogroms im Alten Rathaus eine Gedenktafel zur Erinnerung an die „Reichskristallnacht“.
1999 - Umbenennung des „Valentin-Musäums“ in „Valentin-Karlstadt-Musäum“
München-Graggenau - München-Angerviertel * Umbenennung des „Valentin-Musäums“ in „Valentin-Karlstadt-Musäum“.
1999 - Aus den „Isar-Amper-Werken AG“ wird die „VIAG“
München-Maxvorstadt * Aus den „Isar-Amper-Werken AG“ wird die „VIAG“.
1999 - Das „Amt für Abfallwirtschaft“ zieht zum Georg-Brauchle-Ring um
München * Das „Amt für Abfallwirtschaft“, die „Zentrale der städtischen Abfallentsorgung“, zieht zum Georg-Brauchle-Ring um.
1999 - Forderung für ein Denkmal für die „Wiederaufbau-Generation“
München * Die „CSU-Stadtratsfraktion“ fordert die Errichtung eines Denkmals für die „Wiederaufbau-Generation“ in München.
1999 - Horst Teltschik wird Vorsitzender der „Sicherheitskonferenz“
München-Kreuzviertel * Der Wirtschaftsmanager und Politiker Horst Teltschik (CDU) übernimmt von Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin den Vorsitz der „Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik (MSK)“.
1999 - Die „Totengräber vom Ostfriedhof“ erlangen Kultstatus
München-Obergiesing * Die „Totengräber vom Ostfriedhof“ erlangen Kultstatus.
Als „Boandlkramer-Connection“ singen sie täglich in der „Shitparade“ von „Radio Gong“ das Lied „Drei weiße Tauben und ein Gewehr, drei weiße Tauben, die scheißen nicht mehr. Guru, guru“.
Als einem Hörer dieser Erfolg zu viel wird, verspricht er für jede Gegenstimme ein Weißbier.
Gleich darauf meldet sich der Fußball-Spieler Markus Babbel und bietet - im Namen des „FC Bayern“ - für jede Ja-Stimme zwei Träger Weißbier.
Als die „Totengräber“ im September 1999 ein falsches Grab ausheben, kommt es zum Karriereknick, da der „Leiter der Friedhofsverwaltung“ den „Boandlkramern“ ein Singverbot erteilt.
Doch nun gehen die „Radio Gong“-Hörer auf die Barrikaden.
Binnen vier Tagen fordern 12.000 Hörer auf Unterschriftslisten die Rückkehr der singenden „Totengräber“.
Und nach kaum einer Woche sind sie wieder „Live On The Air“ zu hören.
Bald werden die Bestatter und Aufbahrer durch die ganze Bundesrepublik gereicht.
Sie sangen auf der „Wies’n“ im Bierzelt, bei Stefan Raab im Fernsehen und bei der „SpVVg Unterhaching“ in der Halbzeitpause.
Um den 10. 2 1999 - Amtliche Abnahme der Baumaßnahme Karl-Valentin-Geburtshaus
München-Au * Die Amtliche Abnahme der Baumaßnahme Karl-Valentin-Geburtshaus in der Zeppelinstraße 41.
5 1999 - Beim „Pfingsthochwasser“ führt die Isar 750 Kubikmeter Wasser/sek.
München * Obwohl die Isar beim „Pfingsthochwasser“ nur 750 Kubikmeter Wasser in der Sekunde führt, gibt die „Wilde Karwendelkönigin“ einen Eindruck ihrer Macht und Gewalt, die in ihr steckt.
29. 5 1999 - Die U-Bahnfährt bis zum Bahnhof Messestadt Ost
München * Die U-Bahn-Streckenverlängerung der U 2 zum Bahnhof Messestadt Ost geht in Betrieb.
2. 6 1999 - Die Gartenanlagen im Valentin-Geburtshaus sind abgeschlossen
München-Au * Die Freiflächen, der Garten, des Karl-Valentin-Geburtshauses in der Zeppelinstraße 41 werden amtlicherseits abgenommen. Damit ist das Bauvorhaben endgültig abgeschlossen.
11. 6 1999 - Die Sanierungsarbeiten am Siegestor sind abgeschlossen
München-Maxvorstadt - München-Schwabing * Die Sanierungsarbeiten am Siegestor sind abgeschlossen.
7 1999 - Das „3-Tonnen-System“ wird flächendeckend eingeführt
München * Das „3-Tonnen-System“ wird flächendeckend eingeführt.
7 1999 - Mit einem Trick die Verkaufsräume am Samstag und am Sonntag geöffnet
Berlin * Der Berliner „Kaufhof am Alexanderplatz“ deklariert sein Angebot komplett als „Berliner Souvenirs“, die gesetzlich auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten verkauft werden dürfen.
Mit diesem Trick er seine Verkaufsräume am Samstag und am Sonntag geöffnet.
11. 8 1999 - München erlebt eine totale Sonnenfinsternis
München * Um 12:37 Uhr erlebt München eine totale Sonnenfinsternis, liebevoll SOFI genannt. Die Menschen betrachten das Schauspiel mit speziell hergestellten Brillen.
18. 9 1999 - Stephanie Spendler ist offiziell Wiesnwirtin
München-Theresienwiese * Stephanie Spendler ist offiziell Wiesnwirtin. Gemeinsam mit ihrem Vater Ludwig Wiggerl Hagn betreibt sie das Löwenbräu-Festzelt.
18. 9 1999 - Die Hühner- und Entenbraterei Ammer stellt auf Biohendl um.
München-Theresienwiese * Die Hühner- und Entenbraterei Ammer stellt auf Biohendl um. Ein Biohendl kostet dreimal so viel wie ein normales, frisst dreimal so viel und lebt dreimal so lange.
18. 9 1999 - Das „Oktoberfest“ ist weltweit 91 Prozent der Befragten bekannt
Welt * Bei einer weltweiten Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus ist das Oktoberfest 91 Prozent der Befragten bekannt.
18. 9 1999 - Die Familie Kuffler kauft das Nymphenburg-Sekt-Zelt Zum Weinwirt
München-Theresienwiese * Die Familie Kuffler kauft das „Nymphenburg-Sekt-Zelt ‚Zum Weinwirt‘“, weil die Sektkellerei Nymphenburg von Schloss Wachenheim übernommen wird. Ab da heißt das Festzelt kurz und knapp „Kufflers Weinzelt“.
Um 10 1999 - Der Umbau des Bürohauses der „Isar-Amper-Werke AG“ ist fertiggestellt
München-Maxvorstadt * Der Umbau des Bürohaus-Komplexes der „Isar-Amper-Werke Elektrizitäts AG“ an der Ecke Brienner-/Richard-Wagner-Straße ist fertiggestellt.
Der Haupteingang befindet sich seither in der Richard-Wagner-Straße.
10. 11 1999 - Eine Auszeichnung für die Valentin-Stadthäuser
München-Au * Der Stadtrat beschließt, dem Dipl.-Ing. Klaus Schmidt und seinem Architekten Gert Bayer für die fünf Stadthäuser im Hof der Zeppelinstraße 41 als vorbildliche Baumaßnahme eine „Lobende Erwähnung“ zuzuerkennen.
Die entsprechende Urkunde wird ihnen am 7. Februar 2000 ausgehändigt.
2000 - An der Richard-Wagner-Straße 16 entsteht ein „Studentenwohnheim“
München-Maxvorstadt * Auf dem Ruinengrundstück an der Richard-Wagner-Straße 16 entsteht ein sechsstöckiges Haus der „Technischen Universität München“.
In dem „Studentenwohnheim“ finden heute bis zu 40 Studenten der „TUM“ Unterkunft.
2000 - Wie gehts mit dem „Deutschen Theater“ weiter?
München-Ludwigsvorstadt * Der Stadtrat will wissen, wie es um das „Deutsche Theater“ steht.
Rund zwei Dutzend Experten begutachten in der folgenden Zeit nahezu jeden Winkel des Gebäudes.
2000 - Das Bild der „Birkenau“ hat sich sehr stark verändert
München-Untergiesing * Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Bild der „Birkenau“ sehr stark verändert.
Trotz aller Denkmalschutzvorgaben verschwinden die ärmlichen und sanierungsbedürftigen Kleinhäuser.
Zum Teil hat man die Häuser abgerissen und durch artfremde ersetzt oder man hat sie derart modernisiert, dass von der ursprünglichen Substanz nicht mehr viel erhalten geblieben ist.
2000 - Die evangelische „Lukaskirche“ muss dringend saniert werden
München-Lehel * Die evangelische „Lukaskirche“ erregt die Gemüter, als sich aus einer großen Rosette Steine lösen und auf einen Spielplatz fallen.
Zum Glück passiert nichts, außer dass endlich mit der dringend notwendigen Sanierung begonnen wird.
2 2000 - Die erste CD der „Boandlkramer-Connection“ erscheint
München-Obergiesing * Die erste CD der „Boandlkramer-Connection“ erscheint.
Die Musikscheibe der „Totengräber vom Ostfriedhof“ enthält unter anderem den Titel: „Buam, Buam, Buam“.
4 2000 - Das „Motorama“ wird wieder eröffnet
München-Au * Nach einer zweijährigen Umbau- und Renovierungszeit wird das „Motorama“ wieder eröffnet.
30. 4 2000 - Die Georgskirche in Bogenhausen wird im neuen Glanz eröffnet
<p><strong><em>München-Bogenhausen</em></strong> * Nach sechs Jahren Arbeit und unter Verwendung von 3,8 Millionen DMark wird die Georgskirche in Bogenhausen im neuen Glanz wieder eröffnet.</p>
6 2000 - Die „Karl-Peters-Straße“ wird in „Ida-Pfeiffer-Straße“ umbenannt
München-Graggenau - München-Zamdorf * Die „Karl-Peters-Straße“ wird auf Antrag des „Bezirksausschusses Bogenhausen“ in „Ida-Pfeiffer-Straße“ umbenannt.
3. 9 2000 - Papst Johannes Paul II. spricht Johannes XXIII. selig
Rom-Vatikan * Papst Johannes Paul II. spricht Johannes XXIII. selig.
16. 9 2000 - Stephan Kuffler wird offiziell Wiesnwirt im Weinzelt
München-Theresienwiese * Stephan Kuffler wird offiziell Wiesnwirt im Weinzelt seiner Eltern.
16. 9 2000 - Sepp Krätz, der Hippodrom-Wiesnwirt, führt das VIP-Bändchen ein
München-Theresienwiese * Sepp Krätz, der Wiesnwirt vom Hippodrom, führt das VIP-Bändchen für besondere Gäste ein.
3. 11 2000 - Die August-Everding Theater-Akademie in Bogenhausen
München-Bogenhausen * Die Studiengänge Musical, Dramaturgie sowie Theaterkritik der August-Everding Theater-Akademie beziehen die Bürgermeistervilla in Bogenhausen.
31. 12 2000 - Der Münchner trinkt 40 Liter Wein im Jahr
München * Der Wein-pro-Kopf-Verbrauch liegt in München bei 40 Litern. Darin sind auch eingerechnet: Säuglinge, Anstinenzler und Weinverachter. München ist damit die deutsche Großstadt mit dem höchsten Wein-pro-Kopf-Verbrauch. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 27 Liter.
2001 - Liesl Karlstadt wird im „Valentin-Karlstadt-Musäum“ angemessen gewürdigt
München-Graggenau - München-Angerviertel * Liesl Karlstadt wird im „Valentin-Karlstadt-Musäum“ angemessen gewürdigt.
Valentins kongeniale Partnerin erhält ein „Liesl-Karlstadt-Kabinett“.
2001 - Häuser der „Feldmüller-Siedlung“ ins „Herbergen-Programm“ aufgenommen
München-Obergiesing * Einige Häuser der „Feldmüller-Siedlung“ werden in das „Herbergen-Programm“ aufgenommen und können damit der Sanierung zugeführt werden.
2001 - Die „Museum-Lichtspiele“ werden ausgezeichnet
München-Au * Die „Museum-Lichtspiele“ werden vom „FilmFernsehFonds Bayern“ mit einer Prämie von 15.000 DMark ausgezeichnet.
1. 1 2001 - Aus VIAG und dem VEBA-Konzern wird die E.ON-Energie AG
München-Maxvorstadt * Die VIAG, ursprünglich Vereinigte Industrieunternehmungen AG, ist ein zuletzt in München ansässiger Holdingkonzern geworden. Bis Mitte der 1990er-Jahre war der aktive Sitz in Bonn und davor in Berlin. Im Jahr 2000 wird die VIAG mit dem ähnlich strukturierten VEBA-Konzern zur E.ON-Energie AG fusioniert.
3 2001 - Der „Kriechbaumhof“ im Maßstab 1:20 als Dauerleihgabe
München-Haidhausen * Die Hobby-Modellbauer Ruth und Hans Irlbacher, sowie Hermann Voßeler stellen dem „Haidhausen Museum“ in der Kirchenstraße den „Kriechbaumhof“ im Maßstab 1:20 als Dauerleihgabe zur Verfügung.
Das Modell des Herbergsanwesens entstand nach alten Plänen und Fotos in 400 Stunden Arbeit.
Die Irlbacher und Voßeler reihen sich damit in die Tradition der Auer und Haidhauser „Kripperlbauer“ ein, die sich seinerzeit mit ihren Schnitzarbeiten im Winter einen Nebenerwerb eröffneten.
Im „Bayerischen Nationalmuseum“ sind mehrere hervorragende Arbeiten von aus dem „Ostend“ stammenden „Krippenmachern“ zu sehen.
Man kennt die Künstler zum Teil nur noch dem Vornamen nach:
So den Zimmermann „Niclas“, der um das Jahr 1800 in der Au arbeitete oder Wendelin Reiner, der ebenfalls in der Au wohnte, dessen Stiefsohn Andreas Barsam, Anselm Sickinger, sowie den Schnitzer „Ludwig“ und Johann Berger, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten.
5. 4 2001 - Abendzeitung: „Die Biber sind wieder zurück in München“
<p><strong><em>München-Isarvorstadt - Museumsinsel - München-Englischer Garten</em></strong> * Die Abendzeitung meldet: <em>„Die Biber sind wieder zurück in München“</em>. Nördlich der Zenneck-Brücke am Deutschen Museum und am Oberst-Jägermeister-Bach im Englischen Garten können die Tiere seither beobachtet werden.</p>
5 2001 - Die Wiesnwirte Weinfurtner werden wegen „Steuerhinterziehung“ verurteilt
München-Theresienwiese * Wegen „Steuerhinterziehung“ wird das Wieswirte-Ehepaar Anton und Marianne Weinfurtner zu Bewährungsstrafen und einer Geldbuße von einer Million Mark verurteilt.
9 2001 - Der „Friedrich-Schiedel-Kindergarten“ wird eröffnet
München-Maxvorstadt * Der „Friedrich-Schiedel-Kindergarten“ an der Richard-Wagner-Straße 14 wird eröffnet.
Das Grundstück war zuvor unbebaut.
Ab 9 2001 - Die „Residenzpost“ wird noch einmal umfassend renoviert
München-Graggenau * Die „Residenzpost“ wird noch einmal umfassend renoviert.
22. 9 2001 - Georg Heide wird Festwirt im Pschorr-Bräurösl-Festzelt
München-Theresienwiese • Georg Heide wird Festwirt im Pschorr-Bräurösl-Festzelt.
7. 10 2001 - In der Ochsenbraterei werden 77 Ochsen verzehrt
München-Theresienwiese * In der Ochsenbraterei werden während der Wiesn 77 Ochsen verzehrt.
1. 11 2001 - Die Familie Winklhofer betreibt das Gastlokal Hofer - Der Stadtwirt
München-Graggenau * Die Löwenbräu AG wird Mieter des Anwesens Burgstraße 5. Seither betreibt die Familie Winklhofer das Gastlokal mit dem historischen Ambiente unter dem Namen Hofer - Der Stadtwirt.
29. 11 2001 - George Harrison stirbt an Krebs
Los Angeles * George Harrison, der „stille Beatle“, stirbt in Los Angeles, Kalifornien, an Krebs. Er stand lange Zeit im Schatten von John Lennon und Paul McCartney. Durch die Verwendung orientalischer Instrumente und Kompositionen seit Mitte der 1960er-Jahre wurde er zu einem der Wegbereiter der Weltmusik.
Wie auch John Lennon hinterlässt George Aufnahmen für ein komplettes Album, das sein Sohn Dahni und Jeff Lynne anhand seiner ausführlichen Notizen fertigstellen und 2002 unter dem Titel „Brainwashed“ veröffentlichen.
12 2001 - In Deutschland gibt es 1.100 „McDonald‘s-Restaurants“
Deutschland * In Deutschland gibt es 1.100 „McDonald‘s-Restaurants“, in denen täglich zwei Millionen Menschen essen, der Jahresumsatz liegt bei 2,3 Milliarden Euro.
Damit ist die „Big-Mac-Kette“ der Marktführer in Deutschland.
2002 - Die „Matthias-Pschorr-Straße“ auf der „Theresienwiese“ wird saniert
München-Theresienwiese * Die „Matthias-Pschorr-Straße“ auf der „Theresienwiese“ wird saniert.
2002 - München hat 1.234.692 Einwohner
München * München hat 1.234.692 Einwohner.
1 2002 - Der „Abfallwirtschaftsbetrieb München“ als städtischer Eigenbetrieb
München * Das „Amt für Abfallwirtschaft“ wird ein städtischer Eigenbetrieb und heißt jetzt „Abfallwirtschaftsbetrieb München“.
8 2002 - Der „Daphne-Brunnen“ findet an der „Wahnfriedallee“ ein neues Plätzchen
München-Haidhausen - München-Oberföhring * Der „Daphne-Brunnen“ vom Orleansplatz findet in der Bogenhauser „Wahnfriedallee“ ein neues Plätzchen.
Die nach vorne schreitende hübsche Bronzefigur, die sich in der Verwandlung in einen Lorbeerbaum befindet, findet ihren neuen Standort zwischen zwei Bäumen.
9 2002 - Toni Roiderer wird zum „Sprecher der Wiesnwirte“ gewählt
München-Theresienwiese * Toni Roiderer wird als „Sprecher der Wiesnwirte“ zum Nachfolger von Willy Heide gewählt.
Gleichzeitig bringen die „Wiesnwirte“ erstmals einen gemeinsamen Krug heraus.
21. 9 2002 - Die Galerie des Hacker-Festzeltes wird komplett erneuert
München-Theresienwiese • Die Galerie des Hacker-Festzeltes wird komplett erneuert und die Wände liebevoll ausgemalt.
22. 9 2002 - Ergebnis der Bundestagswahl 2002
Bundesrepublik Deutschland - Berlin • Bei der Wahl zum 15. Bundestag erhält
- die SPD mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Gerhard Schröder 38,5 Prozent [- 2,4] und 251 Sitze.
- Die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber erringt ebenfalls 38,5 Prozent der Stimmen [+ 3,4] und 248 Sitze.
- Die FDP bekommt 7,4 Prozent [+ 1,2] und 47 Sitze.
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN kommen auf 8,6 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 1,9].
- Die PDS erkämpft 4,0 Prozent der Stimmen [- 1,1] und zieht - durch die direkt gewonnenen Berliner Wahlkreise - lediglich mit zwei Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Gerhard Schröder wird Bundeskanzler einer Koalition bestehend aus SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN.
9. 10 2002 - Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2002 steht fest
Bundesrepublik Deutschland - Berlin * Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2002 wird bekannt gegeben. SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN können zusammen 577.000 mehr Wähler als CDU/CSU und FDP für sich gewinnen.
18. 11 2002 - Die George-Harrison-CD „Bainwashed“ erscheint
Großbritannien * Knapp ein Jahr nach seinem Tod erscheint George Harrisons Album „Brainwashed“, das von seinem Sohn Dahni und Jeff Lynne anhand seiner ausführlichen Notizen fertiggestellt wird.
2003 - Stadtverwaltung lehnt „Trümmerfrauen-Denkmal“ ab
München * In der Städtischen Verwaltung wird über die Aufstellung eines „Trümmerfrauen-Denkmals“ beraten.
Die Mehrheit lehnt dieses Vorhaben mit nachstehender Begründung ab:
„Die im Antrag genannten Trümmerfrauen gab es in München nicht. Herangezogen wurden in der Regel arbeitsfähige Männer. Dabei ist besonders zu beachten, dass man die Trümmerbeseitigung direkt nach dem Krieg vor allem ehemaligen Nationalsozialisten als Sühneleistung auferlegt hat“.
2003 - Die ehemaligen Wiesnwirte Weinfurtner stehen erneut vor Gericht
München-Theresienwiese * Die ehemaligen Wiesnwirte Marianne und Anton Weinfurtner stehen erneut wegen „Steuerhinterziehung“ vor Gericht.
Das „Landgericht München I“ geht von einem Schaden von 1,5 Millionen Euro für den Fiskus aus.
Marianne Weinfurtner, die das Gericht für die „treibende Kraft“ hält, wird wegen vier und ihr Mann Anton wegen drei Fällen der „Umsatzsteuerverkürzung“ schuldig gesprochen.
Ins Strafmaß einbezogen wird eine Verurteilung der Eheleute zu je zwei Jahren mit Bewährung aus dem Jahr 2001.
Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Anton Weinfurtner und seine am Unternehmen beteiligte Ehefrau und Buchhalterin haben laut dem früheren Urteil den „Fiskus getäuscht, wo immer sich Gelegenheit bot“.
Frau Weinfurtner wird zu viereinhalb Jahren, Herr Weinfurtner zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.
2 2003 - Ein „Luftschutzbunker“ wird für Wohnzwecke umgebaut
München-Untergiesing * Der Designer Uwe Binnberg und der bildende Künstler Christoph Nicolaus kaufen den „Hochbunker“ an der Claude-Lorrain-Straße, um darin exklusive Wohnungen einzurichten.
Für den „Bunker“ gilt lediglich ein „Bestandsschutz“. Das bedeutet, dass er zwar verändert werden darf, hinterher aber noch das Aussehen des vorherigen Gebäudes erkennen lassen muss. Der „Betonkasten aus Kriegszeiten“ an der Claude-Lorrain-Straße 26 ist damit der erste und einzige „Luftschutzbunker“ in München, der für Wohnzwecke umgebaut werden darf.
Der ursprünglich mit Keller, Erdgeschoss und drei Obergeschossen erbaute achteckige Turm mit seinen 2,40 Metern dicken Mauern bietet eine Gesamtfläche von 280 Quadratmetern. Statt Fenster hat er nur schmale Sichtschlitze, durch die 63 Jahre kaum Licht einfallen konnte und dadurch im Inneren des „Bunkers“ eine dunkle und muffige Atmosphäre erzeugte. Immerhin wurde das „Bauwerk“ im Jahr 1941 für einen Zweck geschaffen, bei dem nicht gerade die Verbreitung einer freundlichen Atmosphäre im Vordergrund stand.
4 2003 - Das „Wirtschaftsreferat“ will das „Deutsche Theater“ schließen
München-Ludwigsvorstadt * Die Untersuchungsergebnisse zum „Deutschen Theater“ werden den Stadträten vorgelegt.
Das „Wirtschaftsreferat“ berechnet die Kosten für die notwendige Sanierung mit 138 Millionen Euro und empfiehlt aufgrund der „unfinanzierbaren Kosten“, das Theater zu schließen.
Innerhalb kürzester Zeit werden 60.000 Unterschriften zum Erhalt des „Deutschen Theaters“ gesammelt.
Auch Oberbürgermeister Christian Ude will das „Deutsche Theater“ dicht machen, doch das Theater und seine Freunde kämpfen dagegen, schlagen günstigere Alternativen vor, auch einen Neubau.
Doch der kommt aus rechtlichen Gründen nicht in Frage.
Ab 3. 4 2003 - Eine Kunstaktion im Luftschutzbunker
München-Untergiesing * Bevor die Umbaumaßnahmen für das Projekt „Wohnen im Turm“ beginnen, muss erst eine mehrmonatige Wartezeit überbrückt werden. Das geschieht mit einer „Kunstaktion“ unter dem Titel „120 Tage Kunst im Bunker“.
Die Eigentümer verfolgen mit dieser Aktion das Ziel, einerseits das Image des „Betonkastens aus Kriegszeiten“ zu verbessern, andererseits wollen sie „durch die Kunst versuchen, das bedrückende des Bunkers aufzubrechen und ihn bis zur tatsächlichen Bautätigkeit mit Leben zu füllen“.
Die Kunstaktion dauert bis zum 26. Juli. Dabei herrscht eine breite Übereinstimmung. Doch mit dem anschließenden Genehmigungsverfahren der Umbauplanung scheiden sich wieder die Geister. Während sich Rathauspolitiker von der „Bunker-Kreativität“ begeistert zeigen, melden Architektur- und Denkmalschutzexperten ihre Bedenken an.
Und obwohl das Gebäude gar nicht unter Denkmalschutz steht, meinen sie, dass „so ein Bunker fast das Einzige [sei], das uns heute noch an den Krieg erinnert“. So ein „Wehrbau“ habe deshalb eine ebenso hohe Aussagekraft wie eine Stadtmauer oder eine Burg.
1. 6 2003 - Die Ladenöffnungszeiten werden nochmals verlängert
München * Die Ladenöffnungszeiten werden nochmals verlängert. Auch an Samstagen können Geschäfte nun bis 20.00 Uhr öffnen. Die Gesamtstundenzahl der Ladenöffnungszeiten pro Woche hat sich damit seit dem 28. November 1956 von 63,5 auf 84 Stunden erhöht.
16. 6 2003 - Kolonalgeschichte in den Münchner Straßennamen
München-Graggenau * Stadtrat Siegfried Benker forderte im Namen der Fraktion der GRÜNEN in einem Antrag, sich mit der Kolonalgeschichte in den Münchner Straßennamen und dem Umang mit diesem Erbe verstärkt zu befassen:
- Dem Stadtrat wird dargestellt, welche Straßennamen nach Personen, Ereignissen und Orten aus der Geschichte der ehemaligen deutschen Kolonien benannt sind.
- Dem Stadtrat wird ein Vorschlag unterbreitet, wie mit diesem Kolonialerbe umgegangen werden soll.
Die Diskussion drehte sich im Vorfeld um die Von-Trotha-Straße, die Von-Gravenreuth-Straße, die Dominikstraße und die Wißmannstraße.
1. 8 2003 - Hans Podiuk: „Kann keine Verherrlichung von Kolonialverbrechen erkennen“
München * Der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, Hans Podiuk, selbst Bewohner des Kolonialviertels, entrüstet sich über den Antrag auf mögliche Straßenumbenennungen: „Ich persönlich kann keine Verherrlichung von Kolonialverbrechen erkennen, wenn Straßen nach Orten oder Personen aus der Kolonialzeit benannt sind“.
9 2003 - Hans Stadtmüller wird Wiesnwirt in der „Fischer-Vroni“
München-Theresienwiese * Innerhalb von zehn Monaten sterben Anita Schmid und Eva Stadtmüller, die Wirtinnen der „Fischer-Vroni“. Hans Stadtmüller übernimmt diese Funktion.
20. 9 2003 - Die Plätze in der Käfer-Wies‘nschänke werden doppelt belegt
München-Theresienwiese * „Versehentlich“ werden die Plätze in der Käfer-Wies‘nschänke doppelt belegt. Der Betreiber darf ein weiteres Zelt im Garten aufstellen.
21. 9 2003 - Ergebnis der Wahl zum Bayerischen Landtag 2003
Freistaat Bayern - München • Nach der Auszählung der Landtagswahl gehören dem Bayerischen Landtag in dieser 15. Legislaturperiode 180 Mitglieder an. Bei der Wahl zum 15. Bayerischen Landtag erhält
- die CSU mit ihrem amtierenden Ministerpräsidenten Edmund Stoiber 60,7 Prozent [+ 7,8] und 124 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kandidaten Franz Maget erringt 19,6 Prozent der Stimmen [- 9,1] und 41 Sitze.
- DIE GRÜNEN kommen auf 7,7 Prozent der Wählerstimmen [+ 2,0] und 15 Sitze.
Edmund Stoiber wird erneut Bayerischer Ministerpräsident und kann mit seiner CSU-Alleinregierung mit einer Zweidrittel-Mehrheit regieren.
25. 9 2003 - 29 Straßennamen werden gutachterlich überprüft
München * Mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN beschließt der Stadtrat, dass 29 Straßennamen gutachterlich überprüft werden, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Kolonialzeit haben.
Noch am gleichen Tag spricht die CSU von einem „Entkolonisierungs-Feldzug“ und davon, dass „es überhaupt keine Notwendigkeit gibt [...] die Straßenumbenennungen aus der Kolonialzeit [...] intensiver zu durchleuchten“.
2. 10 2003 - Dieter Hildebrandt ist letztmals Gastgeber im Scheibenwischer
München * Dieter Hildebrandt ist nach 145 Sendungen letztmals Gastgeber in der Satiresendung Scheibenwischer.
4. 11 2003 - Die Ladenöffnungszeiten vor dem Bundesverfassungsgericht
Karlsruhe * Vor dem Bundesverfassungsgericht wird nach einer Klage der Kaufhof AG erstmals über die Ladenöffnungszeiten verhandelt. Die Warenhauskette will das Verkaufsverbot an Werktagen nach 20.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen beseitigen.
2004 - Jannik Inselkammer wird „Gesellschafter“ der „Augustiner-Brauerei“
München-Ludwigsvorstadt * Jannik Inselkammer wird „geschäftsführender Gesellschafter“ der „Augustiner-Brauerei“.
1 2004 - Die Renovierungsarbeiten in der „Villa Stuck“ beginnen
München-Haidhausen * Die Renovierungs- und Umbauarbeiten in den „historischen Räumen“ und im „Alten Atelier“ der „Villa Stuck“ beginnen.
3. 3 2004 - Eröffnung des Jugendstil-Museums in der Villa Stuck
München-Haidhausen * Eröffnung des Jugendstil-Museums in der Villa Stuck mit der Ausstellung „München! Stadt des Jugendstils“.
9. 6 2004 - Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen bestätigt
Karlsruhe * Das Bundesverfassungsgericht bestätigt das grundsätzliche Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen.
18. 9 2004 - Das Hacker-Festzelt bekommt den Himmel der Bayern
München-Theresienwiese * Das Hacker-Festzelt erhält eine neue Innenkulisse, ein neues, drehbares Musikpodium und einen neuen Himmel - den „Himmel der Bayern“.
18. 9 2004 - Das Winzerer-Fähndl-Festzelt wird heller und freundlicher
München-Theresienwiese * Peter und Arabella Pongraz werden Wiesnwirte im Winzerer-Fähndl. Das Winzerer-Fähndl-Festzelt bekommt ein neues Zeltdach. Die Festhalle wird dadurch heller und freundlicher.
18. 9 2004 - Das Löwenbräu-Festzelt wird als erstes Bierzelt der Welt zertifiziert
München-Theresienwiese * Das Löwenbräu-Festzelt wird als erstes Bierzelt der Welt nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Der Qualitätssicherungsstandard umfasst Kriterien von der Zeltsicherheit über Notfallpläne, Arbeitsabläufe, Essensgeschmack, Sauberkeit bis hin zur Laustärke der Musik.
18. 9 2004 - Das Geschirr für das Brauereigespann von Paulaner wird erneuert
München-Theresienwiese * Das Geschirr für das Brauereigespann von Paulaner wird erneuert. Es kostet 125.000 € für sechs Pferde. 2.280 Arbeitsstunden sind für die Herstellung angefallen.
18. 9 2004 - Die Pschorr-Bräurosl bekommt einen neue Festhalle
<p><strong><em>München-Theresienwiese</em></strong> * Die Pschorr-Bräurosl bekommt einen neue Festhalle. 80 Meter lang und 60 Meter breit ist das Zelt. 300 Kubikmeter Holz 100 Tonnen Stahl stecken in dem Festzelt, 6.000 qm Stoffplanen in der Dekoration. </p>
Bis 20. 9 2004 - Togal schlägt über 160 Kauf- und Fusionsangebote aus
München-Bogenhausen * Mehr als 160 Kauf- und Fusionsangebote hat der Bogenhausener Togal-Chef Günther J. Schmidt schon abgelehnt.
20. 9 2004 - Die Allegorie Monachia im Großen Rathaussaal wird wieder eingeweiht
München-Graggenau * Carl von Pilotys Monumentalgemälde „Allegorie Monachia“ im Großen Rathaussaal wird wieder eingeweiht. Das überdimensionierte Bild entstand 1879 und misst 15,30 mal 4,60 Meter. Es zeigt 128 Personen der Münchner Stadtgeschichte, unter deutlicher Vernachlässigung des Wittelsbacher Herrscherhauses. Das Bild ruhte viele Jahre im Depot.
4. 10 2004 - Wiesn 2004: 210.000 Bierkrüge einkassiert
München-Theresienwiese * Das Ordnungspersonal auf dem Oktoberfest nimmt den Souvernierjägern rund 210.000 Bierkrüge wieder ab.
1. 12 2004 - Das Rock Museum Munich auf dem Fernsehturm wird eröffnet
München-Oberwiesenfeld * Das Rock Museum Munich auf dem Fernsehturm wird eröffnet. Es ist im Aussichtskorb des Olympiaturms untergebracht und liegt auf ungefähr 180 Metern Höhe. Damit ist es das weltweit höchstgelegene „Rock-Museum der Welt“. Betrieben wird das Rock Museum Munich von Herbert Hauke und Arno Frank Eser.
2005 - „Wiesn-Schläger“ wegen „versuchten Mordes“ zu 12 Jahren Haft verurteilt
München * Ein Münchner Gericht verurteilt erstmals einen mit einem Masskrug bewaffneten „Wiesn-Schläger“ wegen „versuchten Mordes“ zu 12 Jahren Haft.
2005 - Einführung eines Wiesn-Masskruges aus Plastik vorgeschlagen
München-Theressienwiese * Der Wiesnwirte-Sprecher und Wirt des Löwenbräu-Festzeltes, Ludwig Wiggerl Hagn, schlägt die Einführung eines Wiesnkruges aus Plastik vor, der 800 Gramm leichter als ein Glaskrug (1.300 Gramm) ist.
Der Vorstoß scheitert: „Ich hab‘ ja nur darüber nachgedacht. Machen tu‘ ich das sowieso net. Oder nur, wenn der Gast einverstanden ist“.
2005 - Die Hotelzimmer in der „Deutschen Eiche“ werden modernisiert
München-Isarvorstadt * Die Hotelzimmer in der „Deutschen Eiche“ werden renoviert und modernisiert.
2005 - Die „Residenzpost“ verlegt ihren Betrieb in den „Alten Hof“
München-Graggenau * Die „Residenzpost“ schließt für immer und verlegt den Betrieb in den „Alten Hof“.
2005 - „Anheuser-Bush Inbev“ übernimmt „Löwenbräu“ und „Spaten“
USA * Der Konzern „Anheuser-Bush Inbev“ übernimmt die Münchner Traditionsmarken „Löwenbräu“, „Spaten“ und „Franziskaner“.
Das belgisch-brasilianisch-amerikanische Unternehmen ist durch immer neue Milliardenübernahmen zum weltweiten Marktführer in Sachen Bier geworden; mit einem Umsatz von 40 Milliarden Dollar und hohen Gewinnen.
2005 - Wasserrohrbruch im „Cuvilliès-Theater“
München-Graggenau * Während der Restaurierung des „Cuvilliès-Theaters“ ergießen sich aus einem alten Rohr ganze Fluten in das Theater.
2005 - Joseph Ratzingers alten „VW Golf“ um 189.000 € verkauft
Rom-Vatikan * Der alte „VW Golf“ von Joseph Ratzinger wird im Jahr seiner „Papstwahl“ um 189.000 € nach Amerika verkauft.
Das „Heilige Blechle“ ist damit aber noch lange keine „Reliquie“.
Dazu müsste Benedikt XVI. erst gestorben und zumindestens zum „Seligen“ erklärt worden sein.
2005 - Die vielleicht orthodoxeste jüdische Gemeinde in Deutschland
München * Durch die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion erhöht sich die Zahl der Gemeindemitglieder auf 9.000. Die Münchner Gemeinde gilt als „sehr orthodoxe, wenn nicht die orthodoxeste Gemeinde in Deutschland“.
14. 1 2005 - Rudolph Moshammer wird von einem Stricher ermordet
München * Rudolph Mooshammer wird von dem irakischen Stricher Herish A. im Streit um den Liebeslohn erdrosselt.
2 2005 - Aus dem „Hochbunker“ wird ein komfortables Wohngebäude
München-Untergiesing * Nach einjähriger Umbauzeit wird der „Hochbunker“ an der Claude-Lorrain-Straße 26, in bester Lage zwischen „Schyrenbad“ und Isar, in ein komfortables Wohngebäude verwandelt.
Natursteinbäder, Massivholzböden, auffaltbare Fenster mit Sonnenschutz und ein Kamin je Wohnung gehören zur hochwertigen Ausstattung. Die ersten Familien beziehen das ehemalige „Kriegs-Bauwerk“ als „Luxuswohnhaus“.
16. 3 2005 - Die Instandsetzungsarbeiten der Villa Stuck sind abgeschlossen
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * Die Vollendung der Instandsetzungs- und Erweiterungsarbeiten der Villa Stuck werden mit einem Festakt gefeiert. Insgesamt 12,97 Millionen Euro musste die Stadt München dafür aufbringen. </p>
18. 3 2005 - Die Historischen Räume der Villa Stuck werden wiedereröffnet
<p><strong><em>München-Haidhausen</em></strong> * Die historischen Räume der Villa Stuck werden wiedereröffnet. </p>
4 2005 - Der „Club Ampere“ wird eröffnet
München-Haidhausen * Der „Club Ampere“ ergänzt die „Muffathalle“, das Café und den Biergarten.
2. 4 2005 - Papst Joannes Paul II. stirbt im Vatikan
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Papst Joannes Paul II. stirbt im Vatikan. Dieser Papst hat während seiner Amtszeit alleine 482 Personen <em>„zur Ehre der Altäre“</em> in den Heiligenstand erhoben. So viele wie kein anderer Papst in den vergangenen 500 Jahren vor ihm. </p> <p>Mit seiner eigenen Heiligsprechung am 27. April 2014 ist die Zahl der seit 1594 in den Heiligenstand erhobenen auf 839 angestiegen. </p>
19. 4 2005 - Kardinal Joseph Ratzinger wird zum Papst gewählt
<p><strong><em>Rom-Vatikan</em></strong> * Nach dem Tod des Papstes Johannes Paul II. wird Kardinal Joseph Ratzinger zu seinem Nachfolger auf dem <em>„Stuhl Petri“</em> gewählt. Der in Marktl am Inn als Sohn eines Gendarmen geborene gibt sich den Namen Benedikt XVI..Das motiviert die Bild-Zeitung umgehend, ihre Titelseite mit <em>„WIR SIND PAPST“</em> zu überschreiben. In der englischen Presse wird dagegen die Vergangenheit in der Hitler-Jugend des <em>„Papa-Ratzi“</em> hervorgehoben. </p>
25. 4 2005 - Maximilian Joseph Graf von Montgelas bekommt ein Denkmal
München-Kreuzviertel * Mit den Worten: „Heute erfüllt sich ein lang gehegtes Anliegen: Der Freistaat Bayern ehrt den großen Staatsmann Minister Maximilian Joseph Graf von Montgelas mit der Aufstellung eines Denkmals am Promenadeplatz“, übergibt „Finanzminister“ Kurt Faltlhauser das Denkmal der Öffentlichkeit.
Die fast zehn Tonnen schwere und 6,20 Meter hohe Skulptur wurde - nach einem Wettbewerb - von der Berliner Künstlerin und Kunstprofessorin Karin Sander geschaffen. Sie ließ dazu Montgelas-Büsten und Gemälde fotografieren und einscannen.
Mit den gesammelten Daten errechnete der Computer ein dreidimensionales Bild.
Auf dieser Datenbasis entwickelte die Künstlerin und der Engineering-Dienstleister „Bertrandt AG“ das tragende Stahlgerüst der aus fünfzehn Segmenten bestehenden Aluminiumfigur.
Die einzelnen Teile wurden aus viereckigen Rohlingen mit einem Gesamtgewicht von dreißig Tonnen auf „Fünf-Achs-Hochgeschwindigkeitsfräsen“ ausgefräst.
Die acht Tonnen schwere Figur wird von einem eineinhalb Tonnen schweren Stahlgerüst getragen. Die Verbindungstechnik im Inneren der Skulptur wiegt weitere 500 Kilo.
Damit das „Montgelas-Denkmal“ richtig wirkt, muss man es aus einiger Entfernung betrachten, erst dann kann man den Dargestellten eindeutig identifizieren.
Je näher man der Statue kommt, desto mehr löst sie sich - bedingt durch die Oberflächenstruktur - auf und wird abstrakt. Dieses „Abstandhalten“ zu dieser geschichtsträchtigen Persönlichkeit war ein Anliegen der Künstlerin.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Höhe der Skulptur.
Dabei ist sie mit ihren 6,20 Metern exakt genauso hoch wie das daneben stehende „Orlando-di-Lasso-Denkmal“. Allerdings mit dem Unterschied, dass der „Aluminium-Montgelas“ nicht auf einem Sockel, sondern in der Wiese steht.
Und das ist angemessen, da in einer demokratischen Gesellschaft niemand mehr idealisiert dargestellt und auf einem Sockel aufgestellt werden darf und damit für den „normalen Bürger“ unerreichbar wird.
Und ein „Reformer“, der noch dazu mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität steht, kann, wenn schon unbedingt ein persönliches Denkmal Aufstellung finden muss, durchaus angemessen sein.
Gleichzeitig mit der Aufstellung des „Montgelas-Denkmals“ wird sang- und klanglos die „Gedenktafel für Bayerns ersten demokratischen Ministerpräsidenten“, Kurt Eisner, mit der Begründung entfernt, dass ja in angemessenem Abstand und an authentischer Stelle seit dem Jahr 1989 eine Bodenplatte angebracht worden ist.
Die „Eisner-Gedenkplatte“ wird im Depot des „Münchner Stadtmuseums“ abgestellt.
25. 4 2005 - Die „Gedenktafel“ für Kurt Eisner am Promenadeplatz ist verschwunden
München-Kreuzviertel * Die „Gedenktafel“ für Kurt Eisner am Promenadeplatz ist über Nacht verschwunden, weil sie im Schatten des monströsen „Montgelas-Denkmals“ vielleicht besonders unangemessen gewirkt hätte.
Sie landet im Depot des „Münchner Stadtmuseums“ und wird dort irgendwann zur Schau gestellt werden.
4. 5 2005 - Eröffnung des U-Bahnhofs am Fröttmaninger Stadion
München * Eröffnung des U-Bahnhofs am Fröttmaninger Stadion.
7 2005 - Regenerative Energie aus dem Auer Mühlbach
München-Haidhausen * Die „Mammut Electric GmbH zur Gewinnung regenerativer Energie“ nimmt am Muffatwerk ein Elektrizitätswerk in Betrieb.
Hier erzeugt der Auer Mühlbach Strom für bis zu 1.500 Haushalte.
7. 9 2005 - Oberbürgermeister Christian Ude eröffnet das Bier & Oktoberfestmuseum
München-Angerviertel * Das Bier & Oktoberfestmuseum wird im ältesten noch erhaltenen Bürgerhaus Münchens, in der Sterneckerstraße 2, durch Oberbürgermeister Christian Ude eröffnet.
Den finanziellen Grundstock für die Ausstellung hat der inzwischen verstorbene Wiesnwirt und langjährige Sprecher der Wiesnwirte und Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Xaver Heilmannseder gelegt, nachdem er dem Verein Münchner Oktoberfestmuseum eine großzügige Erbschaft hinterlassen hat. Einige der in den 1980er-Jahren geschlossenen Deutschen Brauereimuseum e.V. finden sich nun im Bier & Oktoberfestmuseum wieder.
17. 9 2005 - Das Hofbräuhaus-Festzelt erstrahlt in neuem Glanz
München-Theresienwiese * Das Hofbräuhaus-Festzelt erstrahlt in neuem Glanz und erscheint seither wie ein Pendant des Stammhauses am Platzl.
17. 9 2005 - Die Ochsenbraterei erhält mehr Fenster und damit mehr Licht
München-Theresienwiese * Die Ochsenbraterei erhält an der Südseite mehr Fenster, die zusätzlich Licht ins Zelt lassen.
18. 9 2005 - Das Hacker-Festzelt erhält ein Cabrio-Dach
München-Theresienwiese * Das Hacker-Festzelt erhält ein Cabrio-Dach. Ein circa 50 qm großer Teil der überdachung kann bei geeignetem Wetter um einige Meter abgesenkt werden. Damit ist ein Blick auf den Sternenhimmel oder dem weiß-blauen Himmel vom Zeltinneren aus möglich. Außerdem zirkuliert die Luft im Zelt besser.
18. 9 2005 - Ergebnis der Bundestagswahl 2005
Bundesrepublik Deutschland - Berlin * Bei der Wahl zum 16. Bundestag erhält
- die SPD mit ihrem amtierenden Bundeskanzler Gerhard Schröder 34,2 Prozent [- 4,3] und 222 Sitze.
- Die CDU/CSU mit ihrer Kanzlerkandidatin Angela Merkel erringt 35,2 Prozent der Stimmen [- 3,3] und 226 Sitze.
- Die FDP bekommt 9,8 Prozent [+ 2,4] und 61 Sitze.
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN kommen auf 8,6 Prozent der abgegebenen Stimmen [- 0,5] und 51 Sitze.
- Die PDS erkämpft 8,7 Prozent der Stimmen [+ 4,7] und zieht mit 54 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Angelika Merkel wird Bundeskanzlerin in einer Großen Koalition bestehend aus CDU/CSU und SPD.
26. 9 2005 - Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens zum Wiesn-Attentat
München - Berlin - Wiesbaden * Am 25. Jahrestag des Wiesn-Attentats bringen mehrere Organisationen, Gewerkschaften und Einzelpersonen, darunter mehrere Münchner Stadträte sowie Landes- und Bundespolitiker der SPD, im Deutschen Bundestag einen Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens ein.
Der Antrag findet keine politische Mehrheit und wird vom Bundeskriminalamt - BKA abschlägig beschieden.
10 2005 - Die „Residenzpost“ wird an eine Bietergesellschaft verkauft
München-Graggenau * Eine Bietergemeinschaft bestehend aus der „Accumulata Immobilien Development“ und der „LBBW-Immobilien“, einer Tochter der „Landesbank Baden-Württemberg“, erwirbt die ehemalige „Residenzpost“.
Die beiden Firmen haben ambitionierte Pläne für das Gebäude und wollen auf dem rund 4.300 Quadratmeter großen Grundstück ein „Luxushotel der Extraklasse“ entstehen lassen, mit 160 bis 190 Zimmer, passend zur exklusiven Lage. 300 bis 390 Millionen Euro soll das Projekt kosten.
Im Gebäude können neben den „Hotelzimmern“ und „Suiten“, „Konferenzräume“, ein „Ballsaal“, ein „Wellnessbereich“ und edle „Boutiquen“ Platz finden.
Während die Verhandlungen mit möglichen Investoren geführt werden, beantragen die Eigentümer eine „alternative Nutzung“.
Diese ist ein Mix aus Gastronomie und Geschäften.
So findet sich hier die Diskothek „8seasons“, der „Feinkosthändler Käfer“, das „Café L’Opera“ und andere mehr, darunter auch der Schuhhersteller „Ed. Meier“.
26. 10 2005 - Der Erweiterungsbau für die Kunst-Akademie wird eröffnet
München-Maxvorstadt * Der moderne Erweiterungsbau für die Akademie der Bildenden Künste der Architektengruppe „Coop Himmelb(l)au“ wird offiziell eröffnet.
8. 12 2005 - Umbenennung der Von-Trotha-Straße beschlossen
München - München-Trudering * Nach einer erbitterten Redeschlacht beschließt der Kommunalausschuss die Umbenennung der Von-Trotha-Straße in Hererostraße. Die anderen drei strittigen Straßen werden ausgenommen.
Doch alle 29 Straßenbenennungen mit kolonialgeschichtlichem Hintergrund werden mit gedenkenden und erläuternden Schildern zur Namensherkunft versehen.
2006 - Die Garagenbrauer im „Giesinger Bierlaboratorium“ machen Ernst
München-Untergiesing * Die Garagenbrauer im „Giesinger Bierlaboratorium“ in der Birkenau 5 machen aus einem Hobby ihren Beruf.
Sie beginnen mit einer 100-Hektoliter-Anlage.
Die Brauanlage besteht im Wesentlichen aus einer umgebauten Doppelgarage, einem Gärkeller und einem darunterliegenden Lagerkeller.
2006 - Die „Giesinger Brauerei“ wird erstmals erweitert
München-Untergiesing * In der „Giesinger Brauerei“ wird erweitert und die Kapazität durch eine 1.000-Hektoliter-Anlage ersetzt.
Das ist der offizielle Beginn der kleinen Münchner Privatbrauerei, die damit zur „zweitgrößten Privatbrauerei Münchens“ aufsteigt - gleich nach der „Augustiner Brauerei“ mit cirka 1,1 Millionen Hektolitern.
2006 - Die „Museum-Lichtspiele“ beteiligen sich am „Münchner Filmfest“
München-Au * Die „Museum-Lichtspiele“ beteiligen sich am „Münchner Filmfest“.
24. 4 2006 - Der Kirchenaustritt stellt den Tatbestand des Schismas dar
Würzburg * Die Deutsche Bischofskonferenz stellt in einer Erklärung fest, dass der Austritt aus der katholischen Kirche den Tatbestand des Schismas darstellt und die Strafe der Exkommunikation nach sich zieht.
26. 6 2006 - Der Problembär Bruno wird im Spitzingseegebiet erschossen
Spitzingsee * Der „Problembär“ Bruno wird in der Nähe der Rotwand im Spitzingseegebiet erschossen.
12. 8 2006 - Mit dem Papa-Mobil zum Christopher-Steet-Day
München-Isarvorstadt * Dietmar Holzapfel, der Wirt der Deutschen Eiche nimmt mit einem provokant-politischen Wagen am Christopher-Steet-Day teil. Mit seinem Papa-Mobil sorgt er dabei für einen Skandal.
1. 9 2006 - Die Länder sind für den Ladenschluss zuständig
Berlin * Mit der Föderalismusreform gehen die Zuständigkeiten für den Ladenschluss geht auf die Bundesländer über.
Nach dem 16. 9 2006 - Ein CSU-Stadtrat flippt vor der Käfer-Wies‘nschänke aus
München-Theresienwiese * Der ehemalige CSU-Jungspund Christian Baretti, (er ist 2005 aus der CSU ausgetreten) seinerzeit Stadtrat und Drahtzieher der CSU-Wahlfälschungsaffäre, droht dem Türsteher der Käfer-Wies‘nschänke: „Ich werde Euere Haus zerlegen“. Als der Chef des Wachdienstes ankündigt, den Fall der Stadt zu melden, bleibt Baretti stur - und wird letztlich doch ins Zelt gelassen. Doch sein Auftritt hat eine Konsequenz: Er erhält eine schriftliche Missbilligung der Stadt.
Nach dem 16. 9 2006 - Paris Hilton will im Hippodrom einen Dosen-Prosecco präsentieren
München-Theresienwiese * Paris Hilton will im Hippodrom einen Prosecco aus der Dose präsentieren. Sepp Krätz muss sein Einverständnis zurückziehen, weil es die Stadt nicht erlaubt.
5. 10 2006 - Stadtrats beschließt die Umbenennung der Von-Trotha-Straße
München-Graggenau - München-Trudering * Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats beschließt die Umbenennung der Von-Throta-Straße in Hererostraße.
14. 10 2006 - Verlängerung der U-Bahn zum Garchinger Forschungszentrum
Garching * Die Untertunnelung Garchings zur Verlängerung des Streckenabschnitts der U 6 bis zum Forschungszentrum ist abgeschlossen.
9. 11 2006 - Die Hauptsynagoge am Jakobsplatz wird eingeweiht
München-Angerviertel * Die neue Hauptsynagoge der Israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz wird eingeweiht.
17. 11 2006 - Das Land Berlin kippt den Ladenschluss an Werktagen komplett
Berlin * Als erstes Bundesland kippt Berlin den Ladenschluss an Werktagen komplett. Geschäfte können von Montag bis Samstag rund um die Uhr öffnen. Zudem dürfen die Läden auch an den Adventssonntagen und bis zu sechs weiteren Sonntagen öffnen. Das benachbarte Brandenburg, aber auch andere Bundesländer ziehen nach.
2007 - Der Stadtrat beschließt „Rund um den Ostbahnhof - ROst“
München-Berg am Laim * Der Stadtrat beschließt ein Strukturkonzept für das 40 Hektar umfassende Areal zwischen Frieden-. Mühldorf-, Aschheimer- und Rosenheimer Straße.
Das Viertel firmiert unter dem Namen „Rund um den Ostbahnhof - ROst“ und gilt alleine schon wegen seiner guten öffentlichen Verkehrsanbindung und seiner unmittelbaren Nähe zur Innenstadt für die Stadtplaner als „Filetstück“.
2007 - München hat 1.348.650 Einwohner
München * München hat 1.348.650 Einwohner.
9. 1 2007 - Steve Jobs präsentiert das iPhone
<p><em><strong>San Francisco</strong></em> * Apple-Gründer Steve Jobs stellt der Weltöffentlichkeit erstmals das iPhone vor. Er präsentiert es als Kombination aus iPod, Mobiltelefon und Internetgerät und startet damit den Siegeszug der Smartphones.</p>
2. 2 2007 - Kardinal Wetter tritt als Erzbischof zurück
München-Kreuzviertel * Kardinal Wetter tritt als Erzbischof aus Altersgründen zurück. Gleichzeitig wird er zum Apostolischen Administrator für das Erzbistum München und Freising ernannt.
14. 2 2007 - München behält das „Deutsche Theater“ und renoviert es
München-Ludwigsvorstadt * Der Stadtrat lehnt das letzte Kaufangebot der „Musicalfirma Stage Entertainment“ ab und entscheidet:
München behält das „Deutsche Theater“ und renoviert es.
21. 6 2007 - Georg Danzer stirbt
<p><strong><em>Wien</em></strong> * Der österreichische Liedermacher Georg Danzer stirbt. </p>
29. 6 2007 - Das iPhone wird erstmals verkauft
USA * Das iPhone wird erstmals verkauft.
11. 7 2007 - Anwohnerklage gegen Straßenumbenennung abgewiesen
München-Waldtrudering * Das Verwaltungsgericht München weist die Klagen des damaligen Truderinger Bezirksausschuss-Vorsitzenden und weiterer Anwohner zur Umbenennung der Von-Throta-Straße in Hererostraße endgültig ab.
??? 9 2007 - Sepp Krätz lässt die üblichen Kieselsteine um sein „Hippodrom“ teeren
München-Theresienwiese * Sepp Krätz lässt die üblichen Kieselsteine um sein „Hippodrom“ teeren, damit seine illustren Gäste geraden Schritts in Zelt kommen, auch auf High Heels.
Nicht bedacht hat er jedoch, dass die Kiesel bei Regen für die nötige Drainage sorgen.
Als dann das Wasser von oben kam, floss es nicht mehr in den Untergrund - sondern in einen Kabelschacht.
Und weil sich Elektrizität und Feuchtigkeit nicht gut vertragen, gab‘s plötzlich in allen Zelten keinen Strom mehr.
9 2007 - In der „Ochsenbraterei“ werden 104 Ochsen verzehrt
München-Theresienwiese * In der „Ochsenbraterei“ werden 104 Ochsen verzehrt.
9 2007 - Das „Hacker-Festzelt“ wird erstmals komplett mit Energiesparlampen erhellt
München-Theresienwiese * Das „Hacker-Festzelt“ wird erstmals komplett mit Energiesparlampen erhellt.
18.000 kWh Strom und 9.000 kg Kohlendioxyd werden eingespart.
9 2007 - Margot Steinberg kauft die „Wienerwald-Namensrechte“ zurück
München * Margot Steinberg kauft - gemeinsam mit ihrer Schwester - die Namensrechte für die „Wienerwald-Gastronomie“ zurück.
9 2007 - Der „Lüftlmaler“ Sepp Ingerl malt Boxen des „Hofbräuhaus-Festzeltes“ aus
München-Theresienwiese * Der „Lüftlmaler“ Sepp Ingerl malt viele Boxen des „Hofbräuhaus-Festzeltes“ mit München-Motiven aus.
Es gibt einen neuen Zelthimmel mit rautengemusterten Soffbahnen auf denen Masskrüge, Hopfengirlanden und Brezn abgebildet sind.
9. 11 2007 - Das Baureferat bringt die neuen Straßenschilder Hererostraße an
München-Waldtrudering * Das Baureferat entfernt die alten Straßenschilder „Von-Trotha-Straße“ und bringt dafür die Neuen mit der Bezeichnung „Hererostraße“ an. Sie werden noch einige Zeit beschädigt und beschmiert.
22. 11 2007 - Eröffnung der Volkssänger-Ausstellung
München-Graggenau * Die Volkssänger-Ausstellung im Nordturm des Valentin-Karlstadt-Musäums wird eröffnet.
30. 11 2007 - Reinhard Marx wird 13. Erzbischof von München und Freising
Rom-Vatikan * Papst Benedikt XVI. ernennt den bisherigen Bischof von Trier, Reinhard Marx, zum 13. Erzbischof von München und Freising.
2008 - Die Westfassade des „Hofbräuhaus-Festzeltes“ wird neu gestaltet
München-Theresienwiese * Die Westfassade des „Hofbräuhaus-Festzeltes“ wird mit einer großen Glasfläche neu gestaltet.
Es gibt neue Lüftungsmöglichkeiten und die Boxen werden denen der Südseite angepasst.
2008 - Wolfgang Ischinger übernimmt den Vorsitz der „Sicherheitskonferenz“
München-Kreuzviertel * Umbenennung der „Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik (MSK)“ in „Münchner Sicherheitskonferenz * Munich Security Conference (MSC)“.
Der Botschafter Wolfgang Ischinger übernimmt von Horst Teltschik den Vorsitz der „Münchner Sicherheitskonferenz“.
2008 - Das „Mahnmal für die Opfer des Wiesn-Attentats“ wird neu gestaltet
München-Theresienwiese * Das „Mahnmal für die Opfer des Wiesn-Attentats“ wird neu gestaltet.
Die 1981 durch Friedrich Koller entworfene, bronzene Stele ist von ihm um eine halbrunde, durchlöcherte Stahlwand erweitert worden, die an die Streukraft der Bombe erinnern soll.
2008 - Mit der „Renaturierung der Isar“ verschwinden die „Surfwellen“ im Fluss
München-Isarvorstadt * Mit der „Renaturierung der Isar“ verschwinden die „Surfwellen“ im Fluss.
30. 1 2008 - Übergewichtige Männer und Frauen
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Eine bundesweite Ernährungsstudie wird veröffentlicht, nach der 66 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen übergewichtig sind. </p>
2. 2 2008 - Reinhard Marx wird in sein neues Amt eingeführt
München-Kreuzviertel * Kardinal Friedrich Wetters Amtszeit endet. Reinhard Marx wird im Rahmen eines Pontifikalamtes in sein neues Amt als Münchner Erzbischof eingeführt.
25. 6 2008 - Der Stadtrat will ein neues Kurt-Eisner-Denkmal
München * Aufgrund des bevorstehenden 90. Todestages von Kurt Eisner am 21. Februar 1919 beschließt der Stadtrat die Ausschreibung eines neuen Denkmals für den ersten demokratischen Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern.
24. 7 2008 - Das neugestaltete Valentin-Karlstadt-Musäum wiedereröffnet
München-Graggenau * Mit einem Festakt im Innenhof des Isartors wird das völlig neu gestaltete Valentin-Karlstadt-Musäum eröffnet.
Um 8 2008 - Die Sanierung im „Deutschen Theater“ beginnt
München-Ludwigsvorstadt * Die Bühnentechnik und die Inneneinrichtung im „Deutschen Theater“ werden abgebaut.
Die „Asbestsanierung“ beginnt.
9 2008 - 6.483 „Lebensmittel- und Hygienekontrollen“ auf dem Oktoberfest
München-Theresienwiese * 6.483 „Lebensmittel- und Hygienekontrollen“ werden von sieben Mitarbeitern des „Kreisverwaltungsreferats“ durchgeführt.
Es geht um die Einhaltung der einschlägigen Lebensmittelvorschriften und -vorgaben.
703 Beanstandungen werden verzeichnet.
9 2008 - Jeder „Wiesnbesucher“ trinkt im Durchschnitt 1,1 Liter „Wiesnbier“
München-Theresienwiese * Jeder „Wiesnbesucher“, ob Erwachsener, Kind oder Greis, schafft im Durchschnitt 1,1 Liter „Wiesnbier“.
9 2008 - Erich, Dieter und Werner Hochzeiter übernehmen kleine Wiesnzelte
München-Theresienwiese * Nach dem Tod von Erich Hochreiter sen. ist jeder der drei Söhne (Erich, Dieter und Werner) für eine der drei kleinen „Festzelte“ zuständig.
Erich für die „Weißbier-‘Carousel‘-Bar“, Dieter für die „Haxenbraterei“ und Werner für die „Bratwurst“.
9 2008 - Siegfried Able eröffnet auf der Wiesn seine „Kalbskuchl“
München-Theresienwiese * Siegfried Able eröffnet auf der Wiesn seine „Kalbskuchl“, eines der kleinen „Wiesnzelte“.
28. 9 2008 - Ergebnis der Wahl zum Bayerischen Landtag 2008
Freistaat Bayern * Bei der Wahl zum 16. Bayerischen Landtag
- stürzt die CSU mit ihrem amtierenden Bayerischen Ministerpräsidenten Günter Beckstein auf 43,4 Prozent [- 17,3] ab und verliert nicht nur 32 Abgeordnetenmandate [jetzt 92], sondern auch die seit 1962 ununterbrochen erreichte absolute Mehrheit der Landtagsmandate.
- Die SPD mit ihrem Kandidaten Franz Maget erringt 18,6 Prozent der Stimmen [- 1,0] und 39 Sitze das bisher schlechteste Ergebnis seit 1946.
- Die FDP bekommt 8,0 Prozent [+ 5,4] und 16 Sitze und kommen nach 14 Jahren Abwesenheit im bayerischen Parlament wieder zurück.
- Erstmals ziehen die Freien Wähler mit 10,2 Prozent der Stimmen [+ 6,2] und 21 Sitzen in den Bayerischen Landtag ein.
- DIE GRÜNEN kommen auf 9,4 Prozent der Wählerstimmen [+ 1,7] und 19 Sitze.
10 2008 - Das „Deutschen Theater“ zieht in ein „Theaterzelt“ nach Fröttmaning
München-Ludwigsvorstadt - München-Fröttmaning * Anders als bei den vorhergehenden Sanierungen ruht der Theaterbetrieb im „Deutschen Theater“ nicht.
Das Unternehmen zieht während der Zeit der Sanierung in ein riesiges „Theaterzelt“ nahe der Fröttmaninger „Fußballareana“.
Das Exil soll bis Ende 2011 dauern.
Diese Übergangslösung ist allerdings sehr teuer.
Allein die Zeltmiete kostet im Jahr gut zwei Millionen Euro.
Und weil am Anfang nicht genug Publikum kommt, schreibt das Theater Verluste.
27. 10 2008 - Horst Seehofer wird zum Ministerpräsidenten gewählt
München * Horst Seehofer wird vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt.
2009 - Acht Millionen Dokumente zur bayerischen Geschichte
München-Maxvorstadt * In Stahlregalen von insgesamt 46 Kilometern Länge liegen im „Bayerischen Hauptstaatsarchiv“ rund 8 Millionen Dokumente zur bayerischen Geschichte aus über 1.200 Jahren.
Zur Benutzung des „Geheimen Hausarchivs der Wittelsbacher“, das 750 laufende Regalmeter umfasst, braucht man eine Extragenehmigung des „Herzogs“ von Bayern.
2009 - 3.900 Megawatt Strom erzeugt Bayerns „Photovoltaik“
Freistaat Bayern * Mit der „Photovoltaik“ werden in Bayern 3.900 Megawatt Strom produziert.
2009 - Die „Josef Bernbacher & Sohn GmbH & Co KG“
München-Au * Die „Josef Bernbacher & Sohn GmbH & Co KG“ ist einer der größten Nudelhersteller in Deutschland.
30.000 Tonnen Nudeln werden pro Jahr in der Fabrik am Tassiloplatz hergestellt.
Rund 50 Millionen Umsatz Euro macht die Firma.
Die Wirtschaftskrise hat dem Unternehmen, das 130 Mitarbeiter hat, nicht geschadet.
Im Gegenteil: „Viele, die sich nicht mehr so oft Fleisch leisten wollen, essen jetzt öfters mal Nudeln“.
Mehr als Dreiviertel der Produktion wird in Bayern verkauft.
Diese Beschränkung auf den regionalen Markt ist eines der Erfolgsrezepte von Bernbacher.
2009 - Ein Film über die Surfszene am „Eisbach“
München-Englischer Garten - Lehel * Bjoern Richie präsentiert seinen Dokumentarfilm „Keep surfing“ über die Surfszene am „Eisbach“.
2009 - Das „Surfen“ an der „Floßlände“ ist nur mehr eingeschränkt möglich
München-Thalkirchen * Das „Surfen“ an der „Floßlände“ in Thalkirchen ist nur mehr eingeschränkt möglich.
2009 - München hat 1.364.194 Einwohner
München * München hat 1.364.194 Einwohner.
1 2009 - Das „Café L’Opera“ muss seine Räume in der „Residenzpost“ aufgeben
München-Graggenau * Das „Café L’Opera“ muss seine Räume in der „Residenzpost“ aufgeben.
Gleiches passiert dem „Feinkosthändler Käfer“ im Februar.
2 2009 - Keine Investoren für das „Luxushotel“ in der ehemaligen „Residenzpost“
München-Graggenau * Weil sich für das angestrebte „Luxushotel“ in der ehemaligen „Residenzpost“ zwar namhafte Betreiber, aber immer noch keine Investoren haben finden lassen, entscheiden sich die „Accumulata Immobilien Development“ und die „LBBW Immobilien“ für einen „zweiten Weg“, auch wenn noch weitere Gespräche in Richtung „Luxushotel der Extraklasse“ geführt werden.
Die Eigentümer haben in der Zwischenzeit einen „Bauantrag“ eingereicht, der Wohnungen, Büros, Geschäfte und schicke Bars vorsieht.
Einfach der berühmte „Münchner Mix“, der immer dann entsteht, wenn eine teuere Immobilie in bester Lage auf den Markt kommt.
21. 2 2009 - Kurt Eisners Porträt für die Bayerische Staatskanzlei
München-Kreuzviertel * Am 90. Todestag des ersten demokratischen Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern wird vom Verein „Das andere Bayern e.V.“ für die Bayerische Staatskanzlei ein Porträt von Kurt Eisner gestiftet und übergeben.
Das Geschenk wird zwar vom Pförtner entgegen genommen, aber mit einer fadenscheinigen Argumentation trotzdem nicht aufgehängt.
9. 3 2009 - Wegen Generalsanierung wird das Lenbachhaus geschlossen
München-Maxvorstadt * Wegen Generalsanierung wird das Lenbachhaus geschlossen. 52,6 Millionen € werden dafür bereitgestellt.
30. 4 2009 - Ein Wettbewerb für das neue Kurt-Eisner-Denkmal
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Landeshauptstadt München lädt zwölf Künstler zu einem nicht-öffentlichen Wettbewerb für die Gestaltung eines neuen Denkmals für den ersten demokratischen Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Kurt Eisner. </p>
19. 5 2009 - Umbenennung des Marienhofs in Kurt-Eisner-Platz gefordert
München * Wolfram P. Kastner und Ruth Oppl realisieren eine Kunstaktion
- zur Umbenennung des Marienhofs in Kurt-Eisner-Platz,
- sie fordern, das geplante Kurt-Eisner-Denkmal dort zu errichten und
- wollen den 7. November als Feiertag.
6 2009 - Das „Michael-Jackson-Memorial“ auf dem „Promenadeplatz“
München-Kreuzviertel * Das „Orlando-di-Lasso-Denkmal“ auf dem „Promenadeplatz“ dient den trauernden „Michael-Jackson-Fans“ als „Memorial“.
6 2009 - Die Sanierungsarbeiten am „Deutschen Theater“ verzögern sich
München-Ludwigsvorstadt * Erstmals wird öffentlich darüber gesprochen, dass die Sanierungsarbeiten am „Deutschen Theater“ länger als geplant dauern werden.
Der Grund sind Arbeiten am Fundament, das tiefer in die Erde reichen könnte, als von den Genehmigungen gedeckt.
Die Sache ist heikel, weil unter dem Theater die U-Bahn verläuft.
19. 6 2009 - Jörg Hube stirbt in München
München * Der Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Jörg Hube stirbt im Alter von 65 Jahren in München.
25. 6 2009 - Michael Jackson stirbt in Los Angeles
Los Angeles * Der Sänger, Songwriter und Tänzer Michael Jackson stirbt in Los Angeles an einer akuten Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol, das er wegen seiner Schlaflosigkeit verschrieben bekam.
19. 9 2009 - Betriebsvorschrift des Referats für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt
München-Theresienwiese * Im § 53 der Betriebsvorschrift des Referats für Arbeit und Wirtschaft, Tourismusamt Abt. Veranstaltungen heißt es Thema Bierausschank:
- „Das Oktoberfest ist das traditionelle Münchner Volksfest mit Münchner Gastlichkeit und Münchner Bier.
- Diese Tradition gilt es weiter zu wahren.
- An Wiesnbesucher darf deshalb nur Münchner Bier der leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien (das sind derzeit: Augustinerbrauerei, Hacker-Pschorr-Brauerei, Löwenbrauerei, Paulanerbrauerei, Spatenbrauerei und Staatliches Hofbräuhaus), das den Münchner Reinheitsgebot von 1487 und dem Deutschen Reinheitsgebot von 1906 entspricht, ausgeschenkt werden.
- Das Festbier darf nur in Maßkrügen (1,0 l Gefäßen) und das Weißbier in 0,5 l Gefäßen (Weißbierglas) ausgeschenkt werden“.
19. 9 2009 - Mit Ventilatoren wird im Hofbräuhaus-Festzelt der Rauchabzug verbessert
München-Theresienwiese * Zur besseren Entlüftung werden im Hofbräuhaus-Festzelt Ventilatoren in die Rauchabzüge integriert und weitere große Fenster zum öffnen in der Westfassade eingebaut.
27. 9 2009 - Ergebnis der Bundestagswahl 2009
Berlin * Bei der Wahl zum 17. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrer amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel 33,8 Prozent [- 1,4] und 239 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier erringt 23,0 Prozent der Stimmen [- 11,2] und 146 Sitze.
- Die FDP bekommt 14,5 Prozent [+ 4,7] und 93 Sitze.
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN kommen auf 10,7 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 2,6] und 68 Sitze.
- Die PDS erkämpft 11,9 Prozent der Stimmen [+ 3,2] und zieht mit 76 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Angelika Merkel wird Bundeskanzlerin einer Koalition bestehend aus CDU/CSU und FPD.
4. 10 2009 - Die Wiesnbesucher verspeisen 111 Ochsen in der Ochsenbraterei
München-Theresienwiese * Die Wiesnbesucher verspeisen 111 Ochsen in der Ochsenbraterei.
4. 10 2009 - Auf der Wiesn kommt es zu 43 Masskrugschlägereien
München-Theresienwiese * Auf der Wiesn kommt es zu 43 Masskrugschlägereien.
8. 11 2009 - Gedenktafel an die Reichskristallnacht am Alten Rathauses angebracht
München-Graggenau * Nach Protesten aus der Bevölkerung wird eine Kopie der Gedenktafel an die Reichskristallnacht neben dem Eingang des Alten Rathauses angebracht und enthüllt.
12 2009 - Die „Schack-Galerie“wird nach einer Generalsanierung wieder eröffnet
München-Lehel * Nach einer Generalsanierung wird die „Schack-Galerie“ in der Prinzregentenstraße 9 wieder eröffnet werden.
148 Originale und 24 Kopien aus der „Sammlung Schack“ werden gezeigt.
12 2009 - Die Rohbauarbeiten am „Deutschen Theater“ beginnen
München-Ludwigsvorstadt * Die Rohbauarbeiten am „Deutschen Theater“ beginnen.
Schon bald tauchen die ersten Probleme und Überraschungen auf, von denen trotz intensiver Begutachtung niemand wusste: ein unbekanntes Kellergewölbe, Pilzbefall oder statische Probleme.
All das kostet Zeit und Geld.
1. 12 2009 - Öffnung der Adventsonntage der Einzelhandelsgeschäfte verboten
Karlsruhe * Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe untersagt die Freigabe der Adventsonntage zur Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte in Berlin. „Die 2006 getroffene Regelung verletzt das Recht der Kirchen auf Religionsfreiheit“, heißt es in der Urteilsbegründung.
2010 - Das Anbaugebiet des Baierweins ist auf 4 Hektar angewachsen
<p><strong><em>Freistaat Bayern - Niederbayern</em></strong> * Das Anbaugebiet des Baierweins ist auf 4 Hektar angewachsen.</p>
3 2010 - Das Konzept für die Neugestaltung des „Platzes der Opfer“ wird vorgestellt
München-Maxvorstadt * Dem Stadtrat wird ein Konzept über die Neugestaltung des „Platzes der Opfer des Nationalsozialismus“ vorgestellt.
Eine zusammenhängende Platzfläche soll ein ungestörtes, zur Besinnung anregendes Verweilen ermöglichen.
Den Schwerpunkt des Platzes bildet eine nahezu quadratische Fläche, in deren Zentrum das bestehende Denkmal neu platziert wird.
Durch zusätzliche Inschriften werden das Gedenken an alle Opfergruppen sowie der Hinweis auf den örtlichen Bezug zur „Gestapo-Zentrale“ und dem künftigen „NS-Dokumentationszentrum“ stärker hervorgehoben.
Nach dem 18. 9 2010 - Sepp Krätz wird mit groben Fußtritten handgreiflich
München-Theresienwiese * Sepp Krätz wird auf der Wiesn gegenüber eine im Hippodrom beschäftigte Reinigungskaft mit groben Fußtritten handgreiflich. Den Strafbefehl über 18.000 € akzeptiert er. Das Hippodrom überlässt ihm die Stadt aber nur mehr auf Bewährung.
18. 9 2010 - Nach 62 Jahren erstellt Augustiner für seine Festhalle wieder einen Turm
München-Theresienwiese * Nach 62 Jahren erstellt Augustiner für seine Festhalle wieder einen Turm. Er hat eine Grundfläche von 6 x 6 Metern, ist 25,67 Meter hoch und besitzt 4 Ebenen. Im 1. Stock ist eine Kühlzelle eingebaut. Das Erdgeschoss ist als Lagerhalle für die Holzfässer und das Stangeneis ausgebaut.
18. 9 2010 - Das Winzerer-Fähndl-Festzelt bekommt eine unerirdische Bierleitung
München-Theresienwiese * Das Winzerer-Fähndl-Festzelt bekommt eine neue Festhalle. Das Zelt ist eine stützenfreie Konstruktion mit einer Spannweite von 37 Metern. Dadurch wirkt das Wiesnzelt offener und luftiger. Auch der 25 Meter hohe Turm und der Masskrug wird erneuert. Dieser fasst theoretisch 42.300 Liter Wiesnbier. Die neuen Biertisch-Garnituren bieten mehr Beinfreiheit. Mit der ebenfalls neuen unterirdischen Bierleitung ist die Winzerer-Fähndl-Festhalle das modernste und sicherste Wiesnzelt.
18. 9 2010 - Der Probebetrieb für die neue Bier-Ringleitung beginnt
München-Theresienwiese * Der Probebetrieb für die neue Bier-Ringleitung im Winzerer-Fähndl-Festzelt beginnt. Gleichzeitig mit den Fundamenten für das neue Zelt wurde auch die unterirdische Bierleitung gelegt. Die Anlage ist 300 Meter lang und verläuft in einem großen Quadrat gut einen Meter unter dem Zeltboden. Wenn die Leitung gefüllt ist, befinden sich insgesamt 2.400 Liter Bier darin. Die Fließgeschwindigkeit ist minimal, damit kein Schaum entsteht.
Es gibt nur eine einzige Einfüllstelle an der nordöstlichen Ecke des Rohrquadrats. Die neuen Behälter für die Zentralversorgung lassen sich in einer Stunde auffüllen. Der Weg des Bieres ist eine Wissenschaft für sich. Er beginnt in der Paulaner Brauerei, wo es bei minus ein Grad in Tankwagen gefüllt wird. Mit etwa null Grad kommt es am Winzerer-Fähndl-Festzelt an, wo es in die drei Riesentanks mit je 28.000 Liter gefüllt wird. Dort kann der Gerstensaft noch zwei oder drei Grad wärmer werden, bevor er in die unterirdische Leitung fließt.
Die Rohre haben einen Durchmesser von 10 Zentimeter für den Bier-Durchfluss, umschlossen von einer 20 Zentimeter dicken Dämmung. Die letzten vier bis sechs Meter zur Schenke kommt noch ein zusätzlicher Durchlaufkühler hinzu, damit der Gast seine Mass Bier mit einer anständigen Temperatur von sechs bis sieben Grad bekommt.
18. 9 2010 - Alle Wiesn-Zelte haben Bändchen für die Reservierungs-Gäste
München-Theresienwiese * Praktisch alle großen Wiesn-Zelte haben mittlerweile Bändchen für die Reservierungs-Gäste. Und die „Super-Sonder-VIP-Gäste“ werden in streng geheime Rituale eingeweiht, einen Button am Hemd, ein geheimes Passwort, und die Türsteher wissen, mit wem sie es zu tun haben.
11. 10 2010 - Der Streckenabschnitt der U 3 bis Moosach geht in Betrieb
München-Moosach * Der Streckenabschnitt der U 3 bis Moosach geht in Betrieb. Erstmals in der Geschichte der Münchner U-Bahn wird an keinem neuen Streckenabschnitt gebaut.
11 2010 - Die Wiedereröffnung des „Deutschen Theaters“ verzögert sich
München-Ludwigsvorstadt * Die Wiedereröffnung des „Deutschen Theaters“ ist nun für Oktober 2012 geplant.
Doch auch dieser Termin ist nicht sicher.
Zur Not muss das Theater halt bis April 2013 in seinem Zelt bleiben, heißt es in einem Papier der Stadtverwaltung.
Theater-Chef Werner Steer braucht aber einen klaren Umzugstermin, „denn wir müssen die Eröffnungsproduktion bereits jetzt planen“.
20. 11 2010 - Reinhard Marx wird Kardinal
Rom-Vatikan * Erzbischof Reinhard Marx wird von Papst Benedikt XVI. in das Kardinalskollegium aufgenommen. Bis zum Februar 2012 ist der Münchner Bischof das jüngste Mitglied des Kardinalskollegiums.
2011 - Der Name Weinzierl taucht im Münchner Telefonbuch 129 Mal auf
München * Der Name Weinzierl taucht im Münchner Telefonbuch 129 Mal auf.
2011 - 1.459 Betreiber bewerben sich für's Oktoberfest
München-Theresienwiese * 1.459 Betreiber bewerben sich für einen Betrieb auf dem Oktoberfest. 617 Betriebe werden zugelassen. Davon sind 268 Schausteller und 305 Marktkaufleute, städtische Verkaufseinrichtungen sowie mehrere Servicebetriebe.
2011 - Der Englische Garten, eine der weltweit größten Parkanlagen
München-Englischer Garten * Wenn man die Maximiliansanlage, den Hofgarten und den Finanzgarten hinzu zählt, umfasst der Englische Garten eine Fläche von über 417 Hektar.
- Die drei Bäche (Schwabinger Bach, Eisbach und Oberstjägermeisterbach) haben eine Länge von 8,5 Kilometern.
- Von den 16 Hektar Wasserflächen ist der Kleinhesseloher See mit acht Hektar das größte Gewässer.
- Das 78 Kilometer lange Wegenetz (davon 12 Kilometer Reitwege) beinhaltet auch über 100 Brücken und Stege.
2011 - Nur noch 60 Prozent Christen in Deutschland
Bundesrepublik Deutschland * Der Anteil der Christen an der Bevölkerung in Deutschland sinkt innerhalb von fünf Jahren um drei Prozent.
- Die evangelischen Kirchenmitglieder sinken in diesem Zeitraum um gut zwei Millionen auf 23,6 Millionen.
- Die Zahl der Katholiken sinkt um gut 1,5 Millionen auf 24,5 Millionen.
- Von rund 80 Millionen Bewohnern Deutschlands sind nur mehr 48,1 Millionen christlichen Glaubens. Das sind sechzig Prozent.
2011 - München ist die am dichtesten besiedelte Großstadt Deutschlands
München * München ist die am dichtesten besiedelte Großstadt Deutschlands. In der mit 1,4 Millionen Menschen bundesweit drittgrößten Stadt leben 4.340 Einwohner auf dem Quadratkilometer.
2011 - Bierverbrauch sinkt um 37 Prozent gegenüber 1980
Bundesrepublik Deutschland * Der durchschnittliche Bierverbrauch liegt in Deutschland nur noch bei 106,6 Liter. Zum Vergleich: 1980 waren es noch 145,9 Liter. Das ist ein Rückgang von rund 37 Prozent.
16. 1 2011 - Letzter Gottesdienst in der Giesinger Heilig-Kreuz-Kirche
München-Obergiesing * Nach dem vorerst letzten Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing finden die Gottesdienste in der Kapelle des Altenheims Sankt Alfons am Bergsteig statt.
5 2011 - Der Umzugstermin für das „Deutsche Theater“ verzögert sich erneut
München-Ludwigsvorstadt - München-Fröttmaning * Nun wird der Umzugstermin für das „Deutsche Theater“ im April 2013 offiziell.
Die Stadtverwaltung genehmigt weitere zwei Millionen Euro für den längeren Zelt-Betrieb in Fröttmaning.
5 2011 - Die Grünen machen sich stark für den Erhalt der „Birkenau“
München-Untergiesing * Die Stadtratsfraktion der Grünen macht sich stark für den Erhalt der „Birkenau“, dem historischen „Kutscherviertel“ in Untergiesing.
1. 5 2011 - Papst Benedikt XVI. spricht seinen Vorgänger, Papst Johannes Paul II., selig
Rom-Vatikan * Papst Benedikt XVI. spricht seinen Vorgänger, Papst Johannes Paul II., selig.
8 2011 - Ein Schwelbrand im Dachstuhl des „Deutschen Theaters“
München-Ludwigsvorstadt * Ein Schwelbrand im Dachstuhl des gerade sanierten „Deutschen Theaters“ wird den geplanten Umzugstermin nicht verzögern.
13. 8 2011 - Die Wiesnwirt-Legende Willy Heide stirbt
Planegg - München-Theresienwiese * Die Wiesnwirt-Legende Willy Heide stirbt im Alter von 91 Jahren.
17. 9 2011 - Wiggerl Hagn kann sein 50-jähriges Wiesnjubiläum feiern
München-Theresienwiese * Ludwig Wiggerl Hagn kann sein 50-jähriges Wiesnjubiläum feiern. Er ist damit der dienstälteste Wiesnwirt.
17. 9 2011 - Zwei Frauen führen die Ochsenbraterei
München-Theresienwiese * Antje Schneider ist - gemeinsam mit ihrer Mutter Anneliese Haberl - Chefin der Ochsenbraterei, nachdem ihr Vater Hermann Haberl im Februar 2011 verstorben ist.
17. 9 2011 - Eine 300 Meter lange Ringleitung auch in der Bräurosl
München-Theresienwiese * Über eine 300 Meter lange Ringleitung wird das goldfarbene Pschorr-Wiesnbier in der Bräurosl zu den Schänken geliefert. Die Bräurosl verfügt damit als zweites Bierzelt über diese Technik.
17. 9 2011 - Der Turm der Augustiner-Festhalle wird auf 30 Meter aufgestockt
München-Theresienwiese * Der Turm der Augustiner-Festhalle wird um weitere fünf Meter auf 30 Meter Höhe aufgestockt.
10 2011 - Unzufrieden mit der Leistung der Architekten und Projektsteuerer
München-Ludwigsvorstand * Nach einer Sitzung des „Aufsichtsrates des Deutschen Theaters“ lässt dessen Chef Hep Monatzeder wissen, dass man „sehr unzufrieden“ ist mit der Leistung der Architekten und Projektsteuerer.
Doch eine Auswechslung der Verantwortlichen für die Baustelle will bei dem Stand des Verfahrens keiner mehr.
Deutlich wird, dass die 86 Millionen Euro nicht reichen werden.
Außerdem ist die geplante Wiedereröffnung im Frühjahr 2013 sehr ungewiss.
Womöglich wird der Umzugstermin erst im Oktober 2013 stattfinden.
3. 10 2011 - 6,9 Millionen Menschen haben die Wiesn
München-Theresienwiese * Insgesamt 6,9 Millionen Menschen haben das größte Volksfest der Welt, die Wiesn, besucht. Davon kamen rund 20 Prozent aus dem Ausland.
- 118 Ochsen werden in der Ochsenbraterei verspeist, 522.821 Hendl werden gegessen und 7.922.500 Mass Wiesnbier fließen durch die durstigen Kehlen.
22. 11 2011 - Georg Franz Kreisler stirbt in Salzburg
Salzburg • Der Dichter, Komponist und Sänger Georg Franz Kreisler stirbt im Alter von 89 Jahren in Salzburg.
2012 - Der „Ratskeller“ bietet Platz für 1.200 Personen
München-Graggenau * Der „Ratskeller“ bietet Platz für 1.200 Personen.
2012 - Auf dem Gelände des „Togalwerks“ entstehen 60 Eigentumswohnungen
München-Bogenhausen * Auf dem Gelände des „Togalwerks“, dort wo einst Schmerztabletten hergestellt wurden entstehen durch die „Bayerische Hausbau“ 60 Eigentumswohnungen „im gehobenen Segment“ und moderne Büros.
Der neubarocke Bau des ehemaligen „Betz'schen Gasthauses“ an der Ismaninger Straße bleibt bestehen.
2012 - In Deutschland gibt es über 1.300 Brauereien
Bundesrepublik Deutschland * In Deutschland setzen die mehr als 1.300 Brauereien rund 96 Millionen Hektoliter Bier ab.
2012 - 4.220 bayerische „Wasserkraftanlagen“ erzeugen 12.500 Gigawattstunden Strom
Freistaat Bayern * In Bayern erzeugen 4.220 „Wasserkraftanlagen“ 12.500 Gigawattstunden Strom.
Damit werden 15 Prozent des bayerischen Stromverbrauchs gedeckt.
In 93 Prozent der bayerischen Flüsse sind Anlagen zur Stromgewinnung eingebaut.
22. 2 2012 - Anton Weinfurtner, der ehemalige Wiesnwirt vom Hippodrom, stirbt
München-Theresienwiese * Der ehemalige Wiesnwirt vom Hippodrom, Anton Weinfurtner, stirbt im Alter von 80 Jahren. Er erliegt im Klinikum Bogenhausen den Verletzungen, die er sich am Tag zuvor (Faschingsdienstag) bei einem Sturz zugezogen hat.
3 2012 - Die Rohbauarbeiten im „Deutschen Theater“ sind abgeschlossen
München-Ludwigsvorstadt * Die Rohbauarbeiten im „Deutschen Theater“ sind abgeschlossen, der Innenausbau läuft.
Klar ist inzwischen, dass die Wiedereröffnung nicht vor Herbst 2013 stattfinden wird.
22. 3 2012 - Reinhard Marx wird zum Präsidenten der EU-Bischofskonferenzen gewählt
<p><strong><em>St. Gallen</em></strong> * Kardinal Reinhard Marx wird zum Präsidenten der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft - COMECE gewählt. </p>
8. 5 2012 - Vergabe der Konzessionen für die Wiesn 2012
München-Graggenau * Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats entscheidet über die Vergabe der Konzessionen für die Wiesn 2012. Wiesnwirt Sepp Krätz kann vorerst das „Hippodrom“ weiterbetreiben. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft braucht noch Zeit, um die Ermittlungen in Sachen Steuerhinterziehung abzuschließen. Diese haben im Herbst 2011 begonnen.
Krätz soll in seinem „Andechser am Dom“ Personalabgaben nicht korrekt abgeführt haben. Insgesamt werden drei Durchsuchungen von der Steuerfahndung durchgeführt.
Die Stadt hat ihn 2011 bereits abgemahnt, weil er im „Hippodrom“ Angestellte geschlagen hat. Wegen dieses Vorfalls ist er mit einem Strafbefehl über 18.000 € belegt worden, den er letztlich akzeptiert hat.
15. 5 2012 - Der Valentin-Karlstadt-Förderverein e.V. * SAUBANDE wird gegründet
München-Graggenau - München-Angerviertel * Im Turmstüberl des Valentin-Karlstadt-Musäums gründet sich der „Valentin-Karlstadt-Förderverein e.V. * SAUBANDE“. Seine Aufgaben sieht er in der „Wahrung, Stärkung und Verbreitung des Ansehens und des Wissens über Karl Valentin, Liesl Karlstadt und den Münchner Volkssängern“.
7 2012 - Das renovierte „Deutschen Theaters“ soll im Juni 2013 spielfertig sein
München-Ludwigsvorstadt * Bürgermeister Hep Monatzeder bestätigt, dass die Sanierung des „Deutschen Theaters“ mindestens 94 Millionen Euro kosten wird.
Doch eine solche Kostensteigerung ist - nach seinen Worten - nicht ungewöhnlich für Altbauten.
Das renovierte Haus soll nun im Juni 2013 spielfertig übergeben werden.
16. 7 2012 - Die Aufbauarbeiten für das 179. Oktoberfest beginnen
München-Theresienwiese * Die Aufbauarbeiten für das 179. Oktoberfest beginnen. Zunächst sind rund 150 Arbeiter mit dem Aufbau beschäftigt. Ihre Zahl steigert sich im Laufe der Zeit auf 800.
29. 8 2012 - Die Aufbauarbeiten der Hochfahrgeschäfte beginnen
München-Theresienwiese * Die Aufbauarbeiten der Hochfahrgeschäfte auf der Theresienwiese beginnen.
9 2012 - Fertigstellung der Bauarbeiten am „Lenbachhaus“
München-Maxvorstadt * Fertigstellung der Bauarbeiten am „Lenbachhaus“.
9 2012 - Das „Löwenbräu-Festzelt“ wird mit einem Energiesparsystem ausgestattet
München-Theresienwiese * Das „Löwenbräu-Festzelt“ wird mit dem Energiesparsystem KNX ausgestattet.
Das System sammelt Informationen der Beleuchtungs-, Lüftungs- und Fenstersteuerung sowie von den Gasstrahlern und dem Wasserverbrauch.
Die Informationen werden zentral in einem Server verarbeitet, der entssprechende Befehle zurück gibt.
16.500 LED-Leuchten erhellen das „Löwenbräu-Festzelt“.
9 2012 - Das „Hacker-Festzelt“ erhält als dritte „Festhalle“ eine „Bier-Ringleitung“
München-Theresienwiese * Das „Hacker-Festzelt“ erhält als dritte „Festhalle“ eine „Wiesnbier-Ringleitung“.
18. 9 2012 - Das Deutsche Theater muss einen Vertrag platzen lassen
München-Ludwigsvorstadt * In einer Aufsichtsratssitzung sagen die Fachleute, der Termin Juni 2013 für die Wiedereröffnung des Deutschen Theaters ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ nicht zu halten. Das Deutsche Theater muss daraufhin einen unterschriftsreifen Vertrag für ein großes Musical wieder platzen lassen.
Als offizielle Gründe für die neuerliche Verzögerung werden angegeben: „die Komplexität des Bauvorhabens, Anpassung von Vertragsterminen, Wechsel von Firmen und Ausführungsdefizite“. Inklusive Zeltmiete wird die Sanierung mehr als 100 Millionen Euro kosten.
22. 9 2012 - Oberbürgermeister Christian Ude eröffnet das 179. Oktoberfest
München-Theresienwiese • Mit dem traditionellen Anzapfen des ersten Fasses im Schottenhamel-Festzelt durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München wird das 179. Oktoberfest eröffnet.
Gewohnt souverän treibt Christian Ude den Wechsel mit zwei kräftigen Schlägen in das Holzfass. Erst mit dem Ausruf „O‘zapft is‘!“ des Bürgermeisters darf auch in den anderen Zelten Bier ausgeschenkt werden. Dies erledigt Christian Ude beim 17. Einsatz als Anzapfer ohne Probleme. Wie gewohnt fügt er hinzu: „Auf eine friedliche Wiesn!“. Die erste Mass geht direkt an Horst Seehofer in seiner Funktion als Bayerischer Ministerpräsident.
Gleichzeitig beginnt das 125. Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest. Es wird vom Ministerpräsidenten Horst Seehofer eröffnet und dauert bis zum 30. September.
23. 9 2012 - Trotz Regens immerhin noch 850.000 Wiesn-Besucher
München-Theresienwiese • Am ersten Wiesn-Wochenende kommen trotz eines verregneten Samstags immerhin noch 850.000 Menschen aufs Oktoberfest. Knapp eine Million Mass Bier und neun Ochsen werden verzehrt.
27. 9 2012 - Irgendeiner muss den Hut nehmen
München-Isarvorstadt * Dem Chef des Deutschen Theaters, Werner Steer, platzt in einem Interview der Süddeutschen Zeitung der Kragen. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen die für die Sanierung Verantwortlichen und fordert - ohne Namen zu nennen - Konsequenzen. „Irgendwas muss jetzt passieren, ein Signal. Irgendeiner muss den Hut nehmen, und nicht der Pförtner, einer von denen, die Verantwortung tragen“.
7. 10 2012 - Der letzte Tag des Oktoberfestes 2012
München-Theresienwiese * Der letzte Tag des Oktoberfestes. Wieder ein neuer Rekord?
8. 10 2012 - Das Fazit der Wiesn 2012
München-Theresienwiese * Das Fazit der Wiesn 2012:
- 6,4 Millionen Wiesn-Besucher trinken 6,9 Millionen Mass Bier.
- Hinter 439 angezeigten Raufereien verbergen sich auch 66 Masskrugschlägereien.
- Das Rote Kreuz versorgt insgesamt 8.159 Patienten im Servicezentrum direkt auf der Wiesn.
- Hauptsächlich sind dies Kreislauf- und Herzbeschwerden, verstauchte Füße, Schnittwunden und unzählige Filmrisse.
- Bei 739 Patienten müssen die Ärzte eine Alkoholvergiftung diagnostizieren, die dann in umlegenden Krankenhäuser behandelt werden. Dazu sind 1.318 Transporte notwendig. Ein Drittel der ausländischen Patienten zahlt seine Rechnung nicht.
18. 11 2012 - Auftaktveranstaltung der SAUBANDE
München-Maxvorstadt * Auftaktveranstaltung der SAUBANDE, dem Valentin-Karlstadt-Förderverein e.V..
Bei der großen Matinée zur Vereinsgründung treten auf: Luise Kinseher, Maria Peschek, Helmut Schleich, Christian Springer, die Couplet AG, Ilse Neubauer, Bele Turba mit dem Valentin-Karlstadt-Theater, Andreas Koll und Hans well mit den Wellbappn sowie Uli Bauer, bekannt als Christian Ude. Moderation: Holger Paetz.
30. 11 2012 - Kein Anlass für das 525. Jubiläum des Münchner Reinheitsgebotes ?
München-Angerviertel * Das Bier & Oktoberfestmuseum und der Verein Münchener Brauereien e.V. sehen scheinbar keinen Anlass das 525. Jubiläum des Münchner Reinheitsgebotes zu begehen.
11. 12 2012 - 175 Jahre Historischer Verein von Oberbayern
München-Graggenau * Der Historische Verein von Oberbayern feiert im Saal des Alten Rauhauses sein 175. Jubiläum.
2013 - Mehr als 10.000 Megawatt Strom erzeugt Bayerns „Photovoltaik“
Freistaat Bayern * Mit der „Photovoltaik“ werden in Bayern mehr als 10.000 Megawatt Strom erzeugt.
Zum Vergleich: das „Kernkraftwerk Isar 2“ hat eine Leistung von 1.485 Megawatt.
2013 - Der Bayer trinkt im Jahr immerhin 135 Liter Bier
Bundesrepublik Deutschland - Freistaat Bayern * In Deutschland gibt es 1.340 Brauereien.
Davon befinden sich 622 in Bayern, alleine 163 in Oberfranken, womit die Region rund um Bayreuth und Hof Nummer eins in Bayern ist.
Die bayerischen Brauereien haben 22 Millionen Hektoliter Bier verkauft.
4,4 Millionen Hektoliter sind in den Export gegangen, ein Rekordergebnis.
Gerade die Chinesen trinken sehr gerne und immer mehr Bier aus Bayern.
Während in ganz Deutschland immer weniger Bier verkauft wird, kann in Bayern der Absatz noch um 0,7 Prozent gesteigert werden.
Im Jahr 2013 trinkt jeder Deutsche im Durchschnitt 108 Liter.
Der Bayer schafft immerhin 135 Liter.
Der unangefochtene europäische Biertrink-Spitzenreiter ist Tschechien, gefolgt von Deutschland und Österreich.
2013 - 177 „Falschparker“ behindern die Weiterfahrt der Straßenbahn
München * 177 „Falschparker“ behindern die Weiterfahrt der Straßenbahn.
7. 2 2013 - Die 20-jährige Leniata Kepari wird bei lebendigem Leib als „Hexe“ verbrannt
Mount Hagen * In Mount Hagen in Papua Neu-Guinea wird die zwanzigjährige Leniata Kepari bei lebendigem Leib als „Hexe“ verbrannt.
Die junge Frau soll einen Knaben verhext haben.
Der Sechsjährige hat zuvor über Schmerzen in Magen und Brust geklagt und ist daraufhin in das Krankenhaus gebracht worden.
Am nächsten Tag stirbt er.
Die Männer ziehen die mutmaßliche „Hexe“ aus, foltern sie mit einer erhitzten Eisenstange, fesseln sie und übergießen sie mit Benzin.
Danach wird Kepari Leniata ins Feuer geworfen.
Sie verbrennt bei lebendigem Leib.
Bilder zeigen sie unter einem brennenden Lkw-Reifen, der offenbar noch auf sie geschmissen wurde.
Sie selbst ist Mutter eines acht Monate alten Mädchens.
Polizisten und Feuerwehrleute schreiten nicht ein.
Angeblich lässt die Meute ihr Einschreiten nicht zu.
3 2013 - Bald werden 75 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben
München * Bald werden 75 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben, wobei in Deutschland München mit 4.516 Einwohnern pro Quadratkilometer an der Spitze steht.
Zum Vergleich: Es folgen Berlin mit 3.899, Herne mit 3.205, Stuttgart mit 2.925 und Oberhausen mit 2.762 Einwohnern pro Quadratkilometer.
Herne und Oberhausen schrumpfen zurzeit allerdings.
Manila, die Hauptstadt der Philippinen bringt es auf mehr als 43.000 Menschen pro Quadratkilometer.
Die dichtbesiedelte europäische Stadt ist Levallois-Perret bei Paris mit 26.000 Einwohnern auf dem Quadratkilometer.
Immerhin fast dreimal so viel wie in New York mit etwas mehr als 10.000 Einwohnern pro Quadratkilometer.
23. 3 2013 - Der Karten-Vorverkauf für das neu renovierte Deutsche Theater beginnt
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Der Vorverkauf für die Aufführungen im neu renovierten Deutschen Theater für Januar 2014 beginnt.</p>
30. 3 2013 - Willi Kreitmair, der langjährige Wiesnwirt vom „Winzerer Fähndl“, stirbt
München * Der langjährige Wiesnwirt vom „Winzerer Fähndl“, Willi Kreitmair, stirbt im Alter von 78 Jahren.
4 2013 - Wiggerl Hagn und Steffi Spendler eröffnen die Hirschau
München-Englischer Garten - Hirschau * Die Gastwirts- und Wiesnwirtefamilien Hagn und Spendler eröffnen die Hirschau im Englischen Garten.
5 2013 - Besserer Lärmschutz entlang der „Braunauer Eisenbahnbrücke“
München-Untergiesing * Die Bahn verspricht einen besseren Lärmschutz entlang der „Braunauer Eisenbahnbrücke“.
Die Bauarbeiten können allerdings erst 2015 beginnen, da die Streckensperrung erst auf internationaler Ebene abgesprochen werden muss.
8. 5 2013 - Gedenkstein für die Trümmerfrauen und der Aufbaugeneration aufgestellt
München-Graggenau * Am Marstallplatz wird ein schulterhoher Gedenkstein für die „Trümmerfrauen und der Aufbaugeneration“ aufgestellt. Das Denkmal ist stark umstritten, weil nach den Recherchen des Stadtarchivs der klassische Trümmerfrauen-Mythos in München nicht zu halten ist.
Nachdem die Stadt die Anträge auf Errichtung eines „Trümmerfrauen-Denkmals“ mehrfach abgelehnt hat, wendet sich der der CSU nahestehende Verein „Dank und Gedenken der Aufbaugeneration, insbesondere der Trümmerfrauen e.V.“ an den CSU-geführten Freistaat Bayern, der ein Plätzchen zur Verfügung stellt.
21. 6 2013 - Der Cowboy Club München von 1913 e.V. feiert sein 100. Jubiläum
München-Thalkirchen - München-Angerviertel * Der Cowboy Club München von 1913 e.V. feiert sein 100. Jubiläum. Das Münchner Stadtmuseum veranstaltet in dieser Zeit - bis zum 15. September 2013 - eine Ausstellung mit dem Titel „Sehnsucht nach dem Wilden Westen * 100 Jahre Münchner Cowboy Club“.
30. 6 2013 - Die Confiserie Rottenhöfer Café Hag schließt seinre Pforten
München-Graggenau * Die Confiserie Rottenhöfer Café Hag in der Residenzstraße 26 schließt seine Pforten.
17. 7 2013 - Die Finanzierung des Bayreuther Festspielhauses steht
Bayreuth * Die Finanzierung des Bayreuther Festspielhauses steht. Für den ersten Bauabschnitt, bei dem es nur um das Festspielhaus - ohne Nebengebäude und Proberäume - geht, werden 30 Millionen Euro benötigt.
Der Bund und der Freistaat zählen jeweils 10 Millionen, das letzte Drittel kommt von der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken und der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth. Die Bauarbeiten sollen insgesamt zehn Jahre andauern.
9 2013 - Die Stadt München kauft nach 18 Jahren das Werk „Argumente“
München-Graggenau * Die Stadt München kauft nach 18 Jahren das von dem Künstler Bruno Wank geschaffene Werk „Argumente“ zu einem „aus Datenschutzgründen“ nicht genannten Preis.
Die Kunstinstallation aus Bronzesteinen erinnert in der Viscardigasse an jene Münchner, die zwischen 1933 und 1945 den „Hitlergruß“ vor der „Feldherrnhalle“ nicht leisten wollten und deshalb über die Viscardigasse ausgewichen sind.
9 2013 - Zahlen über die weltweite Kinderarbeit
<p><em><strong>Welt</strong></em> * Die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen - ILO nennt Zahlen über Kinderarbeit. Darin wird berichtet, dass </p> <ul> <li>168 Millionen Kinder unter 17 Jahren arbeiten müssen, </li> <li>davon 85 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen. </li> <li>73 Millionen sind jünger als 11 Jahre.</li> </ul> <p>Im Jahr 2013 leben auf der Welt 7,16 Milliarden Menschen. </p>
15. 9 2013 - Ergebnis der Wahl zum Bayerischen Landtag 2013
Freistaat Bayern - München * Nach der Auszählung der Landtagswahl gehören dem Bayerischen Landtag in dieser 17. Legislaturperiode 180 Mitglieder an.
Bei der Wahl zum 17. Bayerischen Landtag erreicht
- die CSU mit ihrem amtierenden Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer 47,7 Prozent [+ 4,3] und 101 Sitze. Damit erreicht sie wieder die absolute Mehrheit.
- Die SPD mit ihrem Kandidaten Christian Ude erringt 20,6 Prozent der Stimmen [+ 2,0] und 42 Sitze.
- Die Freien Wähler erhalten 9,0 Prozent der Stimmen [-1,2] und 19 Sitze.
- DIE GRÜNEN kommen auf 8,6 Prozent der Wählerstimmen [- 0,8] und 18 Sitze.
- Die FDP fliegt mit 3,3 Prozent (- 4,7 Prozent) aus dem Bayerischen Landtag.
Horst Seehofer wird erneut Bayerischer Ministerpräsident und kann mit einer CSU-Alleinregierung arbeiten.
21. 9 2013 - Eine Million Besucher am ersten Wiesn-Wochenende
München-Theresienwiese • Am ersten Wiesn-Wochenende 2013 (21. und 22. September) kommen knapp eine Million Besucher auf das Oktoberfest.
22. 9 2013 - Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Bundesrepublik Deutschland - Berlin • Bei der Wahl zum 18. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrer amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel 41,5 Prozent [+ 7,7] und 311 Sitze.
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück erringt 25,7 Prozent der Stimmen [+ 2,7] und 193 Sitze.
- Die FDP bekommt 4,8 Prozent [- 9,8] und scheitert damit an der Fünf-Prozent-Hürde.
- Bündnis 90/DIE GRÜNEN kommen auf 8,4 Prozent der abgegebenen Stimmen [- 2,3] und 63 Sitze.
- Die PDS erkämpft 8,6 Prozent der Stimmen [- 3,3] und zieht mit 64 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
Angelika Merkel wird Bundeskanzlerin einer Großen Koalition bestehend aus CDU/CSU und SPD.
10 2013 - Schlechte Hopfenernte wegen der ungünstigen Witterungsverhältnisse
Freistaat Bayern * Wegen der ungünstigen Witterungsverhältnisse fällt in Bayern die Hopfenernte schlecht aus und liegt mit 22.300 Tonnen 27 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre (30.500 Tonnen).
53 Prozent der Ernte ist „Bitterhopfen“, 47 Prozent „Aromahopfen“.
Fast 86 Prozent der deutschen Hopfenanbauflächen liegen in Bayern, wovon 97 Prozent oder 14.086 Hektar auf die Hallertau fallen.
Es ist damit das weltweit größte geschlossene Hopfenanbaugebiet.
Für 100 Liter Bier werden im Durchschnitt etwa 120 Gramm Hopfen benötigt.
6. 10 2013 - Das Oktoberfest 2013 endet. Das Fazit.
München-Theresienwiese * Das Oktoberfest 2013 endet. Das Fazit lautet:
- In 16 Tagen besuchten 6,4 Millionen Besucher die Wiesn, davon kamen 540.000 Gäste auf die Oide Wiesn.
Der Konsum und damit die Umsätze waren zum Teil stark rückläufig. - 6,7 Millionen Mass Wiesnbier wurden getrunken.
- 114 Ochsen wurden in der Ochsenbraterei verzehrt, in der Kalbs-Kuchl 58 Kälber verspeist.
- Insgesamt wurden 1.552 Straftaten bei der Polizei angezeigt. Es gab 492 Festnahmen.
- 449 Körperverletzungen wurden von der Polizei registriert.
- Die Polizeistatistik weist 99 Gewalttaten (gefährliche Körperverletzungen) aus, worunter auch die 58 Masskrugschlägereien zählen. 44 Täter konnten sofort festgenommen werden.
- 6 Raubüberfälle wurden angezeigt und 46 Falschgelddelikte erfasst.
- 504 Taschendiebstähle. 78 Täter konnten gefasst werden.
- 16 Strafanzeigen wurden wegen Sexualdelikten gestellt, darunter wegen zwei Vergewaltigungen.
- 7.551 Hilfeleistungen mussten die Sanitäter und Ärzte leisten.
- 914 Patienten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
- 638 Wiesnbesucher mussten wegen Alkoholvergiftungen medizinisch überwacht werden. Der überwiegende Teil dieser Patienten ist zwischen 18 und 30 Jahren alt, etwa ein Drittel ist weiblich. 27 Personen waren jünger als 16 Jahre.
- 230 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden registriert.
- 140 Mal musste der U-Bahnhof Theresienwiese gesperrt werden.
- 81.000 gestohlene Masskrüge werden den Besuchern wieder abgenommen.
- Rund 4.200 Fundstücke wurden im Wiesn-Fundbüro abgegeben. Darunter das obligatorische Gebiss.
- 22.221 Autofahrer wurden kontrolliert. Bei 473 Fahrzeugführern wurde Alkoholeinfluss festgestellt.
Münchens Oberbürgermeister Christian Ude nahm nach 21 Jahren Abschied von der Wiesn.
6. 10 2013 - Ein unergründliches Geheimnis: Die Einkünfte der Wiesnwirte
München * Ein unergründliches Geheimnis sind die Einkünfte der Wiesnwirte. Im Steuerhinterziehungsprozess gegen Sepp Krätz wird bekannt, dass das Hippodrom vor Steuern 3,1 Millionen Euro erwirtschaftet hat.
19. 10 2013 - Die Marianische Kongregation feiert ihren 450. Jahrestag
München-Kreuzviertel * Die Marianische Kongregation feiert ihren 450. Jahrestag. Dazu werden bis zu 2.000 Sodalen, wie sich die Mitglieder nennen, in München erwartet. Die Marianische Kongregation wurde am 19. Oktober 1563 in Rom gegründet.
15. 11 2013 - Klageerhebung gegen den Wiesnwirt Sepp Krätz
München * Die Staatsanwaltschaft erhebt Klage beim Landgericht München wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Wiesnwirt Sepp Krätz. Ihm wird vorgeworfen, in seinem Oktoberfestzelt „Hippodrom“ und im „Andechser am Dom“ mit illegalen Tricks Steuern „gespart“ zu haben. Mit der Anklage wird die Zulassung des Wirts auf der Wiesn gefährdet.
17. 11 2013 - 2. SAUBANDE-Matinée
München-Maxvorstadt * Im Volkstheater findet die zweite SAUBANDE-Matinée statt.
19. 11 2013 - Ferdinand Schmid stirbt im Alter von 88 Jahren
München * Ferdinand Schmid, der Chef der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, die 51 Prozent an der Augustiner-Brauerei besitzt, stirbt im Alter von 88 Jahren in München.
20. 11 2013 - Dieter Hildebrandt stirbt in München
München * Der Kabarettist Dieter Hildebrandt stirbt in München.
4. 12 2013 - Kritik am Gedenkstein für die Trümmerfrauen
München-Graggenau * Die GRÜNEN-Landtagsabgeordneten Katharina Schulze und Sepp Dürr stülpen über den im Mai aufgestellten „Gedenkstein für die Trümmerfrauen und die Aufbaugeneration" am Marstallplatz einen brauen Sack. Dieser trägt die Aufschrift:
„Den richtigen ein Denkmal. Nicht den Alt-Nazis.
Gegen Spaenles Geschichtsklitterung.“
Die Begründung: Er vermittelt „ein falsches Bild von den Aufräumarbeiten in der Stadt. Mehr als 90 Prozent der Männer und Frauen, die später zu Trümmerfrauen stilisiert wurden, waren zwangsverpflichtete Alt-Nazis, die um ihre Essensmarken bangten“.
31. 12 2013 - Bayerns Königsschlösser sind Touristenmagneten
Freistaat Bayern * Bayerns Königsschlösser sind wahre Publikumsmagneten.
- Ewige Nummer Eins ist Schloss Neuschwanstein mit 1,5 Millionen Besuchern [+ 8,2 Prozent],
- Schloss Linderhof besichtigen immerhin noch 426.400,
- Schloss Herrenchiemsee 377.300,
- Schloss Nymphenburg immerhin noch 273.500 und
- die Münchner Residenz 264.100 Menschen.
31. 12 2013 - Arabische Touristen lassen viel Geld in München
München * 526.000 Mal haben arabische Touristen in Münchner Hotels übernachtet. Das ist eine Steigerung von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vermögende Großfamilien reservieren ganze Etagen teurer Luxushotels.
Die zahlungskräftigen Münchenbesucher machen nicht nur Urlaub, sondern auch Geschäfte und lassen ihr Geld in den Luxusboutiquen. Ein arabischer Tourist gibt pro Tag zwischen 500 und 1.000 Euro aus.Beliebt sind arabische Selbstzahler auch bei Fachärzten und Schönheits-Chirurgen.
31. 12 2013 - Die Pfandhausbetreiber können ihr Schmuddel-Image ablegen
Bundesrepublik Deutschland * Die Pfandhausbetreiber können ihr Schmuddel-Image ablegen und sich erfolgreich zum modernen Dienstleister weiterentwickeln. Die deutsche Pfandkreditbranche gibt in dem umsatzschwachen Jahr 2013 rund 630 Millionen Euro an Krediten aus.
Inzwischen nehmen immer mehr Menschen die Dienste der Leihhäuser in Anspruch, da, anders als bei den immer weniger an Privatkunden interessierten Banken, den Pfandhäusern auch Menschen willkommen sind, die nur kleine Darlehen brauchen. Bei kurzen Laufzeiten ist ein Pfandkredit meist günstiger als ein Bankdarlehen. Zudem wird im Leihhaus kein Lohnnachweis verlangt und die Verhandlungen dauern oft keine zwei Minuten.
Pro Monat werden bei Pfandkrediten ein Prozent Zinsen fällig, zuzüglich einer Gebühr, die sich nach der Höhe des Kredits richtet. Mit einem Pfandkredit werden oft unvorhersehbare Ausgaben - wie eine Steuernachzahlung - finanziert oder die Darlehen müssen in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten einfach für die laufenden Ausgaben herhalten.
Wird der Kredit nach Ende der Laufzeit nicht verlängert und das Pfand nicht ausgelöst, kommt es zur Versteigerung. Findet sich dort auch kein Interessent, versuchen die Pfandhausbesitzer diese über ihre Läden zu verkaufen. Ist der Erlös höher als der Darlehensbetrag plus Zinsen, entsteht ein Überschuss, der aber ausschließlich dem Kunden zusteht. Wenn dieser ihn nicht einfordert, wird das Geld nach zwei Jahren an den Staat abgeführt. Allerdings werden nur 6,5 Prozent der Pfänder nicht mehr ausgelöst.
2014 - Die Surfwelle an der Floßlände ist ganz verschwunden
München-Thalkirchen * Die Surfwelle an der Floßlände in Thalkirchen ist ganz verschwunden, weil die Stadtwerke die Wasserzuführungen stark gedrosselt haben. Dabei galt diese Welle für Anfänger als ideal. Der Eisbach ist nur was für Könner.
2014 - Brauereien und Bierabsatz
Bundesrepublik Deutschland - Freistaat Bayern * In Deutschland gibt es insgesamt 1.352 Brauereien. Davon befinden sich 616 Braustätten in Bayern.
Der Bierabsatz liegt in Deutschland bei 95.620.000 Hektoliter. Auf Bayern entfallen davon 23.131.000 Hektoliter.
2014 - 197 Falschparker verhindern die Weiterfahrt der Straßenbahn
München * 197 Falschparker, zwanzig mehr als im Vorjahr, verhindern die Weiterfahrt der Straßenbahn.
17. 1 2014 - Das Deutsche Theater wird endlich wiedereröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Das Deutsche Theater wird nach fünfjähriger Renovierungszeit mit einem „gigantischen Fest“ durch die Münchner Philharmoniker wiedereröffnet.
25. 1 2014 - Im Deutschen Theater beginnt die Faschingssaison
München-Ludwigsvorstadt * Im Deutschen Theater beginnt mit dem Eröffnungsball „Hoch hinaus!“ die Faschingssaison mit 16 Bällen.
27. 1 2014 - Neu gestaltet: Der Platz der Opfer des Nationalsozialismus
München-Maxvorstadt * Der neu gestaltete Platz der Opfer des Nationalsozialismus wird der Öffentlichkeit übergeben. Der Platz wurde seit 2012 für 3,9 Millionen Euro umgestaltet und ergänzt.
- Bäume schirmen den Platz jetzt besser vom Verkehr ab, der Parkplatz wurde verkleinert und die Säule mit der Ewigen Flamme ist in den Mittelpunkt gerückt worden.
- Eine 18,5 Meter lange und 1,3 Meter hohe Bronzetafel erinnert nun an die verschiedenen Opfergruppen.
- Ein Bronzeband im Boden weist auf den Standort der früheren Gestapo-Zentrale und zum NS-Dokumentationszentrum hin.
21. 2 2014 - Der Bayerische Landtag will kein Kurt-Eisner-Porträt
München-Graggenau * Die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm lehnt es ab, ein Porträt des ersten demokratischen bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisners im Bayerischen Landtag anzubringen. Der Verein „Das andere Bayern e.V.“ übergibt das Porträt schließlich der SPD-Fraktion.
9. 3 2014 - Verbot des Bierausschanks im traditionellen Steinkrug verhindert ?
München * Das Nachrichtenmagazin Focus berichtet, dass das „Verbot des Bierausschanks im traditionellen Steinkrug“ durch die EU durch Bayern erfolgreich verhindert worden ist. Zwei Monate vor der Europa-Wahl ist das für Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ein weiterer Beweis für die Regulierungswut der Brüsseler Bürokraten.
Tatsache aber jedoch: Die Europäische Kommission hatte nie das Ziel, Bierkrüge aus Steingut zu verbieten. Es ging lediglich um eine 10 Jahre alte Regelung, wonach Eichstriche auf Gläsern angebracht werden müssen, um die richtige Inhaltsmenge feststellen zu können. Das ist aber beim Keferloher schon aufgrund des Materials nicht anwendbar.
Biertrinker müssen in Gaststätten lediglich darauf hingewiesen werden, dass sie die Füllmenge im Krug durch ein sogenanntes Umfüllmaß, das kann ein Glaskrug sein, überprüfen lassen können.
10. 3 2014 - Der Steuerhinterziehungs-Prozess gegen Uli Hoeneß beginnt
<p><strong><em>München</em></strong> * Prozessbeginn gegen den Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Bayern München, Uli Hoeneß. Die Anklage lautet auf Steuerhinterziehung in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Zu Prozessbeginn gesteht Uli Hoeneß, dass nicht nur 3,5 Millionen, sondern 18,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen habe. Er begründet dieses Geständnis damit, dass er einen reinen Tisch machen möchte, <em>„ohne Wenn und Aber“</em>.</p>
11. 3 2014 - Die Steuerhinterziehungs-Summen überschlagen sich
München * Im „Fall Uli Hoeneß“ überschlagen sich die Steuerhinterziehungs-Summen. Eine Steuerfahnderin ermittelt aus den Zahlen von Uli Hoeneß, dass er nicht nur 18,5 Millionen, sondern insgesamt 27,3 Millionen Euro an Steuerzahlungen betrogen haben soll. Und das sei der best case.
12. 3 2014 - Errichtung einer Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt
München-Graggenau * Der Stadtrat beschließt die Errichtung einer Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt.
12. 3 2014 - Reinhard Marx wird Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz
Münster * Kardinal Reinhard Marx wird im 4. Wahlgang für sechs Jahre zum Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz gewählt. Er löst damit den 75-jährigen Robert Zollitsch ab.
13. 3 2014 - Das Landgericht verurteilt Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung
<p><strong><em>München</em></strong> * Die Steuerschuld des Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß hat sich um weitere 1,26 Millionen Euro erhöht. Der Solidaritätszuschlag muss noch einberechnet werden. Die Summe kann noch weiter steigen, weil sie von den Steuerfahndern bisher nur überschlägig berechnet worden ist. </p> <p>Das Landgericht München II verurteilt Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,46 Millionen Euro zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat fünfeinhalb Jahre Haft gefordert. Die Anwälte des FC-Bayern-Präsidenten kündigen umgehend Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe an. Bis das Urteil rechtskräftig ist, bleibt Uli Hoeneß auf freiem Fuß.</p>
13. 3 2014 - Sepp Krätz handelt mit dem Landgericht einen Deal aus
<p><strong><em>München</em></strong> * Sepp Krätz handelt mi dem Landgericht München I einen Deal aus. Vor Gericht gibt der Wiesnwirt Steuerverkürzungen zu. So hat er in seinem Wiesnzelt Hippodrom rund 988.000 Euro und in seinem Innenstadtlokal Andechser am Dom etwa 115.000 € Steuern hinterzogen. Im Gegenzug sichert ihm das Gericht eine Freiheitsstrafe von eineinalb bis maximal zwei Jahren auf Bewährung zu. Der Prozess geht weiter.</p> <p>Für den Erfolgsgastronomen Krätz kann das - durch die Entziehung der Schankkonzession durch das Kreisverwaltungsreferat - dennoch das Aus als Wiesnwirt, für die Genehmigung zum Frühlingsfest und für die Schankkonzession im Andechser am Dom bedeuten.</p>
14. 3 2014 - Hoeneß verzichtet auf eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht
<p><strong><em>München</em></strong> * Uli Hoeneß weist nach seiner Verurteilung im Prozess wegen 28,46 Millionen Euro hinterzogenen Steuern seine Anwälte an, auf eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zu verzichten. Gleichzeitig legt er seine Ämter als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern nieder.</p> <p>Er muss damit seine dreieinhalbjährige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Landsberg antreten.</p>
16. 3 2014 - Ergebnis der Kommunalwahl 2014 in München
<p><strong><em>München</em></strong> * Bei der Wahl zum Oberbürgermeister treten erstmals zwölf Kandidaten gegeneinander an.</p> <p>Dieter Reiter [SPD] erhält 40,4 Prozent, Josef Schmid [CSU] kommt auf 36,7 Prozent. Sabine Nallinger von den GRÜNEN kommt auf 14,7 Prozent der Stimmen. Die Entscheidung unter den beiden Erstplatzierten fällt nun bei der Stichwahl am 30. März.</p> <ul> <li>Bei der Wahl zum Stadtrat erhält die CSU 32,6 Prozent [+ 4,9] und 26 [+ 3] Sitze.</li> <li>Die SPD erringt 30,8 Prozent der Stimmen [- 8,9] und 25 [- 8] Sitze.</li> <li>Die GRÜNEN kommen auf 16,6 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 3,6] und 13 Sitze [+ 2].</li> </ul> <p>Weiter sind bei Kommunalwahl in München 14 Parteien angetreten:</p> <ul> <li>Die FDP erhält 3,4 Prozent [- 3,4] und 3 Stadtratsmandate [- 2], </li> <li>die Freien Wähler bekommen 2,7 Prozent [+ 1,1] und 2 Stadtratsmandate [+ 2], </li> <li>die AfD kommt auf 2,5 Prozent [+ 2,5] und 2 Stadtratsmandate [+ 2], </li> <li>die ÖDP erreicht 2,5 Prozent [+ 0,8] und 2 Stadtratsmandate [+ 1], </li> <li>die Linke bekommt 2,4 Prozent [- 1,3] und 2 Stadtratsmandate [- 1], </li> <li>die Rosa Liste kommt auf 1,9 Prozent [+/- 0] und ein Stadtratsmandat, </li> <li>die Partei Hut erklimmt 1,3 Prozent [+ 1,3] und ein Stadtratsmandat [+ 1], </li> <li>die Piraten erhalten 1,2 Prozent [+ 1,2] und ein Stadtratsmandat [+ 1], </li> <li>die Bayernpartei - BP bekommt 0,9 Prozent [- 0,7] und ein Stadtratsmandat, </li> <li>die rechtsradikale Bürgerinitiative Ausländerstopp - BIA kommt auf immerhin 0,7 Prozent [- 0,7] und erhält ein Stadtratsmandat, </li> <li>die islamfeindliche Partei Die Freiheit kommt auf 0,6 Prozent [+ 0,6], bekommt aber keinen Platz im Münchner Stadtrat.</li> </ul> <p>Damit ist das seit 1990 bestehende Rot-Grüne Bündnis gescheitert.</p> <p>Auch bei der Wahl zum Bezirksausschuss verliert die SPD massiv. </p> <ul> <li>Nur noch in 9 von 25 Gremien ist die SPD stärkste Fraktion (Bisher: 21). </li> <li>Die CSU wird in 13 Stadtbezirken stärkste Kraft (Bisher: 4) </li> <li>Die GRÜNEN werden stärkste Fraktion in Au/Haidhausen, in der Ludwigsvorsadt-Isarvostadt und in der Maxvorstadt. </li> </ul>
17. 3 2014 - Das Urteil gegen den Ex-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß ist rechtskräftig
München * Nachdem auch die Staatsanwalt verzichtet Rechtsmittel beim Bundesgerichtshof einzulegen, ist das Urteil gegen den Ex-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß rechtskräftig.
19. 3 2014 - Leonard Bernsteins West Side Story wieder im Deutschen Theater
<p><strong><em>München-Ludwigsvorstadt</em></strong> * Mit dem Leonard Bernsteins Klassiker <em>„West Side Story“ </em>wird der Musical-Betrieb im Deutschen Theater wieder aufgenommen. Das Musical hatte 1961 seine Europa-Premiere im Deutschen Theater.</p>
24. 3 2014 - Jannik Inselkammer stirbt beim Helicopter-Skiing bei einem Lawinenunfall
British Columbia/Kanada * Gegen 10:30 Uhr stirbt Jannik Inselkammer, Gesellschafter der Augustiner Brauerei und erfolgreicher Immobilienunternehmer, beim Helicopter-Skiing bei einem Lawinenunfall in der kanadischen Provinz British Columbia. Er ist 45 Jahre alt. Als geschäftsführender Gesellschafter hält der Unternehmer 35 Prozent der Anteile an der Augustiner-Brauerei.
28. 3 2014 - Sepp Krätz erhält eine Bewährungs- und eine Geldstrafe von 570.000 €
<p><strong><em>München</em></strong> * Sepp Krätz wird von der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I in 36 Fällen wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von einen Jahr und zehn Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 570.000 Euro verurteilt.</p> <p>Das Kreisverwaltungsreferat hat dem Wiesnwirt vom Hippodrom bereits mitgeteilt, dass er nicht mehr auf‘s Frühlingsfest darf und seine Schanklizenz für seine Wirtschaft Andechser am Dom verlieren wird. Weil er dadurch kein Wirt mehr ist, kann er sich auch nicht für‘s Oktoberfest bewerben. </p>
30. 3 2014 - Dieter Reiter zum Münchner Oberbürgermeister gewählt
<p><strong><em>München</em></strong> * Bei der Stichwahl der Oberbürgermeisterkandidaten erhält</p> <ul> <li>Dieter Reiter [SPD] 56,7 Prozent. </li> <li>Sein Kontrahent Josef Schmid [CSU] kommt auf 43,3 Prozent der Stimmen.</li> </ul> <p>Gewählter Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München ist damit Dieter Reiter. </p>
31. 3 2014 - Der Mietvertrag des Sanitärgroßhandels im Kegelhof läuft aus
<p><strong><em>München-Au</em></strong> * Der Mietvertrag des Sanitärgroßhandels im Kegelhof in der Au läuft aus. Nun kann die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG mit der Weiterentwicklung des Komplexes Kegelhof beginnen. </p>
8. 4 2014 - Das Nacktbaden in der Stadt wird in 5 Bereichen zugelassen
München * Nachdem das Bayerische Innenministerium im Herbst 2013 die Badeverordnung hat auslaufen lassen, endet in Bayern auch der darin enthaltene „Zwang zur Badekleidung“. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat will das Nacktbaden in der Stadt auf insgesamt fünf Bereiche festschreiben. Das sind jene Orte, an denen der hüllenlose Bade- und Sonnengenuss auch bisher schon erlaubt war und deren Adressen sich seit Jahren in diversen Reiseführern wiederfinden.
Gerade die Nackerten im Englischen Garten sind - vor allem bei Besuchern aus Ländern, in denen solche textilfreien Zonen als „unsittlich“ gelten - eine bekannte Touristenattraktion. Und das sind die künftigen Nackerten-Paradiese:
- Im Englischen Garten auf der Schönfeldwiese hinterm Haus der Kunst, innerhalb des Ovals der Reitbahn. Die sogenannte „Poebene“.
- In der Schwabinger Bucht, zwischen Sulzbrücke und Alte-Heide-Steg im nördlichen Teil des Englischen Gartens.
- Am Ostufer der Isarinsel Oberföhring.
- Bei Maria Einsiedel im westlichen Hochwasserbett der Isar.
- An der Brudermühlbrücke im östlichen Hochwasserbett der Isar bis hinauf zur Braunauer Eisenbahnbrücke.
- Am Südufer des Feldmochinger Sees dürfen die Münchner auch künftig auf ihre Badekleidung verzichten.
- Und selbst am Flaucher, dem Nacktbadestrand Nummer Eins, an dem bisher - sehr zur Verwunderung der Stadtpolitiker - Textilzwang bestand, dürfen jetzt offiziell die letzten Hüllen fallen.
14. 4 2014 - Sepp Krätz zieht seinen Antrag für das Frühlingsfest zurück
<p><strong><em>München-Theresienwiese</em></strong> * Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz zieht seinen eigenen Antrag auf Gestattung für das Frühlingsfest zurück. Statt ihm sollen seine Ehefrau Tina Krätz und seine Schwester Johanna Barsy das Hippodrom betreiben. Das Kreisverwaltungsreferat - KVR stimmt dem Antrag zu.</p> <p>Ob Sepp Krätz seine Schankkonzession und damit seine Zukunft als Wirt des Andechser am Dom weiter behalten kann, entscheidet das KVR nach Ostern. Erst Anfang Mai will das Landratsamt über die Zukunft seiner Konzession als Wirt der Waldwirtschaft in Großhesselohe entscheiden. </p>
Um den 20. 4 2014 - Die Abbrucharbeiten um den denkmalgeschützten Zacherlbau beginnen
München-Au * Die Abbrucharbeiten an den Gebäuden um den denkmalgeschützte Fassade des Zacherlbaus an der Ohlmüllerstraße haben begonnen. Auf dem Gelände soll der neue Verwaltungsbau der Paulaner-Brauerei untergebracht werden. Lediglich die historische Fassade und die Kellergewölbe müssen erhalten werden.
23. 4 2014 - Der Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz verliert seine Schanklizenz
München-Kreuzviertel * Der Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz verliert seine Schanklizenz und muss den Andechser am Dom bis 1. Juni räumen. Möglicherweise übernimmt - ebenso wie das Hippodrom am Frühlingsfest seine Ehefrau Tina Krätz und seine Schwester Johanna Barsy den Betrieb.
Vorsorglich hat Sepp Krätz gegen den Konzessionsentzug geklagt. Die Klage hat aufschiebende Wirkung, sodass er erstmal im Andechser am Dom noch Wirt bleiben kann.
25. 4 2014 - Das Frühlingsfest-Hippodrom wird von Sepp Krätz' Ehefrau betrieben
München-Theresienwiese * Beim Frühlingsfest auf der Theresienwiese wird das Hippodrom nicht mehr vom Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz, sondern von dessen Ehefrau Tina Krätz und seiner Schwester Johanna Barsy betrieben. Die beiden Damen stehen inzwischen auch an der Spitze der Hippodrom Oktoberfest OHG.
27. 4 2014 - Papst Franziskus spricht zwei Päpste heilig
Rom-Vatikan * Papst Franziskus spricht zwei Päpste heilig.
Papst Johannes XXIII. und Papst Johannes Paul II. werden unter den 839 Heiligen aufgenommen, die seit 1594 formal anerkannt sind. Sie gelten als Vorbilder eines christlich geführten Lebens und dürfen von den Katholiken in Gebeten angerufen werden.
28. 4 2014 - Siegfried Able übernimmt das ehemalige Hippodrom als Marstall
München-Theresienwiese * Der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft befasst sich mit der Frage, wer die Nachfolge für Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz im Hippodrom antreten soll. Sepp Krätz war am 28. März von der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I in 36 Fällen wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von einen Jahr und zehn Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 570.000 Euro verurteilt. Seine Schanklizenz für den Andechser am Dom hat er bereits verloren, das selbe Verfahren für die Waldwirtschaft in Großhesselohe wird im Mai angeschlossen.
Das Wirtezelt wird Siegfried Able, der bisherige Wirt der Kalbskuchl auf der Wiesn, übernehmen. Er ist Betreiber des See-Biergartens Lerchenau mit 1.200 Plätzen, des Eiszaubers am Stachus und seit 2008 auch der Kalbskuchl. Zudem gehören ihm Pizza-Stände im Stachus-Untergeschoss und im Hauptbahnhof, in Letzterem auch der Süßigkeitenstand Münchner Zuckerl. Im Tierpark Hellabrunn hat er einen Biergarten, ein Café und einen Fish-and-Chips-Stand.
Siegfried Able wird das Hippdrom in Marstall umbenennen. Auch das Festzelt wird vollkommen neu gestaltet. Seine Kalbskuchl mit 300 Plätzen übernimmt Erich Hochreiter, der Wirt des Biergartens am Viktualienmarkt.
Der Besetzung des Wirtezeltes auf der Wiesn gehen hinter den Kulissen heftige Auseinandersetzungen. Deutlich und laut fällt die Kritik an dem seit 1980 praktizierten Vergabesystem der Stadt aus, das zwar korrekt abgewendet worden sei, aber aus einer Zeit stammt, als Volksfeste noch ein reines Reisegewerbe waren.
Unangenehm heftig fällt die Kritik des Sprechers der Wiesnwirte, Toni Roiderer, aus. Für ihn ist der „Emporkömmling“ Siegfried Able nur ein „Kioskbetreiber“, der nie „Wunschkandidat“ war. Die etablierten Wiesnwirte wollen sogar ernstlich prüfen, ob sie ihn überhaupt in ihrem Kreis aufnehmen wollen.
30. 4 2014 - Oberbürgermeister Christian Ude verabschiedet sich von den Münchnern
München-Graggenau * Oberbürgermeister Christian Ude verabschiedet sich an seinem letzten Arbeitstag auf dem Marienplatz von den Münchnerinnen und Münchnern.
30. 4 2014 - Der Grundstein für die „Griechische Schule“ wird gelegt
<p><strong><em>München-Berg am Laim</em></strong> * Der Grundstein für die Griechische Schule an der Berg am Laimer Hachinger-Bach-Straße wird gelegt.</p>
1. 5 2014 - Oberbürgermeister Dieter Reiters erster Arbeitstag
München-Graggenau * Seinen ersten Arbeitstag beginnt der neue Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auf der Kundgebung des DGB auf dem Marienplatz. Weil er im Zusammenhang mit den städtischen Kliniken auch von Personalabbau spricht, erntet er bei den anwesenden Gewerkschaftern Buh-Rufe und Pfiffe.
Ob er sich jetzt den Schlegel zur Hand herbei gewünscht hat, dem ihm zuvor seine Mitarbeiter - verbunden mit dem Wunsch für einen „guten Start und einer glücklichen Hand - auch beim Anzapfen“ - geschenkt haben, ist nicht bekannt.
2. 5 2014 - Der neugewählte Stadtrat nimmt seine Tätigkeit auf
München * Der neugewählte Stadtrat konstituiert sich.
6. 5 2014 - Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz klagt gegen den Entzug seiner Schanklizenz
München * Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz klagt gegen den Entzug seiner Schanklizenz zum 1. Juni für den Andechser am Dom gegen das Kreisverwaltungsreferat. Sepp Krätz‘ Rechtsbeistand ist Peter Gauweiler.
9. 5 2014 - Das neue Wiesnzelt Marstall stellt sich vor
München - München-Theresienwiese * Mit der Inbetriebnahme seiner Homepage, erfahren die Münchner mehr übers neue Wiesnzelt Marstall.
- Über dem Eingang zum Zelt der Wirtefamilie Able soll eine Quadriga thronen.
- Das Festzelt selbst bietet Platz für 4.800 Gästen, davon 880 im Garten.
- Der Stehplatzbereich an der Bar stellt weiteren 230 Besuchern Platz zur Verfügung.
- Die Musikbühne wird die Form eines alten Karussells haben, die mit vielen Holzpferden geschmückt ist.
- Die Wiesnmusik übernehmen die „Münchner Zwietracht“ und „Die Oberbayern“. Die erste Gruppe ist schon seit vielen Jahren im Hippodrom aufgetreten. Die Andere hat sich schon in der Kalbskuchl ihre Erfahrung angeeignet.
19. 5 2014 - Sepp Krätz erreicht vor dem Verwaltungsgericht einen Etappensieg
München * Der Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz hat vor dem Verwaltungsgericht einen Etappensieg errungen und darf seinen Andechser am Dom über den 1. Juni hinaus gemeinsam mit seiner Tochter betreiben. Mit dem juristischen Sieg hat Krätz den Sofortvollzug ausgehebelt. Bis zu einem abschließenden rechtskräftigen Urteil wird es noch Monate dauern.
19. 5 2014 - Markus Söder eröffnet das Jubiläum des Englischen Gartens
München-Englischer Garten - Lehel * Heimatminister Markus Söder eröffnet am Chinesischen Turm - als Chef der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen - an diesem absolut unhistorischen Datum - die Feierlichkeiten zum 225. Jubiläum des Englischen Gartens.
Um den 20. 5 2014 - Die Bauarbeiten für Baumkirchen Mitte werden aufgenommen.
München-Berg am Laim * Die Bauarbeiten zum ersten Bauabschnitt für das Wohnviertel Baumkirchen Mitte werden aufgenommen. Insgesamt entstehen hier 560 Wohnungen. Der erste Abschnitt umfasst 170 Wohnung, die bis Sommer 2016 fertiggestellt sein sollen.
20. 5 2014 - Das KVR legt beim Verwaltungsgerichtshof Beschwerde ein
München * Das Kreisverwaltungsreferat legt beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Beschwerde ein, nachdem das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden hat, dass der Andechser am Dom des Ex-Wiesnwirts Sepp Krätz bis zum abschließenden Urteil über den Entzug der Konzession geöffnet bleiben darf. Doch das könnte Jahre dauern.
Damit, so das Kreisverwaltungsreferat, würde das Gaststättenrecht „zum stumpfen Schwert“ gemacht.
26. 5 2014 - Georg Schlagbauer (CSU) wird neuer Wiesn-Stadtrat
München-Graggenau - München-Theresienwiese * Der Landesinnungsmeister der bayerischen Metzger Georg Schlagbauer von der CSU wird neuer Wiesn-Stadtrat. Der Besitzer einer Metzgerei am Viktualienmarkt übernimmt mit dieser Funktion eine langjährige Domäne der SPD. Sein Vorgänger ist Helmut Schmid.
Um den 30. 5 2014 - Die Wiesnwirte wollen Siegfried Able nicht in ihrem Kreis aufzunehmen
München * Die Wiesnwirte beschließen in ihrer Sitzung, den neuen Betreiber des Marstall, Siegfried Able, nicht in ihrem Kreis aufzunehmen. Das Verhältnis der Wiesnwirte zu Able ist seit längerem angespannt, nachdem er bereits im November 2013 ein neues großes Zelt in Auftrag gegeben hat und sich nicht mehr auf sein bisheriges kleines Wiesnzelt Kalbskuchl beworben hat. Dieses Vorgehen führte zu dem Vorwurf, dass Able eindeutige Absprachen mit der Stadt getroffen hätte.
Noch mehr dürfte den Sprecher der Wiesnwirte, Toni Roiderer, und die anderen Festwirte ärgern, dass Siegfried Able für seinen Marstall eine abwechslungsreichere Speisenkarte wie in den anderen Zelten angekündigt hat.
Erst nach dem Oktoberfest 2014 wollen die Wiesnwirte über die Aufnahme Ables in ihren Kreis endgültig beschließen. Dieser Zusammenschluss der Wiesnwirte ist allerdings keine offizielle Vereinigung, sondern lediglich eine privater Club, die sich seit etwa 40 Jahren um seine eigenen Interessen kümmert und diese nach Außen vertritt.
4. 6 2014 - Die Mass Wiesnbier überschreitet erstmals die magische Grenze von 10 Euro
München-Theresienwiese * Der Preis für die Mass Wiesnbier überschreitet erstmals die magische Grenze von 10 Euro. Im Löwenbräu-Festzelt und beim Schottenhamel werden für den Liter Wiesnbier 10,10 Euro verlangt.
23. 6 2014 - Schärfere Regelungen für die etwa 1.000 Wiesn-Ordner
München-Theresienwiese * Das Kreisverwaltungsreferat - KVR will für die etwa 1.000 Wiesn-Ordner schärfere Regeln einführen. Jeder muss gut sichtbar einen Ausweis mit dem Namen des Ordners, Foto, Ordnernummer, Name der Sicherheitsfirma und dem amtlichen Siegel der Stadt tragen. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.
Außerdem werden die Security-Firmen verdonnert, nur Mitarbeiter auf die Wiesn zu schicken, „die in rechtlicher und fachlicher Hinsicht geschult, körperlich geeignet sowie der deutschen Sprache mächtig sind“. Die Schulungen müssen speziell auf den Wiesn-Einsatz zugeschnitten sein und ihren Schwerpunkt im Bereich Deeskalation und Gewaltprävention haben.
24. 6 2014 - Franz Herzog von Bayern für den Tunnel unter dem Englischen Garten
München-Englischer Garten * Franz Herzog von Bayern, der Chef des Hauses Wittelsbach, spricht sich für den Tunnel unter dem Englischen Garten und die Wiedervereinigung des Parks aus: „Das ist ein Projekt von allergrößtem Interesse, nicht nur für München, sondern für ganz Bayern.“ 70 Millionen Euro soll laut den Initiatoren Petra Lejeune und Hermann Grub das Projekt kosten. Auch die zuständigen Finanzminister Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann haben ihre Unterstützung bereits zugesagt.
24. 6 2014 - Millionen für Pop-Song-Manuskript
<p><strong><em>New York</em></strong> * Das Originalmanuskript von Bob Dylans Song <em>„Like A Rolling Stone“</em>, das er mit Bleistift auf einem Hotel-Briefpapier verewigt hat, wird in New York um zwei Millionen Dollar versteigert. Ein weiteres Dylan-Manuskript mit dem Titel <em>„A Hard Rain‘s A-gonna Fall“</em> erzielt immerhin noch 485.000 Dollar. </p> <p>Eine von den Beatles im Jahr 1961 in Hamburg signierte Rechnung bringt immerhin noch 375.000 Dollar. Yeah, yeah, yeah! </p>
25. 6 2014 - Großer Wasserschaden durch die Sprinkler-Anlage im Deutschen Theater
München-Ludwigsvorstadt * Nach der Vorstellung von „The Wiz“ löst sich die Sprinkleranlage in neu renovierten Deutschen Theater aus ungeklärten Gründen aus. Es entstehen große Schäden an der Bühnentechnik, weshalb die fünf Produktionen The Wiz, Ewig jung, Dylan, Alice und Der kleine Drache Kokosnuss ersatzlos gestrichen werden.
1. 7 2014 - Sensationeller Fund im Apothekenhof der Münchner Residenz
München-Graggenau * Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen sensationellen Fund im Apothekenhof der Münchner Residenz. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um das fast unversehrte Grab einer 40- bis 60-jährigen Frau, die nach ihrem Tod an anderer Stelle verbrannt und im späteren Apothekenhof beigesetzt wurde.
Die Archäologen fanden einen stattlichen Scherbenhaufen an Feinkeramik, die zum Teil kunstvoll mit in den Ton geritzten Schraffuren, Bändern und Zickzack-Mustern. Auch verschiedene Bronzeutensilien haben die Forscher entdeckt, darunter zwei Vasenknopfnadeln. Die Ur-Münchnerin hat vor mehr als 3.000 Jahren in der späten Bronzezeit (1350 bis 1200 vor Christi) nahe der Isar und ihren Seitenarmen gelebt. Nach der wissenschaftlichen Auswertung sollen die schönsten Fundstücke in der Residenz ausgestellt werden.
8. 7 2014 - Der Stadtrat bestätigt die Ausweispflicht für Wiesn-Ordner
München-Graggenau - München-Theresienwiese * Der Stadtrat bestätigt in seiner Vollversammlung die Ausweispflicht für Wiesn-Ordner und die entsprechenden Bußgelder bei Nichteinhaltung der Vorschriften.
8. 7 2014 - Der Verwaltungsgerichtshof entzieht Sepp Krätz endgültig die Konzession
München * Der Verwaltungsgerichtshof entzieht dem Ex-Wiesnwirt Sepp Krätz endgültig die Konzession für den Andechser am Dom. Schließen muss der Andechser aber nicht. Sepp Krätz wird zwar als Geschäftsführer ausscheiden, seine Tochter, die seit Längerem schon mit ihrem Vater gemeinsam an der Spitze der Wirtschaft steht, wird das Lokal weiter betreiben. Die Stadt will dieses Modell akzeptieren, wenn Krätz schriftlich erklärt, dass er seiner Tochter keine Weisungen erteilen wird.
Das Hauptsacheverfahren läuft noch weiter. Bis zur Urteilsverkündung kann es noch Jahre dauern. Offen ist auch noch, wie es mit der Waldwirtschaft in Großhesselohe weitergeht. Das Verfahren wird beim zuständigen Landratsamt geführt. Die Entscheidung steht noch aus.
13. 7 2014 - Die deutsche Fußballmannschaft wird Weltmeister
Rio de Janairo * Mario Götze schießt in der Verlängerung der offiziellen Spielzeit das einzige Tor des Spieles gegen die Argentinische Nationalmannschaft. Damit ist die deutsche Fußballmannschaft Weltmeister.
14. 7 2014 - Der Aufbau der Wiesn 2014 beginnt
München-Theresienwiese * Der Aufbau der 181. Wiesn 2014 beginnt. Alleine der Auf- und Abbau einer Wiesn-Festhalle kostet rund eine Million Euro.
Nach langer Zeit gibt es mit dem Marstall ein neues Festzelt. Es löst das Hippodrom ab.
20. 7 2014 - Eine Demonstration für die Aufhebung des innerstädtischen Badeverbots
München * Mit einem „Big Jump“ demonstrieren Münchnerinnen und Münchner für die Aufhebung des innerstädtischen Badeverbots.
25. 7 2014 - Der neue Krug der Wiesnwirte zeigt den Steyerer Hans
München * Der neue Krug der Wiesnwirte wird präsentiert. Ihn ziert das Konterfei eines ehemaligen Kollegen: den Steyrer Hans.
29. 7 2014 - Nach Wasserschaden: Das Deutsche Theater wieder eröffnet
München-Ludwigsvorstadt * Das nach einem Wasserschaden geschlossene Deutsche Theater wird mit dem „Alvin Ailey American Dance Theater“ wiedereröffnet.
29. 7 2014 - Die neuen Wiesn-Attraktionen werden vorgestellt
München-Theresienwiese * Josef Schmid, 2. [CSU-]Bürgermeister und Wirtschaftsreferent, stellt die neuen Wiesn-Attraktionen vor. Das Marstall-Festzelt von Siegfried Able wird im Inneren 3.500 und draußen 900 Sitzplätze bieten. Statt dem leuchtenden Rot des Hippodroms überwiegt Weiß mit etwas Blau. Das Thema Pferd steht aber auch hier im Mittelpunkt.
31. 7 2014 - Auf der Theresienwiese sollte ein Kamelrennen stattfinden
München-Theresienwiese * Auf der Theresienwiese sollte im Juni 2015 ein Kamelrennen stattfinden. Auf einem 1,8 Kilometer langen Sand-Rundkurs sollen die bis zu 70 Stundenkilometer schnellen Renn-Dromedare erstmals außerhalb der Arabischen Halbinsel gegeneinander antreten. Die bis zu zehn Millionen Dollar teueren Kamele werden mit Spezialflugzeugen nach München gebracht.
Als Jockeys wurden bis vor kurzem - wegen dem geringen Gewicht - Kinder eingesetzt, die ihren Familien in Asien abgekauft wurden. Diese viel kritisierte Praxis haben die Golfstaaten inzwischen aufgrund der Interventionen der Unicef eingestellt. Die Kinder wurden von teueren Computern ersetzt, die ihre Peitschen ferngesteuert schwingen. Gelenkt werden diese von den Kamelbesitzern, die neben der Dromedar-Rennbahn mit ihren Off-Road-Pick-Ups fahren. Auch hier sollen sich spektakuläre Duelle abspielen.
Von dem Kamelrennen werden die Münchner nichts mehr hören.
31. 7 2014 - Das Konzept für das Großprojekt Kegelhof wird vorgestellt
München-Au * Das Konzept für das Großprojekt Kegelhof wird vorgestellt. Das Gebäude entlang dem Auer Mühlbach wird abgerissen und mit 27 Wohnungen für Senioren neu aufgebaut. Unter dem Gelände entsteht eine Tiefgarage. Der Gebäudekomplex am Imma-Mack-Weg wird saniert und umgebaut. Unten bezieht die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG Büros, darüber kommen elf Wohnungen.
1. 8 2014 - Vertreter von 16 Surf-Initiativen- und Verbänden treffen sich
München-Englischer Garten * Im Café Fräulein Grüneis im Englischen Garten treffen sich Vertreter von 16 Surf-Initiativen- und Verbänden. Sie wollen sich über ihre regionalen Projekte austauschen.
4. 8 2014 - Die Zahl der „unehelich geborenen Kinder“ hat sich verdreifacht
München * Der neue „Familienreport“ des „Bayerischen Sozialministeriums“ zeigt, dass sich die Zahl der „unehelich geborenen Kinder“ seit den 1990er Jahren verdreifacht hat.
Außerordentlich hohe uneheliche Geburtsraten zeigen die ost- und nordbayerischen Randregionen auf.
Anders gesagt: Je christlicher die Bevölkerung, desto höher die Zahl der „unehelich geborenen Kinder“.
5. 8 2014 - Erzengel Michael mitsamt dem Satan wieder zurück
München-Berg am Laim * Nach dreijähriger Restaurierung [600 Arbeitsstunden] in Regensburg kommt der Erzengel Michael mitsamt dem Satan wieder an seinem angestammten Platz an der Berg am Laimer Michaelskirche.
9. 8 2014 - Die „4. Europameisterschaft im Stationary Wave Riding“ finden statt
Flughafen MUC * Am 9. und 10. August findet am Flughafen die „4. Europameisterschaft im Stationary Wave Riding“ statt.
3. 9 2014 - Die Wiesnwirte stiften eine Mordstrumm-Kerze
Planegg * Die Wiesnwirte der großen Festzelte treffen sich - wie jedes Jahr - in der Planegger Wallfahrtskirche Maria Eich, um dort eine mehrere Kilo schwere Kerze zu stiften. Diese Tradition hat der ehemalige Sprecher der Wiesnwirte und Festwirt der Bräu-Rosl, Willy Heide, nach dem Oktoberfest-Attentat im Jahr 1980 ins Leben gerufen. Sie soll für eine friedliche Wiesn stehen. Georg Heide, der Sohn des 2011 verstorbenen Willy, setzt die Tradition gemeinsam mit seiner Frau Renate und Tochter Daniela fort.
Bei den Münchnern hält sich aber eisern das Gerücht, dass das Mordstrumm von einer Kerze für eine sich pünktlich zum Wiesn-Beginn einstellende Schönwetterfront gestiftet wird. Denn schönes Wetter bedeutet für die Wiesnwirte auch gute Umsätze und damit Gewinn. Denn wie singen die Festwirte in Maria Eich: „Maria hilf uns allen aus unsrer tiefen Not“.
8. 9 2014 - Uli Hoeneß gibt den Bayerischen Verdienstorden zurück
München * Die Frau und die Kinder von dem in der Strafvollzugsanstalt Landsberg wegen Steuerhinterziehung zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe einsitzenden Ex-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß geben seinen Bayerischen Verdienstorden persönlich bei Ministerpräsident Horst Seehofer zurück.
Die Bayerische Staatskanzlei soll Hoeneß zu diesem Schritt bedrängt haben. Es sei ein ungeschriebenes Gesetz, dass zu einer Strafe ohne Bewährung Verurteilte den Orden zurückgeben müssen. Der Bayerische Verdienstorden wurde Uli Hoeneß im Jahr 2002 verliehen.
9. 9 2014 - Das Völkerkundemuseum wird in Museum Fünf Kontinente umbenannt
München-Lehel * Das Staatliche Museum für Völkerkunde in der Maximilianstraße wird in Museum Fünf Kontinente umbenannt „Die Umbenennung ist das Ergebnis einer intensiven Phase der Reflexion und Neuorientierung“, sagt die Direktorin Christine Kron. Das Haus „steht für einen einzigartigen Zugang zum kulturellen Reichtum der Menschheit“ und ist „ein Ort des kulturellen Dialogs zwischen Menschen aller Kontinente“.
Obwohl die Sammlung rund 160.000 Objekte, plus 135.000 Fotos und 100.000 Bücher umfasst, gehört es zu den beschaulicheren und weniger bekannten Münchner Museen.
15. 9 2014 - Alt-Oberbürgermeister Christian Ude wird Ehrenbürger
München * Alt-Oberbürgermeister Christian Ude wird zum Ehrenbürger ernannt.
20. 9 2014 - Das 181. Oktoberfest beginnt
München-Theresienwiese * Das 181. Oktoberfest beginnt. Mit vier Schlägen zapft der neu gewählte Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter im Schottenhamel-Festzelt das erste Fass an. Mit dem Ruf „Ozapft is“ ist die Wiesn schließlich offiziell eröffnet.
10 2014 - Der Wirtschaftswert des „Oktoberfestes“ liegt bei 954 Millionen Euro
München-Theresienwiese * Der geschätzte Wirtschaftswert des „größten Volksfestes der Welt“ liegt bei etwa 954 Millionen Euro.
Die Stadt als Veranstalter nimmt lediglich 7,3 Millionen Euro an „Standentgelten“ ein.
Die Kosten liegen bei 5,7 Millionen Euro.
Die Differenz von 1,6 Millionen Euro wird in die Instandhaltung und den Ausbau des „Festgeländes“ investiert.
5. 10 2014 - Das Oktoberfest 2014 endet
München-Theresienwiese * Das Oktoberfest 2014 endet. Das Fazit lautet:
- In 16 Tagen besuchten 6,3 (6,4) Millionen Besucher die Wiesn, davon kamen 610.000 (540.000) Gäste auf die Oide Wiesn.
- Der Konsum und damit die Umsätze waren zum Teil rückläufig. (Zahlen in Klammer = 2013)
- 6,5 (6,7) Millionen Mass Wiesnbier wurden getrunken.
- 112 (114) Ochsen wurden in der Ochsenbraterei verzehrt, in der Kalbsbraterei 48 (58) Kälber verspeist.
- Insgesamt wurden 1.290 (1.552) Straftaten bei der Polizei angezeigt.
- 398 (449) Körperverletzungen wurden von der Polizei registriert.
- Die Polizeistatistik weist 36 (58) Masskrugschlägereien auf.
- 3.603 (7.551) Hilfeleistungen mussten die Sanitäter und Ärzte leisten.
- 681 (638) Wiesn-Besucher mussten wegen Alkoholvergiftungen medizinisch überwacht werden.
- Der überwiegende Teil dieser Patienten ist zwischen 18 und 30 Jahren alt, etwa ein Drittel ist weiblich.
- (230) Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden registriert.
- 150 (140) Mal musste der U-Bahnhof Theresienwiese gesperrt werden.
- 112.000 (81.000) gestohlene Masskrüge werden den Besuchern wieder abgenommen.
- 3.646 (rund 4.200) Fundstücke wurden im Wiesn-Fundbüro abgegeben. Darunter das obligatorische Gebiss.
- Wasserverbrauch: 115.000 Kubikmeter
- Gasverbrauch: 220.000 Kubikmeter
- Stromverbrauch: 2,98 Millionen Kilowattstunden
5. 11 2014 - Sänger Heino für den Karl-Valentin-Orden 2015 nominiert
München * Die Münchner Gesellschaft Narrhalla nominiert den Sänger Heino, 75, als 43. Ordensträger für den Karl-Valentin-Orden 2015. Verliehen wird der Orden - so die Narhalla - für „die humorvollste beziehungsweise hintergründigste Bemerkung im Sinne von Karl Valentin, für eine Rede oder Handlung, für ein Zitat, welches in der Öffentlichkeit publik wurde“.
Der Orden wurde erstmals 1973 an den Kabarettisten Werner Fink verliehen.
16. 11 2014 - Im Volkstheater findet die dritte SAUBANDE-Matinée statt
München-Maxvorstadt * Im Volkstheater findet die dritte SAUBANDE-Matinée, des Karl Valentin-Liesl Karlstadt-Fördervereins, statt.
Es wirken mit: Luise Kinseher, Maria Peschek, Frank-Markus Barwasser (alias Erwin Pelzig), die Couplet AG, Bele Turba, das Fünferl mit Johanna Bittenbinder, Heinz Josef Braun, Sebi Tramontana und Andreas Koll, Hans Well mit den Wellbappn, Stephan Zinner und Holger Paetz.
22. 12 2014 - Joe Cocker stirbt im Alter von 70 Jahren in Crawford/Colorado
Crawford * Der britische Pop-Star Joe Cocker stirbt im Alter von 70 Jahren in Crawford/Colorado.
22. 12 2014 - Demonstration für Völkerverständigung - gegen Fremdenhass
<p><strong><em>München-Graggenau</em></strong> * Auf dem Max-Joseph-Platz demonstrieren nach Polizeiangaben mindestens 12.000, nach Aussagen der Veranstalter um 20.000 Münchner für Humanität, Respekt und Vielfalt und gegen die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Parolen der PEGIDA-Bewegung [= Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes].</p> <p>Organisiert hat die Veranstaltung die Initiative Bellevue di Monaco um Till Hofmann, Alex Rühle, Matthias Weinzierl und andere. Auf der Bühne stehen Künstler wie Konstantin Wecker, die Sportfreunde Stiller, Koflgschroa, Ami Warning, The Notwist sowie die Kabarettisten Christian Springer, Max Uthoff, Claus von Wagner, Michael Mittermeier, Georg Ringsgwandl und andere.</p> <p>Dieter Reiter kommt in seiner Funktion als Münchner Oberbürgermeister. In seiner Ansprache sagt er: <em>„Die Teilnahme an einer Demonstration ist eine bewusste Entscheidung und damit tragen die Teilnehmer auch eine Verantwortung. Aus dieser Verantwortung dürfen wir die Teilnehmer der Pegida-Demonstrationen nicht entlassen“</em>.</p> <p>Am Ende der Demonstration singen Tausende Ludwig van Beethovens <em>„Ode an die Freude“</em>. Die Hymne des Abends heißt <em>„Freude schöner Götterfunke“</em>.</p>
31. 12 2014 - Subventionen im Kultur-, Unterhaltungs- und Bildungsbereich
München * In der Zusammenstellung der städtischen Zuschüsse, die der Münchner Stadtkämmerer Ernst Wolowicz jedes Jahr veröffentlicht, werden die Subventionen im Kultur-, Unterhaltungs- und Bildungsbereich deutlich.
- Das Stadtmuseum wird pro Besucher mit 106,55 Euro unterstützt,
- die Münchner Philharmoniker erhalten pro Zuhörer 97,13 Euro,
- das Volkstheater kriegt für jeden Zuschauer 77,67 Euro,
- in der Stadtbibliothek wird jedes ausgeliehene Buch mit 2,99 Euro bezuschusst,
- nur der Tierpark Hellabrunn sorgt 2014 für ein positives Ergebnis. Die Eisbär-Babies führten zu einem enormen Besucheranstieg von 1,7 auf 2,12 Millionen. Damit überstiegen die Einnahmen die Ausgaben. Trotzdem wird jede Eintrittskarte mit 93 Cent subventioniert.
Bis 2015 - Die „Giesinger Brauerei“ will ihren Marktanteil ausbauen
München-Obergiesing - München-Au * Die „Giesinger Brauerei“ will ein fester Bestandteil der „Auer Dult“ werden und gleichzeitig ihren Marktanteil in München auf ein halbes Prozent ausbauen.
Das hört sich im ersten Moment nach wenig an, ist aber in einer Stadt wie München ein beachtlicher Beitrag.
2015 - 160 „Falschparker“ behindern die Weiterfahrt der Straßenbahn
München * Die Zahl der „Falschparker“, die die Weiterfahrt der Straßenbahn verhindern, hat sich auf 160 [2014: 197] reduziert.
Die „Münchner Verkehrsgesellschaft - MVG“ führt den Rückgang auf das warme Wetter zurück.
„Bei Schneefall wären es erfahrungsgemäß noch einige mehr gewesen“.
Durch den sich schnell bildenden „Trambahn-Stau“ sind oft Hunderte Fahrgäste betroffen.
Das Abschleppen der Fahrzeuge wird beschleunigt.
30. 1 2015 - Der Sänger Heino erhält den „Karl-Valentin-Orden 2015“
München * Der Sänger Heino („Schwarzbraun ist die Haselnuss“) erhält für „die humorvollste beziehungsweise hintergründigste Bemerkung im Sinne von Karl Valentin, für eine Rede oder Handlung, für ein Zitat, welches in der Öffentlichkeit publik wurde“, den „Karl-Valentin-Orden 2015“ der „Münchner Gesellschaft Narrhalla“ überreicht.
Peinlich!
14. 2 2015 - Der „Giesinger Bräu“ verabschiedet sich vom Untergiesinger Brauplatz
München-Untergiesing * Mit einem Fest „auf dem Bierkeller“ feiert der „Giesinger Bräu“ seinen Abschied von seinem Stammsitz in der Untergiesinger Birkenau.
Im Jahr 2006 mietete „Geschäftsführer“ Steffen Marx dort eine Doppelgarage und richtete eine Brauerei samt Bierkeller ein.
Die alten Anlagen sind abgebaut und verkauft.
Im Herbst übernimmt ein Handwerksbetrieb das Untergiesinger Gelände.
Seit November 2014 wird das Bier des „Giesinger Bräu“ im ehemaligen Umspannwerk in der Martin-Luther-Straße gebraut und verkauft.
21. 4 2015 - Die „Hühnerbraterei Poschner“ fliegt von der Wiesn
<p><strong><em>München-Graggenau - München-Theresienwiese</em></strong> * Der Stadtrats-Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft diskutiert in einer nichtöffentlichen Sitzung über die Bewerbungen für das diesjährige Oktoberfest. </p> <ul> <li>Insgesamt liegen dem Wirtschaftsausschuss 1.214 Bewerbungen vor, 2014 waren es noch 1.310 gewesen. 568 Bewerber werden zugelassen [2014: 569]. Die Bandbreite reicht vom großen Bierzelt bis zum Zuckerwattestand, von der Achterbahn bis zum Flohzirkus. </li> <li>Das Schützen-Festzelt soll künftig 7.000 statt bisher 5.500 Plätze bekommen. Gleichzeitig wird die Festhalle schmäler. </li> <li>Die <em>„Hühnerbraterei Poschner“</em> und sein Inhaber Berni Luft kommt nicht mehr zum Zug. Dafür erhält Josef Able, der ältere Bruder des Marstall-Wiesnwirts Siegfried Able, einen Standplatz. Über das Konzept ist noch nichts bekannt. </li> </ul>
8. 5 2015 - Amelia Meyer wird als eineinhalbmillionste Einwohnerin Münchens geboren
München * Amelia Meyer wird als eineinhalbmillionste Einwohnerin Münchens geboren.
Der millionste Einwohner Thomas Seehaus wurde 1957 geboren. Innerhalb von 58 Jahren erhöhte sich die Einwohnerzahl um 500.000 Menschen. Das Wachstum ist ähnlich wie zwischen 1850 und 1910.
24. 5 2015 - The Rolling Stones setzen ihre Welttour in den USA und Kanada fort
San Diego * The Rolling Stones setzen ihre Welttour mit 15 Stadionkonzerten in den USA und Kanada fort. Sie starten an diesem Abend in San Diego und endet am 15. Juli in Quebec City.
15. 6 2015 - Die Bierpreise für das Oktoberfest 2015 um über 3 Prozent erhöht
München - München-Theresienwiese * Die Brauereien und Wiesnwirte erhöhen die Bierpreise für das Oktoberfest 2015 um durchschnittlich 3,17 Prozent. Die Mass Wiesnbier kostet jetzt zwischen 10.- und 10,40 €uro. Begründet wird die Preiserhöhung - wie jedes Jahr - mit höheren Brauereikosten, gesetzliche Vorgaben und erhöhtem Personaleinsatz.
Den Vogel schießt freilich der Sprecher der Wiesnwirte Toni Roiderer mit der Bemerkung ab: „Eigentlich müssten Sie fragen, wie wir es schaffen, so günstig zu bleiben“.
Die Preise werden von den Betreibern der Wiesn-Festzelte und Unternehmungen festgelegt. Die Stadt München überprüft lediglich, ob die Preise angemessen sind. Zum Vergleich: Der Bierpreis für die Mass liegt in Münchens Großbetrieben - je nach Lage - zwischen 7,20 und 9,90 €uro.
15. 7 2015 - Die Rolling Stones beenden ihre USA-Kanada-Tour in Quebec City
Quebec City * Die Rolling Stones beenden ihre USA-Kanada-Tour in Quebec City.
Viele stellen sich die Frage, ob die Stones anschließend noch zu einer Europa-Tournee durchstarten? Die Stones sind für kurzfristige Tournee-Ankündigungen bekannt!
15. 9 2015 - Die Paulaner-Abfüllanlage in Langwied geht in Betrieb
Langwied * Die Paulaner-Brauerei nimmt ihre Abfüllanlage in Langwied in Betrieb. Noch wird Bier in die Flaschen gefüllt, das am Nockherberg hergestellt wurde. Es ist ein Weißbier. Die alte Brauerei am Nockherberg wird im März 2016 stillgelegt.
18. 9 2015 - 175 Jahre Barmherzige Schwestern in Berg am Laim
München-Berg am Laim * Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul feiert das 175-jähriges Bestehen ihres Konvents. Im Jahr 1840 hatten sie den Südflügel der Josephsburg in Berg am Laim erworben. Er bildet den Ursprung des heutigen Alten- und Pflegeheims St. Michael, in dem auch viele Nonnen ihren Lebensabend verbringen.
19. 9 2015 - OB Dieter Reiter eröffnet das weltweit größte Bierfest
München-Theresienwiese * Das 182. Oktoberfest beginnt, indem der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass im Schottenhamel-Festzelt mit zwei Schlägen anzapft. Mit dem Ruf „Ozapft is - Auf eine friedliche Wiesn 2015“ ist das weltweit größte Bierfest offiziell eröffnet.
5. 10 2015 - 26 Sexualdelikte wurden angezeigt, darunter zwei Vergewaltigungen
München-Theresienwiese * 26 Sexualdelikte wurden während des Oktoberfestes angezeigt, darunter zwei Vergewaltigungen, zwei versuchte Vergewaltigungen, sowie exhibitionistische Handlungen und Beleidigungen auf sexueller Basis, wie etwa Grapschen. Sicherlich gibt es eine Dunkelziffer, da viele Frauen aus Scham oder falschen Schuldgefühlen auf eine Anzeige verzichten. Gerade Touristinnen zeigen sexuelle Übergriffe nicht an, sondern wollen einfach vergessen und heimfahren.
Auf dem Oktoberfest kümmern sich verschiedene Hilfsorganisationen, die sich in dem Projekt Sichere Wiesn zusammen geschlossen haben, um sich der Opfer von sexueller Gewalt anzunehmen.
18. 10 2015 - Die Modernisierungsarbeiten für das Deutsche Museum beginnen
München-Isarvorstadt * Nach dem Ende der „Langen Nacht der Museen“ beginnen die Modernisierungsarbeiten für das Deutsche Museum. Etwa die Hälfte des Hauses wird bis 2019 geschlossen. Danach wird die zweite Hälfte saniert, sodass bis 2025 alles fertig sein soll.
11 2015 - Die „Wirtsbudenstraße“ wird in zwei Bauabschnitten saniert
München-Theresienwiese * Die „Wirtsbudenstraße“ auf der „Theresienwiese“ wird in zwei Bauabschnitten saniert.
Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt - vom „Winzerer-Fähndl-Festzelt“ bis zur Kreuzung am „Hacker-Festzelt“ sollen bis Juni 2016 fertiggestellt sein.
22. 11 2015 - Die Giesinger Heilig-Kreuz-Kirche wird wieder eröffnet
München-Obergiesing * Die Giesinger Heilig-Kreuz-Kirche wird nach vierjähriger Sanierung wieder eröffnet.
22. 11 2015 - Die vierte
München-Maxvorstadt * Der Valentin-Karlstadt-Förderverein SAUBANDE veranstaltet im Münchner Volkstheater seine vierte Matinée.
Mit dabei sind:
8. 12 2015 - Ein neuer Konzertsaal im Werksviertel
München-Berg am Laim * Die Standort-Entscheidung für einen neuen Konzertsaal ist zugunsten des Werksviertels gefallen. Die Bayerische Staatsregierung beendet damit eine fünfzehn Jahre andauernde Diskussion. Eröffnet werden kann der Konzertsaal voraussichtlich im Jahr 2021 - wenn alles reibungslos läuft! Die Baukosten sollen zwischen 200 und 300 Millionen Euro liegen.
Die Erbpacht für das gut 8.000 Quadratmeter große Areal, auf dem 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche entstehen werden, soll jährlich bei 600.000 Euro betragen. Über 50 Jahre gerechnet, bedeutet das 30 Millionen Euro für den Besitzer des Geländes, den Pfanni-Erben Werner Eckart. Der Bauherr wird der Freistaat Bayern sein. Bezahlt wird das Projekt hauptsächlich vom Steuerzahler.
Die Alternativstandorte Paketposthalle und Finanzgarten sind damit ausgeschieden. Bei dem einen Objekt wären die Kosten zu hoch geworden, beim anderen befürchtet man eine Klagewelle. Damit hätte sich der Fertigstellungstermin jeweils weit nach hinten geschoben und das Projekt unkalkulierbar gemacht.
16. 12 2015 - Eine zeitlich befristete Ausstellung von Bronzeskulpturen eröffnet
München-Graggenau * Der bayerische Finanz- und Heimatminister Markus Söder eröffnet im Vierschäftesaal der Münchner Residenz eine zeitlich befristete Ausstellung von Bronzeskulpturen aus dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Es handelt sich dabei um Bronze-Skulpturen, die durch Kopien ersetzt und danach aufwändig restauriert worden sind.
Die Ausstellung ist bis zum 14. Februar 2016 für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Danach können die Werke im Bronzesaal nur noch geladene Gäste und Teilnehmer gelegentlich stattfindender öffentlicher Führungen erleben.
1 2016 - Die „Surferwelle“ bei der „Floßlände“ in Thalkirchen wird gerettet
München-Thalkirchen * Die „Surferwelle“ bei der „Floßlände“ in Thalkirchen wird durch Ingenieure durch einen Einbau eines einfachen Keils gerettet.
Die Welle kommt nun mit 75 Prozent der ursprünglichen Wassermenge aus.
Die „Surfwelle“ war seit dem Jahr 2014 ganz verschwunden, nachdem die Stadtwerke die Wasserzuführungen beginnend im Jahr 2009 stark gedrosselt haben.
10. 1 2016 - In Europas größter Party-Zone gehen die Lichter aus
München-Berg am Laim * In der Kultfabrik und im Optimol-Gelände gehen endgültig die Lichter aus. Damit schließt Europas größte Party-Zone.
10. 1 2016 - Der Sänger David Bowie stirbt an Leberkrebs
Großbritannien * Der Sänger David Bowie stirbt an Leberkrebs. Zwei Tage zuvor, an seinem 69. Geburtstag, war sein Album „Blackstar“ veröffentlicht worden.
25. 1 2016 - Paulaner und der Nockherberg gehören zusammen
München-Au * Für die neue Hauptverwaltung der Paulaner-Brauerei in der Ohlmüllerstraße 42 kann sein Richtfest feiern. Der kaufmännische Geschäftsführer Stefan Schmale betont dabei: „Paulaner ist in der Au geboren, Paulaner gehört hierher.“
Bis zum 15. November 2016 soll das Gebäude schlüsselfertig übergeben werden. Danach können die rund 300 Beschäftigten der Paulaner-Hauptverwaltung ihre Büros beziehen.
28. 1 2016 - Richtfest für das Technologiezentrum II der Firma Rohde & Schwarz
München-Berg am Laim * Für das Technologiezentrum II der Firma Rohde & Schwarz an der Ampfingstraße kann das Richtfest gefeiert werden. Der Neubau, der Platz für 600 Beschäftigte bietet, soll 2017 bezogen werden.
15. 2 2016 - Die Ausstellung von Bronzeskulpturen wird wieder geschlossen
München-Graggenau * Die zeitlich befristete Ausstellung von Bronzeskulpturen aus dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert im Vierschäftesaal der Münchner Residenz wird wieder geschlossen. Nun können die Werke im Bronzesaal nur noch geladene Gäste und Teilnehmer gelegentlich stattfindender öffentlicher Führungen erlebt werden.
11. 3 2016 - Keith Emerson stirbt durch Selbstmord
Santa Monica * Der britische Keyborder Keith Emerson, Mitbegründer der Bands Nice und Emerson, Lake and Palmer, ist in Santa Monica in Kalifornien gestorben. Die Polizei geht von Selbstmord des 71-jährigen durch Erschießen aus.
20. 5 2016 - Bob Dylans „Fallen Angels“ wird veröffentlicht
USA * Bob Dylans „Fallen Angels“ wird veröffentlicht. Es ist sein 35. Tonträger.
13. 10 2016 - Bob Dylan erhält den Nobel-Preis für Literatur
Stockholm * Bob Dylan erhält den Nobel-Preis für Literatur.
31. 10 2016 - Das Verbot des Taubenfütterungsverbot fällt
München * Der Stadtratsbeschluss, der das Füttern von Tauben im Stadtgebiet verbietet, läuft nach 20 Jahren aus.
7. 11 2016 - Leonard Cohen stirbt in Los Angeles
Los Angeles * Leonard Norman Cohen stirbt in Los Angeles.
24. 11 2016 - Der Freistaat Bayern schließt mit Werner Eckart einen Vertrag
München * Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt, dass der Freistaat Bayern mit dem Grundbesitzer Werner Eckart einen unbefristeten Vertrag über jährlich 592.000 Euro für den neuen Konzertsaal abschließt.
25. 11 2016 - Uli Hoeneß wird erneut zum Präsidenten des FC Bayern gewählt
München * Uli Hoeneß wird neun Monate nach seiner Haftentlassung erneut zum Präsidenten des FC Bayern gewählt.
9. 12 2016 - Der Architekten-Wettbewerb für den neuen Konzertsaal startet
München-Berg am Laim * Der Architekten-Wettbewerb für den neuen Konzertsaal im Werksviertel startet.
11. 12 2016 - Trambahn-Linie 25 bis zum S-Bahnhof Berg am Laim verlängert
München-Haidhausen - München-Berg am Laim - München-Steinhausen * Die Trambahn-Linie 25 wird bis zum S-Bahnhof Berg am Laim verlängert. Die 2,7 Kilometer lange Strecke hat sechs neue Stationen erhalten.
2017 - Richtige Schreibweise: Wiesn
<p><strong><em>München - Welt</em></strong> * Endlich gibt es Klarheit über die richtige Schreibweise <em>„Wiesn“</em> oder <em>„Wies‘n“</em> als Synonym von <em>„Oktoberfest“</em>. Die richtige und offizielle Schreibweise ist seither <em>„Wiesn“</em> und wird in die digitale Version des Duden aufgenommen.</p> <p>Diese weltbewegende Aktion hat der Münchner Radiosender Gong 96.3 initiiert, die beim bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter Unterstützung fand.</p>
Um 1 2017 - Die „Baubehörde“ wählt aus 206 Bewerbungen 35 Teilnehmer aus
München - München-Berg am Laim * Von 206 Büros, die sich für das Projekt „Konzerthaus im Werksviertel“ beworben haben, wählt die „Baubehörde“ 35 Teilnehmer aus.
Stephan Braunfels befindet sich nicht unter den Auserwählten, obwohl er dank seiner „Bundestagsbauten“ in Berlin und der Münchner „Pinakothek der Moderne“ einer der bekanntesten deutschen Architekten ist.
Laut der „Baubehörde“ kommt er bei der Jury auf eine zu schlechte Beurteilung seiner Bewerbung.
Das will der 67-jährige Architekt nicht akzeptieren, weshalb er den Klageweg beschreitet.
8. 2 2017 - Die jährliche Weißwurst-Prüfung
<p><em><strong>München</strong></em> * Die Münchner Metzgerinnung veranstaltet ihre jährliche Weißwurst-Prüfung. Je zwei Innungs-Obermeister, Veterinäre, Verbraucher und Wirte nehmen an der Verkostung der Produkte von 29 Metzgereien teil. Danach regnet es wieder Goldmedaillen.</p>
12. 2 2017 - Der Doppelbock der Giesinger Brauerei - der „Innovator“
München-Obergiesing * Aus Anlass des 500. Jahrestages der Reformation bringt die Giesinger Brauerei einen dunklen Doppelbock auf den Markt - den „Innovator“ - und veranstaltet an diesem Tag ein Starkbierfest. Das Etikett der Bierflasche ziert ein Bild der evangelischen Martin-Luther-Kirche. „Schismator“ wäre ganz sicher die treffendere Bezeichnung für das Starkbier gewesen.
14. 2 2017 - Die „Staatsregierung“ akzeptiert die juristische Schlappe
München - München-Berg am Laim * Die „Staatsregierung“ akzeptiert die juristische Schlappe, die das „Staatliche Bauamt“ im Rechtsstreit um den „Architekturwettbewerb“ um den neuen „Konzerthausbau auf dem Werksviertel“ hat einstecken müssen.
Zuvor hatte die „Vergabekammer der Regierung von Oberbayern“ der Klage des Architekten Stephan Braunfels im Wesentlichen Recht gegeben. Nun muss das „Staatliche Bauamt“ die Bewerbung des Berliner Architekten Stephan Braunfels neu bewerten.
Das erneut aufgegriffene Verfahren wird die Entscheidung über die Architektur des neuen Konzerthauses im Werksviertel um mehrere Monate verzögern.
21. 2 2017 - Ein 40-Meter-Transparent für den Kurt-Eisner-Platz
München-Graggenau * Auf dem Marienhof wird vom Verein „Das andere Bayern e.V.“ ein vierzig Meter langes Transparent mit der Aufschrift „Kurt-Eisner-Platz“ ausgerollt.
21. 2 2017 - Die Linke will einen Kurt-Eisner-Platz
München * Die Fraktion Die Linke des Münchner Stadtrats bringt einen Antrag zur Umbenennung des Marienhofs in Kurt-Eisner-Platz ein. Darin heißt es: „Der bislang namenlose Platz nördlich des Rathauses wird anlässlich des hundertsten Jahrestages der Proklamation der „freien Volksrepublik Bayern“ durch den ersten Bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner zum „Kurt-Eisner-Platz“ gewidmet.
Die Landeshauptstadt setzt sich beim Betreiber der S-Bahn München dafür ein, dass auch die geplante Haltestelle für den zweiten S-Bahn-Tieftunnel nach Kurt Eisner benannt wird.“
5. 4 2017 - Am Marienhof beginnen die Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Am Marienhof werden mit dem offiziellen Spatenstich die Bauarbeiten für die Zweite S-Bahn-Stammstrecke begonnen.</p>
25. 4 2017 - Hat die Bayerische Staatsregierung Frieden mit Kurt Eisner geschlossen?
München * Scheinbar hat nun auch die Bayerische Staatsregierung ihren Frieden mit Kurt Eisner gemacht. In einem Schreiben des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst heißt es:
„Die Rolle Kurt Eisners bei
- der Beendigung des Ersten Weltkrieges,
- beim Ende der Monarchie und
- der Einführung einer demokratischen Verfasstheit in Bayern,
- beim Bemühen, den künftigen deutschen republikanischen Bundesstaat föderal auszugestalten und
- bei der Bereitschaft, auch die (Mit)Verantwortlichkeit des Deutschen Reiches beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Grundlage für eine neue Friedensordnung in Europa anzuerkennen,
werden von der Bayerischen Staatsregierung außerordentlich positiv bewertet.
Hinzu kommt die Tatsache,
- dass Eisner als Intellektueller (vor allem orientiert an Immanuel Kant),
- mit seinem jüdischen (familiären) Hintergrund und
- als Pazifist (zumal als Zeitgenosse der Blutbäder des Ersten Weltkrieges) wie
- durch seine Ermordung als amtierender Bayerischer Ministerpräsident am 21. Februar 1919
- zu einer Symbolgestalt für aufgeklärt-demokratische Kräfte gegenüber den chauvinistisch-antisemitischen wurde, in deren späterer Konsequenz auch die Barbarei des NS-Regimes in Bayern und Deutschland steht“.
Das Ministerium stellt darin in Aussicht, Kurt Eisner bei den zentralen bayerischen Jubiläumsfeierlichkeiten des Jahres 2018 („100 Jahre Freistaat Bayern“) entsprechend zu würdigen.
Vielleicht bekommt er dann auch ein Bild in der Bayerischen Staatskanzlei.
30. 4 2017 - Familie Pongratz schließt nach 9.820 Tagen ihren Nockherberg
<p><em><strong>München-Au</strong></em> * Peter und Arabella Pongratz, die Wirte vom <em>Nockherberg</em>, werden nach genau 9.820 Tagen ihr Wirtshaus schließen. 27 Jahre Wirte-Dasein auf dem <em>Nockherberg</em> gehen damit zu Ende. </p>
1. 5 2017 - Der Nockherberg wird umgebaut
München-Au * Der Nockherberg wird für die neuen Wirte Christian Schottenhamel und Florian Lechner umgebaut.
3. 5 2017 - Die „Vergabekammer“ weist den erneuten „Nachprüfungsantrag“ zurück
München - München-Berg am Laim * Die „Vergabekammer Südbayern“ hat den erneuten „Nachprüfungsantrag“ des Architekten Stephan Braunfels zurückgewiesen.
Die Schiedsstelle schließt sich damit der Begründung des „Staatlichen Bauamtes“ an, da sich „diese im Rahmen des Beurteilungsspielraums des Aufraggebers“ hält.
18. 5 2017 - Die Entscheidung im Architekten-Wettbewerb wird gefällt
München-Graggenau - München-Berg am Laim * Die Entscheidung über den Architekten-Wettbewerb für den neuen Konzertsaal im Werksviertel ist für diesen Termin vorgesehen. Aufgrund des juristischen Verfahrens, das der Architekt Stephan Braunfels eingeleitet hat, wird die Entscheidung erst Ende Oktober - Anfang November 2017 fallen.
18. 5 2017 - Architekt Stephan Braunfels zieht vors Oberlandesgericht
München - München-Berg am Laim * Der Berliner Architekt Stephan Braunfels gibt nicht auf und will mit einer Klage beim Oberlandesgericht durchsetzen, doch noch am Wettbewerb um den neuen Konzertsaal des Freistaates Bayern im Werksviertel teilnehmen zu dürfen.
30. 6 2017 - Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe
<p><strong><em>Berlin</em></strong> * Der Bundestag beschließt mit großer Mehrheit die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. </p>
14. 7 2017 - Der erste Spatenstich für das Mühlendorf
<p><em><strong>Tierpark Hellabrunn</strong></em> * Mit dem ersten Spatenstich beginnen die Arbeiten für das im künftigen <em>Parkteil Europa</em> des <em>Tierparks Hellabrunn</em> gelegene <em>Mühlendorf</em>. </p>
26. 7 2017 - Stadtrat beschließt Umwandlung des Valentin-Karlstadt-Musäums
München-Graggenau * Der Stadtrat beschließt in seiner Vollversammlung, dass das Valentin-Karlstadt-Musäum zum 1. Januar 2018 ein städtischer Betrieb wird. Damit kommt das Valentin-Karlstadt-Musäum dorthin, wo es eigentlich schon immer hingehört - in die Hände der Münchner Stadtgesellschaft.
10. 8 2017 - Die Beschwerde des Architekten Stephan Braunfels wird zurückgewiesen
München - München-Berg am Laim * Der „Vergabesenat des Oberlandesgerichts“ weist die Beschwerde des Berliner Architekten Stephan Braunfels gegen die „Auswahl der Teilnehmer am Architekten-Wettbewerb“ zurück.
Jetzt soll alles ganz schnell gehen:
- Ende Oktober, Anfang November soll eine Jury den „Siegerentwurf“ für das neue Münchner „Konzerthaus“ küren,
- im Frühsommer 2018 sollen die Bauarbeiten auf dem „Werksviertel“ beginnen.
6. 9 2017 - Die Olympia-Attentat-Gedenkstätte wird eröffnet
München-Oberwiesenfeld * Die Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentats wird auf dem Lindenhügel im Münchner Olympiapark eröffnet.
16. 9 2017 - Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet das 184. Oktoberfest
München-Theresienwiese * Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zapft das erste Wiesn-Fass im Schottenhamel-Festzelt mit zwei Schlägen an und eröffnet damit - mit dem Ruf „Ozapft is - Auf eine friedliche Wiesn“ - das 184. Oktoberfest.
24. 9 2017 - Die CSU stützt ab - Riesige Stimmengewinne der AfD
Freistaat Bayern - München * Bei der Wahl zum 19. Bundestag erhält
- die CSU in Bayern lediglich 38,8 Prozent der Stimmen [- 10,5].
- Die SPD kommt gerade einmal auf 20,0 Prozent [- 4,7],
- die Grünen erhalten 9,8 Prozent [+ 1,2],
- die Linke erreicht 6,1 Prozent [+ 2,3],
- die FDP kann 10,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen [+ 5,1].
- Auch im Freistaat ist die Alternative für Deutschland - AfD die große Gewinnerin, mit 12,4 Prozent der Stimmen, was einem Plus von 8,1 Prozent entspricht.
24. 9 2017 - Große Verluste der etablierten Parteien bei der Bundestagswahl 2017
Bundesrepublik Deutschland - Berlin * Bei der Wahl zum 19. Bundestag erhält
- die CDU/CSU mit ihrer amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel 32,9 Prozent [- 8,6] und 240 Sitze [- 71].
- Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Schulz erringt 20,8 Prozent der Stimmen [- 4,9] und 152 Sitze [- 41].
- „Bündnis 90/DIE GRÜNEN“ kommen auf 9,0 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 0,6] und 66 Sitze [+ 3].
- Die FDP bekommt 10,4 Prozent [+ 5,6] und erreicht damit 76 Sitze.
- Die Linke erkämpft ebenfalls 9,0 Prozent der Stimmen [+ 0,4] und zieht mit 66 Abgeordneten [+ 2] in den Deutschen Bundestag ein.
- Der große Siegerin der Bundestagswahl ist die Alternative für Deutschland - AfD mit 13,0 Prozent [+ 8,3] und 95 Sitzen.
Angelika Merkel wird Bundeskanzlerin einer Koalition bestehend aus CDU/CSU und SPD.
27. 9 2017 - Frauen sollen in Saudi Arabien Autofahren dürfen
Saudi Arabien * Ein Dekret von König Salman von Saudi Arabien schafft die notwendigen praktischen Voraussetzungen, um ab Juni 2018 als letztes Land der Welt den Frauen das Autofahren zu erlauben.
Aktivistinnen kämpften seit 1990 für diese Errungenschaft und mussten oft einen hohen Preis dafür zahlen: Beispielsweise eine Gefängnisstrafe von 73 Tagen.
2. 10 2017 - Tom Petty stirbt in Santa Monica in Kalifornien an Herzversagen
Santa Monica * Der US-amerikanische Rock-Musiker Tom Petty stirbt in Santa Monica in Kalifornien an Herzversagen.
3. 10 2017 - Das Oktoberfest 2017 endet
München-Theresienwiese * Das Oktoberfest 2017 endet. Das Fazit lautet:
- In 18 Tagen besuchten angeblich 6,2 Millionen Besucher [2016: 5,6 in 17 Tagen, 2015: 5,9 in 16 Tagen, 2014: 6,3 in 16 Tagen] die Wiesn.
- 2017 gab es keine Landwirtschaftsausstellung, dafür eine Oide Wiesn.
- Im Jahr 2017 besuchten 480.000 Gäste [2015: 535.000] die Oide Wiesn.
Der Konsum - und damit der Umsatz - hat sich erholt. [Zahlen in Klammer = 2016 - 2015 - 2014.]
- 7,5 Millionen Mass Wiesnbier [6,1 - 7,3 - 7,7] wurden getrunken.
- 127 Ochsen [109 - 114 - 112] wurden in der Ochsenbraterei verzehrt.
- Insgesamt wurden 1.162 Straftaten [1.067 - 1.191 - 1.290] bei der Polizei angezeigt.
- 314 Körperverletzungen [331 - 372 - 398] wurden von der Polizei registriert.
- Die Polizeistatistik weist 49 Masskrugschlägereien [42 - 47 - 36] aus.
- 3.449 Hilfeleistungen [3.897 - 3.312 - 3.617] mussten die Sanitäter und Ärzte leisten.
- 670 Wiesn-Besucher [593 - 628 - 681] mussten wegen Alkoholvergiftungen medizinisch überwacht werden.
- ?? [35 - 121 - 150] Mal musste der U-Bahnhof Theresienwiese gesperrt werden.
- 120.000 gestohlene Masskrüge [96.000 - 110.000 - 112.000] wurden den Besuchern wieder abgenommen.
- 4.055 Fundstücke [2.915 - 2.948 - 3.646] wurden im Wiesn-Fundbüro abgegeben.
14. 10 2017 - Das Gärtnerplatz-Theater wird wiedereröffnet
München-Isarvorstadt * Das Gärtnerplatz-Theater wird mit einer Eröffnungsgala nach fünfjähriger Sanierung wieder in Betrieb genommen.
6. 11 2017 - Die Landtags-SPD fordert einen Feiertag zum Demokratie-Jubiläum
München * Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Markus Rinderspacher, schreibt an Ministerpräsident Horst Seehofer: „Wir sollten das Jahr 2018 nutzen, um an die Heldinnen und Helden der Demokratie in Bayern zu erinnern“, nachdem der Freistaat Bayern sein 100-jähriges Bestehen feiert.
Und weiter: „Der 8. November 1918 hat deshalb für den Freistaat Bayern eine Bedeutung, die der des 14. Juli 1789 für Frankreich oder der des 4. Juli 1777 für die USA in nichts nachsteht.“ Er fordert den CSU-Regierungschef auf, sich für den Feiertag im kommenden Jahr einzusetzen.
23. 11 2017 - Bundesstaatsanwaltschaft stellt Brandanschlag-Ermittlungen ein
Karlsruhe - München-Isarvorstadt * Die Bundesstaatsanwaltschaft in Karlsruhe stellt die Ermittlungen zum Brandanschlag auf das damalige Zentrum der Israelitischen Kultusgemeinde Münchens an der Reichenbachstraße 27 ein.
Dort waren bei einem Brandanschlag auf das jüdische Altersheim am 13. Februar 1970 zwei Frauen und fünf Männer, darunter zwei Holocaust-Überlebende zu Tode gekommen.
16. 12 2017 - Das Seligsprechungsverfahren für Fritz Gerlich und Romano Guardini
München-Kreuzviertel * Kardinal Rainhard Marx leitet mit einem Gottesdienst in der Frauenkirche das Seligsprechungsverfahren für Dr. Fritz Gerlich und Romano Guardini ein.
16. 12 2017 - Markus Söder zum designierten Ministerpräsidenten gewählt
Nürnberg * Auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg wählen die Delegierten Markus Söder zum designierten Ministerpräsidenten.
1. 1 2018 - Das Valentin-Karlstadt-Musäum ist ein städtischer Betrieb
München-Graggenau - München-Angerviertel * Das Valentin-Karlstadt-Musäum ist ein städtischer Betrieb. Bis dahin war das „Musäum“ ein privat betriebenes Museum, das seinen Betrieb bis 2016 ausschließlich selbst erwirtschaften musste.
26. 1 2018 - Im Mühlendorf ist Richtfest
Tierpark Hellabrunn * Das Richtfest für das im künftigen Parkteil Europa des Tierparks Hellabrunn entstehende Mühlendorf findet statt.
6. 2 2018 - München ist Deutschlands Stauhauptstadt
München * München ist wieder einmal mit weitem Abstand Deutschlands Stauhauptstadt. 51 Stunden im Jahr verbringt der Münchner im Stau. Im internationalen Vergleich steht München auf Platz 76 von 1.360.
7. 2 2018 - Der neue Nockherberg wird wieder eröffnet
München-Au * Nach einem Dreiviertel Jahr Umbau wird der neue Nockherberg unter neuer Führung wieder eröffnet. Christian Schottenhamel und Florian Lechner sind die neuen Wirte.
28. 2 2018 - Luise Kinseder tritt letztmals als Mama Bavaria auf
München-Au * Luise Kinseder, die seit dem Jahr 2011 beim Salvator-Anstich auf dem Nockherberg den Politikern als „Mama Bavaria“ die Leviten las, nimmt Abschied von dieser Rolle. Die Politiker, Künstler und die sonst noch zum erlauchten Kreis der geladenen Gäste gehören, feiern sie darauf mit stehenden Ovationen.
11. 3 2018 - Der „Tiger Willi“ stirbt
Steinebach am Wörthsee * Der unter seinem Künstlernamen „Tiger Willi“ bekannte Liedermacher Wilhelm Raabe stirbt kurz vor seinem 71. Geburtstag (9. April).
13. 3 2018 - Gedenkveranstaltung für die deportierten Sinti und Roma
<p><em><strong>München-Graggenau</strong></em> * Im Münchner Rathaus findet erstmals eine Gedenkveranstaltung an die Deportation der Münchner Sinti und Roma statt. </p>
16. 3 2018 - Der Landtag wählt Markus Söder zum Ministerpräsidenten
<p><em><strong>München-Haidhausen</strong></em> * Die aus der CSU bestehende Mehrheit der Abgeordneten des Bayerischen Landtags wählt Markus Söder zum Ministerpräsidenten. </p>
24. 4 2018 - Kruzifixe in allen Dienstgebäuden
München - Freistaat Bayern * Die bayerische Staatsregierung beschließt, dass im Eingangsbereich von Dienstgebäuden künftig Kreuze - als Symbol „unserer bayerischen Identität und Lebensart“ aufgehängt werden sollen.
4. 5 2018 - Münchens OB gegen Kreuze im Eingangsbereich von Behörden
München * Mit seiner Aussage: „Ich sehe keine Veranlassung, die städtischen Regelungen hierzu zu verändern“, erteilt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter der Empfehlung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, im Eingangsbereich künftig Kreuze aufzuhängen, eine deutliche Abfuhr.
1. 6 2018 - Ein Kreuz im Eingangsbereich der bayerischen Dienstgebäude
Freistaat Bayern * In jedem Dienstgebäude des Freistaats Bayern muss ein Kreuz angebracht werden. Das löst Proteste und deutschlandweit eine kontroverse Diskussion aus. Selbst Vertreter der christlichen Kirchen widersprechen dem Beschluss. Auch deshalb, weil Ministerpräsident Markus Söder erklärt: „Das Kreuz ist nicht ein Zeichen einer Religion.“ Im Kreuz spiegle sich vielmehr „unsere bayerische Identität und Lebensart“.
24. 6 2018 - Saudi Arabien erlaubt den Frauen das Autofahren
Saudi Arabien * Saudi Arabien erlaubt als letztes Land der Welt den Frauen das Autofahren. Dazu mussten seit September 2017 die notwendigen praktischen Voraussetzungen geschaffen werden - etwa um Fahrlehrerinnen einzustellen und Verkehrspolizisten im Umgang mit Frauen im Straßenverkehr zu schulen.
Von einer Gleichberechtigung von Mann und Frau ist das Land jedoch noch weit entfernt.
5. 7 2018 - Einführung eines jährlichen Gedenktages für die Sinti und Roma beschlossen
München-Graggenau * Der Kulturausschuss des Münchner Stadtrats beschließt die Einführung eines jährlichen Gedenktages für die von den Nazis deportierten und ermordeten Sinti und Roma.
16. 7 2018 - Die Aufbauarbeiten für das 185. Oktoberfest beginnen
München-Theresienwiese * Die Aufbauarbeiten für das 185. Oktoberfest beginnen. Da das Betreten der Baustelle in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen verboten ist, müssen lange Umwege in Kauf genommen werden.
Nur das Schützenzelt ist von dieser Regel ausgenommen, da es an dem geplanten Fahrradweg steht, auf dem die Radler während des Aufbaus der anderen Festzelte und der Fahrgeschäfte die Wiesn queren können.
13. 9 2018 - Wiesn ist nun eine europaweit geschützte Marke
Alicante * Wiesn ist nun ein für mindestens zehn Jahre europaweit geschützter Begriff. Das Intellectual Property Office der Europäischen Union - EUIPO, das Amt für geistiges Eigentum in Alicante, hat den Münchner Antrag von Ende 2015 positiv beschieden und Wiesn als Wortmarke mit Wirkung zum 13. September eingetragen. Die Wortmarke bleibt nun für zehn Jahre, also mindestens bis Ende 2025 geschützt.
Der Begriff Oktoberfest wird vermutlich demnächst auf europäischer Ebene geschützt sein.
15. 9 2018 - Das Bayerische Oberlandesgericht wird wieder gegründet
München * Das Bayerische Oberlandesgericht - BayObLG, das im Jahr 2006 vom damaligen Ministerpräsident Edmund Stoiber aufgelöst worden war, wird wieder gegründet.
21. 9 2018 - Das Wiesnwirte-Ehepaar Arabella und Peter Pongratz wird geschieden
München-Theresienwiese • Das Wiesnwirte-Ehepaar Arabella und Peter Pongratz wird einen Tag vor der Eröffnung des Oktoberfestes geschieden. Sie bleiben aber dennoch weiterhin die Wiesnwirte im Winzerer-Fähndl-Festzelt.
22. 9 2018 - Oberbürgermeister Reiter zapft mit zwei Schlägen im Schottenhamel an
München-Theresienwiese • Oberbürgermeister Dieter Reiter zapft souverän mit zwei Schlägen das erste Wiesn-Fass in der Schottenhamel-Festhalle an. Danach ertönt sein Ruf: „Ozapft is!“. Den üblichen Zusatz: „Auf eine friedliche Wiesn!“ vergisst er. Die erste Wiesn-Mass erhält der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
23. 9 2018 - Oberbürgermeister Reiter wünscht eine friedliche Wiesn
München-Theresienwiese • Um Punkt zwölf Uhr schickt Oberbürgermeister Dieter Reiter auf Facebook einen Post: „Jetzt nochmal komplett: Auf eine friedliche Wiesn“. Er hatte diesen wichtigen Zusatz am Vortag nach dem Anstich des ersten Wiesn-Fasses im Schottenhamel einfach vergessen.
23. 9 2018 - Das Sturmtief Fabienne schlägt zu
München-Theresienwiese • Am Nachmittag schlägt das Sturmtief Fabienne zu. Der orkanartige Sturm hält die Wiesn-Besucher in Trab. Den Zaun an der Oidn Wiesn hat der Wind auf hundert Meter umgeschmissen. Über die Lautsprecheranlage werden die Besucher vor eventuell umstürzenden Bäumen und herumfliegenden Gebäudeteilen gewarnt. Die Festleitung empfiehlt um 20:57 Uhr den Außenbereich ganz zu meiden.
7. 10 2018 - Das Fazit der Wiesn 2018
München-Theresienwiese * Das Oktoberfest 2018 endet. Das Fazit lautet:
- In 16 Tagen besuchten 6,3 Millionen Besucher [2017: 6,2 Millionen in 18 Tagen; 2016: 5,6 in 17 Tagen; 2015: 5,9 in 16 Tagen; 2014: 6,3 in 16 Tagen] die Wiesn.
- 2018 gab es keine Landwirtschaftsausstellung, dafür eine Oide Wiesn.
- Im Jahr 2018 besuchten 500.000 Gäste [2016: 480.000; 2015: 535.000] die Oide Wiesn.
- Der Konsum - und damit der Umsatz - hat sich erholt. [Zahlen in Klammer = 2017 - 2016 - 2015 - 2014.]
- 7,5 Millionen Mass Wiesnbier [7,6 - 6,1 - 7,3 - 7,7] wurden getrunken.
- 124 Ochsen [127 - 109 - 114 - 112] wurden in der Ochsenbraterei verzehrt und
- 48 Kälber [59 - xx - 50 - xx] in der Kalbsbraterei.
- Insgesamt wurden 924 Straftaten [1.162 - 1.067 - 1.191 - 1.290] bei der Polizei angezeigt.
- 62 Sexualdelikte [42] auf dem Festgelände, davon vier Vergewaltigungen.
- xxx Körperverletzungen [314 - 331 - 372 - 398] wurden von der Polizei registriert.
- Bei einer Schlägerei am 28. September war ein Todesfall zu verzeichnen.
- Die Polizeistatistik weist 27 Masskrugschlägereien [36 - 42 - 47 - 36] aus.
- 3.333 Hilfeleistungen [3.449 - 3.897 - 3.312 - 3.617] mussten die Sanitäter und Ärzte leisten.
- 717 Wiesn-Besucher [670 - 593 - 628 - 681] mussten wegen Alkoholvergiftungen medizinisch überwacht werden.
- ?? [?? - 35 - 121 - 150] Mal musste der U-Bahnhof Theresienwiese gesperrt werden.
- xx.xxx gestohlene Masskrüge [120.000 - 96.000 - 110.000 - 112.000] wurden den Besuchern wieder abgenommen.
- 2.685 Fundstücke [4.055 - 2.915 - 2.948 - 3.646] wurden im Wiesn-Fundbüro abgegeben.
14. 10 2018 - Ergebnis der Wahl zum Bayerischen Landtag 2018
Freistaat Bayern - München * Nach der Auszählung der Landtagswahl gehören dem Bayerischen Landtag in dieser 18. Legislaturperiode 205 Mitglieder an. Bei der Wahl zum 18. Bayerischen Landtag erreicht
- die CSU mit ihrem amtierenden Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder 37,2 Prozent [- 10,5 %] und 85 Sitze [- 16]. Das ist das schlechteste Wahlergebnis der CSU seit 1950.
- Die GRÜNEN kommen auf 17,6 Prozent der Wählerstimmen [+ 9,0 %] und 38 Parlamentssitze [+ 20], davon 6 Direktmandate.
- Die Freien Wähler erhalten 11,6 Prozent der Stimmen [+ 2,6] und 27 Mandate [+ 8].
- Die AfD bekommt 10,2 Prozent der Wählerstimmen [+ 10,2] und 22 Sitze [+ 22] und zieht erstmals in den Bayerischen Landtag ein.
- Die SPD erringt 9,7 Prozent der Stimmen [- 11,0] und 22 Landtags-Mandate [- 20]. Das ist das schlechteste Landtagswahlergebnis der SPD seit 1893.
- Die FDP erringt 5,1 Prozent der Wählerstimmen [+1,8] und 11 Mandate [+ 11] und kann damit wieder in den Landtag einziehen.
Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,3 Prozent, so hoch, wie seit 1982 nicht mehr.
Markus Söder wird Bayerischer Ministerpräsident und kann mit einer Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern arbeiten.
7. 11 2018 - Staatsakt zum 100. Geburtstag des Freistaats Bayern
München * Ministerpräsident Markus Söder spricht auf einem Staatsakt zum 100. Geburtstag des Freistaats Bayern, ohne dessen Gründer Kurt Eisner und die Ermordung des Sozialisten durch einen Rechtsradikalen mit einem Wort zu erwähnen.
Ein Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung bezeichnet Söders Rede „dem Anlass in keiner Weise angemessen“, da er seine Rede in scherzhaft-launigem Stil vortrug, passend eher zum „Jubiläum eines Trachtenvereins“.
9. 11 2018 - Gedenktafeln für die Familie Schülein
München-Haidhausen * An der Fassade des Unionsbräu an der Einsteinstraße 42 und im Innenhof werden zwei Gedenktafeln an die jüdische Brauerfamilie Schülein enthüllt. Die Tafeln hat der Münchner Bildhauer Toni Preis gestaltet. Die Festreden halten u.a. der Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers und die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Dr. Charlotte Knobloch.
Der Text auf den Erinnerungstafeln lautet: „1885 erwirbt Josef Schülein das Anwesen Einsteinstraße (damals Äußere Wiener Straße) 38 - 44 und gründete die Unionsbrauerei Schülein & Co.. Am 5. Januar 1921 fusioniert die Brauerei mit der Löwenbräu AG. Dr. Hermann Schülein, der Sohn der Firmengründers, wird Vorstandsvorsitzender. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 werden die Schüleins auf Grund ihrer jüdischen Herkunft aus all ihren Funktionen gedrängt.
Dr. Hermann Schülein verlässt im Frühjahr 1936 Deutschland und emigriert mit seiner Familie in die USA. Joseph Schülein stirbt am 9. September 1938 auf Gut Kaltenberg. 1943/44 wird fast das gesamte Areal der Unionsbrauerei durch Bomben zerstört.
Auch in den USA als Brauereiunternehmer erfolgreich, unterstützt Dr. Hermann Schülein den Wiederaufbau Münchens. Er stirbt am 14. Dezember 1970.
Zu Beginn der 1990er Jahre werden die noch erhaltenen Kellerräume der Unionsbrauerei saniert. 1998 eröffnet dort ein Kulturzentrum mit Räumen für Theater, Film und Musik.“
11. 11 2018 - Die siebte SAUBANDE-Matinée
<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Zum siebten Mal veranstaltet die SAUBANDE, der Valentin-Karlstadt-Förderverein, eine Benefiz-Matinée im Münchner Volkstheater. Namhafte Künstlerinnen und Künstler geben ihr Bestes, garniert mit valentinschen Spitzen. </p>
31. 12 2018 - Augustiner erhöht seinen Bierumsatz um 2 Prozent
München * Der Ausstoß der Augustiner-Brauerei liegt im Jahr 2018 bei 1,63 Millionen Hektolitern. Das entspricht einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lässt Augustiner auf Platz 11 unter den größten deutschen Brauereien landen.
14. 5 2019 - Die Schiffsschraube vorm Deutschen Museum wird demontiert
München-Isarvorstadt * Die Schiffsschraube vor dem Kongresssaal des Deutschen Museums wird demontiert und auf das Außengelände der Flugwerft Schleißheim gebracht.
Die Schiffsschraube entstand im Jahr 1905, war aber nie in Gebrauch. Sie ist elf Meter lang und hat einen Durchmesser von 6,85 Meter. Es ist der Propeller eines Schnelldampfers, die von der Friedrich Krupp AG Essen gegossen worden war. Jeder der drei Flügel wiegt 4.400 Kilogramm. Insgesamt, samt den Lagerblöcken, wiegt das Monstrum 52.040 Kilo.
Die Verlegung der Schiffsschraube ist wegen der Sanierung der Ludwigsbrücke notwendig. Sie kommt frühestens in sechs Jahren (2025) zurück.
23. 6 2019 - Barbusige Frauen an das Nacktbadeverbot erinnert
München * Mehrere Männer eines Sicherheitsdienstes haben barbusige Frauen am Isarufer zwischen Wittelsbacherbrücke und Reichenbachbrücke angesprochen und sie an das Nacktbadeverbot erinnert, das mit einigen Ausnahmen überall in der Landeshauptstadt gilt, obwohl der Wachdienst angewiesen worden war, das textilfreie Baden an der Isar auch außerhalb der FKK-Zonen nicht von sich aus zu verfolgen.
Die Badeverordnung verlangt etwas unpräzise: „Wer öffentlich badet, muss im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München Badekleidung tragen“. Der Stadtrat muss sich nun in seiner Sitzung am 26. Juni damit beschäftigen, wie viel Nacktheit München verträgt und was unter „nackt“ überhaupt zu verstehen sei.
26. 6 2019 - Jetzt ist endlich geklärt, was „nackt“ ist
München * Die CSU-Stadtratsfraktion stellt einen Dringlichkeitsantrag für die Vollversammlung des Stadtrats in dem es heißt: „Die Badekleidungssatzung der Landeshauptstadt München wird dahingehend geändert, dass Badebekleidung im Sinne dieser Satzung die primären Geschlechtsorgane vollständig bedecken muss.“ Damit ist geklärt, was „nackt“ ist.
2. 7 2019 - Detailplanung für das neue König-Ludwig-Zwo-Denkmal im Stadtrat
München * Der Stadtrat beschäftigt sich mit der Detailplanung für das neue König-Ludwig-Zwo-Denkmal auf dem Isarbalkon der Corneliusbrücke. Damit geht ein Herzens-Projekt des Deutsche-Eiche-Wirts Dietmar Holzapfel endlich in Erfüllung.
23. 9 2019 - Das Varietétheater Schichtl feiert seinen 150. Geburtstag
München-Theresienwiese • Das Varietétheater Schichtl feiert seinen 150. Geburtstag. Zum Empfang kommt die gesamte Stadtspitze zum Schausteller Manfred Schauer auf die Wiesn.
18. 12 2019 - Der Münchner Stadtrat beschließt den Klimanotstand
München-Graggenau * Der Münchner Stadtrat beschließt den Klimanotstand und will schon bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden.
2020 - „Wiesn“ nun auch im Duden
<p><em><strong>München - Welt</strong></em> * Das Wort <em>„Wiesn“</em> als richtige Schreibweise für das Synonym <em>„Oktoberfest“</em> findet nun auch in die 28. Auflage der gedruckten Version des Rechtschreibwörterbuches Duden seinen Niederschlag.</p>
6. 3 2020 - Erstes Merkblatt zur Corona-Pandemie
Freistaat Bayern • Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gibt ein in allen Apotheken aufgelegtes Merkblatt heraus, in dem auf die Gefahren der Corona-Pandemie hingewiesen wird.
9. 3 2020 - Größere Versammlungen werden verboten
Freistaat Bayern • Größere Versammlungen werden wegen der heraufziehenden Corona-Pandemie verboten.
10. 3 2020 - CSU verbietet alle Parteiversammlungen
München - Freistaat Bayern • Der Generalsekretär der CSU verbietet alle Parteiversammlungen.
15. 3 2020 - Kommunalwahl trotz Corona
Freistaat Bayern • Im Freistaat Bayern finden die Kommunalratswahlen trotz der heraufziehenden Corona-Pandemie statt. Da Wahlhelfer reihenweise absagen, werden Lehrer (Beamte) per Anordnung für diese Tätigkeit zwangsverpflichtet.
21. 4 2020 - Das Oktoberfest 2020 wird abgesagt
München • Das Oktoberfest 2020 wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der Inzidenzwert liegt bei 34,2.
26. 7 2020 - Alt-OB Hans-Jochen Vogel stirbt in München
München * Der Münchner Alt-Oberbürgermeister und spätere Bau- und Justizminister sowie SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel stirbt im Alter von 94 Jahren in München.
19. 9 2020 - Die ausgefallene Wiesn 2020
München-Theresienwiese • Das Oktoberfest 2020 fällt nach der Entscheidung vom 21. April 2020 aus. Der Inzidenzwert liegt in München inzwischen bei über 50.
12. 10 2020 - Sieben-Tage-Inzidenz erstmals über 50
München • Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert [= Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen] liegt in München erstmals über 50.
20. 12 2020 - Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert erreicht 300,7
München • Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert erreicht in München mit 300,7 seinen vorläufigen Höchstwert.
4. 2 2021 - Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 48,0
München • Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz [= Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen] liegt in München bei 48,0. Sie liegt damit wieder auf dem Stand vom 12. Oktober 2020. Das sind 10 Tage bis wann der landesweite Lockdown begrenzt ist. Lockerungen wird es laut Oberbürgermeister Dieter Reiter deshalb nicht geben.
Der bayernweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 83,1, in Deutschland bei 80,7.
7. 3 2021 - Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 52,1
München • Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert [= Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen] liegt in München erneut über 50, bei exakt 52,1.
31. 3 2021 - Die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 100
<p><em><strong>München</strong></em> • Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert [= Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen] liegt</p> <ul> <li>in München erneut über 100, bei exakt 100,2. </li> <li>Der bayernweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 137,</li> <li>in Deutschland bei 132. </li> </ul>
3. 5 2021 - Das Oktoberfest 2021 wird wegen Corona abgesagt
München • Das Oktoberfest 2021 wird wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal abgesagt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt zwar seit Tagen, liegt aber immer noch bei 126,4.
5. 5 2021 - Corona-Inzidenzwert für München sinkt wieder auf 99,0 ab
München * Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert für München sinkt auf 99,0 ab. Damit ist der Wert wieder auf dem Stand vor dem 31. März 2021.
6. 5 2021 - Mahnmal zur Bücherverbrennung 1933
München-Maxvorstadt * In Erinnerung an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 hat der Künstler Arnold Dreyblatt auf dem Königsplatz ein Mahnmal errichtet. Es trägt den Titel „The Blacklist / Die Schwarze Liste“.
Das am historischen Ort in den Boden eingelassene Mahnmal zeigt Werke von 310 Autor*innen, die im NS-Regime geächtet wurden. Dreyblatt wählte jeweils die letzte Veröffentlichung der Autor*innen bis einschließlich 1933.
18. 5 2021 - Verwirrung um den Münchner Inzidenzwert
München * Verwirrung um den Münchner Inzidenzwert: Am Morgen meldet das Robert-Koch-Institut, dass der Wert in der Stadt auf 46,2 gesunken sei. Am Vormittag wird die Zahl dann aber nach oben korrigiert, Gründe dafür aber nicht genannt.
19. 5 2021 - Die Inzidenz in München wieder unter 50
München * Die Sieben-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt ist erneut unter den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet an diesem Tag eine Inzidenz von 47,3.
27. 5 2021 - Inzidenz in München wieder unter 35
München • Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert sinkt in München mit 34,9 erstmals wieder unter 35.
27. 5 2021 - Ja, es war Völkermord !
Berlin • Deutschland bekennt sich nach über 110 Jahren zu dem Völkermord an den Herero und Nama. Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia. Bei der Niederschlagung von Aufständen durch die deutsche Schutztruppe zwischen 1904 und 1908 wurden etwa 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama getötet.
30. 5 2021 - Alle Bundesländer erreichen Inzidenz unter 50
Bundesrepublik Deutschland * In allen deutschen Bundesländern ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf unter 50 gerutscht, nachdem auch Thüringen mit 47,5 unter dieser Marke liegt.
- Bundesweit liegt der Wert bei 35,2.
- München hat - trotz leichten Anstiegs - die Marke von 30,7 erreicht.
9. 6 2021 - Maskenpflicht in der Innenstadt aufgehoben
München * Die durch Corona bedingte Maskenpflicht in der Innenstadt und am Viktualienmarkt wird aufgehoben.
12. 6 2021 - Münchner Corona-Inzidenz bei 20,0
München • Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in München bei 20,0. Die bayernweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt lbei 22,0. Der deutschlandweite Wert sinkt innerhalb einer Woche von 26,3 auf 18,3 ab.
22. 6 2021 - 7-Tage-Inzidenz in München bei 9,8
München • Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinkt in München auf 9,8. Im Vergleich: BRD: 7,2; Bayern: 9,92.
29. 6 2021 - 7-Tage-Inzidenz wieder über 10
München * Nur eine Woche liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert für München unter der Marke von 10,0. Am 29. Juni steigt er wieder auf 10,6 an.
28. 7 2021 - Corona-Inzidenz wieder über 25
München * Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt für die bayerische Landeshauptstadt wieder bei 25,7. Tendenz steigend!
26. 9 2021 - Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in München
München * Bei der Wahl in München zum 20. Bundestag erhält
- das Bündnis 90/Die Grünen 26,1 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 8,9].
- die CSU 23,8 Prozent [- 6,2].
- Die SPD wird Drittklassig und erringt 19,0 Prozent der Stimmen [+ 2,8].
- Die FDP bekommt 13,7 Prozent [- 0,5].
- Die Alternative für Deutschland - AfD erhält 4,5 Prozent [- 3,8].
- Die Linke erkämpft lediglich 4,1 Prozent der Stimmen [- 4,2].
Insgesamt 14 Münchnerinnen und Münchner ziehen in den neuen Bundestag ein. CSU: 3 Direktmandate, GRÜNE: 3, davon 1 Direktmandat, SPD: 2, FDP: 3, AfD: 2, Linke: 1
26. 9 2021 - Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Bayern
Freistaat Bayern * Bei der Wahl im Freistaat Bayern zum 20. Bundestag erhält
- die CSU als bayerisches Anhängsel der Union erhält im Freistaat immerhin 31,7 Prozent [-7,1]. Das sind allerdings bundesweit lediglich 5,2 Prozent. Unabhängig von den Direktmandaten schrammt die bayerische Splitterpartei knapp am Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde vorbei.
- Die SPD erringt 18,0 Prozent der Stimmen [+ 2,7].
- Bündnis 90/Die Grünen kommen auf 14,1 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 4,3].
- Die FDP bekommt 10,5 Prozent [+ 0,4].
- Die Alternative für Deutschland - AfD erhält 9,0 Prozent [-3,4].
- Die Linke erkämpft ebenfalls 2,8 Prozent der Stimmen [- 3,3].
Bis auf ein Direktmandat im Freistaat Bayern entfallen die anderen 45 auf die CSU. Die Ausnahme ist die 28-jährige Jamila Schäfer, die das Direktmandat in München-Süd gewinnt.
26. 9 2021 - SPD gewinnt Bundestagswahl 2021
Bundesrepublik Deutschland - Berlin * Bei der Wahl zum 20. Bundestag erhält
- die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz erringt 25,7 Prozent der Stimmen [+ 5,2] und 206 Sitze.
- CDU/CSU mit Armin Laschet als Kanzlerkandidat kommen auf 24,1 Prozent [- 8,9] und 196 Sitze.
- Bündnis 90/Die Grünen erhalten mit ihrer Kanzlerkandidatin Analena Baerbock 14,8 Prozent der abgegebenen Stimmen [+ 5,9] und 118 Sitze.
- Die FDP bekommt 11,5 Prozent [+ 0,8] und erreicht damit 92 Sitze.
- Der Alternative für Deutschland - AfD erhält 10,3 Prozent [-2,3] und 83 Sitze.
- Die Linke erkämpft lediglich 4,9 Prozent der Stimmen [-4,3] und zieht aufgrund von Überhang- und Direktmandaten mit 39 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein.
- Der Südschleswigsche Wählerverband - SSW erhält 1 Mandat.
Der Anteil der Frauen bei den Abgeordneten beträgt 35 Prozent. Die Fraktionen von CDU/CSU, FDP und AfD stellen sich als besonders männerlastig dar.
21. 10 2021 - Münchens erste Bestattung allein im Tuch
München-Moosach * Am Westfriedhof wird in München erstmals ein Verstorbener allein im Tuch zur ewigen Ruhe gebettet. Damit das nach den Regeln des Ritus und der hygienischen Verordnungen klappt, übt das Münchner Friedhofspersonal seit Monaten den selbst konzipierten Ablauf mit einer 1,75 Meter großen und 80 Kilo schweren Puppe.
30. 11 2021 - Josephine Baker zieht ins Panthéon ein
<p><strong><em>Paris</em></strong> * Josephine Baker erhält als erste schwarze Frau einen Platz im Pariser Panthéon. Nach der Entscheidung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden die Gebeine der Afroamerikanerin in den Pariser Ruhmestempel überführt, wo die Großen der Nation ruhen.</p>
25. 3 2022 - Söder will über das Konzerthaus „nachdenken“
<p><strong><em>München-Berg-am-Laim</em></strong> * Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rückt vom geplanten Konzerthaus im Werksviertel ab. Er schätzt die Kosten für den Bau inzwischen auf mehr als eine Milliarde Euro. Nach seinen Aussagen geht es ihm <em>„um eine Pause zum Denken“</em>.</p> <p>Deutlich hört man aber heraus, dass er die Kosten für zu groß hält. Das auch angesichts der entstandenen Kosten und Einnahmeausfälle nach zwei Jahren Corona und der noch nicht bezifferbaren ökonomischen Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine.</p>
10. 8 2022 - Die „European Championships“ beginnen
<p><strong><em>München</em></strong> * München ist für zwölf Tage Schauplatz der <em>„European Championships“</em>. Etwa 4700 Sportlerinnen und Sportler kämpfen in neun Disziplinen um Europameistertitel. Es ist das größte Sportereignis in München seit Olympia 1972. </p>
28. 8 2022 - Klimaaktivisten kleben sich an Rubens-Gemälde
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Zwei Aktivisten der <em>„Letzten Generation“</em> kleben sich in der Alten Pinakothek an das Gemälde <em>„Der bethlehemitische Kindermord“</em> von Paul Rubens aus dem 17. Jahrhundert.</p>
17. 9 2022 - OB Dieter Reiter eröffnet die 187. Wiesn
<p><em><strong>München-Theresienwiese</strong></em> * Zwei Jahre nach der durch die Corona-Epidemie erzwungene Oktoberfest-Pause zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit drei Schlägen in der Schottenhamel-Festhalle das erste Wiesn-Fass an. Nach seinem Ruf <em>„Ozapft is! - Auf eine friedliche Wiesn!“</em> ist das weltweit größte Bierfest offiziell eröffnet. Es ist das 187. Oktoberfest.</p>
25. 10 2022 - Wissenschaftler besetzen den Finanzinvestor Blackrock
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Unter Federführung von <em>„Scientist Rebellion“</em>, einer Gruppe von Wissenschaftlern aus mehreren Ländern, beginnt eine Aktionswoche. Am Lenbachplatz demonstrieren rund zwei Dutzend Menschen vor den Büros des globalen Finanzinvestors Blackrock, 14 kleben sich im und am Gebäude fest. Sie werden vorläufig festgenommen und nach Feststellung ihrer Identität wieder freigelassen. </p>
26. 10 2022 - Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren die Brienner Straße
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Gegen Mittag blockieren Aktivisten der <em>„Letzten Generation“</em> die Brienner Straße am Odeonsplatz; die meisten haben sich mit einer Hand auf den Asphalt geklebt. Die Polizei nimmt 18 Personen mit und hält sie über Nacht fest.</p>
28. 10 2022 - Angeklebt vor dem Justizpalast
<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Kurz vor zwölf Uhr stoppen ein Dutzend Aktivisten den Verkehr vor dem Justizpalast, indem sie sich an der Ecke Karlsplatz und Prielmayerstraße auf die Straße stellen oder setzen. Der Jesuitenpriester Jörg Alt macht solidarisch mit. Er und ein weiterer Mann kleben sich fest. </p>
29. 10 2022 - Klima-Aktivisten kleben bei BMW
<p><strong><em>München-Milbertshofen</em></strong> * Gegen elf Uhr lösen Aktivisten in der BMW-Welt Alarm aus: 14 kleben mit einer Hand an einem Sportwagen, einer filmt die Aktion. Die Polizei nimmt alle fest und beantragt einen Gewahrsam, der nach richterlicher Prüfung auch angeordnet wird: Zwei Wissenschaftler bleiben bis 1. bzw. 2. November in Haft, die übrigen bis zum 4. November, also eine Woche.</p>
3. 11 2022 - Klimaaktivsten kleben am Stachus
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em> * </strong>Die <em>„Letzte Generation“</em> setzt die Klimaproteste in München fort. Um 10:30 Uhr setzen und kleben sich 17 Aktivisten am Stachus auf die Straße und blockieren den Verkehr in beide Richtungen. </p> <p>Gegen 18:45 Uhr kommt es an gleicher Stelle zu einer weiteren Blockade, diesmal sind 15 Personen beteiligt. Weil sie schon am Vormittag mitgemacht haben und weitere Verkehrsstörungen ankündigen, beantragt die Polizei beim Amtsgericht erneut Gewahrsam. Der wird bei zwölf Personen für 30 Tage bis zum 2. Dezember angeordnet, die längstmögliche Dauer nach dem novellierten Bayerischen Polizeiaufgabengesetz. Zwei Aktivisten müssen am 4. November freigelassen werden, einer am 9. November.</p> <p> </p>
7. 11 2022 - Klimaaktivisten blockieren den Stachus erneut
<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Der Stachus wird erneut blockiert, diesmal von fünf Personen; drei haben sich festgeklebt. Auch hier ordnet ein Richter den beantragten Gewahrsam an, in drei Fällen bis zum 14. November.</p>
18. 11 2022 - Inhaftierter Klimaaktivist im Hungerstreik
<p><strong><em>München-Giesing</em></strong> * Es wird bekannt, dass sich einer der bis zum 2. Dezember in Gewahrsam genommenen männlichen Klimaaktivisten in der JVA Stadelheim im Hungerstreik befindet. </p>
21. 11 2022 - Klimaaktivisten blockieren die Luitpoldbrücke
<p><strong><em>München-Bogenhausen</em></strong> * Die Luitpoldbrücke wird von Klimaaktivisten zweimal blockiert, zunächst um acht Uhr von neun Personen. Zwei behält die Polizei in Gewahrsam, eine bis zum 24. November, die andere bis zum 29. November. Sechs der Freigelassenen wiederholen die Aktion um 15 Uhr. Auch sie bleiben in Gewahrsam, drei bis zum 2. Dezember. </p>
16. 4 2024 - Bayern erschwert den Cannabis-Konsum
<p><strong><em>München - Bayern</em></strong> * Nach der Teil-Legalisierung von Cannabis durch den Bund beschließt die Bayerische Staatsregierung, den Konsum im Freistaat zu vervieten </p> <ul> <li>auf Volksfesten, </li> <li>in Biergärten und </li> <li>auf Außengeländen von Gaststätten und Schani-Gärten</li> </ul> <p>Zudem wird ein Konsumverbot festgelegt </p> <ul> <li>im Englischen Garten, </li> <li>im Hofgarten, </li> <li>im Finanzgarten in München sowie </li> <li>dem Hofgarten in Bayreuth</li> </ul> <p>Bei weiteren staatlichen Gartenanlagen soll ein Verbot über das Hausrecht verhängt werden.</p> <p>Saufen ja - kiffen nein !</p>
5. 9 2024 - Freddie Mercury erhält ein Mosaik an der Deutschen Eiche
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * An der Fassade des Hotels Deutsche Eiche in der Reichenbachstraße 13 wird ein Mosaik des Queen-Sängers und Songschreibers Freddie Mercury enthüllt. Mercury hatte zwischen 1979 und 1985 seinen Hauptwohnsitz in München. Hier konnte er in den <em>„Musicland Studios“</em> Alben aufnehmen und seine damals noch nicht öffentlich gemachte Homosexualität ausleben.</p>
31. 5 2025 - Rainer Werner Fassbinder erhält ein Mosaik
<p><strong><em>München-Isarvorstadt</em></strong> * Das Mosaik für Rainer Werner Fassbinder an der Fassade des Hotels Deutsche Eiche wird enthüllt. Der Regisseur und Filmemacher hätte an diesem Tag seinen 80. Geburtstag gefeiert. </p>
21. 11 2025 - „The Beatles Anthology“ Teil 4 kommt in die Plattenläden
<p><strong><em>Großbritannien</em></strong> * Die vierte Doppel-CD der Reihe <em>„The Beatles Anthology“</em> wird veröffentlicht.</p>
Pissoir
Erstellung: 1900Richard-Wagner-Straße
Erstellung: 0Ostbahnhofviertel
Erstellung: 1870xxx
Erstellung: 1901Flaucher-Anlagen
Erstellung: 1839Kath. Kirche Hl. Kreuz
Erstellung: 0Feldmüllersiedlung
Erstellung: 0Flachsiedlung Neuharlaching
Architekt: Lechner Theo, Norkauer Fritz, Dreisch Eugen, Scherer WilhelmErstellung: 1928
Wohn- und Geschäftshaus
Architekt: Exter August, Borst BernhardBaustil: barockisierend
Erstellung: 1893
Ehem. Benefiziatenhaus
Erstellung: 1796Ausbesserungswerk Neuaubing
Erstellung: 1902- Westliche Wagenreparaturwerkstatt (Bau 2), fünfschiffige Halle in Eisenfachwerkkonstruktion mit Blankziegelfassaden, segmentbogigen Zufahrtstoren und gekuppelten Rundbogenfenstern, 1902-06 erbaut.
- Holzbearbeitungswerkstätte (Bau 4), eingeschossiger Satteldachbau mit Blankziegelfassaden und Rundbogenfenstern in Dreiergruppe, 1902-06.
- Schlosserei (Bau 5), zweigeschossiger Satteldachbau mit Blankziegelfassaden und gekuppelten Rundbogenfenstern, 1902-06.
- Kesselhaus (Bau 7), eingeschossiger Satteldachbau mit Blankziegelfassaden und Rundbogenfenstern, westlich davon Schornstein, 1902-06; mit technischer Ausstattung.
- Verwaltung (Bau 10), zweigeschossiger Walmdachbau mit Dachreiteruhrentürmchen, Blankziegelfassaden mit Lisenengliederung und gekuppelten Rundbogenfenstern, 1902-06.
- Zufahrtstor im Nordosten, Gusssteinpfosten mit Eisentoren, und Teil der Einfassung in Blankziegel, 1902-06.
- Feuerwehrhaus, eingeschossiger Satteldachbau mit Blankziegelfassaden und segmentbogigen Toren, 1902-06.
- Südliche Weichenbauwerkstätte (Bau 11), eingeschossiger Satteldachbau mit gekuppelten Rundbogenfenstern, 1909, später verputzt.
- Reparaturwerkstätte von Postkraftfahrzeugen mit Verwaltung, später Nördliche Weichenbauwerkstätte (Bau 12), zweischiffige Halle mit Eisenfachwerkkonstruktion, verputzte Lisenengliederung, im Norden quergestellter Satteldachbau und im Süden Verwaltungsgebäude als dreigeschossiger Mansardwalmdachbau, 1912-14.
- Südliche Wagenreparaturwerkstatt (Bau 3), achtschiffige Halle in Eisenfachwerkkonstruktion, mit Blankziegelfassaden mit Toren und Fenstern mit geradem Sturz, 1921-26.
Flughafen München
Erstellung: 0Isarinsel Oberföhring
Erstellung: 0Südturm Alter Hof
Erstellung: 1589Maximilians-Waisenstift
Erstellung: 0Sabatinihaus
Erstellung: 0Bavaria mit Schild „Gerecht und Beharrlich
0.00 kmKaulbach Wilhelm von, Hiltensperger Johann Georg, Foltz Philipp
1829

| Straße | Name | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | Pettenkoferstraße | Strathmann Carl | |||
| 0.00 | Tizianstraße 16 | Atelier Rudolf Maison | |||
| 0.00 | Giselastraße | Halbe Max | |||
| 0.00 | Christophstraße | Schwarzenegger Arnold | 1966 | 1968 | |
| 0.00 | Scholl Sophie | ||||
| 0.00 | Arcisstraße 12 | Maffei Carl Friedrich von | |||
| 0.00 | Kaiserstraße | Hitler Adolf | 1900 | ||
| 0.00 | Elisabethstraße | Schaefler Fritz | 1918 | ||
| 0.00 | Kaufingerstraße | Westenrieder Lorenz von | |||
| 0.00 | Von-der-Tann-Straße | Siebold Philipp Franz von | |||
| 0.00 | Lerchenfeldstraße 5 | Thoma Ludwig | |||
| 0.00 | Pfitzner Hans | ||||
| 0.00 | Neuhauserstraße 35 | Keller Gottfried | |||
| 0.00 | Ludwigstraße 4 | Toller Ernst | |||
| 0.00 | Konradstraße 17 | Wolf-Ferrari Ermano | |||
| 0.00 | Pettenkoferstraße | Niemeyer Adelbert | |||
| 0.00 | Ungererstraße 2 | Lembke Robert | |||
| 0.00 | Bauerstraße | Levien Max | 1919 | ||
| 0.00 | Pettenkoferstraße | Salzmann Alexander von | |||
| 0.00 | Magdalenenstraße | Hackl Hans | |||
| 0.00 | xxx |