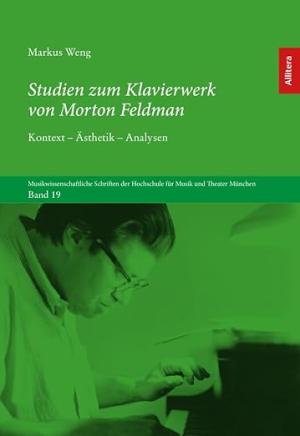Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Münchner Bücher
Studien zum Klavierwerk von Morton Feldman
Kontext – Ästhetik – Analysen
Weng Markus
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
- Aufbau und Konzeption der Arbeit
- Zum Stand der Forschung
- Quellenlage und Archivbestand
- Chronologisches Verzeichnis der Klavierwerke
TEIL I
FELDMANS KLAVIERSCHAFFEN ZWISCHEN 1950 UND 1964
- Entstehungskontext und erster Überblick
- Feldmans musikalische Entwicklung bis 1949
- Frühe Biografie und musikalische Ausbildung
- Exkurs: Feldmans Jugendwerke für Klavier
- Einflussbereiche und biografische Konstellationen um 1950
- Self-Permission: Die Begegnung mit John Cage
- Get Rid ofthe Glue: Die New York School of Music
- Feldman und die New Yorker Art Community
- Organized Sound: Edgard Varese
- Einordnung und Gliederung der frühen Klavierwerke
- Feldmans musikalische Entwicklung bis 1949
- Konventionelle Notation (1950-56)
- Ausgewählte Aspekte zur Ästhetik, Kompositionstechnik und Klangstruktur
- Non-Relationalität
- Zu Feldmans Vortragsentwurf »Structure and theStructural Cell«
- Soft as possible
- Makrostrukturen
- Korrelationen und Zahlenspiele
- Mikrostrukturen
- »Zeit-Leinwand« und »Strukturcollage«: Zwei früheFormmodelle
- Vorstellung und Erläuterung der Modelle
- Modell I: Intermission 1-4
- Modell II: Intermission 5 und Extensions 3
- Adaption und freie Anverwandlung der Modelle zwischen 1954 und 1956
- Klangliche Individualzeichnung und Mikroklanglichkeit in Piano Piece 1955, Piano Piece 1956 A und Piano Piece 1956 B.
- Exkurs: Einige besondere Notations- und Klangphänomene in Feldmans Klavierwerk
- Diskussion ausgewählter Beispiele aus Piano Piece 1955,1956 A und B
- Ausgewählte Aspekte zur Ästhetik, Kompositionstechnik und Klangstruktur
- Graph Pieces
- Die Graph Notation
- Entwicklung und Grundlagen
- Aspekte zur Formvorstellung und Berührungspunkte zur Bildenden Kunst
- Analysen und Einzelbeobachtungen zu den Klavierwerken
- Projection 3
- Intersection 2 und 3
- Intersection +
- Zur Rolle des Interpreten
- Der Interpret als »Co-Komponist«
- Die Grenzen der Freiheit
- David Tudors »Sub-Scores«.
- »Graph Music« versus »Graphic Music« - Die Graph Pieces im Kontext der New York School
- Die Graph Notation
- Individuelle Ansätze
- Piano Piece 1952
- Quellenlage und Entstehungskontext
- Piano Piece 1952 als Klangkette und Tonhöhenrelief.
- Dejä-vu-Momente und Bereiche vorübergehender Ordnung
- Nicht-kategoriales Hören und Aspekte der Zen-Rezeption der New York School
- Intermission 6
- All-Over-Design und Umsetzung der Spielanweisung
- Die Klangpalette von Intermission 6 (»References of Sounds«)
- Entstehung und Folgerungen aus der Frühfassung des Stückes
- Piano Piece 1952
- Klavierwerke der »Free-Durational«-Phase (1957-64)
- Erster Überblick und Grundlagen
- Erste Phase (1957-1962)
- Exkurs: Die Werke für mehrere Klaviere/Pianisten von 1957/ 58
- Last Pieces (1959)
- Zweite Phase
- Merkmale und Adaption des Free-Durational-Konzepts in den Klavierwerken von 1963
- Piano Piece (1964)
- Musik für Tanztheater und Film
- Übersicht zum Werkbereich
- Dance Music
- Allgemeine Aspekte
- Three Dances
- Variations
- Nature Pieces
- Ixion
- Filmmusik
TEIL II TRIADIC MEMORIES (1981)
- Theoretische Aspekte zu Feldmans Komponieren um 1981: Der Essay »Crippled Symmetry« (1981)
- What is symmetrical? - Symmetrie/Asymmetrie und »Crippled Symmetry«
- Why Patterns? - Zur Komposition mit Patterns
- Form als »Scale« und »Equilibrium«
- »Memory Forms« in der Musik
- Aspekte zur Entstehung, Werkgestalt und Kompositionstechnik
- Entstehungshintergrund und Titel
- Skizzen und kompositorischer Prozess
- Partiturbild und Notation
- Zur Bedeutung des originalen Notenbilds
- Taktordnung und Einpassung der Musik in das Taktraster
- Notational Image - Acoustic Reality
- Tempo und Dynami
- Patterns: Typologie, Design, Kompositionstechnik
- Zur Terminologie
- Wiederholung - Veränderung
- Permutation
- Chromatische Zellen
- Das »Gesso« des Pedals
- Detailanalyse
- Vorbemerkung und erste Übersicht
- Teil 1
- Sektion 1
- Sektion 2
- Sektion 3
- Sektion 4
- Sektion 5
- Zwischenteil 1
- Teil 2
- Pattern [A] - [H]
- Pattern [X] und [Y]
- Material aus Teil 1 und Zwischenteil 1
- Kürzere Muster/Freie Muster
- Zwischenteil 2
- Teil 3
- Sektion 1
- Sektion 2
- Sektion 3
- Sektion 4
- Sektion 5
- Sektion 6
- Resume und Ausblick
ANHANG
- Unveröffentlichte Quellen
- Musikalien
- Literatur
- Ton-und Filmquellen
Personenregister
Dank