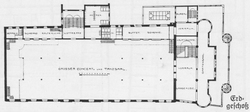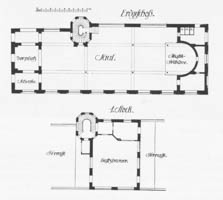Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Alte Bilder
Kindlbräukeller
| Titel | Kindlbräukeller |
|---|
| Ort | München |
|---|---|
| Stadtteil | Haidhausen |
| Straße | Rosenheimer Straße |
| Lat/Lng | 48.1309345 - 11.5901416 |
| Kategorie | Gebäude Brauerein Wirtshaus |
|---|---|
| Suchbegriff | Kindlbräukeller |
| Bildgröße | 0px - 0px |
|---|---|
| Alte Bilder | 1974-12-17 00:00:00 |
| Erstellt am | 2025-06-24 15:36:49 |
| Quelle | SIg. TUM, Nachlaß Thiersch |
|---|
Der Kindlbräukeller an der Rosenheimer Straße