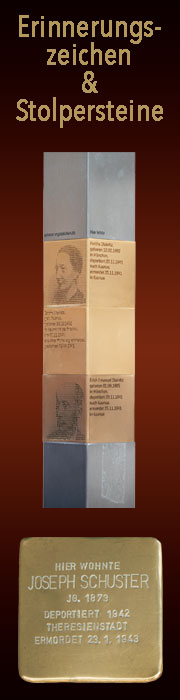Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Alte Bücher
München in guter alter Zeit
Drittes Kapitel - Im Graggenauer-Viertel.
Kuppelscheitel des sogenannten Tempels im Hofgarten schmückt. Auf dem Giebel des Lusthauses sah man eine Statue des Apollo und in den Nischen des mit mythologischen Wand- und Decken-Gemälden von Hans Bocksberger geschmückten Innenraumes mancherlei platisches Bildwerk.
Als Herzog Maximilian seine neue Residen zu bauen begann, ließ er den größten Theil dr Neuen Vester niederlegen, und was noch davon übrig blieb, das verwüsteten die Brände von 1674, 1729 und 1750.Dem Neubau mußte auch der schöne Ziergarten Albrechts V. weichen; an seine Stelle trat das neue kurfürstliche Zeughaus, nachdem das alte beim Frauenfreithof hinter den Theatinern 1599 abgebrannt war. Das neue Zeughaus bestand aus fünf Gebäuden um ein großes Viereck.Hier war es, wo die Schweden die vergrabenen und zum Theil mit Goldmünzen gefüllte Kanonen entdeckten. Daneben stand zu Anfang unseres Jahrhunderts die kurfürstliche Artillerieakademie und weiterhin die Artilleriekaserne mit Offizierswohnungen.
Doch kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zur Residenz zurück.
Herzog Maximilian lebte bis zu seines Vaters Ableben 1597 mit diesem in der nach ihm genannten Burg, wo es ihm nicht sonderlich behagt haben mag. Die neue Veste lag seit dem Brande von 1580 noch theilweise in Trümmern und Maximilian hatte keine Lust zu ihren Wiederaufbau. So begann er denn 1598 den Neubau zwischen dem Kapellenhof und em heutigen Königsbau, die Residenzstraße entlang, wobei der sogenannte Grottenhof den Mittelbau des ganzen Baues bildete. Baumeister war der Münchner Hans Reifenstuel. Nach Vollendung dieses Tracktes ließ Maximilian 1612 den nördlichen um den Kaiserhof in Angriff nehmen und zwar durch einen anderen Münchner: Heinrich Schön, wobei die dortigen Thürme, Mauern und Wälle der Neuen Veste niedergelegt wurden. Der Bau dieses Flügels dauerte über sechs Jahre.
Die neue Residenz Maximilians mit ihren vier weiten Höfen, zwanzig Sälen, sechzehn Galerien, vier Kapellen, sechzehn Küchen, zwölf Kellern, acht Thürnitzen und zweitausendsechzig Zimmern wurde als achtes Weltwunder gepriesen und Gustav Adolf von Schweden wünschte sie auf Walzen nach Stockholm schaffen zu können.
Der hatte sich bei seiner ersten Anwesentheit in München vom 17. bis 27. Mai 1632 in der kurfürstlichen Residenz einquartiert und weil diese nicht selber mitnehmen konnte, so nahm er aus ihr, aus der Bibliothek und der Kunstkammer wenigsten eine Menge werthvoller Sachen fort, und die Prinzen Bernhard und Wilhelm von Sachsen und der vormalige Böhmenkönig Friedrich von der Pfalz machten es nicht besser.
Der italienische Geschmack erhielt sich auch unter Maximilians I. Nachfolger, dem mit der savoyschen Prinzessin Adelheid vermählten Kurfürsten Ferdinad Maria, innerhalb der Residenz freilich nur in Bezug auf die Herstellung der sogenannten italienschen Zimmer (1651—1652), später die Kaiserzimmer genannt, weil Kaiserin Amalie als Witwe sie bewohnte, während unter seinen nächsten Nachfolgern das Rococo die Alleinherrschaft inne hatte, die sich namentlich in den von Karl Albrecht, als Kaiser Karl VII., mit staunenswerter Pracht eingerichteten sogenannten reichen Zimmern ausspricht. Sie entstanden durch die Wiederherstellung des 1729 ausgebrannten östlichen Theils der Residenz und ziehen sich in den westlichen herüber. Von ihnen schreibt Bianconi 1771: „das bei dem Anblick dieser Zimmer die schönsten Paläste der Feen, welche der Thor Anselmo im Ariost um einen so verzweifelten Preis gewinnen wollte, Keinem weiter fabelhaft vorkommen könnten. Die kostbaren Tapeten, vergoldete Bronzen, marmorne Bildsäulen, altes und neues Porzellan, Spiegel, Schilderein, Stickwerk, Gold, Silber, Alles sei derselbst auf's reichste vertheilt und zwar mit so großem Geschmack, daß ein menschliches Auge nichts weiter mehr zu wünschen wisse.“in diesen Zimmern übernachtete später Napoleon I.
Den Brand der Neuen Veste vom Jahre1580 mit eingerechnet, wurde die Residenz viermal von schweren Feuersbrünsten heimgesucht.
In der Nacht vom 9. auf 10. April 1674 schlief die erste Kammerfrau der Kurfürstin Adelheid, Fräulein de la Perouse, über dem Lesen im Bett ein, die Kerze entzündete ihr Bett, sie selbst rette sich nur mit Noth, während das Feuer einen großen Theil der Residenz, namentlich