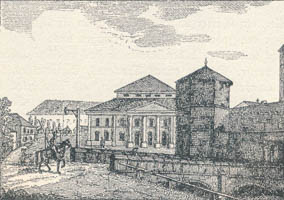Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Alte Bilder
Sterneckerbräu - Gründungszimmer der NSDAP
Auf dem Schild ist zu lesen. An diesem Tisch gründete der Reichsdeutsche Adolf Hitler die NSDAP
| Titel | Sterneckerbräu - Gründungszimmer der NSDAP |
|---|
| Ort | München |
|---|---|
| Straße | Tal |
| Lat/Lng | 48.1355842 - 11.580522 |
| Kategorie | Nationalsozialismus Drittes Reich |
|---|---|
| Suchbegriff | Sterneckerbräu NSDAP |
| Personen | Hitler Adolf |
| Bildart | Foto sw |
|---|---|
| Bildgröße | 0px - 0px |
| Alte Bilder | 1976-04-10 00:00:00 |
| Erstellt am | 2025-06-24 15:36:49 |
| Quelle | Stadtarchiv München |
|---|
Auf dem Schild ist zu lesen. An diesem Tisch gründete der Reichsdeutsche Adolf Hitler die NSDAP