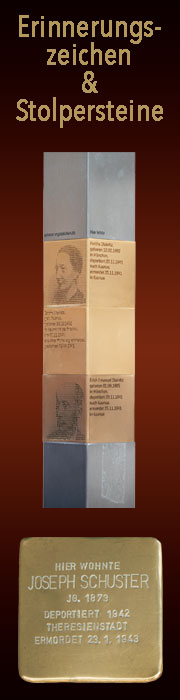Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Münchner Architektur
Ehem. Hofmarstall und Kunstkammer
| Name | Ehem. Hofmarstall und Kunstkammer |
| Bauherr | Albrecht V. Herzog von Bayern |
| Architekt | Egckl Wilhelm |
|---|---|
| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |
| Stadtbezirksteil | Graggenau |
| Straße | Hofgraben 4 |
| Jahr Baubeginn | 1563 |
| Jahr Fertigstellung | 1563 |
| Baustil | Renaissance |
| Kategorie | Keine Kategorie |
| Baustil |
Renaissance Renaissance |
| Suchbegriffe | Alte Münze Hofmarstall Kunstkammer |
| Mittelalter | |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Alte Münze, CC BY-NC 4.0
Beschreibung
sog. Alte Münze, jetzt Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Vierflügelbau mit dreigeschossigem Arkadenhof, errichtet unter der Bauleitung von Wilhelm Egckl 1563-67, Umbau zur Münze durch Andreas Gärtner (mit Franz Thurn) 1807-09, klassizistische Fassadengestaltung von 1807-09, nach schweren Kriegsschäden Wiederaufbau 1950-52; siehe auch die zugehörigen Häuser Pfisterstraße 3 und 5 sowie den nördlichen Erweiterungsbau der Münze Maximilianstraße 6/8.
Quellen
Münzgebäude, Kgl.
Zauner - München in Kunst und Geschichte (1915)Münzgebäude, Kgl., Maximiliansstraße-Hofgraben. Unter Herzog Albrecht V. 1563—67 durch seinen Hofbaumeister Wilhelm Egkl (auch Egckhl oder Oegkhl geschrieben) als herzogliches Marstallge- bäude mit einem Turnierhof (Buhudirhof) errichtet. Damals begann die Zeit, wo man statt der Reittiere die Beförderung in großen Kutschen vorzog, so daß der alte kleine Marstall im Alten Hof nicht mehr genügte.
Zwischen den beiden Residenzen gelegen, der noch immer von Hofleuten bewohnten Alten Veste (Alter Hof) und der von Albrecht Y. errichteten Neuen Veste (jetzige Residenz) gelegen, war der Marstall mit jeder über die Straßen weg durch einen gedeckten Gang verbunden; das Erdgeschoß war für Pferde und Wagen, das 1. und 2. Obergeschoß für Wohnungen der Hofbeamten bestimmt; später wurde auch die „Kunstkammer“ Albrechts V. darin untergebracht. 1809 wurden das Münz- gebäude eingebaut (daher über dem Eingang an der Hofgrabenseite die Aufschrift „Moneta regia“) und zwar nach dem Entwurf des im derben strengklassizistischen Stil Weinbrenners tätigen alten Andreas Gärtner, Vater des bekannten Friedrich Gärtner.
Um 1860 baute Bürklein an der Maximiliansstraße einen Neubau an, der mit dem „Cafe Maximilian“ in seinem östlichen Teil eine symmetrische Baugruppe bildet, die durch einen spitzbogigen Arkadengang (vgl. das Maximilianeum) verbunden ist und auf den Arkaden Statuen trägt, die Allegorien auf die im Zusammenhang mit der kgl. Münze stehende Wissenschaft und Technik darstellen. Ganz besonderes kunstgeschichtliches Interesse bietet der Innenhof des Gebäudes, jetzt Münzhof, früher Turnierhof genannt, und zwar als der uns bekannte früheste und einzig erhaltene Profanbau Münchens aus der beginnenden Periode der einheimischen Renaissance. Es ist ein Hof mit umlaufenden Tribünen oder vielmehr Bogengängen, in denen Gäste als Zuschauer sitzen konnten. Sonst das eigentliche Zentrum einer Schloßanlage, konnte er hier nur wegen der Ungunst des Terrains nicht in der sonstigen geräumigen behaglichen Breite ausgebaut werden. Charakteristisch für diese echt deutsche Renaissancearehitektur des fortgeschrittenen 16. Jahrh. ist jene wechselnde Behandlung der Trägerformen (Säulen), wie es die Italiener nicht gekannt haben: jenes ungebundene Hantieren mit den Architekturgliedern — nicht nach festen Regeln sondern so, daß die Glieder bald kurz, bald lang, bald dick, bald dünn werden können, kurz -— es ist ein ungeheuer großer Reichtum, den die nordische Phantasie postuliert hat. So fehlen hier alle italienischen Säulenproportionen und Bogenproportionen: ganz kurze, stämmige Säulenstümpfe unten, noch kürzere in der Mitte, erst im 3. Stock eine Erleichterung, ohne daß jedoch der volle Halbkreisbogen riskiert worden wäre — auch da noch hält die deutsche Phantasie am Flachen fest: es wäre ihr phrasenhaft vorgekommen, an dieser Stelle den wohlbekannten italienischen Bogentenor zu wiederholen [ Wölffiin],
Der rechteckige Hof wird in 3 Geschossen von Säulengängen umzogen, die an der Langseite 8, an der Schmalseite 3 Arkadenbögen zeigen; im Erdgeschoß tragen die Säulen jonische Kapitelle mit kanneliertem Hals, auf denen weitgespannte Rusticabögen aufsetzen; die schweren, gedrungenen Säulenschäfte im 2. Geschoß tragen korinthisierende Kapitelle, und die Säulen im 3. Geschoß sind toskanisch gebildet. Die Bailustrade im 2. Geschoß ist fest gemauert, jene des 3. besteht aus zaunartig angeordneten viereckigen Pfeilern. Die Gänge sind durchweg mit spitzbogigem Kreuzgewölbe gedeckt. Das Material bilden Qua
Das k. Münzgebäude
Nagler - Acht Tage in München (1863)Das k. Münzgebäude, am Hofgraben Nr. 4, war zum herzoglichen Marstall bestimmt, und es wurden in dem prächtigen, mit Säulengängen gezierten Hof auch Turniere gehalten. Im Jahre 1809 erhielt es nach dem Plane des Hof- Bauintendanten Andr. Gärtner die gegenwärtige Fayade, und gleichzeitig wur- de die sehenswerthe Präganstalt dahin verlegt. Das frühere Münzgebäude ist die Ruine Nr. 7 am Münzgäßchen, in welchem alljährlich Anfangs Mai der Bock ausgeschenkt wird. Das gegenwärtige Münzgebäude erhielt 1860 nach Bürklein's Plan einen Flügelbau an der Maximiliansstraße, welcher mit Arkaden versehen einen lichten Hof bildet, und zugleich eine Zierde der Straße ist. Die Statuen auf der Balustrade des Ganges, welche beide Gebäude an der Nordseite verbindet, wurden 1863 aufgesetzt.