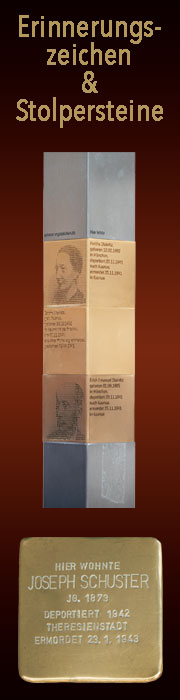Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Münchner Architektur
Heilig-Geist-Kirche
| Name | Heilig-Geist-Kirche |
| Architekt | Löwel Friedrich Ettenhofer Johann Georg |
|---|---|
| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |
| Stadtbezirksteil | Angerviertel |
| Straße | Prälat-Miller-Weg 1 |
| Jahr Baubeginn | 1350 |
| Jahr Fertigstellung | 1350 |
| Baustil | Gotik |
| Sakral | katholisch |
| Kategorie |
Religiöse Bauwerke Kirche |
| Baustil |
Gotik Gotik |
| Unterkategorie | Kirche |
| Suchbegriffe | Hl. Geist Spitalkirche Heilig-Geist-Kirche |
| Mittelalter | |
Beschreibung
Kath. Pfarrkirche Hl. Geist (ehem. Spitalkirche), Wandpfeilerkirche mit polygonalem Chorschluss, Chorscheitelturm und repräsentativ gestalteter Westfassade, im Kern gotische Staffelhalle des 14. Jhs., barocke Umgestaltung durch Johann Georg Ettenhofer, 1724-30, Erweiterung nach Westen in neubarocken Formen, von Friedrich Löwel, 1885-88, etappenweiser Wiederaufbau nach schwerer Kriegsbeschädigung, 1946-1991; mit Ausstattung.
Quellen
Hl. Geist-Kirche
Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Hl. Geist-Kirche im Tal 77.
Geschichte. Alsbald nach der Gründung des „Ordens vom Hl. Geist“ und Erbauung des ersten Hl. Geist-Spitales (in Rom) um 1210 wurde wie in vielen andern Städten so auch in München ein Hl. Geist-Spital errichtet, und zwar noch vor 1250. Die Brüder ließen sich bei der ehemaligen kleinen Katharinen-Kirche am jetzigen Viktualienmarkt (vgl. Hl. Geist-Spital) nieder; 1253 legte Herzog Ludwig der Kelheimer den Grundstein zur neuen großen „Hl. Geist-Kirche“, die 1271 zugleich mit der Frauenkirche zur (3.) Pfarrkirche (neben der Peterskirche) erhoben wurde. Ihre Baugeschichte ist nicht ganz aufgeklärt, und es bestehen Zweifel, ob das Mauerwerk der jetzigen Rokoko- kirche noch dem 14. und nicht erst — was wahrscheinlicher ist, da der Chorschluß das entwickelte Hallensystem der Spätgotik zeigt — dem beginnenden 15. Jahrh. angehört; wäre ihre Entstehung gleich nach dem großen Stadtbrand 1327 gesichert, so würde sie die älteste Hallenkirche Deutschlands sein. 1724 wurden die Seitenschiffe erhöht, die Gewölbe und der Dachstuhl vollkommen erneuert und ein neuer Turm erbaut; die Dekoration wurde damals von den beiden As am (es war ihr erstes Werk in München) unter Mitwirkung des Stuckators Mathias Schmidt- gartners und der Maler Nikolaus Stüber und Peter Horemanns ausgeführt. 1885 w'urde die Kirche, nachdem das Spital abgebrochen war, um 3 Joche verlängert und mit einer stattlichen Fassade versehen. Letzte durchgreifende Renovation 1908/09.
Kunst. Grundriß und Aufbau der vormaligen gotischen Hallenkirche noch deutlich erkennbar. Durch 16 Pfeiler —w’ovon die 2 letzten, etwas enger gestellt, die Herumführung der Seitenschiffe um den Chor in gleicher Weise wie an der Frauenkirche ermöglichen — in 3 Schiffe geteilt, zeigt die Kirche auch die einwärts gezogenen Streben wie die Frauenkirche, wenn sie auch nicht der Stärke von jenen bedurften; das Netzwerk der Gewölbegurten ist indes wie alle andern gotischen Formen im 17. und 18. Jahrh. unter den Stukkaturen völlig verschwunden; das Mittelschiff hat ursprünglich eine geringe basilikale Ueberhöhung, wie etwa U. L. Frau in Ingolstadt, gehabt, bis 1725 auch für die Seitenschiffe der Scheitelpunkt der Gewölbe höhergeführt wurde; an Stelle des 1730 an den Chor angefügten Turmes trug vorher nur ein Dachreiter über dem Orgelchor die einzige Glocke. „Als gotische Hallenkirche mit Umgang im Chor übertrifft sie in der Anlage sogar die Frauenkirche als Raumschöpfung bei weitem: man prüfe einmal vom Chor aus hier und dort (Frauenkirche) die Möglichkeit des Durchblicks! Aber sehr geschickte Künstler des 18. Jahrh. haben (beim Umbau) die Raumwirkung zweifellos noch verstärkt: erstaunlich ist ihnen die Umwandlung der Pfeiler gelungen; durch starke Gesimse und leichte Kompositkapitelle haben sie dem alten Gefüge alle Schwerfälligkeit benommen; überdies wurde aus dem Netzgewölbe ein Spiegelgewölbe, und hier malte Asam mit gewohnter Schnelligkeit und Geschicklichkeit seine kirchlichen Welten voll Zauber und theatralischem Effekt; andere Künstler und andere Künste unterstützten ihn dabei vortrefflich: vor allen Dingen der Gebrüder Asam rassige Stuckornamente machten aus dem ohnehin frohgedachten Raum eine „moderne“ Kirche für ihre Zeitgenossen [Br 54].“
Aufbau: Dreischiffig mit 9 Jochen, davon die 3 westlichen neu: Chorabschluß im Mittelschiff in 5 Achteckseiten, im Chorumgang neunseitig; Pfeiler des Mittelschiffs sowie die Strebepfeiler mit Kompositapilastern besetzt; über den Kapitellen Gesimse; im Mittelschiff Tonnengewölbe mit Stichkappen, in den Seitenschiffen Kreuzgewölbe; in den Wandflächen zwischen den Pfeilern und in den Schildmauern der Gewölbebögen Fenster. Am Plafond und an den Wänden sehr geschickte Arrangements von flotten Stuckornamenten (0. T). Asam) in Bänderschlingwerk, Festons, Ranken und Mascarrons in üppiger Fülle; über den Fenstern Kartuschenformationen.
Fassade 1885 von Loewel nach den Formen der alten Fassade von Asam ; Madonna von Anton Heß-, Marmorportal von Lallinger-, Kirchentor von Badspieler.
Deckenfresken im Mittelschiff, davon die ersten 4 von G. T). Asam 1725 und die letzten 2 von Ludw. Gloetzle 1888:
1. Ueber dem Hochaltar die theologisch tief durchdachte Komposition vom „hl. Geist als dem Spender der 7 Gaben“: in der Mitte die „Hl. Geisttaube“; um sie 7 Vertreter der Engelschöre, die einzelnen Gaben symbolisierend („Weisheit“ = ein leichter weißer Seraph; „Verstand“ = ein Cherub, aus dem Quell der Weisheit selbst schöpfend und andern die Fluten der Erkenntnis zufließen lassend; „Rat“ = einer der Throne, die sitzen und ruhen, weil in ihnen Gott der Herr Sabaot ruht; „Wissenschaft“ — einer vom Chor der Herrschaften, in einem Buche die Weltkugel haltend; „Stärke“ = einer der Fürstentümer, eine mächtige Säule umfassend; „Frömmigkeit“ = einer der Mächte, mit einer brennenden Lampe; „Gottesfurcht“ = einer der Kräfte, eine Geißel schwingend, während aus einem Gewölke Blitze fahren;.
2. Die 2 untersten der 9 Engelchöre, die Erzengel und Engel, in heiliger Andacht harrend der Aufträge des Herrn. 3. Das große Mittelbild mit der Gründung des hl. Geistspitals“, eine gewaltige Komposition: im Mittelpunkt Herzog Otto der Erlauchte, in der Linken die Standarte mit der Darstellung der hl. Dreifaltigkeit, in der Rechten den herzoglichen Stiftungsbrief des Spitals; um ihn reiche Bürger der Stadt, spendend und Spenden sammelnd; unter diesen eine Gruppe von Armen, Kranken und Sterbenden, denen Ordensbrüder und Aerzte beistehen; unten in der Ecke der Schimmel des sogen. ,.Bretzelreiters ein scherzhafter Hinweis auf die „Wadlerspende“ 1).
Ueber der Hauptgruppe schwebt, als Beweggrund und Lohn der christlichen Caritas, Maria als „Mutter der Barmherzigkeit“ und „Braut des hl. Geistes“ mit dem Lilienzepter in der Linken und den Brautring in derBechten; über ihr, Gnadenstrahlen aussendend, der hl. Geist. 4. Bild (vor dem Vergrößerungsanbau, noch über der Orgelempore, befindlich) mit der bezüglichen Darstellung des Königs David mit der Harfe und dem Schriftwort: „In conspectu angelorum psallam tibi“. 5. Bild (von Gloetzle) symbolisierend die Wiederherstellung der christlichen Weltordnung nach den Grundsätzen der Bulle Leos X1JI. „Immortale Dei“ durch Gebet (Maria als „Königin des Bosenkranzes“ von LeoXIII. in dieLauret. Litanei eingefügt), durch Wissenschaft (St. Thomas von Aquin, der Philosoph und St. Augustin mit seiner Lehre „De civitate Dei“) und durch Askese (St. Franziskus von Assisi und der III. Orden); unten am Stein, der Grundlage des Ganzen, das Schriftwort: „Et in terra Pax“. 6. Bild über der Orgel: St. Cacilia, eine herrliche Darstellung himmlischer Harmonien.
Deckenfresken in den Seitenschiffen mit der Darstellung der „Leiblichen Werke der Barmherzigkeit“ durch 11 hl. Männer auf der Evangelienseite und 11 hl. Frauen auf der Epistelseite (die 3 letzten Figuren beiderseits von Gloetzle) von Hofmaler Nikolaus Stüber 1725. Evangelienseite:
1. Franz Begis; 2. Johannes v. Gott (Stifter des Ordens der „Barmherzigen Brüder“); 3. Paulinus v. Nola; 4. Iwo Felori, der Juristen-Patron, führte Prozesse der Armen vor Gericht; 5. Johannes von Alexandrien, der „Almosengeber“; 6. Martinus; 7. Laurentius; 8. der „Barmherzige Samariter“; 9. Otto, Bischof von Bamberg, dargestellt, wie er einen großen Fisch auf seiner Tafel den Armen zuweist; 10. Vinzenz v. Paul;
II. Sebastian, der noch vor dem Tod sein Vermögen den Armen gab. Epistelseite: 1. Notburga; 2. Die „Witwe von Sarepta“; 3. Franziska Bomana; 4. Hyacintha Mariscotti, gest. 1640, Wohltäterin der römischen Spitäler; 5. Tabitha; „haec erat plena operibus bonis et eleemosynis“ A. Ap. 9, 36; 6. Hildegardis, Gemahlin Karls des Großen; 7. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen; 8. Paulina; 9. Monika; 10. Magdalena; 11. Odilia (die 3 letzten gewählt mit Bücksicht auf die 3 Bruderschaften: Frauengebetsverein, Magdalena- und Odiliabruderschaft).
Gemälde an den Seitenwänden (vom Münchner Hofmaler Peter Horemann, einem niederländischen Konversationsmaler), Oelgemälde auf Leinwand in die Mauer eingelassen, enthaltend Allegorien auf die „7 Gaben des hl. Geistes“ im Geschmack der Schäferidyllen seiner Zeit, mit den bezüglichen Schriftworten:
- „Weisheit“, Pyramide mit dem Sonnenbild; der brennende Dornbusch; Sprw. 14, 16;
- „Verstand“, Salomon vor seinem Thron; II K. 17, 19;
- „Rat“, Januskopf; der ägyptische Joseph; Sprw. 21.30;
- „Stärke“, David zerreißt den Löwen; starke Festung; Marterwerkzeuge; Hohe]. 8, 6;
- „Wissenschaft“, Baum der Erkenntnis; „ein Weiser entfernt sich vom verbotenen Baum; ein starker Bewaffneter bewacht sein Haus“; Col. 1, 10;
- „Frömmigkeit“, Tobias die Toten begrabend; Flamme der Andacht; I Tim. 4,7;
- „Gottesfurcht“, David verläßt sein Lager, um Gott Lob zu singen; Mal. 1,6.
Hinter dem Hochaltar Generalgemälde zu dem Zyklus von den 22 Heiligen der Barmherzigkeit: Jesus lehrt die Jünger, den Armen das Evangelium zu predigen; an der Turmwand sehr schöne, große „Kreuzigung“, vielleicht von Hauler. Ueber der Sakristei „Krönung der hl. Elisabeth, Patronin der Spitäler, Oel- gemälde von Franz Zimmermann-, rechts „Die Sünden wider den hl. Geist“, Oelgemälde von Hortmann. An der Büekwand beim Hauptportal: 2 Allegorien: „die 3 Göttlichen Tugenden“ und „die Kardinaltugenden“ Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Starkmut, sowie Friede, Freude, Langmut und Barmherzigkeit.
Hochaltar: Unterbau und Säulen aus Tegern- seer Marmor, von Antonio Matteo-, hoher Kokoko-Altaraufsatz in reicher vergoldeter Holzschnitzerei von Greif „Die hl. Dreifaltigkeit“; Altarbild „Sendung des hl. Geistes“ von Ulrich Loth; daneben an den Säulen die überlebensgroßen Holzfiguren „St. Gabriel“ und „Raffael“ von Greif. Hinterm Hochaltar der Sakramen tsaltar mit geschnitztem vergoldetem Rokokotabernakel, Antipendium und einem (früher in der alten Kapuzinerkirche befindlichen) Altarbild „Das Abendmahl“ von Hofmaler Christian Wink.
Seitenaltäre; sämtliche im Chorumgang, von links beginnend:
- Dreifaltigkeitsaltar mit Marmorsäulen und dem großen Holzschnitzwerk „Krönung Mariens durch die Dreifaltigkeit“, Ende 17. Jahrh. (aus der abgebrochenen Dreifaltigkeitskirche); Mensa aus der Augustinerkirche.
- Antoniusaltar mit gutem Altarbild „St. Antonius“ von Hofmaler Hesmarees um 1770.
- Anna-Altar von gleichem Aufbau und auch von Marmor wie der Hochaltar; Altarbild „Joachim und Anna", in einer Vision die UnbeflekteEmpfängnis schauend; eine treffliche Komposition von Hofmaler Albrecht c. 1760; darunter ein Oelgemälde in Rokokorahmen „St, Florian“.
- Vierzehn-Nothelferaltar mit dem vielverehrten Gnadenbild „Ecce hemo“, einer lebensgroßen Holzfigur von A. Faistenberger um 1730; Altarbild „die 14 Nothelfer“ von Schoenfeld um 1650; im Aufsatz das Bild des Bürgermeisters Harth von Hartmating 1751.
- Unbefleckte Empfängnisaltar; Altarbild „die Immaculata“ von Andreas Wolf um 1710; darunter „St. Aloysius“ von J. Hauler in versilbertem Ovalrahmen.
- Bäcker-Altar, gestiftet von der uralten „Hökhenknecht-Hruderschafi“; hinter der Predella in einem Glasschrank der Leib des hl. Lucidus. Tafelgemälde der „Muttergottes in der Engelsglorie (aus der alten Franziskanerkirche) von Rotthammer um 1560.
An der Nordseite ein Nischenaufbau mit der Lourdes-Madonna, darunter eine Armenseelengruppe gestiftet von Pfarrer Huhn um 1888.
Am Pfeiler bei der Kanzel die vielverehrte sog. „Hämmerthaler-Muttergottes“. anmutiges Schnitzwerk um 1450 (aus der Tegernseer Klosterkirche, bis zur Säkularisation 1802 in der Augustinerkirche): Maria stehend auf dem Halbmond; das Kind auf ihrem Arm hebt den Schleier von seinem Köpfchen empor.
Kreuzweg-Stationen in sehr zierlich geschnitzten Rokoko-Rahmen. Sehr zierliche Kanzel (im Schalldeckel Gemälde „der Hl. Geist“; auf der Bekrönung geschnitzte Engelsfiguren), Beichtstühle und Portale von Simon Lintner 1731; Kommunionbank von J. Poschenröder aus Tegernsee. Kanzelstiege und Abschlußgitter hervorragende Schmiedearbeiten des Ferd. Dürr 1734. Unter der Orgeltribüne aus der ehemaligen Wartenberg-Kapelle das technisch vorzügliche Erzdenkmal (von Hubert Gerhard?) des Herzog Ferdinand von Bayern, der (laut Inschrift der Bronzetafeln) durch seine Heirat mit der Rentamtsmannstochter Maria Pettenbeck 1588 der Gründer der gräfl. Wartenbergischen Familie wurde. Er hält (mit Bezug auf die Einnahme der Feste Godesberg) den Kommando-Stab; im Hintergrund kunstvolle Ornamente. Grabstein der Birgitte Manhartin 1576 in Rotmarmor, oben die „Vision der hl. Birgitta“ (sehr bemerkenswerte Arbeit), unten die Inschrift in gutem Kartuschenrahmen. In Chor 2 neue Glasgemälde „Englischer Gruß“ und „Auferstehung“ nach Entwürfen von M. Feuerstein und Eugen Drollinger. In der Sakristei: Prachttabernakel für Festzeiten; Monstranz, hervorragende Münchner Arbeit 1714, von einem in Silber getriebenem Engel gehalten, Lunula reich mit Edelsteinen besetzt und mit 7 Emails (7 Gaben des hl. Geistes) umgeben; versilberter Weihwasserkessel (aus Ramersdorf) mit getriebenen Medaillons (Ansicht der Wallfahrtskirche und der Stadt München vom Gasteig aus); Messornat der Gräfin Rivera-Prey sing 17. Jahrh. TCK05, 3; D; Gerhauser M. „Die hl. Geist-Kirche 1909;‘KB, Eb, W].
*) Der Bürger Burkhard Wadler von München machte 1318 eine Stiftung für das Hl. Geistspital, woraus dessen Insassen an jedem Montag eine Mahlzeit und überdies am Johannestag nach Weihnachten <27. Dez.) eine außerordentliche Bretzenspende, und zwar „2 Stück für jeden armen Menschen der Stadt“ gewährt wurde; am Johannestag nun (später geschah dies am 1. Mai) ritt nachts 12 Uhr vom Hl. Geisthof ein Mann auf einem Schimmel, dem 3 Hufeisen gelockert waren (damit es mehr klapperte) auf die Hauptwache mit seinem Sack voll Bretzen; von dort aus ritt er durch die ganze Stadt, Bretzen austeilend jedem, der wollte, und rufend: „Ihr alt und jungen Leut, Geht zum Hl. Geist, Wo man die Wadler-Bretzen geit!“ Hierauf ritt er zum Spital zurück, wo man jedem, arm oder reich, beim Hl. Geistbäcker bis 12 Uhr mittags umsonst Bretzen austeilte — zur Lust und Freude der alten und jungen Münchner. Als ihm 1801 die Bretzen vorzeitig ausgegangen warenund er vom erzürnten Volk vomPferd gerissen und durchgeprügelt wurde, ist darauf hin die ganze Spende aufgehoben worden.
Hl. Geist-Pfarrkirche
Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die h. Geist-Pfarrkirche im Thal wurde in ihrer Geschichte schon in der einleitenden Baugeschichte besprochen. Der gegenwärtige Bau stammt wohl nur mehr in der allgemeinsten Anlage von der Erweiterung zwischen 1253—1268, in der Hauptsache jedoch von dem Wiederaufbau nach dem Brande von 1327. Man kann sich von dem Charakter der vormals gothischen Hallenkirche noch ein deutliches Bild machen. Durch 16 Pfeiler, wovon die zwei letzten etwas enge gestellt die Herumführung der Nebenschilfe um den Chor in gleicher Weise wie an der Frauenkirche ermöglichen, in drei Schiffe getheilt, zeigt sie auch die einwärts gezogenen Streben wie die Metropolitankirche, wenn sie auch nicht die Stärke jener bedurfte. Das Netzwerk der Gewölbgurten ist indess wie alle und jede gothische Form an Pfeilern, Fenstern, Wänden u.s. w. von der Mitte des 17. Jahrhunderts an, aus welcher der Hochaltar stammt, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu Gunsten reicher Stuccatur- und Gemäldezier so gründlich verschwunden, dass selbst in der restaurationseifrigsten Zeit Niemand daran dachte, die Kirche des barocken Gewandes wieder zu entkleiden. Doch fehlen auch hier die farbigen Fenster nicht, durch welche moderner Eifer die meisten Münchener Kirchen, deren Charakter durch barocke Stuccatur bedingt ist, entstellt Hat. Am jüngsten vom ganzen Bau ist der nüchterne Thurm, welcher um 1730 an den Chor angefügt wurde, während vorher nur ein Dachreiter über dem Orgelchor die nöthigon Glocken trug.
Das Bemerkenswertheste der inneren Ausstattung ist das von Hans Kruumper herrührende Bronzedenkmal des Herzogs Ferdinand von Bayern, des Gründers der gräflich Wartenberg’schcn Linie durch seine Ehe mit der Rentamtmannstochter Maria Pettenbeck, aus dem Bildniss des Herzogs in ganzer Figur (Hochrelief und zwei reich umrahmten auf den Herzog und dessen Gemahlin bezügliche Inschrifttafeln bestehend. Sie befanden sich ursprünglich in der Sebastianskirche, der jetzt verschwundenen Haus- und Begräbnisskapelle des gräflich Wartenberg'schen Hauses zwischen Rindermarkt und Rosenthal, nach deren Secularisation sie hier an die Schlusswand unter dem Orgelchor versetzt wurden Die beiden mittelalterlichen Madonnen im Chorumgang zur Rechten wie zur Linken des Hochaltars haben durch Zuthaten und Fassung wenn nicht ihren Werth so doch ihren Charakter fast gänzlich eingebüsst. Von dem einst sehr weitläufigen Spitalgebäude (vergl. die einleitende Baugeschichte S. 18) ist ausser der sehenswerthen gothischen Halle der nunmehrigen „grossen Fleischbank“ nichts mehr erhalten.
Die hl. Geistkirche
Nagler - Acht Tage in München (1863)Die hl. Geistkirche und das ehemalige Spital, im Thale Nr. 77 und 78, nehmen in der Geschichte einen bedeutenden Abschnitt ein, und wir haben daher in der topographischen Geschichte von München S. 29 die Hauplmomente bezeichnet. Es wurde schon 1204 an dieser Stelle ein Pilgerhaus exbaut, und 1253 legte Otto der Erlauchte den Grundstein zum Spitale. Die Kirche wurde 1268 eingeweiht, beide aber gingen 1327 durch Brand zu Grunde. Der gegenwärtige Bau ist jener, welcher nach dem Brande hergestellt wurde. Das massive gothische Gewölbe des Spitales, jetzt Produktenhalle und Stadtwaage, hat der Zeit und den späteren Feuersbrünsten getrotzt, und wir haben daher in demselben ein solides Muster des alten Gewölbebaues. Der Hintere Theil des Spitalgebäudes mit durchlaufendem Gewölbe ist nicht jünger, und man kann sogar mit Grund vermuthen, daß die vordere große Halle noch jene ist, welche nach 1253 gebaut wurde. Nach dem Brande von 1327 erfolgte dann der Hintere Anbau.
Die Kirche, eine schöne Halle mit Säulenumgang, hat 1727 leider das ehrwürdige gothische Gepräge gänzlich verloren, indem auch die Fensteröffnungen im Zopfstyl ausgemauert wurden. Die herabgeschlagenen Gewölberippen wurden von Egid Asam in Stucco überkleidet, und die dadurch gewonnenen Felder von Nikolaus Stuber und Cosmas Damian Asam in Fresco bemalt. Von Stuber sind die Werke der Barmherzigkeit an den Seitengewölben, von Asam die Hauptbilder des Mittelschiffes. Das Hochaltarbild, die Sendung des hl. Geistes, ist von Ulrich Loth gemalt. Es ersetzte schon 1630 den alten gothischen Altar. Von den Seitenaltären ist jener mit der unbefleckten Empfängniß ein Werk des Andreas Wolf von 1712. Die übrigen Seitenaltarbilder sind von Adam Müller (St. Johann von Nepomuk) Tiepolo (die vierzehn Nothhelfer) Joseph Hauber (der hl. Joseph und Christus vor der Magdalena), Augustin Albrecht und Franz Zimmermann. Eines der schönsten Bilder ist das Abendmahl des Herrn hinter dem Choraltare von unbekannter Hand. Das alterthümlich aussehende Bild des hl. Benno auf einem Pfeiler ist von einem jungen Künstler Münchens, August Bräutigam, gemalt. Die fein gemalten, aber geistlosen Darstellungen der sieben Gaben des hl. Geistes in de» Seitennischen sind das Werk des Peter Horemans von 1727.
Links vom Hochaltar ist ein altes Rundbild der hl. Jungfrau mit dem Kinde in Holz, welches durch die neue Fassung ein ziemlich modernes Ansehen erhalten hat. Es war Eigenthum der Bäckerznnft, welche 1323 das thurmartige Gebäude an der Hochbrücke Nr. 15 von Kaiser Ludwig dem Bayer zum Bruderschaftshause erhielt. Das Madonnenbild war vor der Restauration ebenfalls mit der Jahrzahl 1323 versehen, doch stimmt die Auffassung nicht für jene Zeit. Der Bäckerzunft gehörten auch die in der Kirche vorhandenen gothischen Leuchter von Holz, deren Füße der Restaurateur mit styllosen Zusätzen bereicherte. Gegenüber dem Bäckerbilde, in der Nische unweit der Sakristeithüre ist ein merkwürdiges Holzbild der hl. Maria mit dem Kinde, welches ebenfalls neu gefaßt erscheint, doch nicht mit jener Feinheit, welche die alten Meister ihren Holzsculpturen zu verleihen wußten. Das Bild stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, und befand sich ursprünglich in der Klosterkirche zu Tegernsee. Im Jahre 1620 erhielt es die Frau des Gastgebers Wolfgang Hammerthaler, nach welchem der Ammcrthaler Hof im Thal benannt ist. Die Statue war anfangs in der Hauskapelle der Hammerthalerschen Eheleute der Verehrung ausgesetzt, und wurde nach und nach in ihrer Bekleidung mit vielen Kleinodien geschmückt. Der starke Zulauf bewog aber die Eheleute zuletzt, das Bild den P. P. Augstinern zu überlassen, und somit war es von 1624—1803 in der Kirche derselben, der jetzigen Mauthhalle, als wunderthätig bekannt. Nach der Aufhebung des Klosters nahm der Besitzer des Ammerthaler Hofes das Bild zurück, und vor ungefähr zwölf Jahren ging es als Geschenk in die hl. Geistkirche über. Die jüngere Generation weiß nicht mehr, daß in derselben ein hoch- verehrtes Heiligthum der alten Münchner sich befinde.
Oben an der Rückwand der Kirche ist das eherne Grabmonument des Herzogs Ferdinand von Bayern, des Stifters der gräflich Wartenbergischen Linie mit der Man, Pettenbeck. Es stammt aus dessen Kapelle, der St. Sebastianskirche im Rosenthale, jetzt das Haus Nr. 5. Ein Werk des Hans Krümper, fand es nach der Säkularisation der Kirche bei hl. Geist eine würdige Aufstellung. Der Herzog ist in Hochrelief in Lebensgröße vorgestellt.
Die Spitalkirchen zum hl. Geist hatten in der Regel keinen Thurm, und so war bis gegen 1730 auf dem hinteren Langhause nur ein kleiner Aufbau mit zwei Glocken. Der gegeuwärtige die Gasse verengende Thurm datirt aus der Zeit von 1730. Den Bau betrieb der Pfarrer Joseph Pirchinger, welcher 1722 investirt wurde und 1755 starb. Seiner Bemühung verdankt die Kirche ihre Entkleidung vom alten ehrwürdigen Gepräge des 13. Jahrhunderts. Das die Werke der Barmherzigkeit vorstellende Gemälde über dem Eingänge des Spitales wurde 1863 restaurirt. Es datirt aus der Zeit von 1727, und ist ein Werk des Nikolaus Stuber.