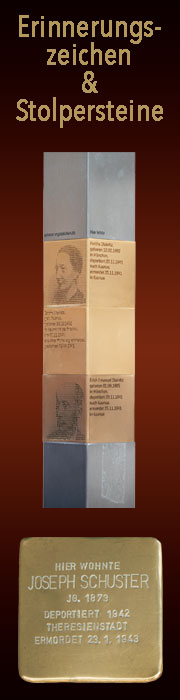Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Münchner Wirtschaftsgeschichte
| Firma | Hacker-Pschorr |
|---|---|
| Gründung | 1417 |
| Wikipedia | Hacker-Pschorr |
| Kategorie | Brauerei |
1417 wurde erstmals eine Brauerei an der Stelle der heutigen Gaststätte „Altes Hackerhaus“ in der Sendlinger Straße in München genannt. Die Münchner Bierchronik zeigt eine Abbildung hierzu: „Die Wiege der Joseph Pschorr’schen Braustätte «zum Hackher» Sentlingergasse im XM. Jahrhundert“. Weiter beschreibt man: „Im Haggenviertel, an der heutigen Sendlinger- und Hackenstraße, stand Ende des 14. Jahrhunderts eine schon damals altbekannte Braustätte, der Bräu am Hag .. «Prew im Haggenviertel» zwei gekreuzte Hacken als Wahrzeichen“ (wohl das Gewerbe des Besitzers, Hausnummern gab es damals nicht). Da sich unter den damaligen Hauptbesuchern der Bräuwirtschaft zahlreiche Zimmerleute befanden, vermutet der Autor aber eher zwei Beile oder Äxte, die auch älteste Zeichnungen der Schutzmarke aufweisen.
1738 erwarb „Bürger und Bierprau“ Simon Hacker das Anwesen, das Joseph Pschorr 1793 von seinem Schwiegervater Peter-Paul Hacker kaufte und bedeutend erweiterte.[3] Unter dem Ehepaar Joseph Pschorr d. Ä. (1770–1841) und Maria Theresia Hacker wurde Hacker-Pschorr Anfang des 19. Jahrhunderts zur führenden Münchner Großbrauerei. So errichteten sie 1813 mit dem „Hacker-Keller“ den größten Lagerkeller Deutschlands in der Landsbergerstraße. Der riesige Brau- und Lagerkeller umfasst eine Grundfläche von 4000 Quadratmetern und eine Lagerkapazität von über 35.000 Hektolitern.
1820 erwarb Joseph Pschorr d. Ä. die „Brauerei zum Bauernhansl“ sowie weitere Häuser in der Neuhauserstraße und errichtete dort die „Brauerei zum Pschorr“. Nach dem Tod Pschorrs fiel das Erbe an die Söhne Georg Pschorr d. Ä. (1798–1867) (Brauerei zum Pschorr) und Matthias (1800–1879) (Hacker-Brauerei, „zum Hacker“[6]). Sie und ihre Nachkommen bauten beide Brauereien weiter aus und führten sie mit Investitionen in damalige neue Technik, wie z. B. der Kältemaschine von Carl von Linde, in die Moderne. 1922 erfolgte die Umwandlung des Unternehmens G. Pschorr in die Pschorrbräu AG.
Erst 1972 verschmolzen die Brauereien Hacker und Pschorr wieder zur Hacker-Pschorr Bräu AG, die später von der Schörghuber Unternehmensgruppe erworben wurde.
Ab 1993 wurden auf dem ehemaligen Gelände des Hacker-Pschorr-Sudhauses an der Hackerbrücke die Pschorr-Höfe (u. a. auch der Bürokomplex des Europäischen Patentamts) errichtet. Die Brauanlagen wurden mit denen der Paulaner Brauerei zusammengelegt.
Heute ist die Hacker-Pschorr Bräu GmbH Teil der Paulaner Brauerei Gruppe. Seit Anfang 2007 wurde das Sortiment komplett auf Bügelverschluss-Flaschen umgestellt. Die Entwicklung wurde 2014 abgeschlossen, als die 0,33-Liter-Bügelflasche auf den Markt kam.
In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Wird nicht veröffentlicht
Die Firmen HACKER und PSCHORR waren von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert hinein Fa milienunternehmen, deren Leitung vom Vater auf den Sohn übertragen wurde.
Joseph Pschorr, der Stammvater der Brauerei, teilte 1834 seinen Besitz unter den Söhnen Ge org und Matthias auf. Georg Pschorr erhielt die „Brauerei zum Pschorr“ in der Neuhauser Straße, Matthias die „Brauerei zum Hacker“ in der Sendlinger Straße.
Beide vererbten Ihren Anteil, der sich inzwi schen wesentlich vergrößert hatte, ihren Söh nen Georg Pschorr jun. und Matthias Pschorr jun.
Der Pschorr-Bräu Georg widmete sich ganz der Firma und übergab sie seinen Söhnen August, Georg Theodor und Joseph, genannt die „drei Geheimräte“. Matthias Pschorr jun. wandelte seine Firma 1881 in eine Aktiengesellschaft um, behielt aber das Aktienkapital in seinen Händen.
Auch die Pschorr-Brauerei wurde 1922 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, doch blieben hier die Mitglieder der Familie noch lange in der Unternehmensleitung tätig.
Als Keimzelle des heutigen Unternehmens kann wohl die Hackerbrauerei gelten. Schon seit dem 15. Jahrhundert bestand auf dem Grundstück Sendlinger Straße 75 — im sogenannten „Hag genviertel“ — eine Braustätte, deren Braurecht 1363 verheben worden war. Erst ab 1589 aller dings kann man von einer kontinuierlich geführ ten Braustätte sprechen. 1738 erwarb Simon Hacker das Brauanwesen. Sein Sohn, Peter Paul, heiratete eine reiche Bauerstochter und konnte den Oberpollinger-Bräu in der Neuhau ser Straße dazukaufen.
1793 heiratete die „Hacker-Tochter“ den jun gen Brauer Joseph Pschorr, der die inzwischen vor dem Ruin stehende Brauerei wieder in Schwung brachte.
Im Jahre 1806 lag der Bierausstoß des „Pschorr zum Hacker" bereits an erster Stelle in Mün chen. Neben Modernisierungen im Braubetrieb führte Joseph Pschorr auch in der Verwaltung neue Methoden ein; so wurde z. B. mit doppel ter Buchführung gearbeitet und mittags und abends über alle vollzogenen Aufträge Bericht erstattet.
Durch ein neues Darrverfahren lag die Qualität des Pschorr’schen Bieres erheblich über dem, was die Münchner bisher gewohnt waren. Dies und die folgende Innovation sicherte Pschorr auf Jahre hinaus die Vorrangstellung unter den Münchner Brauereien:
Er kaufte an der jetzigen Bayerstraße ein großes Stück Land und errichtete bis 1823 einen Lager keller für 60000 Eimer Bier. Diese konnten 12 Meter tief auf 4000m2 eingelagert werden — un terteilt in kleine, festgeschlossene Abteilungen, die nur nacheinander geöffnet wurden, um ihre Kühle zu behalten. In den 30er wurde dann der sog. Stirneiskeller eingerichtet, in dem große Mengen Natureis den ganzen Sommer über Kälte an den Keller abgaben.
Für die Münchner Bürger hieß das riesige Bauwerk bald „die Bierfestung“.
Die Hackerbrauerei von 1834 bis 1972
1823 brannte das Brauanwesen bis auf die Grundmauern nieder. Der 1831 beendete Neu bau, das heutige „Alte Hackerhaus“, ist eine Zierde der Sendlinger Straße.
Als 1834 Matthias Pschorr die Brauerei über nahm, führte er sie im Sinne seines Vaters weiter. Durch Rationalisierung und straffe Organisation gelang es ihm, den Bierausstoß ständig zu steigern.
Dies erforderte räumliche Erweiterungen, die durch Ankauf oder Anmieten von stillgelegten Braustätten nur sehr notdürftig vollzogen werden konnte.
Schließlich wurde es unumgänglich, den gesamten Betrieb zu verlegen. Die alte „Bierfestung“ — seit 1834 in eine „Pschorr-“ und eine „Hacker-Seite“ geteilt, bildete das Fundament für die neuen Fabrika tionsanlagen beider Firmen, die gleichzeitig zwischen 1860 und 1865 an der Bayerstraße gebaut wurden. In den folgenden Jahrzehnten konnte der Bierausstoß durch den „Export“ über die Grenzen Münchens hinaus beträcht lich gesteigert werden. Schließlich wurde — via Hamburg - sogar nach Übersee exportiert.
1879 übernahm Matthias Pschorr die Brauerei und wandelte sie 1881 in eine Aktiengesell schaft um. Als er 1900 starb, interessierte sich keiner seiner Erben für das Unternehmen. Sie boten ihre Anteile zum Verkauf an.
Einen Großteil dieser Aktien kaufte der Apothe ker Adolf Obermaier, der schon seit längerer Zeit im Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft saß. Er kaufte im Laufe der Zeit immer mehr Aktien, bis er schließlich die Mayorität besaß. Es folgte eine wechselvolle Zeit für die Brauerei. Kriegszeit und Inflation brachten das Unterneh men an die Grenze seiner Leistungskraft.
In der schrecklichen Notzeit nach dem Kriege gelang dann die Entwicklung des „Hacker Nährbieres“, das für viele Menschen zur Kraft quelle wurde. Kranke bekamen es sogar auf Rezept von ihrem Arzt verordnet. Bis nach Amerika ging der Export dieses Spezialbieres, wo es unter dem Namen „Nurse-Brand“ be kannt wurde.
Mit dem dritten Reich begann eine neue Krisen zeit, die während des zweiten Weltkrieges ihren Höhepunkt erreichte. Trotz der großen Schäden durch Bombeneinwirkung gelang es immer wieder, den Betrieb in Gang zu halten, bis schließlich 1945 alles restlos vernichtet wurde.
In mühevoller Kleinarbeit wurde der Wiederauf bau begonnen. Bereits 1949 — auf dem ersten Oktoberfest nach dem Kriege — war die Hacker brauerei wieder mit einem Festzelt vertreten. Ab 1950 schließlich konnte der Wiederaufbau in großem Stil begonnen werden.
Die Brauerei wurde neu und modern aufgebaut. Der Bierausstoß wurde ständig gesteigert. Außerdem nahm die Hackerbrauerei auch alkoholfreie Getränke in ihr Angebot auf.
Die Pschorrbrauerei von 1834 bis 1972
Wie die Arbeit seines Bruders Matthias in der Sendlinger Straße, so stand auch die des Georg Pschorr jun. unter dem Zeichen des technischen Fortschritts. Er vergrößerte die Kapazität und den Besitz der Brauerei durch Erweiterungen auf der Gant und begann, in eigenen Gaststätten sein Bier auszuschenken.
Mit der Einführung der Eisenbahn kam auch für die Brauerei zum Pschorr die Zeit des Exports in großem Stil. Ein speziell eingebrautes Bock-Lagerbier wurde für den Versand entwickelt, das dann seit 1867 auch in Flaschen verschickt wurde. Diese Spezialmarke Pschorrs war schon 1860 in Rio de Janeiro erhältlich.
Drei Jahre nach dem Tode seines Vaters über nahm Georg Pschorr (III.) die Brauerei und er stellte an der Bayerstraße — neben der Hacker brauerei— eine moderne Großbrauerei.
Durch Studienreisen gewonnene Erfahrungen führten schließlich dazu, daß in fast jeder Großstadt der Welt von Georg Pschorr eine Absatz stelle eingerichtet wurde.
Selbstverständlich gab es auch überall in Deutschland Gaststätten der Brauerei. Wichtig war dabei die Gründung des Pschorr-Hauses in Berlin. Dem ersten folgten in kurzem Abstand zwei weitere Häuser, die bald an der Spitze der eleganten Berliner Gastronomie standen.
Der jüngste Sohn Georg Pschorrs, Joseph, stellte auf der Weltaustellung in Chicago zum ersten Mal Pschorr-Bier vor. Durch die Einrichtung von Kühlräumen auf den Schiffen konnte schließlich ab 1894 Bier ohne Einbußen nach Übersee gebracht werden.
Im gleichen Jahr noch wurde in New York die „US Brand of Pschorr Bräu München“ eingerichtet.
Als Georg Pschorr jun. 1894 starb, übernahmen seine drei ältesten Söhne — die später als die drei Geheimräte bekannt wurden — die Brauerei gemeinsam.
Unter ihrer Leitung konnte sich das Unterneh men gut weiterentwickeln.
Der erste Weltkrieg brachte auch der Pschorr- —Brauerei schwere Einbußen. Auch in der Nach kriegszeit konnte sich das Unternehmen nur sehr langsam erholen.
1922 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, wobei das Aktienkapital allerdings in den Händen der Familie Pschorr blieb.
Auf den scheinbaren Aufschwung der zwanzi ger Jahre folgten Börsenkrach und Wirtschaftskrise. Die Machtübernahme der Nationalsoziali sten bedeutete für das angeschlagene Unter nehmen den Anfang vom Ende.
Die völlige Vernichtung aber brachte dann der zweite Weltkrieg und seine Folgen. Die Flieger angriffe des letzten Kriegsjahres legten die ge samte Produktionsanlage in Schutt und Asche. Und obwohl ein Wiederaufbau sinnlos erschien, gab man nicht auf.
In den fünfziger Jahren konnten die Wiederaufbau-Pläne verwirklicht werden. Vorbildliche so ziale Einrichtungen wurden geschaffen und langsam erreichte auch der Export wieder große Bedeutung. In der ganzen Welt gewann die Pschorr-Brauerei wieder neue — alte — Freunde.
Die Hacker-Pschorr Bräu GmbH
Trotz aller Vorausplanungen und Anstrengun gen der beiden Brauereien Hacker und Pschorr blieb aber die Zeit nicht stehen. Die Konkurrenz durch andere Unternehmen wurde nicht gerin ger und im allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung wurde es auch für erfolgreiche Brauereien immer notwendiger, die eigene Position zu stärken, um unabhängig zu bleiben. Vor allem aber mußte man dem Druck norddeutscher Braukonzerne standhalten, die auf den süd deutschen Markt drängten.
Daher entschlossen sich die Pschorrbräu AG und die Aktiengesellschaft Hackerbräu im Jahre 1972, ihre auf nebeneinanderliegenden Grundstücken seßhaften Firmen zu einer einzi gen zu verschmelzen.
Durch die allgemeinen wirtschaftlichen und hi storischen Bedingungen hatten beide Firmen eine parallele Entwicklung genommen und standen sich — etwa gleich stark — gegenüber. Der gemeinsame Ausgangspunkt war stets das Gelände auf der Bayerstraße geblieben und der Verschmelzungsvertrag betonte die natürlichen Verbindungen beider Gesellschaften. So ent stand 1972 die Hacker-Pschorr Bräu Aktienge sellschaft.
Zwölf Jahre später wurde im Rahmen einer Be triebsaufspaltung der Grundbesitz von der Brauerei getrennt. Die „Brauerei und Verwal- tungs-AG“ und die „Hacker-Pschorr Bräu GmbH“ entstanden, um in den unterschiedli chen Geschäftszweigen effektiver arbeiten zu können.