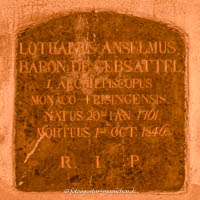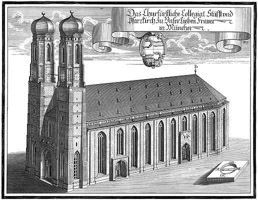Stadtgeschichte München
Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Münchner Architektur
Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau
| Name | Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau |
| Architekt | Halsbach Jörg von |
|---|---|
| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |
| Stadtbezirksteil | Kreuzviertel |
| Straße | Frauenplatz 1 |
| Jahr Baubeginn | 1468 |
| Jahr Fertigstellung | 1488 |
| Baustil | Gotik |
| Sakral | katholisch |
| Kategorie |
Religiöse Bauwerke Kirche |
| Baustil |
Gotik Gotik |
| Unterkategorie | Kirche |
| Suchbegriffe | Dom Frauenkirche |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Frauenkirche, CC BY-NC 4.0

Urheber: Lebschée Carl August
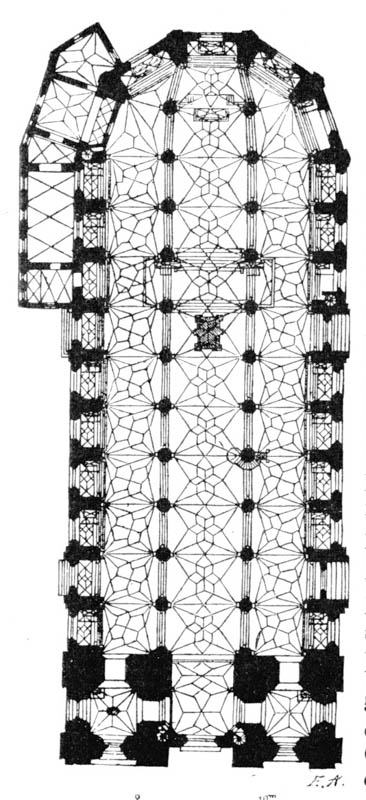
Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)
Beschreibung
Kath. Metropolitan- und Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau (Dom, Frauenkirche), mächtige backsteingotische Hallenkirche mit Umgangschor, von Jörg von Halsbach 1468-88, mit zwei Westtürmen, deren charakteristische Kuppelhauben 1524/25 aufgesetzt wurden; mit Ausstattung.
Quellen
Frauenkirche
Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Frauenkirche am Frauenplatz; genannt „die Dom- und Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau“.
Baugeschichte. Wie die Stadt München selbst ihren Namen und ihr Wappen, so verdankt wahrscheinlich auch deren Hauptkirche, der „Dom“, ihren Ursprung den Benediktinermönchen von Schäftlarn, bezw. von Tegernsee und Wessobrunn, die vordem auf dem jetzigen Münchner Burgfrieden begütert waren; namentlich gilt das vom Kloster Schäftlarn, das durch die reiche Schankung eines frommen Apolt von 782 in Sendling und Schwabing, und wahrscheinlich auch zwischen diesen Orten, zu großen Grundbesitz gelangte — den die Schankung eines wittelsbachischen Grafen Konrad von Dachau noch mehrte, nach welchem der zwischen Sendling und Schwabing gelegene, von der jetzigen Ett- bis zur Dachauerstraße sich erstreckende .Konradshof“ benannt war; diesen Hof bemeierten die Mönche durch Hörige, deren Seelsorge zunächst von der alten Pfarrei Sendling (zu der München bis dahin gehörte) aus besorgt wurde, bis es nötig erschien, in der Nähe der Gebäude des „Konradshofes“ (die wahrscheinlich an der Stelle der spätem Michaelskirche und des .Tesuitenkollegs standen) eine eigene Kapelle mit einer schlichten Behausung für einen Seelsorger zu errichten; deren Patronin war damals schon „Unsere liebe Frau“ die Gottesmutter, der auch — und zwar noch vor der pipinianischen Zeit — Schäftlarn selbst, das Mutterkloster, geweiht war und das erst im 8. Jahrh. den Patron der fränkischen Pipine, St. Dionys annahm. Dieses erste Marienkirchlein (spätere „Frauenkirche“) stand auf einer östlich vom Konradshof gelegenen Anhöhe; es wurde, als Herzog Heinrich der Löwe 1156 den bisherigen Zug der Salzstraße Salzburg-Augsburg von Uberföhring weiter isaraufwärts zur „villa Munichia“ (dem heutigen „München“) verlegte, eben wegen seiner Lage alsbald ins Gebiet der werdenden Stadt einbezogen und kam nach Errichtung eines Walles und Grabens hart an den Nordwestrand dieses primitiven Befestigungswerkes zu liegen. Da indessen der Herzog wie mit dem Bischof von Freising (wegen der erwähnten Salzstraße) so auch mit dem diesem ergebenen Kloster Schäftlarn haderte, bekümmerte er sich um das von dem Letztem abhängige Kirchlein nicht weiter, sondern wandte seine Gunst dem — auch strategisch wichtigeren — andern Kirchlein am steilen Südostrand der Stadt zu, •dem Peterskirchlein: er ließ letzteres zur (ersten und damals einzigen) Pfarrkirche der Stadt München erheben und mit Heribert, bis •dahin Pfarrer und Dekan von Feldmoching, besetzen; die Marienkirche mußte sich mit dem Rang einer einfachen Seelsorgskirche begnügen.
Aber alsbald war das Marienkirchlein für die rasch anwachsende Volksmenge zu klein geworden, weshalb — wahrscheinlich noch im 13. Jahrh. — daneben eine größere Marienkirche erbaut wurde. Die bisherige Marienkapelle an der Stelle des Chores der jetzigen Frauenkirche) aber blieb bis zu ihrem gänzlichen Abbruch 1468 [anläßlich des Neubaues der großen Frauenkirche] als Totenkapellc („Michaelsfriedhofkapelle“) unter dem Schutze des hl. Erzengels Michaels, des Patrons der Sterbenden, bestehen; in ihrer Krypta ruhte provisorisch die Leiche des im Bann gestorbenen Kaisers Ludwig IV. des Bayern bis zu deren definitiven Beisetzung (nach der Absolution vom Banne) neben der Leiche seiner schon 1322 verstorbenen ersten Gemahlin Beatrix in der Gruft der zweiten, im 13. Jahrh. erbauten Frauenkirche. Höchst wichtig für diese zweite und größere Marienkirche wurde das Jahr 1271, in dem der Bischof von Freising die Bevölkerung Münchens in zwei Pfarreien teilte, wobei er die bisherige Marienkirche ebenfalls zur Pfarrkirche erhob, die Peterskirche — als die ältere Pfarrkirche — zur Dekanats- und Mutterkirche ernannte. Ueber die genauere Lage und Gestalt [Größe: ungefähr 24 m lang und 9 m breit] dieser zweiten, dem Baustile nach jedenfalls romanischen Kirche ist urkundlich nichts überliefert; nach Beher wurden 1849 an deren mutmaßligen Stelle die Beste einer Kirche mit den Fundamenten von 2 Türmen gefunden, die sich danach dem jetzigen Dom parallel gegen Osten erstreckte. In ihrer Fürstengruft lagen außer Kaiser Ludwig dem Bayern und seiner Gemahlin Beatrix deren Söhne und Enkel: Ludwig der Brandenburger 1361, Herzog Stephan mit der Hafte 1375, Markgraf Otto V. 1379, Herzog Friedrich I. 1392, Herzogin Thaddäa 1381, Herzogin Katharina 1391 nebst dem kleinen Prinzen Adolf, Herzog Frnst der Starkmütige 1438. Ihre Gebeine wurden dann um 1490 in die Fürstengruft der jetzigen Frauenkirche übertragen, und es folgten ihnen hierauf: Herzog Sigmund 1501 (Grundsteinleger der Frauenkirche), Herzog Albrecht IV. der Weise 1508 und dessen Gattin Kunigunde, Herzog Wilhelm 1V. der Standhafte 1550, Herzog Frnst, Erzbischof von Salzburg 1560, Herzog Albrecht V. der Großmütige 1579 und dessen Gemahlin Anna, deren Sohn Herzog Ferdinand 1608, Gründer des gräfl. Wartenberg sehen Hauses (vgl. Grabdenkmal in der hl. Geistkirche) sowie dessen Gattin Maria von Pettenbeck; desgleichen der .,Kardinal von Bayern“ Philipp Wilhelm 1598, Sohn Wilhelms V. Nach der Aufhebung des Clarissenklosters am Anger 1809 wurden auch die Gebeine der dort verstorbenen Prinzeßnonnen hierher gebracht (s. Angerkloster).
Diese zweite, größere Marienkirche wurde im 15. Jahrh. mehrfach als baufällig bezeichnet und deshalb schon 1443 von dem eben in München anwesenden Kardinal Alexander, Patriarchen von Aquileja allen denen, die unter Einhaltung der hierzu vorgeschriebenen Werken der Frömmigkeit zum Neubau der Kirche beisteuerten, ein Ablaß bewilligt. Weil infolge der Stadtumwallung der Baum im alten München sehr beschränkt war, erledigte sich die Frage des Bauplatzes alsbald von selbst: die neue Kirche konnte nur zu stehen kommen an die Stelle der alten; da aber beim sofortigen Abbruch der Kirche die Bevölkerung auf Jahre hinaus keinen Gottesdienst gehabt hätte, erfolgte der Abbruch wie der Neubau nur schrittweise und zwar mußte dem Neubau zunächst 1468 die Michaels- Friedhofkapelle weichen. Inzwischen ging der städtische Baumeister Jörg Ganghofer (aus der Gegend von Moosburg [S'XthalsbacM]) auf Kosten der Stadt auf eine Studienreise durchs Bayerland, in dessen großen Städten, namentlich in Augsburg und Ulm, nach dem Vorgänge von St. Martin in Landshut im 15. Jahrh. bereits die kühnen und riesengroßen spätgotischen Hallenkirchen mit den schlanken hohen Türmen erstanden waren, so in Ingolstadt die Frauenkirche, in Freising die St. Georgs- Pfarrkirche, in Moosburg der Chorbau von St. Castulus, in Straubing und selbst in kleinern Städten wie Wasserburg und Neuötting.
Herzog Sigismund, der kurz zuvor zugunsten seines Bruders Albrecht IV. auf die Mitregierung verzichtet hatte, legte am 9. Februar 1468 den Grundstein zu unserer Frauenkirche, wohl als offizieller Vertreter des Fürstenhauses, das hier seine Gruft erhielt und dementsprechend auch zu den Baukosten beisteuerte. In der Hauptsache aber war und blieb der Bau ein Werk des Gemeinsinns der Bürger und der bürgerlichen Geistlichkeit, wie denn auch der Grundgedanke des Planes der einer streng bürgerlichen Pfarrkirche war, freilich zu Kathedraldimensionen gesteigert, würdig der großen Haupt- und Residenzstadt München. In der Tat war darin nur an die Bedürfnisse des Pfarrklerus und des Volkes gedacht, und nirgendwo auch nur andeutungsweise Rücksicht genommen auf den Hof oder den Herzog. Mit ihr schließt München — spät — die Reihe der großen altbayerischen gotischen Stadtpfarrkirchen, ihnen in Anlage (Hallenkirche) und Baustoff (Backstein) nahe verwandt, allerdings weit weniger leicht im Aufbau und weniger frei in der Raumbildung.
Der Bau der Kirche begann auf der Nordseite. Noch im August desselben Jahres (1468) war er soweit fortgeschritten, daß zum Abbruch des Nord turms der alten Kirche geschritten werden konnte; im Mai des nächsten Jahres fiel auch glücklich der Südturm (mit den Glocken), nachdem Ganghofer kurz vorher von seiner Studienreise zurückgekehrt war; 1473 hatten die Umfassungsmauern ihre volle Höhe erreicht. Im nächsten Jahr, bevor man zur schwierigen Herstellung des Gewölbes schritt, veranlagte Meister Jörg den Stadtrat, einen Kongreß von bayerischen Kirchenbaumeistern zusammenzurufen, zu dem dann erschienen: Matthias von Fichstädt, Moritz Ensinger von Ulm, Konrad Roritzer von Regensburg (der Erbauer der Inrenzkirehe in Nürnberg), Friedrich von Ingolstadt und Michel von Pfarrkirchen. Im Frühjahr 1477 war das Gewölbe glücklich vollendet. Von 1477 auf 78 wurde von Zimmermeister Heinrich von Straubing (Forster nennt nach der alten Bezeichnung den Meister Hei- meran) der Dachstuhl aufgesetzt, wozu 2200 Bäume verbraucht wurden.
Damit waren aber auch alle Geldmittel erschöpft. Zur Beschaffung der gesamten Innenausstattung, einschließlich der teuern Glasgemäldefenster, wandten sich die Bürger, unterstützt von Herzog Albrecht 1 V., 1476 nach Rom an Papst Sixtus IV. mit der Bitte, „daß alle Gläubigen, welche zum Ausbau der neuen Kirche U. L. Frau soviel au Geld oder Geldeswert beisteuern würden, als jeder in einer Woche zu seinem Lebensunterhalt bedurfte, für dieses Almosen nach Empfang der hl. Sakramente der Beicht und Kommunion vom Sonntag Laetare bis zum Sonntag Judica (die Woche vor dem vorletzten Fastensonntag) einen vollkommenen Ablaß für ihre zeitlichen Sündenstrafen gewinnen konnten; 3 Jahre sollte diese Gnade währen und von dem fallenden Opfer zwei Drittel zum Bau der Kirche, ein Drittel aber zum Krieg wider die Türken verwendet werden“ [F]. In diesen 3 Jahren beteiligten sich an der Ablaßfeier insgesamt über 123000 Gläubige, darunter sogar aus Orten nördlich der Donau, die einen für damals außerordentlich hohen Gesamtbetrag von über 15000 fl. beisteuerten; auch die Türkenquote erließ schließlich der Papst auf Bitten des Stadtpfarrers Hundertpfund.
Kurz vor dem Tode Ganghnfers, 1488, wurden die beiden Türme bis zur jetzigen Höhe vollendet; 1489 überreichte Zimmermeister Wil- bolt dem Stadtrat für die Bedachung der Türme die Rechnung; jedoch wegen Geldmangel und Kriegsunruhen konnten sie einstweilen nur mit einem hölzernen, von unten herauf unsichtbaren Kot dach versehen werden; die beiden weltberühmten Kuppeln, damals (weil inzwischen der Renaissancestil eingedrungen war) „welsche Hauben“ genannt, wurden wahrscheinlich nach 1524 aufgesetzt, wozu vielleicht die Reise des Rates Matheis Kirchmeiers nach Augsburg, dem Ausgangspunkt der Renaissance für Südbayern, beigetragen hat.
Noch vor Vollendung des Baues, 1484, erlangte Herzog Albrecht IV. vom Papst — mit dem Gedanken, seine Residenzstadt bei Gelegenheit zu einem Bischofssitz zu erheben — die Erlaubnis, aus jedem Domkapitel im bayerischen Kreise (Freising, Passau und Regensburg) einen oder zwei Kanoniker als herzogliche geistliche Räte zeitweise an seinen Hof zu ziehen. Da aber die Domkapitel ihre gelehrten Männer nur ungern abgeben wollten, kam der Fürst zum Entschluß, sich einen bleibenden „Geistlichen Rat“ in München zu verschaffen; deshalb hob er mit päpstlicher Genehmigung 1492 die Kollegialstifte St. Arsatius zu Ilmmünster und St. Sixtus zu Schliersee auf und transferierte deren Pfründen und besten Kanoniker nach München, woselbst er damit ein neues Kanoni- kat- und Kollegiatstift an der Frauenkirche stiftete. Damit erhielt die Kirche U. L. Frau als vornehmste Kirche den Vorrang auch vor der alten St. Peterskirche.
Unter dem Kurfürsten Maximilian I. winden im Kircheninnern im Sinne der Renaissance einige Neuerungen getroffen: 1601 winde die ganze Kirche, deren Flächen bis dahin teilweise bemalt waren, überweißt; ferner an Stelle der gotischen bunten Glasgemälde reine weiße Fensterscheiben eingesetzt; sodann wurde über dem Grabmonument des Kaisers Ludwig des Bayern, das damals noch vor der Treppe zum Hochaltäre stand, die interessante Improvisationsdekoration des sogen. Bennobogens errichtet ; „nach Geist und Stil der imperatorischen Barockkunst des alten Roms entlehnt [W]“, wölbte sich die große Tonnendecke — 1604 ziemlich schnell aus Gips gebaut — wie ein Triumphbogen über dem Kaisergrab und rahmte den Durchblick zum Hochaltar (mit dem mächtigen Rahmenwerk um das Feier Candid’sehe Kolossalgemälde der Himmelfahrt Mariä“ von 1620 — jetzt oberhalb dem nördlichen Portal neben dem äußeren Sakristeieingang) feierlich ein; auf dem Bogenscheitel ragte ein Kruzifixus zwischen Maria und Johannes auf. Bis der neue Hochaltar des Candid hergestellt war, wurde er vertreten durch einen ziemlich einfachen Ältartisch, auf dem seit 1618 jene von Hans Krumper gegossene Madonna stand, die von 1638 ab auf der Mariensäule tront. Unter dem Bennobogen selbst — daher wurde er benannt — ließ Maximilian 1601 den Bennoaltar errichten, worin die 1576 vor den Reformatoren aus Meißen [Sachsen] von Herzog Albrecht V. geretteten Reliquien des Meissener Bischofs St. Benno (seine Gebeine, zugleich mit Stab, Inful und Meßgewand) untergebracht waren; der Kurfürst ließ zu gleicher Zeit dem hl. Bischof, dem nunmehrigen Landespatron Bayerns, zu Ehren die berühmte kostbare „Bennobiiste“ auf dem Altar aufstellen (ausgestellt auf der bayerischen Gewerbeschau 1912 zu München): ein silbernes großes Brustbild über einem mit Edelsteinen reich geschmückten Reliquiarium, das nur durch den Edelsinn der Bürger bei der Säkularisation 1803 vor dem Schmelzofen bewahrt wurde und seitdem als „Eigentum der Bürgerschaft“ im Kircheninventar aufgeführt ist.
Um die Wende des 17. Jahrh. verfiel das Kanonikatstift, und es wurde dann zu seiner Ausstattung das gesamte Stift Indersdorf herangezogen. Kurfürst Karl Theodor erhob schließlich die Kirche zur „Hofkirche“, sie wurde indes alsbald, durch die Säkularisation 1803 des Stifts- einkommens beraubt, wieder bloße „Pfarrkirche“. Erst 1817, anläßlich der Errichtung des Erzbistums „München-Freising“ (durch Transferierung der bischöflichen Residenz von Freising nach München) gelangte sie — nach all den widrigen Wechselfällen — zu der jetzigen Stellung höchsten Ansehens, zur Würde der „Metropolitankirche Bayerns“, und somit zum Vorrang gegenüber allen andern Domkirchen des Landes. Infolge davon wurde im selben Jahre aueh die unterm Chor gelegene Fürstengruft erweitert, wodurch der Chor selbst erhöht wurde, aber auch Platz geschaffen wurde zur Beisetzung der Münchner Erzbischöfe.
Die letzte große Aenderung erfuhr der Dom durch jene unglückliche Restauration von 1858 — 67. Sie hatte eine blaue Deekenbemalung mit goldenen Sternen vorgesehen; und der Gegensatz dieses Blau zu den gelben Pfeilern ist der erste farbige Eindruck, den jetzt der Eintretende empfängt, ein Eindruck, der durchaus neuer, fast sentimentaler Art ist und den die Kirche ursprünglich sicher nicht gekannt hat; nicht nur außen, auch im Innern erstrahlte der Bau im hellen Putzgewande — alles gehöht mit den starken Farben frischtönender Bemalung. Dieser Restaurierung zuzuschreiben ist dann die zunächst etwas erschreckende Kahl heit, Nüchternheit, Frostigkeit des Innern, die nur gelegentlich, so z. B. in der festlichen Fronleichnamswoche, aufgehoben wird, wenn die Utensilien der Festprozession im Vereine mit den vielen Birkenbäumchen in der Kirche einen außerordentlichen Eindruck bewirken. .Illein von Anfang an ist jedenfalls damit gerechnet worden, daß die kahle Architektur nur das Gerüste geben sollte einer bunten reichen Dekoration, wobei dann — nach Analogie alle andern derartiger Kirchen — sich jenes urdeutsche Eufeuwerk von da und dort prangenden Statuen, Tafeln und zierlichem Omamentschmuck an den Pfeilern und Wänden sich hinziehen sollte. Alles das war vordem vorhanden — wenn auch nicht vom ersten Tage an, so doch im Verlaufe der Jahrhunderte. Mit einem grimmigen Besen aber ist dieser Reichtum ausgekehlt worden. Statt dessen hat man in vollendeter Symmetrie höchst langweilige Figuren an die Wände geklebt; und man hat auch, im Gefühl, der „reinen“ Kunst zu dienen, herausgebrochen, was eine sehr viel spätere Zeit, das Barock, hineingebaut hat, den „Bennobogen“, durch den zwar die Perspektive nicht aufgehoben, aber in einem echt barocken „malerischen“ Sinn bereichert wurde; er hatte sich wie ein „Zwischenakzent“ eingesetzt ins Langhaus und so die Verhältnisse von „vorn“ und „hinten“ geschaffen. Daran allerdings ist kein Zweifel: dem Meister Ganghofer und seinerzeit wäre eine solche Interpolation entschieden unangenehm gewesen; hatte es doch die Barockidee abgesehen gehabt auf ein gewaltsames Unterbrechen der gewaltig wirkenden Längenperspektive. Leiter jener Restauration war Architekt M. Berger, der Erbauer der neuen Haidhauser Johanniskirche, ein Kind der Romantik, dem alles Renaissancewerk als profan erschien und dem die reine Stileinheit der Ausstattung über alles ging. Diesem Puritanismus fielen daher auch sämtliche alten (Renaissance-) Altäre zum Opfer, damit sieden jetzigen „stilreinen“ Nachfolgern PIatz machten. Doch verdiente Berger den Dank, daß er die gewöhnliche helldurchsichtigen Fensterverglasung (eine Tat des 17. Jahrh.) wieder ersetzte durch die urspriinglichen farbenprächtigen Glasgemälde, soweit sie damals noch vorhanden waren. Etwas völlig Atypisches, nicht mit dem Geist der alten Kirchenbauer Verträgliches war auch die Herstellung der Domfreiheit in jener romantischem Restaurationsepoche. War es doch ursprünglich darauf abgesehen, in die Enge der Gassen etwas hineinzusetzen, was über alle bürgerlichen Maßstäbe hinaus* ging. Und wenn heute überdies die Häuser rings um die Kirche ein viel größeres Volumen haben als ursprünglich zur Zeit Ganghofers, so muß man um so mehr darauf bedacht sein, aus der engen Perspektive schmaler Gäßchen, der Sporergasse (von der Weinstraße her) oder vom Durchgangsgäßchen vom Promenadeplatz her etwas von den überwältigenden Eindruck zu gewinnen, denn diese immense „moles“ einstmals gemacht haben mußte, als sie in den modernen Häuserkasernen noch keine Konkurrenz besaß: müßte man doch heute die Kirchen drei- und viermal größer bauen, als es jetzt geschieht um jene Proportionen zwischen dem Profanen und Sakralen wiederherzustellen, wTie sie vorliegen in unserm Fall. —
Grundrifs und Aufbau.
1. Aeufseres.
Der Riesenbau, eine der mächtigsten und großräumigsten spätgotischen Kirchen Deutschlands und zugleich das bedeutendste Bauwerk Münchens, repräsentiert sich von außen als unverputzter Backstein bau auf Nagelfluhsockel. Das jetzige Bild jedoch, das als unverputzter Ziegelbau etwas trübe, fabrikmäßig anmutet, ist in seiner Erscheinung dahin zu korrigieren, daß die Mauerwände ursprünglich w'eiß verputzt waren und ihnen eine farbenfreudige Dekoration ganz sicher nicht gefehlt hat; es ist Norddeutschland, namentlich die Ostseeprovinz, in denen unverputzte Ziegelbauten üblich waren; in Süddeutschland, in Oberbayern, gehörten solche zu den Ausnahmen. Um der Kirche als Bauleistung gerecht zu werden, sei hingewiesen auf die außergewöhnlich großen Maße: 101 m in der Länge, 38,5 m in der Breite, 58 m Höhe bis zum First und 99 m Turmhohe bis zum Kuppelkreuz; dazu erinnere man sich, was es heißen will, daß ein Bau, der berechnet war auf eine Stadt von 20000 Einwohnern, heute noch die Macht besitzt, als Zentralkircbe die Silhouette einer Stadt von einer halben Million Bewohner zu beherrschen. Die religiöse Kraft des Volkes hat sich am Ende des Mittelalters, am Vorabend der Reformation, hier noch einmal gesammelt zu einer unglaublich hohen Leistung bei einer unglaublich kurzen Frist von 1468—86. Und nun erwägen wir die Verhältnisse von Dach und Körperl Wenn wir die Mauerwand mit jenen gewaltigen, hochgeschlitzten Maß- werkfenstern (über 20 m hoch, im Langhaus vierteilig, im Chor fünfteilig) abgeschritten haben, und uns überlegen, daß in diesen Fenstern ziemlich vollständig die Höhe des Innern ausgesprochen ist, und dann daß das, was als Dach diesem Körper aufgesetzt ist, eine freie Zugabe an Höhe ist, die dem Innern nicht mehr zukommt — das Gewölbe mit seinen an und für sich schon riesigen Abmessungen sitzt da auf, wo das Dach erst ein- setzt —, dann erst kommt uns der gewaltige Luxus an Hochbau zu Bewußtsein. Und dann die Türme, die weltbekannten Wahrzeichen der Stadt, Türme, die eng zusammengerückt, diesem Dach das Gegengewicht halten müssen, bis zur Firsthöhe des Kirchendaches ein wuchtiger Aufstieg in nicht ganz gleichmäßigen Stockwerken fensterlos — die paar Durchbrüche können vollkommen ignoriert werden — vmd mit einem Minimum von Dekoration. Was spricht, sind nur die Horizontalen der Wasserschläge und dann an den Ecken die lisenenartigen Bänder mit ihren nur flach reliefierten Maßw’erkmotiven; man braucht die Einzelformen nicht zu sehen, aber man spürt, wie sehr diese „Bänder“ dem Bau eine entschiedene Festigkeit und zugleich Zierlichkeit geben. Und darauf dann der große Gegensatz, das eigentlich Belebende und Schmückende: nach den 5 untern quadratischen Geschossen das Ueberspringen ins Achteck in den beiden Obergeschossen, wobei die Diagonalseiten ausgesetzt sind mit Strebepfeilern. Dort erst — und auch dort erst im zweiten Geschoß — kommen nun die großen „Löcher“, die Fenster, wo die Schallöcher für die Glocken1) sich auftun; dann ein kurzes Zierglied — der Turmhals in Form eines rudimentären Tambours, und dann endlich der Abschluß mit den berühmten, einstmals vielumstrittenen „welschen Hauben“, von denen die gotischen Puritaner absolut nicht glauben wollten, daß sie zum ursprünglichen Bau gehört haben sollen.
Bezüglich der Fassade ist hier bei unserer Frauenkirche eigentlich wenig zu sagen. Denn eine richtige „Fassade“ ergibt sich an ihr nicht, insofern die Türme die Fassade „auffressen“. Die Türme sind daran das entschiedene Hauptmotiv; sie süid — was an sich nicht notwendig wäre — in unserem Fall bis in die alleruntersten Ansätze sichtbar. In andern Fällen fließen die untern Etagen der Türme mit den untern Feldern der Fassade zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. Hier aber sieht man nur die Türme und etwas Schmales inzwischen, etwas Eingeklemmtes, das keine große Wirkung entfalten kann. Der große Giebel kommt zwischen den Türmen gleichfalls nicht in seiner Dreieckform zum Vorschein, sondern ist verdeckt durch eine hohe, horizontal abgeschlossene Wand. In die nischenförmige Oeffnung der Mitte ist das Portal eingebettet. Die Fassade ist ebenso wie die Außenseite der Langhausmauern nur. schwach belebt, schon deshalb, wreil sie durch die Einbeziehung des Strebewerkes in den Innenbau jener wohltätigen und stilgemäßen Gliederung, vor allem der Strebebögen mit dem Reichtum an Türmchen, Wimpergen und Fialen, beraubt sind. So beschränkt sich die Gliederung auf die Betonung der Vertikale durch die breiten, glatten, jedoch nur schwach hervortretenden Lisenen mit einigem Stab- und Maßwerk, die — vom Sockel bis zum Gesims laufend — bestimmt sind, die Außenflächen der eingezogenen Strebepfeiler zu markieren. Das Dachsims setzt sich aus Hohlkehle und Platte zusammen. Unter den Fenstern zieht sich das Kaffsims hin und ein Kleeblattbogenfries, dessen untere Spitzen in Lilien auslaufen. Ueber dem Dach der Kapellen erhöht sich das Mittelschiff noch um etwa 2 m, gegliedert durch rechteckige Felder mit Vierpaßfüllung. Im Querschnitt ergibt der Aufbau ein umschriebenes gleichseitiges Dreieck, ähnlich der Pfarrkirche zu Neuötting, der sie im Aufbau auch sonst gleicht. Das Verhältnis von Breite zu Höhe (mit Ausschluß der äußern Kapellenreihen — da diese lediglich der Einbeziehung der Strebepfeiler ihr Dasein verdanken) ist wie 25 : 31 (Landshut, St. Martin 24,5 : 29; Ingolstadt, Frauenkirche 26,5 : 28).
II. Inneres.
Gehen wir in das Innere, so sind wir zunächst überrascht — trotz aller Größe des Aeußern — darüber, wie hoch sich der Raum reckt, in welch schwindelnder Entfernung die Decke über den Pfeilern sich wölbt! Viel von diesem Eindruck kommt auf Rechnung des Systems, in dem diese Kirche erbaut ist: sie ist eine „ Hallen kirclie“. Sie ist demnach, zum Unterschied von den meisten andern gotischen Kirchen, nicht so gebaut, daß das Hauptschiff überragend emporgetrieben wird und im Verhältnis zu ihm die Nebenschiffe niedrig bleiben; vielmehr sind hier alle 3 Schiffe von gleicher Höhe. Und daraus ergibt sich ein größeres Raumvolumen und damit zugleich eine Verstärkung des wegen der gewaltigen Höhe ohnehin imponierenden Raumeindrucks auf den eintretenden Beschauer. Allein die Gefahren, die diesem Typus anhängen, sind nicht unbeträchtlich. Man kann zunächst finden, daß es im Sinne kirchlicher Erhebung, kirchlicher Idealität wirken muß, wenn ein Mittelkörper sich emporhebt: dadurch wird das geistige „Empor!“ erst recht zum Bewußtsein gebracht. Vor allem aber ist es bedenklich, daß beim Mangel an mittlerer Ueberhöhung die Gelegenheit fehlt, ein eigentliches, reines Oberlicht zu gewinnen, das hocheinfallende „saerale“ kirchliche Licht. Wir sind nun angewiesen auf die Seitenlichter. Lind wenn das im Falle unserer Frauenkirche uns nicht eigentlich als etwas Unangenehmes zum Bewußtsein kommt, so hängt das damit zusammen, daß die Fenster, die sich in den umlaufenden Kapellenwänden auftun, eben sehr hoch sind - so hoch wie der Gewölbeanfang, also in der ganzen Kirchenhöhe emporgeführt sind. So verliert hier das Seitenlicht etwas von seinem „profanen“ Charakter deswegen, weil die ringsum von den nahen Häusern eng umbaute Kirche selbstverständlich das Licht nur aus dem obersten Teil der Fenster hereinfallen läßt, so daß die untern Partien — die übrigens ohnedies zumeist in den dunkelsten Farbtönen gehalten sind — als lichtspendend nicht funktionieren können. Eine weitere Eigentümlichkeit der Frauenkirche, und jedenfalls von Anfang an angeordnet, ist die, daß die Pfeiler bei ihrer engen Stellung (10 Joche mit 22 Pfeilern auf eine innere Länge von 74 m) nirgends einen vollkommenen Ueberblick über den Raum gestatten. Darum muß man, wenn man sagt, die Kirche ist eine „kahle“, hinzufügen: ihr Reichtum liegt darin, daß die Phantasie überall noch etwas zu suchen hat; und wenn man sagt, die Kirche ist „nüchtern“, so ist gleich beizufügen, daß das Geheimnis darin liegt, daß nirgends der letzte Grund, die letzte Silhouette sich dem Blick erschließt. Bei einer monumentalen, spätgotischen Kirche ist nämlich die Absicht nicht gestellt auf die Behandlung der einzelnen Formen: der Beiz liegt vielmehr im „Malerischen“, im Unübersichtlichen und Unbegrenzten. Darin also unterscheidet sich unsere spätgotische von dem bald folgenden Kenaissancebau der MichaelsJcirche, daß es trotz der riesigen Raumab Wirkungen und trotz der Gleichartigkeit der 3 Schiffe, die beidemale etwas Saalartiges ergeben könnten, doch nicht eigentlich abgesehen ist auf die Wirkung des Gesamtvolumens des geschlossenen Baumes, sondern auf das Schauspiel, das aufgeführt wird durch die Dinge, die im Baume drinn stehen — das, was geschieht im Raume, ist immer noch wichtiger als der Baum selber. Firn den Renaissancegeschmack wäre die Frauenkirche „verstellt“ durch einen Wald von Pfeilern — und es war daher in der Tat eine neue Epoche, als dann mit der Michaelskirche jene Form italienischer Raumgestaltung in Deutschland einzog, die unter Beibehaltung der großen Abmessungen ein Stück Baum aus einem Gusse darstellte.
Im einzelnen ist über Grundriß und Aufbau zu bemerken: Langhaus sehr langgestreckt, ohne Querschiff; dagegen Chorumgang, der als Fortsetzung der Seitenschiffe um das erhöhte Presbyterium herumgelegt ist. Aeußerer Chorabschluß in 5 Seiten des Achtecks, innere Umgangsmauer jedoch (im Gegensatz zum Abschluß der äußern :Mauer) ohne regulären polygonalen Abschluß: hier letztes Pfeilerpaar, wie schon bei St. Jakob in Straubing, einfach durch Engerstellung einander genähert. „Ursache hiervon die schwierige Lösung des Wölbungsproblems im fünfteiligen Chorabschluß: denn der aus den Seitenschiffen erwachsende Umgang um den Chor ist als solcher nicht auch im Gewölbe durchgeführt; vielmehi- setzt sich das Mittelschiffgewölbe bis an die beiden mittleren Streben des Chorabschlusses fort, und zwar, weil das letzte Pfeilerpaar etwas enger gestellt ist, in 2 Trapezen sich verjüngend; der beiderseits übrigbleibende Gewölberaum aber stellt sich in je einem unregelmäßigen Viereck und in einem Dreieck dar, welchen besondere und gleichfalls unregelmäßige Netzformen geschaffen werden mußten“ [Bb). Zwischen den letzten 8 östlichen Pfeilern Einbau des über eine Krypta erhöhten Chores. Uebermauerung (Einziehung) der Strebepfeiler zur Gewinnung eines Kapellenkranzes für die zahlreichen, ursprünglich aus der alten Frauenkirche transferierten Seitenaltäre (also unter Umgehung eines eigenen Anbaues von niedrigen Abseiten eigens für die Seitenkapellen wie in Landshut- St. Martin). „Damit erlangte das prächtige Gewölbenetz eine an eine fiinfschiffige Anlage gemahnende Breite, und es ist damit jene unangenehme Schmalschultrigkeit vermieden, die besonders den hochemporgefiihrteu gotischen Kirchen sonst eigen ist; dieser Vorteil wird jedoch durch den Nachteil aufgewögen, daß nun die Kapellen selbst über den Altären abschlußlos zu unverminderter Höhe sich erstrecken (Hinaufführung der Kapellen bis zum Gewölbe der Seitenschiffe!) und die Fenster sich gleichfalls in einer innen wie außen unerquicklichen Weise in die Länge ziehen“ |1. c.]. Pfeiler achteckig, schlicht und ohne Kapitelle, unter sich in der Kämpferhöhe des Hauptschiffes durch Scheidebögen auf Kragsteinen verbunden ; an der Vorderseite der Pfeiler, den Seitenschiffen zu, eckige Dienste und kleine Profilkapitelle. Scheidebögen 3fachabgestuft; in ihrer unterste] 1 Stufe auf Kragsteinen ruhend; die beiden andern Stufen aus den Pfeilern in einer Höhe von 34,5 m herauswachsend — „eine empfindungslose Ueberführung des Bogens in die Stütze, die in bayerischen Hallenkirchen nicht selten ist“ [W]. An den Strebepfeilern vorgelegte Dienste von der Grundform des halben Achtecks mit kleinen Profükapitellen; Strebepfeiler selber an ihrem Vorderende in der Kämpferhöhe der Scheidebögen des Mittelschiffes durch profilierte, auf Kragsteinen ruhende Bögen verbunden. Am Gewölbe der 3 Mittelschiffe eine gut geteilte Netzfiguration, über den Seitenkapellen spitze, mit netzartigen Rippen besetzte Quertonnen. Gurtbogen in der Längsrichtung deutlich markiert, in der Querrichtung dagegen nicht stärker betont als die übrigen Rippen des Netzgewölbes: daher günstig für die einheitliche Wirkung des Gewölbes.
Ausstattung.
Im Chor: Hochaltar von 1861, nach einem Entwurf M. Bergers in prächtigen gotischen Formen ausgeführt von Anselm Sickinger, im Schreine kunstvolles Schnitzwerk „Krönung Mariä“ von Jos.Kndblm überlebensgroßen Figuren, im gotisierenden Stil derN azarener durchaus idealistisch; Flügelgemälde (Innenseite: Darstellungen aus dem Leben Mariä, Außenseite: 4 große Passionsbildor) von Moritz Schwind, die — weil dem Künstler kirchliche Kunst weniger lag — mit Ausnahme der „Erziehung Mariens“ die sonst so herzliche Gemütlichkeit des Künstlers vermissen lassen. Erzbischöflicher Thron mit reichem Baldachin aus Eichenholz nach Bergers Entwurf von Joh. Wirth. Kredenztisch und die beiden Kronleuchter von Prof. Ludwig Foltz, dem Nachfolger Bergers in der Leitung der Restauration seit 1863. Sedilien (nur bei den Pontifikalämtern gebraucht) noch aus 1823, der Zeit der Erhebung zur bischöflichen Domkirche, von Anton Schwanthaler (dem ältcrn). Am Chorabschluß 2 Seitenaltäre: nördlich Altar des hl. Korbinian und Maximilian (den Glaubensboten Bayerns) mit deren Statuen von Zumbusch und Flügelgemälden von Max von Menz\ südlich Altar der 2 Apostelfürsten Petrus und Paulus; Altar und Statuen von Joh. Petz. Flügelgemälde von Heinr. v. Pechmann. Chorgestühl, 1493 für die hierher berufenen Kanoniker errichtet in der im 15. Jahrh. in Süddeutschland wiederholt auftretenden Art, wovon als hervorragendstes Werk jenes des Meisters Syrlin im Ulmer Münster bekannt ist, und der selbst kleinere Kirchen folgten und wenigstens für die Patronatsherrn ein ansehnliches Gestühl erhielten; vielleicht ein Werk des Erasmus Grosser (Aller Bat- haussaal), jedenfalls eines der besten Werke aus der Glanzzeit der Münchner Schule. Von den alten Teilen des im 17. und 18. Jahrh. mehrfach umgeänderten Gestühls sind noch vorhanden 28 geschnitzte Halbfiguren von Aposteln, Propheten und Kirchenvätern, darüber, dem Chor zu, kleine Heiligengestalten in Ganzfigur, und über diesen wieder 15 kleinere Figür- chen sowie 18 weitere Figuren den Seitenschiffen zu an der Rückwand; außerdem an den Rückseiten der Wände südlich 8 hl. Päpste und nördlich 8 hl. Bischöfe in flachreliefierten Ganzfiguren. (Die kleinen Figuren an den durchbrochenen Chorschranken zwischen Gestühl und Hochaltar sind gleich den Schranken selbst modern aus der Restaurationszeit von 1860.) Das Beste sind die Halbfiguren, während bei den kleinern (als mehr Nebensächlichem) mehrfach Werkstättenarbeit von Gesellen vorliegt. „In der heiligen Männer lange Reihe Abwechslung hineinzubringen war äußerst schwierig; manche Motive kehren natürlich öfter wieder, so das Deuten der Prediger mit der Rechten oder das Halten des Buches in der hinken: aller gerade da bewundern wir, daß der Künstler doch nicht einfach wiederholt, sondern dasselbe Motiv stets anders durchführt. Wieviel Leben liegt trotz des engen Rahmens, der hier gezogen war, schon in den Bewegungen dieser Männer! Wie mannigfach sind die gewaltigen Motive! Hier setzt ein Bischof gerade seine Brille auf, während er in lebhafter Rede aufsieht. Gut bewegt sind vor allem auch die trefflich verstandenen, oft fein durchgeführten Hände. Diese Mannigfaltigkeit gewinnt erhöhtes Interesse in den Köpfen; schon äußerliche Dinge sind hier bezeichnend, wie der Künstler, ganz nach Art Grassers, Freude an dem buntesten Wechsel der Kopfbedeckung hat, wozu allerdings die Mode des 15. Jahrh. wie keine andere reizen konnte: wir treffen da Hüte aller möglichen Formen, Mützen, Kappen, turbanartig gewundene Kopftücher; sehr verschieden behandelt sind die Haare, was schon auf feine stoffliche Beobachtung und das Erfassen des Individuellen hinweist : bald sind sie leicht geringelt, bald hart gesträhnt, dann erscheinen sie wieder leicht gewellt oder mehr zottig ausgeführt. Das Bedeutendste aber an diesen Köpfen ist ihr inneres Leben, sind die Charaktere: wir haben voll ausgebildete Persönlichkeiten wie im träumerischen Thomas, in Philippus den (lüstern, ergreifenden Prediger mit dem Kreuze, in dem geistreichen, fein das Wort wählenden Sophonias, im leidenschaftlich erregten Arnos; — und doch geht andrerseits ein einheitlicher Grundton durch die ganze Versammlung: aus hartem, sprödem Holz geschnitzt, sind sie hagere Gestalten mit nervigen Händen, meist lang herabhängenden Haaren und großen Bärten; die Backenknochen treten stark hervor, die Wangen sind eingefallen, die Augen liegen in der Regel tief, die Züge sind scharf geschnitten und Falten und Furchen ins Gesicht eingegraben; verhaltene Leidenschaft arbeitet in diesen Männern; manchmal, wie bei Ämos, bricht sie auch heftig hervor; sie hat das Ebenmaß der Züge zerstört, aber sie kündet vom tiefen, innern Leben dieser ernsten, düstern, erschütternden Prediger [RM]“. — An der Rückseite des Hochaltars der neue Eingang zur Fürstengruft, bezeichnet durch eine Gedenkplatte im Fußboden; dort- selbst auch 3 bemalte Steinreliefs um 1500: Christus am Oelberg, Vesperbild, Kreuzabnahme. An den beiden Pfeilern rechts und links der rückwärtigen Stiege der Gedenkstein zur Errichtung des Konkordates, der 8 Bistümer Bayerns und Erhebung der Frauenkirche zur „Metropolitankirche“, andrerseits der Gedenkstein zur Anwesenheit des Papstes Pius VI. in München 1782.
Außerdem 21 Seitenkapellen mit ebenso vielen Seitenaltären aus 1860 (Beschreibung beginnend mit der mittleren Kapelle der Ostseite, fortschreitend auf der Südseite [Epistelseite] gegen Westen und zurückkehrend vom Westen her auf der Nordseite):
1. Altöttinger-Kapelle (auch „Priesterbruderschafts“-Kapelle, weil deren Altar von der Priesterbruderschaft an der Frauenkirche gestiftet wurde). Altar nach seiner Herkunft aus Memmingen genannt der Memminger-Altar, bezeichnet „Claus Strigel de Memmingen f. 1500“; aus diesem Jahr und vom gleichen Meister auch die Skulpturen, das Gemälde des hl. Achatius und die Gemälde der Flügel (Teile der letzteren über dem Eingang zur alten Sakristei und am Altar der Auferstehungskapelle); Altarbau selbst größtenteils modem. An den Flügeln außen je 4 gemalte, voneinander getrennt stehende Heiligengestalten: links St. Anna selbdritt, Agnes mit dem Lamm. Juliana mit Kreuzstab, Apollonia mit Zange und Zahn; rechts Margaretha mit dem Drachen, Magdalena mit der Salbbüchse, Antonius der Einsiedler und Bischof Nikolaus: innen in den Flügeln je 2 Apostel in Ganzfigur und Hochrelief: St. Thomas mit der Lanze, Petrus mit den Schlüsseln, Bartholomäus mit dem Messer, Jakobus mit dem Pilgerstab. Im Oberaufsatz eine Kopie der Altöttinger Mutter Gottes (daher der andere Name der Kapelle), St. Franz Xaver und Johann Nepomuk 18. Jahrh.; im Mittelschrein 5 stehende Holzfiguren: in der Mitte St. Blasius mit Kerzen, ausdrucksvoll, streng und herb, die beste der Figuren; ferner die beiden Leviten St. Laurentius und Stephanus und die beiden Johannes der Evangelist und der Täufer. In der Predella Christus und die 12 Apostel, Brustbilder im Hochrelief, tüchtige, scharf charakterisierende Arbeiten, nur in der Gewandbehandlung im Charakter des 15. Jahrh. noch ziemlich eckig. Links vom Altar St. Anna selbdritt, Oelgemälde auf Goldgrund; treffliches Bild der oberdeutschen Schule von großer Freiheit des Vortrags und großem koloristischem Reiz; rechts vom Altar ein alter Altarflügel mit der Anbetung der hl. 3 Könige; Stall in einer antiken, etwas barock aufgefaßten Ruine mit Ausblick auf die Landschaft; Münchner Schule 10. Jahrh.; an den Seitenwänden 2 Oelgemälde von AHk. Pfleger um 1680: Christus in langem Mantel und St. Joseph mit der Lilie. Rechts in der Ecke Marmorreliquiar gestiftet von Freiherrn H. von Uberkamp S. J. Im Fenster alte Glasgemälde mit biblischen Szenen.
2. Tabernakel-Kapelle mit dem Corpus Christi-Altar, von M. Berger und J. Knabl 1863, gestiftet von Erzbischof Gregor v.Scherr; über den Tabernakel Abendmahlgruppe von J. Petz. Als Altar-Anti- pendium das in Silber getriebene hochrelifierteLiegebild des hl. Arsatius, Bischof von Mailand, dessen Reliquien 1493 die Kanoniker von Ilmmünster hierher brachten (1846 aber wieder dorthin zurückgegeben wurden); ein interessantes Werk um 1500; am Kleidsaum die Widmung des Stifters Herzog Albrecht V.: „Divi Arsatii, quam me imaginem cernis. suas indicantem inesse Reliquias, illustris Albertus Bavariae dux sua in me pietate suoque sumptu fecit, currente tum salutis anno 1496, erectionis autem dicti cura Ducis hujusce collegii et harum translationis tarn Reliquiarum Canonicorumque secundo“ [AM|. Am Täfelwerk der Kapelle Flachreliefs aus dem Leben Jesu und Mariens, vom ehemaligen Chorgestühl des Ign. Günther 1773. Sehr bemerkenswert, namentlich durch die mächtige Totalwirkung, ist das hiesige, nach dem Stifter benannte „ S chart'- zant“sehe Fenster mit 3 Hauptdarstellungen: Verkündigung — Geburt und Anbetung Christi — Mariä Reinigung; die reiche gotische Umrahmung gehörte zu den wichtigsten Vorbildern für die Münchner Glasmalerei der Ainmillerschen Schule. — Der Kapelle gegenüber Grabstein des Hofrates M. Chr. von Mayr 1725; daneben die Gedenktafel zur Anwesenheit Papst Pius VI. in der Frauenkirche 1782; dortselbst auch das Grabmal des Kardinals und Erzbischofs Karl August Grafen von Reisach 1860.
3. Herz Jesu-Kapelle. Herz Jesu-Altar von J. Petz 1863 mit Herz Jesu-Bild von Ant. Heß; von letzterem auch die von R. v. Oberkamp gestifteten Bilder „Margaretha Maria Alacoque“ und „St. Petrus Claver“; dazwischen Oelgemälde „St. Theresia“, ein spanisches Werk, vielleicht Kopie des späten 16. Jahrh. Fenster: in der obern Hälfte ein Teil des sogen. „Herzogenfensters“, wahrscheinlich von Egid Trautenwolf um 1486, darstellend „Maria umgeben von Heiligen“, darunter die Stifter Herzog Ernst, der Starkmütige, Wilhelm III., Albrecht III. und Albrecht IV.; daran angereiht ein Stück aus dem benachbarten Scharfzant- Fenster: „der Auferstandene“ umgeben von Heiligen, den Stiftern und deren Wappen (Stupf und Scharfzant); unten modernes Glasgemälde „St. Urban“ von Heinr. Burmeister. Gegenüber am Pfeiler Grabdenkmal des Erzbischofs Antonius von Steichele 1889, entworfen von Paul Säger, ausgeführt von Anton Heß.
4. Johann Nepomuk-Kapelle. Altar von Wilhelm Niessen. Im goldenen Kästchen auf der Altarstaffel Reliquien des hl. Johannes. Unterm Fenster 3 Holzreliefs: Verkündigung Mariä, Mariä Heimsuchung, Hl. 3 Könige; manirierte Arbeiten des späten 16. Jahrh. Grabdenkmal Gabriel Riedlers 1581, dessen Familie hier ehedem Gruft und Stiftung hatte. Gegenüber an der Chorrückwand Epitaph für Erzbischof Antonius von Ihoma, von H. Wadere aus rotem Marmor in streng architektonischer Zusammenfassung. Daneben Epitaph für Erzbischof Frauz Joseph von Stein 1909, früher Bischof in Würzburg, von Prof. Gg. Busch, gegossen von Rupp; Tafelkanten holilkehlenartig abgeschrägt; in den so gebildeten Nischen die hl. Bischöfe Korbinian von Freising und Kilian von Würzburg mit den Diözesanwappen: das Ganze gestützt von Rebengerank (Franken als Heimat des Bischofs); nach oben zu Lorbeerzweige und Dornengestrüpp (Symbol für die Ehren und Würden des hohen Berufes). — 5. Arco-Kapelle. Steinaltar nebst Wandung und Betstuhl 1877 gestiftet von den gräflichen Familien Arco-Zinneberg, -Valley und -Stepperg, Altarwerk aus rotem Sandstein mit weißen Marmorfiguren von W. Messen 1887. Im Fenster Teile eines 1473 von der Priesterbruderschaft gestifteten Fensters. —
6. Keindl-Kapelle; Altar 1864 von dg. Schneider; die darin befindliche Gruppe „Mariä Vermählung“ geschnitzt von Kaspar Zumbusch. Oelgemälde aus Schleißheim „Katharina weist den Freier ab“; hinter ihr der Freier und ihr Vater, mit dem Stocke drohend, vor ihr der Kaiser mit Gefolge; interessantes oberdeutsches Gruppenbild um 1500. Am Strebepfeiler Denkmale für den berühmten Historiker Andreas Felix vonOefele 1780, und für den kurfürstl. Hofrat und Gelehrten (Erfinder der Logarithmentafel) Hans Georg Hörwarth von Hohenburg 1622; im Relief zielt der Tod auf den Verstorbenen, der vor dem Kreuze kniet, lieber den Treppeneingang zur Empore Hochrelief „Tod Mariens“, barocke Arbeit Anfang 17. Jahrh.; darüber Tafelgemälde aus Schleißheim, Anfang 16. Jahrh. „Der Tod des hl. Apostels Jakobus“: in einer Halle vor einem Götzenbild die Leiche des Heiligen, dahinter Ausblick in die Landschaft, in der die Leiche des Heiligen auf einem Ochsenwagen geführt wird. Auch in diesem Fenster Reste aus dem Priesterbrudersehaftäenster; links oben das Ligsalzwappen. — Neben dieser Kapelle das „Brautportal“ mit Empore, auch „Donatustor“, genannt nach dem Brustbild des Heiligen an der Türaußenseite. Ueber dem Tor innen 2 Holzfiguren, St. Petrus und Paulus aus der alten Kirche, Mitte 15. Jahrh.; dazwischen sitzende Holzfigur „Maria mit dem Kinde“ um 1850, Entwurf von Konrad Eberhard, geschnitzt von U. Entres. Darüber runde gemalte Totenschilde mit dem Ligsalzwappen.
7. Geburt Christi-Kapelle. Altar von dg. Schneider 1863; Altarbild „Geburt Christi“ von Max Huber. An der Wand 2 Tafelgemälde auf Goldgrund „Christus am Oelberg“ und „Verrat des Judas“ (wobei Christus dem Malchus das Ohr anheilt), charakteristische bayerische Arbeiten um 1500. Dazwischen Kalksteinepitaph mit Relief des Gekreuzigten, ohne Inschrift (vielleicht für Kanonikus Karl debhard 1651 bestimmt). Dem Altar gegenüber Tafelgemälde auf Goldgrund: „Kreuzabnahme“, wertvolle, koloristisch bedeutende süddeutsche Arbeit um 1520. Im Fenster Glas- gemäldc aus der alten Kirche „Krönung Christi“ 1395 mit den Stiftern Pütrich, Astaller und Ligsalz.
8. St. Georgs-Kapelle. Altar 1862 von dg. Schneiden und Herd. Freckle; Altarbild „St. Georg“ von Ulr. Halbreiter. Im Boden Ligsalzgrabstein 1360. An der Wand 2 Sehleiß- heimer Tafelgemäldc: „St. Laurentius mit seinem väterlichen Freund Papst Sixtus“ und Bischof „St. Wunibald“. In deren Mitte treffliches Bronzerelif 1596 von Hubert derard gegossen für das früher hier befindliche Epitaph des Thomas Merman, Leibmedikus Herzogs Wilhelm V. 1612; darunter eine zum Grabmal des Benno Ligsalz 1712 gehörige Inschrift, dessen Familie hier Gruft und Stiftung hatte. Ueber dem Beichtstuhl Barthwappen und Toten Schild des Andreas Ligsalz 1564. Im Fenster Ligsalzwappen und altes Glasgemälde „Anbetung der hl. 3 Könige“..
9. Englische Grufs-Kapelle mit dem Altar der Bäckerinnung 1865 von A. Sickinger, mit der Schnitzgruppe der „Emausjünger“ in der Predella und „Maria mit dem Kind“ im Schrein. Geber dem Beichtstuhl Tafelgemälde auf Goldgrund „Kreuzigung Christi“ aus der alten Kirche um 1460, vielleicht fränkisch; Komposition sehr gedrängt: eine Menge Berittener in Rüstung oder orientalischem Kostüm, einer von ihnen stößt mit Hilfe eines Fußknechtes dem Heiland die Lanze in die Seite, im Vordergrund (in kleinerm Maßstab) Maria mit den Frauen, rechts 4 um Christi Kleid streitende Soldaten; vielfach ist mit dem Pinsel gezeichnet, wie überhaupt die Konturen stark betont sind. An der Wand 3 Schleiß- heimer Tafelbilder: „Grablegung“ und „Kreuzigung“, oberdeutsch, Anfang 16. Jahrh.; dazwischen „Christus am Oelberg“ mit landschaftlichem, bis ins einzelne liebevoll ausgeführten Hintergrund. Unten Grabstein der Herrn von Mandl. Im Fenster „St. Florian“; rechts oben das Wappen des Bischofs Tulpek 1473. Unterm Gewölbe der rote Hut des Kardinals Kiesel, eines Wiener Bäckersohns und spätem Fürstbischofs von Wien, der ihn 1607 auf seiner Pilgerfahrt nach Altötting und zum hl. Benno in München hierher schenkte und (nach römischer Sitte) hier auf - hängen ließ.—
10. Maffei-Kapelle. Altar und Figur des hl. Bartholomäus von J. Knabl 1863 als Stiftung des Reichsrats J. A. vonMaffei; dessen goldner Wappenschild über dem Veronikabild (Tafelgemälde 16. Jahrh.). 2 Schleißheimer Tafelgemälde auf goldgemustertem Grund: St. Quirinus und Barbara, aus dem Kloster Wengen bei Ulm, treffliche schwäbische Arbeiten Anfang 16. Jahrh. Dazwischen Epitaph des Franz Karl vonOw 1726. Im Fenster eine „Mariä Heimsuchung“ und ein Martyrium des hl. Vitus“ mit den Stiftern Astaller, Ligsalz und Pütrich. — Neben dieser Kapelle das Arsatiustur mit Empore. Ueber ihm (zwischen 2 Ligsaiz- totenschildern von 1587 und 1610) Holzgruppe „Anna Selbdritt“ Ende 15. Jahrh.; rechts vom Portal die gekrönte Fürstin Mechtildis mit Szepter, den Mantel zusammenraffend, links die gekrönte hl. Lucia, eine Kerze haltend, tüchtige, lebensgroße, steinfarbig bemalte Holzfiguren aus der Wende zum 16. Jahrh.; „die Köpfe der Jungfrauen haben noch den zarten Reiz der Spätgotik und manche Faltenmotive deren großen Zug; das reiche, nieht immer ganz bewältigte Detail namentlich des weiten Mantels entspricht dem spätgotischen Streben, scharf ins einzelne zu gehen, deutet aber schon auf die reich gebauschten Falten der folgenden Periode; noch mehr ist dies der Fall bei der ebenfalls lebensgroßen Maria Magdalena, ihnen gegenüber an einem Pfeiler: an der vorzüglichen Figur mit ihrem fein empfundenen Kopf, aus den letzten Jahren des 15. Jahrh , fällt beim Gewände neben einzelnen echt gotischen zügigen Motiven (z. B. dem linken Mantelrand) ein starkes Aufbauschen und Wehen des Mantels auf, das zu Beginn des 16. Jahrh. mehr und mehr üblich wird; nur sind hier die Details der Falten, die dann weich und rund werden, noch knitterig, scharf und eckig“ [RM].
11. Ecee homo-Kapelle. Altar von J. Wirth 1868. Auf dem Altar überlebensgroße Ecce homo-Steinfigur um 1400; in der Predella bemalte Terracotta-Pietä um 1400. Dem Altar gegenüber Ecee homo-Gemälde, gute Arbeit des Ulrich Loth 18. Jahrh. Unten Steintafel (früher in Bennobogen) mit den Wappen von 16 hochadeligen Häusern. Grabmal des geistlichen Dichters Hofrates Franz von Kohlbrenner 1783. Im Fenster unten alte Darstellungen aus der Bibel; obere Hälfte neu, entworfen von L. Foltz Der Kapelle gegenüber, rechts vom Eingang in die Turmkapelle, an der Wand Tafelgemälde der Taufe Christi; sehr sorgfälig behandelte Vegetation, Anfang 16. Jahrh. Zwischen dieser und der folgenden Kapelle 2 Rotmarmorgrabplatten: 1. Kitter Wilhelm Lew 1693 (aus der alten Franziskanerkirehe mit dem Relief des Verstorbenen in voller Rüstung); 2. Hofrat Karl Kheckh 1592 mit Kreuzigungsrelief, darunter die Sippe des Verstorbenen; tüchtige Arbeit.
12. Sendlinger-Kapelle mit Magdalenenaltar von Oberbaurat von Beischlag und A. Sickinger. An der Nordwand Grabmonumente:
- Bronzeepitaph des kurfürstl. Hoferzgießers Martin Frey aus Kempten 1603 (wahrscheinlich von Hans Krümper);
- Grabstein des Erbauers der Kirche, hier genannt „Meister Jörg von Halspach“ (bekannt als Jörg Ganghofer) und seine Frau Margaretha; Inschrift: „Ao Dom 1488 jar an mantag nach sanct michels tag starb maister jörg von Haispach maurer dis gotzhauss vnser lieben frawen, der mit der hilff gotz vnd seiner haut den ersten den mittln vnd den lösten stain hat volfuert an disem pau. der lait hie pegraben vnd Margret sein eelichc hausfrav. den got genadig sei“; unten Schild mit seinem Meisterzeichen.
- Bronzeepitaph von Hans Krümper 1600 für Dr. Jakob Burkhard mit vierteiligem Relief der Kreuzabnahme (liebreizende Englein bedienen den Leichnam) und des Verstorbenen.
- Bronzeplatte für Joh. Christoph Thanner von Thann 1665. 5. Brouzeepithaph in Kartuschenumrahmung des Gg. Lautherius 1602.
Neben dem Baumeister Jörg- Grabmal die Brustbilder des Zimmermeisters Heinrich (oder Heimeram) und des Baumeisters Jörg, beide Tafelgemälde in Oel: vielleicht stark übermalte Originale, wahrscheinlicher jedoch Kopien des 18. Jahrh. nach den früheren Originalen.
Unterm Fenster Relief der hl. Dreikönige, 2. Hälfte 16. Jahrh. Am Bogen zum großen Westportal Grabstein des Kanonikus Abraham Ridler 1580. Darüber ein Bild J. Sandrarts um 1670 „Johannes der Täufer und die hl. Cäcilia, im Hintergrund Münchens Marienplatz“; gegenüber St. Rupert von Andr. Wolf um 1700; darunter Kotmarmorgrabstein des Kanonikus Alex. Andorfer 1611 mit seinem Bild in einer Pilasternische; tüchtige Arbeit.
Hanptportal des Domes: das „Lieblfrauentor“; darüber Totenschilde der Patrizier Ligsalz, Gießer und Riedler. — In der Halle jenseits des Hauptportals an der Wand Grabmal des ersten Erzbischofs von München- Freising, Lothar Anselm Freiherrn von Gebsattel 1846, von Ludwig Schwanthaler 1848. Gegenüber Missionskreuz der Jesuitenmission 1866. Im Bogen zur Kapelle Rotmarmorgrabstein des ersten Propstes der Frauenkirche Dr. Joh. Neuhauser 1516, „im Stil und im bescheidenen Ornament noch spätgotisch, und dadurch allerdings altertümlich und hinter der Entwicklung seiner Zeit zurückgeblieben; statt des sonst üblichen Porträts des Verstorbenen ein Relief mit einem Skelett, durch das sich eine Schlange windet und neben dem Kröten und allerlei Ungetier sitzen (wie dies auch sonst im 15. und 16. Jahrh. in Südbayern mehrfach zu finden): über dem Skelett eine umfangreiche Inschrift, unter ihm ein Jüngling mit Spruchband und ein Wappen [RM].
Ferner Grabmale für die Kanoniker Eisenreich 1584 und Wagenrieder 1567. Darüber eine von Hans Mielich 1554 für den berühmten bayerischen Kanzler Dr. Leonhard von Eck gefertigte Kopie des „Jüngsten Gerichtes“ von Michelangelo (Eck ist unterhalb mit seiner Frau kniend dargestellt).
13. Tulpek- Kapelle mit Mariahilf-Altar von J. Wirth 1863. Im Schrein das von Bischof Tulpek, dem einstigen Pfarrer an der Frauenkirche, 1475 gestiftete Mariahilfbild, eine bemalte Holzfigur: Maria hält das Kind auf ihrem linken Schoß, neben ihr kniet der Stifter, hinter ihr breiten 2 Engel den Vorhang aus; „ein tüchtiges und für die Zeit charakteristisches Werk: unbefangen und freundlich sieht das frische anmutig bewegte Kind, das seine Beinchen auseinanderschlägt, zum Beschauer herab und segnet ihn; seine vollen, weichen Formen sind gut verstanden; die Falten des Gewandes und besonders des Mantels der Maria sind von einfachem Zug — an den schlichten Stil der 1. Hälfte und Mitte des Jahrhunderts erinnernd, der das Detail noch wenig beachtet, das bei diesem Mantel nur unter dem rechten Arm in kleinern, meist scharfen Brüchen bestimmter betont wird; die weich über die Schulter fließenden Haare sind noch schematisch und ohne Empfindung; der Kopf mit den gesenkten, nur wenig geöffneten Augen kommt wegen der geringen Durchbildung über einen allgemeinen liebenswürdigen Ausdruck nicht hinaus [RM 413], Zu beiden Seiten St. Elisabeth als Gräfin mit Kanne und Brotkorb und Agnes mit dem Lamm, treffliche Arbeiten um 1500. In der Predella Oelgemälde auf Holz „Grablegung Christi“, links ein Kanonikus als Stifter; Münchner Schule um 1580. Oben in einer Nische Holzfigur St. Friedrich, gute Arbeit 18. Jahrh. Neben dem Altar Tulpeks Grabstein 1476, interessant wegen seines sorgfältig und gewandt ausgeführten Reliefbildnisses des Verstorbenen: „der Grund der Platte wie auch das Kissen, auf dem das Haupt ruht, sind durch gotische Ranken und Blumen schön gemustert, die Leinwandstickerei der in feinen Falten auf den Boden fallenden Albe sind (in der üblichen Miniaturtechnik) sorg- fältigst wiedergegeben und sehr fein sind die auf den Rand des Mantels gestickten Heiligen ausgeführt ebenso wie die Verkündigung auf der Mitra und die Goldschmiedearbeit (das Kruzifix auf der Brust, die eleganten Mantelschließen und der schöne, spätgotische Bischofsstab); feine Beobachtung und gewandte Ausführung zeigt das Tulbekrelief aber keineswegs nur in Aeußerlichkeiten, sondern diese entfalten an ihm auch in der Charakteristik ihre ganze Bedeutung und zwar beim Kopf, dessen hagere Wangen, tiefgefurchten, ernsten und bedeutenden Züge ein treues Bild des ehrwürdigen Kirchenfürsten aus den letzten Jahren seines Lebens geben“ [KB]. In der Mitte der Taufstein.
In der Ecke die sogen, „kunstreiche Uhr“ aus dem 16. Jahrh.; 2 Löwen schlugen die Stunden und Viertel; bei jedem Stundenschlag wollte Gottvater das Strafschwert über die sündige Welt zücken, aber Jesus und Maria streckten ihm gnadeflehend die Hände entgegen, und das Schwert sank wieder in die Scheide; zugleich bewegten sich oben in einem Türmchen Figuren, öffneten den Mund und bewegten die Hände, als predigten sie Buße nach allen 4 Weltgegenden ; auch eilte dann, als warnendes Beispiel menschlicher Schwäche, St. Petrus vom Feuer des Vorhofes, wo er den Herrn verleugnet hatte, während über ihm der Hahn krähte und mit den Flügeln schlug, auf der andern Seite aber der Herr vom Verhör bei Kaiphas kam und den Verleugner liebevoll anblickte.
Unterm Fenster altes Relief „Tod Mariens“. — Am Pfeiler zwischen dieser und der nächsten Kapelle unterm Wappen des ehemaligen Kollegialstiftes Terracotta-Relief „Christus am Oelberg“ um 1500; darunter feingearbeitete Grabplatte für den Mailänder J. P. Bianchi 1615 mit Relief der „Krönung Maria“; gegenüber Grabmal des Kanonikus P. Pronner 1678 mit dessen Relief in Pilasternische. Am selben Pfeiler im Schiff Gemälde „Christus unter den Aposteln“; darüber Ligsalztotenschild 1608.
14. Appollonia-Kapelle mit dem Andreas-Altar von 1513, dem einzigen Altar der Kirche aus dem 16. Jahrh., von dem noch erhebliche Beste vorhanden sind (aus der Nikolauskirche am Haberfeld, die 1582 dem Neubau der Michelskirche wich); im Schrein recht geschickt ausgeführte Statuen St. Basso (oder Herzog Sigismund im III. Orden-Skapulier [FS 38], der den Altar stiftete? [KB]) und Onuphrius; ersterer im Harnisch mit Barett und Lanze, das Skapulier umgehängt, letzterer gekrönt, im härenen Gewand mit Mantel und Stab; in deren Mitte St. Andreas, modern. Im modernen gotischen Aufsatz Holzfigur St. Katharina mit Schwert und Palme. Auf den Standflügeln Reliefs von St. Rasso (Sigismund) und Onuphrius. Auf den kleeblattförmig abgeschlossenen beweglichen Flügeln 4 Tafelgemälde aus der Andreaslegende; rechts: an reich besetzter Tafel ein Bischof und eine Frau; ein Jüngling öffnet dem Heiligen die Tür; darunter: Andreas wird im Beisein eines Fürsten mit Gefolge mit einem Stock geschlagen; links: Andreas, vor dem Betpult kniend, wird von einem Häscher ergriffen, seitlich ein Fürst im Hermelinmantel mit Gefolge; d at unter Kreuzigung des Apostels. An den Flügelaußenseiten 4 Passionsreliefs (Oelberg, Gefangennehmung, Dornenkrönung, Kreuztragung). Die Reliefs des derben charakteristischen Onuphrius und besonders Bassos „sind für die Zeit bezeichnend namentlich auch im kleinlichen Gewand; bezeichnend ist aber auch, daß ein eigentlicher Fortschritt gegenüber dem 15. Jahrh. nirgends erzielt wird, daß nur alte Geleise weiter ausgetreten werden, daß gerade das Beste eng mit der ältern Kunst zusammenhängt, ihr gegenüber aber nicht fortschreitet wie etwa die beiden Genrefiguren links im Hintergrund der Geißelung oder die edle Auffassung Christi bei der Kreuztragung“ [RM], An der Predella schönesTafelgemälde der „Verkündigung“. An der Wand große Votivtafel „Mariä Schutzmantel“, 1554 von Kanonikus Nik. Sänftl gestiftet, „Hauptbild der Münchner Schule jener Zeit“, stark übermalt; Maria im blauen Ehrenkleid hält mit beiden Händen den weißen, rotgefütterten Mantel, der auch noch von 2 Engeln emporgehalten wird; links unterm Mantel 12 Vertreter des Klerus, rechts 12 Laien mit einem Kind; zu Häupten Mariens halten 2 Engel die Krone; in den Ecken je eine Gruppe geflügelter Engelsköpfe; das sogen. „Wahrzeichen“ des Bildes (die Frau, die allein mit gesenkten Händen betet) — der Frau, die in Erbangelegenheiten meineidig geschworen habe, soll es die betenden Hände nach abwärts gezwungen haben — ist nicht eine Frau, sondern ein Mann; unten am Rand der Stifter und seine Sippe; der mildschöne Madonnentypus ist für Oberbayern besonders charakteristisch und verkündet schon die hereinbrechende Renaissance. Grabstein des Kanonikus Franz Tichtl 1520 mit dessen Ganzfigur in einer Nische; im bekrönenden Rundgiebel Maria mit dem Kind und 2 Engel mit den Leidenswerkzeugen. Gegenüber Statue des hl. Antonius von J. Knabl. Im Fenster oben Leidenszenen des Herrn, unten der bethlehemitische Kindermord. — Zwischen dieser und der nächsten Kapelle das „St. Sixtusportal“. Darüber Bischof St. Ulrich zwischen 2 kleinern Bischofsstatuen; treffliche Arbeiten Ende 15. Jahrh. Aus der alten Kirche Weihwasserkessel mit Wappen und Jahreszahl 1447.
15. Barthkapelle ausgestattet 1866 von der freiherrlichen Familie Barth auf Harmating. Altar von Foltz, mit dem Altarbild aus dem ältern Altar „HL Dreikönige“ von Ulr. Loth um 1620; halbrund abgeschlossenes Tafelbild; oben schwebende Engel in Flachrelief (modern): links Maria, neben ihr ein Korb Wäsche für das Kind, von rechts her die 3 Könige; bei ihnen ein Hund. In der Predella Brustbilder von 6 Heiligen von Christoph Schwarz. 3 Marmorgrabplatten der Barth: 1. Balthasar Barth 1528, mit Wappen; unterer Teil zu einer Grabschrift für Anton Barth 1763 umgearbeitet; 2. Georg und Margaretha Barth 1566; Oelbergrelief mit den nahenden Häschern; Wappen in wreißem Kalkstein; zwischen den Patronen St. Georg und Margareth die Familienangehörigen; zu Seiten kleine Ahnenwappen; 3. Kanonikus Gabriel Barth 1600; oben Relief des Gekreuzigten, links der Verstorbene knieend, unten Wappen. Im Fenst er 4 alte Glasgemälde (Christi Geburt, Hl. 3 Könige, Darstellung Jesu im Tempel, Tod Mariens in eigenartiger Bandumrahmung; oben Wappen der Patrizier Giesser.
16. Herz Mariakapelle (früher genannt „zur hl. Maria von der Rosen“. Altar 1863 von J. Werth, mit Teilen eines ältern Altars; zu Seiten des Schreins 12 alte Apostelfigürchen vom späten 16. Jahrh. (stark restauriert), ausgezeichnet durch große Milde in den Gesichtszügen, im Schrein Statue „Maria vom Siege“, gleich den übrigen Figuren von L. Blaim. Ueber dem Beichtstuhl Holzrelief „Mariä Himmelfahrt“ vom vorgerücktem 16. Jahrh.; wohl nicht aus Syrlins Werkstätte in Ulm. Votivbild von L. Ittenbach 1876, gestiftet von R. v. Oberkamp S. J. Rotniarmorgrabmal mit Relief eines geharnischten Ritters 16. Jahrh. (ohiie Inschrift), vielleicht aus der Familie Weil- brecht. Im Fenster neues Glasgemälde von Jos. Scherer.
17. Bennokapelle. Altar in Eiche, entworfen von Foltz; Bennostatue und Predella Relief (Kurf. Maximilian verehrt mit der Geistlichkeit und Bürgerschaft Münchens den hl. Stadt- und Landespatron) von Foltz; im Altar das alte, silbergezierte Bennoreliquiar. Grabstein des ersten Stiftsdekans Dr. Balth. Hundertpfund 1520, der beste der Reliefsteine dieser Kirche aus jener Zeit, von der neuen Kunstweise der Renaissance noch gar nicht berührt; ein eleganter spätgotischer Rahmen umschließt das Relief, in dem oben eine anmutige Maria tront, dem Kind eine Birne reichend, unten der lebendig erfaßte betende Dekan kniet: abgesehen von dem besonders im Kopf verunglückten Kind eine sehr tüchtige Arbeit spätgotischen Stils [RM], Davon links interessantes Oelgemälde auf Kupfer der Legende des hl. Benno in 15 Szenen Ende 17. Jahrh. Votivbild der Stadt Braunau, aus Anlaß von Kriegs- und Brandnöten 1747 und 1752. Darüber (in modernem Schrein) als Bennoreliquien dessen Inful, Stab und Meßgewand. Zu beiden Seiten wächserne, bronzierte Knabenfiguren (früher am Bennobogen): die Söhne des Kurf. Maximilian I. aus 2. Ehe: Ferdinand Maria (4 Jahre) und Maximilian Philipp (6 Jahre). Im Fenster neutestamentliche Szenen, darunter eine „Verkündigung“, ursprünglich aus dem merkwürdigen Fenster der Barthkapelle.
18. Kapelle der Schmerzhaften Mutter. Altar von Foltz; im Schrein ältere „Schmerzhafte Mutter“, vielleicht von Tobias Baader. Ueber dem Beichtstuhl das frühere Altarbild „Christus am Kreuz“, stark nachgedunkelt, wahrscheinlich Kopie nach van Dyk. An der Fensterwand 5 Bestandteile des ehemaligen Priesterbundbegräbnisses mit trefflichen Bronzereliefs von hohem künstlerischen Wert aus der Werkstätte Hans Krümpers: 1. Inschrifttafel mit dem Gründungsjahr 1620 ; 2. und 3. Marmortafeln mit aufgesetzten Bronzekartuschen; darauf 2 Priester mit Kelch und Hostie unterm Schutzmantel Mariens und der Dulder Job; 4. Bronzefigur des hl. Apostels Johannes (des Bündnispatrons), 5. Bronzefigur des Propheten Enoch. Im Fenster Martyrium des hl. Sebastian und der hl. Agnes. — ,,St. Bennutor“, das fünfte und letzte Kirchenportal; darüber zwischen Totenschilden die überlebensgroße bemalte Holzfigur St. Christophorus mit dem Jesuknaben auf der linken Schulter (früher im Pütrichkloster); treffliche Arbeit um 1500 (vgl. unten zu den Figuren St. Georg und Rasso in der „Annakapelle“). Weihwasserbecken 1516 mit Wappen Dr. Joh. Neubauers, des ersten Stiftspropstes, zu dessen Grabstein es ursprünglich gehörte.
Ueberm Sakristeieingang das frühere Hochaltargemälde von Peter Candid 1620 „Mariä Himmelfahrt und Krönung“ in überlebensgroßen Figuren: Maria schwebt auf einer von vielen Engeln getragenen Wolke stehend aus dem Grab empor und wird von Christus gekrönt; darüber der hl. Geist, zu Seiten anbetende Engel; unter diesen Gruppen von Seligen, darunter Adam und Eva. Am Strebepfeiler Grabmal des Erzbischofs Gregor von Scherr 1877, von P. Seyer; gegenüber großes Epitaph des Stiftsdekans Phil. Tobereiner 1577: in den Hauptteilen aus Holz hergestellt, bildet die Umrahmung zu einem großem, figurenreichen Gemälde der „Kreuztragung“ (im Hintergrund die Schädelstätte und Jerusalem, darunter kleineres Gemälde „Abschied Christi von seiner Mutter“, links der knieende Stifter); Meister „jedenfalls Hans Mielich“ [KB]; als Bekrönung eine „Kreuztragung“ in bemalten Vollfiguren; neben dem Hauptbild bärtige Apostel, über ihm Christus in der Rast; unten die Embleme des Todes.
19. Dreifältigkeitskapelle mit Altar von J. Knall, gestiftet 1862 von Dr. Herenäus Haid. Ihm gegenüber altes Altarblatt „Kreuzauffindung“ in figurenreicher Komposition, treffliche, auch koloristisch bedeutende Arbeit des Mathias Hager um 1625: links neben der Grabstelle der vom Tod erweckte, rechts die Kaiserin Helena, im Hintergrund Jerusalem. An der Fensterwand — neben dem modernen „Karl Borromäus“ — gute Holzfigur St. Barbara um 1520: in den Grundzügen der Draperie noch spätgotisch, jedoch schon rundliche, wirkungsvolle Faltenbehandlung. Am Altar von einem ältem Altarwerk 2 Flügeln: innen die Reliefs der Apostel Simon (mit der Säge) und Jakobus (mit dem Pilgerstab), außen die Anbetung der hl. Dreikönige: tüchtige, aber stark überarbeitete Malerei um 1550. An der Nordwand das vom Kurf. Karl Theodor durch Benjamin Ritter Tompson (Graf Rumford) 1790 errichtete Denkmal der „Wohltäter des Münchner Armeninstituts“ mit dem Sandsteinrelief „Verteilung von Gaben an die Armen“ von Schwanthaler sen.
20. Annakapelle mit Altar von L. Foltz, 1865 gestiftet von der gräfl. Familie Preysing-Moos; im Schrein treffliche Holzgruppe der Anna Selbdritt Ende 17. Jahrh.; in der Predella 6 Brustbilder weiblicher Heiliger, sehr gutes Werk Peter Candida um 1620 (früher am Arsatiusschrein); dahinter (verdeckt) die reich gefaßten Reliquien der hl. Christina. Ueber dem Beichtstuhl „Kreuzabnahme“ von Roh. von Sänger um 1380. Unterm Fenster Marmorgrabsteine der hier ruhenden Preysinger (Maria Anna, geb. von Rechberg 1721, und Maria, geb. Auer von Tobel). Darüber auf dem Gesims die überlebensgroßen Figuren St. Ras so im Harnisch und mit der bayerischen Fahne, und St. Georg mit dem Drachen (wahrscheinlich aus dem alten Pütrichkloster), gleich St. Christophorus (s. oben beim Bennotor) prächtige Beispiele für den eigentümlich manierierten Stil der ersten Hälfte des 16. Jahrh.: bei diesen Statuen läßt sich von Errungenschaften des 16. Jahrh. reden wie bei keinem andern Werk dieser Zeit in München; ein wirklich großer Sinn spricht aus diesen (3) Statuen, die so frei und sicher dastehen: triumphierend tritt Georg auf den erlegten, schrecklichen Drachen, dessen eine Vordertatze er in der Rechten hält, während die erhobene Linke die mächtige Lanze seitwärts stellt, deren Fuß sich in den Drachen gebohrt; Georg ist der jugendliche Held, noch bartlos, sein Gesicht mit Locken umrahmt, in denen der Wind spielt : aber ist doch nicht mehr der zarte Jüngling, wie ihn das späte 15. Jahrh. gern bildete, sondern von männlicher Kraft erfüllt; diese Kraft spricht aus der freien, sichern Haltung und aus den scharf geprägten Gesichtszügen, die sagen, daß der Held schon manchmal gekämpft und auch vieles in sich durchgerungen hat. Rasso dagegen, der rechts das Banner hält und mit der Linken den Schild auf den Boden stellt, ist nachdenklich und ernst: seines Zieles sich klar bewußt, steht er ruhig und fest vor uns gesenkten Blickes; reiche Locken und ein voller, gekräuselter Bart schmücken den Kopf, dessen verwittertes, durcharbeitetes Antlitz einen Streiter erkennen läßt, in dem das rauhe Leben tiefes Empfinden nicht erstickte. Beiden Rittern steht (entwicklungsgeschichtlich) St. Christoph nahe: daß er jedoch ein Werk desselben Meisters ist, steht nicht sicher; er schreitet fest und stützt sich mit hocherhobener Rechten auf dem Baum, den er als Stab herausgerissen, der unten noch die knorrigen Wurzeln hat und oben ein paar dürre Aeste; auf der linken Schulter des Eremiten sitzt das Christuskind, das mit der Linken in Christophs zottigen Bart greift, die Rechte erhebt; der Wind weht des Kindes Mäntelchen in die Höhe und spielt mit dem über die Schultern geworfenen langen Mantel Christophs, der seine Rechte ausspreitzt, als suchte er nach einer festen Stütze. Die alte Freude am Detail kann der Künstler nicht ganz verleugnen, wenn sie manchmal auch mit dem großen, kecken Wurf des Ganzen in Widerspruch tritt wie bei Christophs Mantel oder beim wehenden Gewand Georgs, das er aus Freude an malerischen wirkungsvollen Motiven aufrollt, als ob der Sturmwind hineinblase; die sichere Beherrschung der Formen infolge gediegenen Naturstudiums, der freie Vortrag, die scharfe und tiefe Charakteristik dieser Figuren zeugen aber glänzend von dem großen Können, den bedeutenden Gedanken, dem tiefen Empfinden des 16. Jahrh. und von dessen gesteigertem Leben! am auffälligsten zeigt dies der stark bewegte Christoph mit dem kühn behandelten, wehenden Gewand, tiefer aber spricht es aus den Charaktern der ruhigen, jedoch fest auftretenden Ritter Georg und Rasso“. [RM[. Ueber ihnen das Preysing-Wappen. — Ueber dem Eingang zur alten Sakristei 2 bemalte Altarflügel vom „Memminger Altar“ (s. „Altöttingerkapelle), von Claus Strigel 1500: St. Achatius im Fürstengewand, Oberkörper im Harnisch, Fahne in der Rechten, ein dürres Reis in der Linken; darüber ein Engel; daneben Papst Urban mit Trauben. Darüber 3 Ligsalz-Totenschilde vom 15. und 17. Jahrh.
21. Auferstehungsaltar, gewaltiger Flügelaltar, entworfen von L. Foltz, gebaut von A. Sickinger, gestiftet 1856 vom Magistrat München, Die Auferstehungsgruppe, sowie St. Fabian und Sebastian von Prof. Max Widmann; an der Außenseite der Flügel Bilder vom „Memminger“ (s. Altöttingerkapelle) des Claus Strigel 1500; St. Martin als ritterlicher Jüngling, den weiten grünen Mantel mit dem Bettler teilend (darunter Halbfigur eines Engels und die Leidenswerkzeuge); andrerseits St. Georg in voller Rüstung, mit beiden Händen die Lanze in den Rachen des Drachen stoßend (darunter ein Engel in Halbfigur).
Im Fenster sehr bemerkenswerte alte Glasgemälde: Erscheinung des hl. Michael und Martyrium des hl. Sebastian. Gegenüber an der Wand eine Marmortafel mit Inschrift, dem einzigen Rest von einem sehr prunkvollen Grabmal des Stiftspropstes Wilh. von Bettendorf 1766.
Das Kaiser Ludwig-Mausoleum, „unstreitig das bedeutendste Kunstwerk der Kirche und das ehrwürdigste Grabmonument Münchens“ [KB]; es ist zusammengesetzt aus einem altern Teil, (der Marmordeckplatte einer Tumba von 1490) und einem jüngern (dem Grabgehäuse aus schwarzen Marmor und Bronze von 1622), stammt also aus den 2 Perioden, die in gleicher Weise den Ruhm beanspruchen können, für die künstlerische Ausschmückung der Frauenkirche maßgebend gewesen zu sein: aus der Spätgotik und Spätrenaissance. Ludwig IV. der Bayer, Herzog von Bayern und zugleich der erste deutsche Kaiser aus dem Hause Wittelsbach, starb 1347 anläßlich eines Jagdausfluges bei Fürstenfeld infolge eines Schlaganfalles. Seine Leiche wurde in der alten Frauenkirche beigesetzt, wo bereits seine erste Gemahlin Beatrix ruhte; 1490 wurden seine Gebeine in die Fürstengruft der neuen Frauenkirche übertragen und es ließ ihm Herzog Albrecht V. am Chore westlich vom Kreuzaltare ein prächtiges Grabmal (wahrscheinlich ein „Hochgrab“, dem der Marmorstein als Decke diente) zugleich im Sinne eines Familiendenkmals (für die in der Fürstengruft beigesetzten Nachkommen) errichten. Das Relief, „gemacht von Meister Hanns dem Steinmeissel“ ganz in des Erasmus Grasser Art (vgl. seme Grabsteine des Dekan Aresinger und Ritters Bötschner in der Beterskirche), verherrlicht die Versöhnung zwischen Herzog Ernst und dessen Sohn Albrecht III. gleichsam unterm Schutz und Schirm des großen Ahnherrn Kaiser Ludwig: 1453 ließ nämlich Herzog Ernst die heimliche Braut Albrechts, Agnes Bernauer, in der Donau ertränken, und es wäre wohl zur Fehde gekommen, hätte nicht Kaiser Sigismund vermittelnd eingegriffen; Herzog Ernst ernannte seinen Sohn zum Mitregenten, und Albrecht vermählte sich auf Wunsch des Vaters 1456 mit Anna von Braunschweig — diese Versöhnung wird auf dem Denkmal gefeiert. Die Marmorplatte selbst ist in 2 Felder geteilt; im obern thront voll Hoheit und Machtbewußtsein Kaiser Ludwig, der Begründer der durch die Versöhnung neugesicherten wittelsbachischen Einheit und Macht; hinter ihm halten 2 Engel einen reichgemusterten Teppich hoch; in der Rechten hält Ludwig das Szepter, in der Linken den Reichsapfel; sein Haupt trägt eine spätgotische, hohe Laubkrone, seinen mächtigen Kaisermantel ziert reiche Stickerei. An der gut profilierten Platte, die dieses Relief vom untern scheidet, sind das bayerische und pfälzische Wappen angebracht und dazwischen das des Reichsadlers mit den bayerischen Rauten als Herzschild. Im untern Feld schreitet Herzog Ernst in fürstlicher Hoftracht (in pelzbesetztem weitärmeligen Ueberrock über dem glatten enganschließenden Wams, das Baret auf dem Haupt) mit ausgebreiteten Armen zu freundlichem Empfang auf den in voller Rüstung, gepanzert mit dem maximilianischen Plattenharnisch, dastehenden jungen Albrecht zu; seine Linke ruht am Schwert, die Rechte faßt des Vaters dargebotene Hand. Zwischen beiden Fürsten zeigt sich der wittelsbachische Löwe, halb in stilisierter Heraldik behandelt, der gleichsam hocherfreut über die Versöhnung — am jungen Albrecht schmeichelnd emporspringt. Der Boden, auf den die Fürsten stehen, ist mit zierlich gemusterten Platten belegt, in denen vor deren Füßen ein A und E als Anfangsbuchstabe ihrer Namen steht; als Hintergrund dient wieder ein mit gotischen Ranken hübsch gemusterter Vorhang. Von besonderm Interesse ist das Porträt Kaiser Ludwigs vor allem dadurch, daß es kein willkürliches Bildnis ist, sondern die Züge des vor etwa anderthalbhundert Jahren Verstorbenen getreu wiederzugeben bestrebt ist; auch die Herzoge Ernst und Albrecht sind, wie der Vergleich mit andern Darstellungen zeigt, wirkliche Porträtbildnisse. „Die Ausführung des Denkmals ist äußerst sorgfältig; prächtig modelliert sind die Köpfe, zumal der des Kaisers mit reichem gekräuseltem Haar; die Hände sind gut durchgebildet; sehr sorgfältig ist auch alles Beiwerk ausgeführt wie die reiche Stickerei des Mantels, die elegante fein gegliederte Rüstung Albrechts, die hübschen Muster der Teppiche und des Grundes; die Drapierung, in den Hauptmotiven wohl verstanden, ist charakterisiert durch einen großen Zug trotz feiner Einzelheiten, w'odurch gute stoffliche Wirkung und individueller Verlauf der einzelnen Falten gewonnen wird — die aber nur selten, etwa beim Aermel des Herzogs Ernst, etwas kleinlich werden [RM]“. Die Inschrift der um den Stein sich windenden Banderolle besagt, daß „Herzog Albrecht der Junge“ (Albrecht IV.) dieses Denkmal habe setzen lassen für den Kaiser und Nachkommen: Johann, Ernst, Wilhelm, Adolf und Albrecht.
Schon etwa 60 Jahrenach Aufstellung dieses Grabmals faßte Albrecht V. den Plan, dem „ersten Wittelsbacher Kaiser“ zu Ehren ein ein neues prächtigeres Dynastenmonument zu errichten. Jedoch erst unter seinem Sohn Wilhelm V. wurden die Vorarbeiten hierzu begonnen, 1595; dieser aber hatte dabei ohne Zweifel das große Habsburger Prachtmonument [Grabmal des Kaisers Maximilian I.] in der Innsbrucker Franziskanerhofkirche (ein Werk nach dem Entwurf des Meisters Konrad Peutinger aus dem nahen Augsburg) vor Augen (mit seinen 4 allegorischen Erzstandbildern an den Ecken und den 28 Bronzestatuen der Habsburger Ahnen); „wie die Alten bei der Totenfeier die Ahnenbilder um die Bahre aufstellten, so war auch für die Renaissancefürsten das Grabmal der Mittelpunkt ihrer dynastischen Denkmalsstiftungen, die heutzutage im stattlichen Bilderreigen einer „Siegesallee“ vorgeführt wird [W 115]“; unser Mausoleumstyp in Form einer überirdischen freistehenden Grabeskammer („castrum doloris“) mit dem liegenden Steinbild des Toten darin findet sich zuerst in den romanischen Ländern. Wilhelms Sohn Kurfürst Maximilian I. erst konnte den Plan vollständig ausführen: 1622 wurde die Stein-Tumba entfernt, die Deckplatte mit dem Bildschmuck des Kaisers an die vornehmste und einzig passende Stelle am hohen Chor im Mittelpunkt vor der Treppe verbracht — erst seit 1891 steht das schönste und und kostbarste Grabmal der bayerischen Residenzstadt im düstersten Winkel der Domkirche — und darüber das Grabgehäuse nach dem Entwurf P. Candids errichtet. Für den Entwurf waren wohl maßgebend die schon vorhandenen Bestandteile des wilhelminischen Grabdenkmals aus der Michaelskirche: durch die 4 Wächter und wahrscheinlich auch durch die Standbilder der beiden Herzoge Wilhelm IV. und Albrecht V. in der festlichen Ordenstracht des goldenen Vließes, die schon 1603 und zwar in der Werkstätte des Dionys Frey aus Kempten entstanden; gleich allen andern Arbeiten der frühen wilhehninisch-maximilianischen Epoche haften auch diesen Freifiguren die charakteristisch-modischen Züge einer gezierten Befangenheit in der Bewegung und Haltung an, für die die Präzision und der Beichtum der Ornamente und Zierarten nicht immer entschädigen kann; aber innerhalb dieser Grenzen atmet alles den großen Zug einer musterhaften Arbeit; als Gußwerk verdient die Feinheit der Ziselierung und die vollendete Bravour der Metalltechnik höchstes Lob. Das Grabgehäuse selbst ist aus schwarzem Marmor und dunkler Bronze: die sepulkrale Plastik hielt damals die düstern Farben des Materials zum Ausdruck der Trauer für notwendig. Ein Sockel mit durchbrochenen Seitenfeldern läßt den Blick auf den Grabstein frei, als läge dort im Zwielicht der Gruft der Tote selbst auf der Bahre; darüber wölbt sich ein Aufsatz gleich einem Sarkophagdeckel, der in der Mitte auf dem Kissen die Kaiserkrone trägt. Die Inschrift (am Kranzgesims) sagt, daß das Denkmal Ludwig IV., dem Kaiser des römischen Reiches, gewidmet sei: dieser Idee dienen die als Hüterinnen der Krone gedachten allegorischen Gestalten der „Waffenmacht“ im Kriege mit Schild und Schwert und der „Regierungsgewalt“ mit Szepter und Reichsapfel, die geflügelten Genien mit dem kaiserlichen und bayerischen Wappen und die an den 4 Ecken knieenden Wächter mit Standarten, die mit den Wappen und Namen Ludwig des Bayern und seiner (2.) Gemahlin Margaretha, ferner Karl des Großen, Ludwig des Frommen und Karl des Dicken sowie ihrer Gemahlinnen ausgestattet sind. Der Entwurf zu den Bronzen von 1622 stammt „wahrscheinlich [W 1. c.]“ von Hans Kruumper; von den vier Wächtern hat die ganz im Dunkeln vor dem Portal stehenden Hubert Gerhard modelliert.
Uebrige Ausstattung. Am Gewölbe in der Mitte herabschwebend Joh. Halbigs kolossales Kreuz. Aus der Sickingerschen Werkstätte die zierliche und zugleich stattliche Kanzel, gestiftet von König Max II. 1861. Der Kanzel gegenüber gotisches Fliigelaltärchen, im Schrein „Kreuzigung Christi“ mit den (etwas kleineren) Maria und Johannes um 1456; auf den Flügeln (etwas jünger) „Geburt Christi“ und „Tod Mariens“. Darunter Steinrelief „Mariä Verkündigung“, 2. Hälfte 15. Jahrh. Portale von Ign. Günther, 1772 in die alten gotischen Steinrahmen eingelassen (mit den Brustbildern Marias, St. Bennos, Arsatius, Sixtus und Donatus), ein hervorragendes Rokoko-Werk; besonders schwungvoll die karyatidenartig angeordneten Engel. Sakristei-Portal spätgotisch; spitzbogig und mehrfach profiliert; seitlich 2 Halbsäulen mit profilierten Kapitellen, denen Brustbilder von Engeln mit Spruchbändern vorgelegt sind; darüber hohe Fialen; zwischen diesen ein Kielbogen, der den Spitzbogen der Türe umschließt, mit Krabben besetzt und in eine Kreuzblume auslaufend. In der „alten“ Sakristei Netzgewölbe. — An den Gewölbeansätzen der Kapellen Köpfe mit Spruchbändern; leider in solcher Höhe, daß eine eingehende Würdigung derselben unmöglich ist, was deshalb bedauerlich ist, weil sie wohl der Ausgangspunkt jener Dekoration sind, die uns in den von Münchner Meistern erbauten Landkirchen wie Untermenzing, Pipping, Eggeiburg, Hohenlinden und Ebersberg (vgl. „Münchens Umgebung in Kunst und Geschichte“ vom gleichen Verfasser) oft so charakteristisch begegnen. Sonstige Bildwerke im Innern: Im Westteil des Schiffes „St. Ulrich“ und „Nikolaus“, treffliche Holzskulpturen aus der Erbauungszeit der K;rche; in den Grundzügen der Drapierung noch spätgotisch, zeigen sie in den sehr charakteristischen Köpfen und Gewänderfalten bereits die malerische Empfindung des 16. Jahrh. Am Ostportal der Nordseite Pfeilerfigur der „Maria auf dem Halbmond“, gekrönt, mit lang herabwallendem Haar; streift in ihrem weichen, stark geknäuelten Faltenwurf schon etwas an Manier, die seit 1520 recht häufig wird. Figur, weil auf dem Halbmond schwebend, stark bewegt. Holzfigur in Steinfarbe; tüchtige Arbeit um 1520. Zwischen der alten und neuen Sakristei „St. Katharinas Enthauptung“; Engel halten den Leichnam und tragen das Haupt gegen Himmel; prächtige, farbenglühende Komposition. — Glasgcmälde (s. bei den einzelnen Kapellen): Die erhaltenen alten Galsgemälde der Frauenkirche sind hervorragende Arbeiten der Münchner Schule und bilden den Hauptteil der erhaltenen Werke; da zudem 1490 ein großes Teil davon aus der alten Frauenkirche übernommen worden ist, erhalten wir einen Ueberblick über die Zeit von 1400—1520. Jedoch waltete über diesem kostbaren Kirchenschmuck ein besonderer Unstern; sowohl bei der Reinigung der Fenster als auch bei der Restauration 1864 behandelte man dieselben mit größter Willkür: nicht nur daß in den einzelnen Fenstern Tafeln aus verschiedenen Fenstern und Zeiten ohne Zusammenhang eingesetzt wurden, sondern häufig bilden auch Figuren, Teile von Ranken und Maßwerk, Stücke von Wappen ein buntes Gemisch. Am besten erhalten sind noch die spätesten, übrigens auch reichsten Fenster im Chor. Merkwürdig ist es, daß sich bei den der Mehrzahl nach doch erst im späten 15. Jahrh. gefertigten Bildern eine sonderbare archaische Auffassung, im Gegensatz zur Tafelmalerei und Skulptur derselben Zeit, geltend macht; daher könnte man, wären die Daten nicht zwingend, leicht versucht sein, nicht nur die aus der alten Kirche stammenden Fenster vor die Mitte des 15. Jahrh. zu setzen, sondern auch jene in den Seitenschiffen. Die höchst wertvollen Fenster aus der alten Kirche sollen Arbeiten ..Martin des Glasers" und der beiden „Hans Gleißmüller“ sein ; für die Fenster des Neubaues war Egid Trautenwolf in Verpflichtung genommen; seine Farbe erreicht indes" die Aeltern nicht an Glanz und Feuer der Transparenz. — Türkenfahne, hoch oben an einem Pfeiler des Mittelschiffs, aus grüner Seide, mit goldgewirkten Inschriften und Verzierungen, von Kurfürst Max Emanuel als die schönste der im Türkenkrieg (Schlacht bei Griechisch- Weißenburg 1688 [FS]) eroberten 55 Türkenbanner hierher als Votivgeschenk gestiftet; Form fünfeckig; im obersten Drittel eine breite, querdurchlaufende Inschriftenborte; darüber in der Mitte ein Halbmond mit 5 Sternen und rechts und links eine Sonne; darunter an den Seiten große Sonnen, Halbmonde und Sterne; in der Mitte als Hauptbild der „Dhulfakar“ (Bild des in 2 Klingen auslaufenden Lieblingssehwertes Mohammeds). Auf den Saumborten die Koran-Sure: „Im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes 1 Außer ihm gibt es keinen, der ewig lebt, der immer da ist, der weder dem Schlaf unterliegt noch der Müdigkeit; ihm allein gehört alles, was im Himmel und was auf der Erde ist. Wer möchte es wagen, seine Wünsche ihm vorzutragen, wenn er es nicht erlaubt? Er weiß alles, was geschehen ist, ehe die Menschen waren, und alles, was nach ihnen kommen wird. Von der Wissenschaft, die er besitzt, haben die Sterblichen nie mehr erfahren, als ihm zu offenbaren beliebte. Sein Thron umfaßt den Himmel und die Erde; die Sorge, sie zu regieren, war für ihn nie eine zu schwere Last; denn er ist der allgewaltige hocherhabene Gott!“ Datum der Fahne: „Im Jahre der Hegira 1370“, d. i. 1662 unserer Zeitrechnung.
Teufelstritt. Durch den mächtigen Hochaltar-Aufbau Candids aus 1630 (1860 ersetzt durch den jetzigen zierlichen gotischen Aufbau) wurde für jene, die unter der Orgelempore ihren Fuß auf den in den Boden eingelassenen schwarzen (daher vielleicht der Name) Teufelstritt setzten, außer sämtlichen Seitenschiffenstern auch das Hochaltarfenster unsichtbar. Daran knüpfe sich folgende Legende [Tr 36]: Der böse Feind hat einen Pakt mit dem Baumeister gemacht und ihm Geld zu seiner Kirche gegeben — vorausgesetzt, daß man keine Fenster sehe; als nun nach der Vollendung des Baues der Teufel herbeikam und (schon von außen) die Fenster in großer Zahl sah, triumphierte er und sagte zur bestimmten Zeit zum Baumeister: „Die Zeit ist aus; nur her da und fort mit dir!“ Da hat aber der Baumeister gesagt: „Aber nicht, folge nur Du mir!“ Und er führte den Teufel durch das große Portal bei den Türmen in die Kirche hinein und stellte ihn hin an den Ort, von dem aus die Säulen alle Fenster bedecken. Ueber diese List ist der Teufel voll Zorn aufgeflammt, hat schauerlich geschrien und beim Davoneilen seine Fußspur zurückgelassen.
Aeußere Portalfiguren. Die Figuren, auch die von der alten Kirche übertragenen, gehören der Steinplastik an, der — weil die Frauenkirche ein konsequenter Backsteinbau ist, hier nur eine bescheidene Bolle zufällt. Die Skulpturen, die mit dem Neubau der Frauenkirche, also 1470—90 geschaffen wurden, sind nur Werke einer bescheidenen Lokalschule; das Wichtigte davon sind in der Leibung des Ostportals an der Südseite die Figürchen der 12 „Apostel“ mit Christus und Maria sowie den 5 weiblichen Heiligen und den 5 musizierenden Engeln (von denen je-doch mehrere erst der Restauration von 1858 entstammen) ; auch das kleine Relief mit „Herzog Sigismund“ im Pilgergewand, der zu Maria betet (oben an der Gedächtnistafel zur Grundsteinlegung) ist eine sehr schlichte und unbeholfene Arbeit [RM]. Rechts an der Wand Maria, zu einer „Verkündigung“ gehörend (der entsprechende Engel links ist modern) um 1480. Links oben in der Eingangshalle Tonfigur „Christus als Schmerzensmann“ mit Dornenkrone und Schurz, den reichgefalteten Mantel überm Arm; gegenüber „gekrönte Maria mit dem Kind“; beide sehr gute Arbeiten um 1430. Am Westportal (Südseite): links oben gekrönte „Maria mit dem (nackten) Jesuskind, rechts „Christus als Schmerzensmann“ vor dem an der Wand ausgebreiteten Mantel stehend, nur mit dem Lendentuch bekleidet; rechts an der Wand Hochrelief „Christus am Oelberg“, von Stabwerk umrahmt; links „Maria Verkündigung“: sämtliche Figuren gute Arbeiten um 1480.
Nordseite: Ueberm Ostportal links „gekrönte Maria mit dem Kind“, rechts „Christus als Schmerzensmann“ mit über die Schultern geworfenem Mantel und Lendentuch; wegen der eigentümlich geschwungenen Haltung der lebhaften Figuren interessant; um 1430. Am Westportal links „St. Jakobus“ als Pilger, sehr tüchtige Arbeit um 1500, rechts Holzfigur „St. Benno“ mit Tisch um 1480; links an der Wand „Christus am Oelberg“ Ende 15. Jahrh. — Grabmalplaslik an der Aufsenseite, beginnend an der Ostseite vom Bennobrünnlein aus [dieses sogenannt nach den Gemälden mit der „Uebertragung der(im 30jährigen Krieg geflüchteten) Bennoreliquien“ aus Salzburg nach München anläßlich der Pestzeit 1634]; die hervorragenderen Werke sind:
1. Epitaph für Kanonikus Richard Pettenbeck 1634 mit Kreuzigungsrelief.
2. Marmorepitaph für Lebzelter J. Scheyerl 1740; auf dem Relief kniet das Ehepaar vor dem Kreuz, dessen Stamm Magdalena umfaßt.
3. Familie Unertl 1788: Oelgemälde der Grablegung auf Kupfer in Marmorarchitekturrahmen.
4. Marmorgrabstein des Kaspar Weiler auf Garatshausen um 1580 mit der Auferweckung des Lazarus und den Familienangehörigen.
5. Marmorgrabplatte für Eustach Ligsalzl576 mit Hochrelief desselben inGanzfigur; über demWappen ein Totenschädel.
6. Marmorgrabplatte für den blinden Musikus Konrad durch einen NiirnbergerPaumann 1473. Dieser wurde [AM,Zusatz S.101] als Blindgeborner durch Wohltäter in der Musik ausgebildet, um 1446 Organist zu St. Sebald in Nürnberg, und reiste später an die Fürstenhöfe; auf dem originellen und lebendig, aber etwas derb ausgeführten Relief sitzt „wie ein ,Hieronymus im Gehäuse“ ein blinder alter Mann vor uns und spielt auf einer Handorgel; die Rechte gleitet über die Tasten, während die Linke bedächtig den Blasbalg auf- und niederzieht; den Kopf hat er — nach Art der Blinden — geneigt, als ob er den langen Tönen seines Instrumentes lauschte; Harfe und Laute, Flöte und Mandoline umgeben ihn als Attribute seiner Macht [W 49].“
7. Marmorepitaph der Maria Imhoff, Gattin des Bürgermeisters Ferd. Ligsalz, mit Bronzerelief der „Beweinung Christi“.
8. Monument mit (in 2 Kästen unter Glas ver-wahrten) Gemälden: „Christus in der Rast“ und „Dornenkrönung“ für Heinrich Vambes von Florimont, bay er. Generalfeldzeugmeister.
9. Marmorepitaph für- Seb. Bichler 1661 mit Relief „Christus und die Ehebrecherin“. — Fortsetzung an der Nordwand:
10. Marmorepitaph der Familie Högkh um 1661: im architektonischen Aufbau Relief des „Schutzmantelbildes Mariens“ mit der Familie des Verstorbenen.
11. Epitaph der Elisabeth Schötlin 1559 mit Auferstehungsrelief; darunter im Fries die Familie.
12. Monument für Hofkammerrat Jeremias von Delling 1703 mit Relief der „Krönung Mariens“.
13. Grabplatte für Petronilla Strohmeierin mit ihrer Ganzfigur in Relief: sie stützt sich auf den Ellenbogen, der auf einem Totenschädel aufruht; hinter ihr eine erlöschende Kerze.
Sakristei und Schatzkammer. In der hintern Sakristei unter früheren Altargemälden 1. Krönung Mariens, das Hauptwerk Rottenhammers, des letzten großem Vertreters der bayerischen Tafelmalerei; 2. Kreuzigung Petri, von einem Kapuzinerbruder; trefflich charakterisierte Köpfe, gut in der Farbe. In der Schatzkammer „kniende Magdalena“, sehr gute Holzfigur Ende 16. Jahrh. Hier außerdem an hervorragenden Sehenswürdigkeiten:
1. Massiver goldener Prachtkelch vom 18. Jahrh. mit vielen Edelsteinen; an der Kuppa 3 getriebene Darstellungen von 4 Emailmedaillons aus dem Leben der hl. Walburga, Richarda und Wunna; im Nodus 3 weitere Medaillons.
2. Johannesweinkelch mit gerader Kuppa um 1580 (Fuß wahrscheinlich später); silberne Kuppa sehr schön mit Puttenköpfen und Bandornament in zarter Ausführung geschmückt; hervorragende Augsburger Arbeit.
3. Johanneswein kelch mit Flachornamenten und gepunztem Grunde; sehr originelle, elegante Form, Ende 16. Jahrh.
4. Sehr schönes Elfenbeinkruzifix um 1780; unten am Schaft Maria in der Manier Trogers; am Fuß Relief der Geburt Christi.
5. Reliquienbüste St. Benno im Bischofsornat mit Stab und Fisch; im Fischrachen die Kette mit den Domschlüsseln; Mitra und Pluviale mit Engeln und allegorischen Figuren in getriebener Arbeit; um den Hals eine Prachtkette mit perlenbesetztem Brustkreuz; Arbeit ersten Ranges um 1620.
6. Reliquiar des hl. Johannes Nepomuk; zierliches mit vergoldetem Silber und Silberfiligran verziertes Kristallgehäuse; darin die Reliquienkapsel mit vielen Edelsteinen; Boden zusammengesetzt aus verschiedenen edlen Gesteinsarten; auf dem Deckel in Email die Allianzwappen der Stifter: Herzogin Maria Anna von Neuburg im Jahr der Vermählung (1719) mit dem Sohn des Kurfürsten Ferdinand Maria.
8. Kostbares Missale um 1500 mit den besten Miniaturen der Münchner Malschule; Initialen mit Szenen aus dem Leben Jesu und der Heiligen; sehr hübsche Randleisten mit stilisierten Blumenranken, reichem Blütenflor und allerlei Getier wie Hirsch, Löwe, Tiger, Raubvogel, Reiher, Falke, Singvögel, Kaninchen, Hasen, Bären, alles lebendig gezeichnet und bunt koloriert; hervorragend das Bild des Gekreuzigten [CK 08/2, 10/5, 11/6; D, Heigel K. Th. „Das Grabmal Kaiser Ludwigs des Bayern“ in „Zeitschrift des bayer. Kunstgew. Vereins“ 1893; KB, F, FS, P, Rb, RM, Tr, W],
Frauenkirche
Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die Dom- und Pfarrkirche zu Unser Lieben Frau. (Ueber die Geschichte des Baues siehe die einleitende Baugeschichte Münchens S. 20-21, 82—35.) Eine der mächtigsten und grossräumigsten gothischen Hallenkirchen Deutschlands verdankt die Frauenkirche ohne Zweifel die Erhaltung ihrer ursprünglichen baulichen Gestalt ihren Verhältnissen, welche der Umgestaltung im Renaissance- oder Barockgeschmacke allzu grosse Schwierigkeiten bereitete, während man sie an der Peterskirche, hl. Geistkirche, Augustinerkirche u. s. w. leichter zu überwinden vermochte. So steht die Frauenkirche mitten unter den verballhornten übrigen Schöpfungen ihrer Zeit als ungetrübtes Beispiel des süddeutschen Backsteinhallenbaues da, zugleich als das bedeutendste Bauwerk, das München überhaupt aufzuweisen hat. Die Maße sind ungewöhnlich, 101 Meter lang und 38,5 Meter breit hat die Kirche bis zum First eine Höhe von 58 Meter Höhe. Als Hallenkirche erheischt sie Pfeiler die bis zum Gewölbeansatz des Mittelschiffes emporreichen; zweiundzwanzig an der Zahl sind sie in schlichter Einfachheit bei einem Durchmesser
von 2,10 Meter lediglich nach achteckigem Grundplane gebildet und besitzen zwar einen schlichten, nur mit einer Schmiege sich an den Pfeilerschaft anschliessenden Sockel aber keine Capitälbildung, indem vielmehr die Gewölberippen in einer Höhe von 34,5 M. meist ganz unvermittelt und nur zum geringeren Theile von Consolenbildungen gestützt, dem polygonen Schafte entspringen. In der Längsrichtung ist der Gurtbogen deutlich markirt, in der Querrichtung dagegen ist der Gurt nicht stärker betont als die übrigen Rippen dos Netzgewölbes, wodurch das Gewölbe nicht unwesentlich an einheitlicher Wirkung gewinnt. Die Gewölbe der Seitenschiffe werden den Pfeilern entsprechend anderseits von starken Strebepfeilern aufgenommen, welche nach innen gezogen zugleich die Scheidewände der Kapellen und zumeist auch die Altarwände bilden. Der Gewinn nach innen ist hiebei ausserordentlich, indem dadurch die Kirche an Weiträumigkeit wesentlich zunimmt und zugleich den Seitenaltären , Beichtstühlen, Denkmälern u. s. w. passender und vermehrter Raum geschaffen wird. Doch ist diese Anordnung auch nicht ohne Nachtheil und dieser ist an der Kahlheit des Aeussern, zu dessen Belebung und Brechung nichts abfiel, fühlbar genug. Während sonst die Bildung bei der gegenseitig rechtwinkligen Stellung der Pfeiler und Streben einfach, musste die Lösung des Wölbungsproblems im fünftheiligen Chorabschluss einige Schwierigkeiten bereiten. Denn der aus den Seitenschiffen erwachsende Umgang um den Chor ist als solcher nicht auch im Gewölbe durchgeführt, indem vielmehr das Mittelschiffgewölbe sich bis an die beiden mittleren Streben des Chorabschlusses fortsetzt, und zwar, weil, das letzte Pfeilerpaar etwas enger gestellt ist. in zwei Trapezen sich verjüngend. Der beiderseits übrigbleibende Gewölberaum aber stellt sich in je einem irregulären Viereck und in einem Dreieck dar, welchen besondere und gleichfalls unregelm ssige Netzformen geschaffen werden mussten.
An die linke Chorseite sind ausgedehnte Sakristeir ume angelehnt, von vorneherein in diesem Umfange nöthig, weil schon 1495, mithin ein Jahr nach der Einweihung der Kirche als Pfarrkirche, der Herzog Albrecht IV. von Bayern im Einvernehmen mit der Curie die Collegiatstifte Schliersee und Ilmmünster an die Frauenkirche versetzte. Vor die Westseite aber wurden, wie es an der alten während des Neubaues niedergelegten Frauenkirche, und nicht minder bei S. Peter der Fall gewesen, zwei Thürme vorgelegt, so dass ihr gewölbtes Erdgeschoss noch besondere Kapellenräume bildete, während der Zwischenraum zwischen den Thürmen für Eingangshalle und Orgelchor in Anspruch genommen ward. Die Dimensionen der Kirche erforderten natürlich auch riesige Verhältnisse der Thürme (Höhe 99, untere Mauerdicke 3,30, Führung 9,60 Meter), anderseits aber auch schlichte und massige Behandlung mit geringer Betonung der Streben und ruhigen Wand
flächen. Sie erhoben sich in sechs durch Bogenfriese sicli abgrunzenden und leicht verjüngten Stockwerken rechtwinklig und nur mit sehr sp rlicher Fensterdurchbrechung, bis in der Firsth he des Mittelschiffes an die Stelle des quadratischen Planes ein achteckiger tritt, der jedoch erst nachdem die zwei Stockwerke der Uhr und des Glockenraumes mit den mächtigen Schalllöchern in wie von unten auf so auch jetzt stetig zunehmender Etagenhöhe hergestellt sind, in dem kräftigen Arkadenfries zum regelmässigen Octogon wird. Den ursprünglich beabsichtigten Helmabschluss haben aber die Thürme leider nicht erlangt. Die Vorliebe, welche die Renaissance für die Kuppeln entfaltete, machte sich hier schon in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts geltend und gab den Thürmen jene weltbekannten Kugelhauben, welche eine Art Wahrzeichen von München bilden, und so und siech mit der Physiognomie der Stadt verbunden scheinen, dass die Restauration dieselben nicht zu berühren wagte. L. Lange hat zwar wenigstens eine perspectivische Aussenansicht mit Spitzhelmen geschaffen*), doch ist zu bezweifeln, ob in der durchbrochenen Art, wie sie - später W. Berger an der Haidhauser-Kirche zur Anwendung brachte, das Problem richtig gelöst sei. Einen kostbaren Inhalt bergen die Thürme in den stattlichen Glocken, wovon die grösste, die sog. Salve-Glocke**), 1490 von Herzog Albrecht IV. gestiftet, bei einem unteren Durchmesser von 2,15 M. 125 Zentner wiegt.
Portale besitzt die Frauenkirche fünf, ein grosses zwischen den Thürmen, das jedoch selten im Gebrauche, und je zwei an jeder Langseite. Von den letzteren ist das stlich der Mündung des Mazarigässchens entsprechende in der üblichen Weise mit Figuren und Baldachinen in den Hohlkehlen der Umfassung reich geschmückt, die übrigen sind höchst einfach, alle aber noch durch die zopfigen Thüren entstellt. Die beiden Portale der Südseite sind abweichend von den Fensterwänden nach innen gelegt, wodurch sich über ihnen eine Art von Empore entwickelt.
Das Innere bietet ausser dem baukünstlerischen Interesse, welchem bereits oben Rechnung getragen worden, noch manches andere durch die alte wie neue Ausstattung. In erster Linie stehen hier die Fenster. Mit wenigen Ausnahmen enthalten nun alle, und es sind deren nicht weniger als siebzehn, die in der ganzen Höhe der Seitenschiffe bis zum Gewölbe sich erstrecken, wovon wieder die im Chor befindlichen auch von ungewöhnlicher Breite sind, alte Glasgemälde, freilich zumeist nur in ihrem unteren Drittheile, während das Uebrige erst bei der Restauration in Teppichmustern verglast worden ist. Den Kenner interessiren wohl am meisten die über die Mehrzahl der Fenster verstreuten Reste der Glasmalereien der alten Frauenkirche, welche grossentheils vor 1450 entstanden sein mögen. Leider sind sie zumeist rücksichtslos zersplittert und selbst bei der Restauration ohne weitere Bedachtnahme auf Composition und Darstellung an einander gestückt. Mehr künstlerische als archäologische Bedeutung hat dann das sog. Herzogenfenster in der Capelle des Herz-Jesu-Altars im Chor rechts vom Hochaltäre, wohl aus dem Jahre 1486 stammend, dessen Hauptbild Madonna von vielen Heiligen und den Donatoren, den Herzogen Ernst, Wil
helm, Albrecht III. und Albrecht IV. von ihren Kindern umgeben, darstellt. Es füllt jetzt nur die obere Hälfte eines Chorfensters und hat dadurch nicht gewonnen, dass unterhalb die Donatoren des benachbarten jüngeren Scharfzandt’schen Fensters angestückt sind und der Rest mit einem ziemlich rohen modernen Glasgemälde, in dessen Mitte S. Urbanus sich aufdrängt, ausgefüllt ist. Ansprechender, namentlich durch die mächtige Totalwirkung, ist das linksbenachbarte in der Tabernakelkapelle befindliche Scharfzandt’sche Glasgemälde mit drei Hauptdarstellungen (Verkündigung, Geburt und Anbetung Christi und Mari Reinigung). Die reiche gothische Umrahmung dieses das ganze Chorfenster ausfüllenden Glasmalereiwerkes gehörte zu den wichtigsten Vorbildern für die moderne Münchener Glasmalerei und Ainmüller’sche Schule.
Weiterhin fällt das Hauptdenkmal des Domes in’s Auge, das Epitaph des Kaisers Ludwig des Bayers. Dieses besteht aus zwei sehr verschiedenen Bestandtheilen, der 1438, mithin fast ein Jahrhundert nach des gebannten Kaisers Tod hergestellten Grabplatte aus rothem Untersberger Marmor und dem darüber gesetzten Mausoleum in Marmor und Bronze. Die Grabplatte von der Hand dos „Meisters Hans des Steinmeisseis“ geschaffen, stellt Ludwig den.Bayer im Kaiserornate von teppichhaltenden Engeln umschwebt und unterhalb die Herzoge Ernst und Albrecht III., Vater und Sohn sich vers hnlich die Hand reichend dar, wie es nach langer Fehde wegen Agnes Bernauer, der von Vater Ernst wegen Berückung seines Sohnes gemordeten Gemahlin Albrechts 1437 geschehen war. Leider ist die Reliefplatte lediglich durch die Ausschnitte des späteren Mausoleums und nur unvollständig*) zu sehen, noch mehr aber ist zu beklagen, dass die Ummantelung des älteren Denkmales die Zerstörung der Reliefs veranlasst hat, welche sich als Fries um das sarkophagartige Grabmal gezogen und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts selbst Italiener entzückt hatten. Das Mausoleum darüber besteht aus einem in schwarzem Marmor ausgeführten, durchbrochenen Schrein, welchen vier auf ein Knie gesunkene ritterliche Bannerträger zu bewachen scheinen. Diese wie die beiderseits stehenden Herzoge Albrecht V. und Wilhelm V. sind in Bronze gegossen und wurden nach dem Denkmal - Entwurf des Kunstintendanten des Churfürsten Maximilian I., des Niederländers Peter Candid (de Witte) von dem Weilheimer Hans Krumpper nebst allen übrigen Bronzezierden des Denkmals ausgeführt.
Zu den besseren Resten der Ausstattung aus der Entstehungszeit gehören dann noch die Chorstühle, d. h. deren reich ornamentirte Rückwände. Sonst ist das alte Geräthe der Frauenkirche insist, stammt von anderer Seite und wurde erst bei der Restauration dahin verbracht. Von den neuen Altarwerken ist der Hochaltar mit der schönen J. Knabl’schen Schnitzgruppe (Mari Himmelfahrt) und den Flügelgem lden von Schwind immerhin beachtenswerth. Nicht minder der noch unvollendete gräflich Arco’sche. Steinaltar im rechten Seitenschiff, der Altar der Bäckerzunft auf derselben Seite und der Bennoaltar auf der gegenüberliegenden, in dessen Kapelle auch noch die liturgischen Gewänder dieses Kirchenpatrons aufbewahrt werden. Sonst ist die Kanzel, von König Maximilian II. gestiftet, ein zierliches und zugleich stattliches Werk der Sickinger’- schen Werkstatt (1861), und ebenso der schöne Baldachin über dem erzbischöflichen Stuhl, links neben dem Hochaltar (nach Berger’s Zeichnung) von Werth, wie auch der Foltz’sche Credenztisch. Von neueren Bildwerken heben wir nur das grosse im Gewölbe hangende Crucifixbild Halbig's, wie die zwölf Apostelstatuen mit Baldachinen in rothem Marmor von Foltz hervor, die, ein Geschenk des Königs Ludwig II., an den Pfeilern angebracht sind. Objecte der Malerei und Bildnerei finden sich übrigens in dem ganzen Dome verstreut, und es ist in dieser Beziehung anzuerkennen, dass die Restauration in der Beseitigung des Nichtstylgemässen nicht allzu rigoros vorging. So hat z. B. das frühere Hochaltargemälde Peter Candid’s, „die Himmelfahrt Mari “, ein immerhin tüchtiges Werk, wenigstens eine Stelle über der Sakristeithüre gefunden.
*) E. Forster’s Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei. Leipzig T. O. Weigel 1850—1860. **) Sie hat den Namen von dem Wunsche des Stifters, wonach sie beim Salve Kegina gel utet werden sollte. Nach der Inschrift die der Regensburger Glockengiesser Hans Ernst auf ihr anbrachte, heisst sie Susanna.
*) Der Gypsabguss der Platte, bei der Versetzung des Monuments w hrend der Restauration abgenommen, ist indess allgemein verbreitet.
Die Frauenkirche
Nagler - Acht Tage in München (1863)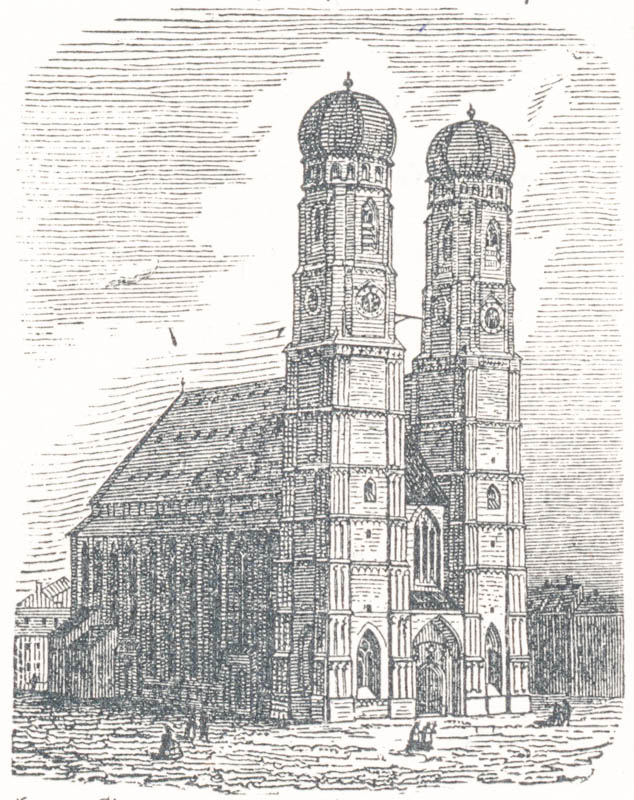 Die Frauenkirche ist ein gothischer Bau auf dem Areale «wer alten Kapelle, über welche wir in der topographischen Geschichte von München S. 17 gehandelt haben. Den Bau führte Meister Jörg von Halsbach, welcher aber auch Jörg von Polling und Jörg Gankoffer genannt wird, so daß man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, woher er stamme. Herzog Sigmund von Bayern legte den 9. Febr. 1468 den Grundstein, und nach 20 Jahren war die Kirche vollendet. Doch wurde sie erst am 14. April 1494 eingeweiht. Die mächtigen Pfeiler dieser dreischiffigen Halle mit eingezogenen Streben stützen das künstliche Steinrippenwerk ohne Gurten, und bis zum Gewölbe mißt man 113 Fuß. Das Schiff ist 128 Fuß breit und 336 Fuß lang. Fein berechnet, und nicht ohne Absicht eines Wahrzeichens, ist die Stellung der Pfeiler und der Fenster. Unter dem Orgelchor ist im Pflaster ein Fußtritt, von wo aus kein Fenster ersichtlich ist.
Die Frauenkirche ist ein gothischer Bau auf dem Areale «wer alten Kapelle, über welche wir in der topographischen Geschichte von München S. 17 gehandelt haben. Den Bau führte Meister Jörg von Halsbach, welcher aber auch Jörg von Polling und Jörg Gankoffer genannt wird, so daß man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, woher er stamme. Herzog Sigmund von Bayern legte den 9. Febr. 1468 den Grundstein, und nach 20 Jahren war die Kirche vollendet. Doch wurde sie erst am 14. April 1494 eingeweiht. Die mächtigen Pfeiler dieser dreischiffigen Halle mit eingezogenen Streben stützen das künstliche Steinrippenwerk ohne Gurten, und bis zum Gewölbe mißt man 113 Fuß. Das Schiff ist 128 Fuß breit und 336 Fuß lang. Fein berechnet, und nicht ohne Absicht eines Wahrzeichens, ist die Stellung der Pfeiler und der Fenster. Unter dem Orgelchor ist im Pflaster ein Fußtritt, von wo aus kein Fenster ersichtlich ist.
Die Thürme ruhen auf einer 11 Fuß dicken Grundmauer, und steigen viereckig in vier Stockwerken empor. Oben legt sich ein Achteck an, auf dessen Spitzbogenfries die Kuppel ruht. Eine Gedenktafel im nördlichen Thurme besagt, daß die Thürme so hoch, als die Kirche lang seien. In beiden Thürmen hängen zehn Glocken, wovon die größte 120 Ctr. wiegt. Wer die 430 Stufen des nördlichen Thurmes besteigen will, genießt von der Oeffnung der Kuppel unter dem Knopfe aus eine Überraschende Aussicht. Der südliche Thurm bleibt verschloßen. Von diesem herab stürzte sich 1783 ein 17jähriges Mädchen von unglücklicher Liebe getrieben.
Im Jahre 1858 begann die Restauration im Innern der Kirche unter Leitung des Architekten Mathias Berger, des Erbauers der Haidhauser Kirche, und sie war bei der Benedicirung am 2. Juni 1861 noch nicht vollendet. Die alten Altäre mit ihren Gemälden und Sculpturen aus der Zeit der Erbauung der Kirche wurden schon im 16. und 17. Jahrhundert entfernt, und nach und nach füllten sich die durch die Streben gebildeten Kapellen mit neuen Altären im Renaissance- und Roccocostyl. Bei der neuesten Restauration wurden alle früheren Altäre entfernt, und an der Stelle derselben sind jetzt theils noch die Gemälde und Statuen, welche aus den Altären genommen wurden. Leider 'können in kürzester Zeit nicht alle Altäre durch neue ersetzt werden, da das Unternehmen auf freiwilligen Beiträgen beruht. Die alten Familien, welche Altäre und Benefizien stifteten, sind ausgestorben, und die moderne Generation beeilt sich mit solchen Dingen nicht.
Die Glasmalereien der Fenster stammen nicht alle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es wurden auch die bemalten Fenster der alten Frauenkirche benützt, und durch Seitenstücke ergänzt, da sie für die gegenwärtigen Oefsnungen zu klein waren. An der Südseite bemerkt der Kenner ein eingesetztes kleineres Fenster mit den Ergänzungen. Die alte Frauenkirche, bis 1171 eine Filiale von St. Peter, in diesem Jahre aber zur Pfarre erhoben und erweitert, wurde beim Baue der jetzigen Kirche an der Südseite erhalten, und erst nach 1480 demolirt. Diese Kirche hatte zuletzt 18 Altäre, welche größtentheils in die neue Kirche übergingen, so wie die Glasmalereien. Die nenen Fenster wurden 1486 eingesetzt, aber nur ein einziger Glasmaler ist urkundlich bekannt, nämlich Egidius Trautenwolf von München. Von ihm ist vorn das Fenster mit der Anbetung der Könige, der Geburt Christi, der Darstellung im Tempel und dem Tode der Maria. Zu Anfang unsers Jahrhunderts wollte man, um mehr Licht zu gewinnen, die Fenster ihres gemalten Schmuckes berauben, und bei dieser Gelegenheit kam eine Scheibe zum Vorschein mit der Schrift: Egidius Trautenwolf pictor Monac. me fecit 1486.
Unter der erwähnten Anbetung der Könige stehen die Buchstaben E. T. Dieses Fenster gehört in Hinsicht auf Farbenpracht und Schmelzung nicht zu den Hauptwerken der Kirche. In den Contnren und Schraffirungen tritt das Schwarzloth hervor, und zu den Fleischpartien nahm der Künstler ein blaßrosenrothes Glas. Dieß kennzeichnet seine Gemälde, und man ersieht, daß noch ein zweiter, gleichzeitiger Meister Vorzüglicheres leistete. Ein dritter gehört dem Anfang des 16. Jahrhunderts an.
Besondere Beachtung verdient das Monument des Kaisers Ludwig des Bayern. Der durch die Oeffnungen der Tumba im Innern sichtbare horizontal liegende Stein stammt aus der alten Frauenkirche. In der oberen Abtheilnng thront Kaiser Ludwig der Bayer im Ornate. Rechts unter dem Throne ist die Figur des jungen Herzogs Albert III., und gegenüber jene des Herzogs Ernst. Letzterer starb 1438, und in diesem Jahre scheint Herzog Albert III. den Stein zum /Ändenken des Kaisers Ludwig und der in der alten Frauenkirche ruhenden Nachkommen desselben gesetzt zu haben.
Am schiefen Rande des Steines oben über dem Kaiser anfangend liest man:
Üno dom MCCCXLVII an. öritn. lag. Dionietj starb.
der . allerdurchleuctigiot . Komisch . Kayser . Ludwig. zu.
alln. zeiten wer. Keichs. psallz. gf. bei. Kein. Herzog ^in
bairn. ll. hie begrab». mit. den. nachgntn . suste. hzog.
Johas. Ernst. lvilhalm. lldols. Ülbrecht. d. jung, all fasten
no . Vairn. Mit rc. schließt die Inschrift.^
Ans der beschädigten theils ausgebrochenen Bandrolle steht:
llno Öni .M| — 1 — | — | — |ie starb | ind an
| — I — | durch | den dar | chleichte | gisten | hoch ge |
pornen | surste | and Herrn | Mbrech | ten | den | jungen |
psalzgr. s pey reT | — | — | ern and nydren | payrn |
mit der s — s porn | sraw lln | na aon | praun | swaig |
der an s — s — s gt and Starb s — s — s — s
Beim Abbruche der alten Kirche wurden die fürstlichen Ueberreste in einen gemeinschaftlichen Sarg gesammelt, und in der
Gruft der jetzigen Kirche beigesetzt. Der große Kaiserstein fand ebenfalls im Chore der neuen Kirche eine Stelle, bis endlich der Churfürst Maximilian I. 1622 durch Hans Krümper das gegenwärtige Monument aussühren ließ, nämlich die Tumba mit den knieenden Rittem, und was auf derselben angebracht ist. Die rechts und links beigefügten Standbilder in Erz haben ein älteres Ansehen, und stehen an Kunstwerth weit über den ehernen Standartenträgern, zu welchen, wie zur Tumba, Peter Candito die Zeichnung geliefert hat. Man nimmt gewöhnlich an, es seien dieß die Porträtstatuen der Herzoge Albert V. und Wilhelm V., des Großvaters und Vaters des Churfürsten Maximilian I. Diese Statuen waren ehedem in der Kunstkammer des Herzogs Albert V. († 1379), und wurden von Maximilian I. als Wächter des Kaiser-Monumentes bestimmt. Ueber letzterem ließ der Churfürst einen großen Rundbogen einbauen, welcher mit Malereien von Peter Candito geziert war. Dieser Bogen mußte bei der Restauration weichen, und das Kaiserdenkmal wurde tiefer gesetzt.
Hinter diesem Monumente führen Stufen in den jetzt erweiterten Chor. Aus alter Zeit sind nur noch die schönen Schnitzwerke der Chorstühle. Sie sind von Erasmus Grasser gefertiget, gleichzeitig mit der Kirche, und jetzt neu bemalt. Der neue prachtvolle gothische Hochaltar ist im architektonischen Theile von Anselm Sickinger nach der Zeichnung des Architekten Berger gefertiget. Die Gruppe der Krönung Mariä ist das Werk des Bildhauers Joseph Knabl in München. Die vier Evangelisten, und die Statuen der Apostel Petrus und Paulus hat W. I. Niesten ausgeführt. Die über diesen Rundbildern stehenden Figuren sind im Atelier Sickinger's entstanden. Die schönen Gemälde der Flügel dieses Altares sind von Moriz von Schwind, und eine Zierde des Werkes. Auch die beiden Seitenaltäre au den Pfeilern, und der bischöfliche Thron links im Chore gingen aus dem Atelier des Bildhauers Sickinger hervor, sowie die Kanzel, ein Meisterwerk der Gothik. Die Malereien der Seitenaltäre an den Pfeilern sind von Max v. Meuz und von Heinrich Baron v. Pechmann. Außer dem Hochaltäre und den beiden Altären an den Pfeilern nach dem Entwürfe des M. Berger sind noch andere Altäre aufgestellt, welche Beachtung verdienen. Der Dreifaltigkeitsaltar am Fenster der Kapelle rechts vom Hauptaltare ist von I. Knabl im figürlichen Theile, ganz von Holz, nur weiß grundirt. Die Gemälde der Aussenseiten sind alt. Der im Umgänge folgende Corpus-Christi-Altar mit den zwölf Aposteln im oberen Theile des Bogens ist ein Geschenk des Erzbischofs von 1862, nach Bergers Zeichnung ausgeführt. Die Reliefs in den Nischen der Wände stammen aus dem vorigen Jahrhundert, und sind von Roman Boos-1802) gefertiget. Sie zierten die Wände der Chorstühle. Das Relief von Silber im Antependium kommt vom Reliquienkasten des hl. Arsacius von 1497. Der Altar in Mitte des Polygon hinter dem Hochaltäre ist alt, und neu gefaßt. Im Kasten sind Figuren, und im Innern der Flügel Flachreliefs. Die Madonna oben in der Spitzverzierung, die Apostelfiguren des unteren Frieses und die Gemälde der Aussenseiten stammen aus einer frühem Zeit, und wurden nur neu gefaßt. Dieß ist auch mit dem folgenden Altäre der Fall, so wie mit dem Andreas-Altar zwischen den zwei Sakristeithüren. Der Marienaltar in Mitte der nördlichen Wand ist neu. Den architektonischen Theil fertigte Wirth, die Marienstatue im gothischen Style ist von Bleim.
Besonders schön ist die mattirte Vergoldung. Der Altar beim Taufstein der Thurmkapelle stammt aus älterer Zeit. Der neue St. Georgenaltar an der Südseite ist nach Schneiders Zeichnung ausgeführt, und das Gemälde des hl. Georg von der Hand des U. Halbreiter. Auf die Ueberreste der alten Altäre gehen wir nicht ein, da sie entfernt werden. Das neue, 13 Fuß große Crucifix am Gewölbe über dem Chore ist nach Halbig's Modell in Holz geschnitzt.
Das ehemalige Haupaltarbild, die Himmelfahrt Mariä, von Peter Candito, ist gegenwärtig über dem Eingang der Sakristei angebracht. In den Kapellen sind noch einige alte Gemälde aus der Zeit der Erbauung der Kirche vorhanden. Mit diesen Kunstwerken wird aber wohl eine Aenderung getroffen, und somit unterlassen wir den weiteren Bericht. Außerdem hängt in dieser Kirche auch eine Türkenfahne, welche der Churfürst Max Emanuel am 12. August 1687 in der Schlacht von Mohacz mit dem Zelte des Großveziers eroberte.
Die Orgel der Frauenkirche erklärte Joseph Zarlini 1389 in seinen Zupplemsnti musicali VIII. p. 290 als eine der größten in der Welt, und gibt an, daß die 20' langen und 1' weiten Gesichtspfeifen aus einem Stück Buchsbaumholz rund gedreht seien. Diese Fabel haben bis 1846 alle nachgeschrieben. Bei der Entfernung der wurmstichigen Pfeifen im Jahre 1848 zeigte es sich, daß dieselben von Lerchenholz, und aus zwei Hälften zusammengesetzt waren. Der Kasten der Orgel ist aus der neueren Zeit, paßt aber in seiner gothisirenden Form in die restaurirte Kirche.
Die Orgel, welche bis dahin auf dem Chore des Presbyteriums sich befand, und ein Werk von ausgezeichneter Reinheit und Kraft des Tones war, stammte aus dem 1802 aufgehobenen Franziskaner-Kloster, und wurde leider destruirt.
Unter dem Chore der Kirche ist jetzt die älteste bayerische Fürstengruft. Sie war ursprünglich nur 8—10 Schritt lang, und 6 Schritt breit. Maximilian I. ließ sie 1606 erweitern. Damals war der alte Sarg mit den Gebeinen des Kaisers Ludwig und seiner Vorfahren und Nachkommen noch vorhanden. Der Churfürst ließ sie in einen neuen Sarg einschließen. Diese sterblichen Ueberreste in der Gruft gehören den fürstlichen Personen von 1293—1626 an. Jetzt ist der Eingang hinter dem Hanptaltare.
Die Sonnenuhr an der Südseite der Kirche mit der Madonna wurde 1830 restaurirt. Sie ist ursprünglich das Werk eines Münchner Künstlers von 1314. (Die Abbildung des Kaiftr-Monumentes ist bei G. Franz um 12 kr. zu haben. Auch die äussere und innere Ansicht der Kirche ist daselbst vorräthig, letztere mit dem eingebauten Bogen aus der Zeit Maximilian's I., und in der jetzigen Gestalt ohne denselben. Der Bogen wurde, wie gesagt, bei der neuen Restauration entfernt. Die Abbildung der erwähnten Türkenfahne in Buntdruck ist ebenfalls bei G. Franz vorräthig, roh. fol.)
Weitere Bilder
Alte Ansichten
Sagen & Geschichten
Die Frauenkirche 1468-1488
Schon in der ältesten Zeit der Stadt München bestand da, wo jetzt der ältere Theil der Sakristei der Frauenkirche sich befindet, eine einfache Kapelle, der heiligen Jungfrau Maria geweiht. Obwohl wir über die Zeit ihrer Erbauung keine bestimmte Nachricht haben, so wissen wir doch so viel, daß sie um das Jahr 1200 erbaut wurde, weil ihrer seit dieser Zeit mehrmals in Urkunden erwähnt wird. Dieses Marienkirchlein war in dem damals herrschenden romanischen Style erbaut, hatte drei Altäre und eine Krypta, welch letztere noch gegenwärtig, wenn auch erst in neuester Zeit wieder eingeschüttet, vorhanden ist.
Nach Ablauf von hundert Jahren des Bestandes der Stadt München war aber die Bevölkerung derselben bereits so sehr angewachsen, daß die bisherige Eine Pfarrei St. Peter für die Gemeinde nicht mehr ausreichte. Auf Ansuchen der Bürger Münchens gestattete der Bischof Konrad II. von Freising durch Urkunde vom
24. November 1271 die Errichtung einer zweiten Pfarrei. Die betreffende Stelle in dieser Urkunde lautet:
„Da die Taufgemeinde der Kirche des heil. Petrus in München durch Gottes Gnade ins Unendliche angewachsen ist, so daß sie durch die Leitung eines einzigen Hirten ohne Gefahr der Seelen nur schwer kann regiert werden, und da überdieß der Begräbnißplatz dieser Kirche so eng ist, daß er zur Bestattung der Leichen nimmer hinreicht, so haben Wir nach weiser Berathung und frommer Erwägung,* Gehör gebend den andächtigen Bitten jenes Volkes, die genannte Kirche des heil. Petrus mit ihrer Gemeinde in zwei Pfarreien zum gemeinsamen Wohle der Bürger zu theilen beschlossen mit einer von rechtlichen Männern zu bestimmenden Ausscheidung des Volkes, der Zehenten und des Vermögens, so daß die Kirche der heiligen Maria, welche bis dahin eine einfache Kapelle gewesen, nun einen gesetzmäßigen, Residenz haltenden, mit allen Pfarrrechten versehenen Vorstand habe und eine eigene und ewige Begräbnißstätte gleich einer Mutterkirche besitze. Beide Pfarrer sollen aber Residenz halten, Gastfreundschaft halten nach dem Maße ihres Vermögens, und jeder zwei Gesellpriester halten zur Aushilfe in der Seelsorge, sowie einen Knabenschulmeister."
Als Gränzlinie beider Pfarreien wurde die Kausingergasse bestimmt.
Pabst Gregor X. bestätigte durch zwei Breven im Jahre 1273 diese bischöflichen Bestimmungen.
Es war bereits die Erbauung einer neuen Pfarrkirche ins Werk gesetzt, und wurde dieselbe am Vorabend des St. Katharinentages (1273?) vom Bischofe Konrad II.
eingeweiht. Dieser neue Tempel war ein gothischer Bau von ansehnlicher Größe, was wir daraus,mit Bestimmtheit entnehmen können, weil um diese Zeit der frühere romanische Baustyl schon überall dem gothischen Platz gemacht hatte, und die neue Pfarrkirche im Chore drei Altäre, den Fron-, Annen- und Kreuzaltar, im Ganzen aber achtzehn, ja später einundzwanzig Altäre , enthielt. So viele Altäre hätten in einer kleinen romanischen Kirche nicht Raum gehabt. Wir kennen die Anzahl und die Namen der Altäre aus den noch vorhandenen Urkunden genau, denn sie wurden von den Herzogen, den Patriziern und andern vermöglichen Bürgern der Stadt fortwährend mit reichen Stiftungen von Meßbenesizien, ewigen Lichtern und Wachsstiftungen dotirt.
Die alte romanische Marienkapelle wurde aber in Folge des neuen Pfarrkirchenbaues keineswegs abgebrochen. Es wurde dieselbe vielmehr nun als Gottesackerkirche verwendet, da die neue Pfarrei auch eine Sepultur erhalten hatte. Da diese Freithofkapellen gewöhnlich dem heil. Michael, als dem Patrone der Sterbenden, geweiht waren, so erscheint das bisherige Marienkirchlein von nun an als St. Michaelskapelle bei U. L. Frau.
Ueber die Lage dieser St. Michaelskapelle haben sich in neuerer Zeit vielfältige Untersuchungen, Zweifel und irrige Ansichten ergeben. Der fleißige Forscher der Topographie der Stadt München, Dr. Nagler, sprach die Meinung aus, dieselbe sei an dem Platze gestanden, wo in der heutigen Frauenkirche sich die Fürstengruft befindet, und diese Gruft sei eben die Krypta der St. Michaels-Todtenkapelle gewesen. Herr Dr. Sighart, der Verfasser einer gründlichen Geschichte der Frauenkirche, gibt wohl die Umwandelung der ursprünglichen Marienkapelle in die St. Michaels-Gottesackerkapelle zu, vermeint aber hingegen, es seien bei Erbauung der heutigen Frauenkirche im Jahre 1468 alle Reste jenes ersten Baues gänzlich verschwunden. — Allein beide Ansichten möchten irrig sein. Diese Kapelle lag urkundlichermassen auf dem Gottesacker gegen das Schulhaus zu, nahe an dem Stadtgraben und Walle, da wo schon damals ein enges Gäßchen, wie noch heut zu Tage, aus der Windenmacher- und Schäfflergasse über ein Brückchen über den Stadtgraben auf den Freithof führte. Die neuere Zeit aber hat uns hierüber vollständige Aufklärung gegeben. Es war nämlich im Jahre 1822, als man bei der damaligen Restauration der inneren Sakristei der Frauenkirche, und zwar bei Herstellung des Bodens auf ein gemauertes Gewölbe stieß. Nach Durchschlagung desselben zeigte sich eine Gruft, welche ganz mit regelmäßig aufgeschichteten Menschenknochen angefüllt war. Wahrscheinlich wurden diese Gebeine beim Baue der jetzigen Frauenkirche im Jahre 1468 und Einlegung des alten Gottesackers in diese Gruft gesammelt und dieselbe zugemauert. Wir haben hier also eine alte Gruft vor uns, welche schon vor Erbauung der jetzigen Frauenkirche bestand. Allein keine alte Nachricht gibt uns Kunde, daß ausser der St. Michaelskapelle noch eine weitere Kapelle mit einer Gruft auf dem Freithofe stand, wir haben auch keinen sonstigen Grund, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit das Bestehen einer zweiten Kapelle daselbst anzunehmen, und wir kommen daher zu der nothwendigen Schlußfolgerung, daß diese im Jahre
1822 entdeckte Gruft die Krypta der St. Michaelskapelle gewesen sei, und daß sie daher da stand, wo jetzt die innere Sakristei sich besindet. — Es wäre wohl im historischen Jnteresse höchst wünschenswerth gewesen, daß diese Krypta, deren Erbauung sich bis zum Jahre 1200 zurück erstreckt, und in welcher der große Kaiser Ludwig der Bayer beigesetzt worden war, erhalten und zugänglich gemacht worden wäre; aber leider wurde diese Gruft bei der neuerlichen Restauration der Frauenkirche im Jahre 1858—1862 eingeschüttet und dadurch der künftigen Kenntniß entzogen. Möchte doch bessere Einsicht sie wieder eröffnen und herstellen!
Aber auch über die Lage der alten Frauenpfarrkirche von 1271 haben wir durchaus keine Gewißheit; alle und jede bestimmte Nachrichten fehlen darüber, und es ist daher nicht zu verwundern, daß hierüber verschiedene Vermuthungen von Seite der Geschichtsforscher erhoben wurden. So tauchte erst in neuerer Zeit eine sonderbare Ansicht auf. Als nämlich Anfangs des Monates August 1849 auf dem Frauenplatze Graben gezogen wurden, um die Röhren der Gasleitung einzulegen, kam in der Erde in einer Tiefe von ungefähr 5 Fuß Mauerwerk zu Tage, welches sich in einer Länge von beiläusig 35 Fuß vom östlichen Ecke des Mazarigäßchens an, vor dem Sedaller'schen Hause hin, aufwärts in schiefer Richtung mit der jetzigen Kirche erstreckte. Vom Mazarigäßchen auS führte ein Eingang durch diese Mauer, welche dann weiter gegen das Sporergäßchen zulief. Eine nähere Untersuchung des ganzen Platzes fand nicht statt, was sehr zu bedauern ist. Aus diesen Mauerüberresten
und namentlich aus dem Umstande, daß die Mauer ziemlich dick ist und die aufgefundenen Vorsatzstücke von gebrannten Ziegelsteinen romanisches Gepräge tragen, schloß der verstorbene Forscher Dr. Nagler, diese Mauer habe der alten Frauenkirche angehört, und letztere fei daher auf dem Frauenplatz e, sohinfüdlich von der jetzigen Frauenkirche gestanden. Allein die Unmöglichkeit dessen und ebenso die Unrichtigkeit dieser Schlußfolgerung ergibt sich schon aus der Ansicht des sehr beschränkten Frauenplatzes. Denken wir uns nämlich die nördliche Wand der Dr. Nagler'schen Frauenkirche nur in einer Entfernung von zwei Schritten neben der jetzigen Kirche herlaufend, so bleibt für die innere Breite dieser Frauenkirche nicht einmal ein Raum von dreißig Fuß. Und in diesem engen Kirchlein das einer Pfarrkirche wenig entspricht, sollen achtzehn, ja später einundzwanzig Altare gestanden haben! Die absolute Unmöglichkeit dessen und also auch die Unrichtigkeit der Nagler'schen Ansicht liegt klar vor Augen.
Wir müssen daher bei der früheren Ansicht stehen bleiben, daß die alte Pfarrkirche an der Stelle der jetzigen Frauenkirche stand, ohne jedoch die Ausdehnung der letzteren gegen Westen zu haben. — Die im Jahre 1849 am Frauenplatze aufgefundenen Mauerreste aber rühren von der ehemaligen Freithofmauer her.
Diese alte Kirche war mit drei Portalen und einem zur Seite stehenden Thurme versehen.
Unter den Stiftungen, welche in dieser Kirche bestanden, ist besonders die des Patriziers Franz Dichtel vom Jahre 1432 merkwürdig, durch welche er die
Donnerstags-Prozession, die heut zu Tage noch abgehalten wird, einführte,
Von den Werken der Kunst, die in der alten Frauenkirche vorhanden waren, ist ausser einigen Glasfenstern mit den Wappen der Astaller mit der Jahrzahl 1395, der Pütrich und Schrenk, welche in die spätere Frauenkirche übergebracht wurden und noch gegenwartig auf der Südseite derselben zu sehen sind, nur die Kunde von zwei bedeutenden Werken auf uns gekommen. Eines derselben ist noch jetzt, wenn auch in verstümmeltem Zustande, vorhanden, nämlich der Grabstein des Kaiser Ludwig des Bayer von rothem Schlehdorfer Marmor, gefertiget von „Hans dem Steinmeißel" im Jahre 1438, über welchen wir in dem Abschnitte: „Tod und Begräbniß des Kaisers Ludwig des Bayer" bereits das Nähere erwähnt haben.
Das andere aber war ein Altarwerk, von welchem sich leider kein Ueberrest, sondern nur eine sehr mangelhafte und unbestimmte Abbildung in dem bekannten Gemälde über die Vermählungsfeier Herzog Wilhelms V. mit der Prinzessin Renata erhalten hat.
Der Maler Gabriel Angler von München erhielt nämlich den Auftrag, einen neuen Hochaltar in die Frauenkirche zu machen. Er ging eifrig an das Werk, scheint aber oft in Geldnoth gewesen zu sein, denn wir besitzen noch in den Urkunden eine Reihe von Quittungen, die derselbe den Kirchenpröbsten für die abschlägig bezahlten Arbeiten ausstellte. Zuerst im Jahre 1434 läßt er sich von den Kirchenpröbsten Franz Dichte! und Otto Sänftl sechsthalb hundert und zwei rheinische Gulden und hundert
zwanzig Dukaten geben, „darum er Farb und Lasur gekauft zu Venedig zum Werk, das er machend ist auf unser lieben Frauen Chor." Diese feine Anforderungen um Geld wiederholen sich zwei Jahre lang fortwährend, so daß die Kirchenpröbste sich endlich veranlaßt sahen, zur genaueren Untersuchung über den Fortgang des Werkes eine Kommission, bestehend aus Johann Tulpeck, damals Domherr von Freising und Pfarrer zu U. L. Frau, dem Probst Johannes von Jllmünster und Martin Katzmair, Bürger von München, niederzusetzen, die aber einen für den Meister Gabriel Angler so günstigen Ausspruch that, daß er im Jahre 1436 abermals neunzig Pfund Pfenninge erhielt. Aber noch ein Jahr verschob sich die Vollendung des Werkes. Am Freitag vor Pfingsten des Jahres 1437 haben die Kirchenpröbste nochmals den Maler „freundlich und gnädig aufgericht mit hundert sechsthalb und vierzig Pfund Münchener Pfenninge und vier und sechzig Gulden rheinisch für seine Arbeit am Werk und der Tafel zu unser Frau."
Endlich am Dienstag vor St. Martin des Jahres 1437 ward die Tafel auf den Altar gesetzt. Da kamen die Herrn vom innern und äußern Rath, Werkleute, Maler und Goldschmide zur Besichtigung und Prüfung der ganzen Arbeit, und deren Urtheil ging dahin, daß man dem Maler geben solle, was er verlangt, auf daß ihm vollkommen genügt sei. Acht Tage später gibt der Meister nochmals eine Gesammtquittung und bekennt, „für die Tafel und das Werk, das er in unser lieben Frauen Pfarrkirche zu München mit feinen Gesellen gemacht und das jetzt steht auf ihrem Fronaltar im Chor
sowie für allen Zeug und Arbeit vom Rath erhalten zu, haben zwei tausend Gulden rheinisch." Zugleich erklärt er aber, daß sie insbesondere noch von ihm gekauft den Tabernakel, der jetzt auf der Tafel steht, und zwar um 275 Gulden rheinisch. Und sofort sagt er die Kirchenpröbste für immer quitt und ledig.
Aus den schriftlichen Urkunden können wir über die Beschaffenheit dieses Altares nur entnehmen, daß es ein gothischer Flügelaltar mit Tabernakel von ausserordentlicher Herrlichkeit gewesen, wofür auch spricht, daß der Künstler drei Jahre lang an diesem Werke gearbeitet und dessen Kosten sich auf die für damalige Zeit ungeheure Summe von 2275 Gulden belaufen haben, während z. B. der große Albrecht Dürer noch im Jahre 1508 für ein Gemälde, auf welchem zweihundert Köpfe vorkamen, nur 200 Gulden erhielt, worüber er sich freilich beklagt.
Leider ist von diesem Altarwerke des Gabriel Angler, obwohl er in den dreißig Jahre später sich erhebenden Neubau der Kirche übergegangen ist, keine Spur mehr vorhanden, und wir werden weiter unten auf sein Schicksal bei Erwähnung der Umänderung des Jnnern der Frauenkirche unter Kurfürst Maximilian I. darauf zu sprechen kommen. — Daß übrigens Gabriel Angler ein anerkannt tüchtiger Künstler gewesen sei, geht aus den städtischen Kammerrechnungen hervor, inhaltlich deren er im Jahre 1443 vom Rathe den Auftrag erhielt, ein großes Bild in die kleine Rathstube zu malen, wofür ihm zwei Tafeln angeschafft wurden. Auch dieses Bild ist spurlos verschwunden.
Zweihundert Jahre war diese Pfarrkirche gestanden, als sich wieder das Bedürfniß eines Neubaues in Folge der immer mehr anwachsenden Bevölkerung der Stadt fühlbar machte. Wir kennen zwar die Volkszahl Münchens in den frühesten Jahrhunderten nicht, aber die erste bekannte Volkszählung von 1580 wies 20,000 Einwohner nach; wir dürfen daher in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundertes immerhin eine Einwohnerzahl Münchens von beiläusig 16—18,000 Einwohnern annehmen. Zudem hatten sich auch in der alten Frauenkirche schon bedeutende Baugebrechen und Schaden gezeigt, so daß im Jahre 1443 sogar denen, welche die Frauenkirche besuchen und zur baulichen Herstellung Geschenke opfern, ein Ablaß verliehen wurde.
Da entschloß sich der edle Herzog Sigmund, welcher, wie wir in einem vorgehenden Abschnitte gesehen haben, schon im Jahre 1467 auf seine Mitregentschaft freiwillig verzichtet, die Regierung an seinen Bruder Herzog Albrecht IV. abgetreten und sich auf seine Schlösser Dachau, Menzing und Nanhofen zurückgezogen hatte, wo er den Künsten und Wissenschaften, besonders aber der Musik und der Jagd pflegte, auch schönen Frauen hold war, durch Freigebigkeit und Mildthätigkeit aber (denn er war unverheirathet) sich die Liebe des Volkes erwarb, — der Stadt München einen neuen Tempel zu bauen.
In jenen Tagen hatte die Fürsten und das Volk in Bayern eine große Begeisterung zu gewaltigen Kirchenbauten erfaßt. Jm Jahre 1407 hatte die Bürgerschaft in Landshut unternommen, die herrliche Martinskirche mit ihrem weitaussehenden Thurme zu bauen und wurde dieser
Bau im Jahre 1478'vollendet; in Jngolstadt hatte Herzog Ludwig der Gebartete die Pfarrkirche zu U. L. Frau erbaut; Amberg, Straubing, Wasserburg und Neuötting hatten um jene Zeit ihre großartigen gothischen Pfarrkirchen erhalten; andere Dome, wie die altehrwürdige Münsterkirche zu Moosburg, der Dom in Freising, die Pfarrkirche St. Georg daselbst," wurden erweitert oder mit Anbauten versehen.
Rasch setzte der jugendliche Herzog Sigmund, — er zählte erst 29 Jahre seines Alters, — sein Vorhaben in's Werk. Vor Allem handelte es sich aber um die Mittel zu einem so großartigen Baue. Der Herzog selbst opferte hiezu aus feinem geringen Einkommen, — er war durch seine Freigebigkeit in Schulden gerathen, — so viel er vermochte; die Geldmittel der alten Frauenkirche wurden flüssig gemacht und mehrere jährliche Gilten verkauft, und endlich wurde auf die Begeisterung der Münchener durch Beihilfe von Geld und Arbeit gerechnet. Mit solchen geringen und unsichern Mitteln ging man damals an ein so riesenhaftes Werk! Nur standhafter Muth und festes Vertrauen auf Gott konnte ein solches Unternehmen beginnen und, trotz aller Schwierigkeiten fortführen lassen.
Als Baumeister wurde der wackere Maurermeister Jörg von Halsbach ernannt, der auch den Plan zur neuen Kirche sertigte. Letzterer ist leider verloren gegangen. Der Baumeister wird in den Rechnungen gewöhnlich einfach Jörg der Maurer genannt, in einem Dokumente von 1475 heißt er Maister Jörg von Polling, Maurer, auf seinem in der Kirche vorhandenen Leichensteine Maister Jörg vonHalsspach, und unter seinem
Bildnisse in der Kirche steht Jörg Gankoffer. Wahrscheinlich ist letzterer sein Familienname; ob er aber aus Polling oder aus Halspach stamme, bleibt dahingestellt.
Am 9. Februar 1468 Nachmittags zwischen zwei und drei Uhr wurde der Grundstein auf der Ostseite der Kirche feierlich gelegt, und von dem Bischofe Johann IV. von Freising, aus dem Patriziergeschlechte der Tulpeck von München, eingesegnet. Das Fragment der Chronik eines gleichzeitigen Mönches erzählt diese Grundsteinlegung also: „Unser Frauen-Sonntag nach Lichtmeß von Apollonia, den neunten Februar.
Am besagten Tag hat unser gnädiger Herr Herzog Sigmund von Bayern gelegt den ersten Stein des löblichen Baues unser lieben Frauen-Pfarrkirche zu München. Denselben Bau man Gott in Lob und Ehre und in die Ehre der lobsamen Jungfrauen Maria angefaugt hat von Neuem und eine größere Kirch von Mehrung des Volks wegen, den die alte Kirch zu eng war, zu vollbringen. Gott der Allmächtige verleihe und gebe gnädiglich die Gnade, daß der löblich und seliglich und ohn männiglich Schaden des Leibs vollbracht werde. Amen. Und waren der Zeit Pfarrer der benannten Pfarrkirchen Meister Ernst Püttrich und Kirchprobst Martin Katzinair vom innern Rath und Andre Sanftl vom äußern Rath. Und zu dem Stein zu legen wurde löblich geläutet, und kam dazu viel männig des Volks zwischen zwei und drei Uhr des Nachmittags; es kam dazu der Pfarrer mit feiner .Priesterschaft löblich mit dem Weihpronnen und Rauch, zu sprengen und zu rauchen den Grund und Gestein."
Und nun begann der Bau. „Meister Jörg, der Maurer
von gemeiner Stadt," erhielt am Sonntag Oeuli (20. März) 6 Schillinge 27 Pfenninge Haftgeld, und dann vierteljährig als Sold 2 Pfund Pfenninge; dazu kam aber noch der Taglohn, wenn er im Dienste der Stadt arbeitete. Dieser bestand nach Satz und Ordnung im Sommer in 28, im Winter in 24 Pfenningen; der Gesell erhielt 26 und 22 Pfenninge.
Vor Allem mußten, um den nöthigen Raum zu gewinnen, die entgegenstehenden Baulichkeiten abgetragen werden, daher zuerst die St. Michaels-Freithofkapelle entfernt und die darunter befindliche Krypta, wie schon oben erwähnt, zugemauert wurde. Wahrscheinlich begann sodann der Bau im Südosten der Kirche mit Ausführung des Grundes beim vordern Südportale; denn erst gegen den August hin kam man mit der Grundlegung auch gegen den Nordwesten der alten Kirche. Dortselbst stand der freistehende Thurm der alten Kirche, welcher auch entfernt werden mußte. Darüber berichtet uns derselbe Chronist folgendes:
„Des Thurms zu unser Frauen. Prima Augusti. Jtem den hat man untergraben und pelzt und an dem Tag niedergeworfen und ging durch schlechts auf einander nieder ohne Schaden des Pfarrhofs und ward ein groß Koth und Gestein übereinander und wurde dasselb durch die Menig des Volks, Mannen und Frauen, fast Edlen und Unedlen, Arm und Reich, Burgerin und ander Frauen und Jungfrauen, jung und alt, klein und groß, mit viel gieriger Müh und Arbeit andächtiglich Alles ob der Hofstatt geräumt und getragen, alles bei 10 Tagen."
Der Bau schritt nun mit möglichster Beschleunigung
rasch vorwärts. Dennoch hatte er mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gleich Anfangs ergab das Material viele Anstände, indem die Münchener Hafner, zu deren Gewerbe auch das Ziegelbrennen damals gehörte, die Ziegelsteine nur von geringer Güte lieferten. Es mußte daher erst auswärts die nöthige Erfahrung und Kenntnis; dieser Kunst erholt werden, und sah sich der Magistrat überdieß genöthiget, selbst einen Ziegelstadel zu errichten. Nunmehr wurden die Ziegelsteine mit aller Sorgfalt bereitet und dreimal gebrannt, wodurch sie jene Härte und Festigkeit erhielten, die wir noch jetzt an der Frauenkirche bewundern. Die Volksfage aber, daß der Mörtel mit Wein angemacht worden sei, ist lächerlich und entbehrt alles Grundes. Aber auch Meister Jörg scheint Mißtrauen in seine eigene Kraft und Kenntniß gesetzt zu haben und in schwere Sorgen ob der Ausführung des schwierigen Werkes gerathen zu sein. Da nahm er sich vor, „etliche Paue" zu beschauen. Der Magistrat billigte sein Vorhaben und unterstützte es bereitwillig; nicht nur der nöthige Zehrpfenning zur Reise wurde dem Meister Jörg, gereicht, sondern auch seinen Taglohn bezog er während dieser Zeit fort, da die Fahrt ja im Dienste und zum Nutzen der Stadt geschah; zudem wurde ihm, damit er als der Stadt München Werkmeister desto stattlicher auftreten könne, auch ein Stadtsöldner zum Begleiter mitgegeben. Er ging nun zuerst nach Augsburg, wo eben an der im Jahre 1467 begonnenen St. Ulrichskirche gebaut wurde, und von da nach Ulm, dessen Münsterbauhütte so lange berühmt war und in großem Rufe stand.
Als Meister Jörg im Frühjahre 1470 wieder nach
München zurückgekehrt war, wurde mit erneuerter Thätigkeit der Bau der Frauenkirche fortgesetzt, so daß im Herbste 1473 die Mauern schon eine Höhe von 115 Fuß erreicht hatten. Aber die Ausführung des Gewölbes brachte dem vorsichtigen und ängstlichen Meister neue Sorgen. Der Magistrat, die Schwierigkeit und Wichtigkeit des gewaltigen Baues wohl ermessend und die vorgebrachten Vorschläge des Meisters Jörg, das Urtheil anderer tüchtiger Meister zu erholen, würdigend, sendete Anfangs des Jahres 1474 Söldner und Boten aus, „um von Unser Frauen Pfarrkirchenbaues wegen etlich Meister zu werben. Auf die freundliche Einladung erschienen nun in München mehrere weitberühmte Baumeister, zuerst Moriz Ensinger, Münsterbaumeister in Ulm, in der Kunst des Gewölbebaues wohl erfahren, ferner Konrad Roritzer, der berühmte Dombaumeister von Regensburg, der auch schon früher dem Baue der St. Lorenzerkirche in Nürnberg vorgestanden, Friedrich, der Baumeister der herrlichen Unser Frauen-Pfarrkirche in Jngolstadt, und Meister Michel von Pfarrkirchen. Reiflich prüften sie den Plan unseres Meisters Jörg, und erwogen die eingewendeten Bedenken; endlich kamen sie überein in den strittigen Punkten und deß war unser Meister Jörg gar froh. Die Stadt bezahlte den fremden Meistern ihre Reise- und Zehrungskosten, und gab ihnen auch noch vor dem Scheiden ein fröhliches Gelag, das für sie und Meister Jörgs Gesellen ein Pfund und sechs Schilling Pfenninge kostete.
Aber nach einiger Zeit trat eine noch größere Schwierigkeit ein, nämlich die Herbeischaffung der nöthigen Geldmittel. Die Kirchenpröbste hatten viele jährliche Gilten
und Jmmobilien um eine für damalige Zeit nicht unbedeutende Summe von beiläufig 4500 Gulden verkauft. Diese Summe, sowie die von Privaten gebrachten Opfer waren zum Bau schon aufgewendet und die Quellen des Herzoges Sigmund waren auch schon beinahe versiegt; aller Geldvorrath war bereits erschöpft, ja beträchtliche Schulden waren schon gemacht und wie weit hatte der Bau noch bis zu seiner völligen Vollendung, welche Kosten nahm derselbe noch in Anspruch! Schon war der Bau einige Zeit lang eingestellt. In dieser Bedrängniß wendeten sich die Kirchenvorstände mit Bewilligung Herzogs Albrecht IV. mit einer Bitte nach Rom. Diese Bitte fand Gehör. Pabst Sixtus IV. erließ im Jahre 1479 ein Breve, in dem er allen Gläubigen, die zum Ausbaue der Kirche so viel Beisteuer in eine vom Kirchenvorstand und den Pröbsten aufgestellte Buchse entweder in klingendem Gelde oder an Geldeswerth legen würden, als Jeglicher durch acht Tage zum Lebensunterhalte brauche, nach Empfang der heil. Sakramente einen vollkommenen Ablaß in Form eines Jubiläums von Sonntag Lätare bis zum Sonntag Judiea ertheilte, und zwar sollte dieser Ablaß drei Jahre nach einander zu gewinnen sein. Eine alte Aufschreibung berichtet uns über dieses Jubiläum folgendes:
„Das sing sich an tausend vierhundert und in dem achtzigsten. Da brachten am Samstag vor Lätare zur Vesperzeit die Suffraganen von Augsburg und Briren im Geleit der Klöster und etlicher Priesterschaft die päbstliche Bulle und trugen sie unter dem Himmel mit löblicher Prozession bis auf die Mitte des Marktes; der entgegen ging der Pfarrer von Unser Frauen in löblicher
Prozession auch auf die Mitte des Marktes und empfing die Bulla knieend mit großer Löblichkeit und trugen sie unter Glockengeläute in den Dom.
„Allhie geschahen nun zum allermindesten alltag zwei oder drei Predigten. Setzten auch eine Truhe vor des Kaisers Altar in den Chor, darin legte man das Geld, Jeglicher so viel, als Einer eine Woche zu verzehren nothdürftig wäre. Die Truhen trug man alle Nacht in den innern Sagrar. Dazu wurden gesetzt zwei Priester und zwei vom äußern Rath."
Aus allen Gegenden, von nah und fern, eilte nun eine große Menschenmenge herbei, die Gnaden der Kirche zu empfangen. Bei zweihundertundsiebzig Beichtväter waren bestellt, die aßen alle im Pfarrhofe und wurde ihnen Atzung gegeben. Es hatte auch Jedermann Sicherheit und Geleite; dazu hatte man alle Nacht vierhundert Wappener und dabei den Pfäntermeister und den Hauptmann vom äußern Rath und zwei Junggesellen; bei Tag aber nur fünfzig. Unter jedem der vier Hauptthore lagen acht Mann, die drei Nebenthore wurden gesperrt. Zur Zählung der fremden Pilger waren unter den vier Thoren eigene Leute bestellt, die legten allemal für jeden hereingehenden Menschen eine Erbse in einen Hafen, „und zählt man sie zu Nacht eigentlich ab." Auch zündete man alle Pfannen an und ordnete von jedem Handwerk ihrer Zwei, die umgingen, den Leuten Herberg zu beschicken. Der Beichtenden war eine solche Menge, daß die Beichtbriefe immer wieder vergriffen waren, und Einer „oft um Brief gen Augsburg" laufen mußte, wo selbe „gemalt" wurden. Jm ersten Jahre 1480 kamen über 65,000 Menschen,
im zweiten 24,000, im dritten 34,700, so daß die Zahl aller in den drei Jahren herbeigeströmten Pilger auf 123,700 sich belief. Am stärksten war der Zudrang durch das Jsarthor, durch welches allein 75,490 Menschen eintraten. Der Ertrag des ersten Jahres in allen Münzsorten an Gold und Silber betrug 9,376 Gulden 72 Pfenninge rheinisch; der des zweiten Jahres nur 2,083 Gulden 4 Schillinge und 29 Pfenninge, der des dritten Jahres 3,772 Gulden 3 Schillinge 19 Pfenninge, so daß im Ganzen in diesen drei Jahren 15,232 Gulden 4 Schill, eingegangen waren.
Jm Jahre 1483 mußte abermals der Pfarrer Kaspar Eytlinger von Fürholzen im Auftrage nach Rom reisen, und erwirkte dort durch den päbstlichen Legaten auch dießmal die Gnaden des Himmels durch eine Beisteuer, wofür „die Kirche Unser lieben Frauen mit Lichtern, Büchern, Kelchen und Ornamenten versehen werden kann."
Der Bau war inzwischen soweit vorgerückt, daß man schon einzelne Kapellen und Altäre im Westtheile der Kirche einweihen und zum Gottesdienste verwenden konnte, so die neue Kapelle der heiligen Katharina, der Ottilien Altar, vor welchem bald darauf der Bischof Johann Tulpeck seine Grabstätte erhielt; ferner die Altäre des heil. Aegidius, Dionysius und andere. Die alte Frauenkirche, die jetzt entbehrlich wurde und dem Ausbau der neuen Kirche, namentlich der Säulen, im Wege stand, wurde nunmehr abgebrochen. Jrrig ist daher die Meinung des Dr. Nagler, wenn er annimmt, daß die neuen Messenstiftungen noch in die alte Kirche gemacht und daß Bischof Tulpeck und der blinde Organist Paumann
(nicht Paulmann) noch in der alten Kirche begraben worden seien.
Den Grabstein des Bischosts Johann Tulpeck, ein Meisterstück mittelalterlicher Kunst, haben wir oben in dem Abschnitte über die „alten Münchener Geschlechter" schon erwähnt; es sei uns vergönnt, hier auch jenes des Paumann kurz zu berühren. Dieser Paumann war berühmt als Orgel-, Violin-, Cither- und Flötenspieler, wie auch als Meister auf der Trompete; er ward ob seiner Kunst von mehreren Fürsten berufen, von Kaiser Friedrich III. mit einem golddurchwirkten Kleide, einem Schwerte mit goldenem Gehänge und einer goldenen Kette beschenkt und in den Adelstand erhoben. Vom kunstliebenden Herzog Albrecht IV. hatte er einen Jahrgehalt von 80" Gulden rheinisch. Seine Grabstätte befindet sich an der Südseite der Kirche links vom vorderen Portale, und auf dem Grabsteine, wo er Orgelfpielend, umgeben von einer Harfe, einer Laute und einer Flöte abgebildet ist, steht folgende Jnschrift: „Anno 1474 an St. Pauls Bekehrungs-Abend ist gestorben und hie begraben der kunstreichist aller Jnstrumenten und der Musika Meister Conrad Paumann, Ritter, bürtig von Nürnberg und blind geboren. Dem Gott Genad."
Jm Jahre 1477 hatte die Aufstellung des Dachstuhles begonnen. Hiezu wurde Heinrich der Zimmermeister von Straubing berufen, welcher schon am Allerheiligen Abend 1470 auf zehn Jahre in der Stadt Dienste getreten war. Als Sold erhielt er vierteljährig zwei Pfund Pfenninge, und zu Psingsten noch eigens zwei Pfund Pfenninge für Holz- und Schaitengeld, dann jährlich einen
Rock gleich andern Amtleuten, der Stadt und freie Herberge; für die Werktage, wenn er arbeitete, 28 Pfenninge und zudem sonntäglich 8 Pfenninge Badegeld, denn die Bäder waren im Mittelalter, wo man noch weniger mit Wasche und Kleidung wechselte, nothwendig und sehr im Gebrauche.
Im Jahre 1488 wurde der letzte Stein am Mauerwerke vom Meister der Kirche gesetzt, und wir sehen nun nach zwanzig Jahren den Riesenbau unserer Frauenkirche vollendet. Nach vollbrachter Arbeit schied der Meister noch im nämlichen Jahre aus der Welt und wurde im südlichen Glockenhause in eben der Kirche zur Erde bestattet, die sich als das erhabendste und sprechendste Monument über seinem Grabe erhebt. Seine Grabschrift lautet:
,,Anno domini 1488 am Montag nach St. Michelstag starb der Meister Jörg von Halspach, Maurer dieß Gotzhaus unser Frauen, der mit der Hilf Gottes und seiner Hand den ersten, den mittlern und letzten Stein hat vollführt an diesem Bau. Der leit hie begraben und Margret sein ehliche Hausfrau. Den Gott genädig sei."
Sein Bildniß, das an einem Pfeiler vor dem südlichen Glockenhause sammt dem des Zimmermeisters hängt, zeigt einen altersgrauen Mann mit milden gutmüthigen Zügen.
Die beiden kolossalen Thürme, obwohl zu bedeutender Höhe emporgestiegen, waren aber noch unvollendet. Wahrscheinlich verhinderte nach dem Tode des Meisters der völlige Mangel an Baumitteln den Ausbau derselben, und zudem erschien es zunächst dringender, den inneren Ausbau und die Ausschmückung der Kirche vorzunehmen. Die beiden Thürme wurden daher einstweilen nur mit einem
Nothdache von Holz gedeckt, wie aus einer vorhandenen Abbildung der Stadt aus jener Zeit zu sehen ist. Erst um die Jahre 1512—1514 schritt man wieder an den Ausbau der Thürme und man sieht daher auch bei der Uhr die Jahrzahl 1514 angebracht. Aber es war in dieser kurzen Zeit bereits eine ganz andere Geschmacksrichtung in der Kunst angebrochen, die Gothik war verschwunden und an ihre Stelle trat die Renaissanee. Die beiden Thürme erhielten daher nun die runden Kuppeln, damals „welsche Hauben" genannt, welche sie noch tragen.' Dagegen aber wurde das oben besprochene wunderherrliche Tafelwerk des Meisters Gabriel Angler in die neue Kirche übergetragen und auf den Hochaltar gesetzt.
Die vollendete Ausschmückung der Kirche mit Altären, Gemälden, Glasfenstern, Glocken und Paramenten zog sich aber wohl noch mehrere Jahre hin, so daß die Einweihung der Kirche durch den Bischof von Freising erst am 14. April 1494 erfolgen konnte. Die große Salveglocke war aber schon im Jahre 1493 vom hohen Thurme erklungen. Diese Glocke, 125 Zentner schwer und sieben Schuh drei Zoll im Durchmesser haltend, trägt folgende Umschrift.
„Susanna heiß ich, in Jesus und Lukas, Markus, Matthäus und Johannes Namen goß man mich. Der durchleuchtig hochgeborne Fürst und Herr Albrecht Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Ober- und Niederbayern war Stifter mein. Von Regensburg her brachte man mich. Die bösen Wetter vertreib ich, den Tod erwehre ich. Hanns Ernst goß mich, als man zählt von Gottes
Gepurt tausend vierhundert und drei dem neunzigsten Jahr, tetragrammaton."
Ein Jahrhundert war unsere Frauenkirche gestanden, als mit Anfang des siebzehnten Jahrhundertes eine allgemeine Sucht um sich griff, die alten gothischen Dome im Sinne der Renaissanee zu „verschönern", und ihre ganze frühere Herrlichkeit zu zerstören. So erging es in München nicht nur mit der alten gothischen von Ludwig dem Strengen im Jahre 1291 erbauten Augustinerkirche, der alten gothischen St. Peters-Pfarrkirche und der in den Jahren 1480—1485 erbauten Kreuzkirche; auch unsere Frauenkirche erlitt gleiche Unbilden. Zuerst geschah im Jahre 1601 die erste Ausweißung der ganzen Kirche, welche vom 15. April bis 16. Oktober dauerte, wodurch alle Freskogemälde übertüncht wurden. Jm Jahre 1604 wurde das alte gothische Kirchengestühl mit seinen lieblichen Ornamenten fortgeschafft und durch ein neues unförmliches ersetzt. Jm Jahre 1605 wurde in der Mitte der Kirche ein kolossaler Rundbogen, gegossen in einem Tage aus Gyps, im römischen Style errichtet, um angeblich der ungeheuer langen Kirche die Einförmigkeit zu benehmen! Auf diesen Bogen wurde eine hölzerne Kuppel mit einer ein Crucifix enthaltenden Laterne aufgesetzt, und der Bogen selbst ausgeschmückt mit mittelmäßigen Fresken von Peter Candid. — Jm Jahre 1609 wurden sämmtliche alte gothischen Altäre herausgerissen und zertrümmert, und dafür ganz neue höchst geschmacklose und zopfige Altäre im Style der Renaissanee errichtet. Dieses traurige Schicksal traf leider auch das
herrliche Tafelwerk des Gabriel Angler, welches wahrscheinlich gänzlich zertrümmert, spurlos verschwand. Statt dessen ward ein prunkender Hochaltar, 90½ Fuß hoch und 30 breit, nach dem Entwurfe des Hofmalers Peter Candid erbaut, mit reicher Vergoldung, zwei den Aufsatz tragenden Säulen korinthischer Ordnung, und dem von Peter Candid selbst gemalten großen Bilde der Himmelfahrt Mariä. Sogar das einfache Grabmal des Kaisers Ludwig sagte dem modernen Geschmacke nicht mehr zu; im Jahre 1622 wurde über dem alten Grabstein ein schwerfälliger, plumper, im römischen Renaissaneestyl gehaltener Bau von schwarzem Marmor geführt, geschmückt mit halbnackten allegorischen Figuren und heidnischen Emblemen, der die schöne gothische Kirche im höchsten Grade verunstaltet. Hiemit schloß aber glücklicherweise die begonnene „Verschönerung" der Frauenkirche. Wahrscheinlich verhinderte nur die große Höhe der Kirche, daß nicht, wie solches in andern Kirchen geschah, die Gewölberippen ausgeschlagen, die Spitzbögen des Gewölbes und der Fenster zu Rundbögen ausgemauert und mit Stukkatorarbeit von Gypsschnörkeln ausgestattet wurden!
In diesem Zustande blieb die Frauenkirche bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhundertes, wo ein neuer Verschönerungsschwindel hereinbrach. Jm Jahre 1772 mußten die alten würdigen Kirchthüren den noch gegenwärtig prangenden ganz geschmacklosen Zopfthüren weichen, die der Münchener Bildhauer Jgnaz Günther um hohen Preis verfertigte; die Kirche wurde wiederholt ausgeweißt, im Jahre 1774 wurden die herrlichen Holzschnitzereien des Chorgestühles mit Oelfarbe überschmiert. Ja die alten
Fenster konnten nicht mehr genügen, weil sie wegen der vielen Glasgemälde und der Menge Blei zu große Finsterniß in der Kirche verursachten. Ein Theil der Glasmalereien wurde daher entfernt und in Kisten auf das Langhaus gebracht, wo sie größtentheils zerschlagen wurden, die übrigen aber wurden aus den Fenstern herausgenommen, geputzt und ziemlich sinnlos wieder zusammengesetzt. Endlich im Jahre 1777 wurde die alte gothische Kanzel, die am längsten noch allen Stürmen des Zeitgeistes und der Barbarei getrotzt hatte, abgebrochen und durch einen von dem Hofbildhauer Roman Boos geschnitzten plumpen Kasten ersetzt.
Die gründliche Verballhornung der Kirche war somit vollendet.
Aus der Mitte des vorigen Jahrhundertes stammt eine sonderbare und räthselhaft klingende Nachricht über den Fund einer gläsernen Lampe in der Frauenkirche. Diese seltsamen Umstände finden sich in „Dissertation sur une lampe antiquw, trouvée à Munich en -#annèe 1753, écrite par Mr. le Prince de St. Sévère. A Naples, 1756. 4.“ Der Verfasser erzählt folgendes:
„Es war im Jahre 1753, als die Zeitungen die Nachricht mittheilten, es sei in München, als man in der Frauenkirche ein unterirdisches Gewölbe erweiterte, in einem Pfeiler eine noch brennende Lampe eingemauert gefunden worden. Da mir der Fund in Bezug auf mein Lieblingsfach, die Chemie, sehr interessant war, so suchte ich die genauesten Erkundigungen einzuziehen und war so glücklich, durch Herrn Grafen von Wackerbart ein in Holz sehr genau verfertigtes Modell jener Lampe, sowie einen
Theil des in demselben vorgefundenen Spiritus zu erhalten.
„Die fragliche Lampe bildet eine sogenannte Karaffe, ist aus grünem Glase, 6 Zoll 8 Linien Pariser Maßes hoch, oben 2 Zoll 2 Linien und unten 2 Zoll 9 Linien breit. Als man sie fand, war sie theilweise mit einer trüben fleischbrühähnlichen Mäßigkeit angefüllt. Der Docht war, wie die Finder aussagten, die ihn sogleich wegwarfen, von einer unbekannten graulichen Masse. Der Bodensatz rührte von dem verbrannten Phosphor her. Die Oeffnung des Glases war mit einem gelben Wachse, das die Dicke einer Linie hatte, hermetisch verschlossen."
Ohne der Wahrheitsliebe des Herrn Prinzen von St. Sévère im Geringsten nahe treten zu wollen, scheint offenbar die ganze Nachricht auf einem Irrthum oder einer Täuschung zu beruhen. Es ist eine absolute Unmöglichkeit, daß ein Licht, eingeschlossen in eine hermetisch verschlossene Lampe, also dem Zutritte der zum Brennen unumgänglich nothwendigen atmosphärischen Luft gänzlich entzogen, auch nur längere Zeit, geschweige denn mehrere Jahrhunderte lang brennen könne. Wahrscheinlich fiel beim Eröffnen der Mauerhöhlung ein Strahl entweder des Tageslichtes oder der angezündeten Lichter auf die gläserne Lampe und verursachte dadurch die optische Täuschung, als brenne in der Lampe ein Licht, oder es waren an diesem Orte verwesende Körper, die nun beim Zutritte der Luft einen phosphoreseirenden Schein von sich gaben.
Jedenfalls aber fehlt zur Würdigung dieser seltsamen Sache leider die genaue und chemische Untersuchung des
Dochtes und der in dem Glase noch vorhanden gewesenen trüben Flüssigkeit. Wir haben hier die Nachricht gegeben wie sie vorliegt, und lassen bei dem Mangel aller weiteren Nachrichten darüber die Sache dahin gestellt.
Wir wenden uns nach dieser Abschweifung wieder zur Kirche.
Der neueren Zeit erst war das wiedererwachende Verständniß der altdeutschen Art und Kunst vorbehalten. Damit stellte sich auch bald das Bedürfniß heraus, unsere herrlichen mittelalterlichen Dome vom Unrathe und den Unbilden der Zeit zu reinigen und sie im Sinne und Geiste der Zeit, die sie geschaffen, wieder herzustellen, und sie, wo unausgebaut, zu vollenden. In Folge dessen sahen wir in unserem deutschen Vaterlande die Restauration der romanischen Dome von Bamberg und Speier, der gothischen Münster von Regensburg, Ulm und mehrerer kleineren Kirchen, endlich den wieder aufgenommenen Ausbau der Dome zu Köln und Regensburg. Auch unsere Frauenkirche zu München konnte nicht verwaiset zurückbleiben und sie war einer Restauration auch würdig. Denn entbehrt sie auch jener Mannigfaltigkeit der Verhältnisse, der Leichtigkeit des Aufbaues, des Reichthumes und der Zierlichkeit der Ornamentik, welche die Bauwerke der früheren Gothik auszeichnen, so besitzt sie doch eine machtig ergreifende Schönheit in ihrer eigenthümlichen Erhabenheit, Einfachheit, Majestät und Kraft.
Diese Erneuerung geschah auch.
Im Jahre 1858 begann, durch freiwillige Beiträge ermöglichet, die Restauration. Es wurde der über den Kreuzaltar gespannte gypserne römische Rundbogen
abgebrochen und wurden sammtliche Altäre, der plumpe Kanzelkasten und überhaupt alle stylfremden Zuthaten späterer Zeit entfernt. Statt deren erheben sich jetzt neue prachtvolle gothische Altäre und Kanzel im Sinne und Geiste der alten Zeit, und die alten kunstreichen Chorstühle sind in ihrer früheren Schönheit wieder hergestellt. Die Restauration ist zwar gegenwärtig (1867) noch nicht vollendet; aber es prangt unser Dom schon jetzt wieder als herrlicher Zeuge der Kunst und Kraft unserer Vorfahren in seiner gewaltigen Würde. Möge das Werk bald zu seinem Ziele gedeihen!
Eine Aufzählung und Beschreibung der neuen Kunstwerke liegt aber nicht im Zwecke dieser Blätter.
Mayer - Münchner Stadtbuch (1868)
Der Teufel in der Frauenkirche
 Als die Kirche zu unser lieben Frau in München erbaut wurde, ärgerte sich der böse Feind, der dadurch sein Reich der Hölle bedroht sah, ganz teufelmäßig darüber. Mit all seiner bösen List konnte er den Bau nicht hintertreiben; nachdem aber endlich die Kirche vollendet dastand, beschloß er sie mit Wind und Sturm zu verderben. Als nun der Teufel in dieser Absicht durch das Hinterthor in die Kirche eintrat und unter dem Musikchore stand, sah er zu seiner großen Verwunderung wegen der vorstehenden gewaltigen Säulen kein einziges Fenster. Darüber lachte der dumme Teufel ganz vergnügt, denn er hielt die Kirche für einen ungeschickten und unnützen Bau, der ihm nicht viel schaden könne, weil es ja zu dunkel in derselben sei. Er ging daher wieder beruhigt sort, aber an der Stelle, wo er stand, ist sein Fuß noch sichtbar schwarz im Steine eingeprägt.
Als die Kirche zu unser lieben Frau in München erbaut wurde, ärgerte sich der böse Feind, der dadurch sein Reich der Hölle bedroht sah, ganz teufelmäßig darüber. Mit all seiner bösen List konnte er den Bau nicht hintertreiben; nachdem aber endlich die Kirche vollendet dastand, beschloß er sie mit Wind und Sturm zu verderben. Als nun der Teufel in dieser Absicht durch das Hinterthor in die Kirche eintrat und unter dem Musikchore stand, sah er zu seiner großen Verwunderung wegen der vorstehenden gewaltigen Säulen kein einziges Fenster. Darüber lachte der dumme Teufel ganz vergnügt, denn er hielt die Kirche für einen ungeschickten und unnützen Bau, der ihm nicht viel schaden könne, weil es ja zu dunkel in derselben sei. Er ging daher wieder beruhigt sort, aber an der Stelle, wo er stand, ist sein Fuß noch sichtbar schwarz im Steine eingeprägt.
Als aber der Teufel nachher sah, daß dennoch die Leute fleißig in die neuerbaute Kirche zur Andacht und zum Gottesdienste gingen, er selbst aber, weil sie nun schon geweiht war, nicht mehr in dieselbe eintreten konnte, stürmte er aussen um die Kirche herum, um die Leute vom Kirchgange abzuhalten. Daher kommt es, daß der Wind um die Frauenkirche oft so heftig geht, daß er Manchen das Frauenbergl hinabtreibt, ehe er stch's versieht, oder den Leuten den Hut vom Kopfe nimmt.
Mayer - Münchner Stadtbuch (1868)