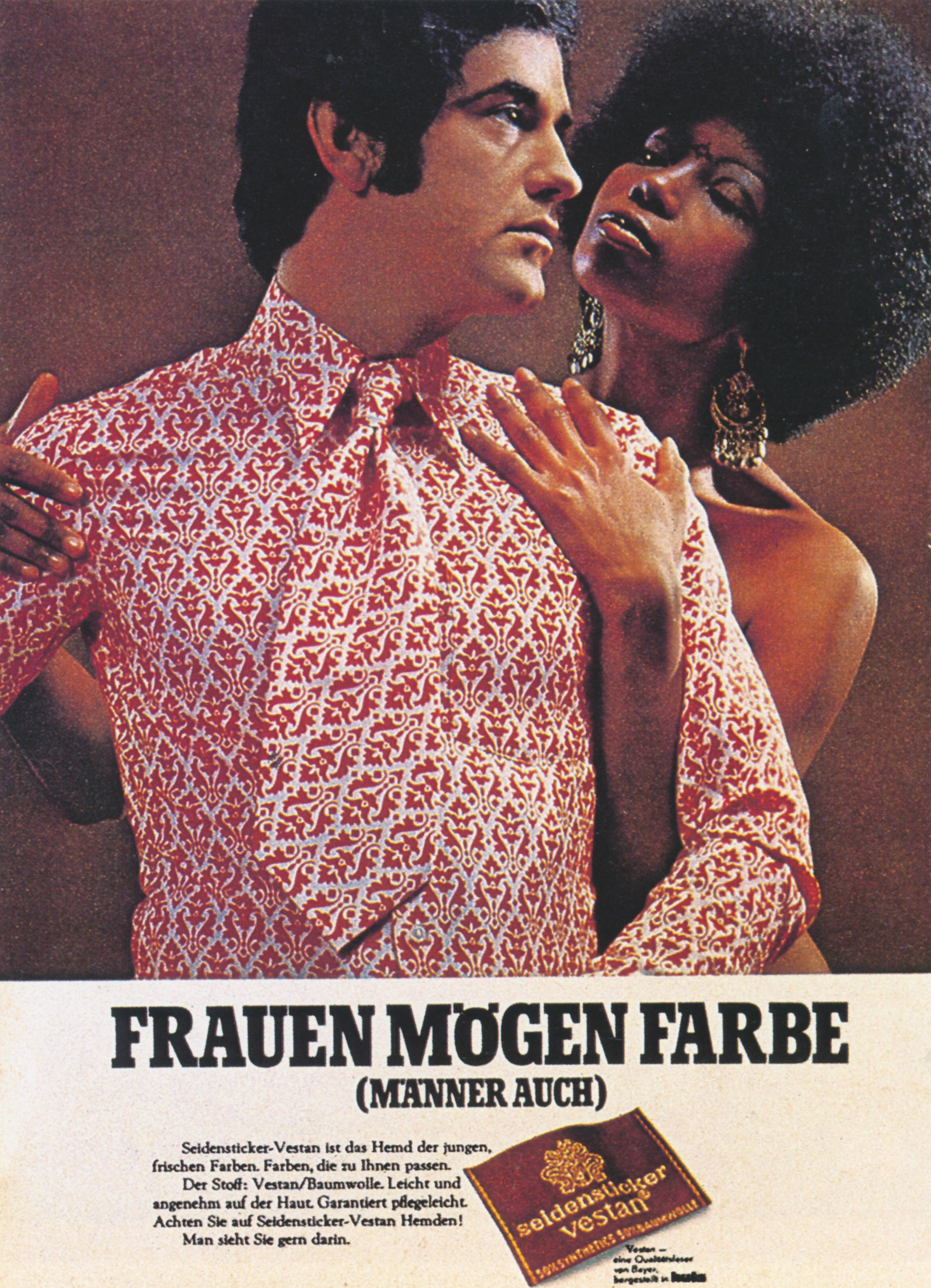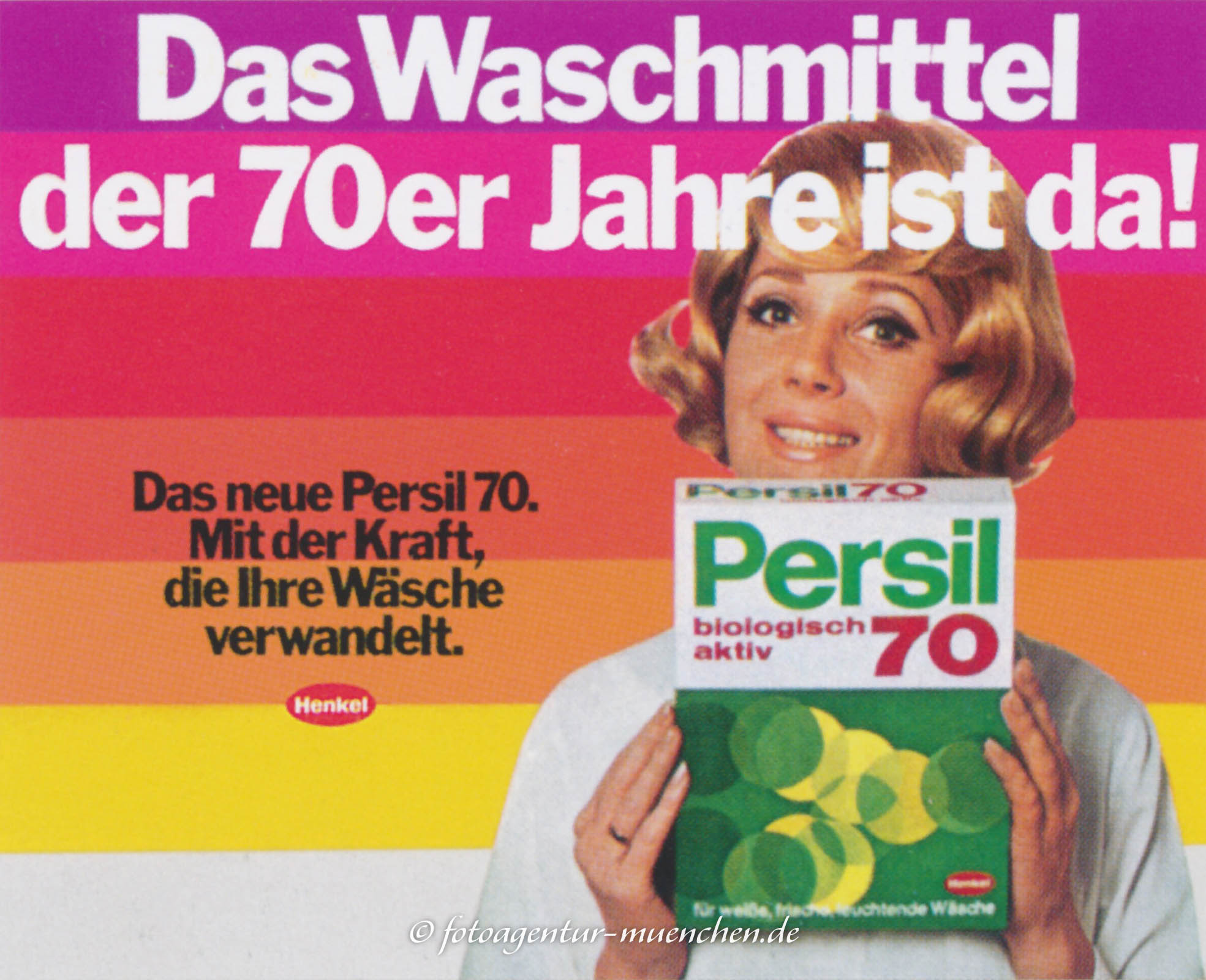Die weltweit erste LED-Armbanduhr, “Pulsar”, wurde von der Hamilton Watch Company in Zusammenarbeit mit Electro/Data Inc. entwickelt. Sie wurde 1972 auf den Markt gebracht. Pulsar kostete damals etwa 2.100 USD (heute über 10.000 USD inflationsbereinigt) und galt als Luxusprodukt.